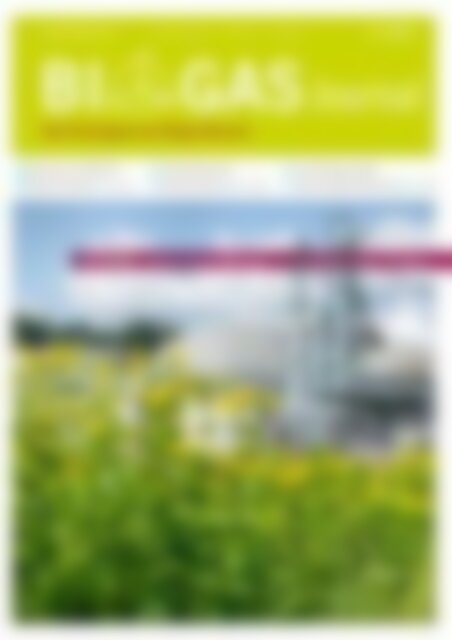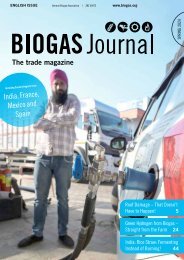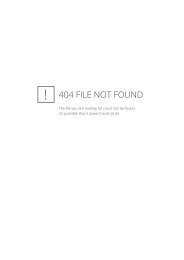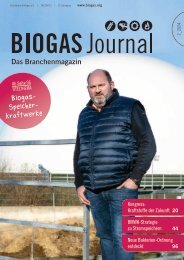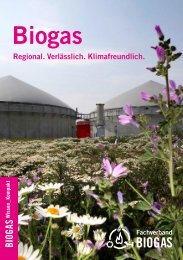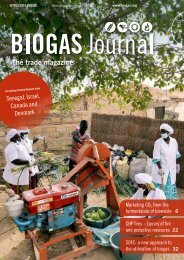2_2018 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 21. Jahrgang<br />
2_<strong>2018</strong><br />
Bi<br />
gaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Interview mit Robert<br />
Habeck (Grüne) S. 22<br />
Entwicklung der<br />
Biomassepreise S. 58<br />
Forschungsprojekt<br />
Gärproduktaufbereitung S. 66<br />
Topthemen: Emissionsminderung +++ Durchwachsene Silphie<br />
Adressfeld
Inhalt<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Alles aus einer Hand - Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Labor<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
D-17166 Teterow<br />
2<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Editorial<br />
Fortschritt durch Technik –<br />
umweltfreundliche Bio-Batterie!<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
das Ringen um den Koalitionsvertrag war langwierig und<br />
zäh. Die Biogasbranche als Teil der Familie der Erneuerbaren<br />
Energien hätte sich durchaus ambitioniertere<br />
und mutigere Ziele bei der Energiewende und beim<br />
Klimaschutz gewünscht. Schlussendlich lassen sich<br />
dennoch zahlreiche positive Anknüpfungspunkte für die<br />
kommenden Jahre finden. Ein Ausbau der Erneuerbaren<br />
Energien im Strombereich auf 65 Prozent im Jahr 2030<br />
kann nur gelingen, wenn die Bioenergie entsprechend<br />
Berücksichtigung findet, der Bestand erhalten und ein<br />
moderater Ausbau ermöglicht wird.<br />
So ist nicht ohne Grund im Koalitionsvertrag zu lesen:<br />
„Die Bioenergie trägt zur Erreichung der Klimaziele im<br />
Energie- und Verkehrssektor bei.“ Gerade im Verkehrssektor<br />
eröffnen sich Chancen für Biogas, wenn Deutschland<br />
die Vorgaben auf EU-Ebene zügig in nationales<br />
Recht umsetzt. Nicht nur wegen der hohen Treibhausgaseinsparung<br />
wird dort Biomethan als fortschrittlicher<br />
Biokraftstoff gelistet. Die im Koalitionsvertrag verankerte<br />
Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote<br />
kann hier der Schritt in die richtige Richtung sein.<br />
Biogas vereint viele positive Aspekte auf sich. Neben<br />
dem Klimaschutz sieht der Koalitionsvertrag insbesondere<br />
die Chance, durch Biogas die Artenvielfalt in der<br />
Feldflur zu erhöhen. Der Einsatz von Blühpflanzen soll<br />
ausgeweitet werden. Dies kann gelingen, wenn die Rahmenbedingungen<br />
für den Landwirt entsprechend gestaltet<br />
werden. Nur was wirtschaftlich ist, wird langfristig<br />
umgesetzt werden können.<br />
Ein Schwerpunkt in diesem Heft ist vor diesem Hintergrund<br />
sehr gut gewählt. In vier Artikeln werden Ergebnisse<br />
aus der Forschung sowie Praxiserfahrungen zum<br />
Anbau der Durchwachsenen Silphie vorgestellt. Das ist<br />
nur der Auftakt! Wir wollen in diesem Jahr verstärkt die<br />
Landwirte unterstützen, neue Wege bei der Fruchtfolge<br />
zu gehen. Unter anderem soll die bekannte Homepage<br />
www.farbe-ins-feld.de komplett überarbeitet werden. Den<br />
Landwirten sollen wertvolle Anbauhinweise sowie Sonderkonditionen,<br />
beispielsweise beim Saatgutkauf, zur Verfügung<br />
gestellt werden. Gleichzeitig sollen für die breite<br />
Öffentlichkeit die vielfältigen Leistungen (Humusaufbau,<br />
Grundwasserschutz etc.) veranschaulicht werden.<br />
Biogas muss sich weiter positiv entwickeln. Das gilt<br />
nicht nur für den Anbau, sondern auch für die Nutzung<br />
der erzeugten Energie. Wir müssen noch stärker<br />
demonstrieren, welche Bedeutung wir als verlässlicher<br />
und flexibler Energieträger bei der Energiewende haben.<br />
Wir sind die „Bio-Batterie“, die Stromnetze stabil hält,<br />
Wärmeversorgung garantiert und auch im Verkehrssektor<br />
eine umweltfreundliche Bereicherung ist.<br />
CNG-Fahrzeuge auf der Basis von Biomethan sind heute<br />
schon eine perfekte Ergänzung zur E-Mobilität. Erfreulich<br />
ist, dass dies nun etliche Autohersteller erkannt<br />
haben – wohl auch wegen des Drucks der Abgasaffäre.<br />
„Vorsprung durch Technik“ lautet der Werbeslogan von<br />
einem der Hersteller, die auf CNG-Fahrzeuge setzen.<br />
„Fortschritt durch Technik“ könnte der Slogan für die<br />
Biogasbranche in den nächsten Jahren lauten. Die Branche<br />
entwickelt sich und ihre Stärken weiter, sodass die<br />
Politik nicht darauf verzichten kann, da auch die Öffentlichkeit<br />
von Biogas überzeugt ist.<br />
Deswegen ist es wichtig, bei Schadstoffemissionen<br />
nicht negativ aufzufallen. Wozu das führen kann, hat die<br />
Automobilbranche leidvoll erfahren müssen. Biogas ist<br />
mittlerweile ein bedeutender Teil der Energiewirtschaft<br />
geworden. Entsprechende Bedeutung haben die entstehenden<br />
Emissionen. Das Titelthema dieser Ausgabe<br />
greift diesen Aspekt auf und zeigt technische Möglichkeiten,<br />
neue Abgasgrenzwerte einzuhalten. Ganz nach<br />
dem Motto „Fortschritt durch Technik“.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dr. Stefan Rauh,<br />
Geschäftsführer des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
24<br />
titelFoto: Energiepark Hahnennest i Fotos: Interkat, Michael Dickeduisberg, Fachverband Biogas e.V.<br />
Editorial<br />
3 Fortschritt durch Technik –<br />
umweltfreundliche Bio-Batterie!<br />
Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher<br />
10 Termine<br />
12 Biogas-Kids<br />
14 Biomethan – ein Kraftstoff<br />
mit Zukunft<br />
Von Thomas Gaul<br />
POLITIK<br />
18 „EU-Ministerrat hat die Bremserrolle<br />
übernommen“<br />
Von Bernward Janzing<br />
22 Interview<br />
„Mit dem Pilotprojekt Power-to-Feed<br />
wollen wir die Fruchtfolge erweitern“<br />
Interviewer: Bernward Janzing<br />
Titelthema<br />
Emissionsminderung<br />
24 Luftqualität im Fokus<br />
Von Alexander Fiedler<br />
28 Abgasreinigung bleibt ein<br />
heißes Thema<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
34 Hersteller arbeiten an<br />
sauberen BHKW<br />
Von Thomas Gaul<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen 2G Energietechnik,<br />
agrikomp und greentec.<br />
4
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Inhalt<br />
TOP Thema<br />
40 96<br />
Durchwachsene<br />
Silphie<br />
40 Fast so gut wie Mais<br />
Von Ulrich Deuter und<br />
Dr. Maendy Fritz<br />
46 Lebensraum und Energiepflanze<br />
Von Michael Dickeduisberg<br />
50 Lange gesucht – erst die<br />
Silphie überzeugte<br />
Von Bernward Janzing<br />
53 Pflanze, die ökologisch punktet<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
PRAXIS<br />
58 Biomassepreisvergleich<br />
Trotz hoher Erträge leicht<br />
steigende Preise<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
62 Innovationen zur Ertragssteigerung<br />
Von Dipl.-Geograph Martin Frey<br />
WISSENSCHAFT<br />
66 Wasseraufbereitung und Nährstoffgewinnung<br />
aus Gärprodukten<br />
Von M.Sc. Tobias Gienau und<br />
Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger<br />
72 Stromlangzeitspeicher mit<br />
Wasserstofftechnologie<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
INTERNATIONAL<br />
76 Interview<br />
Digitalisierung verstetigt<br />
Biogasproduktion<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
80 Komplexität des Themas Biogas<br />
wächst weiter<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
84 Aus den Regionalgruppen<br />
88 Aus den Regionalbüros<br />
92 Netzwerk Nachwachsende<br />
Rohstoffe startet in Sachsen<br />
Von Erik Ferchau und Jürgen Wellerdt<br />
94 Koalitionsvertrag<br />
Bioenergie soll helfen, Klimaziele<br />
zu erreichen<br />
Von Dr. Peter Röttgen (BEE)<br />
96 Wie der Hackl Schorsch zum<br />
Fachverband kam<br />
Von Dipl.-Ing. agr. Andrea Horbelt<br />
RECHT<br />
97 Clearingstelle EEG I KWKG<br />
Votum zu Satelliten-BHKW veröffentlicht<br />
Von Isabella Baera<br />
98 Impressum<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Bundesländervergleich<br />
Erneuerbare Energien: Baden-Württemberg neuer<br />
Spitzenreiter vor Mecklenburg-Vorpommern und Bayern<br />
Berlin/Stuttgart – Baden-Württemberg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Bayern sind im Bereich der Erneuerbaren<br />
Energien die führenden<br />
Bundesländer. Das ist das Ergebnis<br />
des Bundesländervergleichs, den<br />
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung<br />
(DIW Berlin) und<br />
das Zentrum für Sonnenenergieund<br />
Wasserstoff-Forschung Baden-<br />
Württemberg (ZSW) im Auftrag von<br />
und in Kooperation mit der Agentur<br />
für Erneuerbare Energien (AEE)<br />
zum fünften Mal erstellt haben.<br />
Die Analyse bewertet auf Basis von<br />
59 Indikatoren detailliert die politischen<br />
Anstrengungen und Erfolge<br />
der Länder bei der Nutzung von<br />
Erneuerbaren Energien sowie beim<br />
damit verbundenen wirtschaftlichtechnischen<br />
Wandel. Am Ende der<br />
Rangliste stehen Hessen, Berlin und<br />
das Saarland. Die Bundesländer sind<br />
wichtige Akteure der Energiewende.<br />
Sie setzen nicht nur die Energieziele<br />
von Bund und EU mit dem konkreten<br />
Ausbau vor Ort um, sondern sie<br />
können durch eigene Ziele, Schwerpunkte<br />
und Programme sowie die<br />
Ausgestaltung von Rahmenbedingungen<br />
den Fortgang der Energiewende<br />
entscheidend voranbringen<br />
oder auch bremsen.<br />
„Mit dem inzwischen zum fünften<br />
Mal durchgeführten Bundesländervergleich<br />
Erneuerbare Energien<br />
können wir die Energiewende-<br />
Entwicklungen auf der föderalen<br />
Ebene vergleichbar machen und so<br />
bewerten, wer besonders erfolgreich agiert<br />
und wo es noch Optimierungspotenzial<br />
gibt”, erläutert Prof. Dr. Claudia Kemfert,<br />
Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt<br />
beim DIW Berlin. „Die Studie zeigt<br />
bei vielen Indikatoren neue Höchststände,<br />
etwa hinsichtlich der Anteile an Erneuerbaren<br />
Energien in den Bundesländern, und<br />
einen fortschreitenden Ausbau bei den<br />
verschiedenen Technologien. Generell sind<br />
die meisten Länder auf dem richtigen Weg,<br />
auch wenn es Unterschiede beim Entwicklungstempo<br />
gibt“, so Kemfert weiter. Die<br />
meisten Punkte im aktuellen Gesamtranking<br />
erhält Baden-Württemberg, das damit<br />
erstmals die Spitzenposition erreicht. Den<br />
zweiten Platz kann Mecklenburg-Vorpommern<br />
für sich verbuchen. Beide Länder verbessern<br />
sich damit um eine Position gegenüber<br />
dem letzten Ranking von 2014. Der<br />
letztmalige Spitzenreiter Bayern erreicht<br />
die dritthöchste Gesamtpunktzahl.<br />
Prof. Dr. Frithjof Staiß, Geschäftsführendes<br />
Vorstandsmitglied des ZSW, kommentiert<br />
die Ergebnisse: „Die Vielfalt an Indikatoren<br />
erlaubt eine detaillierte Einordnung<br />
der Stärken und Schwächen jedes Bundeslandes.<br />
Allein die drei Spitzenreiter<br />
unterscheiden sich hier deutlich: Baden-<br />
Württemberg punktet vor allem mit seinem<br />
politischen Input zur Nutzung Erneuerbarer<br />
Energien, Mecklenburg-Vorpommern ist<br />
im Bereich Strukturwandel stark und Bayern<br />
weist weiterhin hohe Ausbaustände bei<br />
den Erneuerbaren auf. Allerdings ist weder<br />
beim Schlusslicht Saarland alles schlecht,<br />
6
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
noch ist Baden-Württemberg in allen Bereichen<br />
Vorreiter und könnte nun die Hände<br />
in den Schoß legen“, so Staiß weiter. „Dort<br />
gibt es beispielsweise Verbesserungspotenzial<br />
bei der wirtschaftlichen Bedeutung der<br />
Erneuerbaren Energien. In diesem Bereich<br />
kann hingegen das letztplatzierte Saarland<br />
zumindest bei der Entwicklung der Umsätze<br />
mit Erneuerbaren-Technologien punkten.“<br />
Während bei den meisten Einzelindikatoren<br />
für alle Länder Fortschritte zu verzeichnen<br />
sind, gibt es an verschiedenen Stellen<br />
in einzelnen Ländern aber auch Rückwärtsentwicklungen,<br />
etwa beim Erneuerbaren-Anteil<br />
an der Fernwärme oder bei der<br />
Entwicklung energiebedingter CO 2<br />
-Emissionen.<br />
Philipp Vohrer, AEE-Geschäftsführer,<br />
kommentiert: „Auch dort, wo erfreuliche<br />
Werte konstatiert werden können, ist die<br />
Systemtransformation noch lange nicht geschafft.<br />
Die Studie zeigt deutlich auf, wo<br />
es zu Fehlentwicklungen kommt und wo<br />
noch dringender Handlungsbedarf besteht.<br />
Es gibt überall noch Verbesserungspotenzial<br />
– hier kann man sich jeweils bei den<br />
Ländern, die in den einzelnen Punkten besser<br />
abgeschnitten haben, noch etwas abschauen.<br />
Für die erfolgreiche Realisierung<br />
der Energiewende und insbesondere das<br />
Erreichen der Klimaziele braucht es weitere<br />
Anstrengungen, auch und gerade in den<br />
Bundesländern.”<br />
Bürgerenergie bleibt Schlüssel für<br />
erfolgreiche Energiewende<br />
Berlin – Für eine erfolgreiche Energiewende in<br />
Deutschland spielen die Bürgerinnen und Bürger<br />
als Energieproduzenten eine Schlüsselrolle. Wie<br />
aus einer neuen Studie des Instituts trend:research<br />
hervorgeht, sind Privatpersonen weiterhin die mit<br />
Abstand wichtigsten Investoren für Erneuerbare-<br />
Energien-Anlagen. Ihnen gehört in Deutschland<br />
knapp ein Drittel der installierten Leistung zur<br />
regenerativen Stromproduktion. Damit liegen sie<br />
weit vor Energieversorgern, Projektierern, Gewerbebetrieben,<br />
Fonds und Banken. „Bürgerengagement<br />
bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor für den weiteren<br />
erfolgreichen Ausbau der Erneuerbaren Energien“,<br />
betont der Geschäftsführer der Agentur für<br />
Erneuerbare Energien (AEE) Philipp Vohrer.<br />
Sowohl Energie-Genossenschaften als auch Bürgerwindparks,<br />
die als Verbund gemeinsam Erneuerbare-Energien-Projekte<br />
verwirklichen, werden<br />
in der trend:research-Studie ebenso zur Kategorie<br />
der Privatleute gezählt wie Einzelpersonen, die zum<br />
Beispiel in eine Photovoltaikanlage investieren.<br />
Zusammen bringen es die Privatleute und Landwirte<br />
auf einen Anteil von 42 Prozent am Eigentum<br />
Erneuerbarer-Energien-Anlagen in Deutschland.<br />
Ihr Anteil ist damit gegenüber der Vorgänger-Erhebung,<br />
die das Jahr 2012 erfasste, insgesamt um<br />
vier Prozentpunkte gesunken. Zur Entwicklung der<br />
vergangenen Jahre gehört auch, dass sich der Anteil<br />
größerer Unternehmen an der installierten Leistung<br />
Erneuerbarer Energien erhöht hat. „Die große Vielfalt<br />
der Akteure ist zu begrüßen. Dennoch darf nicht<br />
vergessen werden: Die Basis für Akzeptanz und Engagement<br />
beim Ausbau Erneuerbarer Energien steht<br />
und fällt mit Beteiligungs- und Investitionsmöglichkeiten<br />
der Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Vohrer.<br />
Überdurchschnittlich ist der Anteil der Bürgerenergie<br />
bei Solar- und Windenergie. Privatleute und<br />
Landwirte bringen es bei der Windenergie an Land<br />
auf einen Anteil von 41 Prozent. Beim Solarstrom<br />
vereinen sie sogar 49 Prozent der installierten Leistung<br />
in ihren Händen. In beiden Sparten ist der Anteil<br />
der Bürgerenergie allerdings gesunken. So fiel<br />
der Anteil der Privatpersonen und Landwirte an der<br />
installierten Leistung von Windenergieanlagen an<br />
Land 2016 gegenüber 2012 um 9 Prozentpunkte.<br />
Hingegen legte der Anteil der Energieversorger in<br />
diesem Segment um 3,6 Prozentpunkte auf insgesamt<br />
14,3 Prozent zu. Die Gewerbebetriebe verdoppelten<br />
ihren Anteil auf mehr als 6 Prozent.<br />
„Die Entwicklung zeigt die wachsende Attraktivität<br />
des Zukunftfelds Erneuerbare Energien für institutionelle<br />
Investoren. Getreu dem Motto ‚Eigentum<br />
verpflichtet‘ sollte es den Investoren aber unbedingt<br />
auch um eine hohe Akzeptanz ihrer Projekte gehen.<br />
Unsere Erfahrung zeigt: Nur durch die Teilhabe der<br />
Bevölkerung erhalten Erneuerbare Energien die notwendige<br />
Unterstützung vor Ort. Diese Unterstützung<br />
ist für den weiteren dynamischen Ausbau Erneuerbarer<br />
Energien in Deutschland essenziell“, betont<br />
AEE-Geschäftsführer Vohrer.<br />
WINGAS liefert Biogas an Spedition Zippel<br />
Essen/Kassel – Die neuen gasbetriebenen Lastkraftwagen<br />
der Hamburger Spedition Konrad Zippel<br />
fahren künftig mit Biogas, das von WINGAS<br />
geliefert wird. Mit dem Biogas will die Zippel<br />
Group ihre Transporte in das BMW-Werk<br />
Leipzig künftig CO 2<br />
-neutral halten. Die<br />
Abrechnung erfolgt erstmalig über die DKV-<br />
CNG-Tankkarte (Compressed Natural Gas)<br />
der Gazprom NGV Europe.<br />
Die neuen CNG Scania Trucks ersetzen einen<br />
Teil der alten Diesel-Flotte, um künftig Emissionen<br />
einzusparen. Die Trucks liefern Automotive-Teile<br />
in das BMW-Werk nach Leipzig. Die<br />
Verwendung der Tankkarte ermöglicht der Zippel<br />
Group, ihren Verwaltungsaufwand deutlich<br />
zu senken, da Kosten und Betankungen nun<br />
monatlich detailliert aufgearbeitet werden.<br />
„Wir können damit die Attraktivität von Intermodalen<br />
Transporten für einen Kunden<br />
wie BMW deutlich erhöhen und den CO 2<br />
-Ausstoß in<br />
der Well-to-Wheel Betrachtung um bis zu 90 Prozent<br />
Uwe Johann (rechts), Geschäftsführer der Gazprom NGV Europe, überreicht<br />
die Tankkarte an Axel Kröger (Bildmitte), dem geschäftsführenden<br />
Gesellschafter der Zippel Group. Rechts im Bild: Björn Tiemann,<br />
Leiter Business Development und CNG-Experte der Zippel Group.<br />
senken“, sagt Axel Kroeger, geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Zippel Group. Damit erreicht das Unternehmen<br />
CO 2<br />
-Einsparungen von umgerechnet rund<br />
420 Tonnen pro Jahr. Ein weiterer positiver Faktor sei<br />
die Lärmreduzierung. Denn CNG-Motoren sind<br />
laut der Deutschen Energie Agentur (dena) 5<br />
bis 10 Dezibel leiser als Dieselaggregate. „Wir<br />
sehen bei der Erdgasmobilität langfristig ein<br />
hohes Potenzial, um Emissionen im Straßenverkehr<br />
deutlich zu reduzieren. Durch Beimischung<br />
von Biogas werden gasbetriebene<br />
Fahrzeuge noch umweltfreundlicher“, erklärt<br />
Uwe Johann, Geschäftsführer der Gazprom<br />
NGV Europe. Im Vergleich zu Benzin verursachen<br />
mit Biogas betankte Fahrzeuge 97 Prozent<br />
weniger CO 2<br />
. Stickoxide und Feinstaub<br />
werden um rund 80 Prozent reduziert. Im Rahmen<br />
ihrer langfristigen Kooperation stellen<br />
WINGAS und ihre Konzernschwester Gazprom<br />
NGV Europe sicher, dass es sich bilanziell um<br />
Biomethan handelt.<br />
7
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Bücher<br />
Atlas of the Energiewende<br />
The Energy Transition in Germany<br />
Die Energielandschaft<br />
in Deutschland erlebt<br />
derzeit einen grundlegenden<br />
Wandel: Sonne,<br />
Wind, Biomasse<br />
und Co. werden für die<br />
Erzeugung von Strom<br />
und Wärme sowie im<br />
Verkehr eingesetzt.<br />
Der Ausbau der Netze, die Erweiterung der<br />
Speicherkapazitäten und eine permanente<br />
Effizienzsteigerung bestimmen die Energielandschaft.<br />
Wie diese im Jahr 2030<br />
aussehen könnte und wo man bereits einen<br />
Blick in die Zukunft werfen kann, zeigt<br />
der reich bebilderte Atlas zu Deutschlands<br />
Energiewende-Potenzialen – jetzt auch auf<br />
Englisch.<br />
Download: www.unendlich-viel-energie.de/<br />
english unter Media Library (Brochures)<br />
oder bei: alexander.knebel@unendlichviel-energie.de<br />
BImSchG – Kommentar<br />
Der Handkommentar<br />
erläutert das<br />
BImSchG aktuell,<br />
kompetent und zuverlässig<br />
unter Berücksichtigung<br />
der<br />
Bundes-Immissionsschutzverordnungen,<br />
der TA Luft und<br />
der TA Lärm. Die 12. Auflage berücksichtigt<br />
zahlreiche Novellen, darunter das Gesetz<br />
zur Einführung einer wasserrechtlichen<br />
Genehmigung für Behandlungsanlagen für<br />
Deponiesickerwasser vom 18.7.2017, das<br />
Gesetz zur Anpassung des Umwelt-RechtsbehelfsG<br />
und anderer Vorschriften an europa-<br />
und völkerrechtliche Vorgaben vom<br />
29.5.2017 und das Gesetz zur Umsetzung<br />
der RL 2012/18/EU zur Beherrschung der<br />
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen<br />
Stoffen vom 30.11.2016.<br />
C.H.BECK, 12. vollständig überarbeitete<br />
Auflage 2017. Buch. 1.092 Seiten,<br />
149 Euro, Hardcover (in Leinen)<br />
ISBN 978-3-406-71751-2<br />
Energiehandel in Europa<br />
Das Buch stellt den<br />
Handel mit Öl, Gas,<br />
Strom, Derivaten und<br />
Zertifikaten aus verschiedenen<br />
rechtlichen<br />
und wirtschaftlichen<br />
Blickwinkeln dar.<br />
Grafiken, Schaubilder<br />
und Handlungsanleitungen<br />
veranschaulichen die komplexe<br />
Materie. Inhaltliche Schwerpunkte bilden<br />
die Regelungsaktivitäten der EU zum Energiegroßhandel<br />
sowie EU-Vorschriften der<br />
MiFID II, MiFIR, CRD IV, EMIR, REMIT und<br />
deren deutsche Umsetzungsvorschriften.<br />
Es richtet sich an Handelsunternehmen,<br />
Mineralölkonzerne, Strom- und Gasproduzenten,<br />
Behörden, Europäische Kommission,<br />
Banken und Universitäten.<br />
C.H.BECK Verlag, 654 Seiten, 99 Euro<br />
ISBN 978-3-406-71636-2<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 20. Jahrgang<br />
www.biogas.org Dezember 2017<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
AnlAgensicherheit<br />
SonderheFt<br />
Feststoffdosierer: Gefahren Brandschutz: neues nachschlagewerk<br />
verfügbar S. 32 reinigung planen S.<br />
Fermenter: Sichere<br />
nicht unterschätzen S. 10<br />
40<br />
Biogas Journal Sonderheft Anlagensicherheit<br />
Das aktuelle Heft finden Sie<br />
auf der Homepage (www.biogas.org)<br />
DIN A4-Format<br />
Bestellnr.: BVK-14<br />
Preis auf Anfrage<br />
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 20. Jahrgang<br />
Bi gaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche sondERhEFT<br />
Regenwasser auffangen,<br />
was dann? S. 6<br />
Technik und Pflanzen<br />
kombiniert S. 12<br />
Verdunster<br />
im Einsatz S. 30<br />
Digitale auSgaBe – erhältlich unter www.biogas.org<br />
REgEnwassER-<br />
ManagEMEnT<br />
Aktualisiert<br />
18.12.2017<br />
Dezember 2017<br />
Biogas Journal Sonderheft Regenwasser-Management<br />
digital verfügbar<br />
Erstmals gibt es vom Biogas Journal ein digitales Sonderheft. Darin wird die Thematik der<br />
„Niederschlagswasser-Behandlung“ aufgegriffen. Auf 40 Seiten finden Sie Informationen<br />
zu den rechtlichen Gegebenheiten der Niederschlagswasser-Behandlung. Außerdem werden<br />
verschiedene Verfahren zur Reinigung des verschmutzten Niederschlagswassers vorgestellt.<br />
Sie können das komplette Sonderheft unter<br />
www.biogas.org<br />
kostenlos downloaden und in Ihrem pdf-Reader lesen<br />
und dort auch Seiten ausdrucken.<br />
8
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
NEU! Betonsanierung<br />
bei Biogasanlagen<br />
Sanieren mit bewährter Methode<br />
auch bei Gärsäften ab PH 3,2 bei<br />
Schäden in Abläufen,<br />
Schächten & Fahrsilos<br />
Mehr Infos auf der Homepage:<br />
www.syscompound-biogas.com<br />
Consulta GmbH • Tel. 09942/808312<br />
consulta.gmbh@fgaz.de<br />
Mathias Waschka<br />
Beratung und Vertrieb<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
Trocknungstechnik bis 1,5 MW<br />
Mobil schallged. Varianten<br />
bis 500 kW 45 dB(A)<br />
Aktuelles<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Biete ca. 2000 to.<br />
ZuckerrüBen<br />
frei Feld, frei Feldrand oder frei Biogasanlage.<br />
Rodetermine nach Absprache spätestens bis<br />
Mitte April. Nehme bei Interesse Gärsubstrat,<br />
Gülle etc. in Rücktransport auf.<br />
Biete ca. 20 ha Maisanbaufläche für <strong>2018</strong>.<br />
robert Bossmann<br />
Tel. 0171-5377736<br />
r.s.bossmann@t-online.de<br />
40789 Monheim (Rheinland)<br />
Schubboden-Trocknungscontainer<br />
Tel.<br />
Fax<br />
Mobil<br />
info@m-waschka.de<br />
www.m-waschka.de<br />
04482 - 908 911<br />
04482 - 908 912<br />
0151 - 23510337<br />
Biologische Behandlung von Niederschlagswasser<br />
Silage-verunreinigte Hofabläufe mit dem Festbett-Verfahren klären<br />
und direkt einleiten: C zugelassenes Verfahren<br />
C bereits seit 4 Jahren im Einsatz<br />
C günstiger als Ausbringen<br />
C Verfahrens- und Anlagenauslegung<br />
mit garantierten Ablaufwerten<br />
C kostenlose Beratung<br />
C Wartungsservice<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
DELPHIN Water Systems GmbH & Co. KG Tel. 04161 66921-0 www.delphin-ws.de<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
9<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com<br />
9
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
termine<br />
12. bis 14. März<br />
Abfallvergärungstag und GGG-Fachseminar<br />
Eltville am Rhein<br />
www.biogas.org<br />
13. März<br />
25. C.A.R.M.E.N.-Forum „Bioraffinerie –<br />
Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und<br />
Chemie“<br />
Straubing<br />
www.carmen-ev.de<br />
15. bis 18. März<br />
New Energy Husum<br />
Husum<br />
www.new-energy.de<br />
Mit Beteiligung des Fachverbandes Biogas<br />
22. bis 23. März<br />
Betreiberschulung im Sinne der TRGS 529<br />
Wemding<br />
www.green-energy-zintl.de<br />
Gemeinschaftsstand Fachverband Biogas e.V.<br />
IFAT, 14. bis 18. Mai in München<br />
Besuchen Sie den Fachverband Biogas und seine Mitgliedsfirmen auf dem Gemeinschaftsstand<br />
in Halle A4 Stand 415/514 während der IFAT <strong>2018</strong> vom 14. bis<br />
18. Mai in München. Mit über 3.100 Ausstellern und 135.000 Besuchern ist die<br />
IFAT die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft und<br />
somit immer interessanter für alle Themen rund um die Abfallvergärung weltweit.<br />
Neben dem Fachverband sind folgende<br />
Mitgliedsfirmen auf dem Gemeinschaftsstand<br />
vertreten:<br />
BAUR Folien GmbH,<br />
Friedmann Mikronährstoffe GmbH,<br />
Pfister Waagen Bilanciai GmbH,<br />
Hermann Sewerin GmbH,<br />
UGN-Umwelttechnik GmbH.<br />
Das gesamte Programm, alle<br />
weiteren Informationen und<br />
Tickets finden Sie unter:<br />
www.ifat.de<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
Motiv2015_85x118 15.06.2015 16:25 Seite 1<br />
Für die Revision nach BetrSichV §15(15)<br />
Austauschgeräte und Ersatzbaugruppen vom Original-Hersteller<br />
› passgenau<br />
› sicher, da ATEX-konform<br />
› wirtschaftlich durch kurze Stillstandszeit<br />
› mit voller Garantie<br />
› kurze Lieferzeit<br />
ATEX Ventilatoren<br />
für Biogas Zone 1 und 2<br />
(Kat.II 2G und II 3G)<br />
Anfragen bitte stets mit Ihrer Gerätenummer. Bezug und<br />
Installation in Deutschland über unsere Servicepartner möglich.<br />
MEIDINGER AG<br />
Landstrasse 71 4303 Kaiseraugst / Schweiz<br />
Tel. +41 61 487 44 11 service@meidinger.ch www.meidinger.ch<br />
Fest und abnehmbar montierbarer Wartungsumlauf für alle Biogasanlagen-Behälter!<br />
sicher<br />
zeiteinsparend<br />
kostengünstig<br />
Jetzt informieren!<br />
Telefon: 04409 9729680<br />
eMail: info@EasyFlexMultiSteg.de<br />
EasyFlex<br />
Willerfang 8<br />
26655 Westerstede<br />
www.EasyFlexMultiSteg.de<br />
10
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Connecting Global Competence<br />
Ressourcen. Innovationen. Lösungen.<br />
14.–18. Mai <strong>2018</strong> • Messe München<br />
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft<br />
Wie lässt sich die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung nachhaltig gestalten?<br />
Wie können Abfall- und Recyclingprozesse effizient umgesetzt werden?<br />
Und wie lassen sich die Herausforderungen im Winter und bei der Straßenreinigung innovativ bewältigen?<br />
Erleben Sie in spektakulären Live-Demonstrationen das gesamte Potenzial der Innovationen praxisnah<br />
und anschaulich im Einsatz. Aktuelle Themen- und Länderspecials sowie zahlreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen<br />
präsentieren Strategien und Konzepte für die Herausforderungen der Zukunft.<br />
Auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft finden Sie neue Lösungen<br />
und Innovationen.<br />
Neue Verteilung der Ausstellungsbereiche: www.ifat.de/hallenverteilung<br />
Jetzt Online-Ticket sichern.<br />
www.ifat.de/tickets<br />
www.ifat.de<br />
11
Aktuelles<br />
BIOGAS-KIDS<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Konkurrenz vom Acker<br />
Noch ist der Mais die wichtigste<br />
Energiepflanze vom Acker, wenn<br />
es um die Produktion von Biogas<br />
geht. Doch ihm erwächst mehr und<br />
mehr eine ernsthafte Konkurrenz.<br />
„Durchwachsene Silphie“ heißt sie –<br />
ein geheimnisvoller Name dieser<br />
Pflanze, die eigentlich aus Nordamerika<br />
stammt, die sich aber auch in unseren Regionen<br />
sehr wohl fühlt. Für Biogaserzeuger ist die Silphie<br />
schon mehr als nur ein Geheimtipp. Denn durch ihre<br />
Ertragsstärke auf dem Acker ist sie dem Mais wie<br />
bei der Biogas- und Methanausbeute nahezu ebenbürtig.<br />
Das liegt unter anderem an der gewaltigen<br />
Wuchshöhe bis zu 3,50 Meter. Wie beim Mais wird<br />
die ganze Pflanze geerntet und zu Silage verarbeitet.<br />
Dass die Silphie bisher noch nicht stärker Eingang gefunden<br />
hat in die Fruchtfolgen unserer Regionen, lag<br />
bisher an Problemen bei der Aussaat und der Tatsache,<br />
dass die Silphie erst im zweiten Jahr geerntet werden<br />
kann. Jetzt wunderst du dich vielleicht, weil Ackerpflanzen<br />
in der Regel einjährig angebaut werden. Genau<br />
das ist aber ein Riesenvorteil der mehrjährigen<br />
Silphie, die – einmal auf dem Acker – über viele weitere<br />
Jahre geerntet werden kann. Somit bedecken die<br />
Pflanzen das ganze Jahr über den Boden und bieten<br />
Die Uhr tickt<br />
Biogas ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.<br />
Das weißt du natürlich schon längst. Aber manchmal<br />
sind gerade Zahlen hilfreich, um Worte besser<br />
zu erklären und zu verstehen. Der Fachverband<br />
Biogas e. V. hat deshalb eine Klima-Uhr auf seiner<br />
Homepage installiert (www.biogas.org). Die zeigt<br />
anhand einer fortlaufenden Zahl eindrucksvoll, wie<br />
viel klimaschädliches CO ² durch den Betrieb von<br />
Biogasanlagen vermieden wird – und das schon<br />
seit dem Jahr 1992. Schau dir mal diese Riesenzahl<br />
an! Und noch ein weiterer Vergleich ist überzeugend:<br />
Pro Jahr vermeiden die rund 9.000 deutschen<br />
Biogasanlagen etwa 19 Millionen Tonnen CO ² . Das<br />
entspricht der CO ² -Erzeugung von 1,6 Millionen<br />
Menschen (schließlich enthält die von uns ausgeatmete<br />
Luft auch CO ² ). Das heißt, Biogasanlagen<br />
neutralisieren fast die Emissionen der Einwohner<br />
von Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg.<br />
N. L. Chrestensen<br />
Schutz vor Erosion. Und das Bild lässt ahnen, welchen<br />
weiteren ökologischen Nutzen die Silphie bietet: Durch<br />
ihre gelbe Blütenpracht, die sie ab Anfang Juli entfaltet,<br />
ist sie eine hoch willkommene Nahrungsquelle und<br />
wunderschöne Bienenweide. 150 kg Honig kann die<br />
Silphie pro Hektar liefern. Dazu passt, dass die Silphie<br />
ab dem zweiten Jahr keine Herbizide mehr benötigt.<br />
Weder Hitze noch Kälte können der Pflanze viel anhaben.<br />
Sie wurzelt bis zu zwei Meter tief und erschließt<br />
Wasserquellen, so dass auch Trockenperioden ihr nichts<br />
anhaben. Also dann: mehr Silphie auf die Äcker!<br />
Welttag der Meteorologie<br />
Der 23. März ist<br />
weltweit der<br />
Internationale Tag<br />
der Meteorologie.<br />
An diesem<br />
Tag macht die<br />
Weltorganisation der<br />
Wetterforscher auf ihre<br />
Arbeit aufmerksam. Die<br />
sogenannte „World Meteorological<br />
Organization“ wurde am<br />
23. März 1950 gegründet. Wetterprognosen<br />
sind heutzutage sehr<br />
wichtig und haben schon große<br />
Fortschritte gemacht. Nicht<br />
nur die Landwirtschaft ist sehr<br />
wetterabhängig. Mit richtigen Wetterprognosen<br />
können insbesondere bei extremen Wetterlagen<br />
Menschenleben und ihr Hab und Gut besser geschützt werden.<br />
Vor 25 Jahren konnte das Wetter erst zwei Tage im voraus<br />
bestimmt werden – heute stimmt die Vorhersage meist schon<br />
für die nächsten fünf bis acht Tage.<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
12
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber<br />
für Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der<br />
deutschen Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet.<br />
Seit der Gründung des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren<br />
Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt<br />
werden und unseren Wettbewerbern als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit<br />
unseren individuellen Beratungsleistungen.<br />
vogelsang.info<br />
ENGINEERED TO WORK
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Biomethan – ein Kraftstoff<br />
mit Zukunft<br />
Auf dem Kongress „Kraftstoffe der Zukunft“ am 22. und 23. Januar in Berlin gab es in<br />
diesem Jahr intensive Diskussionen über die Zukunft der Biokraftstoffe. Denn gerade<br />
in der Woche zuvor hatte das Europäische Parlament seine Position zur Neufassung der<br />
Erneuerbare-Energien-Richtlinie veröffentlicht. Für Kritik sorgt insbesondere die vorgesehene<br />
Absenkung des Absatzes von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse. Das würde das<br />
weitgehende „Aus“ für Biokraftstoffe der ersten Generation, wie aus Raps hergestelltem<br />
Biodiesel, bedeuten. Für Biomethan sehen die Perspektiven besser aus.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Walter Casazza von den<br />
Stadtwerken Augsburg<br />
lobte das Emissionsverhalten<br />
der mit<br />
Biomethan betriebenen<br />
Busse. Zudem lägen<br />
die Betriebskosten von<br />
gasbetriebenen Bussen<br />
unter denen von<br />
Dieselfahrzeugen.<br />
Eigentlich sind die Biokraftstoffe ein Opfer ihres<br />
eigenen Erfolges geworden. Der Grund ist<br />
die in Deutschland im Jahr 2015 eingeführte<br />
Treibhausgasminderungsquote und die stetige<br />
Verbesserung der Treibhausgasbilanz<br />
der Biokraftstoffe. So betrug im Jahr 2016 die durchschnittliche<br />
Treibhausgaseinsparung durch Biokraftstoffe<br />
77 Prozent im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen.<br />
Das ist gegenüber 2015 ein<br />
Plus von 7 Prozentpunkten.<br />
Durch den Einsatz von Biokraftstoffen<br />
wurden somit<br />
7,3 Millionen (Mio.) Tonnen<br />
CO 2<br />
-Äquivalent im Jahr<br />
2016 vermieden.<br />
Durch diese Effizienzsteigerung<br />
werden jedoch<br />
weniger Biokraftstoffe benötigt.<br />
Mit Biokraftstoffen<br />
könnten zudem schnell die<br />
CO 2<br />
-Emissionen im Verkehrssektor<br />
gesenkt werden,<br />
da sie in vorhandenen<br />
Fahrzeugen eingesetzt werden<br />
können und keine neue<br />
Infrastruktur aufgebaut werden muss. Mit Biomethan<br />
ließen sich die Klimaziele im Verkehr erreichen, denn<br />
es gibt attraktive Fahrzeuge mit großer Reichweite und<br />
ein gutes Tankstellennetz.<br />
Fotos: Thomas Gaul<br />
Durch die Mehrfachanrechnung<br />
droht Gefahr<br />
Doch wenn durch gesetzgeberische Maßnahmen der<br />
Anteil der Biokraftstoffe sinkt, würde im Umkehrschluss<br />
der Anteil fossiler Kraftstoffe wieder wachsen,<br />
denn 270 Mio. Fahrzeuge in der EU müssen mit Kraftstoffen<br />
versorgt werden. Artur Auernhammer, Vorsitzender<br />
des Bundesverbandes Bioenergie e.V. (BBE),<br />
forderte auf der Kongress-Pressekonferenz: „Der erst<br />
2015 beschlossene Kompromiss eines Anteils von 7<br />
Prozent für Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse muss<br />
daher zumindest bis 2030 beibehalten werden. Die<br />
kostengünstigste Alternative zu fossilen Kraftstoffen<br />
sind Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse.“<br />
Dem Beschluss zur Neufassung der Erneuerbaren-<br />
Energien-Richtlinie (REDII) zufolge muss der Anteil<br />
Erneuerbarer Energien im Verkehrssektor im Jahr<br />
2030 mindestens 12 Prozent betragen, wobei Biokraftstoffe<br />
aus Rest- und Abfallstoffen 10 Prozent erbringen<br />
sollen. Problematisch dürfte auch die Mehrfachanrechnung<br />
sein: So wird der Strom für E-Fahrzeuge<br />
fünffach auf die Erneuerbaren-Quote angerechnet.<br />
Dietrich Klein, Geschäftsführer des Bundesverbandes<br />
der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V. erläutert das<br />
Prinzip: „Für jede Kilowattstunde, die die Post in ihren<br />
Elektrotransportern einsetzt, könnte sie ein Zertifikat<br />
über 5 Kilowattstunden an die Mineralölindustrie verkaufen,<br />
die damit ihren Absatz an fossilem Benzin und<br />
Diesel sichern kann.“<br />
Zudem kann sich auch die Mineralölindustrie nun<br />
Emissionsminderungen bei der Kraftstoffproduktion<br />
auf die Quote anrechnen lassen. Für die Ölraffinerien<br />
ist das Einsparpotenzial groß, denn die methanhaltigen<br />
Begleitgase werden bislang noch meist abgefackelt<br />
oder direkt in die Atmosphäre entlassen. Ab<br />
2020 sollen auf diese Emissionsminderungen 1,2 Prozent<br />
entfallen, ohne dass dafür Nachhaltigkeitszertifikate<br />
oder dergleichen vorgelegt werden.<br />
Die neue Bundesregierung sollte nach den Vorstellungen<br />
der Biokraftstoffwirtschaft die Treibhausgasminderungsquote<br />
anheben, so Artur Auernhammer:<br />
„Sie sollte daher in <strong>2018</strong> beginnend bis 2030 sukzessive<br />
auf 16 Prozent angehoben werden, um den<br />
vom Ministerrat vorgeschlagenen EU-Mindestanteil<br />
von 14 Prozent Erneuerbareren Energien im Verkehr<br />
zu erreichen.“<br />
14
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Abkehr von fossilen Kraftstoffen notwendig<br />
Mit 560 Teilnehmern aus dem In- und Ausland war der<br />
Kongress besser als in den Vorjahren besucht. Deutlich<br />
wurde, dass es wenig sinnvoll ist, allein auf die<br />
Elektromobilität zu setzen, wenn es um die notwendige<br />
„Dekarbonisierung“, also die Abkehr von fossilen Kraftstoffen,<br />
im Verkehrssektor geht. Bei einem jährlichen<br />
CO 2<br />
-Ausstoß in Deutschland von 163 Mio. Tonnen geht<br />
es auch schon gar nicht mehr um das „Ob“, sondern<br />
vielmehr um das „Wie“, weil der Klimaschutz auch eine<br />
Herausforderung für die Landwirtschaft darstellt.<br />
Auernhammer zufolge haben sich im EU-Parlament nun<br />
„diejenigen Kräfte durchgesetzt, die der umstrittenen<br />
iLUC-Theorie folgen“, beklagte der BBE-Vorsitzende.<br />
Bei dieser seit mehreren Jahren geführten Diskussion<br />
geht es darum, dass für den Anbau von Biomasseflächen<br />
Flächen für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion<br />
in Anspruch genommen werden, für die dann<br />
wieder auf bislang nicht genutzte schützenswerte Flächen<br />
ausgewichen werden muss.<br />
Für Europa lassen sich solche Effekte aber wissenschaftlich<br />
stichhaltig nicht nachweisen. Für die<br />
vorzulegenden detaillierten Nachweise der Nachhaltigkeitsverordnung<br />
ist das für Deutschland auch<br />
auszuschließen. Dass die „ideologische Debatte“ seit<br />
nunmehr 20 Jahren geführt wird, räumte auch Bas<br />
Eickhout ein, Mitglied des Umweltausschusses im<br />
Europäischen Parlament. Mit Blick auf die unterstellten<br />
Landnutzungsänderungen seien jedoch nicht alle<br />
Biokraftstoffe „gleich gut“. Nicht nachhaltige Biokraftstoffe<br />
müssten vom Markt verschwinden.<br />
Biomethan stärker nutzen<br />
Aus Sicht des Umweltverbandes WWF Deutschland<br />
gelte es, das begrenzte Potenzial an Anbaubiomasse<br />
optimal zu nutzen. Die Anbaubiomasse werde zumindest<br />
im motorisierten Individualverkehr als Alternative<br />
zu flüssigen Kraftstoffen wegfallen, meinte Michael<br />
Schäfer vom WWF Deutschland. Sie sollte als Energieträger<br />
nur dort eingesetzt werden, wo es noch keine<br />
Alternative zu flüssigen Kraftstoffen gibt, beispielsweise<br />
in der Luftfahrt. Langfristig sollten nachhaltige Anbaukonzepte<br />
entwickelt werden, indem Biomasse von<br />
Blühflächen, extensivem Grünland und Untersaaten<br />
genutzt wird. Schäfer plädierte dafür, Biomethan vorübergehend<br />
stärker im motorisierten Individualverkehr<br />
zu nutzen.<br />
Um die Chancen von Biomethan und um das Marktpotenzial<br />
ging es in zwei Foren am Dienstag. Auf die Potenziale<br />
von Biomethan im Verkehrssektor in Deutschland<br />
ging Frank Bonaldo aus dem Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein. Das nationale<br />
Biomassepotenzial beträgt seinen Ausführungen zufolge<br />
1.000 Petajoule (PJ) im Jahr, davon sind mindestens<br />
300 PJ im Jahr Biomethan. Ein Biogas-Pkw mit<br />
einer jährlichen Fahrleistung von 14.000 Kilometern<br />
verbraucht in diesem Zeitraum 30 Gigajoule (GJ).<br />
Insgesamt ließen sich also 16,7 Mio. Pkw mit reinem<br />
Biomethan betreiben, rechnete Bonaldo vor. „Ein Erdgasmotor<br />
ist heute schon nicht teurer als ein Diesel“,<br />
sagte Bonaldo, „im Laufe der Zeit wird der Diesel sogar<br />
teurer werden.“ Entscheiden sollte ohnehin weniger<br />
die Antriebsart als vielmehr die CO 2<br />
-Einsparung. „Ein<br />
großer Hebel ist das Steuer- und Abgabensystem“ – das<br />
allerdings umgestaltet werden<br />
müsste, um über den<br />
Preis den CO 2<br />
-Ausstoß im<br />
Verkehr zu reduzieren.<br />
Dass die Anreize für einen<br />
stärkeren Biomethan-Einsatz<br />
im Verkehrssektor fehlen,<br />
konstatierte auch Marcel<br />
Leue, Consultant bei<br />
Arcanum Energy. Insbesondere<br />
die 38. BImSchV türme<br />
dagegen neue Hürden<br />
auf. „Dabei hat Biomethan<br />
aus Abfall- und Reststoffen<br />
ein hohes Treibhausgas-<br />
Minderungspotenzial von<br />
70 bis 80 Prozent.“ Im<br />
vergangenen Jahr wurden<br />
seinen Angaben zufolge 1,5 Terawattstunen (TWh)<br />
Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen, dagegen 7,9<br />
TWh Biomethan aus NawaRo produziert. Rund 400 Gigawattstunden<br />
(GWh) Biomethan wurden in 2017 als<br />
Kraftstoff abgesetzt.<br />
Es gibt genügend Beispiele für den erfolgreichen<br />
Einsatz von Biomethan. Vorreiter war in zahlreichen<br />
Städten der öffentliche Nahverkehr. Dr. Walter Casazza<br />
stellte auf dem Kongress das Engagement der Stadtwerke<br />
Augsburg (SWA) auf diesem Gebiet vor. Bereits<br />
seit 1995 fahren in der Fuggerstadt Erdgasbusse,<br />
2011 erfolgte ihre Umstellung auf reines Bio-CNG.<br />
Zum Angebot der SWA gehört auch eine Carsharing-<br />
Flotte mit Biomethanantrieb. Die Gas-Infrastruktur<br />
zum Betanken der Fahrzeuge können insgesamt 1.600<br />
Fahrzeuge nutzen. Das Biomethan wird von der Verbio<br />
AG bezogen. Rund 400 Tonnen (t) „bilanzielles“ Biomethan<br />
werden im Jahr geliefert. In das örtliche Gasnetz<br />
wird Biomethan der Abfall-Verwertung Augsburg<br />
(AVA) eingespeist.<br />
Vor dem Hintergrund der Diskussionen über die städtische<br />
Stickoxid-Belastung lobte Walter Casazza das<br />
Emissionsverhalten der mit Biomethan betriebenen<br />
Busse: „Bezogen auf die NO X<br />
-Emissionen gibt es nichts<br />
Besseres.“ Die städtische Busflotte trägt durch ihren<br />
umweltfreundlichen Antrieb zu einer CO 2<br />
-Einsparung<br />
von 7.300 t im Jahr bei. „Biogas ist für uns ein wichtiger<br />
Imageträger“, betonte Casazza. Der emissionsfreie,<br />
umweltfreundliche Antrieb wird auf den Außenseiten<br />
der Fahrzeuge auch offensiv beworben.<br />
Ein Erdgasbus ist nach Angaben Casazzas rund 45.000<br />
Euro teurer als ein Bus mit Dieselmotor. Durch den<br />
Frank Hofmann sagte,<br />
dass es in den sich<br />
entwickelnden Ländern<br />
eine ganz andere Motivation<br />
gibt, Biogasanlagen<br />
zu betreiben.<br />
Vorrangig gehe es um<br />
eine Verbesserung der<br />
Luftqualität und das<br />
Vermeiden von Treibhausgas-Emissionen.<br />
15
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Konzeptstudie: Der<br />
Traktorenhersteller<br />
New Holland zeigte auf<br />
der letztjährigen Agritechnica<br />
in Hannover<br />
ein neuartiges Modell<br />
eines CNG-betriebenen<br />
Schleppers. Die<br />
Gastanks befinden<br />
sich nicht mehr in<br />
den Kabinenholmen,<br />
sondern komplett unter<br />
der Kabine.<br />
Freistaat Bayern gibt es eine Förderung von 10.000<br />
Euro. Bei den Betriebskosten werden gegenüber Diesel<br />
5.000 Euro im Jahr gespart. Casazza ist sich sicher,<br />
dass wir mit Biomethan „auch die nächsten 10 Jahre<br />
die Nase vorn haben“.<br />
Ein Blick über Grenzen<br />
Jeppe Bjerg, Präsident des im September 2017 gegründeten<br />
European Renewables Gas Registry, richtete<br />
den Blick nach Dänemark. Hier wurden in den letzten<br />
vier Jahren 27 neue Biomethan-Einspeiseanlagen gebaut.<br />
Damit konnten im vergangenen Jahr 6 Prozent<br />
des dänischen Gasbedarfes gedeckt werden. Bis Ende<br />
<strong>2018</strong> sollen es 8 bis 10 Prozent sein.<br />
Weiter voran ging es mit Biomethan auch in den Niederlanden,<br />
wie Pelle Schlichting von Orange Gas<br />
schilderte. Im Nachbarland wurden seit 2015 zwei<br />
Biomethan-Aufbereitungsanlagen gebaut und es existieren<br />
Pläne für zehn weitere. „Der niederländische<br />
Markt unterscheidet sich stark vom deutschen“, führte<br />
Schlichting aus. So sind hier mehr Taxis, Postautos und<br />
Müllwagen mit Biomethan unterwegs.<br />
Alleine die Post hat 400 Lieferfahrzeuge, die durch<br />
Vans mit CNG-Antrieb ersetzt werden. Die CO 2<br />
-armen<br />
Fahrzeuge werden durch das niederländische Steuersystem<br />
begünstigt. „Wichtig ist eine gute öffentlich<br />
zugängliche Infrastruktur zum Tanken“, betonte<br />
Schlichting. Hierzulande ist Orange Gas durch die<br />
Übernahme der Gazu-Stationen vertreten.<br />
Die Diskriminierung von Biomethan als Kraftstoff beklagte<br />
Zoltan Elek, Geschäftsführer der Landwärme<br />
GmbH in München. So sei seit 2012 der Einsatz tierischer<br />
Fette zur Biomethanproduktion für Kraftstoffe<br />
ausgeschlossen, was faktisch zu einem „veganen“ Biomethan<br />
führe. Nur drei Standardwerte für Biomethan<br />
führten dazu, dass für jeden Einsatzstoff individuelle<br />
Berechnungen des Treibhausgas-Minderungswertes<br />
vorgenommen werden müssten. Schwierigkeiten beim<br />
grenzüberschreitenden Handel mit Biomethan behindern<br />
Importe.<br />
Die internationale Perspektive nahm Frank Hofmann<br />
vom Fachverband Biogas e.V. ein, der den Blick auf die<br />
weltweite Mobilität mit Biomethan richtete. Seinen Angaben<br />
zufolge gibt es 600 Biomethan-Aufbereitungsanlagen<br />
weltweit. Global betrachtet werden 10 Prozent<br />
des Biomethans im Transportsektor eingesetzt. Dabei<br />
gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, so<br />
Hofmann: „Während in Schweden 88 Prozent des Biomethans<br />
als Kraftstoff eingesetzt werden, sind es in<br />
Deutschland nur 4 Prozent.<br />
Hofmann verwies darauf, dass es in den sich entwickelnden<br />
Ländern eine ganz andere Motivation gibt,<br />
Biogasanlagen zu betreiben. Vorrangig geht es um eine<br />
Verbesserung der Luftqualität und das Vermeiden von<br />
Treibhausgas-Emissionen. Deshalb werden beispielsweise<br />
Abwasserbecken bei der Palmölgewinnung abgedeckt<br />
und zur Biogasproduktion genutzt. Im chinesischen<br />
Fünfjahresplan ist eine Biomethanproduktion<br />
von 8 Billionen Kubikmetern vorgesehen. Das Biomethan<br />
wird dort in Tankfahrzeugen zu den Tankstellen<br />
gebracht.<br />
Biomethan bietet auch eine Chance für die Landwirtschaft<br />
hierzulande: Zum einen könnten bestehende<br />
Biogasanlagen auf die Gasaufbereitung umgerüstet<br />
werden. Und auch zum Antrieb der Traktoren lässt sich<br />
Biomethan verwenden. Durch die saisonalen Spitzen<br />
ist das eine ideale Kombination mit der Wärmenutzung.<br />
Denn der Kraftstoffbedarf ist im Sommer am<br />
höchsten und im Winter am geringsten, wenn aber der<br />
höchste Wärmebedarf besteht. „Aus Sicht der Energieeffizienz<br />
ist das ideal“, sagte Johan Grope vom Institut<br />
für Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie.<br />
Nachteilig sind jedoch die immer noch hohen Aufbereitungskosten<br />
für kleine Biogas-Aufbereitungsanlagen.<br />
Praxisreif ist der Biomethan-Traktor: New Holland ließ<br />
ihn auf verschiedenen Betrieben erfolgreich testen. Die<br />
zweite Generation des Schleppers wurde als Konzept<br />
auf der vergangenen Agritechnica vorgestellt. Bemerkenswert<br />
ist die freie Sicht, die möglich wurde, weil<br />
der Tank aus Verbundwerkstoffen unter die Kabine<br />
verbannt werden konnte. Für einen langen Arbeitstag<br />
reicht der Biomethanvorrat nicht aus, Abhilfe könnte<br />
hier ein mit Biomethan gefüllter Fronttank bieten. „Der<br />
Motor hat einen satten Klang bei 50 Prozent weniger<br />
Geräuschemissionen“, lobte Klaus Senghaas von New<br />
Holland das neue Antriebsaggregat. „Es ist wichtig zu<br />
zeigen, dass der Landwirt mit seinen eigenen Betriebsmitteln<br />
arbeiten kann“, erläuterte Senghaas die Strategie<br />
seiner Firma.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
Mobil: 01 72/512 71 71<br />
E-Mail: gaul-gehrden@t-online.de<br />
16
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Kloska<br />
Group<br />
Thomsen & Co.GmbH<br />
Engine Power Systems<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort ·Fachwerkstatt · Vertrieb Gasmotoren<br />
Der BHKW- Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Neumodule für den<br />
Flexbetrieb<br />
von 100-1.500 kW<br />
im Container, Betonhaube<br />
oder als<br />
Gebäude-Einbindung<br />
Speller Straße12 · 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 - 945 82-0 · Fax: -11<br />
Email: mail@eps-kloska.com<br />
Internet: www.eps-kloska.com<br />
Servicestützpunkte: Beesten, Wilhelmshaven, Lübeck, Magdeburg, Rostock<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für jedes in Deutschland zugelassene BHKW.<br />
Hohe Lebensdauer durch hervorragende Schwefelresistenz<br />
mit über 30 mg /mm 2 (andere oft nur 25<br />
mg). In Deutschland gefertigt.<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto plus Fracht)<br />
z.B. für MWM TCG 2016 V12: nur 2.950 €<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Biogas CLEAN und COOL!<br />
Wir machen Ihr Biogas sauber und trocken. Mit den individuellen Anlagen von Züblin<br />
Umwelttechnik zur Reinigung und Kühlung von Biogas: Der Aktivkohlefilter CarbonEx ® zur<br />
Feinentschwefelung, die GasCon Gaskühleinheit zur Kühlung, der BioSulfidEx oder –<br />
unser neuestes Produkt – der BioBF zur biologischen Vorentschwefelung.<br />
www.zueblin-umwelttechnik.com<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Otto-Dürr-Str. 13, 70435 Stuttgart, Tel. +49 711 8202-0, umwelttechnik@zueblin.de<br />
Stuttgart • Berlin • Chemnitz • Dortmund • Hamburg • Nürnberg • Straßburg • Mailand • Rom • Bukarest<br />
17
Politik<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
„EU-Ministerrat hat die<br />
Bremserrolle übernommen“<br />
Die europäischen Energieminister zeigen wenig Bereitschaft, die Erneuerbaren voranzubringen,<br />
stattdessen wollen sie die Kohle in Kapazitätsmärkten etablieren.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Fünfzehn Stunden wurde verhandelt – dann<br />
war der Kniefall vor der fossilen Energiewirtschaft<br />
beschlossene Sache. Es war am 18.<br />
Dezember, als sich der Rat der EU-Energieminister<br />
traf, um – so die offizielle Formulierung<br />
– „einen Standpunkt zu einer Richtlinie über die<br />
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren<br />
Quellen in der EU“ festzulegen. Am Ende betätigte sich<br />
der Rat vor allem als Bremser.<br />
Herausgekommen seien „Positionen, die in fast allen<br />
Fragen hinter das zurückfallen, was angesichts des<br />
Pariser Klimaschutzabkommens notwendig wäre“,<br />
sagt Rainer Hinrichs-Rahlwes, Vizepräsident der European<br />
Renewable Energies Federation (EREF). Wo<br />
klare Entscheidungen angebracht gewesen wären,<br />
überwögen „Formelkompromisse, Zugeständnisse an<br />
die alte Energiewelt und völlige Anspruchslosigkeit“.<br />
Die bisherigen Beschlüsse der Ausschüsse des Europäischen<br />
Parlaments seien „fast durchgehend präziser<br />
und ambitionierter als die beschlossenen Positionen<br />
des Rates“.<br />
Ähnlich urteilte auch Claude Turmes, grüner Europa-<br />
Abgeordneter, über das Ergebnis der Verhandlungen:<br />
Es greife „in vielerlei Hinsicht zu kurz, um die Herausforderungen<br />
des Klimawandels anzugehen“. Denn die<br />
Mitgliedstaaten weigern sich, das Ziel für Erneuerbare<br />
Energien im Jahr 2030, das derzeit auf 27 Prozent des<br />
Gesamtenergieverbrauchs festgelegt ist, anzuheben.<br />
Diese 27 Prozent seien „kaum mehr als Business-asusual“,<br />
erklärt EREF-Vizepräsident Hinrichs-Rahlwes.<br />
Hoffen auf das Parlament<br />
Das EU-Parlament hatte zuvor immerhin einen Ausbau<br />
auf 35 Prozent über alle Sektoren gefordert. Umweltverbände<br />
halten mindestens 45 Prozent für notwendig.<br />
Hinrichs-Rahlwes´ Fazit: „Unterm Strich hat der Rat<br />
in Sachen Ambition und Verbindlichkeit eindeutig die<br />
Bremserrolle übernommen.“ Nun stehen die Verhandlungen<br />
des Rates mit dem Europäischen Parlament an –<br />
was zumindest die Hoffnung in der Branche nährt, dass<br />
die Abgeordneten am Ende doch noch mehr herausholen.<br />
Typisch für den Beschluss der 15-stündigen Minister-<br />
Verhandlungen sind unpräzise Formulierungen: „In<br />
Bezug auf die Wärme- und Kälteversorgung werden die<br />
Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen müssen, um den<br />
Anteil erneuerbarer Energiequellen um einen Richtwert<br />
18
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Politik<br />
von einem Prozentpunkt pro Jahr<br />
zu steigern“, teilte der Ministerrat<br />
anschließend mit. „Lachhaft“<br />
nennt diesen einen jährlichen<br />
Prozentpunkt die Energieexpertin<br />
und Bundestagsabgeordnete<br />
der Grünen Julia Verlinden. Der<br />
Ministerrat feiere sich für ein<br />
„Versagen auf ganzer Linie“. In<br />
Deutschland wäre der Wärmesektor<br />
mit diesem Szenario „erst im<br />
Jahr 2105 dekarbonisiert“.<br />
Als „noch schlimmer“ wertet Verlinden<br />
die Positionen des Ministerrates<br />
zum Verkehr. Denn das<br />
Gremium setzt das Ziel für den<br />
Anteil der Erneuerbaren Energien<br />
für jeden Mitgliedstaat auf gerade<br />
14 Prozent im Jahr 2030 fest. Es<br />
soll „ein Teilziel von 3 Prozent an<br />
‚modernen Biokraftstoffen‘“ geben,<br />
die dann in der Statistik doppelt gezählt werden<br />
dürfen, um die Staaten besonders zum Einsatz dieser<br />
Energieträger zu ermuntern. Die bestehende Obergrenze<br />
von 7 Prozent für Biokraftstoffe der ersten Generation<br />
soll zugleich aufrechterhalten werden, „um Rechtssicherheit<br />
für Investoren zu gewährleisten“.<br />
Foto: fotofinder.com_jalens - joachim affeldt<br />
EU-Ministerrat zementiert<br />
Energieimportabhängigkeit<br />
Hans-Josef Fell, Initiator der Energy Watch Group und<br />
als ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen<br />
auch einer der Väter des EEG im Jahr 2000, nimmt<br />
kein Blatt vor den Mund, wenn er die Pläne der EU-<br />
Minister bewertet: „Widersinn und Ignoranz“ offenbare<br />
die jüngste EU-Ratsentscheidung. Die EU wolle „die<br />
extrem hohe Energieimportabhängigkeit mitsamt den<br />
großen geopolitischen Risiken aufrechterhalten“. Und<br />
sie setze zugleich auf eine „immer teurere Energieversorgung,<br />
weil die Erneuerbaren Energien als heute die<br />
mit Abstand billigste Energiequelle auf niedrigem Niveau<br />
bleiben sollen“.<br />
Die EU werde damit die „einstmalige Vorreiterrolle“ –<br />
auch was die Industrieentwicklung der Erneuerbaren<br />
Energien betrifft – an China, Indien, Nord- und Südamerika<br />
„noch stärker verlieren als heute schon“. Statt den<br />
durch die nationale Politik vieler EU-Länder fast schon<br />
zum Stillstand gekommenen Ausbau der Erneuerbaren<br />
Energien wirklich anzukurbeln, setze der Europäische<br />
Rat weiter auf einen minimalen Erneuerbare-Energien-<br />
Ausbau, letztendlich um die Geschäftsmodelle der fossilen<br />
und atomaren Wirtschaft zu schützen.<br />
Schon in jüngster Vergangenheit schritt der Ausbau der<br />
Erneuerbaren Energien in Europa nur langsam voran.<br />
Im Jahr 2016 wuchs der Anteil der Erneuerbaren Energien<br />
am gesamten EU-Energiebedarf nach Zahlen der<br />
Umweltagentur EEA nur noch um minimale 0,2 Punkte<br />
19
Politik<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aalen-Beuren<br />
auf 16,7 Prozent. Nun wollen die Energieminister in der<br />
EU das Ausbautempo für Erneuerbare Energien sogar<br />
weiter drosseln: „Das ist angesichts rapide sinkender<br />
Kosten für Energie aus Wind und Sonne politischer<br />
Unsinn und untergräbt den wirtschaftlichen Umbau“,<br />
sagt Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbandes<br />
Deutscher Naturschutzring (DNR) .<br />
Pariser Klimagipfel wird zum Werbegag<br />
europäischer Staatsoberhäupter<br />
Zugleich stößt auch die Kohlepolitik auf Widerstand.<br />
Die Minister öffneten durch ihre jüngsten Beschlüsse<br />
„gleichzeitig Tür und Tor für neue Kohlesubventionen“,<br />
klagt der grüne EU-Abgeordnete Turmes. Dies belege,<br />
dass der Gipfel in Paris „wenig mehr als ein Werbegag<br />
der europäischen Staatsoberhäupter“ war. Nun ruhten<br />
alle Hoffnungen auf dem EU-Parlament, „um die Ambition<br />
des Pariser Klimavertrags zu retten und in europäisches<br />
Recht zu gießen“. Und zumindest ein klein wenig<br />
Hoffnung ruht auch noch auf einzelnen Staaten, denn<br />
die EU gestattet diesen immerhin, sich eigene, höhere<br />
Ziele zu setzen.<br />
Die Kohlepolitik freilich läuft allem Klimaschutz zuwider;<br />
sie wird in der EU inzwischen vor allem unter dem<br />
Aspekt eines Kapazitätsmarktes betrieben. Bei einem<br />
solchen Marktmodell wird nicht der erzeugte Strom vergütet,<br />
sondern die bereitgestellte gesicherte Leistung.<br />
Kraftwerksbetreiber erhalten also unabhängig von den<br />
erzeugten Kilowattstunden auch für ihre Betriebsbereitschaft<br />
Geld. Diese Kapazitätsprämien sollten nach dem<br />
ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission allerdings<br />
auf Kraftwerke beschränkt werden, die maximal<br />
550 Gramm CO 2<br />
pro Kilowattstunde ausstoßen. Damit<br />
wäre die Kohle im Kapazitätsmarkt außen vor gewesen;<br />
selbst der neue Block der EnBW mit dem Kürzel RDK8<br />
in Karlsruhe, der als eines der modernsten Steinkohlekraftwerke<br />
der Welt gilt, emittiert nach Daten der Betreiber<br />
noch 740 Gramm.<br />
Doch statt solche Abgasgrenzwerte baldmöglichst zu<br />
erlassen, wollen die europäischen Minister die Kohle<br />
durch lange Übergangsfristen am Markt halten. Bis<br />
Aufgepasst Biogasbetreiber :<br />
wir kümmern uns um alles ...<br />
Komplettsilage:<br />
Säen / Mähen / Häckseln / Abfahren / Walzen / Abdecken / Gärreste<br />
Je nach Anforderung und Wunsch können wir Ihnen ein<br />
maßgeschneidertes Paket an Dienstleistungen in allen Bereichen<br />
rund um die Beschaffung und Entsorgung Ihrer Biomasse anbieten.<br />
2025 sollen neue Kohlekraftwerke auch dann noch Unterstützung<br />
durch den Kapazitätsmarkt erhalten, wenn<br />
sie den CO 2<br />
-Grenzwert überschreiten. Bestehende Anlagen<br />
sollen sogar bis ins Jahr 2030 Kapazitätszahlungen<br />
erhalten können, unabhängig von ihren Emissionen.<br />
Und wenn es in einem Land bereits Kapazitätsmärkte<br />
gibt, soll die Frist gar bis 2035 ausgedehnt werden.<br />
Falsche Rücksichtnahme auf Kohle-Lobby<br />
„Damit wird jede Bemühung um die klimapolitisch<br />
dringend notwendige Reduzierung der Kohleverstromung<br />
oder gar eines Kohleausstiegs ad absurdum geführt“,<br />
sagt Rainer Hinrichs-Rahlwes. Zwar gebe es in<br />
den Ratspapieren längere Passagen zu den Kriterien<br />
für die Bedarfsbestimmung für Kapazitätsmechanismen,<br />
jedoch bleiben diese „so weit im Ungefähren,<br />
dass letztlich nationale Vorlieben für einen bestimmen<br />
Energiemix den Ausschlag geben können, bestimmte<br />
Kraftwerke über Kapazitätszahlungen ökonomisch jahrelang<br />
am Leben zu erhalten“. Dies sei eine „falsche<br />
Rücksichtnahme auf die Kohle-Lobby und die überholte<br />
Idee der Versorgungssicherheit nur durch Grundlastkraftwerke“.<br />
Auch der DNR mahnt: „Wenn die EU-Minister sich mit<br />
dieser Haltung gegenüber Kommission und EU-Parlament<br />
durchsetzen, verliert Europa an internationaler<br />
Glaubwürdigkeit.“ Präsident Niebert spricht von einem<br />
„klima- und finanzpolitisch verantwortungslosen Spiel,<br />
mit dem die Pariser Klimaziele nicht erreicht werden<br />
können“.<br />
Der etablierten Stromwirtschaft freilich geht selbst<br />
eine zögerliche Zurückdrängung der Kohle noch zu<br />
schnell. „Wenn ab 2030 alle Anlagen, die mehr als<br />
550 Gramm CO 2<br />
pro Kilowattstunde ausstoßen, vom<br />
Kapazitätsmarkt ausgeschlossen werden, würde das<br />
selbst die modernsten Kohlekraftwerke aus dem Markt<br />
drängen“, sagt Stefan Kapferer Hauptgeschäftsführer<br />
des Branchenverbandes BDEW. Und das sei „ein klarer<br />
Verstoß gegen den Grundsatz der Technologieneutralität,<br />
der in einem Kapazitätsmarkt gelten muss“.<br />
Kapferer betont stattdessen, dass die CO 2<br />
-Minderung<br />
„anderen Mechanismen – insbesondere<br />
dem Emissions-Zertifikatehandel – vorbehalten“<br />
sein müsse. Allerdings: Würden die<br />
Preise für CO 2<br />
wirklich auf ein relevantes<br />
Niveau steigen, käme auch das einem Ende<br />
der Kohleverstromung gleich.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
20
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Politik<br />
Wir lassen nichts<br />
an ihren Beton!<br />
nach<br />
neuem<br />
WHG!<br />
Auszug aus unserem<br />
Produktsortiment<br />
www.besatec.eu<br />
I Biogasbehälter<br />
I Fahrsilos<br />
I Güllebecken<br />
I Sanieren<br />
I Beschichten<br />
I WHD-Strahlen<br />
Wärmezähler<br />
Besatec Holsten GmbH Fischerweg 2a · 38162 Cremlingen · 05306 99 050 10 · info@besatec.eu<br />
Gaszähler<br />
mit getrennter Hydrolyse…<br />
...der Turbo für jede Biogasanlage<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Ertüchtigung und Optimierung bestehender<br />
Biogasanlagen.<br />
Nachrüstung der Hydrolyse bei NAWARO<br />
Biogasanlagen.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com www.innovas.com<br />
Stromzähler<br />
Systemtechnik<br />
INFOS ANFORDERN – Fax: 07 11 / 35 16 95 - 29<br />
E-Mail: info@molline.de<br />
www.molline.de/kontakt<br />
21<br />
www.molline.de
Politik<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Interview<br />
»Mit dem Pilotprojekt Power-to-Feed<br />
wollen wir die Fruchtfolge erweitern«<br />
Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in<br />
Schleswig-Holstein spricht über die Flexibilisierung von Biogasanlagen und alternative Energiepflanzen,<br />
über eine CO 2<br />
-Bepreisung, Netzausbauten und die Reststrommengen des Atomkraftwerks Brokdorf.<br />
Interviewer: Bernward Janzing<br />
Biogas Journal: Herr Habeck, nach wie vor<br />
muss in Schleswig-Holstein viel Strom aus<br />
Erneuerbaren Energien abgeregelt werden,<br />
weil die Netze verstopft sind – trotz des<br />
Netzausbaus. Sehen Sie noch irgendeine<br />
Handhabe, unter diesem Aspekt das Ende<br />
des AKW Brokdorf doch noch vorzuziehen?<br />
Robert Habeck: Nein, dafür gibt es keine<br />
Handhabe. Der rechtliche Rahmen wird<br />
allein durch das Atomgesetz bestimmt.<br />
Die Möglichkeit, die Betreibergesellschaft<br />
aufgrund anderer Rechtsvorschriften zur<br />
Beendigung des Leistungsbetriebs in<br />
Brokdorf zu veranlassen, gibt das geltende<br />
Recht nicht her. Hier gilt Bundesrecht, an<br />
das sich Schleswig-Holstein halten muss.<br />
Biogas Journal: Aber Brokdorf ist darauf angewiesen,<br />
Reststrommengen von anderen<br />
Reaktoren übertragen zu bekommen, um<br />
bis 2021 laufen zu können ...<br />
Habeck: Wir fordern schon seit längerem<br />
von der Bundesregierung, dass keine Reststrommengen<br />
von anderen Kernkraftwerken<br />
ins Netzausbaugebiet übertragen werden.<br />
Das passt nämlich nicht: den Windkraft-<br />
Ausbau deckeln wegen der Netzengpässe<br />
und dann Reststrommengen in genau dieses<br />
Gebiet übertragen.<br />
Biogas Journal: Werden die Abregelungen<br />
in Schleswig-Holstein in den kommenden<br />
Jahren durch den Netzausbau weniger?<br />
Habeck: Die in die Stromnetze aufgenommene<br />
Stromerzeugung aus Erneuerbaren<br />
Energien ist 2017 weiter angestiegen –<br />
ein Indikator dafür, dass Netzausbau- und<br />
Netzmanagementmaßnahmen in Schleswig-Holstein<br />
zu wirken beginnen. Besonders<br />
hervorzuheben sind hier die erfolgten<br />
Inbetriebnahmen von Netzteilen in der<br />
Höchstspannungsebene – insbesondere<br />
der erste Abschnitt der Westküstenleitung.<br />
Biogas Journal: Gibt es Prognosen zur künftigen<br />
Abregelung?<br />
Habeck: Mittelfristig erwarten wir und die<br />
Betreiber der Stromnetze in Schleswig-Holstein,<br />
dass die weiter zunehmende Verfügbarkeit<br />
des Höchstspannungsnetzes den<br />
Anteil der abzuregelnden EE-Strommenge<br />
maßgeblich beeinflussen wird. So können<br />
beispielsweise entlang der Westküste<br />
durch die Inbetriebnahmen von weiteren<br />
Abschnitten der Höchstspannungsleitungen<br />
sowie der neuen Umspannwerke in<br />
den Bereichen von Heide, Husum, Niebüll<br />
und insbesondere in der Mittelachse<br />
in der Nähe von Flensburg Abregelungen<br />
aufgrund von Netzengpässen in Schleswig-<br />
Holstein weiter sinken.<br />
Biogas Journal: Auch Kohlestrom kann Netze<br />
überlasten. Wird es nach dem Willen der<br />
Grünen beim Kohleausstieg auch eine Rolle<br />
spielen, wo die Kraftwerke stehen?<br />
Habeck: In Schleswig-Holstein planen die<br />
Betreiber der Kohlekraftwerke ohnehin,<br />
diese in den nächsten Jahren durch flexible<br />
Kraftwerke auf Erdgasbasis beziehungsweise<br />
durch die Nutzung von Ersatzbrennstoffen<br />
und anderen Alternativen zu ersetzen.<br />
Die Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur<br />
weist für 2030 nur noch 27 Megawatt installierte<br />
Leistung aus Kohlekraftwerken<br />
aus. Das Kohle-Heizkraftwerk Wedel soll<br />
nach den Plänen des Hamburger Senats<br />
2021/22 abgeschaltet werden.<br />
Biogas Journal: Wie könnte man erreichen,<br />
dass vordringlich im Norden Deutschlands<br />
die Kohlekraftwerke vom Netz gehen?<br />
Habeck: Weitere Kraftwerke in Norddeutschland<br />
stehen unter verstärkter Beobachtung.<br />
Es wird geprüft, ob dort die<br />
Fahrweise tatsächlich dem Vorrang der<br />
EE-Einspeisung entspricht. Dieser Vorrang<br />
muss künftig noch nachdrücklicher umgesetzt<br />
werden. Zudem setzen wir uns für<br />
eine CO 2<br />
-Bepreisung auch im Stromsektor<br />
in einer gemeinsamen Initiative mit Frankreich<br />
und weiteren europäischen Staaten<br />
ein. Auch die Außerbetriebnahme von besonders<br />
emissionsintensiven Braunkohlekraftwerken<br />
und eine Begrenzung der Jahresfracht<br />
von CO 2<br />
-Emissionen muss stärker<br />
in den Fokus rücken.<br />
Biogas Journal: Rechnen Sie mit einem<br />
Rückgang der Arbeitsplätze im Sektor der<br />
Erneuerbaren in Schleswig-Holstein in den<br />
kommenden Jahren?<br />
Habeck: Diese Gefahr droht, wenn die derzeit<br />
geltenden Rahmensetzungen nicht<br />
geändert werden. Ich unterstütze das Ziel<br />
der neuen Bundesregierung, die Stromerzeugung<br />
aus Erneuerbaren Energien auf 65<br />
Prozent auszubauen und empfehle dabei,<br />
wie bisher als Bezugsgröße den Bruttostromverbrauch<br />
zugrunde zu legen. Im Kontext<br />
des dafür erforderlichen zusätzlichen<br />
Ausbaus der Erneuerbaren Energien sollte<br />
auch das Offshore-Ausbauziel auf mindestens<br />
20 Gigawatt bis 2030 und mindestens<br />
30 Gigawatt bis 2035 angehoben werden.<br />
Kurzfristig sind die im „neuen“ Koalitionsvertrag<br />
(auf Bundesebene) vorgesehenen<br />
zusätzlichen Ausschreibungen für Wind<br />
Onshore, Offshore und Photovoltaik ein<br />
richtiger Ansatz.<br />
Die neue Bundesregierung sollte zudem<br />
das Instrument des Netzausbaugebiets<br />
2019 evaluieren und gegebenenfalls ab-<br />
22
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Politik<br />
schaffen. Vor allem dann, wenn es sich als<br />
nicht (mehr) geeignet erweist, die Kosten<br />
für Redispatch und Einspeisemanagement<br />
in Deutschland zu senken, oder wenn effizientere<br />
Instrumente zur Verfügung stehen.<br />
Darüber hinaus sollte das Instrument der<br />
zuschaltbaren Lasten, das die Abregelung<br />
erneuerbaren Stroms aufgrund von Netzengpässen<br />
auf ein Minimum reduzieren<br />
soll, technologieoffen gestaltet werden und<br />
sich nicht mehr nur auf Power-to-Heat beschränken.<br />
Werden diese Rahmensetzungen umgesetzt,<br />
hat Schleswig-Holstein – wie auch andere<br />
Bundesländer – gute Chancen, der bisherigen<br />
wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte<br />
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien ein<br />
neues Kapitel hinzuzufügen. Und wenn die<br />
Bundesregierung sich dann auch noch zu<br />
einer systematischen Reform der Abgaben<br />
und Umlagen im Energiesektor durchringen<br />
könnte, wäre damit ein zentrales Hemmnis<br />
für Flexibilitäten und Sektorkopplung beseitigt,<br />
und es könnten weitere wirtschaftliche<br />
Impulse geschaffen werden.<br />
Biogas Journal: Ein wichtiger Aspekt für die<br />
fortschreitende Energiewende ist die Flexibilisierung<br />
der Biomasseverstromung ...<br />
Habeck: In der Tat müssen sich Biogasanlagenbetreiber<br />
zukünftig neuen Anforderungen<br />
stellen, um einen Beitrag für die Energiewende<br />
zu leisten. Dafür brauchen sie ein<br />
gut durchdachtes Wärmekonzept und müssen<br />
durch eine flexible Fahrweise die fluktuierenden<br />
Erneuerbaren Energien unterstützen.<br />
Die Umstellung von ursprünglich<br />
für den Dauerbetrieb ausgelegten Biogasanlagen<br />
auf eine flexible Stromproduktion<br />
verlangt sowohl verschiedene technische<br />
Lösungen als auch Fingerspitzengefühl bei<br />
der Fütterung der Anlage und ein funktionierendes<br />
Wärmekonzept.<br />
Biogas Journal: Welche<br />
Impulse wird hier das<br />
Land geben?<br />
Habeck: Da es für manche<br />
Fragestellungen<br />
noch keine Standardlösungen<br />
gibt, haben<br />
wir uns vor etwa eineinhalb<br />
Jahren entschieden,<br />
eine Biogasanlage,<br />
deren Betrieb<br />
auf einen intensiven<br />
Start-Stopp-Betrieb<br />
umgestellt wird, bei<br />
der Suche nach notwendigen IT-Lösungen<br />
und dem Verknüpfungskonzept der Einzelkomponenten<br />
(BHKW, Gasspeicher, Wärmespeicher<br />
und Steuerung) finanziell zu<br />
unterstützen. Dieser Entwicklungsprozess<br />
ist inzwischen fast abgeschlossen. Mit Erfolg,<br />
denn die Stromproduktion kann über<br />
eine innovative Steuerung jederzeit nach<br />
Bedarf so angepasst werden, dass sie zur<br />
Versorgungssicherheit beiträgt. Wir werden<br />
gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber beraten,<br />
wie die gesammelten Erfahrungen<br />
und die Ergebnisse beispielsweise über<br />
Veranstaltungen und/oder Vor-Ort-Termine<br />
als Impuls für möglichst viele Nachahmer<br />
genutzt werden können.<br />
Foto: Dennis Williamson/www.williamson-foto.de<br />
Biogas Journal: Welche Rolle spielen in<br />
Schleswig-Holstein alternative Energiepflanzen<br />
für Biogas?<br />
Habeck: In Schleswig-Holstein werden<br />
seit einigen Jahren weniger Maissilage und<br />
stattdessen deutlich mehr Ganzpflanzenbeziehungsweise<br />
Grassilage, Zuckerrüben,<br />
Landschaftspflegematerial und Zwischenfrüchte<br />
als Substrate in Biogasanlagen<br />
eingesetzt. Neben einer ganzen Reihe verschiedener<br />
alternativer ein- und mehrjähriger<br />
Energiepflanzen spielen vor allem alternative<br />
Fruchtfolgen eine wichtige Rolle.<br />
Biogas Journal: Welche Möglichkeiten gibt<br />
es seitens des Landes, diese Alternativen<br />
zu fördern?<br />
Habeck: In Schleswig-Holstein experimentieren<br />
Landwirte mit Biogasanlagen zumeist<br />
auf eigene Kosten und eigenes Risiko sowohl<br />
mit neuen Kulturpflanzen, wie der Silphie,<br />
als auch auf größeren Flächenanteilen<br />
mit bewährten Alternativen, wie Ackergras.<br />
Die Ergebnisse von Verbundvorhaben zeigen,<br />
dass insgesamt vor allem regionaltypische<br />
und standortspezifische Fruchtfolgen<br />
besonders positiv abschneiden. Arten- und<br />
Sortenwahl, Anbauverfahren und Verwertungsmöglichkeiten<br />
müssen zu den naturräumlichen<br />
Unterschieden passen.<br />
Das Land hilft den Landwirten vor allem<br />
bei der Suche nach Alternativen. Wir informieren<br />
beispielsweise über (Bundes-)<br />
Förderprogramme, bieten eigene und Kooperationsveranstaltungen<br />
an und arbeiten<br />
mit dem Kompetenzzentrum Erneuerbare<br />
Energien und Klimaschutz Schleswig-<br />
Holstein (EEK.SH) eng zusammen. Darüber<br />
hinaus haben wir in der Vergangenheit<br />
den Fachverband Biogas bei der Suche<br />
nach geeigneten Versuchsflächen beziehungsweise<br />
bei der Kooperation mit der<br />
Landwirtschaftskammer und dem EEK.<br />
SH sowohl für alternative Pflanzen wie Gräser,<br />
Wildkräuter und Blühstreifen als auch<br />
Untersaaten wie Kleegras für Fruchtfolgen<br />
unterstützt.<br />
Biogas Journal: Sie haben im Koalitionsvertrag<br />
das Projekt Power-to-Feed definiert.<br />
Was ist das?<br />
Habeck: Unsere Idee ist es, im Umkreis einer<br />
oder mehrerer Biogasanlagen mit freien<br />
Kapazitäten der Wärmenutzung eine Modellregion<br />
„Power-to-Feed – Luzerne-SH“<br />
zu etablieren. Ziel ist, dort die Fruchtfolgen<br />
zu erweitern und so sowohl alternative Substrate<br />
für Biogasanlagen als auch für die<br />
Milchviehfütterung zu gewinnen.<br />
Biogas Journal: Und wo wird die Modellregion<br />
sein?<br />
Habeck: Ich bitte um Verständnis, dass wir<br />
derzeit noch keine konkreten Angaben zur<br />
Auswahl oder zur Abgrenzung der Modellregion<br />
machen können, da wir uns zunächst<br />
intern sowohl über die Kriterien als auch<br />
das Auswahlverfahren und die Finanzierung<br />
beraten müssen. Wir streben an, in<br />
diesem Jahr zumindest eine grobe Konzeption<br />
zu erarbeiten, an der wir ausgewählte<br />
Fachleute aus Praxis und Wissenschaft beteiligen<br />
wollen.<br />
Biogas Journal: Herr Habeck, vielen Dank<br />
für das Gespräch!<br />
Interviewer<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
23
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Foto: Fotolia_fotoman1962<br />
24
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
Emissionsminderung:<br />
Luftqualität im Fokus<br />
Gasmotor- und Zündstrahl-Blockheizkraftwerke weisen ein unterschiedliches Emissionsverhalten<br />
auf. Fakt ist, dass rechtsverbindliche Emissionsgrenzwerte eingehalten werden<br />
müssen. Der Autor erörtert die Anforderungen.<br />
Von Alexander Fiedler<br />
Seit dem Inkrafttreten des „Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetzes“ (EEG) im Jahr 2000<br />
wird die Erzeugung von Strom aus Biogas<br />
vergütet. Von zentraler Bedeutung war von<br />
Anfang an die Biogasverwertung in Verbrennungsmotoren.<br />
Waren die ersten Motorengenerationen<br />
oft umgebaute Dieselmotoren, entwickelten<br />
sich die folgenden Modellreihen zu Gasmotoren mit<br />
höheren elektrischen Wirkungsgraden. Die Abgasgesetzgebung<br />
hingegen hat sich während dieses innovativen<br />
Zeitraums seit der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift<br />
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG), der „Technischen Anleitung zur Luftreinhaltung“<br />
(TA Luft) aus dem Jahr 2002, nicht mehr verändert.<br />
Deshalb stellt sich die Frage, ob aus Sicht der<br />
Luftreinhaltung neue Akzente gesetzt werden sollten.<br />
Die Beantwortung dieser Frage soll zuerst am Beispiel<br />
der Emissionsrelevanz der nach BImSchG genehmigungsbedürftigen<br />
Energieerzeugungsanlagen in Bayern<br />
verdeutlicht werden.<br />
Feuerungswärmeleistung bestimmt<br />
über BImSchG-Genehmigungspflicht<br />
der Biogasmotoranlage<br />
Nach §4 des BImSchG sind genehmigungsbedürftige<br />
Anlagen vor allem solche, die in besonderer Weise geeignet<br />
sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen.<br />
Diese Anlagen sind im Anhang 1 der 4. Verordnung<br />
zum BImSchG aufgeführt. Im Anhang 1 sind diese sehr<br />
unterschiedlichen Anlagenarten in zehn Obergruppen<br />
aufgeteilt. Im Herbst 2017 waren in Bayern zehntausend<br />
nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen<br />
registriert.<br />
Die größte Obergruppe Nr. 8 zur „Verwertung und<br />
Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen“<br />
umfasst 31 Prozent der Anlagen. Hierin sind etwa<br />
300 Biogaserzeugungsanlagen mit Gülleeinsatz enthalten,<br />
die mindestens eine Produktionskapazität<br />
von 1,2 Millionen Normkubikmeter Rohgas je Jahr<br />
aufweisen, deren Biogasmotoranlage jedoch noch<br />
nicht genehmigungsbedürftig ist. Erreicht die Biogasmotoranlage<br />
eine Feuerungswärmeleistung von<br />
1 Megawatt (MW) oder überschreitet sie diese, wird<br />
die Genehmigungspflicht nach Ziffer 1.2.2.2 des<br />
Anhangs 1 der 4. BImSchV ausgelöst. Diese Biogasmotoranlagen<br />
stellen mit über 800 genehmigungsbedürftigen<br />
Anlagen in Bayern in der Obergruppe<br />
Nr. 1 „Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie“ die<br />
bedeutendste Anlagenart dar. Mit etwa 250 Anlagen<br />
zählen die meist im Stadtwerksbereich eingesetzten<br />
Erdgas- und Dieselmotoren zu den weiteren<br />
dezentralen Energieerzeugungsanlagen. In diesem<br />
Zusammenhang komplettieren die 200 eigenständig<br />
genehmigungspflichtigen Holzfeuerungsanlagen<br />
diese Obergruppe der 4. BImSchV, die 20 Prozent der<br />
gesamten nach BImSchG genehmigungsbedürftigen<br />
Anlagenzahl in Bayern aufweist.<br />
25
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aus dieser Übersicht kann geschlossen<br />
werden, dass die Energiewende mit ihrem<br />
dezentralen Energieerzeugungsansatz bereits<br />
fest in Bayern verankert ist. Erwähnenswert<br />
für die Energieerzeugung sind<br />
noch die ebenfalls der Obergruppe Nr. 1<br />
zugeordneten 51 Großkraftwerke in Bayern<br />
mit einer Feuerungswärmeleistung von 50<br />
MW oder mehr.<br />
NO x<br />
-Mengen der<br />
Emissionserklärungen 2016<br />
Bei den Luftschadstoffen sind derzeit durch<br />
die Diskussion der Immissionssituation an<br />
stark durch den Güter- und Individualverkehr<br />
belasteten Straßenabschnitten in<br />
Großstädten die gesundheitsschädlichen<br />
Stickstoffdioxide (NO 2<br />
) in den Mittelpunkt<br />
gerückt worden. Bei den stationären Anlagen<br />
wird die Luftreinhaltepolitik mit länderspezifischen<br />
Zielsetzungen nach Auswertung<br />
der von der Emissionserklärungspflicht<br />
gemäß 11. BImSchV betroffenen genehmigungsbedürftigen<br />
Anlagen entwickelt.<br />
Die Emissionserklärungen müssen alle vier<br />
Jahre abgegeben werden. Das Bayerische<br />
Landesamt für Umwelt hatte im Oktober<br />
2017 etwa 90 Prozent der im Jahr 2016<br />
erklärungspflichtigen Anlagen ausgewertet.<br />
Alle relevanten genehmigungsbedürftigen<br />
Anlagen emittierten demnach in<br />
Bayern 36.448 Tonnen (t) Stickstoffoxide<br />
(NO x<br />
) pro Jahr (a). Davon verursachten<br />
die 51 Großkraftwerke 7.232 t/a, die<br />
Die dauerhafte Einhaltung des Emissionsgrenzwertes von 0,50 Gramm (g) pro Kubikmeter (m³) NO x<br />
als NO 2<br />
–<br />
Bezugssauerstoffgehalt 5 Prozent – bei Biogasmotoren mit Fremdzündung aus Luftreinhaltegesichtspunkten<br />
ist dringend erforderlich.<br />
Biogas-, Klärgas-, Holzfeuerungsanlagen<br />
sowie die aufgeführten Erdgas- und Dieselmotoren<br />
11.262 t/a NO x<br />
. Alleine die<br />
genehmigungsbedürftigen Biogasmotoren<br />
emittierten hiervon nach derzeitigem Auswertungsstand<br />
über 5.000 t NO x<br />
im Jahr<br />
2016.<br />
Zu beachten ist, dass in Bayern nach aktuellen<br />
Erhebungen der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft insgesamt<br />
2.440 Biogasanlagen betrieben werden<br />
und folglich etwa 1.500 nach BImSchG<br />
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei<br />
dieser Erhebung noch nicht berücksichtigt<br />
werden. Diese Zahlen verdeutlichen, dass<br />
die dauerhafte Einhaltung des Emissionsgrenzwertes<br />
von 0,50 Gramm (g) pro Kubikmeter<br />
(m³) NO x<br />
als NO 2<br />
– Bezugssauerstoffgehalt<br />
5 Prozent – bei Biogasmotoren<br />
mit Fremdzündung aus Luftreinhaltegesichtspunkten<br />
dringend erforderlich ist.<br />
Deshalb hat das Bayerische Staatsministerium<br />
für Umwelt und Verbraucherschutz<br />
entsprechende Projekte initiiert.<br />
Oberstes Ziel ist eine dauerhaft sichere<br />
Einhaltung des Tagesmittelwertes von<br />
0,50 g/m³ NO x<br />
als NO 2<br />
im bestimmungsgemäßen<br />
Betrieb der Biogasmotoren auch<br />
zwischen den Emissionsmessungen nach<br />
§ 28 BImSchG. Diese Messungen finden<br />
nach TA Luft 2002 im dreijährigen Rhythmus<br />
statt. Da aber viele Biogasmotoranlagen<br />
den im EEG 2009 eingeführten<br />
Foto: Fotolia_Countrypixel<br />
Emissionsminderungsbonus für Formaldehyd<br />
in Anspruch nehmen, finden hier<br />
die Emissionsmessungen im jährlichen<br />
Rhythmus statt.<br />
Untersuchungen des Landesamtes für<br />
Umwelt und im Rahmen von anderen Forschungsprojekten<br />
haben jedoch gezeigt,<br />
dass der vom Betreiber der Biogasmotoranlagen<br />
auch im Dauerbetrieb in der Zwischenzeit<br />
während der Emissionsmessungen<br />
einzuhaltende Tagesmittelwert von<br />
0,50 mg/m³ NO x<br />
als NO 2<br />
nicht immer sichergestellt<br />
ist. Dies liegt vor allem an den<br />
emissionscharakteristischen Zusammenhängen<br />
beim Betrieb von Biogasmotoren.<br />
In der Regel werden bei einer „fetteren“<br />
Zusammensetzung des Biogas-/Luftgemisches<br />
– das heißt weniger Verbrennungsluftüberschuss<br />
– höhere elektrische Leistungen<br />
erzielt. In diesem Betriebspunkt<br />
steigen wegen der höheren Verbrennungstemperaturen<br />
auch die Emissionen von<br />
thermischen NO x<br />
an. Folgerichtig ist die<br />
Höhe der maximalen elektrischen Leistung<br />
durch die im Genehmigungsbescheid verpflichtend<br />
gegenüber dem Anlagenbetreiber<br />
festgelegten Emissionsgrenzwerte an<br />
NO x<br />
als NO 2<br />
limitiert.<br />
Bayerisches Umweltministerium<br />
untersucht Alternativen<br />
Da diese Emissionen nicht mit verhältnismäßigem<br />
Aufwand quantitativ kontinuierlich<br />
ermittelt werden können und dies auch<br />
auf eine weitere Verkürzung des Jahreszyklus<br />
der Emissionsmessung der zugelassenen<br />
Messstellen nach § 29b BImSchG zutrifft,<br />
werden im erwähnten Projekt des Bayerischen<br />
Umweltministeriums deshalb weniger<br />
aufwendige qualitative Kontrolleinrichtungen<br />
zur Einhaltung der Betreiberpflichten<br />
nach § 5 BImSchG untersucht.<br />
Ein erfolgversprechender Lösungsansatz ist<br />
der Rückgriff auf die im mobilen Bereich<br />
bewährte NO x<br />
-Sensortechnik. Sowohl die<br />
im Motorprüfstand durchgeführten systematischen<br />
Untersuchungen als auch die<br />
Auswertung der im Feldversuch erzielten<br />
Ergebnisse werden voraussichtlich noch in<br />
diesem Halbjahr die Bewertung der technischen<br />
Eignung dieser dauerhaften Emissionskontrolle<br />
ermöglichen. Flankiert werden<br />
diese Untersuchungen durch betriebswirtschaftliche<br />
Rechenmodelle, die für den<br />
Anlagenbetreiber die zu erwartenden Gesamtkosten<br />
der beschriebenen einfachen,<br />
qualitativen Messeinrichtung, zum Beispiel<br />
26
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
in Anhängigkeit der Motorengröße, Wartungskosten<br />
oder der Nachrüstmöglichkeit<br />
an bestehenden Anlagen, darstellen. Erst<br />
wenn diese Ergebnisse vorliegen, kann aus<br />
Sicht des Autors eine belastbare Entscheidung<br />
getroffen werden, ob eine Aufnahme<br />
von qualitativen Messeinrichtungen im gesetzlichen<br />
Regelwerk dem Stand der Technik<br />
entsprechend geboten erscheint. Wenn<br />
der Fokus alleine auf die maximal erreichbare<br />
elektrische Leistung eines Biogasmotors<br />
gelegt wird, müssen Wege gefunden werden,<br />
die limitierende motorische Einhaltung der<br />
NO x<br />
-Emissionen durch eine nachgeschaltete<br />
Abgasreinigungseinrichtung zu lösen. Der<br />
zweite Teil des Projektes zur Reduzierung<br />
der NO x<br />
-Emissionen untersucht daher die<br />
dauerhafte Funktionsfähigkeit eines SCR-<br />
Katalysators an einem Biogasmotor. Ende<br />
Januar <strong>2018</strong> erfolgte die Inbetriebnahme<br />
des an einer neuen Biogasmotoranlage aufgebauten<br />
Abgasreinigungssystems.<br />
In den folgenden drei Jahren werden intensive<br />
Untersuchungen zu den erzielbaren<br />
Emissionsminderungspotenzialen an NO x<br />
als NO 2<br />
in Abhängigkeit von den Kosten für<br />
Ad-Blue und der erzielbaren höheren elektrischen<br />
Leistung durchgeführt. Sollte die Gesamtbewertung<br />
die grundsätzliche Eignung<br />
dieser Technik bestätigen, wären in Summe<br />
NO x<br />
-Minderungen innerhalb eines Jahres zu<br />
erreichen wie an keiner weiteren Anlagengruppe<br />
der 4. BImSchV. Untersucht wird<br />
auch die Möglichkeit von direkt verfügbaren<br />
pflanzenschädlichen Ammoniakemissionen<br />
durch eine Überdosierung von Ad-Blue sowie<br />
die Begrenzung der klimaschädlichen<br />
Gesamt-C-Emissionen, die im Wesentlichen<br />
aus unverbrannten Methanemissionen bestehen.<br />
Diese Emissionen stellen nach der in der VDI<br />
3475 Blatt 4 vom August 2010 angestoßenen<br />
Reglementierung der Methanemissionen<br />
aus nicht abgedeckten Substratlagern<br />
bei Biogasanlagen die relevanteste anlagentechnische<br />
Quelle klimaschädlicher Gase<br />
im bestimmungsgemäßen Betrieb von Biogasanlagen<br />
dar.<br />
Niedrigere Formaldehyd-<br />
Grenzwerte<br />
Gleichzeitig wird durch den Einsatz der<br />
SCR-Technik und mit den damit bei der Verbrennung<br />
höheren NO x<br />
-Rohgasemissionen<br />
eine deutlich messbare positive Beeinflussung<br />
der Formaldehyd-Rohgasemissionen<br />
erwartet. Da Formaldehyd durch die EU-<br />
Foto: Fotolia_Wolfgang Jargstorff<br />
Nach der Einführung der „Vollzugsempfehlung Formaldehyd“ vom 9. Dezember 2015 durch die „Bund/Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz“ (LAI) ist bei bestehenden Biogasmotoranlagen in Abhängigkeit<br />
vom Ergebnis der Einstufungsmessungen seit 15. Februar <strong>2018</strong> beziehungsweise ab 15. Februar 2019 eine<br />
Emissionsbegrenzung von 30 mg/m³ Formaldehyd einschlägig.<br />
Kommission ab 1. Januar 2016 als „wahrscheinlich<br />
beim Menschen karzinogen“<br />
eingestuft wurde, ist derzeit neben dem auf<br />
oxidativer Basis arbeitenden Thermoreaktor,<br />
der die Formaldehyd- und Methanemissionen<br />
auf ein Minimum reduziert, aber die<br />
NO x<br />
-Emissionen nicht vermindern kann, der<br />
Oxidationskatalysator die dem Stand der<br />
Technik entsprechende Abgasreinigungstechnik.<br />
Nach der Einführung der „Vollzugsempfehlung<br />
Formaldehyd“ vom 9. Dezember<br />
2015 durch die „Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft<br />
Immissionsschutz“ (LAI) ist<br />
bei bestehenden Biogasmotoranlagen in<br />
Abhängigkeit vom Ergebnis der Einstufungsmessungen<br />
seit 15. Februar <strong>2018</strong><br />
beziehungsweise ab 15. Februar 2019 eine<br />
Emissionsbegrenzung von 30 mg/m³ Formaldehyd<br />
einschlägig. Zusätzlich ist für Biogasanlagen,<br />
die bisher den im EEG 2009<br />
eingeführten Emissionsminderungsbonus<br />
für Formaldehyd in Höhe von 40 mg/m³ in<br />
Anspruch nehmen, ab 1. Juli <strong>2018</strong> der fortgeschriebene<br />
Emissionsminderungsbonus<br />
von 20 mg/m³ maßgebend.<br />
Auch hier steht die dauerhafte Einhaltung<br />
des Emissionsgrenzwertes im Vordergrund.<br />
Deshalb ist eine klare Tendenz hin zur Gasaufbereitung<br />
erkennbar, um Katalysatorgifte<br />
sicher abzuscheiden. Hier stellt der diskontinuierliche<br />
Betrieb der Motoranlagen bei<br />
der bedarfsgerechten Stromerzeugung eine<br />
weitere Herausforderung nicht nur an die<br />
Gasaufbereitungsanlagen dar. Angesichts<br />
der Tatsache, dass in Bayern im Jahr 2016<br />
die zum 16. Oktober 2017 ermittelten<br />
Formaldehydemissionen von 407 t zu über<br />
der Hälfte mit 218 t von den Biogasmotoranlagen<br />
und der überschaubaren Anzahl<br />
von Klärgasmotoren emittiert wurden, ist<br />
diese weitere Reduzierung aus Sicht der<br />
Luftreinhaltung nachvollziehbar und auch<br />
erforderlich.<br />
Zusammenfassend muss konstatiert werden,<br />
dass seit Entstehung der Biogasbranche erhebliche<br />
technische Anstrengungen an den<br />
Biogaserzeugungsanlagen unternommen<br />
wurden, um die gesamtökologische Bewertung<br />
von Biogasanlagen zu optimieren. Gelingt<br />
es, im Bereich der Biogasmotoranlagen<br />
zukünftig auch noch entscheidende Akzente<br />
unter Luftreinhaltegesichtspunkten zu setzen,<br />
wird diese dezentrale Form der Energieerzeugung<br />
ihre Position als wichtige Säule<br />
der Stromerzeugung ausbauen können.<br />
Autor<br />
Alexander Fiedler<br />
Umweltschutzingenieur<br />
Referent für Energieerzeugungsanlagen<br />
im Referat 75 Luftreinhaltung<br />
und Anlagensicherheit<br />
Bayerisches Staatsministerium für<br />
Umwelt und Verbraucherschutz<br />
27
Der Grundkörper eines<br />
Katalysators mit seinen<br />
zahlreichen Kanälen –<br />
auch als Substrat oder<br />
Matrix bezeichnet –<br />
entstand hier durch das<br />
Aufrollen von gewelltem<br />
und glattem Edelstahlblech<br />
in wechselnden Lagen.<br />
Abgasreinigung bleibt ein<br />
heißes Thema<br />
Foto: Carmen Rudolph<br />
Die lange angekündigten Verschärfungen der Grenzwerte bei den Emissionen von Biogas-<br />
BHKW sind nach wie vor nicht beschlossen. Packager, OEMs und Kat-Produzenten stellen<br />
sich aber auf deutlich höhere Anforderungen an die Abgasnachbehandlung ein. Auch<br />
Anlagenbetreiber sollten das Thema im Blick behalten.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Durch die Beschichtung<br />
der Matrix mit dem<br />
Washcoat vergrößert<br />
sich die Oberfläche des<br />
Katalysators um ein<br />
Vielfaches.<br />
Viele beklagen die schleppende Regierungsbildung.<br />
Doch manchmal ist es ganz gut,<br />
wenn es in der Politik nicht so schnell geht.<br />
Die gesetzliche Regelung zur Abgasreinigung<br />
von Biogas oder Biomethan betriebenen<br />
Blockheizkraftwerken ist so ein Fall, zumindest aus<br />
Sicht der Anlagenbetreiber, die dadurch für die Nachrüstung<br />
etwas mehr Zeit gewinnen. An Brisanz hat das<br />
Thema allerdings nicht verloren. Denn die diskutierten<br />
und um die Kennziffer Gesamtkohlenstoff (C ges<br />
) erweiterten<br />
Grenzwerte bei der Abgasreinigung bleiben trotz<br />
technischem Fortschritt weiterhin anspruchsvoll.<br />
Unabhängig von der noch laufenden TA-Luft-Novelle<br />
hat die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Imissionsschutz<br />
(LAI) bereits auf die Neueinstufung von Formaldehyd<br />
reagiert und zwei neue Vollzugsempfehlungen<br />
veröffentlicht.<br />
Demnach erhalten BHKW-Betreiber bereits ab dem<br />
1. Juli <strong>2018</strong> den sogenannten Luftreinhaltebonus in<br />
Höhe von 1 Cent/kWh, wenn die Motoren einen Emissionswert<br />
für Formaldehyd von 20 Milligramm einhalten.<br />
Einstellen muss sich die Branche zudem auf behördliche<br />
Überprüfungen ohne Voranmeldung, wie dies bereits<br />
in einigen Bundesländern praktiziert wird, oder sogar<br />
auf kontinuierliche Messungen der Emissionswerte<br />
und deren Aufzeichnung mittels versiegeltem und für<br />
die Kontrolleure frei zugänglichem Datenlogger.<br />
Foto: Interkat<br />
Magermotoren erschweren Abgasreinigung<br />
Die besonderen Herausforderungen bei der Abgasreinigung<br />
von BHKW-Motoren in Biogasanlagen entstehen<br />
aus dem verwendeten Kraftstoff als auch aus der<br />
eingesetzten Verbrennungstechnologie. Biogas ist ein<br />
undefinierter Brennstoff mit wechselnder Qualität und<br />
entsprechend unruhiger Verbrennung. Es enthält Begleitstoffe<br />
wie Schwefel und Silicium, die – wie später<br />
28
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
erläutert wird – als Katalysatorgift wirken. Eine Belastung<br />
für Systeme zur Abgasnachbehandlung (AGN) ist<br />
überdies Motorenölasche. Die Partikel bleiben teilweise<br />
haften und behindern so den Kontakt zwischen Abgasstrom<br />
und Katalysatorschicht.<br />
Die Mehrzahl der Aggregate im Bereich Bio-, Klär- und<br />
Deponiegas sind Magermotoren. Sie arbeiten mit Luftüberschuss,<br />
um einen höheren elektrischen Wirkungsgrad<br />
des BHKW zu erzielen. Demgegenüber wird bei<br />
Lambda-1-Maschinen, die zum Beispiel als Ottomotor<br />
in Mikro-Erdgas-BHKW für Einfamilienhäuser, teilweise<br />
aber auch in höheren BHKW-Leistungsklassen<br />
arbeiten, das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (Lambda) so<br />
eingestellt, dass im Brennraum stets genau die Menge<br />
an Sauerstoff vorhanden ist, die der Kraftstoff für die<br />
komplette Verbrennung benötigt.<br />
Da demzufolge die Abgase keinen Sauerstoff enthalten,<br />
ermöglicht dies die gleichzeitige Überführung von Kohlenmonoxid,<br />
Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen,<br />
also auch Formaldehyd, im 3-Wege-Kat in ungefährliche<br />
Bestandteile. Den Sauerstoff für die Oxidation<br />
liefert das NO x<br />
, das sich dabei in Stickstoff wandelt.<br />
Dagegen befinden sich im Abgas der überwiegend eingesetzten<br />
Magermotoren noch etwa 8 Prozent Restsauerstoff.<br />
Dieser lässt sich zwar im Oxidationskatalysator<br />
(Oxi-Kat) für die Umwandlung von Kohlenmonoxid<br />
und Kohlenwasserstoffen in CO 2<br />
und Wasser nutzen.<br />
Die Entfernung der Stickoxide erfordert jedoch eine<br />
nachgeschaltete selektive katalytische Reduktion<br />
(SCR-Kat). Dies ist bislang häufig jedoch nicht nötig,<br />
da sich die NO x<br />
-Grenzwerte der gültigen TA Luft bei<br />
vielen Motortypen über entsprechende Einstellungen<br />
einhalten lassen.<br />
Dabei geht man einen Kompromiss ein. Denn je mehr<br />
NO x<br />
-Emissionen ein Motor erzeugt, desto effizienter<br />
arbeitet er, das heißt mit weniger Gas bei gleicher Leistung.<br />
Durch die Einstellung wird eine geringe Minderung<br />
des Wirkungsgrades in Kauf genommen, um sich<br />
die Installation eines SCR-Katalysators zu ersparen.<br />
An großen Aggregaten ist das relativ problemlos realisierbar.<br />
Kleinere Motoren laufen bei niedrig geregelten<br />
NO x<br />
-Emissionen unruhiger. Es kommt zu Zündaussetzern<br />
und erhöhtem Zündkerzenverschleiß. In solchen<br />
Fällen kann die Entscheidung für eine höhere NO x<br />
-<br />
Emission und damit einen besseren Wirkungsgrad in<br />
Kombination mit einer SCR-Abgasreinigung zur Einhaltung<br />
der Grenzwerte wirtschaftlich sinnvoll sein.<br />
Eine Besonderheit in deutschen Biogasanlagen sind<br />
die Zündstrahlmotoren. Ihnen räumt die TA Luft höhere<br />
CO- und NO x<br />
-Grenzwerte ein. „In einer EU-harmonisierten<br />
Regelung wird es diesen Sonderstatus nicht<br />
mehr geben. Die neuen Emissionsvorgaben sind mit<br />
der Zündstrahltechnik aber nicht zu schaffen, da bei<br />
der Verbrennung des eingespritzten Biodiesels zu hohe<br />
NO x<br />
-Werte entstehen“, sagt Motorenentwickler Hans-<br />
Jürgen Schnell. Daher konzipiert er gemeinsam mit<br />
einem Kat-Spezialisten für die rund 3.000 in Betrieb<br />
Foto: Carmen Rudolph<br />
Fotos: Werkfoto Foto: DCL<br />
Wie eine Schublade lässt sich diese<br />
Katalysatormatrix von Air-Sonic für die<br />
Reinigung aus dem Gehäuse entnehmen<br />
und wieder einstecken.<br />
befindlichen Zündstrahlaggregate einen Umrüstsatz,<br />
zu dem bei Bedarf auch ein dafür zugeschnittener Oxi-<br />
Kat gehört.<br />
Überhaupt nutzt ein Kat von der Stange wenig. Die<br />
genaue Abstimmung des Materials auf die für den<br />
Motorentyp spezifische Abgastemperatur und des<br />
Kat-Volumens auf den Abgasmassestrom bestimmen<br />
maßgeblich die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer<br />
der Abgasreinigung. Der bei allen Gasmotoren unvermeidliche<br />
Methanschlupf im Abgas lässt sich bei einer<br />
Überschreitung des in der künftigen TA-Luft-Novelle<br />
Katalysator für Formaldehyd-<br />
Rohemissionen von 75 mg/Nm³ der<br />
Firma Emission Partner. Der Einsatz<br />
mit schwefeltoleranter Beschichtung<br />
kann über zwei Spannringe gewechselt<br />
werden.<br />
Mit dem Schnellwechselsystem<br />
„Quick Lid“ von<br />
DCL können Betreiber<br />
und Serviceunternehmen<br />
den Katalysator an<br />
veränderte Emissionsanforderungen<br />
anpassen,<br />
etwa durch ein weiteres<br />
oder in der Zelldichte<br />
anderes Element.<br />
Katalysatoreinsatz von<br />
Air-Sonic mit kundenspezifischen<br />
Druckbügeln, die das<br />
Substrat an eine Dichtfläche<br />
pressen.<br />
29
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Foto: Emission Partner<br />
Foto: Aprovis<br />
Die für Neuanlagen konzipierte Abgasnachbehandlung „Emission<br />
Blue“ benötigt mehr Bauraum, ist aber schwefelresistent, da als<br />
Katalysator kein Edelmetall verwendet wird.<br />
Mit einer regenerativ-thermischen Nachverbrennung lassen sich<br />
die Emissionsgrenzwerte bei Kohlenmonoxid, Formaldehyd und<br />
Methanschlupf dauerhaft einhalten.<br />
Selektive katalytische<br />
Reduktion (SCR)<br />
zur Entfernung von<br />
Stickoxiden auf dem<br />
Container eines<br />
Biogas-BHKW.<br />
voraussichtlich eingeführten Grenzwertes von 1 g/Nm³<br />
nur durch eine Nachverbrennungsanlage eliminieren.<br />
Washcoat bestimmt das Alterungsverhalten<br />
BHKW-Abgasreinigungssysteme bestehen grundsätzlich<br />
aus einem Edelstahlgehäuse, in dem sich eine<br />
metallische oder keramische Matrix befindet. Sie ist<br />
als Kreuzgitter oder wabenförmig gestaltet. Fachleute<br />
sprechen vom Substrat. Solch eine Konstruktion<br />
entsteht zum Beispiel, wenn im Wechsel glattes und<br />
gewelltes Edelstahlblech zu einer Rolle aufgewickelt<br />
wird. Ziel ist es, den Abgasen beim Durchströmen der<br />
Kanäle eine möglichst große Reaktionsfläche zu bieten.<br />
Sind Well- und Glattlagen miteinander verlötet,<br />
können sie sich bei Verpuffungen und Druckstößen<br />
oder durch anhaltende Vibration nicht herausschieben<br />
(teleskopieren).<br />
Durch das Beschichten der Matrix mit dem sogenannten<br />
Washcoat, der eine extrem poröse Struktur hat, vergrößert<br />
sich diese Fläche noch einmal um ein Vielfaches.<br />
Ein Gramm des Titan- oder Aluminiumoxid basierten<br />
Washcoats erzeugt eine Fläche von bis zu 250 Quadratmetern<br />
(m²). Pro Liter Abgasvolumen stehen in einer<br />
Matrix 500 bis 2.000 m² zur Verfügung. Die Beschaffenheit<br />
des Washcoats mit den herstellerspezifischen<br />
Zuschlagstoffen (Dotierungen) hat entscheidenden<br />
Einfluss auf das Alterungsverhalten, die Haftfähigkeit<br />
und die Beständigkeit gegenüber Temperaturspitzen.<br />
Hier hüten die Kat-Hersteller die meisten Geheimnisse.<br />
Beim Oxi-Kat dient der Washcoat als Trägersubstanz<br />
für gleichmäßig verteilte, mikroskopisch kleine Cluster<br />
aus Edelmetall, meist Platin. Sie sind der eigentliche<br />
chemische Katalysator. Bei Abgastemperaturen von<br />
etwa 400 Grad Celsius (°C) sorgen die Platinmoleküle<br />
für eine Aufspaltung der Sauerstoff-<br />
Doppelbindungen in der Restluft der<br />
Abgase des Magermotors. Die Sauerstoffradikale<br />
stehen dann für die<br />
Oxidation von Kohlenmonoxid und<br />
Formaldehyd zu CO 2<br />
und Wasser zur<br />
Verfügung. Docken im Abgas enthaltene<br />
Schwefelmoleküle auf der Kat-<br />
Oberfläche an, ist dem Sauerstoff an<br />
dieser Stelle der Zugang verwehrt.<br />
Der Katalysator verliert zunehmend<br />
an Wirkung.<br />
SCR-Katalysatoren zur Entfernung<br />
der Stickoxide sind verfahrensbedingt<br />
deutlich größer, aber pro Liter<br />
Abgasvolumen auch preislich günstiger.<br />
In den Washcoat wird bei dieser<br />
Technologie nicht Edelmetall, sondern<br />
Vanadiumoxid als Aktivkomponente<br />
eingesetzt. Auf dem Weg zum<br />
gitterförmigen Katalysatorsubstrat<br />
Foto: IGS<br />
30
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
wird in das Abgas eine Harnstofflösung (bei Fahrzeug-<br />
Dieselmotoren als AdBlue bezeichnet) eingesprüht.<br />
Bei Temperaturen über 250 °C hydrolysiert Harnstoff<br />
zu CO 2<br />
und Ammoniak und homogenisiert sich idealerweise<br />
mit dem Abgasmassestrom. Trifft die Mischung<br />
auf den Reduktionskatalysator, reagiert das Ammoniak<br />
in der heißen Umgebung mit den Stickoxiden zu elementarem<br />
Stickstoff (N 2<br />
) und Wasser. Zu den technischen<br />
Herausforderungen beim SCR-System gehören<br />
die möglichst gleichmäßige Vermischung der Harnstofflösung<br />
mit dem Gasstrom und die Steuerung der<br />
Einspritzmenge je nach NO x<br />
-Anteil, der durch Umgebungseinflüsse,<br />
Motorverschleiß und andere Faktoren<br />
Schwankungen unterliegt. Zu wenig Harnstofflösung<br />
minimiert den Reinigungseffekt. Eine Überdosierung<br />
führt zu Ammoniakschlupf am Katalysator.<br />
Was eine BHKW-Abgasreinigung leisten muss, wird<br />
beim Vergleich mit dem Pkw deutlich. Fahrzeug-Katalysatoren<br />
haben eine Lebensdauer von 3.000 bis<br />
4.000 Stunden und erfüllen ihren Zweck somit selbst<br />
bei überdurchschnittlicher Nutzung über mehrere Jahre.<br />
Bei einem Kat am BHKW mit 8.000 Betriebsstunden<br />
würde dies bestenfalls für sechs Monate reichen.<br />
computergestütztes Strömungsdesign anpassen lassen.<br />
Besonders stolz ist man bei Emission Partner auf die<br />
Entwicklung der Abgasnachbehandlung „Emission<br />
Blue“ für Neuanlagen, zum Beispiel Flex-BHKW. „Das<br />
modular aufgebaute System benötigt zwar deutlich mehr<br />
Bauraum, arbeitet aber ohne Edelmetall und ist daher<br />
schwefelresistent. Dies ermöglicht die Einhaltung des<br />
neuen Formaldehydgrenzwertes von 20 mg/Nm 3 über<br />
eine Laufzeit von 16.000 Stunden oder drei Emissionsmessungen“,<br />
erläutert Geschäftsführer Dirk Goeman.<br />
Der Katalysator funktioniere bei den anliegenden Temperaturen<br />
und Strömungsgeschwindigkeiten wie ein<br />
Oxidations-Kat zur Beseitigung von Formaldehyd aus<br />
den Motorabgasen. Die Einfügung einer zusätzlichen<br />
Harnstoffdosierung zur weiteren Reduktion der Stickoxide<br />
sei möglich.<br />
Unterschiedliche Konzepte der Hersteller<br />
Die Hersteller von Katalysatoren reagieren auf die<br />
wachsenden Umweltanforderungen mit unterschiedlichen<br />
Konzepten:<br />
Die Interkat Catalyst GmbH in Königswinter (NRW)<br />
beschichtet Trägermaterialien mit katalytisch aktiven<br />
Materialien, zum Beispiel Edelmetallen. Aus diesen<br />
Katalysator-Substraten fertigen Packager, Motorenhersteller<br />
und Serviceunternehmen Katalysatorsysteme<br />
für verschiedenste Anwendungsbereiche. „Anders als<br />
im Automotive, wo es um Durchsatz und Stückzahlen<br />
geht, ist der Biogasmarkt in Bezug auf die Applikation<br />
wesentlich inhomogener und benötigt daher genau auf<br />
die Kunden abgestimmte Produkte“, weiß der in diesem<br />
Bereich verantwortliche Vertriebsleiter Kevin Zirpel.<br />
Dafür entwickelte das Unternehmen unterschiedliche<br />
Washcoat-Typen, die sich durch eine besonders hohe<br />
Schwefelresistenz, zum Teil bereits bei relativ niedrigen<br />
Abgastemperaturen, auszeichnen. „Bei richtiger<br />
Dimensionierung des Katalysatorvolumens zum Motor,<br />
regelmäßiger Wartung und gereinigtem Treibgas garantieren<br />
wir im Biogasbereich über 16.000 Stunden eine<br />
durchgehende Einhaltung der Grenzwerte“, sagt Zirpel.<br />
Das niedersächsische Unternehmen Emission Partner<br />
GmbH & Co. KG ist auf die Entwicklung, Fertigung und<br />
den Vertrieb von Katalysatoren für Gasmotoren spezialisiert.<br />
Dabei erfolgt die Fertigung von der Wicklung der<br />
Metallträger über die Beschichtung bis zum Zusammenbau<br />
der Systeme am Firmensitz in Saterland-Ramsloh.<br />
Für die Einhaltung der verschärften Grenzwerte bei Bestandsanlagen<br />
werden Nachrüstpakete angeboten, die<br />
sich den tatsächlichen Emissionen der Anlage sowie an<br />
den Motorentyp durch optimierte Kat-Volumen und ein<br />
Foto: Air-Sonic<br />
Die Air Sonic GmbH im hessischen Sinntal verwendet<br />
für die Fertigung einer breiten Palette an Katalysatoren-Bauformen<br />
gewellte und glatte Edelstahlfolien<br />
mit einer Stärke von 50 bis 80 µm. Beim Wickeln und<br />
Verlöten der Folien entstehen Zellen, die je nach Anforderung<br />
unterschiedlich groß sind. Um insbesondere<br />
im Biogasbereich eine bessere Alterungsstabilität zu<br />
erreichen, kommt bei der Beschichtung dieser Matrix<br />
nach Herstellerangabe ein Washcoat zum Einsatz,<br />
der bis zur doppelten Menge an Platin enthält, als am<br />
Markt üblich.<br />
„Bei derart auf Langlebigkeit ausgelegten Katalysatoren<br />
ist eine Reinigung von Ascheablagerungen wirtschaftlich<br />
besonders sinnvoll“, betont Technikchef<br />
Stefan Fröhlich. Hierzu habe Air Sonic zusammen mit<br />
einem Partner Langzeitversuche durchgeführt. Die<br />
Katalysatoren an den Biogasmotoren habe man regelmäßig<br />
gereinigt, und sie hätten über 48.000 Betriebsstunden<br />
eine gleichmäßige Leistung gezeigt. Fröhlich<br />
empfiehlt, die Katalysatorpflege mit der Reinigung des<br />
Wenn ein Katalysator<br />
nicht mehr funktioniert,<br />
sind die Edelmetalle<br />
trotzdem noch vorhanden.<br />
Diese können<br />
durch das Recycling<br />
wieder dem Stoffkreislauf<br />
zugeführt werden.<br />
31
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Interkat ist ein Spezialist<br />
für die Beschichtung<br />
von Trägermaterialien<br />
mit katalytisch<br />
aktiven Materialien.<br />
Für den Biogasbereich<br />
entwickelte das Unternehmen<br />
schwefelbeständige<br />
Washcoats.<br />
„Besonderen Wert legen<br />
wir auf die Qualität der<br />
Lot-Substrate aus einem<br />
Spezialstahl“<br />
Wärmetauschers zu verbinden. Einige Servicefirmen<br />
würden diese Leistung anbieten. „Verfügt das Katalysatorsystem<br />
über ein gedämmtes Einschubgehäuse, bei<br />
dem sich der Katalysator über eine Wartungsöffnung<br />
herausziehen lässt, ist eine Reinigung auch bei kurzen<br />
Motorstillstandszeiten praktizierbar“, so Fröhlich.<br />
Michael Kalb, Leiter Produktmanagement der Aprovis<br />
Energy Systems GmbH, einem Anlagenbauer im mittelfränkischen<br />
Weidenbach, geht davon aus, dass die<br />
Oxidationskatalysatoren größer dimensioniert werden<br />
müssen, um die verschärften Grenzwerte für Formaldehyd<br />
einhalten zu können. Voraussetzung, um bei den<br />
dafür notwendigen Anlagenanpassungen die technisch<br />
und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden, sei eine<br />
gute Abstimmung mit den Betreibern als auch den Kat-<br />
Herstellern. „Dazu gehört ein kompetenter Blick auf die<br />
Gesamtanlage, um mit einem neuen Katalysator nicht<br />
die Leistung des BHKW zu reduzieren,<br />
etwa durch zu hohen<br />
Thorsten Hohnemann<br />
Druckverlust“, so Kalb. Das<br />
gelte ebenso für die künftig sicher<br />
in vielen Fällen unabdingbaren<br />
SCR-Kats zur Einhaltung<br />
der NO x<br />
-Grenzwerte. Hier sei<br />
bei der Entscheidung für ein<br />
System auch der Betreuungsund<br />
Wartungsaufwand zu berücksichtigen<br />
als auch darauf<br />
zu achten, dass durch die Eindüsung<br />
von Harnstofflösung<br />
nicht andere Komponenten<br />
der Abgasanlage geschädigt<br />
werden.<br />
Die DCL Europe GmbH mit Sitz in Sulzbach am Taunus<br />
(Hessen) produziert auf einer automatisierten<br />
Fertigungslinie neben anderen Komponenten zur<br />
Emissionskontrolle ein breites Spektrum an Katalysatoren.<br />
„Besonderen Wert legen wir auf die Qualität der<br />
Lot-Substrate aus einem Spezialstahl. Sie sind nicht<br />
nur gegen hohe Temperaturen, sondern<br />
ebenso gegen mechanische Stöße<br />
extrem beständig und bieten unseren<br />
Kunden gleichzeitig eine kostengünstige<br />
Alternative zu den auf dem Markt angebotenen<br />
keramischen oder nichtgelöteten<br />
Metallsubstraten“, sagt Vertriebsleiter<br />
Thorsten Hohnemann. Angesichts der<br />
Förderung über den Formaldehydbonus<br />
von 1 Cent pro Kilowattstunde, was bei<br />
einer mittleren Anlage bis zu 40.000<br />
Euro bedeute, lohne sich in jedem Fall<br />
ein Katalysator, der eine kontinuierliche<br />
Einhaltung der Grenzwerte sichert und<br />
bei dem Betreiber unangemeldete Messungen<br />
nicht fürchten müssen.<br />
Unempfindlich gegenüber der Zusammensetzung<br />
und dem Schwefelgehalt<br />
des Biogases sind Anlagen zur regenerativ-thermischen<br />
Nachverbrennung, wie<br />
sie zum Beispiel die IGS Anlagentechnik<br />
GmbH & Co. KG im hessischen Gelnhausen<br />
entwickelt und fertigt. Diese Technik<br />
reduziert dauerhaft Kohlenmonoxid und<br />
alle Kohlenwasserstoffe, also auch Methan und Formaldehyd<br />
bis an die Grenze der Nachweisbarkeit.<br />
„In den meisten Fällen reichen bereits der Methanschlupf<br />
sowie das im Motor-Abgas enthaltene Kohlenmonoxid<br />
aus, um den Thermoreaktor nach dem Start<br />
autotherm zu betreiben, also ohne zusätzliche elektrische<br />
Beheizung oder Biogas-Eindüsung die Temperatur<br />
von 825 bis 850 °C im Reaktionsraum aufrechtzuerhalten“,<br />
argumentiert Geschäftsführer Gerd Schneider.<br />
Durch die energetische Umsetzung des Methanschlupfs<br />
von 800 bis 1.000 mg pro Nm³ heize sich das<br />
Gas bis zum Verlassen des Thermoreaktors sogar um<br />
weitere 20 bis 30 Grad auf. Diese zusätzliche thermische<br />
Energie könne im nachfolgenden Wärmetauscher<br />
genutzt werden. „Da kommen durchaus einige kW zusammen“,<br />
meint der Betriebschef.<br />
Foto: Werkfoto<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
32
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
Maissilage<br />
sicher handeln<br />
Geschäftsführer: Christian Scharnweber<br />
Handelsregister Schwerin HRB 3377<br />
GMP<br />
038852 + - B2 und GMP<br />
- + B4.1<br />
6040<br />
UST-Id-Nr.: DE 162151753<br />
Commerzbank AG, Schwerin<br />
Kreissparkasse Ludwigslust<br />
Raiffeisenbank Mölln e.G.<br />
Christian 038852 Scharnweber - 6040<br />
www.aat24.de<br />
Telefon: 038852 – 604 0<br />
Telefax: 038852 – 604 30<br />
E-mail: mail@aat24.de<br />
URL: www.aat24.de<br />
THERM<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
Nicht<br />
vergessen!<br />
Der Anzeigenschluss<br />
für die Ausgabe 3_<strong>2018</strong><br />
ist am 29. März<br />
BI<br />
GAS Journal<br />
an: «Faxnummer»<br />
Machen Sie mehr aus Ihrer Biogasanlage<br />
Installation und Reparatur von Pumpen,<br />
Rührwerken, Separatoren und Edelstahlbehältern.<br />
Als autorisierte Servicewerkstatt setzen wir auf<br />
hochwertige Komponenten unseres Partners<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
HARMS Systemtechnik GmbH · Alt Teyendorf 5 · 29571 Rosche<br />
Telefon: 0 58 03.98 72 77 · www.harms-system.de<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
+49 (0) 9932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
6. Februar 2013<br />
@F211«Faxnummer»@<br />
@F599@<br />
Ihre Spezialisten für Biogasmotoren<br />
Wir sind Motorspezialisten mit langjähriger Erfahrung<br />
im Biogas BHKW-Bereich. Unser Ziel: verbesserte<br />
Effizienz und Langlebigkeit von BHKW-Motoren unter vorausschauender<br />
Einhaltung von Umweltnormen.<br />
Wartung und Motoreninstandsetzung<br />
Wir bieten flexiblen, kundenorientierten Support einschließlich<br />
Notruf und schnelle Ersatzteillieferung – über 1.000 Artikel<br />
sind stets vorrätig.<br />
Sonderaktion<br />
Katalysatoren für<br />
Biogasmotoren<br />
Qualitativ hochwertige Katalysatoren<br />
mit einer Standzeit von nachweislich<br />
bis zu 8 Jahren.<br />
Langjährige Erfahrung in der<br />
Branche, siehe Seite …<br />
Umbau auf<br />
Passive Vorkammer<br />
Wir rüsten die Schnell BHKW BO Motoren auf Passive Vorkammer<br />
um. Langlebigkeit und Wirkungsgrad steigen, Emissionen,<br />
Unterhaltskosten und Ausfallzeiten sinken.<br />
Umbau des Mitshubishi 6R41.1B<br />
Durch eine Kombination von Hard- und Software erreichen<br />
wir Kompatibilität mit neuen Abgasnormen, größere Zuverlässigkeit<br />
und reduzierten Ölverbrauch.<br />
Stand 21.01.2009<br />
Umbau von Zündstrahlmotoren<br />
auf Gas-Otto mit Passiver Vorkammer<br />
Der Umbau auf Gas-Otto-Motoren mit Passiver Vorkammer<br />
sichert die Zukunftsfähigkeit Ihres BHKW bei verschärften<br />
Abgasnormen und spart Wartungskosten.<br />
33<br />
HJS MOTOREN GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Schnell, Spiesberg 20, D-88279 Amtzell, Telefon +49 (0)75 20 9 139 790, info@hjs-motoren.de
Hersteller arbeiten an<br />
sauberen BHKW<br />
Foto: Caterpillar Energy Solutions GmbH<br />
„Caterpillar Energy<br />
Solutions ist gut<br />
gewappnet und kann<br />
für die Verschärfung<br />
der Emissions-<br />
Grenzwerte seine<br />
Gasmotoren der Marken<br />
MWM und Cat mithilfe<br />
von innermotorischen<br />
Maßnahmen sowie<br />
entsprechenden Abgasnachbehandlungssystemen<br />
ausrüsten“,<br />
sagt Heinrich Baas,<br />
Leiter Vorentwicklung<br />
Systemtechnologien.<br />
Im Hinblick auf die zu erwartenden niedrigeren Grenzwerte für Emissionen von Biogas-<br />
BHKW stehen die Hersteller unter Zugzwang. Denn sie müssen technische Lösungen<br />
anbieten können, wenn die neuen Emissionswerte zur Pflicht werden. Die Herausforderung<br />
besteht auch darin, dass die BHKW wirtschaftlich betrieben werden können.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Die Emissionen von Biogas-BHKW müssen<br />
gesenkt werden – so viel steht fest. Das aktuell<br />
in Deutschland geltende Regelwerk<br />
für Emissionen von Biogasaggregaten wird<br />
derzeit überarbeitet. Dabei wird das europäische<br />
Recht in Form der MCP-Directive (Medium<br />
Combustion Plant Directive) in eine deutsche Verwaltungsvorschrift<br />
überführt. Angesichts der Umsetzung<br />
der europäischen MCP-Richtlinie in nationales Recht<br />
und der ursprünglich geplanten Überarbeitung der aktuell<br />
geltenden TA Luft erwarten die BHKW-Hersteller<br />
in Deutschland ein neues Regelwerk in Form einer<br />
BImSchV. Durch die Verzögerung bei der Bildung einer<br />
neuen Bundesregierung ist aber auch dieser Umsetzungsprozess<br />
ins Stocken geraten. So wird die Vorschrift<br />
voraussichtlich erst Ende des Jahres erlassen,<br />
wann sie in Kraft tritt, ist noch ungewiss. Peter Müller-<br />
Baum, Geschäftsführer des Arbeitskreises Abgasnachbehandlung<br />
im VDMA, kann Anlagenbetreiber jedoch<br />
beruhigen: „Nach dem uns heute bekannten Stand<br />
der künftigen BImSchV verbleiben die NO x<br />
-Grenzwerte<br />
für Biogasanlagen in allen Leistungsbereichen (ausgenommen<br />
Zündstrahler) auf dem Niveau der letzten TA<br />
Luft aus dem Jahr 2002. Damit ist hier weiterhin keine<br />
SCR-Technologie notwendig, sofern dies nicht noch im<br />
Zuge der ausstehenden Beratungen im Kabinett sowie<br />
Bundesrat und Bundestag geändert wird.“<br />
Formaldehyd im Fokus<br />
Aufgrund einer Neueinstufung hinsichtlich der Kanzerogenität<br />
von Formaldehyd wurden in den vergangenen<br />
Jahren die genehmigungsrechtlichen Grenzwerte für<br />
Biogas-BHKW abgesenkt. Grundsätzlich muss bei den<br />
Formaldehydgrenzwerten zwischen genehmigungsrechtlichen<br />
und vergütungsrechtlichen Anforderungen<br />
unterschieden werden:<br />
34
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
1. Genehmigungsrecht: Hier kommt die<br />
seit Dezember 2015 veröffentlichte<br />
LAI-Vollzugsempfehlung zur Anwendung,<br />
die eine gestufte Absenkung der<br />
Formaldehydgrenzwerte für Alt- und<br />
Neuanlagen vorsieht. Diese soll in die<br />
neue BImSchV übernommen werden.<br />
2. Luftreinhaltebonus (EEG): In einer<br />
weiteren LAI-Vollzugsempfehlung<br />
aus dem Herbst 2017 wird ein neuer<br />
Emissionswert für die Erstellung einer<br />
Bestätigung der zuständigen Behörden<br />
zur Gewährung des Luftreinhaltebonus<br />
definiert. Dieser soll nur noch gewährt<br />
werden, wenn Biogas-Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW) ab 1. Juli <strong>2018</strong> einen<br />
Formaldehyd-Emissionswert von 20<br />
Milligramm pro Kubikmeter (mg/m 3 )<br />
Abgas einhalten.<br />
Die ersten BHKW-Hersteller und natürlich<br />
auch die Komponentenhersteller, die sich<br />
mit Abgaskatalysatoren zur Oxidierung<br />
von Formaldehyd und zur Reduktion von<br />
Stickoxiden beschäftigen, stellen sich der<br />
Diskussion um die Abgaswerte, die Biogas-<br />
BHKW heute erzielen. Es geht zunächst<br />
um die Formaldehyd-Grenzwert-Festlegung<br />
für neue und bestehende Aggregate,<br />
die sich mit bezahlbarer Technik (Oxikats)<br />
umsetzen lässt, erläutert Michael Wentzke,<br />
Geschäftsführer der Interessengemeinschaft<br />
Biogasmotoren: „Und dabei nicht<br />
nur zum Prüfzeitpunkt die Grenzwerte<br />
einhalten, sondern für die zugesagte Nutzungsdauer<br />
von 12 bis 24 Monaten. Die<br />
Anbieter entwickeln hier mit der Zielsetzung,<br />
den Betreibern eine sichere Einhaltung<br />
der Grenzwerte zuzusagen. Diese lässt<br />
sich aber nur aufrechterhalten, wenn das<br />
Aggregat gemäß Herstellervorgabe gewartet<br />
und korrekt eingestellt ist. Bei dem im<br />
Markt vorherrschenden Biogasmotoren-Typ<br />
mit sehr magerem Gemisch (Lambda etwa<br />
1,7) ist dies mit Blick auf die Stickoxid-<br />
Emission zwingend notwendig.“<br />
Lernen von der Fahrzeugbranche<br />
Die Biogasbranche kann von der Fahrzeugbranche<br />
lernen. So ist der Zielkonflikt<br />
zwischen hohem Wirkungsgrad und geringer<br />
Stickoxid-Emission nur mit einem<br />
SCR-Katalysator mit Harnstoffeindüsung<br />
lösbar. Ein weiteres Abmagern des Gemisches<br />
(„kältere“ Verbrennung, geringere<br />
Stickoxidbildung) würde zu starken Zündaussetzern<br />
und einem steilen Anstieg unverbrannten<br />
Methans führen, so Wentzkes<br />
Einschätzung. Dies wäre weder unter dem<br />
Gesichtspunkt der Emissionen noch hinsichtlich<br />
eines akzeptablen Laufverhaltens<br />
der Motoren vertretbar.<br />
Auch bei den Stickoxiden (NO x<br />
) ist neben<br />
einer weiteren Reduzierung der Emissionswerte<br />
eine kontinuierliche Sicherstellung<br />
der neuen Vorgaben geplant. In Nutzfahrzeugen<br />
haben sich NO x<br />
-Sensoren in Verbindung<br />
mit SCR-Kat-Systemen bewährt,<br />
da damit der notwendige Harnstoff-Bedarf<br />
ermittelt und überwacht werden kann.<br />
Beim SCR-Verfahren, das in Nutzfahrzeugen<br />
und auch in Kraftwerken eingesetzt<br />
wird, erfolgt ein Einspritzen von Harnstoff<br />
in den heißen Abgasstrom. Ein Projekt wird<br />
gemeinsam mit der Firma Elektro Hagl an einem<br />
MAN-Gasmotor mit 550 Kilowatt (kW)<br />
elektrische Leistung auf einer Biogasanlage<br />
in Bayern betrieben. In dem Projekt spielen<br />
NO x<br />
-Sensoren eine wesentliche Rolle. Eine<br />
elektrochemische Zelle, über die ein Strom<br />
induziert wird, misst dabei die Konzentration<br />
im Gas. Ein NO x<br />
-Sensor sitzt vor dem<br />
SCR-Kat, ein zweiter dahinter.<br />
Damit soll kontrolliert werden, ob nicht zu<br />
viel Harnstoff eingedüst wurde. Das wäre<br />
an sich nicht schädlich, würde aber zu<br />
einer Geruchsbelästigung und weiteren<br />
Ammoniak-Emissionen führen. Vorteil des<br />
NO x<br />
-Sensors ist, dass er relativ preisgünstig<br />
ist. Eine Nachrüstung an vorhandenen<br />
Motoren ist nach Klaus Hagl´s Angaben<br />
möglich. Die Kosten beziffert er auf 2.000<br />
bis 5.000 Euro. Die NO x<br />
-Sensoren sind auf<br />
15 BHKW-Motoren im Praxiseinsatz, die<br />
ersten davon laufen bereits über ein Jahr.<br />
Optionen für günstige<br />
Nachrüstlösungen offenhalten<br />
Die BHKW-Hersteller arbeiten an einer<br />
wirtschaftlichen Lösung dieses Zielkonfliktes<br />
für Betreiber. Wenn der Gesetzgeber<br />
eine Verschärfung des Stickoxid-Grenzwertes<br />
beschließen wird, wovon Branchenspezialisten<br />
in den nächsten Jahren ausgehen,<br />
wird die SCR-Kat-Technologie im Fokus<br />
stehen. Wentzke: „Wer heute für die nächsten<br />
8 bis 10 Jahre investiert, tut sicher gut<br />
daran, gemeinsam mit Herstellern Handlungsoptionen<br />
für eine kostengünstige<br />
Nachrüstlösung zur Stickoxid-Reduzierung<br />
zu haben.“<br />
In der Nutzfahrzeugbranche gibt es hinreichende<br />
Betriebserfahrungen mit der<br />
Eindüsung von Harnstoff. Gasmotoren-<br />
35
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Das neue 450-kW-<br />
Aggregat vom MAN.<br />
Hersteller beschäftigen sich derzeit mit der Anpassung<br />
dieser Großserien-Technik. Ein Lösungskonzept sieht<br />
ein „mildes“ Mager-Motor-Konzept vor (Lambda etwa<br />
1,4), das aufgrund höherer Brennraumtemperaturen<br />
für einen Wirkungsgradgewinn und damit besseren<br />
Biogasverbrauch (rund 3 Prozent weniger) sorgt, der<br />
zum großen Teil die Kosten der eingespritzten Harnstoffmenge<br />
und SCR-Kats zur Stickoxidreduktion<br />
trägt.<br />
Für Betreiber bedeutet dies, mit ihrem BHKW-Lieferanten<br />
einen ausreichend großen Einbauraum zwischen<br />
Abgasturbolader und Abgaswärmetauscher vorzusehen,<br />
um später problemlos nachrüsten zu können.<br />
Schon heute sind ausreichend groß dimensionierte<br />
Kat-Gehäuse auf dem Markt erhältlich, die zunächst<br />
nur mit dem Oxi-Kat bestückt werden und einen einfachen<br />
späteren Ausbau mit den SCR-Elementen einschließlich<br />
der Harnstoffeindüsung ermöglichen.<br />
Flexbetrieb und das Emissionsverhalten der Motoren<br />
stehen in einem Wechselspiel. Denn durch das Heraufund<br />
Herunterfahren des Motors ändert sich auch das<br />
Emissionsverhalten. Die Warm-Kalt-Wechsel belasten<br />
den Katalysator. Gute Ergebnisse werden mit sauberem,<br />
temperiertem Biogas und einem hitzefesten Katalysator<br />
erzielt. Auf der einen Seite muss klar sein,<br />
welchen Fahrplan der Betreiber mit seinen Aggregaten<br />
zukünftig im Flexbetrieb fahren möchte, auf der<br />
anderen Seite sind die Peripherie-Aggregate (wie Biogasaufbereitung)<br />
ebenso zu warten und zu prüfen wie<br />
das Aggregat selbst, da ihr Zustand ganz wesentlich<br />
Einfluss auf die Funktion des BHKW und damit auch<br />
auf die Betriebskosten nimmt.<br />
Hersteller bereiten sich vor<br />
Die Verschärfung der Emissions-<br />
Grenzwerte für Gasmotoren-BHKW<br />
umfasst für den Biogas-Betrieb im<br />
Wesentlichen die Formaldehyd-<br />
Emissionen, die für Neuanlagen in<br />
zwei Schritten ab dem Jahr 2016<br />
auf 30 Milligramm pro Normkubikmeter<br />
(mg/Nm³) und ab 2020<br />
auf 20 mg/Nm 3 limitiert wurden.<br />
Für Anlagen, die den Emissionsbonus<br />
von 1 Eurocent nach dem EEG<br />
2009 erhalten, gilt eine Formaldehyd-Grenze<br />
von 20 mg/Nm 3 bereits<br />
ab 1. Juli <strong>2018</strong>.<br />
Heinrich Baas, Leiter Vorentwicklung<br />
Systemtechnologien bei Caterpillar<br />
Energy Solutions, sieht das<br />
Unternehmen gut gerüstet für die<br />
künftigen Anforderungen: „Caterpillar<br />
ist gut gewappnet und kann<br />
für die Verschärfung der Emissions-<br />
Grenzwerte seine Gasmotoren der<br />
Marken MWM und Cat mithilfe<br />
von innermotorischen Maßnahmen<br />
sowie entsprechenden Abgasnachbehandlungssystemen<br />
ausrüsten.“ Caterpillar forscht seit langem in<br />
verschiedenen Forschungsprojekten der Forschungsvereinigung<br />
Verbrennungsmaschinen (FVV) sowie dem<br />
Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ), auf<br />
eigenen Versuchs-Prüfständen und an Kundenanlagen<br />
im realen Betrieb an der weiteren Absenkung der Abgas-Emissionen.<br />
Mit der Einführung der Formaldehyd-<br />
Limitierung (40 mg/Nm³) im Rahmen des EEG 2009<br />
und der damit verbundenen Gewährung eines Emissionsbonus<br />
konnte den Betreibern von Biogasanlagen ein<br />
komplettes Paket zur Gasreinigung angeboten werden.<br />
Dies besteht aus Gas-Kühltrocknung und Aktivkohle<br />
sowie einem standfesten Oxidationskatalysator. „Die<br />
Systeme haben sich in einer Vielzahl von Anlagen in<br />
der Praxis bewährt“, betont Baas: „Wir haben uns<br />
auf erreichten Erfolgen nicht ausgeruht, sondern die<br />
Entwicklungsarbeit konsequent weiter betrieben.<br />
So können die neuen Grenzwerte für Formaldehyd<br />
und Kohlenmonoxid mittels entsprechender Katalysatoren<br />
sicher unterschritten werden. Testreihen an<br />
mehreren Biogas-Anlagen haben über mehrere Jahre<br />
Testzeit die sichere Unterschreitung der Grenzen<br />
nachgewiesen.“<br />
Caterpillar hat bereits bei Biogasanlagen SCR-Systeme<br />
erprobt, sodass auch bei einer weiteren Verschärfung<br />
der Emissionsgrenzen erprobte Systeme zur<br />
Verfügung stehen, betont Baas: „Die Emissionen an<br />
Stickoxiden, wie sie mit 0,5 g/Nm 3 für Biogas limitiert<br />
sind, werden durch Motoreinstellung und Regelung<br />
über die eigene und patentierte Brennraumregelung<br />
sicher eingehalten.“<br />
Foto: Thomas Gaul<br />
36
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
MTU setzt auf Anpassung der<br />
Katalysator-Geometrie<br />
Der Motorenhersteller MTU setzt bei seinen<br />
Aggregaten auf eine Anpassung der Katalysator-Geometrie,<br />
wie Hans-Peter Krämer,<br />
Senior Manager Powergen Engineering<br />
Testing bei MTU Onsite Energy erklärt:<br />
„Die Grenzwerte für Formaldehyd sind de<br />
facto heute schon bei 30 mg/Nm³. Um einen<br />
Anspruch auf den Formaldehydbonus<br />
zu erhalten, jedoch schon bei 20 mg/Nm³<br />
(bezogen auf 5 Prozent O 2<br />
, gültig ab 1. Juli<br />
<strong>2018</strong>). Der Formaldehydbonus entscheidet<br />
bei vielen Biogasanlagen darüber, ob<br />
die Anlage wirtschaftlich zu betreiben ist<br />
oder nicht. Zusätzlich soll (gemäß Entwurf<br />
der 43. BImSchV) der CO-Grenzwert von<br />
1.000 mg/Nm³ auf 200 mg/Nm³ verschärft<br />
werden.“<br />
Die Anforderung, 20 mg/Nm³ Formaldehyd<br />
zu erreichen, sei für den Oxidationskatalysator<br />
in der Regel aber deutlich anspruchsvoller<br />
als das Erreichen der 200 mg/Nm³<br />
CO und entscheide somit über die Standzeit<br />
des Katalysators. Um die 20 mg/Nm³<br />
Formaldehyd zu erreichen, müsse eine Katalysator-Anpassung<br />
gegenüber dem Stand<br />
der Vergangenheit erfolgen, oder es müsse<br />
die Standzeit des Katalysators reduziert<br />
werden.<br />
Motortechnisch kann seinen Angaben zufolge<br />
zusätzlich versucht werden – über<br />
Optimierung der Brennraumgeometrie<br />
oder Ähnliches –, die Roh-Emissionen von<br />
unverbrannten Kohlenwasserstoffen zu<br />
reduzieren. Organisatorisch laufen aktuell<br />
zusätzlich Gespräche, wie man die Einhaltung<br />
der CO- und Formaldehyd-Emissionen<br />
dauerhaft (für die Standzeit des Katalysators)<br />
gewährleisten kann. Hier wird sowohl<br />
die Maßnahme einer „Verplombung“ des<br />
Katalysators diskutiert als auch gegebenenfalls<br />
der Einsatz von CO-Sensoren im<br />
Abgastrakt hinter dem Katalysator.<br />
MAN bietet optional modulares<br />
Abgasnachbehandlungssystem<br />
MAN Engines entwickelt, produziert und<br />
vertreibt Gasmotoren für Erd- und Sondergase<br />
(Biogas, Klärgas) im Leistungsbereich<br />
von 37 bis 580 kW. Bezogen auf Biogas<br />
können die aufgeladenen Magergasmotoren<br />
(λ >1.4) die zukünftigen, aktuell zur<br />
Diskussion stehenden Anforderungen der<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Lassen Sie sich beraten –<br />
kompetent und unverbindlich!<br />
Technischer<br />
Service<br />
TA Luft/BImSchV innermotorisch nicht<br />
erfüllen. MAN Engines wird daher seinen<br />
Kunden (Packager/Hersteller von BHKW)<br />
und damit auch den Endkunden optional<br />
ein modulares Abgasnachbehandlungssystem<br />
(AGN) bestehend aus SCR-Katalysator,<br />
Mischer, Harnstoff-Einspritzsystem, Oxidations-/Ammoniak-Sperrkatalysator<br />
und<br />
Sensorik anbieten, erklärt Günther Zibes,<br />
Head of Power MAN Engines.<br />
„Speicherung, Verrohrung sowie die Steuerung<br />
des Einspritzsystems werden durch<br />
die Packager bereitgestellt, um größtmögliche<br />
Flexibilität zu gewährleisten. Das<br />
modulare Abgasnachbehandlungssystem<br />
ist bei MAN bereits erfolgreich in mobilen<br />
Anwendungen im Einsatz und bewährt<br />
sich dort in engen Motorräumen. Durch die<br />
Konstruktion als Stand-Alone-Lösung mit<br />
flexibler Positionierung des SCR-Systems<br />
können Packager den gering vorhandenen<br />
Bauraum und komplexe Einbausituationen<br />
noch flexibler nutzen als mit einer voluminösen<br />
integrierten Einzellösung.<br />
Packager als auch Endkunden wissen die<br />
Wartungsarmut der Bauteile zu schätzen.<br />
In laufenden Feldtests in Blockheizkraft-<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
37
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
BHKW-Modell 16V4000<br />
von MTU.<br />
werken beim Betrieb mit 50 Hz (1.500 min -1 ) und mit<br />
60 Hz (1.800 min -1 ) beweist die modulare AGN aktuell<br />
ihre Praxistauglichkeit und Dauerfestigkeit. Unsere<br />
Zeitplanung sieht vor, zur Einführung der neuen<br />
BImSchV das System serienreif zu haben.“<br />
SCHNELL: gesamtes Portfolio für<br />
Oxikats überarbeitet<br />
Der BHKW Hersteller SCHNELL Motoren GmbH, seit<br />
2016 Mitglied der TEDOM Firmengruppe, sieht sich<br />
auf bevorstehende Verschärfungen der Abgas-Emissions-Grenzwerte<br />
vorbereitet. Die SCHNELL Motoren<br />
GmbH hat entsprechend ihre Abgasnachbehandlung<br />
mittels Oxidationskatalysator für das gesamte Portfolio<br />
überarbeitet und für alle aktuellen und bisherigen<br />
BHKW attraktive Lösungen im Programm. Diese<br />
Abgasnachbehandlung garantiert ebenfalls das Einhalten<br />
des zukünftig niedrigeren Kohlenmonoxid-<br />
Grenzwerts (CO), der für Biogas-Motoren 300 mg/Nm³<br />
betragen soll.<br />
Voraussichtlich werden die Limits hinsichtlich Stickoxidemissionen<br />
(NO x<br />
) für Biogas-Motoren brennverfahrensunabhängig<br />
bei 500 mg/Nm³ liegen. Damit<br />
wird das Zündstrahlverfahren (Micro-Pilot-Zündung)<br />
zukünftig nicht mehr gesondert behandelt. Zusätzlich<br />
wird mittels der neuen BImSchV erstmals eine Grenze<br />
betreffend dei Emissionen von Gesamtkohlenwasserstoffen<br />
(THC) eingeführt. Der Erwartungswert hierfür<br />
beträgt 1.300 mg/Nm³.<br />
Nach aktuellem Stand werden alle bevorstehenden<br />
Emissionsgrenzwerte von der neuen Generation der<br />
SCHNELL Biogas-BHKW ohne Verwendung eines<br />
SCR-Katalysators eingehalten. Entsprechend fallen<br />
auch keine Anschaffungs- und Betriebskosten (Harnstofflösung<br />
bzw. AdBlue) für ein derartiges Abgasnachbehandlungssystem<br />
an. Für Bestandsanlagen wird mit<br />
einer Übergangsfrist im Bereich von fünf bis acht Jahren<br />
gerechnet, bis die Grenzwerte der neuen BImSchV<br />
zu erfüllen sind.<br />
2G: in der Entwicklungsarbeit auf<br />
absehbare Verschärfungen reagiert<br />
Erstmals auf der Hannover-Messe 2017 vorgestellt<br />
wurde die neue BHKW-Baureihe „Aura“ von 2G mit<br />
Aggregaten von 100 kW und 150 kW elektrischer Leistung.<br />
„Die Antwort auf die gegebenenfalls absehbare<br />
Verschärfung der NO x<br />
-<br />
Grenzwerte von 500 mg/<br />
Nm 3 bei Magermotoren<br />
bzw. 250 mg/Nm 3 bei stöchiometrisch<br />
betriebenen<br />
Motoren auf generell 100<br />
mg/Nm 3 durch die neue<br />
BImSchV in Deutschland<br />
haben wir damit bei<br />
unserer Entwicklungsarbeit<br />
quasi vorweggenommen“,<br />
so Frank Grewe,<br />
Geschäftsführer der 2G<br />
Drives GmbH.<br />
Wobei hier angemerkt<br />
werden muss, dass diese<br />
Grenzwertverschärfung<br />
noch völlig unklar ist. Die<br />
Leistungsausbeute soll<br />
laut Grewe bei gleichem<br />
Hubraum um 15 Prozent<br />
über dem Wettbewerb<br />
liegen. Die bewährte Agenitor-Baureihe werde voraussichtlich<br />
mit einem SCR-Katalysator in der Lage sein,<br />
die gesenkten Grenzwerte zu erfüllen.<br />
Auch SES, ein Hersteller von BHKW im Leistungsbereich<br />
von 50 bis 4.500 kWel, geht davon aus, dass die<br />
größeren Aggregate einen SCR-Katalysator erhalten<br />
müssen. Die kleineren Aggregate kommen weiterhin<br />
ohne diese Technologie aus.<br />
Der Markt für Biogas-BHKW wird geprägt durch Packager,<br />
die Serienmotoren von den großen Herstellern<br />
kaufen und entsprechend auf- oder umrüsten. Bei der<br />
Einhaltung der Grenzwerte verlassen sich diese Unternehmen<br />
der Wolf-Gruppe, zu der die Marken Dreyer &<br />
Bosse und Kuntschar + Schlüter gehören, auf die Motorenhersteller.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
Mobil: 01 72/512 71 71<br />
E-Mail: gaul-gehrden@t-online.de<br />
Foto: MTU Energy<br />
38
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Service-Arbeiten an Aktivkohlefiltern der Biogas-Anlagen<br />
praxis / Titel<br />
Umwelttechnik GmbH<br />
Die Begriffe “Aktivkohle-Service” und<br />
“Maisch” sind seit über 55 Jahren auf dem<br />
deutschen Markt und auf internationalen<br />
Märkten ein Synonym für Fachkenntnis und<br />
Zuverlässigkeit. Mit eigenem Equipment und<br />
speziell ausgebildetem Fachpersonal betreuen<br />
wir die verschiedensten Marktsegmente,<br />
in denen Aktivkohlefilter bis hin zu Adsorbern<br />
mit Füllmengen von 60 m 3 und darüber betrieben<br />
und periodisch gewartet werden müssen.<br />
Als Beispiel verweisen wir auf die Tiefdruckindustrie<br />
mit Anlagen zur Lösemittel-Rückgewinnung<br />
mit Luftmengen bis zu 500.000 m 3 /h.<br />
Wir können auch für Biogas-Anlagen, bei<br />
denen größere Aktivkohlefilter vor allem zur<br />
Entschwefelung des Gases im Einsatz sind,<br />
solche Serviceleistungen anbieten.<br />
Die Entleerung gebrauchter Aktivkohle und die<br />
Befüllung mit neuer Aktivkohle, einschließlich<br />
Kontrolle der Filter-Inneneinbauten, zählen<br />
zu unseren traditionellen Aufgabengebieten<br />
und werden von uns gerne übernommen.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter:<br />
www.maisch-service.de<br />
Wir sind zertifiziert nach SCC*: 2011,<br />
dem Umweltschutzmanagementsystem<br />
ISO 14001: 2015 und WHG § 19 L<br />
(Wasserhaushaltsgesetz).<br />
Maisch Umwelttechnik GmbH<br />
Am Sportplatz 54<br />
D – 40789 Monheim am Rhein<br />
Tel: +49 (0)2173- 9655-50 / 51<br />
michael@maisch-service.de<br />
Warum nicht auch bei Ihnen?<br />
Fördern Sie Ihr Image und das der Branche!<br />
von der Biogasanlage Erdmann<br />
QR-Code scannen oder unter:<br />
Installieren Sie eine Ladebox<br />
an Ihrer EE-Anlage!<br />
BHKW<br />
BLOCKHEIZKRAFTWERKE VON HENKELHAUSEN<br />
IHR PARTNER VON DER PLANUNG BIS ZUM RUND-UM-SERVICE<br />
KREFELD • WESSELING • MELLE • WUNSTORF • GÜNZBURG<br />
39<br />
www.henkelhausen.de
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
TOP Thema<br />
<br />
Durchwachsene Silphie –<br />
fast so gut wie Mais<br />
Fotos: Deuter/Fritz<br />
Blühender Bestand<br />
der Durchwachsenen<br />
Silphie.<br />
Auf der Suche nach alternativen und ergänzenden Biogaskulturen spielte die Durchwachsene<br />
Silphie bisher nur eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich allerdings durch die<br />
Entwicklung kostengünstiger Saatverfahren und die neuen Greening-Vorgaben in Zukunft<br />
ändern. Im Rahmen verschiedener Forschungsvorhaben konnte das Technologie- und Förderzentrum<br />
(TFZ) in Straubing bereits grundlegende Erkenntnisse zu Etablierung, Anbau<br />
und Ertragspotenzial dieser vielversprechenden Dauerkultur gewinnen.<br />
Von Ulrich Deuter und Dr. Maendy Fritz<br />
Die Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum<br />
L.) stammt ursprünglich aus den<br />
gemäßigten Regionen Nordamerikas und<br />
wird aufgrund ihrer am Stängel zusammengewachsenen<br />
Blattpaare auch als<br />
Becherpflanze bezeichnet. Sie stellt keine besonderen<br />
Ansprüche an Klima oder Boden, ist winterfest<br />
und gedeiht auch auf Böden mit niedriger Ackerzahl.<br />
Dauerhaft staunasse Böden sind allerdings für einen<br />
ertragreichen Silphieanbau nicht geeignet, während<br />
auf sandigen Böden in sommertrockenen Lagen mit<br />
Ertragseinbußen zu rechnen ist.<br />
Im Pflanz- oder Saatjahr bildet die Pflanze nur eine bodenständige<br />
Rosette und erbringt keinen erntewürdigen<br />
Bestand. Erst ab dem zweiten Standjahr wächst sie<br />
in die Höhe, kann über 3 Meter hoch und 10 Jahre und<br />
länger beerntet werden. Neben einem hohen Ertragspotenzial<br />
bietet die Silphie die bekannten ökologischen<br />
Vorteile einer Dauerkultur: lange Bodenbedeckung,<br />
Erosionsschutz, Bodenruhe und dadurch geringere<br />
Stickstoff-Mineralisation sowie Humusaufbau. Zudem<br />
hat die Pflanze eine lange Blühdauer (Juli bis September)<br />
und die gelben Blüten (siehe Foto 1) werden als<br />
wertvolle Bienenweide von zahlreichen Insekten besucht.<br />
Die Ernte erfolgt in der Regel von Ende August bis<br />
Ende September. Meist erreicht die Silphie zu diesem<br />
Zeitpunkt Trockensubstanzgehalte (TS) von 25 bis 27<br />
Prozent, wobei schon bei 25 Prozent TS nur sehr wenig<br />
Sickersaft gebildet wird. TS-Gehalte oberhalb 30<br />
Prozent sollten vermieden werden, da die Verholzung<br />
der Pflanzen entsprechend stark voranschreitet und die<br />
Methanausbeute rasch absinkt. Dies ist leider häufig<br />
der Fall, da kleinere Silphieflächen meist zusammen<br />
mit Silomais – also für die Silphie zu spät – beerntet<br />
werden.<br />
Die hohe Anfangsinvestition in Pflanzgut war bisher<br />
eine hohe Hemmschwelle für den Anbau. Berechnungen<br />
des Instituts für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur<br />
(LfL-IBA) auf Grundlage von TFZ-Versuchsdaten<br />
zeigten, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wie<br />
günstiger Standort, Etablierung durch Saat, Flächen-<br />
40
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Abbildung 1: Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt der Durchwachsenen<br />
Silphie zum Zeitpunkt der Ernte am Standort Straubing über fünf Jahre (2012 bis 2016)<br />
300<br />
Straubinger Gäu<br />
45<br />
dt TM/ha<br />
Trockenmasseertrag<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2012<br />
TM D. Silphie<br />
2013<br />
TM Mais<br />
2014<br />
Erntejahr<br />
2015<br />
kosten von 600 Euro pro Hektar (€/ha) und mindestens 10-jähriger<br />
Nutzung der Silphie, die Kosten pro Kubikmeter Methan nur<br />
geringfügig höher sind als bei der Verwendung von Silomais. Bei<br />
15-jähriger Nutzung unter ansonsten gleichen Voraussetzungen<br />
wird die Silphie sogar günstiger, da sich die Etablierungskosten<br />
über den längeren Nutzungszeitraum verteilen.<br />
Trockenmasseerträge und Methanausbeuten<br />
Auf dem Gunststandort des Straubinger Gäu wurden in Parzellenversuchen<br />
zur Durchwachsenen Silphie Erträge von durchschnittlich<br />
180 Dezitonnen (dt) Trockenmasse (TM) je Hektar geerntet.<br />
Der Biomasseaufwuchs liegt damit etwas unterhalb von Silomais<br />
(siehe Abbildung 1). Auf ungünstigeren Standorten sind, je nach<br />
Jahreswitterungsverlauf, unter Umständen niedrigere Erträge von<br />
120 bis 150 dt TM/ha zu akzeptieren. Ein Vergleich verschiedener<br />
Standorte mit parallelem Anbau von Mais, Silphie und Getreide-<br />
GPS ist in Abbildung 2 dargestellt. Es zeigte sich, dass Silphie<br />
vor allem in Ideallagen für den Maisanbau nur bedingt konkurrenzfähig<br />
ist. Sehr trockene Standorte mit einer eingeschränkten<br />
Wasserhaltefähigkeit wie beispielsweise die Donau-Schotterebene<br />
eignen sich ebenfalls nur mit ertraglichen Abstrichen für den Silphie-Anbau.<br />
Die durch das Institut für Landtechnik und Tierhaltung (ILT) der<br />
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Batchversuchen<br />
bestimmte Methanausbeute schwankt stark zwischen 220<br />
und 300 Normlitern pro Kilogramm organische Trockenmasse (Nl/<br />
kg oTM) in Abhängigkeit von der Untersuchungsmethode, dem Erntezeitpunkt<br />
und dem Versuchsstandort. Auch die Methanausbeute<br />
nach KTBL liegt für Silphie mit 280 Nl/kg oTM unterhalb von Silomais<br />
(nach KTBL 340 Nl/kg oTM). Insbesondere bei zu später Ernte<br />
steigt der Gehalt an schwer beziehungsweise nicht verdaulichen<br />
Inhaltstoffen wie Lignin deutlich an und die Methanausbeute sinkt<br />
dementsprechend.<br />
TS<br />
*<br />
757 mm<br />
8,6 °C<br />
AZ: 76<br />
*<br />
2016<br />
= Hagelschaden<br />
%<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Trockensubstanzgehalt<br />
Rührwerk<br />
optimieren,<br />
Kosten<br />
reduzieren!<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Bio gas anlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie<br />
z. B. ein altes 18,5-kW-Tauchmotor-<br />
Rührwerk durch ein effizientes<br />
11-kW-Stallkamp-Modell aus und<br />
sparen Sie – bei gleicher Rührleistung<br />
– rund 4.000 Euro jährlich*.<br />
Der Tausch amortisiert sich meist<br />
schon im ersten Jahr. Kontaktieren<br />
Sie unsere Spezialisten!<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der tatsächlichen Ersparnis ist abhängig von<br />
Laufzeit, Strompreis, TS-Gehalt, Fermenterauslegung<br />
und Wirkungsgrad des Rührwerks.<br />
41<br />
Tel. +49 4443 9666-0<br />
www.stallkamp.de<br />
MADE IN DINKLAGE
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Geschlossener Bestand<br />
der Durchwachsenen<br />
Silphie im Herbst des<br />
Ansaatjahres.<br />
<br />
Abbildung 2: Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt der Durchwachsenen Silphie<br />
im Vergleich zu Silomais und Roggen-GPS an drei Standorten im Erntejahr 2016<br />
Trockenmasseertrag<br />
300<br />
dt/ha<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
TM-Ertrag Silphie Mais Roggen-GPS TS-Gehalt<br />
Donau-Schotterebene<br />
leichter Boden, trocken<br />
8,6 °C, 757 mm<br />
Bodenart: lS<br />
AZ: 45<br />
Erfolgreiche Etablierung der<br />
Durchwachsenen Silphie<br />
Das Technologie- und Förderzentrum (TFZ)<br />
hat neben standortüblichen Ertragspotenzialen<br />
auch die Möglichkeiten zur erfolgreichen<br />
Etablierung der Durchwachsenen<br />
Silphie untersucht. Dabei stellt das Saatverfahren<br />
eine kostengünstige Alternative<br />
zu der aufwendigen und teuren Pflanzung<br />
Ernte 2016<br />
Ochsenfurter Gäu<br />
warm und trocken<br />
6,0 °C, 678 mm<br />
Bodenart: tL<br />
AZ: 72-76<br />
Höhenlage Bayerwald<br />
kalt und feucht<br />
6,7 °C, 852 mm<br />
Bodenart: lS<br />
AZ: 35-45<br />
45<br />
%<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
dar. Für eine erfolgreiche Aussaat sollten<br />
jedoch einige grundlegende Anforderungen<br />
an das Verfahren beachtet werden.<br />
Bei der Auswahl möglicher Anbauflächen<br />
sollten Standorte mit einer starken Problemverunkrautung<br />
für den Silphieanbau<br />
ausgeschlossen werden. Für die Vorbereitung<br />
der Saat empfiehlt sich eine Herbstfurche<br />
beziehungsweise gründliche Bodenbearbeitung<br />
im Herbst. Die<br />
Saatbettbereitung im Frühjahr<br />
ist so zu gestalten, dass Bodenlockerung<br />
und Unkrautbekämpfung<br />
vor der Saat so flach wie<br />
möglich durchgeführt werden,<br />
da Silphiesamen eine geringe<br />
Triebkraft besitzen und verhältnismäßig<br />
viel Wasser zum Quellen<br />
und Keimen benötigen. Unter<br />
Umständen ist ein vorzeitiges<br />
Einebnen der Flächen bereits im<br />
Herbst oder im zeitigen Frühjahr<br />
zielführend.<br />
Im Anschluss wird die Silphie<br />
üblicherweise mit einer Saattiefe<br />
von 0,5 bis 1 Zentimeter<br />
(cm) abgelegt. Die Ablagetiefe<br />
kann jedoch in einem gewissen<br />
Maße an die Bodenverhältnisse<br />
und Witterungsbedingungen angepasst<br />
werden. Dennoch sollte<br />
die maximale Saattiefe von 2 cm<br />
auch bei drohender Trockenheit<br />
nicht überschritten werden.<br />
Nach bisherigen Versuchserkenntnissen<br />
des TFZ sind sowohl<br />
Drill- als auch Einzelkornsägeräte<br />
generell zur Aussaat geeignet,<br />
allerdings können gerätespezifische<br />
Eigenschaften Vorteile bringen.<br />
Sägeräte mit einer in der<br />
Särille nachlaufenden, schmalen<br />
Andruckrolle bringen den besten<br />
Saaterfolg, da sie das Korn<br />
zusätzlich im Boden andrücken<br />
und einen intensiven Feuchtekontakt<br />
gewährleisten. Eine<br />
den Säscharen vorauslaufende<br />
Andruck- oder Packerrolle zeigt<br />
ebenfalls gute Wirkung. Zustreicher<br />
und Saatstriegel sind so einzustellen,<br />
dass das Saatgut nicht<br />
verschüttet, sondern nur leicht<br />
mit Erde bedeckt wird. Auch ein Anwalzen<br />
nach der Saat verbessert und beschleunigt<br />
den Aufgang, insbesondere auf trockenen<br />
Böden und in Regionen mit geringen Niederschlägen.<br />
Saatmengen von 2,3 bis 3,8 kg/ha bzw.<br />
eine Aussaatdichte von 15 bis 25 Körnern<br />
je Quadratmeter sind erforderlich, um einen<br />
ausreichend dichten, gleichmäßigen<br />
Trockensubstanzgehalt<br />
42
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
»Mit N·DYN hole ich<br />
mehr Energie<br />
aus meiner Anlage.«<br />
N·DYN Da ist mehr drin.<br />
<br />
<br />
Die Durchwachsene<br />
Silphie als Untersaat<br />
zu verschiedenen<br />
Entwicklungsstadien<br />
der Deckfrucht Mais.<br />
Innovative Additive<br />
für Ihren maximalen<br />
Biogas-Ertrag<br />
N·DYN Additive sind die optimal abgestimmte<br />
Kombination ertragsteigernder<br />
Produkte für den Bedarf von Biogasanlagen.<br />
Bestand von mindestens vier Pflanzen je<br />
Quadratmeter zu erzielen. Dabei gelten<br />
die empfohlenen höheren Angaben für<br />
normale Bedingungen, die niedrigeren für<br />
optimale Saatgegebenheiten und den Fall,<br />
dass bereits Erfahrungen mit der Silphiesaat<br />
vorhanden sind. Eine Unterschreitung<br />
der 2,3-kg- bzw. 15 Körner-Grenze sollte<br />
vermieden werden.<br />
Unkräuter im Griff behalten<br />
Die Reihenweite richtet sich vor allem<br />
nach der vorhandenen Saat- bzw. Pflegetechnik<br />
und dem zu erwartenden Unkrautdruck<br />
auf der Fläche. Einerseits bringen<br />
engere Reihenweiten einen rascheren<br />
Bestandsschluss und<br />
damit eine bessere<br />
Unkrautunterdrückung.<br />
Andererseits kann das<br />
begrenzte Spektrum<br />
einsetzbarer Herbizide<br />
in Verbindung mit der<br />
sehr langsamen Jugendentwicklung<br />
der Silphie<br />
dazu führen, dass mechanische<br />
Pflegemaßnahmen<br />
ergriffen werden<br />
müssen. Der Einsatz<br />
von Hackgeräten oder<br />
Reihenfräsen ist unter<br />
Umständen die einzige Möglichkeit, das<br />
aufkommende Unkraut zu bekämpfen. Vor<br />
diesem Hintergrund können Reihenweiten<br />
von 37,5 bis 50 cm empfohlen werden, da<br />
diese schnellstmöglichen Reihenschluss<br />
mit erfolgreichem Hackgeräteeinsatz vereinen.<br />
Zur chemischen Unkrautregulierung ist in<br />
Silphie derzeit (Stand: Februar <strong>2018</strong>) als<br />
einziges Mittel Stomp Aqua zugelassen.<br />
Der Einsatz dieses Herbizids erfolgt mit<br />
einer Aufwandmenge von maximal 3,5 l/ha<br />
im Vorauflauf. Stomp Aqua gilt gewissermaßen<br />
als Standardmaßnahme im Silphie-<br />
Anbau. Es wirkt hauptsächlich über den<br />
Boden, benötigt dazu entsprechend auch<br />
43<br />
4 Stabilisieren die biologischen Prozesse<br />
4 Sparen Substrat<br />
4 Senken Ihren Eigenstromverbrauch<br />
4 Erhöhen den Methan-Ertrag<br />
4 Steigern die Leistung<br />
4 Werden seit Jahren erfolgreich<br />
eingesetzt<br />
N·DYN orientiert sich bei der Rezeptur und<br />
Dosierung der Additive an den neuesten<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die N•DYN<br />
Additive schaffen auf diese Weise optimale<br />
Wachstums- und Stoffwechsel-Bedingungen<br />
für Bakterien im Fermenter und steigern<br />
zuverlässig und nachhaltig den Wirkungsgrad.<br />
Mit N·DYN gewinnen Sie mehr Energie<br />
aus Ihrer Anlage!<br />
DIE NEUE GENERATION<br />
FERMENTER-ADDITIVE<br />
Trouw Nutrition<br />
Deutschland GmbH<br />
Gempfinger Straße 15<br />
86666 Burgheim<br />
Tel. 08432 89-0<br />
Fax 08432 89-150<br />
milkivit@nutreco.com<br />
www.milkivit.com
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
TOP Thema<br />
<br />
Gut entwickelte Silphie-<br />
Pflanzen nach der Ernte<br />
der Deckfrucht Mais im<br />
Herbst des Ansaatjahres.<br />
ausreichend Feuchtigkeit. Aufgrund der Wirkungsschwäche<br />
von Stomp Aqua bezüglich Kamillen, Klettenlabkraut<br />
und Windenknöterich sowie der Unwirksamkeit<br />
gegen alle Wurzelunkräuter wie beispielsweise<br />
Disteln und Windenarten ist eine zusätzliche mechanische<br />
Unkrautbekämpfung anzuraten. Beim Einsatz<br />
der Hacke in frühen Entwicklungsstadien ist die Silphie<br />
jedoch sehr empfindlich gegen Verschütten. Bei<br />
Pflegemaßnahmen in diesem Pflanzenstadium sollten<br />
daher Schutzbleche, Hohlscheiben und Winkelschare<br />
eingesetzt werden.<br />
Bei der Beurteilung und Planung möglicher Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
ist zu berücksichtigen, dass die<br />
Silphie wesentlich mehr Unkraut als andere Pflanzenarten<br />
toleriert. Nur wenn ein Überwuchern<br />
durch Unkraut droht, so dass<br />
die Silphie kaum Licht bekommt, ist<br />
wirklich eine Gegenmaßnahme erforderlich.<br />
Als letzte Maßnahme ist ein<br />
Mähen beziehungsweise Notbeernten<br />
des Bestands möglichst gegen<br />
Blühende der Unkräuter mit Abfuhr<br />
des Mähguts möglich. Dies dient<br />
auch dazu, ein Absamen der Unkräuter<br />
und eine Zunahme des Samenpotenzials<br />
im Boden zu minimieren. Die<br />
Silphie treibt nach den bisherigen Erfahrungen<br />
danach erneut aus, selbst<br />
wenn die Blätter bei der Noternte entfernt<br />
wurden.<br />
Für die Produktion einer Dezitonne<br />
Trockenmasse benötigt die Silphie<br />
etwa 0,8 bis 1,0 kg Stickstoff. Der<br />
N-Sollwert (N-Bedarf inklusive N min<br />
)<br />
der Silphie zu Beginn jeden Vegetationsjahres<br />
beträgt in Abhängigkeit von<br />
der Ertragserwartung 130 bis 160 kg N/ha. Im Anlagejahr<br />
ist eine Startgabe auf etwa 100 kg N/ha (Sollwert)<br />
ausreichend (Achtung: kein Entzug anrechenbar bei<br />
Etablierung in Reinsaat!). Überhöhte N-Gaben können<br />
sich negativ auf die Standfestigkeit und die Anfälligkeit<br />
der Pflanzen gegenüber abiotischen und biotischen<br />
Stressfaktoren auswirken. Eine organische Düngung<br />
mit Gärresten verwertet die Silphie sehr gut, allerdings<br />
sollte die Düngung relativ früh zum Austrieb erfolgen,<br />
um Beschädigungen an den Schoßtrieben gering zu<br />
halten. Bei einem Ertragsniveau von 150 dt TM/ha ist<br />
mit Entzügen von 60 bis 70 kg P 2<br />
O 5<br />
/ha, 240 bis 300<br />
kg K 2<br />
O/ha, 85 bis 115 kg MgO/ha sowie 280 bis 420<br />
kg CaO/ha zu rechnen.<br />
44
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Silphie unter Mais<br />
Die Ansaat der Silphie als Untersaat mit der Deckfrucht<br />
Mais, wie vom Energiepark Hahnennest GmbH & Co.<br />
KG entwickelt, hat sehr positive Ergebnisse hervorgebracht.<br />
Durch die Deckfrucht kann im sonst ertraglosen<br />
ersten Anbaujahr der Silphie ein Maisertrag von 50<br />
bis 80 Prozent des standortüblichen Ertrags realisiert<br />
werden. Zudem wird die Unkrautunterdrückung mithilfe<br />
der Beschattung durch die Maispflanzen unterstützt<br />
(siehe Fotos 3+4).<br />
Bei einer Etablierung der Silphie als Untersaat wird in<br />
der Regel die Deckfrucht als Hauptkultur angerechnet.<br />
Somit stehen auch die für die Deckfrucht zugelassenen<br />
Pflanzenschutzmittel und Aufwandmengen zur Verfügung.<br />
Für die Untersaat unter Mais kann dementsprechend<br />
Stomp Aqua mit voller Aufwandmenge (4,4 l/ha)<br />
eingesetzt werden. Beim Einsatz Focus Ultra-resistenter<br />
Maissorten kann zudem eine Ungrasbekämpfung<br />
mit Focus Ultra (2,0 l/ha) durchgeführt werden. Es ist<br />
jedoch zu beachten, dass die Einsatzmöglichkeiten von<br />
Hackgeräten durch die Maispflanzen deutlich eingeschränkt<br />
werden.<br />
Bei der Etablierung der Silphie unter einer Deckfrucht<br />
sollte grundsätzlich die erfolgreiche Etablierung der Dauerkultur<br />
im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund ist<br />
es erforderlich, die Bestandsdichte der Deckfrucht Mais<br />
auf 5 bis 6 Pflanzen je Quadratmeter zu reduzieren und<br />
somit eine ausreichende Versorgung der Silphie mit Licht<br />
zu gewährleisten. Die sehr unterschiedlichen Saattiefen<br />
der beiden Kulturen erfordern entweder den Einsatz<br />
spezieller Sätechnik für die gleichzeitige Aussaat beider<br />
Kulturen oder ein abgesetztes Verfahren, bei dem zwei<br />
Arbeitsgänge vorgenommen werden. Dabei empfiehlt es<br />
sich, erst die Deckfrucht einzusäen, um zu vermeiden,<br />
dass bereits ausgebrachtes Silphiesaatgut in den Fahrspuren<br />
zu tief und zu stark in den Boden gedrückt wird.<br />
Die Düngung richtet sich bezüglich der Nährstoffmengen<br />
nach den Vorgaben für die Deckfrucht. Zur abschließenden<br />
Ernte der Deckfrucht ist die Silphie in<br />
jedem Fall so weit entwickelt, dass sie das Überfahren<br />
toleriert (siehe Foto 5). Auch Abschlegeln der Maisstoppel<br />
als Hygienemaßnahme gegen den Maiszünsler<br />
ist ohne nennenswerte Einbußen bei der Silphie möglich.<br />
In den anschließenden Nutzungsjahren benötigt<br />
die Silphie in der Regel keine weiteren Pflanzenschutzmaßnahmen.<br />
Weitere, detaillierte Informationen zur Durchwachsenen<br />
Silphie, u. a. eine artspezifische BBCH-Skala,<br />
sind auf der Homepage des TFZ unter http://www.tfz.<br />
bayern.de/silphie zu finden.<br />
Hinweis: Literaturangaben sind bei den Autoren<br />
erhältlich<br />
Autoren<br />
Ulrich Deuter<br />
Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum<br />
für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ)<br />
Tel. 0 94 21/300-074<br />
E-Mail: ulrich.deuter@tfz.bayern.de<br />
Dr. Maendy Fritz<br />
Leiterin Sachgebiet Rohstoffpflanzen und Stoffflüsse, TFZ<br />
Schulgasse 18, 94315 Straubing<br />
Tel. 0 94 21/300-012<br />
E-Mail: maendy.fritz@tfz.bayern.de<br />
www.tfz.bayern.de
Blühende Silphie<br />
mit Kohlweißling.<br />
Lebensraum und<br />
Energiepflanze<br />
TOP Thema<br />
Änderungen der agrarpolitischen Rahmenbedingungen sowie eine neue Saattechnik<br />
fördern den Anbau der Durchwachsenen Silphie.<br />
Von Michael Dickeduisberg<br />
Die Durchwachsene Silphie, kurz Silphie genannt,<br />
ist mit ihrer langen Blüte von Ende<br />
Juni bis Mitte September eine beliebte<br />
Pflanze für Blütenbesucher in der trachtarmen<br />
Zeit. Ferner kann die Silphie als Dauerkultur<br />
mit einer Standzeit von über 15 Jahren ein gutes<br />
Wurzelwerk ausbilden, das Stickstoff vor Auswaschung<br />
und den Boden im Winter vor Erosionen schützt.<br />
In der Vergangenheit lag die Anfangsinvestition in einen<br />
Silphiebestand bei etwa 7.000 Euro pro Hektar<br />
(€/ha). Vor allem hohe Kosten für die Beschaffung von<br />
40.000 Stecklingen je Hektar (etwa 6.400 €/ha) und<br />
Lohnkosten für die Pflanzung waren Argumente gegen<br />
den großflächigen Anbau in der landwirtschaftlichen<br />
Praxis. Inzwischen ist ein kostengünstiges Aussaatverfahren<br />
praxiserprobt. In Kombination mit den Ergebnissen<br />
bundesweiter Forschungsaktivitäten ist die Silphie<br />
eine ernsthafte Ergänzung zum derzeitigen Biogas-Substratmix.<br />
Die positiven Effekte durch die Förderung der<br />
Biodiversität und ein positives Image in der Bevölkerung<br />
werden dank der energetischen Verwendung in Biogasanlagen<br />
mit wirtschaftlichen Interessen vereint. Seit<br />
dem 1. Januar <strong>2018</strong> wird der Anbau der Silphie auch<br />
politisch gefördert. Im Rahmen des „Greenings“ hat die<br />
Silphie als ökologische Vorrangfläche einen Faktor von<br />
0,7 erhalten.<br />
Abbildung 1: Bestandesdichte der Silphie im Etablierungsjahr in Abhängigkeit von der Aussaattechnik<br />
25<br />
20<br />
Pflanzen/m²<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Silphie Drillsaat<br />
(Untersaat)<br />
Silphie Drillsaat<br />
(Reinsaat)<br />
Silphie Einzelkornsaat<br />
(Untersaat)<br />
Silphie Einzelkornsaat<br />
(Reinsaat)<br />
46
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Die Silphie läuft nach<br />
dem Mais auf.<br />
INNOVATIVE Praxis<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
Fotos: Michael Dickeduisberg<br />
Die Drillsaat weist Fehlstellen auf, die in der<br />
Regel nicht nachgesät werden können.<br />
Saatverfahren ist einfach<br />
und günstig<br />
Mit einem neuen Aussaatverfahren ist die<br />
Etablierung der Silphie deutlich einfacher<br />
und günstiger als die Pflanzung von Stecklingen.<br />
Die Kosten des Saatguts betragen<br />
rund 1.500 Euro für 2,8 kg/ha. Die Aussaat<br />
erfolgt nach einer gründlichen Bodenvorbereitung<br />
bei optimalen Bodenverhältnissen<br />
ab Anfang Mai mittels Einzelkornsämaschine<br />
auf 75 Zentimeter Reihenabstand.<br />
In Versuchen der Landwirtschaftskammer<br />
Nordrhein-Westfalen gelang es auch, die<br />
Silphie per Drillsaat auf 12,5 cm Reihenabstand<br />
zu säen.<br />
Bedingt durch die flache und<br />
große Saatgutgeometrie konnte<br />
die mechanische Drillmaschine<br />
allerdings nicht exakt abgedreht<br />
werden. Die tatsächliche<br />
Aussaatstärke lag mit teilweise<br />
4 kg/ha deutlich über dem Sollwert<br />
von 2,8 kg/ha, wodurch<br />
sich die Saatgutkosten signifikant<br />
erhöhten. Zudem waren<br />
Fehlstellen ebenso wie zu dicht<br />
stehende Teilflächen die Folge<br />
heterogener Saatgutablage<br />
(siehe Bilder und Grafik). Demgegenüber<br />
war die Saatgutablage<br />
mittels Einzelkornsämaschine<br />
homogen und exakt. Mit<br />
etwa 7 aufgelaufenen Pflanzen<br />
pro Quadratmeter (m²) lag die<br />
Bestandesdichte knapp über<br />
dem Optimum von 4 aufgelaufenen<br />
Pflanzen pro m².<br />
Ertrag auch im<br />
ersten Jahr<br />
Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Silphie entwickelte<br />
die Praxis ein Untersaatverfahren.<br />
Die Deckfrucht<br />
liefert im Etablierungsjahr, in<br />
dem die Silphie lediglich eine<br />
bodenständige Rosette bildet,<br />
einen erntewürdigen Biomasseertrag.<br />
In der praktischen<br />
Umsetzung wird dazu nach<br />
der Drillsaat in einem zweiten<br />
Arbeitsgang der Mais gelegt<br />
beziehungsweise in der Einzelkornsaat<br />
in einem Arbeitsgang<br />
mittig zwischen die Silphie-<br />
Reihen gelegt.<br />
Um den Aufgang der Silphie durch zu starke<br />
Konkurrenz des Maises um Licht und<br />
Wasser nicht zu gefährden, wird der Mais<br />
mit verminderter Aussaatstärke von 5,2<br />
Körnern/m² statt der ortsüblichen 9,7 Körner/m²<br />
gelegt. Unkräuter werden mit einem<br />
Vorauflaufherbizid unterdrückt und gegebenenfalls<br />
mit einer zusätzlichen späteren<br />
Applikation erfasst. Obwohl die Bestandesdichte<br />
von Mais als Deckfrucht gegenüber<br />
der Mais-Reinsaat nahezu halbiert wird,<br />
zeigten Versuche einen Ertragsrückgang<br />
von nur 20 Prozent. Mais kann die reduzierte<br />
Bestandesdichte durch verstärktes<br />
Dickenwachstum teilweise kompensieren.<br />
47<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 210m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Gleichmäßige Pflanzenverteilung nach Einzelkornsaat.<br />
Die Silphie etabliert sich als Untersaat in Mais.<br />
Zur Ernte wird der Mais wie üblich gehäckselt. Überfahrschäden<br />
an der Silphie zeigten bisher keine direkten<br />
Auswirkungen auf die Entwicklung im Folgejahr.<br />
Silphie nach Ernte der Deckfrucht Mais im Etablierungsjahr.<br />
Abbildung 2: Ertrag Silphie in Abhängigkeit von der Etablierungstechnik,<br />
Mais als Referenz<br />
Ertrag dt TM/ha<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Silphie Drillsaat<br />
(Untersaat)<br />
Silphie Drillsaat<br />
(Reinsaat)<br />
Silphie Einzelkornsaat<br />
(Untersaat)<br />
Silphie Einzelkornsaat<br />
(Reinsaat)<br />
Gute Silphieerträge<br />
Am Standort Haus Düsse (toniger Schluff, Jahresmittel:<br />
10,4 Grad Celsius und 771 Millimeter Niederschlag)<br />
erzielte die Silphie sehr gute Erträge. Die<br />
Einzelkornsaat nutzte den Standraum besser als die<br />
Drillsaat. Dies führte zu höheren Biomasseerträgen<br />
und reduzierte die Lageranfälligkeit. In Reinsaat<br />
bildete die Silphie im Etablierungsjahr eine größere<br />
Blattoberfläche und Blattmasse an der Rosette als im<br />
vergleichbaren Untersaatanbau.<br />
Im ersten Ertragsjahr wurden 199 Dezitonnen<br />
Trockenmasse pro Hektar (dt TM/<br />
ha) im Einzelkorn-Reinsaatanbau geerntet.<br />
Der Ertrag der Referenzkultur Mais lag<br />
auf derselben Fläche bei 180 dt TM/ha.<br />
Entscheidend für hohe Biomasseerträge<br />
ist der Erntezeitpunkt. Idealerweise wird<br />
mit Beendigung der Blüte und des Bienenflugs<br />
ab der zweiten Septemberwoche<br />
geerntet. Da die Silphie in der Regel auf<br />
kleinen Flächen und einzelbetrieblich in<br />
relativ geringem Umfang angebaut wird,<br />
eignet sich aus arbeitswirtschaftlicher<br />
Sicht die Einbindung in die frühe Maisernte<br />
des Jahres.<br />
Mit zunehmendem Alter verliert der Bestand<br />
durch Abfallen von Blättern und<br />
Fruchtkörpern an Ertrag, der sich bis<br />
Ende November um 40 Prozent reduzieren<br />
kann. Zeitgleich ändert sich mit<br />
Mais<br />
48
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Abbildung 3: Ertrag Silomais im Etablierungsjahr in Abhängigkeit<br />
von der Etablierungstechnik und dem Etablierungsjahr<br />
Maisertrag dt TM/ha<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Silphie Drillsaat<br />
US Mais 5,2 K/m²<br />
Silphie<br />
Einzelkornsaat<br />
US Mais 5,2 K/m²<br />
Fortschreiten des Alterungsprozesses die<br />
Zusammensetzung der Pflanzeninhaltsstoffe,<br />
die in stetig sinkenden spezifischen<br />
Biogasausbeuten resultieren.<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Die positiven externen Effekte der Silphie,<br />
wie beispielsweise die ökologischen Vorteile<br />
und die Imageverbesserung, lassen<br />
sich ökonomisch nicht einfach darstellen.<br />
Inwiefern die Anrechnung als ökologische<br />
Vorrangfläche zu einem ökonomischen<br />
Mehrwert im Betrieb beiträgt, ist nur einzelbetrieblich<br />
bewertbar. Die tatsächlichen<br />
Aufwendungen des Silphieanbaus lassen<br />
sich darstellen und können zur Orientierung<br />
mit der gut bekannten Referenzkultur<br />
Mais verglichen werden.<br />
Der Anbau der Silphie unterscheidet sich<br />
in ein paar Punkten vom klassischen Maisanbau.<br />
Das Silphiesaatgut ist vergleichsweise<br />
kostenintensiv, weshalb der Feldaufgang<br />
mit zusätzlicher Saatbettbereitung<br />
und Anwalzen abgesichert werden sollte.<br />
Ferner ist im Ansaatjahr unter ungünstigen<br />
Umständen zusätzlich zu einer Vorauflaufbehandlung<br />
eine weitere Herbizidmaßnahme<br />
notwendig. Die einmaligen Kosten der<br />
Etablierung fallen in den folgenden Nutzungsjahren<br />
nicht mehr an.<br />
Auch Pflanzenschutzmaßnahmen sind<br />
nach der Etablierung nur in Ausnahmefällen<br />
erforderlich. Folglich müssen die<br />
einmaligen Investitionen auf die Nutzungsdauer<br />
umgelegt werden. Die jährlich<br />
anfallenden Kosten für organische<br />
Düngung und Ernte unterscheiden sich<br />
praktisch nicht von der Maisernte. Hohe<br />
Mais Reinsaat<br />
9,7 K/m²<br />
Silphie Drillsaat<br />
US Mais 5,2 K/m²<br />
Silphie<br />
Einzelkornsaat<br />
US Mais 5,2 K/m²<br />
2016 2017<br />
Mais Reinsaat<br />
9,7 K/m²<br />
Biomasseerträge und günstige jährliche<br />
Etablierungskosten wirken sich positiv auf<br />
die Wirtschaftlichkeit aus. Dem entgegen<br />
haben die um etwa 20 Prozent geringeren<br />
spezifischen Gasausbeuten einen negativen<br />
Effekt auf die Wirtschaftlichkeit. Insbesondere<br />
in Regionen mit angespanntem<br />
Bodenmarkt kann der daraus folgende zusätzliche<br />
Bedarf an Substrat beziehungsweise<br />
Anbaufläche die Wirtschaftlichkeit<br />
beeinträchtigen.<br />
Fazit: Die Durchwachsene Silphie ist als<br />
wertvolle Trachtpflanze, für den Erosionsschutz,<br />
durch sehr geringen Einsatz chemischer<br />
Pflanzenschutzmittel und das damit<br />
in Zusammenhang stehende Marketing für<br />
die heimische Landwirtschaft und Bioenergieerzeugung<br />
sehr gut geeignet. Mit<br />
der neuen Anbautechnik und den agrarpolitischen<br />
Rahmenbedingungen ist sie für<br />
landwirtschaftliche Betriebe eine sinnvolle<br />
Ergänzung zu den vorrangig eingesetzten<br />
Kulturen.<br />
Autor<br />
Michael Dickeduisberg<br />
Zentrum für nachwachsende Rohstoffe (ZNR)<br />
Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus<br />
Düsse<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br />
Ostinghausen · 59505 Bad Sassendorf<br />
Tel. 0 29 45/989-144<br />
E-Mail: Michael.Dickeduisberg@lwk.nrw.de<br />
www.landwirtschaftskammer.de<br />
www.duesse.de/ZNR<br />
49<br />
Sichern Praxis Sie<br />
sich Ihren<br />
Preisvorteil!<br />
Nur bei<br />
Aktivkohle24:<br />
Aktivkohle zum<br />
besten Preis, trotz<br />
Preissteigerung<br />
am Markt.<br />
Garantiert<br />
bis zum 31.05.<strong>2018</strong><br />
Schnelle<br />
Reaktionszeit<br />
Festpreis<br />
Kurze<br />
Wechselzeiten<br />
Fachpersonal<br />
Deutschlandweit<br />
Fachmännische<br />
Entsorgung<br />
AKTIVKOHLE 24<br />
Rausholen, was drin ist.<br />
+49 201/99 9957-57<br />
info@aktivkohle24.com<br />
www.aktivkohle24.com<br />
Jetzt auch auf
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
TOP Thema<br />
Lange gesucht – erst die<br />
Silphie überzeugte<br />
Links über dem Feldweg<br />
ist eine blühende<br />
Silphiefläche zu sehen.<br />
Rechts unterhalb des<br />
Weges im Kontrast<br />
dazu ein Maisacker.<br />
Biogas-Landwirt Bruno Stehle aus Sigmaringen probierte viele Alternativen<br />
zum Mais – jetzt baut er auf 56 Hektar die Becherpflanze an.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Bruno Stehle hat schon manches ausprobiert,<br />
was als Alternative zum Mais diskutiert<br />
wurde. „Vor zehn Jahren habe ich zwei<br />
Hektar Topinambur angebaut, aber das war<br />
nichts“, sagt der Landwirt aus Laiz, einem<br />
Stadtteil von Sigmaringen in der Region Bodensee-<br />
Oberschwaben. Später versuchte er es dann mit Hirschgras,<br />
schließlich auch mit Wildblumenmischungen. Die<br />
Blühpflanzen sahen zwar wunderschön aus, ökologisch<br />
waren sie sehr wertvoll, doch ihr Biomasse-Ertrag kam<br />
an den Mais nicht heran.<br />
Seit 2014 hat Stehle die Durchwachsene Silphie auf<br />
mehreren Feldern stehen – und ist mit den Erträgen<br />
sehr zufrieden. Jahr für Jahr hat er seither die Flächen<br />
vergrößert, in diesem Jahr steht die Becherpflanze bei<br />
ihm bereits auf 56 Hektar. Ein Großteil davon wächst<br />
auf einem Rendzina, einem flachgründigen, trockenen<br />
und auch steinigen Boden.<br />
Damit bei der Silphie vom Start weg alles rund läuft,<br />
müsse sorgfältig gearbeitet werden, weiß der Landwirt:<br />
„Das Saatbeet muss gut vorbereitet sein, es muss<br />
feinkrümelig sein.“ Und die richtige Maissorte, der im<br />
ersten Jahr noch mit ausgebracht wird, sei<br />
für den Ertrag im ersten Jahr entscheidend;<br />
Stehle säte Geox an.<br />
Landwirt Bruno Stehle baut die Durchwachsene<br />
Silphie in großem Stil an. Beim Substratinput macht<br />
die Silage etwa ein Viertel der Inputmenge aus.<br />
Frau Stehle auf einem hölzernen Hochstand am Silphiefeld.<br />
Wer die Pflanze mit der Metzler & Brodmann<br />
KG bezieht, erhält den Hochstand dazu. Er bietet die<br />
Möglichkeit, über die bis zu 3,50 Meter hohen, gelb<br />
blühenden Pflanzen zu schauen. Infotafeln am Hochstand<br />
halten Wissenswertes für Interessierte bereit.<br />
Fotos: Bruno Stehle<br />
Erträge der Silphie sprechen<br />
für sich<br />
Im dritten Jahr habe er 16,5 Tonnen Trockenmasse<br />
pro Hektar ernten können, sagt<br />
Stehle – bei einem Maisertrag von 15 bis<br />
16,5 Tonnen an vergleichbarem Standort<br />
eine attraktive Menge. Bundesweit hätten<br />
die mittleren Erträge im Jahr 2017 bei<br />
15,8 Tonnen gelegen, sagt Ralf Brodmann,<br />
Silphie-Pionier der Metzler & Brodmann<br />
KG aus dem württembergischen Ostrach-<br />
Hahnennest.<br />
Die Methanwerte lägen bei 300 Normlitern<br />
pro Kilogramm, womit sich eine Methanausbeute<br />
von 4.740 Kubikmetern pro Hektar<br />
ergibt. Zwar erbringen manche Maissorten<br />
noch etwas mehr Methan, doch weil die Sil-<br />
50
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Fotos: Energiepark Hahnennest<br />
Der Silphieanbau fördert das Bodenleben – und verbessert auch die<br />
Anzahl an Regenwürmern.<br />
phie nach der Aussaat in den Folgejahren<br />
mit weniger Maschineneinsatz auskommt<br />
als der Mais, spart sie andererseits auch<br />
Kosten.<br />
Auch der Düngereinsatz ist nach einer Anfangsphase<br />
nicht mehr erforderlich. Im<br />
ersten und zweiten Jahr habe er jeweils<br />
80 Kilo Stickstoff pro Hektar ausgebracht,<br />
dazu 30 bis 35 Kubikmeter Gärdünger, sagt<br />
Landwirt Stehle. Ab dem dritten Jahr komme<br />
er nun alleine mit dem Gärrest aus. Die<br />
Metzler & Brodmann KG liefert das Saatgut<br />
und übernimmt die Aussaat in Form eines<br />
Vertragsanbaus. Landwirte mit guten Pflanzenkulturen<br />
können ihrerseits Samen an die<br />
Hahnennester Silphie-Experten zurückliefern.<br />
Stehle hat das auch schon gemacht.<br />
Wenn eine Fläche gute Samenqualität<br />
liefert, werden mit einer Spezialmaschine<br />
vorab die obersten 30 Zentimeter der Pflanze<br />
beschnitten, ehe die Ernte der ganzen<br />
Pflanze für die Energiegewinnung erfolgt.<br />
Hinsichtlich des Untergrundes erweist<br />
sich die Energiepflanze als ausgesprochen<br />
anpassungsfähig. „Wenn die Wurzeln weit<br />
hinunter gewachsen sind, ab dem dritten<br />
Jahr etwa, verträgt die Silphie Trockenheit<br />
besser als der Mais“, hat der Landwirt beobachtet.<br />
Zugleich könne die Pflanze aber<br />
auch mit viel Wasser umgehen: „Staunasse<br />
Flächen gehen auch.“ Zudem biete die Becherpflanze<br />
auch Vorteile in Wildregionen.<br />
„Am Waldrand haben wir hier beim Mais<br />
schon bis zu 80 Prozent Schäden durch<br />
Schwarzwild gehabt, bei der Silphie gibt<br />
es diese Probleme nicht.“ Die Tiere hielten<br />
sich zwar in den Kulturen auf, sie verursachten<br />
aber keine Ertragsausfälle.<br />
Nach der Ernte, die einige Wochen vor dem<br />
Mais stattfindet (was den Lohnunternehmern<br />
oft gelegen kommt),<br />
werden die Silphie-Pflanzen<br />
siliert. Und auch im Silo erweise<br />
sich diese als ausgesprochen<br />
praktikable Alternative:<br />
Die Silage der Silphie<br />
erzeuge trotz eines Trockensubstanzgehaltes<br />
der Pflanze<br />
von nur 25 Prozent nur wenig<br />
Sickersaft.<br />
In der Biogasanlage von Landwirt<br />
Stehle macht die Silphie<br />
etwa ein Viertel des eingesetzten<br />
Substrates aus. „100<br />
Prozent Silphie würde ich<br />
nicht machen, aber das täte<br />
ich auch mit Mais nicht“, sagt<br />
der Praktiker. Eine vielfältige Mischung sei<br />
immer besser. Und so kommen in den Fermenter<br />
oberhalb der Donau in Laiz neben<br />
der Silphie auch Rüben, Festmist, Rindergülle<br />
und Mais hinein.<br />
Die Biogasanlage auf dem Laizer Christelhof<br />
besteht aus fünf BHKW mit zusammen<br />
1.800 Kilowatt elektrischer Leistung. Die<br />
Höchstbemessungsleistung liegt aber bei<br />
nur 750 Kilowatt, die Aggregate laufen<br />
also nur knapp 4.000 Stunden im Jahr,<br />
vor allem tagsüber. Der Strom wird über<br />
die Firma Next Kraftwerke bevorzugt in<br />
hochpreisigen Stunden an der Börse vermarktet.<br />
Flexibilisierung ist Investition<br />
in die Zukunft<br />
Ein zusätzlicher Gasspeicher, der die Produktion<br />
von 24 Stunden aufnehmen kann,<br />
soll künftig noch mehr Flexibilität bringen.<br />
Es sei eine Investition in die Zukunft, sagt<br />
Landwirt Stehle, denn er hofft, dass sich mit<br />
solcher Flexibilität künftig wieder Geld verdienen<br />
lässt. Im Moment bringt eine kurzfristig<br />
regelbare Stromerzeugung – so sehr<br />
sie immer als notwendig diskutiert wird –<br />
kaum auskömmliche Erträge. Stehle hat<br />
schon immer versucht, seinen Betrieb auf<br />
möglichst viele Beine zu stellen. Er bewirtschaftet<br />
490 Hektar Land, davon rund 200<br />
Hektar für seine Biogasanlage, 150 Hektar<br />
Grünland, auf dem Rest steht Getreide. Bis<br />
2007 hatte er zudem 100 Milchkühe, doch<br />
die waren bald nicht mehr auskömmlich.<br />
Heute ist er als Land- und Energiewirt nicht<br />
nur in der Stromerzeugung aktiv, sondern<br />
liefert auch viel Wärme aus den Aggregaten<br />
in zwei Wärmenetze. An einem sind zwei<br />
Schulen, ein Kindergarten und das Freibad<br />
51
Praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Aussaat der Silphie: Mit der neuartigen Sätechnik am Traktor können in einem<br />
Arbeitsgang die Silphiesamen und der Mais im Boden abgelegt werden.<br />
Ernte des Silomaises über der Durchwachsenen Silphie im ersten Anbaujahr.<br />
Für die Pflanzen ist das Überfahren kein Problem.<br />
von Sigmaringen in 1,5 Kilometern Entfernung angeschlossen.<br />
Am anderen Netz, das er selbst betreibt, befinden<br />
sich 21 Wohnhäuser.<br />
Sein Sohn plant unterdessen, in der Nähe einen Biobetrieb<br />
mit Schweinen aufzubauen. Dieser könnte später<br />
auch die Silphie übernehmen, die sich im späteren<br />
Verlauf der Kultur gut für den Bioanbau eignet. Denn<br />
nachdem das erste Jahr überstanden ist, in dem noch<br />
gegen konkurrierende Gräser gespritzt wird, wächst die<br />
Pflanze fortan alljährlich ohne Spritzmittel auf.<br />
Die Öffentlichkeit über die Silphie zu informieren hat<br />
sich Stehle zudem zum Ziel gesetzt – auch um das<br />
Image des Biogases wieder zu verbessern, das unter<br />
dem Mais schwer gelitten hat. Im August war der Landwirt<br />
daher Mitveranstalter einer Silphie-Rallye: Auf<br />
einem rund 4 Kilometer langen Spazierweg rund um<br />
den Nachbarortsteil Unterschmeien konnten Interessierte<br />
einiges über die Energiepflanze Silphie lernen,<br />
die in jenen Wochen auf etlichen Feldern unübersehbar<br />
gelb blühte. An einem seiner Felder hat Stehle einen<br />
Hochsitz aufgebaut, der den Blick über die 3,50 Meter<br />
hohen Pflanzen ermöglicht. Dass die Silphie Anfang<br />
<strong>2018</strong> auch ins Greening aufgenommen wurde, könnte<br />
ihr einen weiteren Schub geben.<br />
Demoprojekt untersucht geoökologische<br />
Potenziale<br />
Unterdessen wird die neue Energiepflanze auch immer<br />
mehr zum Forschungsgegenstand. Von „ersten<br />
vielversprechenden Ergebnissen“ berichtet auch Reinhard<br />
Wesinger von der Firma Geoteam Bayreuth. Im<br />
Rahmen des Demonstrationsprojektes Becherpflanze<br />
Oberfranken untersuchen die Geoökologen insbesondere<br />
die Potenziale der Silphie zum Einsatz in Wasserschutzgebieten<br />
und in erosionsgefährdeten Arealen<br />
durch Beregnungsversuche. Die Ergebnisse aus dem<br />
Demonstrationsprojekt sollen somit auch eine fundierte<br />
Entscheidungsgrundlage liefern, ob Wasserversorger<br />
den Anbau fördern sollen, um die Nitratauswaschung<br />
zu minimieren.<br />
2017 erfolgte im Rahmen dieses Projektes die erste<br />
Aussaat in der nördlichen Frankenalb auf 41 Flächen<br />
mit zusammen 65 Hektar bei 27 Landwirten. <strong>2018</strong><br />
kommen weitere 35 Hektar hinzu. Die Flächen seien<br />
bewusst sehr unterschiedlich gewählt, sagt Wesinger,<br />
vom Kalk- bis zum Sandboden. Am Ende sollen dann<br />
auch Erkenntnisse darüber vorliegen, für welchen Untergrund<br />
sich die Energiepflanze besonders eignet.<br />
Auch Erfahrungen mit der Erntetechnik, Informationen<br />
über die Erträge, die Stickstoffbilanz und das invasive<br />
Potenzial der Becherpflanze sind das Ziel.<br />
Renergie Allgäu untersucht regionaltypische<br />
Bedingungen<br />
Gleichzeitig untersucht auch der Renergie Allgäu e.V.<br />
auf 15 Hektar in Kooperation mit zehn landwirtschaftlichen<br />
Betrieben die Silphie. Die Versuchsflächen verteilen<br />
sich auf vier Landkreise, sodass möglichst alle geologischen<br />
und klimatischen Bedingungen des Allgäus<br />
berücksichtigt werden können. Alle Felder wurden auch<br />
schon vor Beginn des Projekts als Ackerfläche genutzt,<br />
zumeist für Mais. Im Moment befinden sich die Versuche<br />
im zweiten Jahr, sodass Aussagen über Erträge hier noch<br />
nicht möglich sind.<br />
Richard Mair, Vorsitzender von Renergie Allgäu, sieht<br />
bei der Silphie alle Begleitaspekte „im Plus“: Bei den<br />
Themen Insekten, Gewässerschutz, Humusaufbau,<br />
Pflanzenschutz und auch bei der Akzeptanz schneide<br />
die Silphie besser ab als der Mais. In dem auf drei<br />
Jahre angelegten Forschungsprojekt sollen die Erträge,<br />
die Bodenverhältnisse und die Witterungseinflüsse<br />
systematisch erfasst werden. Auch die Akzeptanz wird<br />
bei den Bürgern begleitend abgefragt. Prädestiniert für<br />
die Pflanze seien Hanglagen, sagt Mair. Weil hier die<br />
Bewirtschaftung aufwändiger ist, schlagen die Vorteile<br />
der mehrjährigen Pflanze besonders durch. Und dann<br />
hat Mair noch eine Beobachtung gemacht: Rabenvögel<br />
können der Silphie deutlich weniger anhaben als dem<br />
Mais.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
52
Biogas Silphiepflanze Journal am | 2_<strong>2018</strong><br />
1. Februar: oberirdischer<br />
Trieb und gut entwickelter<br />
Wurzelballen.<br />
praxis<br />
TOP T h e ma<br />
Pflanze, die ökologisch punktet<br />
Immer mehr Biogasanlagenbetreiber werden auf die Silphie aufmerksam. Während<br />
anfangs hauptsächlich gepflanzt wurde, wird inzwischen durch ein innovatives Konzept<br />
immer mehr ausgesät. Drei Praktiker berichten von ihren Erfahrungen.<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Wir haben im Mai 2011 auf einer Fläche<br />
von zwei Hektar die Durchwachsene<br />
Silphie angepflanzt, um mit dieser<br />
Energiepflanze Erfahrungen zu sammeln“,<br />
berichtet Rainer Niedermeyer<br />
aus Borgholzhausen im Kreis Gütersloh im nordöstlichen<br />
Nordrhein-Westfalen. Dort betreibt er mit seinem<br />
Nachbarn Dieter Vahrenbrink seit 2010 eine Biogasanlage,<br />
die heute eine installierte elektrische Leistung<br />
von 750 Kilowatt aufweist.<br />
Das Pflanzgut hat er damals aus Sachsen von der N.L.<br />
Chrestensen Erfurter Samen und Pflanzenzucht GmbH<br />
bezogen. „40.000 Stecklinge pro Hektar haben wir<br />
mit einer alten Steckrübenpflanzmaschine ins Feld gesetzt.<br />
Zwei Tage waren wir damit beschäftigt. 5.000<br />
Euro haben wir pro Hektar für die Setzlinge bezahlt.<br />
Die Maschinen- und Arbeitskosten kamen noch dazu“,<br />
erinnert sich Niedermeyer. Nach der Pflanzung sei es<br />
sehr trocken gewesen, sodass die jungen Pflanzen bewässert<br />
werden mussten.<br />
Die Setzlinge waren etwa 10 Zentimeter groß, hatten<br />
einen gut ausgebildeten Wurzelballen und besaßen<br />
schon 5 bis 6 Blätter. „Im ersten Jahr wurden die<br />
Pflanzen lediglich 30 Zentimeter groß. Auf der gesamten<br />
Fläche waren maximal 100 Blüten zu finden“, erzählt<br />
Niedermeyer. Der Standort ist ein Lehmboden,<br />
der mit Kalksteinbrocken durchsetzt ist. Er befindet<br />
sich auf einem Südhang des Teutoburger Waldes. Die<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Durchschnittstemperatur beträgt 8 Grad Celsius, die<br />
mittlere Niederschlagsmenge pro Jahr liegt bei 800<br />
Millimeter.<br />
Rainer Niedermeyer<br />
(links) und Gerd-<br />
Hinrich Groß auf dem<br />
Silphiefeld, das 2011<br />
angepflanzt worden<br />
ist. Gut zu erkennen<br />
auf dem Bild sind die<br />
langen Stoppeln der<br />
Silphiepflanzen. Laut<br />
Niedermeyer ist die Fläche<br />
erstmals in diesem<br />
Winter komplett durch<br />
Ungräser und -kräuter<br />
begrünt.<br />
29. Januar <strong>2018</strong>:<br />
Erste Silphietriebe<br />
lassen sich<br />
auf dem Feld<br />
entdecken.<br />
53
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
TOP Thema<br />
Der Tipp vom Hackl Schorsch:<br />
Jetzt Durchwachsene Silphie anbauen<br />
Das war doch mal eine gute Nachricht aus Brüssel: Die Durchwachsene<br />
Silphie ist ab diesem Jahr greeningfähig. Das freut mich<br />
wirklich, denn ich finde, die Silphie ist eine ausgesprochen schöne<br />
Pflanze, die zudem viele Vorteile mit sich bringt: sie blüht<br />
von Anfang Juni bis Ende August leuchtend gelb, Bienen<br />
und andere Insekten lieben sie, einmal ausgesät<br />
muss man sich nicht weiter um sie kümmern und<br />
man kann sie viele Jahre hintereinander ernten.<br />
Ich selbst habe die Durchwachsene Silphie im letzten<br />
Jahr bei mir im Garten ausgesät und bin schon<br />
sehr gespannt darauf, sie in diesem Jahr wachsen zu<br />
sehen. Für mich ist das natürlich nur ein Hobby. Für euch<br />
Betreiber von Biogasanlagen eröffnen sich mit der Anerkennung<br />
der Durchwachsenen Silphie als Greeningpflanze ganz neue<br />
Optionen. Auf den 5 Prozent, die als ökologische Vorrangflächen genutzt<br />
werden müssen, könnt ihr nun eine Energiepflanze anbauen,<br />
die eine wirkliche Alternative zum Mais darstellt. Der Biogas-Ertrag<br />
ist vergleichbar. Und ihr spart euch mit der Durchwachsenen Silphie<br />
viel Arbeit und damit Geld, beispielsweise für die jährliche Bodenbearbeitung<br />
oder Ansaat.<br />
Ihr tut etwas für die Insekten, um die es in letzter Zeit wahrlich<br />
nicht besonders gut bestellt ist – und über all das leistet ihr mit<br />
dem Anbau von Silphie einen großen Beitrag für das Image von<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Biogas. Wir können die Landschaft wieder bunter und artenreicher<br />
machen. Biogas kann dazu beitragen, dass es den Insekten wieder<br />
besser geht. Bei der Durchwachsenen Silphie hat die EU-Agrarpolitik<br />
endlich mal eine gute Entscheidung getroffen.<br />
Darum: macht’s mit!<br />
Bestellt noch heute euer Saatgut!<br />
Infos zur Aussaat und dem Anbau der Durchwachsenen Silphie<br />
gibt’s auch bei Dennis Schiele im Fachverband Biogas (0 81 61/98<br />
46 73). Und schickt ihm eure Fotos – von der Aussaat, von den blühenden<br />
Pflanzen und von der Ernte (dennis.schiele@biogas.org).<br />
Wildpflanzen<br />
l zur<br />
Biomasseproduktion<br />
BeiBestellung ellu<br />
lung<br />
bis<br />
31.05.18<br />
.1<br />
erhalten Sie 20% Rabatt<br />
Saaten Zeller GmbH & Co.KG<br />
Ortsstraße 25<br />
63928 Eichenbühl<br />
Fon 09378 – 530<br />
Fax 09378 – 699<br />
info@saaten--zeller.de<br />
Biodiversität auf dem Acker<br />
zur Biomasseproduktion:<br />
• BG 90 neue Rezeptur (mehrjährige, ertragsstarke Arten)<br />
Wildpflanzenmischung mit<br />
mehrjährigen Arten zur Aussaat<br />
z.B. nach GPS oder Gerste<br />
Preis: 28,00 /kg<br />
(280,00 /ha)<br />
Preis gültig bis 31.05.<strong>2018</strong>,<br />
regulärer Preis: 35,00 /kg<br />
Alle Preise gelten zzgl. 7% MwSt<br />
u. Versandkosten<br />
Vorteile im Überblick:<br />
• einmalige Saatgutkosten und langjährige Nutzung für fünf und<br />
mehr Standjahre<br />
• breite Standortanpassung<br />
• für Wasserschutzgebiete geeignet (geringere Erntemengen)<br />
• auch geeignet für Gewässer- und Erosionsschutzstreifen<br />
• Zusätzlicher Lebensraum für Wildtiere, hervorragend für Bienen<br />
• ökologisch wertvoll – geringe Produktionskosten<br />
• bis zu 800 dt. Frischmasseernte pro Hektar bei ca. 30%<br />
Trockenmasse<br />
54
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis<br />
Nacktschnecken in jungem<br />
Bestand bekämpfen<br />
95 Prozent der Setzlinge wuchsen im ersten<br />
Jahr an. Im zweiten Anbaujahr konnte<br />
die Silphie schon 80 Prozent vom ortsüblichen<br />
Maisertrag erzielen. In den folgenden<br />
Anbaujahren bilden sich aus den Stecklingen<br />
sogenannte Horste, aus denen weitere<br />
Stängel austreiben. Mit zunehmender Nutzungsdauer<br />
wachsen immer mehr Pflanzen<br />
aus ausfallenden Samen auf. Bei den Jungpflanzen<br />
sei eine Bekämpfung von Nacktschnecken<br />
angeraten. Auch bei dem Saatverfahren<br />
sollte fünf Tage nach der Aussaat<br />
Schneckenkorn gestreut werden.<br />
Während Niedermeyer mit den Erträgen der<br />
Durchwachsenen Silphie über die Jahre gut<br />
zufrieden ist, sei die Ernte aufgrund suboptimaler<br />
Technik problematisch gewesen.<br />
„Mit reihenunabhängigen Maiserntevorsätzen<br />
am Feldhäcksler funktioniert die Ernte<br />
nicht so gut. Außer das Krone EasyCollect<br />
am Kronehäcksler – das hat im vergangenen<br />
Jahr gut funktioniert. In diesem Jahr wollen<br />
wir einen neuartigen GPS-Erntevorsatz mit<br />
Seitenschneidwerk – ähnlich wie bei Rapsmähwerken<br />
für Mähdrescher – testen“, erklärt<br />
der Biogaserzeuger.<br />
Die Silphie wird um den 20. August gehäckselt<br />
und einsiliert. Das Erntegut hat dann<br />
einen Trockensubstanzgehalt von etwa 25<br />
Prozent. Pflanzensaft tritt kaum aus. Das<br />
Häckselgut lässt sich laut Niedermeyer gut<br />
walzen. Der Silomais wird im Herbst einfach<br />
auf die Silphiesilage aufgeschüttet. Vorher<br />
muss natürlich die Silofolie vom Haufen entfernt<br />
werden. Kühe würden die Silphisilage<br />
nicht fressen.<br />
Hälfte pro Hektar reduziert. Unterfußdünger<br />
zu Mais wird in dem Saatverfahren nicht<br />
abgelegt. Trotzdem erzielt der Mais 50 bis<br />
80 Prozent des Ertrages einer Maisreinsaat.<br />
„Das Donau-Silphie-Verfahren kostet pro<br />
Hektar 1.950 Euro inklusive Saatgut für die<br />
Silphie und den Mais sowie die Arbeits- und<br />
Maschinenkosten. In diesem Jahr werden<br />
wir bundesweit mit insgesamt vier Traktor-<br />
Sämaschinen-Gespannen unterwegs sein.<br />
Ziel ist, 1.500 Hektar in <strong>2018</strong> zu bestellen“,<br />
erklärt Gerd-Hinrich Groß, der ab diesem<br />
Jahr für den Vertrieb der Donau-Silphie<br />
in Norddeutschland zuständig ist.<br />
Anbau bringt Imagegewinn<br />
Bereits ausgesät hat nach dem Donau-<br />
Silphie-Konzept Hermann-Josef Benning<br />
in Reken, Kreis Borken in NRW, nördlich<br />
des Ruhrgebiets. 2,8 Hektar hat er im Mai<br />
vergangenen Jahres bestellt, die sich auf<br />
drei Flächen aufteilen. „Wir haben Schläge<br />
ausgewählt, die vom Zuschnitt der Flächen<br />
nicht so attraktiv sind in der Bewirtschaftung.<br />
Die Samen haben gut gekeimt, sodass<br />
die Saat auf allen Flächen gut aufgelaufen<br />
ist“, berichtet der Biogas-Landwirt. Er sei<br />
immer schon auf der Suche nach Alternativen<br />
zum Mais gewesen, obwohl die Dramatik<br />
des Maisanbaus vor Ort nicht so groß sei.<br />
In der Region spielen Möhren, Kartoffeln,<br />
Spinat und auch Porree eine große Rolle.<br />
Diese Marktfrüchte bestimmen wesentlich<br />
die Pachtpreise. Im Raum Reken habe der<br />
Maisanbau einen relativ geringen Anteil an<br />
der Ackerfläche. „Die Wahrnehmung des<br />
Maisanbaus ist jedoch eine ganz andere, außerdem<br />
wird der gesamte Mais gedanklich<br />
immer mit der Biogasproduktion in Verbindung<br />
gebracht“, erzählt Benning.<br />
Auf einem Viertel der Maisfläche findet kein<br />
Fruchtwechsel statt. Das seien Standorte,<br />
die für die vorgenannten „Spezialkulturen“<br />
unattraktiv sind. Dabei handelt es sich um<br />
moorige oder stark beschattete Felder mit<br />
unwirtschaftlichem Zuschnitt. Es ist gut<br />
vorstellbar, dass auf solchen Standorten in<br />
Zukunft auch die Durchwachsene Silphie<br />
wächst. „Wir bauen die Silphie nicht an, weil<br />
wir ein schlechtes Gewissen haben. Der Mais<br />
hat auch seine ökologische Berechtigung“,<br />
ist Benning überzeugt.<br />
Der Mais wurde auf den Silphieflächen im<br />
vergangenen Jahr Anfang September geerntet.<br />
Die Silphie hatte sich bis dahin gut<br />
entwickelt. Bei der Feldbesichtigung am<br />
Pachtvertrag nur mit Silphieanbau<br />
In diesem Jahr wollen die Borgholzhausener<br />
Landwirte die Silphieanbaufläche ausdehnen.<br />
13 weitere Hektar sollen eingesät<br />
statt bepflanzt werden. Die Fläche ist eine<br />
Pachtfläche. „Die Verpächterin will, dass<br />
dort kein Mais mehr angebaut und keine<br />
Pflanzenschutzmittel mehr aufgebracht<br />
werden. Sie macht uns die Vorgabe, dort<br />
die Silphie anzubauen“, hebt Niedermeyer<br />
hervor. Die Saat geschieht nach dem sogenannten<br />
Donau-Silphie-Konzept, das vom<br />
Energiepark Hahnennest und der Metzler &<br />
Brodmann Saaten GmbH entwickelt worden<br />
ist. Das heißt, dass in einem Arbeitsgang<br />
Mais gelegt und zwischen den Maisreihen<br />
die Silphiesamen abgelegt werden. Dabei<br />
wird die Menge an Maissaatgut um gut die<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Stellenweise stand die Silphie auf dem Acker von<br />
Hermann-Josef Benning Anfang Februar schon auf<br />
einem Meter in der Reihe.<br />
Hermann-Josef Benning (links) und Anton Sieverdingbeck<br />
auf dem Silphieacker in Reken. Die<br />
Maisstoppeln vom letzten Jahr sind noch zu sehen.<br />
Zwischen den Reihen wird die Silphie aufwachsen.<br />
55
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Pflanzung der Silphie auf dem Biolandbetrieb<br />
Kroll-Fiedler im Juni 2012.<br />
Auf dem Betrieb von Christian Kroll-Fiedler musste der Acker nach der Pflanzung<br />
mehrmals mit der Hacke bearbeitet werden, um die Unkräuter zu beseitigen.<br />
1. Februar konnten schon erste Triebe gesichtet werden.<br />
Je nach Witterung sollen die Silphieflächen mit Gärdünger<br />
früh angedüngt werden. Jedoch ist darauf zu achten,<br />
dass auf den sandigen Böden kein Nitrat ausgewaschen<br />
wird. Einen Imagegewinn haben Bennings schon erreicht:<br />
Drei Imker haben angefragt, ob sie die Flächen<br />
mit Bienen befliegen dürfen.<br />
„Einen Imagegewinn bringt sicherlich auch die Aussaat<br />
als Randstreifen an Gewässern. Mir ist ein Betrieb bekannt,<br />
der hat auf die Arbeitsbreite der Häckseltechnik<br />
angepasst einen Gewässerstreifen angelegt. So hat er<br />
Ruhe mit den Kontrollbehörden“, erzählt Anton Sieverdingbeck<br />
aus dem benachbarten Velen, der beim Gespräch<br />
mit Hermann-Josef Benning dabei ist. Er selbst<br />
hat im vergangenen Jahr die Silphie auf 0,25 Hektar<br />
versuchsweise aussäen lassen. Aufgelaufen sei sie leider<br />
nicht. Über die Gründe kann er nur spekulieren.<br />
Dass nur das Maissaatgut abgerechnet worden sei, lobt<br />
er als faire Geste. Voll des Lobes ist auch Benning über<br />
die Betreuung durch die Metzler & Brodmann Saaten<br />
GmbH. Wie sich die Silphie in den nächsten Jahren in<br />
Reken schlägt, bleibt abzuwarten.<br />
Nische im Biobetrieb mit Biogas<br />
Nicht gesät, sondern gepflanzt hat auch Christian Kroll-<br />
Fiedler die Silphie in 2012 auf 1,5 Hektar. Seine Frau<br />
hatte die Pflanze damals entdeckt. Kroll-Fiedler bewirtschaftet<br />
in Warstein (NRW) mit seiner Familie einen<br />
145-Hektar-Betrieb ökologisch nach den Kriterien des<br />
Bioland-Anbauverbandes. Biolandbetrieb ist der Hof<br />
seit 1989, die Biogasanlage betreibt er seit 1998. „Die<br />
100-kW-Anlage passt gut in unseren Betrieb. Es war<br />
schnell klar, dass wir nicht ohne Mais aus konventioneller<br />
Landwirtschaft auskommen würden. Allerdings<br />
benötigen wir nur 10 Hektar Mais. Wir vergären im<br />
Wesentlichen Mist und Gülle von unserem Hof sowie<br />
von anderen ökologisch wirtschaftenden Betrieben“,<br />
erklärt Christian Kroll-Fiedler.<br />
56
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis<br />
Fotos: Kroll-Fiedler<br />
Silphieacker von Kroll-Fiedler im späten Frühjahr. Die verbliebene Verunkrautung<br />
macht der Silphie nichts. Sie wächst darüber hinweg.<br />
Gelb blühende Durchwachsene Silphie, wie sie sich ab dem zweiten Anbaujahr<br />
in der Landschaft zeigt. Hier auf dem Betrieb Kroll-Fiedler.<br />
Auf die Höfe gelangt später Gärdünger wieder zurück,<br />
um den Nährstoffkreislauf zu schließen. Nach Angaben<br />
des Biolandwirts sei Kleegras schwierig zu vergären,<br />
da es zur Schwimmdeckenbildung neige. Die Silphie<br />
mache diese Probleme nicht. Dennoch setzt er auch<br />
eine gewisse Menge Kleegras ein. Das Pflanzgut hat<br />
Kroll-Fiedler wie Niedermeyer von Chrestensen damals<br />
bezogen. „Mit einer Gemüsepflanzmaschine haben<br />
wir das Pflanzgut ins Feld gesetzt. 3,5 Pflanzen pro<br />
Quadratmeter haben wir gepflanzt. Der Reihenabstand<br />
beträgt 45 Zentimeter. Der Abstand ist angepasst auf<br />
die Hackmaschine. Im ersten Jahr mussten wir mehrmals<br />
den Bestand durchhacken, weil immer wieder in<br />
bestimmten Wellen Unkraut aufwuchs“, blickt Kroll-<br />
Fiedler zurück.<br />
Schon damals hatte er sich neben den Setzlingen auch<br />
Saatgut besorgt. Das hat er einer in der Nähe befindlichen<br />
Gärtnerei gegeben. In der Gärtnerei wurde das<br />
Saatgut für die Keimung vorbereitet. Die sehr hohe<br />
Keimrate sorgte dafür, dass sehr viele Pflanzen aufliefen<br />
und pikiert werden konnten. Die aus den Samen<br />
gezogenen Pflanzen hat Kroll-Fiedler später überwiegend<br />
verschenkt.<br />
Das Pflanzgut hat ihn damals auch 5.000 Euro pro<br />
Hektar gekostet. Gepflanzt wurde 2012 im Juni nach<br />
einer Winterzwischenfrucht als Vorfrucht. Der Standort<br />
ist ein Lehmboden mit guter Wasserversorgung im<br />
Höhenzug Haarstrang, der sich nördlich des Sauerlandes<br />
befindet und von Dortmund von West nach Ost verläuft.<br />
Die Fläche ist ein schwieriger Ackerstandort, kein<br />
Hochertragsstandort. Der Mais sei dort gut gewachsen –<br />
was die Durchwachsene Silphie dort ebenfalls mache.<br />
Da die Silphiesilage mit den anderen Gärsubstraten<br />
vergoren wird und ihr Anteil sehr gering ist, kann Kroll-<br />
Fiedler keine Angaben über den Gasertrag in seiner<br />
Biogasanlage machen. Er empfiehlt, die Kulturpflanze<br />
früh zu ernten, damit sie nicht zu sehr verholzt. Für die<br />
Ernte eigne sich am besten ein Krone-Maiserntevorsatz<br />
vor dem Häcksler.<br />
Kroll-Fiedler findet die sogenannte Becherpflanze spannend,<br />
weil sie nicht nur ökologische Vorteile wie Bienenweide,<br />
Erosionsschutz und Humusaufbau bietet,<br />
sondern weil sie ohne Pflanzenschutzmittel auskommt,<br />
nur gedüngt werden muss und ähnlich hohe Biomasseerträge<br />
an seinem Standort liefert wie der Mais. Im<br />
zeitigen Frühjahr bringt er 30 Kubikmeter Gärdünger<br />
aus – daraus muss die Silphie ihren Ertrag realisieren.<br />
Ausdehnen kann er den Silphieanbau nicht, da er seine<br />
Felder für den Leguminosenanbau benötigt, die Luftstickstoff<br />
über die Knöllchenbakterien an den Wurzeln<br />
binden und so in den Boden bringen. Diesen Stickstoff<br />
benötigen andere Kulturpflanzen wie Getreide in der<br />
Fruchtfolge zur Ertragsbildung.<br />
Die Pioniere des Silphieanbaus zeigen, dass sowohl<br />
Pflanzung als auch die Saat für die Etablierung eines<br />
Bestandes erfolgreich sind. Aus Kostengründen und weil<br />
der Mais im ersten Jahr genutzt werden kann, wird sich in<br />
Zukunft wohl das Untersaatverfahren etablieren.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
TOP Thema<br />
Ernte des Silphiebestandes<br />
mit dem<br />
Feldhäcksler und einem<br />
reihenunabhängigen<br />
Kemper-Maiserntevorsatz.<br />
Dieses Maisgebiss<br />
stößt bei der Silphie an<br />
seine Grenzen.<br />
57
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Trotz hoher Erträge leicht steigende Preise<br />
Zum nunmehr achten Mal wurden die Substratpreise der zurückliegenden Ernte des Jahres 2017 durch den<br />
Fachverband Biogas e.V. abgefragt. Trotz der in vielen Regionen guten Erträge stiegen die Preise vieler Energiepflanzen<br />
im Vergleich zum Vorjahr.<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
7%<br />
6%<br />
Die Erfassung der Daten gestaltete<br />
sich in diesem Jahr etwas<br />
schwieriger. Erstmals war eine<br />
zusätzliche Nachfassaktion<br />
notwendig, um eine halbwegs<br />
ausreichende Datengrundlage zu erhalten.<br />
Am Ende erreichte die Geschäftsstelle des<br />
Fachverbandes Biogas lediglich 134 verwertbare<br />
Datensätze – halb so viel wie im<br />
Vorjahr. Aufgrund mangelnder Datengrundlage<br />
können deshalb bei dieser Ausgabe<br />
keine Ergebnisse zu Preisen von Gülle, Mist<br />
oder Gärprodukten gezeigt werden.<br />
Bei den Energiepflanzen vereint – wie in<br />
den Vorjahren – der Silomais die meisten<br />
Rückmeldungen auf sich, gefolgt von Grassilage<br />
und Getreide-GPS. Wie in Abbildung<br />
1 links zu sehen ist, sind allerdings nur<br />
ein Drittel der eingegangenen Datensätze<br />
Preisangaben zu Silomais. Neben klassischen<br />
Substraten wie Grassilage, Getreide-<br />
GPS und Zuckerüben wurden auch vereinzelt<br />
Preise für sogenannte alternative<br />
Energiepflanzen übermittelt.<br />
Insgesamt entfallen 13 Prozent der Preisangaben<br />
auf nicht-klassische Energiepflanzen.<br />
Gehäuft genannt wurden Riesenweizengras<br />
und die Durchwachsene Silphie.<br />
Auch wenn die zugehörigen Flächen berücksichtigt<br />
werden, zeigt sich ein Trend<br />
hin zu mehr Vielfalt. Nachdem der Silomais<br />
lange Jahre bei zwei Drittel der gemeldeten<br />
Fläche stand, ist es diesmal nur gut die<br />
Hälfte (siehe Abbildung 1 rechts). Profiteur<br />
war dieses Jahr insbesondere die Grassilage.<br />
Durch die zahlreichen Niederschläge<br />
war 2017 in vielen Regionen ein gutes<br />
„Futterjahr“ und Biogasanlagen konnten<br />
überschüssige Mengen von benachbarten<br />
Betrieben nutzen.<br />
Erträge um rund 10 Prozent<br />
gestiegen<br />
In der Tabelle auf Seite 61 sind die wichtigsten<br />
Ergebnisse der Umfrage für die Substrate<br />
mit ausreichend vielen Rückmeldungen<br />
zusammengefasst. Neben den Nettopreisen<br />
stehend ab Feld (oberer Teil der Tabelle)<br />
und frei Silo (unterer Teil der Tabelle) sind<br />
dort auch die Mittelwerte des Ertrags sowie<br />
des Trockenmassegehalts aufgelistet. Nach<br />
der schon im letzten Jahr positiven Ertragsentwicklung<br />
konnten die Erträge bei den<br />
meisten Kulturen (Silomais, Grassilage,<br />
Grünroggen) nochmals um rund 10 Prozent<br />
gesteigert werden. Sehenswert waren auch<br />
die gemeldeten Erträge von Riesenweizengras<br />
und der Durchwachsenen Silphie mit<br />
Abbildung 1: Anteile der Substrate (links Anzahl der Rückmeldungen, rechts Fläche der Rückmeldungen)<br />
8%<br />
6%<br />
3%<br />
3%<br />
7%<br />
33%<br />
33%<br />
14%<br />
Silomais<br />
14%<br />
Grassilage Silomais<br />
Grassilage<br />
Getreide-GPS<br />
Getreide-GPS<br />
Grünroggen Grünroggen<br />
Getreidekorn<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben<br />
Zuckerrüben Riesenweizengras<br />
Durchw. Silphie<br />
Riesenweizengras<br />
Sonstige<br />
Durchw. Silphie<br />
23%<br />
Sonstige<br />
jeweils 42 Tonnen Frischmasse pro Hektar.<br />
Einschränkend muss hier aber erwähnt werden,<br />
dass dem Ergebnis eine kleine Zahl an<br />
Rückmeldungen gegenübersteht.<br />
Trotz eigentlich zufriedenstellender Erträge<br />
war bei vielen Substraten eine leichte<br />
Preissteigerung festzustellen. Dies kann<br />
mit den zum Teil sehr schwierigen Erntebedingungen<br />
gerade im Norden Deutschlands<br />
zusammenhängen. In manchen Regionen<br />
konnte im Herbst sogar überhaupt nicht<br />
geerntet werden. Gerade Silomais und Zuckerrüben<br />
stehen dort noch heute auf den<br />
Feldern. Silomais als wichtigste Kultur<br />
wurde im Schnitt für 83 Euro je Tonne Trockenmasse<br />
ab Feld und 106 Euro je Tonne<br />
Trockenmasse frei Silo gehandelt (siehe<br />
Abbildungen 2 und 3).<br />
Umgerechnet auf die Frischmasse ergeben<br />
sich Preise in Höhe von 28 beziehungsweise<br />
35 Euro je Tonne. Beim Vergleich mit dem<br />
Vorjahr fällt auf, dass der Trockenmassepreis<br />
gestiegen ist, während der Frischmassepreis<br />
konstant geblieben beziehungsweise leicht<br />
gesunken ist. Dies liegt daran, dass im Jahr<br />
2017 im Schnitt feuchter geerntet wurde<br />
und verdeutlicht, dass Betreiber je nach<br />
Abrechenart beim Preisvergleich genau hinschauen<br />
müssen. Dies gilt verstärkt für den<br />
2% 2% 0% 4%<br />
0%<br />
2%<br />
53%<br />
Silomais<br />
2% 2% 0% 4%<br />
0%<br />
2%<br />
53%<br />
Grassilage Silomais<br />
Grassilage<br />
Getreide-GPS<br />
Getreide-GPS<br />
Grünroggen Grünroggen<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben<br />
Zuckerrüben Riesenweizengras<br />
Riesenweizengras<br />
Durchw. Silphie<br />
Sonstige<br />
Durchw. Silphie<br />
Sonstige<br />
16%<br />
18%<br />
23%<br />
Quelle: FvB <strong>2018</strong><br />
Quelle: FvB 2017<br />
58<br />
18%
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis<br />
Abbildung 2: Trockenmassepreise im Vergleich<br />
160,0<br />
140,0<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t TM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t TM]<br />
144,3<br />
124,4<br />
120,0<br />
Substratpreis in €/t TM<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
82,6<br />
105,5<br />
59,5<br />
88,0<br />
81,8<br />
100,9<br />
69,6<br />
40,0<br />
20,0<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t TM]<br />
Mittlerer Preis 0,0 frei Silo [€/t TM]<br />
Abbildung 3: Frischmassepreise im Vergleich<br />
144,3<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben<br />
Anmerkung: Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mitte<br />
124,4<br />
82,6<br />
105,5<br />
40,0<br />
35,0<br />
Mittlerer Preis stehend 100,9 ab Feld [€/t FM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t FM]<br />
88,0<br />
35,2<br />
81,8<br />
36,5<br />
144,3<br />
Substratpreis in €/t FM<br />
30,0<br />
25,0<br />
59,5<br />
27,5<br />
30,5<br />
29,6<br />
69,6<br />
28,3<br />
20,0<br />
20,6 20,5<br />
15,0<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben<br />
Quelle: FvB <strong>2018</strong><br />
Anmerkung: Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mitte<br />
Fall, dass Biomasse ab Feld gekauft wird.<br />
Insgesamt liegen Silomais und Getreide-<br />
GPS weiterhin in der gleichen Preiskategorie.<br />
Günstiger angeboten wird Grassilage.<br />
Bei einem Kauf ab Wiese sind die hohen<br />
Ernte- und Transportkosten zu berücksichtigen.<br />
Deshalb ist der große Unterschied<br />
beim Vergleich der Preise auf der Wiese (60<br />
Euro je Tonne Trockenmasse; 88 Euro je<br />
Tonne Frischmasse) und im Silo (21 Euro<br />
je Tonne Trockenmasse; 31 Euro je Tonne<br />
Frischmasse) gut nachvollziehbar. Die<br />
Substrate mit einer hohen Energiedichte<br />
(Getreidekorn und Zuckerrüben) erreichen<br />
die höchsten Trockenmassepreise. Bei den<br />
alternativen Energiepflanzen konnte kein<br />
repräsentativer Wert erfasst werden.<br />
Für künftige Ausschreibungen<br />
die Rohstoffkosten kennen<br />
Wichtig für viele Anlagen ist gerade auch<br />
vor dem Hintergrund der zukünftigen<br />
Ausschreibungen, welche Stromgestehungskosten<br />
aus den genannten Preisen<br />
resultieren. Zuerst muss bedacht werden,<br />
dass die Kosten für Lagerung und<br />
Entnahme aus dem Silo und Transport<br />
zur Einbringung hinzugerechnet werden<br />
müssen. Hier können pauschal 6 Euro<br />
je Tonne Frischmasse angenommen werden.<br />
Die Kosten für Silomais frei Fermenter<br />
lagen damit 2017 im Schnitt bei etwa<br />
41 Euro je Tonne Frischmasse. Bei Standardgaserträgen<br />
und einem Nutzungsgrad<br />
von 39 Prozent resultieren daraus<br />
59<br />
WWW.TERBRACK-MASCHINENBAU.DE
praxis<br />
135,7<br />
122,3<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
119,5<br />
Abbildung 1204: Substratpreisindex für NawaRo<br />
116,8<br />
135,7<br />
Substratpreisindex<br />
Substratpreisindex<br />
113,8 122,3<br />
111,9<br />
119,5 112,2<br />
120 110,8<br />
116,8<br />
110 108,3<br />
108,8 108,9<br />
113,8 106,7 107,6<br />
107,6<br />
105,9<br />
106,3<br />
112,2<br />
111,5<br />
111,9 105,4<br />
110,8<br />
111,3<br />
110 108,3 102,9<br />
108,8 108,9<br />
102,4<br />
103,0<br />
106,7 107,6<br />
107,6<br />
101,4<br />
105,9 100,6<br />
106,3<br />
105,4<br />
100,7<br />
99,9<br />
104,8<br />
100 102,9 102,4<br />
98,0<br />
103,0<br />
101,4<br />
100,3<br />
100,6<br />
97,196,9<br />
97,6<br />
100,7<br />
99,9<br />
100,1 99,9<br />
100<br />
94,8<br />
98,0<br />
94,7<br />
97,196,9<br />
97,6<br />
94,891,7<br />
94,7<br />
91,2<br />
90<br />
91,7<br />
91,2<br />
90<br />
86,1<br />
86,1<br />
85,9<br />
85,9<br />
84,2<br />
84,2<br />
111,5<br />
111,3<br />
104,8<br />
109,1<br />
100,3 107,5<br />
106,0<br />
100,1 99,9<br />
103,0<br />
101,1 101,6<br />
100,1<br />
10<br />
106,0<br />
103,0<br />
1<br />
80 80<br />
Index 2011 Index 2012 Index 2013 Index 2014 Index 2015 Index 2016 Index 2017<br />
Index 2011 Index 2012 Index 2013 Index 2014 Index 2015 Index 2016 Index 2017<br />
Silomais Silomais Grassilage Grassilage Getreide-GPS Getreide-GPS Getreidekorn Getreidekorn Grünroggen Zuckerrüben Grünroggen Zuckerrüben Biomasseindex Biom<br />
Quelle: FvB FvB <strong>2018</strong> <strong>2018</strong> Anmerkung: Anmerkung:<br />
Stand Januar<br />
Substratpreisindex im Vergleich zum Jahr 2010 (2010 = 100); Ausnahme: Zuckerrüben (2011 = 100)<br />
Stand Januar<br />
Substratpreisindex im Vergleich zum Jahr 2010 (2010 = 100); Ausnahme: Zuckerrüben (2011 = 100)<br />
Stromgestehungskosten von 9,6 Cent je<br />
Kilowattstunde (ct/kWh). Getreide-GPS<br />
liegt etwas höher. Bei maximalen Vergütungen<br />
von unter 17 ct/kWh im Ausschreibungsmodell<br />
sind die Rohstoffkosten im<br />
Auge zu behalten.<br />
Die Entwicklung der Biomassepreise in Relation<br />
zu den Vorjahren zeigt Abbildung 4.<br />
Das Basisjahr für den dort gezeigten Substratpreisindex<br />
ist 2010. Die jeweils rechte<br />
Säule zeigt den Indexwert für das Jahr<br />
2017 an. Dieser liegt je nach Kultur mal<br />
oberhalb mal unterhalb des Wertes für<br />
2016. Der Gesamtindex zeigt eine leichte<br />
Preissteigerung um 1,5 Prozentpunkte von<br />
100,1 auf 101,6.<br />
Fazit: Die<br />
Biomassepreise scheinen sich mit Ausnahme<br />
des Jahres 2015 halbwegs stabilisiert<br />
zu haben. Klar ist aber auch, dass Wetterereignisse<br />
oder Trends auf den Agrarmärkten<br />
die Preise schnell verändern können.<br />
Spannend wird sein, wie sich im Norden<br />
die extrem feuchten Bedingungen auf das<br />
kommende Erntejahr auswirken. Im Süden<br />
Sicherheit durch Füllstandsüberwachung ...<br />
... mit dem Kugelschalter KSS (seitlich) bzw. KST (oben):<br />
• Prüfen auf sichere Funktion jederzeit von außen ohne Aufstauen möglich<br />
• Nur ein bewegliches mechanisches Teil, mit dem die VA-Schwimmerkugel<br />
den außerhalb des Gasbereichs liegenden NAMUR-Sensor sicher schaltet<br />
• Alle mechanischen Teile aus VA<br />
• Keine aufwendige Elektronik<br />
• Draht- und Sensor-bruchsicherer Aufbau mit Ex-i-Trennschaltverstärker<br />
Jetzt schon<br />
nachrüsten – bald<br />
wird die Füllstandsüberwachung<br />
zur<br />
Pflicht!<br />
Seitz Electric GmbH Saalfeldweg 6 86637 Wertingen / Bliensbach<br />
08272 99316-0 info@seitz-electric.de www.seitz-electric.de<br />
60
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis<br />
Biomassepreise 2017 Stand Januar <strong>2018</strong><br />
Substrat ab Feld<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/ha]<br />
Silomais 1) 82,6 33,3 27,5 51,6 1.420<br />
Grassilage 2) 59,5 34,7 20,6 28,0 578<br />
Getreide-GPS 2) 81,8 36,2 29,6 36,3 1.075<br />
Grünroggen 3) 69,6 29,5 20,5 29,0 595<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben 3) 124,4 22,7 28,3 89,5 2.531<br />
Substrat frei Silo<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/ha]<br />
Silomais 2) 105,5 33,3 35,2 51,6 1.813<br />
Grassilage 2) 88,0 34,7 30,5 28,0 854<br />
Getreide-GPS 3) 100,9 36,2 36,5 36,3 1.326<br />
Grünroggen<br />
Getreidekorn 3) 144,3 86,7 125,1 7,4 922<br />
Zuckerrüben<br />
Anmerkung:<br />
Nettopreise mit korrigierten Mittelwerten; je mehr Daten vorhanden sind, desto höher kann das Perzentil gewählt werden<br />
1) 10 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 90 % Perzentil<br />
2) 20 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 80 % Perzentil<br />
3) 40 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 60 % Perzentil FvB <strong>2018</strong><br />
sollten im Gegensatz dazu die Lager gut<br />
gefüllt sein, sodass schlechte Witterungsbedingungen<br />
den Landwirt nicht direkt in<br />
Zugzwang bringen.<br />
Hinweis: Wie jedes Jahr bestehen die vorgestellten<br />
Preis- und Mengenangaben aus<br />
Mittelwerten. Es bestanden bei den eingegangenen<br />
Fragebögen jedoch zum Teil erhebliche<br />
regionale Unterschiede. Die Zahlen<br />
dienen aus diesem Grund der besseren<br />
Orientierung und können nicht auf bestehende<br />
Lieferverträge angewandt werden.<br />
Der Fachverband Biogas e.V. wird auch dieses<br />
Jahr eine Umfrage unter seinen Betreibermitgliedern<br />
durchführen. Um auch in<br />
Zukunft eine transparente Preisverteilung<br />
darstellen und Trends beobachten zu können,<br />
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.<br />
Vielen Dank noch einmal an alle Betreiber,<br />
die durch die Rücksendung des ausgefüllten<br />
Fragebogens dazu beigetragen haben,<br />
dass auch dieses Jahr eine aussagekräftige<br />
und hilfreiche Analyse der Substratpreise<br />
veröffentlicht werden konnte.<br />
Autor<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
61
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Innovationen zur<br />
Ertragssteigerung<br />
Die Erzeugung von Biogas effizienter<br />
gestalten und den Ertrag von Anlagen<br />
steigern – dieses Ziel verfolgen gleich<br />
zwei Produkte der greentec-service GmbH<br />
aus Föhren bei Trier, die das Unternehmen<br />
seit kurzem auf Messen vorstellt.<br />
Von Dipl.-Geograph Martin Frey<br />
An der Biogasanlage<br />
von Klaus Hölzl im<br />
oberbayerischen<br />
Schwindegg kommt<br />
eine der ersten<br />
Suprajet-Anlagen von<br />
greentec zum Einsatz.<br />
Klaus Hölzl hat die Investition überzeugt: „Der Suprajet hat eine<br />
sehr effektive Futterausbeute durch den Zellaufschluss.“<br />
Das Biogas-Service-Unternehmen aus der<br />
Ökobit-Unternehmensgruppe bietet zum<br />
einen mit dem „Suprajet“ ein Gerät, das<br />
zur Optimierung des Substrataufschlusses<br />
beitragen kann. Zweitens bringt es mit einer<br />
Elektrolyseeinheit mit dem Namen „Bio-H2-Plus“<br />
eine neuartige Technologie auf den Markt, die durch die<br />
interne Verwendung des erzeugten Wasserstoffes den<br />
Anlagenprozess unterstützen soll.<br />
Der Biogasprozess bietet an vielen Stellen Möglichkeiten<br />
zur Optimierung. Dies gilt vor allem, wenn anhand<br />
einer Restgas-Potenzialanalyse des Gärrestes feststeht,<br />
dass nicht der gesamte organische Anteil der Einsatzstoffe<br />
zur Biogaserzeugung genutzt wird. Wird das<br />
Substrat einer solchen Anlage genauer untersucht, so<br />
finden sich oft sogenannte strukturviskose Materialien,<br />
die schwer zu rühren sind, dann zu Schwimmschichtenbildung<br />
neigen und die auf klassische Weise nur<br />
durch wesentlich längere Verweilzeiten komplett vergärbar<br />
sind. An dieser Stelle setzt der Suprajet an, den<br />
greentec-service GmbH seit 2017 anbietet.<br />
Aufgeschlossene Zellmembranen sollen<br />
mehr Gas liefern<br />
Mit der Suprajet-Anlage wird die Biomasse durch Aufbrechen<br />
von Zellmembranen aufgeschlossen, damit<br />
die Bakterien im Biogasprozess die vergärbaren<br />
Stoffe besser angreifen können.<br />
Auf diese Weise können nach Unternehmensangaben<br />
bis zu 15 Prozent mehr an<br />
Gas- und somit auch Stromertrag sowie in<br />
einigen Fällen sogar ein höherer Methangehalt<br />
im Biogas erzielt werden.<br />
„Unser Ansatz war, die Biogasanlage<br />
in ihrem Prozess zu unterstützen“, erklärt<br />
greentec-service-Geschäftsführer<br />
Christoph Spurk die Entwicklungsleistung.<br />
Insofern habe man sich auf die<br />
Unterstützung der im Abbauprozess geschwindigkeitsbestimmenden<br />
Hydrolyse<br />
konzentriert, die die komplexen hochmolekularen<br />
Substanzen in niedermolekulare<br />
umwandelt.<br />
Im Wesentlichen basiert die Funktionsweise<br />
des Suprajet auf der Ausnutzung<br />
der sogenannten Kavitation zur Aufspal-<br />
Fotos: Bioenergie Hölzl<br />
62
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
praxis<br />
tung des Materials. Unter diesem Begriff ist der physikalische<br />
Effekt zu verstehen, dass sich in Flüssigkeiten<br />
bei hohen Fließgeschwindigkeiten spontan Dampfbläschen<br />
bilden können. Diese haben die Eigenschaft,<br />
dass sie nach kurzer Zeit in sich zusammenfallen und<br />
dabei einen extrem hohen Druck freisetzen. Dieser<br />
kann entweder zu Schäden führen, etwa<br />
an Metallen, wie bei Schiffsschrauben bekannt.<br />
Gezielt eingesetzt kann dieser Effekt<br />
jedoch auch ohne sonstige Schäden<br />
technisch genutzt werden, wie eben beim<br />
Suprajet.<br />
Kavitationsdüse ist das Herzstück<br />
Der Suprajet wird dazu im Anlagenprozess<br />
am Fermenter platziert, um das Substrat<br />
dort zu entnehmen und nach der Behandlung<br />
auch dort wieder einzuspeisen. Bei<br />
zwei Fermentern kann die Synergie genutzt<br />
werden, beide mit dem Suprajet zu<br />
verbinden, um dann abwechselnd beide<br />
Substrate zu behandeln. Die Förderleistung<br />
der Anlage beträgt zwischen 6 und<br />
12 Kubikmeter pro Stunde.<br />
Beim Betrieb kann das Substrat nicht sofort<br />
durch das Herzstück der Anlage, die<br />
sogenannte Kavitationsdüse, gepresst<br />
werden, da diese verstopfen würde. Daher<br />
werden zunächst Störstoffe ausgesiebt und grobfaseriges<br />
Material durch eine Schneidevorrichtung grob<br />
zerkleinert. „Dieser Schritt dient dem Schutz und<br />
der Schonung der nachfolgenden Aggregate“, so Geschäftsführer<br />
Spurk.<br />
Eine große Exzenterschneckenpumpe saugt das Substrat<br />
an und pumpt es zu der Kavitationsdüse. Hier<br />
ist extrem hoher Druck gefragt: Vor der Düse steht das<br />
Substrat unter 8 bis 10 bar. „Direkt am Ausgang der<br />
Düse entsteht die Kavitation, die in dem danach folgenden<br />
Behälter, der zur Druckentspannung des Substrates<br />
dient, verstärkt wird“, beschreibt Spurk den<br />
Vorgang, bei dem die Aufspaltung erfolgt.<br />
Mehrmaliger Durchlauf möglich<br />
Manche Substratanteile müssen dabei mehrmals die<br />
Düse passieren, um den gewünschten Effekt zu verstärken:<br />
Welchen Weg sie nehmen, entscheidet sich in<br />
dem Entspannungsbehälter, wo die Entwickler die mit<br />
der dortigen Drehbewegung des Substrates verbundene<br />
Zentrifugalkraft ausnutzten, um die großen Partikel am<br />
Rand des Behälters abzusaugen.<br />
Von dort können sie über einen Bypass zurück vor die<br />
Düse gebracht werden. „Somit durchlaufen nicht zerkleinerte<br />
Partikel den Prozess so lange, bis sie klein<br />
genug sind, um die Anlage passieren zu können“,<br />
beschreibt Spurk den Vorgang. Von dort pumpt dann<br />
eine kleinere Exzenterschneckenpumpe das Substrat<br />
zurück in den Fermenter.<br />
Foto: greentec-service GmbH<br />
Zwar bieten auch andere Hersteller Anlagen zur Aufspaltung<br />
von Substrat an. Allerdings habe der Suprajet<br />
laut greentec jenen gegenüber die Vorteile, dass<br />
seine Behandlungsintensität stufenlos einstellbar sei<br />
und durch die Erzeugung der Kavitation mittels einer<br />
Düse die hohen physikalischen Kräfte der Druckentspannung<br />
und die Genauigkeit der Behandlung der<br />
Kernströmung optimal genutzt werden können.<br />
Zudem ergebe sich, dass sich die Vorrichtung bei einer<br />
eventuellen Erweiterung der Biogasanlage oder bei Änderungen<br />
im Prozess individuell anpassen lasse, ohne<br />
technisch in die Anlage eingreifen zu müssen. Wäre<br />
dies nicht der Fall, lasse sich nicht adäquat reagieren<br />
beziehungsweise müssten zusätzlich weitere Einheiten<br />
dazu gekauft werden, was die Umstellung natürlich<br />
kostspieliger mache. Außerdem sei das Verschleißpotenzial<br />
überschaubar, da das Herzstück keine beweglichen<br />
Teile besitzt.<br />
Einsatzgebiete<br />
In das Verfahren, das ursprünglich aus der Lebensmittelindustrie<br />
stammt, hat die Unternehmensgruppe<br />
Ökobit über sechs Jahre Entwicklungsarbeit investiert.<br />
Es eignet sich nach Angaben des Unternehmens primär<br />
für Anlagen, die schwierige Substrate wie große<br />
Mengen Mist oder Grassilage verarbeiten. Der Einsatz<br />
verbessere die Viskosität im Prozess, es träten keine<br />
Schwimmschichten mehr auf und die Betriebszeiten<br />
der Rührwerke könnten gesenkt werden. Bei Anlagen,<br />
die viel Mais vergären, der ja bereits gut vergärbar sei,<br />
fördere der Suprajet immerhin die Geschwindigkeit der<br />
Ausgasung, sodass auch jene Betreiber die Verweilzeiten<br />
optimieren und die Leistung ihrer Anlage steigern<br />
könnten. Neben dem genannten Zugewinn an Stromertrag<br />
von bis zu 15 Prozent soll der Suprajet auch<br />
Der Elektrolyseur Bio-<br />
H2-Plus von greentec<br />
erzeugt Wasserstoff,<br />
der mittels einer Injektionslanze<br />
direkt ins<br />
Substrat im Fermenter<br />
eingeführt wird, um die<br />
Effizienz der Biogasanlage<br />
zu steigern.<br />
63
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Der Suprajet auf einem<br />
Anhänger montiert,<br />
dient dem zeitweisen<br />
Mietbetrieb auf<br />
Biogasanlagen. Am<br />
linken Bildrand hinter<br />
dem Manometer (siehe<br />
roter Pfeil) sitzt das<br />
Herzstück der Anlage –<br />
die Kavitationsdüse.<br />
„Ich war der<br />
Meinung, dass<br />
noch mehr<br />
Leistung aus<br />
dem Futter<br />
herauszuholen<br />
sein muss“<br />
Klaus Hölzl<br />
Foto: greentec-service GmbH<br />
eine Reduzierung der Rührwerklaufzeiten um bis zur<br />
Hälfte ermöglichen, was entsprechend auch weniger<br />
Strombedarf bedeutet. In einer Beispielrechnung für<br />
eine 600-kW-Anlage mit einem Wirkungsgrad von 40<br />
Prozent und 8.200 Volllaststunden im Jahr kommt<br />
greentec-service auf ein Ergebnis von knapp 60.000<br />
Euro pro Jahr, was eine statische Amortisation von 2,2<br />
Jahren ermögliche. Angeboten wird die Anlage in einem<br />
Containermodul. Nach Unternehmensangaben sind bei<br />
Kunden bereits zwei Anlagen im Betrieb und eine weitere<br />
werde gerade gefertigt.<br />
Eine der ersten wurde in Schwindegg<br />
im oberbayerischen Landkreis Mühldorf<br />
am Inn angeschafft: Klaus Hölzl<br />
ist der Betreiber der dortigen Biogasanlage<br />
der Bioenergie Hölzl. Diese<br />
hat eine elektrische Leistung von 1,7<br />
Megawatt (MW). Nach Inbetriebnahme<br />
im Jahr 2006 hat sie Hölzl inzwischen<br />
mehrfach modernisiert und für<br />
die flexible Fahrweise ausgerüstet.<br />
Hierzu trägt unter anderem ein 2.800<br />
Kubikmeter großer Gasspeicher sowie<br />
ein 100 Kubikmeter fassender Wärmepufferspeicher<br />
bei.<br />
Klaus Hölzl hat die Investition überzeugt:<br />
„Der Suprajet verbessert eine<br />
effektive Futterausbeute durch den<br />
Zellaufschluss. Ich hatte schon immer<br />
viel Interesse an neuen Technologien und war der Meinung,<br />
dass noch mehr Leistung aus dem Futter herauszuholen<br />
sein muss“. So sei es ein Glücksfall gewesen,<br />
dass ihn sein Berater für die Biogasanlage im Frühjahr<br />
2016 auf den Suprajet aufmerksam gemacht habe.<br />
Pro Tag sei der Suprajet an seiner Biogasanlage für acht<br />
Stunden im Einsatz gewesen. Durch die Behandlung<br />
war es möglich, dass der Substratmix angepasst werden<br />
konnte hin zu deutlich faserigeren und trockeneren<br />
Inputstoffen. Dabei sei trotz 13 Prozent Trockensubstanzgehalt<br />
im Fermenter der Inhalt deutlich homogener<br />
und fließfähiger geworden. Hölzl<br />
berichtet: „Dadurch haben wir unsere<br />
Rührzeiten um die Hälfte halbieren<br />
können.“ Zudem sei der Stromertrag<br />
bei gleicher Futtermenge, aber mit<br />
mehr schwer verdaulichem Material<br />
und weniger Maiseinsatz täglich um<br />
ca. 1.200 bis 1.500 Kilowattstunden<br />
(kWh) gestiegen. Unterm Strich bedeute<br />
dies für ihn: „Die Amortisation liegt<br />
an meiner Anlage bei zwei Jahren.“<br />
Elektrolyseur als weitere<br />
Innovation<br />
Mit einer weiteren Innovation, dem<br />
Elektrolyseur Bio-H2-Plus, richtet<br />
sich greentec speziell an Betreiber von<br />
Biogasanlagen, die bereits über einen gut funktionierenden<br />
Prozess verfügen, diesen aber noch effizienter<br />
gestalten möchten. Die in einem Container, der Hydrobox,<br />
gelieferte Anlage, erzeugt Wasserstoff, der mittels<br />
einer Injektionslanze direkt ins Substrat im Fermenter<br />
eingeführt wird. Die Bakterien sollen den Wasserstoff<br />
komplett verarbeiten, denn ein Übergang in das Biogas<br />
sei nicht gewünscht.<br />
Das Verfahren habe gleich mehrere Vorteile: Zum einen<br />
steige der Methangehalt und der Ertrag werde gesteigert.<br />
Zweitens würden alle Schadgase, einschließlich<br />
CO 2<br />
, reduziert. Bei der Verbrennung im Blockheizkraftwerk<br />
führt das H 2<br />
-behandelte Biogas außerdem zu<br />
einem sauberen Abbrand, was ihn gleichmäßiger und<br />
ruhiger laufen lasse. Es ermögliche somit bessere Abgaswerte<br />
und günstigere Betriebskosten.<br />
Erhältlich ist die Anlage je nach Fermentergröße in<br />
unterschiedlichen Leistungsklassen. Das System<br />
sei bereits auf mehreren Anlagen in Österreich, der<br />
Schweiz und Deutschland installiert, berichtet greentec-Geschäftsführer<br />
Christoph Spurk. Auf eigenen<br />
Testanlagen habe der Einsatz bereits nach 30 Tagen<br />
eine Effizienzsteigerung von 10 Prozent und mehr ergeben,<br />
berichtet das Unternehmen. Dabei habe sich<br />
nach kurzer Zeit die Leistungsfähigkeit des Verfahrens<br />
bewiesen: „Im realen Betrieb haben die erzielten<br />
Effekte die vorab theoretisch errechneten noch übertroffen.“<br />
Autor<br />
Dipl.-Geograph Martin Frey<br />
Fachjournalist<br />
Fachagentur Frey - Kommunikation für Erneuerbare<br />
Energien<br />
Gymnasiumstr. 4 · 55116 Mainz<br />
Tel. 0 61 31 / 61 92 78-0<br />
E-Mail: mf@agenturfrey.de<br />
www.agenturfrey.de<br />
64
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Visuelle<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-<br />
Produktion<br />
praxis<br />
Lumiglas optimiert Ihren<br />
Biogas-Prozess<br />
Biogasanlagen im Bauherrenmodell<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13 · 88299 Leutkirch · Tel. 07563/8471<br />
Fax 0 75 63/80 12 www.paulmichl-gmbh.de<br />
• Fernbeobachtung mit dem<br />
Lumiglas Ex-Kamera-System<br />
• Lokale oder<br />
globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig<br />
Sicherheit<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
Unser Info-Material:<br />
Paketlösung für<br />
die Biogaserzeugung<br />
Gleich heute anfordern!<br />
AGROTEL GmbH • 94152 NEUHAUS/INN • Hartham 9<br />
Tel.: + 49 (0) 8503 / 914 99- 0 • Fax: -33 • info@agrotel.eu<br />
65<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />
Telefon 0 23 04-205-0<br />
info.lumi@papenmeier.de<br />
www.lumiglas.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wasseraufbereitung<br />
und Nährstoffgewinnung<br />
aus Gärprodukten<br />
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat ein Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück<br />
und der Firma A3 Water Solutions gefördert. Darin wurde die Leistungsfähigkeit des<br />
Gesamtverfahrens Gärproduktaufbereitung im Hinblick auf die erzielbaren Prozessströme<br />
bei Einsatz unterschiedlichster Gärdünger untersucht sowie eine Verfahrensoptimierung<br />
zur deutlichen Senkung der Betriebskosten entwickelt. Im Fokus stand dabei die<br />
Optimierung der Ultrafiltrationsstufe. Der Energiebedarf dieser Prozessstufe ließ sich<br />
auf 50 Prozent reduzieren.<br />
Von M.Sc. Tobias Gienau und Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger<br />
Deutschlandweit erzeugten Biogasanlagen<br />
im Jahr 2012 etwa 65,5 Millionen (Mio.)<br />
Kubikmeter (m³) Gärdünger (Gärrest beziehungsweise<br />
Gärprodukt genannt) mit<br />
390.000 Tonnen (t) Stickstoff, 74.000<br />
t Phosphor und 330.000 t Kalium (Möller und Müller<br />
2012) – das entspricht ca. 20.000 t Gärrest pro<br />
Megawatt (MW) installierte elektrische Leistung. Bei<br />
einer installierten Arbeitsleistung der derzeit 9.350<br />
in Deutschland betriebenen Biogasanlagen von 3.770<br />
MWel (Fachverband Biogas 2016) lässt sich für das<br />
Jahr 2017 eine Gärproduktmenge von 73,6 Mio. m³<br />
abschätzen.<br />
Die Novelle der Düngeverordnung (DüV 2017) hat<br />
Folgen für viele Biogasanlagenbetreiber – insbesondere<br />
in Regionen mit Nährstoffüberschüssen: Zum<br />
einen ergibt sich eine deutliche Flächenkonkurrenz<br />
zwischen Gärprodukten und Wirtschaftsdüngern, zum<br />
anderen werden teils deutlich größere Lagerkapazitäten<br />
notwendig. Für viele Landwirte, vor allem aus<br />
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, ergeben sich<br />
zwei Möglichkeiten: Entweder werden Nährstoffe aus<br />
nährstoffreichen in nährstoffarme Regionen Deutschlands<br />
über Distanzen von mitunter 150 Kilometern<br />
verbracht.<br />
Bekannt sind beispielsweise Transporte aus der Veredelungsregion<br />
Cloppenburg/Vechta in die Region Hannover<br />
(Nährstoffbericht Niedersachsen 2015/2016).<br />
Oder es werden Gärdünger vor Ort aufbereitet und fraktioniert,<br />
wobei dem Gärprodukt Wasser entzogen wird,<br />
um die Transportwürdigkeit der Düngefraktionen zu<br />
steigern. Auf dem Markt existieren dafür verschiedene<br />
Teil- und Vollaufbereitungstechniken (Drosg et al.<br />
2015). Das Vollaufbereitungsverfahren aus der Kombination<br />
Fest/Flüssig-Trennung und Membranverfahren<br />
stellt dabei eine besonders interessante Lösung dar.<br />
Abbildung 1: Vollaufbereitungsverfahren von Gärresten durch Membrantechnik<br />
Retentat UF<br />
Retentat UF<br />
N/K-<br />
Flüssigdünger<br />
Biogas<br />
Anlage<br />
Gärrest<br />
Separator<br />
Dekanter<br />
Ultrafiltration<br />
Umkehr-<br />
Osmose<br />
Wasser<br />
N/P-<br />
Feststoffdünger<br />
66
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 2: Fotos der Pilotanlage – Versuchscontainer am Standort 2, Dekanterzentrifuge, Ultrafiltration, Umkehrosmose<br />
Dekanterzentrifuge<br />
Ultrafiltration<br />
Fotos: Tobias Gienau, Ulrich BrüSS<br />
Vorlagetank<br />
Umkehrosmose<br />
Zentrifugen: weitere Abtrennung<br />
von Organik und Nährstoffen<br />
Abbildung 1 zeigt eine mögliche Verfahrenskombination<br />
aus Schneckenpressenseparator,<br />
Dekanterzentrifuge, Ultrafiltration (UF)<br />
und Umkehrosmose (UO). Separatoren zur<br />
Abtrennung der organischen Feststofffraktion<br />
sind heute an vielen Biogasanlagen im<br />
Einsatz. Durch alternative oder nachgeschaltete<br />
Dekanterzentrifugen kann ein weiterer<br />
Anteil an Organik, Stickstoff und Phosphor<br />
in einen stichfesten N/P-Dünger überführt<br />
werden.<br />
Die gelösten Nährstoffe Kalium und Ammoniumstickstoff<br />
werden über ein mehrstufiges<br />
Membranverfahren, bestehend aus Ultrafiltration<br />
und Umkehrosmose, in einen hoch<br />
angereicherten flüssigen N/K-Dünger überführt.<br />
Das Retentat der Ultrafiltration kann<br />
entweder in den Prozess rezirkuliert oder als<br />
zusätzliches Flüssigdüngerprodukt ausgeschleust<br />
werden. Bei Bedarf kann die Anlage<br />
so dimensioniert werden, dass das gereinigte<br />
Wasser Einleitfähigkeit erreicht. Die Anlagentechnik<br />
ist technisch erprobt und seit etwa zehn Jahren erfolgreich<br />
im Einsatz (Brüß 2014). Allerdings führt der<br />
bislang hohe spezifische Energiebedarf des Gesamtprozesses<br />
von 20 bis 30 Kilowattstunden (kWh)/m³ zu<br />
Aufbereitungskosten von rund 8 Euro/m³ Gärrest.<br />
Im Forschungsprojekt sind 42 Gärproduktproben aus<br />
zwölf NawaRo- und sieben Abfall-Biogasanlagen analysiert<br />
und charakterisiert worden. Dadurch wurde ein<br />
breites Wissen über die Inhaltsstoffe der Gärprodukte<br />
sowie über die für die Leistung der Ultrafiltrationsanlage<br />
relevanten Gärproduktinhaltsstoffe erworben.<br />
Abbildung 3: Versuchsablauf zur Ermittlung der Ultrafiltrationsflüsse<br />
bei konstant eingestellten Betriebsbedingungen<br />
Filtratfluss in L/h<br />
Aufkonzentrieren<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
Betrieb bei 70 % Ausbeute<br />
100<br />
Betriebspausen über Nacht<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
Betriebzeit in h<br />
Gärdünger lassen sich unterschiedlich gut filtrieren,<br />
beispielsweise waren die Gärprodukte aus Abfall-Biogasanlagen<br />
einfacher aufzubereiten als die Gärreste<br />
der NawaRo-Biogasanlagen.<br />
Als Ursache für die unterschiedliche Filtrierbarkeit<br />
wurde die Menge an organischen Makromolekülen im<br />
Presswasser beziehungsweise Dekanterzentrat und die<br />
damit einhergehende höhere Fluidviskosität identifiziert<br />
(Gienau und Rosenberger 2015). Diese lassen<br />
sich leicht analysieren. Außerdem lassen sich schnell<br />
Prognosen für die weitere Aufbereitung ableiten. In<br />
einem zweiten Untersuchungsschritt wurden Optimie-<br />
67
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Abbildung 4: Mittlere prozentuale Aufteilung des Gärrestmassenstroms auf die Prozessströme<br />
Gärrest<br />
100 %<br />
Feststoff Dekanter<br />
Feststoff Separator<br />
12 %<br />
Retentat Ultrafiltration<br />
11 %<br />
Feststoffdünger 23%<br />
oTS = 65 - 87 %<br />
N ges = 6,0 - 12,0 kg/t<br />
P 2 O 5 = 4,7 - 11,0 kg/t<br />
K 2 O = 4,4 - 5,3 kg/t<br />
Konzentrat Umkehrosmose<br />
26 %<br />
oTS = 71 - 72 %<br />
N ges = 3,4 - 4,8 kg/t<br />
P 2 O 5 = 0,6 - 0,9 kg/t<br />
K 2 O = 4,6 - 5,3 kg/t<br />
Gereinigtes Wasser 36 %<br />
15 %<br />
Flüssigdünger 31%<br />
oTS = 32 - 43 %<br />
N ges = 4,6 - 5,8 kg/t<br />
P 2 O 5 = 0,3 - 0,5 kg/t<br />
K 2 O = 10,1 - 11,1 kg/t<br />
Abbildung 5: Mittlere prozentuale Aufteilung der Nährstoffe auf die Prozessströme<br />
Aufteilung der Nährstoffe auf die<br />
Massenströme in %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0%<br />
Feststoff<br />
Separator<br />
Feststoff<br />
Dekanter<br />
N total P 2 O 5 K 2 O<br />
UF Retentat<br />
Flüssigdünger<br />
Prozesswasser 36%<br />
oTS = n. m.<br />
N ges = < 0,02 kg/t<br />
P 2 O 5 = < 0,001 kg/t<br />
K 2 O = < 0,001 kg/t<br />
rungsansätze der Ultrafiltrationsstufe<br />
durch Vorbehandlung des Gärrestes<br />
entwickelt, die zum Teil deutliche<br />
Steigerungen des Ultrafiltrationsflusses<br />
ergaben.<br />
Optimierungen in der Praxis<br />
getestet<br />
Einige vielversprechende Optimierungsansätze<br />
wurden anschließend<br />
in einer Pilotphase an zwei unterschiedlichen<br />
Biogasanlagen getestet.<br />
Abbildung 2 zeigt Komponenten der<br />
Pilotanlage und Tabelle 1 (S. 70) die<br />
Betriebsparameter der Biogasanlagen<br />
an den zwei Versuchsstandorten. Der<br />
Dekanter der Firma GEA Westfalia<br />
Separator erlaubt einen maximalen<br />
Durchsatz von 6 m³/Stunde und wird<br />
in Kombination mit einem polymeren<br />
Flockungsmittel betrieben, für das<br />
ein Nachweis über den 20-prozentigen<br />
Abbau innerhalb von zwei Jahren<br />
nach Düngemittelverordnung vorliegt.<br />
Die Ultrafiltrationseinheit ist mit keramischen<br />
Membranmodulen bestückt,<br />
die einen robusten Betrieb ermöglichen<br />
und sich gut reinigen lassen. Die<br />
dreistufige Umkehrosmoseeinheit ist<br />
mit Standard-Wickelmodulen ausgestattet.<br />
Zwischen Ultrafiltration und<br />
Umkehrosmose wird das UF-Permeat<br />
angesäuert. Die Aufbereitung der Gärprodukte<br />
erfolgte in Versuchsreihen<br />
von drei bis vier Tagen und zeigte an<br />
den beiden Standorten ähnliche und<br />
BIOGASANALYSE<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 – Fax -90<br />
info@pronova.de I www.pronova.de<br />
FOS/TAC 2000<br />
automatischer Titrator zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und FOS/TAC<br />
SSM 6000 ECO<br />
SSM 6000<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit<br />
und ohne Gasaufbereitung<br />
mit proCAL für SSM 6000,<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
68<br />
www.pronova.de
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
stabile Prozessergebnisse. In Abbildung 3 ist ein typischer<br />
Versuchsverlauf für einen konstanten Betriebsparameter<br />
dargestellt. Zunächst wurde das Retentat bis<br />
zu einer Permeatausbeute von 70 Prozent aufkonzentriert.<br />
Anschließend wurde über drei Versuchstage bei<br />
konstanten Bedingungen filtriert.<br />
Abbildungen 4 und 5 zeigen die während des Versuchsbetriebs<br />
gemessene Aufteilung der Gärrestmasse und<br />
der Nährstoffe nach den verschiedenen Prozessstufen.<br />
Die dazugehörigen Konzentrationen finden sich in Tabelle<br />
2 auf Seite 71. Die Messung der Nährstoffkonzentrationen<br />
erfolgte mit Standardmethoden durch<br />
AGROLAB und das Labor für Verfahrenstechnik der<br />
Hochschule Osnabrück. Der Schneckenpressseparator<br />
scheidet etwa 10 bis 13 Prozent (%) des Massenstroms<br />
mit 18 bis 19 % der Stickstoff- und 27 bis 38 % der<br />
Phosphorfracht ab.<br />
In der nachgeschalteten Dekanterzentrifuge können<br />
weitere 10 bis 13 % des Massenstroms sowie 29 bis<br />
38 % der Stickstoff- und 45 bis 61 % der Phosphorfracht<br />
abgeschieden werden. In Summe werden damit<br />
rund 20 bis 26 % der Gärstoffmasse als Feststoffdünger<br />
abgetrennt, der zirka 50 % der Stickstoff- und 85 %<br />
der Phosphorfracht enthält. Mit einem mittleren<br />
TR-Gehalt von 21 % sowie mittleren Stickstoff- und<br />
Phosphorkonzentrationen von 8,5 Kilogramm (kg)/t<br />
beziehungsweise 7 kg/t handelt es sich dabei um einen<br />
guten organischen Feststoffdünger. Vom Gärprodukt<br />
können 14 bis 15 % nach der Umkehrosmose als partikelfreier<br />
Flüssigdünger aus dem Prozess gewonnen<br />
werden. Der Flüssigdünger enthält im Wesentlichen<br />
Ammoniumstickstoff und Kalium. Dabei ist anzumerken,<br />
dass die in technischen Anlagen enthaltene UO-<br />
Konzentratstufe in der Pilotanlage nicht realisiert war.<br />
Im volltechnischen Maßstab wird der Flüssigdünger<br />
zusätzlich um den Faktor 5 bis 6 aufkonzentriert.<br />
Ablaufwasser ist sehr rein<br />
Die Pilotversuche ergaben an beiden Standorten eine<br />
sehr hohe Qualität des gereinigten Wassers aus der letzten<br />
Umkehrosmosestufe (siehe Abb. 6). Die Ablaufwerte der<br />
vermessenen Stichproben erfüllten im Mittel die Anforderungen<br />
an die Ablaufqualität eines kommunalen Klärwerkes<br />
der Größenklasse 5 (CSB ≤ 75 mg/L, N ges<br />
≤ 13 mg/L,<br />
NH 4<br />
-N ≤ 10 mg/L, P ges<br />
≤ 1 mg/L) (AbwV 2017).<br />
Abbildung 6: Qualität des gereinigten Wassers am Standort 1<br />
Konzentration in mg/L<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
CSB < 15 mg/L<br />
N total NH 4 -N P 2 O 5 K 2 O<br />
Als gereinigtes Wasser konnten 36 % des Gärrestes<br />
abgetrennt werden. In technischen Anlagen kann die<br />
Menge an aufbereitetem Wasser durch die zusätzliche<br />
Konzentratstufe auf über 50 % angehoben werden.<br />
Im Laufe des Projektes konnte der Energiebedarf<br />
der Ultrafiltrationsstufe durch Optimierung der Be-<br />
©<br />
Für Drücke bis 15 mbar!<br />
Über- & Unterdrucksicherung, auch<br />
als SN DRYLOCK SMART© für Ihre<br />
Biogasanlage lieferbar!<br />
Flüssigkeitslos – absolut frostsicher<br />
Wartungsarm – keine tägliche Kontrolle<br />
Stufenlos einstellbare Auslösedrücke – bis 15 mbar<br />
Ultrakompakt – für alle Flansche!<br />
Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Biogasanlage!<br />
SN Energy GmbH // Gustav-Weißkopf-Str. 5 // 27777 Ganderkesee // +49 4222 - 8058060 // info@snenergy.de // www.snenergy.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Abbildung 7: Auswirkung der Prozessoptimierung auf die Flussleistung der Ultrafiltrationsmembranen<br />
und auf den Energieverbrauch der gesamten Ultrafiltrationsstufe inklusive Peripherie<br />
Membranleistung<br />
140 %<br />
120 %<br />
100 %<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Standort 1<br />
Standort 2<br />
Referenz +Wärme Prozessoptimierung<br />
Relativer Energieverbrauch UF<br />
140 %<br />
120 %<br />
100 %<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Standort 1<br />
Standort 2<br />
Referenz +Wärme Prozessoptimierung<br />
Tabelle 1: Prozessparameter der Biogasanlagen der Standorts 1+2<br />
Prozessparameter Standort 1 Standort 2<br />
Elektrische Leistung 2,5 MW el<br />
1,27 MW el<br />
Substrat<br />
36 % Rindergülle,<br />
36 % Maissilage,<br />
28 % Zuckerrübe<br />
37 % Gülle/Mist<br />
51 % Maissilage<br />
12 % Hafer/GPS<br />
Jährliche Gärrestmenge 35.000 – 55.000 m³/a 30.000 – 35.000 m³/a<br />
triebsbedingungen deutlich reduziert werden. Das<br />
betriebswirtschaftliche Optimum ergab sich in der<br />
Kombination aus Erwärmung des Gärproduktes vor<br />
der Ultrafiltrationsstufe mit Änderungen verschiedener<br />
Betriebsparameter. Durch diese Kombination lässt<br />
sich der Volumenstrom durch die Ultrafiltrationsmembran<br />
um etwa 45 % erhöhen und der Energieverbrauch<br />
auf unter 50 % reduzieren (siehe Abbildung 7).<br />
Für Standorte mit problematischer Nährstoffsituation<br />
bietet die membrangestützte Gärproduktaufbereitung<br />
eine interessante Perspektive. Die Feststoffabtrennung<br />
durch Schneckenpressseparator und Dekanter<br />
GASSPEICHER FÜR FLEXIBLE STROMPRODUKTION<br />
Umweltfreundliche und effektive Speicherkonzepte für Biogas-, Substrat, Gülle, Si-<br />
Sickerwasser, Rübenmus- und Gärrestelagerung haben bei bei uns eine lange Tradition.<br />
Wir bieten Ihnen individuell angepasste Lösungen für jede Anforderung - - vom runden runden<br />
zum bis zum eckigen eckigen Biogasspeicher bis zu bis 40.000 zu 40.000 m³ Speichervolumen m³ - möglich. - möglich.<br />
bis<br />
Profitieren Sie Sie von von unserer unserer langjährigen langjährigen Erfahrung Erfahrung und und Kompetenz! Kompetenz!<br />
BIO<br />
GAS<br />
SPEICHER<br />
HOCH<br />
SIlO SILO<br />
däCHER DÄCHER<br />
MOBIlE MOBILE<br />
GAS<br />
SPEICHER<br />
Sattler Ceno TOP-TEX GmbH<br />
70<br />
Am Sattlerstrasse Eggenkamp 1, A-7571 14 | D-48268 Rudersdorf Greven Am Eggenkamp 14, D-48268 biogas@sattler-global.com<br />
Greven<br />
biogas@sattler-global.comwww.sattler-ceno-toptex.com<br />
Telefon: T: +43 3382 +49 733 2571 0 969 0<br />
T: +49 2571 969 0
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Tabelle 2: Nährstoffkonzentrationen der Prozessströme<br />
Standort 1<br />
Gärrest<br />
Separator<br />
Feststoffdünger<br />
Dekanter<br />
UF Retentat<br />
Flüssigdünger<br />
(UO Retentat)<br />
TR % 5,8 21,1 19,1 3,4 3,6<br />
N total<br />
kg/t 4,0 6,0 9,7 3,4 4,6<br />
NH 4<br />
-N kg/t 1,7 2,4 2,4 1,7 4,0<br />
P 2<br />
O 5<br />
kg/t 1,6 4,7 6,1 0,6 0,3<br />
K 2<br />
O kg/t 4,6 4,4 4,7 4,6 10,0<br />
Standort 2<br />
TR % 7,7 20,8 24,1 4,3 4,5<br />
N total<br />
kg/t 5,1 6,4 12,0 4,8 5,8<br />
NH 4<br />
-N kg/t 3,0 3,1 4,4 3,0 5,7<br />
P 2<br />
O 5<br />
kg/t 2,4 5,9 11,0 0,9 0,5<br />
K 2<br />
O kg/t 5,0 4,7 5,3 5,3 11,0<br />
erzeugt ein transportwürdiges und lagerfähiges Düngeprodukt.<br />
Die Kombination aus Ultrafiltration und<br />
Umkehrosmose ermöglicht eine Abtrennung von 36<br />
bis 50 % des Gärrestes als aufbereitetes Wasser, das<br />
entweder direkt oder indirekt in Vorfluter eingeleitet<br />
werden kann und somit nicht zur weiteren Anreicherung<br />
von Nitrat im Grundwasser beiträgt.<br />
Gleichzeitig werden Ammoniumstickstoff und Kalium<br />
in einem hochkonzentrierten Flüssigdüngerprodukt<br />
angereichert. Durch die entwickelte Prozessoptimierung<br />
lassen sich die spezifischen Aufbereitungskosten<br />
der gesamten Aufbereitungskette von 8 Euro/m³ Gärprodukt<br />
auf 5 bis 6 Euro/m³ Gärprodukt reduzieren.<br />
Die Kosten beinhalten die laufenden Betriebskosten<br />
für Strom, Chemikalien und Polymere, Rückstellung<br />
für Wartung, Instandhaltung und Membranersatz sowie<br />
die Abschreibung auf die Investition der Anlage.<br />
Hinweis: Die Quellenangaben sind bei Bedarf bei den<br />
Autoren erhältlich.<br />
Autoren<br />
Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger<br />
M.Sc. Tobias Gienau<br />
Hochschule Osnabrück<br />
Albrechtstr. 30 · 49076 Osnabrück<br />
E-Mail: s.rosenberger@hs-osnabrueck.de<br />
E-Mail: tobias.gienau@hs-osnabrueck.de<br />
+++ ZÜNDKERZEN +++ DENSO +++ BERU +++ BOSCH +++ FEDERAL MOGUL +++ CHAMPION +++ MWM +++<br />
Große Auswahl an Zündkerzen für Ihr BHKW<br />
Jetzt einfach online bestellen »<br />
71
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Der Container umfasst<br />
zwei getrennte Abteile,<br />
eins für die effiziente<br />
Anbindung ans<br />
elektrische Netz und<br />
die Steuerungstechnik<br />
(vorne), das andere für<br />
den verfahrenstechnischen<br />
Aufbau.<br />
Strom-Langzeitspeicher mit<br />
Wasserstofftechnologie<br />
Mit einem Strom-Langzeitspeicher auf Wasserstoffbasis wollen Fraunhofer-Forscher<br />
zukünftig regenerative Energien effektiv und platzsparend speichern.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Weil Photovoltaik oder Windkraft keine<br />
konstante Strommenge liefern, sondern<br />
diese wetterbedingt schwankt,<br />
suchen Forscher schon lange nach<br />
Möglichkeiten, die Überschüsse zu<br />
speichern – und dies möglichst effektiv und ohne große<br />
Verluste. „Durch den stetig steigenden Anteil an<br />
regenerativen und damit verbundenen kleineren und<br />
stark verteilten Energiequellen steigt auch ihr Einfluss<br />
auf heutige Verteilnetze“, erklärt Fraunhofer-Forscher<br />
Bernd Wunder den Hintergrund.<br />
Die bisher stark zentralisierte Verteilung würde durch<br />
die steigende Anzahl dezentraler Quellen neuen Belastungen<br />
unterworfen. Neben einem lokalen Über- oder<br />
Unterangebot könnten auch starke Fluktuationen auftreten.<br />
Neue intelligente Netzstrukturen in Verbindung<br />
mit elektrochemischen Energiespeichern ermöglichten,<br />
diese Effekte direkt im lokalen Netz abzufangen<br />
und dadurch das Verbundnetz zu entlasten.<br />
Aus diesen Gründen haben Wissenschaftler des Fraunhofer<br />
IISB in Erlangen einen Strom-Langzeitspeicher<br />
auf Wasserstoffbasis in einen Container integriert. Sie<br />
forschen daran, wie ein solcher Energiespeicher zur sicheren<br />
und sauberen Energieversorgung von Industriebetrieben<br />
und größeren Gebäudekomplexen beitragen<br />
kann. Das Grundkonzept der Anlage besteht darin, aus<br />
überschüssiger elektrischer Energie Wasserstoff zu erzeugen<br />
und diesen in einem organischen Trägerstoff<br />
sicher und kompakt – auch über längere Zeiträume – zu<br />
speichern.<br />
Für die spätere Nutzung kann der Wasserstoff wieder<br />
aus dem Trägerstoff freigesetzt und mit einer Brennstoffzelle<br />
in elektrische Energie umgewandelt werden.<br />
„Im Prinzip kann man sich den Container wie eine große<br />
Batterie vorstellen“, erklärt Bernd Wunder. Nach eigenen<br />
Angaben haben die Forscher damit in Erlangen<br />
ein „weltweit einmaliges System zur kompakten Speicherung<br />
großer Mengen an Energie“ aufgebaut.<br />
Viel Technik auf kleinem Raum<br />
Das im Rahmen des Leistungszentrums Elektroniksysteme<br />
(LZE) errichtete neuartige System soll Maßstäbe<br />
für die langfristige Speicherung großer Energiemengen<br />
setzen. Aus diesem Grund wurde die Technik in einen<br />
72
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Stahlcontainer integriert. Anfang Mai 2016 startete<br />
der Aufbau. Auf kleinstem Raum wird hier das neue<br />
Verfahren erforscht, das die Ein- und Ausspeicherung<br />
elektrischer Energie auf Basis eines flüssigen Wasserstoffträgers<br />
ermöglicht.<br />
Bernd Wunder erklärt die Enge: „Das System soll mobil<br />
einsetzbar sein, deshalb sollten alle Anlagenkomponenten<br />
in einem 20-Fuß-Container untergebracht werden.“<br />
Der Container umfasst zwei getrennte<br />
Abteile, eins für die effiziente Anbindung<br />
ans elektrische Netz und die Steuerungstechnik,<br />
das andere für den verfahrenstechnischen<br />
Aufbau. Entstanden ist das<br />
Speichersystem im Rahmen des LZE-Pilotprojekts<br />
„DC-Backbone mit Strom-Gas-<br />
Kopplung“.<br />
Weil dieses Projekt besonderen Wert auf<br />
eine enge interdiziplinäre Zusammenarbeit<br />
legt, wurde der „Container voller Energie“<br />
gemeinsam von den Fraunhofer-Instituten<br />
IISB und IIS, der Friedrich-Alexander-<br />
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und<br />
regionalen Industriepartnern errichtet. Aufgrund<br />
der extremen Kompaktheit des Containersystems<br />
waren viele maßgeschneiderte<br />
Lösungen notwendig, die die beteiligten<br />
Mitarbeiter das eine oder andere Mal ins<br />
Grübeln brachten. „Aber bisher haben wir<br />
alles untergebracht“, sagt Michael Steinberger<br />
mit einem Schmunzeln. Der studierte Elektrotechniker<br />
ist für die Steuerungstechnik im Container<br />
verantwortlich.<br />
Trägerstoff nimmt Wasserstoff auf<br />
Bei dem Verfahren speichert ein flüssiger Trägerstoff<br />
den Wasserstoff. Er ist in der Fachsprache als LOHC<br />
(Liquid Organic Hydrogen Carrier) bekannt. Der Trägerstoff<br />
ist in der Industrie übrigens schon weitläufig<br />
im Einsatz – dort allerdings als Thermoöl für die Beheizung<br />
und Kühlung von Prozessen. In der Anwendung<br />
als LOHC hingegen ermöglicht er die wiederholte<br />
Einspeicherung und Freisetzung von Energie in einem<br />
geschlossenen Kreislaufprozess. Im Gegensatz zu fossilen<br />
Kraftstoffen wird das LOHC im Prozess nicht verbraucht,<br />
sondern kann immer wieder mit Wasserstoff<br />
be- und entladen werden. „Im Rahmen des Projekts<br />
ist uns eine wichtige Innovation gelungen“, erklärt<br />
Wunder, „wir verwenden für beide Prozessschritte nur<br />
einen einzigen Reaktor.“<br />
Für eine einfache Handhabung liegt das Medium flüssig<br />
vor. Im Prozessverlauf nimmt der organische Trägerstoff<br />
verschiedene Zustände an: So liegt er in seiner<br />
dehydrierten (wasserstoffarmen) Form, der hydrierten<br />
(wasserstoffreichen) Form und gegebenenfalls noch in<br />
verschiedenen Zwischenstufen vor. Über eine chemische<br />
Reaktion nimmt LOHC große Mengen an elektrolytisch<br />
erzeugtem Wasserstoff auf. Die Elektrolyse findet<br />
Fotos: Kurt Fuchs/Fraunhofer IISB<br />
mithilfe von elektrischem Strom im Elektrolyseur statt.<br />
Das wasserstoffreiche LOHC kann dann unter üblichen<br />
Umgebungsbedingungen für Druck und Temperatur sicher<br />
gelagert werden. Was die Anforderungen an Lagerung<br />
und Transport betrifft, lässt sich der Trägerstoff<br />
mit herkömmlichem Diesel vergleichen – ein großer<br />
Vorteil gegenüber anderen Wasserstoffspeichertechnologien,<br />
die meist hohe Drücke oder sehr tiefe Temperaturen<br />
benötigen. Im Container in Erlangen können<br />
derzeit etwa 300 Liter LOHC gelagert werden, was einer<br />
im Wasserstoff gespeicherten Energie von fast 600<br />
Kilowattstunden entspricht.<br />
Das reicht aus, um den Strombedarf eines kleineren<br />
Industriebetriebs über mehrere Stunden zu decken.<br />
Über zusätzliche Tankbehälter lässt sich die gespeicherte<br />
Energiemenge jedoch leicht um ein Vielfaches<br />
erhöhen. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen innerhalb<br />
eines chemischen Reaktors kann der Wasserstoff<br />
wieder vom Trägerstoff gelöst werden. Um die Verbindungen<br />
zu lösen, muss Energie zugeführt werden.<br />
Die Brennstoffzelle<br />
Bei der späteren Nutzung wird der Wasserstoff wieder<br />
aus dem Trägerstoff freigesetzt und mithilfe einer<br />
Brennstoffzelle genutzt. Eine Brennstoffzelle ist eine<br />
galvanische Zelle zur Umwandlung von chemischer in<br />
elektrische Energie. Das eingesetzte Brennstoffzellensystem<br />
beruht auf der sogenannten Niedertemperatur-<br />
PEM-Technologie (PEM: Proton Exchange Membrane).<br />
Ihre Funktionsweise basiert auf der elektrochemischen<br />
Reaktion beim Zusammentreffen von Sauerstoff und<br />
Wasserstoff.<br />
Die PEM-Bauweise ermöglicht es grundsätzlich, die<br />
Brennstoffzelle innerhalb weniger Minuten aus dem<br />
ausgeschalteten Zustand heraus in den Betriebszustand<br />
zu versetzen. Schnelle Betriebsbereitschaft ist<br />
Das Innere des<br />
neuartigen Containers<br />
ermöglicht die<br />
effiziente Verstromung<br />
und Produktion von<br />
Wasserstoff.<br />
73
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Im Elektroabteil des<br />
Containers ist hocheffiziente<br />
Leistungselektronik<br />
zur Anbindung<br />
an das Gleichstromnetz<br />
des Instituts installiert.<br />
beispielsweise für die spätere Abdeckung von Lastspitzen<br />
in Industriebetrieben wichtig. Mit ihrer Leistung<br />
von 25 Kilowatt ist sie schon zu groß für Ein- oder<br />
Mehrfamilienhäuser. „Das Energiespeichersystem auf<br />
LOHC-Basis ist eher für größere Gebäudekomplexe und<br />
Quartiere geeignet“, erklärt dazu Johannes Geiling, der<br />
für den verfahrenstechnischen Aufbau der Forschungsanlage<br />
verantwortlich war.<br />
„Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt wird sein, die<br />
am besten geeignete Betriebsweise für das Speichersystem<br />
zu finden“, so Geiling weiter. Denn mit der<br />
richtigen Betriebsstrategie wird es das LOHC-System<br />
ermöglichen, Erneuerbare Energien unter Gewährleistung<br />
der Versorgungssicherheit auch in Industriebetrieben,<br />
mittelständischen Unternehmen oder größeren<br />
Gebäudekomplexen und Quartieren stärker einzubinden<br />
und damit den energetischen Eigenversorgungsgrad<br />
zu erhöhen. „Mit der Inbetriebnahme des Brennstoffzellensystems<br />
ist ein erster wichtiger Schritt getan.<br />
Nun sind wir gespannt auf die nächsten Ergebnisse“,<br />
so Geiling.<br />
Gleichspannungswandler<br />
Das Containersystem ist in das lokale Gleichstromnetz<br />
integriert. „Dadurch können wir unnötige Wandlungsverluste<br />
von Gleichstrom in Wechselstrom vermeiden“,<br />
führt Wunder aus. Der Betrieb des Gesamtsystems,<br />
also das Zusammenspiel lokaler Erzeuger, Speicher<br />
und Verbraucher, würde dadurch effizienter. Das Netz<br />
arbeitet mit ±380 V zur Verringerung der Leitungsverluste.<br />
Allerdings arbeiten die Brennstoffzelle und der<br />
Elektrolyseur für den LOHC-Speicher im Container mit<br />
lastabhängigen Spannungen zwischen 50 Volt (V) und<br />
100 V.<br />
Zur Anpassung der Spannungsniveaus ist ein Gleichspannungswandler<br />
erforderlich. Er wandelt die am<br />
Eingang zugeführte Gleichspannung in ein anderes<br />
Spannungsniveau um und muss aus Sicherheitsgründen<br />
zusätzlich isoliert ausgeführt werden. Bei der Umsetzung<br />
wurde auf eine einfache Skalierbarkeit der isolierten<br />
Gleichspannungswandler geachtet.<br />
Dies ermöglicht Anpassungen an andere Spannungslagen,<br />
Ströme beziehungsweise Leistungen und verringert<br />
die Entwicklungszeit für nachfolgende Projekte.<br />
Besonderer Wert wurde auch auf die Energieeffizienz<br />
gelegt. Durch Phasenabschaltung können ab 10 kW<br />
Ausgangsleistung Wirkungsgrade zwischen 94,0 Prozent<br />
und 96,6 Prozent erzielt werden. Nach erfolgreichem<br />
Abschluss aller Labortests läuft nun die Integration<br />
der Gleichspannungswandler im Gesamtsystem.<br />
Das Ziel: eine große Batterie<br />
Die Forschungsarbeiten am weltweit einmaligen Energiespeicher<br />
bringen wichtige Erkenntnisse, wie Speichersysteme<br />
auf Basis flüssiger Wasserstoffträger in lokale<br />
Energiesysteme integriert werden können. Mit der<br />
neuen Forschungsanlage wollen die Wissenschaftler in<br />
Erlangen verschiedenen Fragen auf den Grund gehen:<br />
Wie können mit einem LOHC-basierten Energiespeichersystem<br />
schwankende Energieerzeugungsverläufe<br />
aufgenommen werden, wie sie zum Beispiel bei den vor<br />
Ort installierten Photovoltaikanlagen vorkommen? Und<br />
wie lässt sich eine solche Anlage effizient in industrielle<br />
Energienetze einbinden?<br />
Noch sind die Forschungen nicht abgeschlossen, doch<br />
am Ende, wenn die ganze Prozesskette reibungslos<br />
läuft, soll der Container wie eine große Batterie eingesetzt<br />
werden. „Er kann dann überall dort aufgestellt<br />
werden, wo ein Stromspeicher benötigt wird“, erklärt<br />
Wunder, er könne aber auch zur kurzfristigen Stromversorgung<br />
dienen. Das System sei zudem modular<br />
aufgebaut und könne an verschiedene Anforderungen<br />
angepasst werden. Die LOHC-Speicherkette eigne sich<br />
vor allem für die Einspeicherung großer Energiemengen<br />
über mehrere Monate.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
Tel. 0 71 50/9 21 87 72<br />
Mobil: 01 63/232 68 31<br />
E-Mail: braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
74
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Anlagenbau<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Folienbecken | Leckagefolien<br />
Ihr starker Partner für:<br />
l mobile Feststoffbeschickung<br />
besonders geeignet<br />
für Umbau-/<br />
Sanierungsarbeiten<br />
und in<br />
Störfällen<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Substrat-<br />
Aufbereitungs- und<br />
Zerkleinerungstechnik<br />
für jedes Substrat<br />
die richtige Aufbereitungstechnik:<br />
NEU<br />
l Prallzerkleinerer<br />
HPZ 1200<br />
l speziell für verschleißintensive<br />
Substrate oder<br />
organische<br />
Abfälle<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
Segment-Kolben Linear-Kolben Flügel-Kolben<br />
Registrieren und sofort Kaufen in unserem Webshop<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL | E: info@benedict-tho.nl | T: 0031 545 482157 |<br />
Rührtechnik seit 1957<br />
Schubbodencontainer<br />
in<br />
Stahlbauweise<br />
l Volumen<br />
40 – 200 m 3 , als<br />
Twin bis 300 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l wahlweise<br />
Dosier- oder<br />
Fräswalzen<br />
Zugbodensystem in<br />
Betonbauweise<br />
l Ober-/Unterflur<br />
befahrbar<br />
l Volumen<br />
80 – 175 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l hydr. Verschlussrampe<br />
l hydraulische<br />
Abdeckung<br />
ANDERE RÜHREN - WIR LÖSEN.<br />
SUMA Rührtechnik GmbH • Martinszeller Str. 21 • 87477 Sulzberg<br />
+49 8376 / 92 131-0 • www.suma.de • info@suma.de<br />
75<br />
Kompaktsystem<br />
l komplett aus<br />
Edelstahl<br />
l Volumen<br />
13 – 33 m 3<br />
l mit 2 Dosierwalzen<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
International<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Interview<br />
Tansania: Digitalisierung verstetigt<br />
Biogasproduktion<br />
Dodoma<br />
Im Gespräch mit Benedikt Dollinger, Projektingenieur im Business<br />
Development der BayWa r.e. Bioenergy GmbH, über die Digitalisierung<br />
von Kleinstbiogasanlagen im afrikanischen Tansania. Das Unternehmen<br />
projektiert und betreibt Biogas- und Biomethananlagen<br />
der Megawattklasse. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte<br />
Genehmigungsplanung und Realisierung komplexer Verfahrenstechnik<br />
von Rohstoffverarbeitung, Biogasproduktion sowie Aufbereitung und<br />
Einspeisung.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Biogas Journal: Herr Dollinger, wie kam<br />
es dazu, dass Ihr Unternehmen in dem<br />
ostafrikanischen Land die Digitalisierung<br />
von Kleinstbiogasanlagen finanziell unterstützt?<br />
Benedikt Dollinger: Wir sind über einen<br />
Umweg zu dem Projekt gekommen. 2016<br />
haben wir in Großbritannien in der Nähe<br />
von Nottingham eine Biomethan-Einspeiseanlage<br />
geplant, errichtet und in Betrieb<br />
genommen. Während der Projektrealisierung<br />
kamen wir mit sehr unterschiedlichen<br />
Akteuren in Kontakt. So auch über unser<br />
Büro in Edinburgh in Schottland. Wir lernten<br />
Mitarbeiter der Organisationen Scene<br />
und CREATIVenergie kennen. Einer von<br />
ihnen war Jelte Harnmeier. Er ist in Afrika<br />
geboren und hat sich in den vergangenen<br />
Jahren in Sachen Biogasentwicklung in<br />
Tansania sehr engagiert.<br />
Biogas Journal: Um was geht es konkret in<br />
dem Projekt, das die BayWa r.e. Bioenergie<br />
GmbH finanziell unterstützt?<br />
Dollinger: Es geht um die digitale Erfassung<br />
von Betriebsparametern bereits in<br />
Tansania installierter Kleinstanlagen sowie<br />
um die Schulung von Service-Technikern.<br />
Die Datenerfassung soll dazu dienen, die<br />
Betriebsführung dieser Anlagen zu verbessern.<br />
Die Techniker wiederum sollen<br />
lernen, die Daten zu interpretieren und die<br />
Kleinbauern zu beraten. Wir waren sofort<br />
begeistert von der Idee. Viele Kleinbauern<br />
haben zwar inzwischen eine kleine Anlage,<br />
sie sind jedoch im Anlagenbetrieb oftmals<br />
auf sich allein gestellt. Darum werden sehr<br />
viele Biogasanlagen sehr schlecht oder gar<br />
nicht mehr genutzt.<br />
Biogas Journal: Es handelt sich wahrscheinlich<br />
um so kleine Anlagen, die nur<br />
dazu dienen, Kochgas bereitzustellen und<br />
die anfallenden Reststoffe zu verwerten,<br />
oder?<br />
Dollinger: Ja, das ist richtig. Das hat mit<br />
Biogasanlagen nach deutschen Standards<br />
wenig zu tun. Die Gärbehälter werden mit<br />
Exkrementen der Tiere sowie mit zum Beispiel<br />
Bananenblättern oder anderer Biomasse<br />
gefüttert. Das gewonnene Biogas<br />
wird zum Kochen benutzt, was den Einkauf<br />
teurer Holzkohle oder das Sammeln von<br />
Feuerholz unnötig macht. Dadurch werden<br />
wiederum die Waldressourcen geschont.<br />
Andererseits verbessert sich die Raumluft<br />
in den Wohnstätten, da es kein offenes,<br />
rauchendes Holzfeuer mehr gibt.<br />
Biogas Journal: Welche Partner sind neben<br />
Ihrem Unternehmen in dem Projekt involviert?<br />
Dollinger: Beteiligt sind die Universität<br />
Nottingham sowie die niederländische<br />
Entwicklungshilfe-Organisation SNV, die<br />
weltweit über 700.000 Kleinstbiogasanlagen<br />
errichtet haben. Weiter mit an Bord<br />
sind Camartec, eine Organisation zur Förderung<br />
von Technik in ländlichen Gebieten<br />
Tansanias sowie ECHO East Afrika, Scene<br />
und Connect Ltd. Dieses Konsortium hatte<br />
eigentlich schon die finanzielle Unterstützung<br />
eines britischen Hilfsfonds mit Namen<br />
Innovative UK Energy Catalyst sicher.<br />
Allerdings musste das Konsortium noch<br />
Geld aus der Privatwirtschaft akquirieren,<br />
um die Unterstützung aus dem Fonds zu<br />
bekommen. So sind wir dazugekommen.<br />
Biogas Journal: Und warum ist das Projekt<br />
nun konkret für Ihr Unternehmen interessant,<br />
es zu unterstützen?<br />
Dollinger: Wir waren von Anfang an von der<br />
Idee begeistert. Wir haben uns die einzelnen<br />
Projektdetails, wie zum Beispiel die<br />
Einschätzung der WHO über die Atemwegserkrankungen<br />
aufgrund des Kochens mit<br />
Brennholz, die Probleme mit bestehenden<br />
Anlagen sowie die schlechte Servicestruktur,<br />
aber auch die Vielfalt und einzelnen<br />
Stärken und Aufgaben der Projektpartner<br />
angesehen und waren überzeugt. Wir finden<br />
es grundsätzlich wichtig, dass Kleinstbiogasanlagen<br />
in Entwicklungsländern betrieben<br />
werden, dass sie verlässlich in Betrieb<br />
sind und kontinuierlich Gas erzeugen.<br />
Auch die Stiftung unseres Mutterkonzerns<br />
BayWa engagiert sich in Tansania und hat<br />
sich zum Ziel gesetzt, Biogas als alternative<br />
Kochenergie zu herkömmlichem Feuerholz<br />
in Kagera zu etablieren. In zahlreichen<br />
Workshops werden die afrikanischen Dorfbewohner<br />
geschult. Dieses grundsätzliche<br />
Wissen über Biogas sowie das Know-how<br />
für den Bau und die Wartung von Biogas-<br />
76
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
International<br />
Foto: Bioenergy GmbH<br />
Foto: SmartBiogasNetwork<br />
Benedikt Dollinger, Projektingenieur im Business Development<br />
der BayWa r.e. Bioenergy GmbH.<br />
Für Tansania typische Kleinstbiogasanlage, deren Betriebsparameter<br />
nun digital erfasst werden sollen.<br />
anlagen ermöglicht es den Bewohnern der<br />
Region Kagera, selbst Anlagen zu bauen, zu<br />
warten und zu betreiben.<br />
So wurden inzwischen acht Biogasanlagen<br />
für den privaten Haushalt ebenso wie<br />
eine institutionelle Anlage an einer neuen<br />
Mädchenschule gebaut. Die neue Anlagenüberwachung<br />
durch ein Netzwerk aus<br />
geschulten Technikern sowie die kontinuierliche<br />
Datenerfassung ist eine hilfreiche<br />
Ergänzung, um den optimalen Betrieb der<br />
Anlagen zu gewährleisten.<br />
Biogas Journal: Lohnt es sich denn überhaupt,<br />
diesen Aufwand der Datenerfassung<br />
auf den Kleinstanlagen zu betreiben?<br />
Dollinger: Es macht aus vielerlei Sicht<br />
Sinn. Es geht erst einmal darum, zu verstehen,<br />
welche Probleme diese Anlagen<br />
haben, warum der Betrieb gestört ist. Die<br />
Datensammlung, die Datenauswertung,<br />
das Filtern der Daten ist eine wichtige Basis<br />
für das Verstehen der Probleme. Nichtsdestotrotz<br />
verstehen wir den gesamten Prozess<br />
der automatisierten Datenerfassung in einem<br />
ersten Schritt als Machbarkeitsstudie,<br />
deren Ergebnisse nach Projektabschluss<br />
Elektro<br />
Hagl<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
+ Installation<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
Grünsalz (0176) 476 494 69<br />
Unser Grünsalz hilft Biogasanlagenbetreibern,<br />
die billig und unkompliziert schon im Fermenter<br />
entschwefeln wollen. Hervorragende Wirkung!<br />
Angebot: BigBag mit 1 to für nur<br />
498,00 € netto frei BGA in Deutschland<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Ihre Alte ist nicht dicht?<br />
Dichten durch Beschichten!<br />
Beschichtung als Betonschutz<br />
und / oder Dämmung,<br />
ihrer alten oder neuen<br />
Biogasanlage / Güllebehälter.<br />
Tel. 03525/8753610<br />
www.nilpferdhaut.de<br />
77
International<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Sensor mit Datenübertragungstechnik.<br />
veröffentlicht werden. In dem Projekt<br />
sollen also nicht nur die Hard- und Softwareseite<br />
betrachtet werden. Es geht uns<br />
vor allem um die Etablierung einer verlässlichen<br />
Servicestruktur vor Ort, die den<br />
Anlagenbetreibern einen echten Mehrwert<br />
bietet: So wurde ein SMS-Gateway entwickelt,<br />
über das die Betreiber direkt Kontakt<br />
mit einem Techniker aufnehmen können.<br />
Außerdem wurde ein Internetportal programmiert,<br />
in dem sich Techniker, die die<br />
Schulungen durchlaufen haben, registrieren<br />
können. Das ist das eigentliche Herzstück<br />
des Projektes.<br />
Biogas Journal: Was heißt Digitalisierung<br />
der Kleinstanlagen nun genau?<br />
Dollinger: Wir statten die Anlagen mit einem<br />
Sensor aus, der in der Gasleitung, die<br />
vom Speicher zur Kochstelle führt, eingesetzt<br />
wird und den Gasdruck in der Leitung<br />
misst. Anhand des Parameters Druck können<br />
wir eventuelle Verstopfungen detektieren<br />
oder auch Gaslecks erfassen. Außerdem<br />
erhalten die Betreiber ein Solarpanel,<br />
eine Batterie sowie ein Funkgerät. Das<br />
Komplettpaket kostet keine 60 Euro.<br />
Es gibt viele verschiedene Anlagen, die zum<br />
Beispiel nicht alle die gleichen Gasdruckkurven<br />
haben, was den Betrieb komplex macht.<br />
Später soll die Software die für die jeweilige<br />
Anlage spezifische Gasdruckkurve überwachen<br />
und gegebenenfalls Alarm geben.<br />
Ein solch datenbasiertes Netzwerk zu errichten,<br />
innerhalb dessen ein Informationsund<br />
Erfahrungsaustausch stattfindet, um<br />
die Verfügbarkeit der Kleinstanlagen zu<br />
verbessern, ist ein großer Erfolg. Zumal<br />
es in einer Region gelungen ist, die sehr<br />
Foto: SmartBiogasNetwork<br />
arm ist. Wir sehen, dass<br />
die Implementierung von<br />
Kommunikationspfaden<br />
vor Ort gar nicht teuer ist.<br />
Teuer ist die Hardware,<br />
also die Sensoren und<br />
deren Entwicklung.<br />
Biogas Journal: Gibt es<br />
noch weitere Vorteile –,<br />
neben den schon genannten<br />
– von denen die<br />
Kleinstanlagenbetreiber<br />
profitieren?<br />
Dollinger: Wenn erst<br />
einmal die produzierten<br />
Gasmengen erfasst<br />
sind, dann können die<br />
Betreiber künftig möglicherweise am CO 2<br />
-<br />
Zertifikatehandel teilnehmen, wodurch<br />
sich deren Einnahmesituation verbessert.<br />
Die Nachverfolgbarkeit und die Vernetzung<br />
sind enorm wichtig.<br />
Biogas Journal: Wie viele Anlagen konnten<br />
bisher in die Datenerfassung eingebunden<br />
werden?<br />
Dollinger: Wir haben seit Mitte Dezember<br />
zehn Anlagen in der Onlineerfassung,<br />
die sich im Nordosten des Landes in der<br />
Arusha-Region befinden. Erfreulich ist die<br />
Strahlkraft des Projektes. So haben wir inzwischen<br />
Anfragen aus dem benachbarten<br />
Kenia, ob es nicht auch dort möglich ist,<br />
solche Strukturen aufzubauen.<br />
Biogas Journal: Sie sagten, dass zehn Anlagen<br />
Daten liefern. Lassen sich aus der<br />
Datenerfassung schon erste Erkenntnisse<br />
ablesen?<br />
Dollinger: Aufgrund der manuellen Interpretation<br />
der Daten konnten erste Störungen<br />
auf den Anlagen entdeckt werden,<br />
wie zum Beispiel verstopfte Gasleitungen<br />
aufgrund von abgesetztem Kondensat. Das<br />
Projekt läuft noch bis März. Dann werden<br />
wir sicherlich mehr sagen können.<br />
Biogas Journal: Wenn das Projekt im März<br />
endet, wie geht es dann vor Ort weiter? Es<br />
ist doch sicherlich weitere finanzielle Unterstützung<br />
notwendig, oder?<br />
Dollinger: Es soll Folgeprojekte geben. Die<br />
wollen den Ausbau des SMS-Gateways weiter<br />
vorantreiben. Auch sollen die Techniker<br />
weiter geschult werden. Zudem ist CREA-<br />
TIVenergie auf der Suche nach Hilfsgeldern<br />
für ein eventuell ähnliches Projekt in<br />
Kenia. In dem sollen sich dann auch Privatpersonen<br />
engagieren können.<br />
Biogas Journal: Aber wer bezahlt in Zukunft<br />
den beratenden Techniker, die Wartung der<br />
digitalen Kommunikationsschnittstellen?<br />
Wer kommt für verschlissene Sensorik, Solarpanels,<br />
Batterien, Funkgeräte oder Softwareprobleme<br />
auf? Sind die Kleinbauern<br />
auf sich allein gestellt?<br />
Dollinger: Die Machbarkeitsstudie soll in<br />
einem ersten Schritt die Möglichkeiten und<br />
die damit verbundenen Kosten der Datensammlung<br />
aufzeigen. Danach muss bewertet<br />
werden, ob es sinnvoll ist, diesen Weg<br />
weiterzugehen und ob es ein regionales bzw.<br />
internationales Interesse gibt, die Anlagen<br />
an einen CO 2<br />
-Markt anzubinden, auch hinsichtlich<br />
der Gesichtspunkte Datenverlässlichkeit<br />
und niedriger CO 2<br />
-Preise.<br />
Was für uns im Vordergrund steht, ist aber<br />
die mit wenig Kosten verbundene Möglichkeit,<br />
ein Netzwerk mit SMS-Gateway,<br />
geschultem Personal und einem „Bewertungssystem“<br />
professionell aufzubauen.<br />
Damit ist gemeint, dass jeder Job geloggt<br />
wird und die erbrachte Leistung des Technikers<br />
bewertet werden kann. Die Techniker<br />
können dann ebenfalls ihre Erfahrungen<br />
aufschreiben, damit der nächste Job von<br />
vorneherein gezielter angegangen werden<br />
kann. Damit versprechen wir uns einen<br />
nachhaltig positiven Effekt in den Bereichen<br />
Klimaschutz, Gesundheit und auch in<br />
der generellen Wahrnehmung von Kleinstbiogasanlagen,<br />
die durch die vielen bisher<br />
ungelösten Probleme ein bisweilen eher<br />
schlechtes Image haben.<br />
Biogas Journal: Herr Dollinger, vielen Dank<br />
für das Gespräch.<br />
Hinweis: Weitere Informationen zum<br />
Projekt finden Sie auf der Internetseite<br />
www.smartbiogas.net.<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
78
Sonic Cut Thru Heavy<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
International<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Der STORM-Service<br />
für Ihre Biogas-Anlage<br />
- Störungsbehebung<br />
- Instandsetzung<br />
- Wartung/Inspektion<br />
- Ersatzteilversorgung<br />
Schnell und kompetent - überall<br />
in Ihrer Nähe - 24 h täglich*<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
SENSOREN<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle<br />
Fon: +49 5977 73-0 · Fax: +49 5977 73-138 · www.a-storm.com · info@a-storm.com<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
Sie ziehen ihre Kreise.<br />
Effizient. Zuverlässig. Legendär.<br />
P HAN T O M<br />
Das Rührwerk<br />
Heavy-Duty Rührwerke<br />
PTM GmbH ۰ D-87719 Mindelheim<br />
+49 82 61 ⃒ 738 182<br />
info@propeller-technik-maier.de<br />
www.propeller-technik-maier.de<br />
Unsere Produkte:<br />
Gasdruckerhöhung<br />
für Biogas, Erdgas, Klärgas, etc.<br />
Zum Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2 gemäß der<br />
ATEX Richtlinie 2014/34/EU<br />
MAPRO® Gasverdichter sind keine Zündquellen<br />
NEU! Wartung zum Festpreis<br />
Seitenkanalverdichter<br />
0-800 mbar | 0-1900 m³/h<br />
Radialventilatoren<br />
0-155 mbar | 0-2600 m³/h<br />
Drehschieberkompressoren<br />
0,5-3,5 bar | 22-2900 m³/h<br />
Mehrstufige-Zentrifugalverdichter<br />
0-950 mbar | 0-3550 m³/h<br />
MAPRO® Deutschland GmbH<br />
www.maprodeutschland.com<br />
E-Mail: deutschland@maproint.com<br />
Tel.: +49 (0) 211 98485400<br />
79
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
Komplexität des<br />
Themas Biogas<br />
wächst weiter<br />
Wie sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hat, wird das<br />
Thema Biogas zunehmend komplexer und führt zu weiteren<br />
Herausforderungen für die gesamte Biogasbranche: So geht<br />
die neue Düngeverordnung in ihr erstes vollständiges Jahr<br />
inklusive neuer Stoffstrombilanz und neue Anforderungen an<br />
die Emissionsminderung, Anlagensicherheit sowie Netzanschluss<br />
werden zur Umsetzung kommen. Wir als Geschäftsstelle<br />
werden unsere Mitglieder dabei intensiv unterstützen.<br />
Hierzu zählt neben der politisch-fachlichen Arbeit insbesondere<br />
die Bereitstellung von Arbeitshilfen und Schulungen.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Das Referat Politik war in den vergangenen Wochen und Monaten<br />
intensiv mit der Begleitung des steinigen Wegs zur Regierungsbildung<br />
beschäftigt. Im Rahmen der gemeinsam mit dem<br />
Dachverband BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.)<br />
durchgeführten Kampagne wurden politische Gespräche mit Entscheidungsträgern<br />
ebenso wahrgenommen wie Präsenzen auf den im Zusammenhang<br />
mit den Wahlen veranstalteten Parteitagen der Grünen, der CSU<br />
und der SPD.<br />
Zusätzlich initiierten wir in Allianz mit dem Deutschen Bauernverband und<br />
dem Bundesverband Bioenergie ein parlamentarisches Frühstück, um die<br />
Abgeordneten über aktuelle Belange der Bioenergie zu informieren. Der zwischenzeitlich<br />
vorliegende Koalitionsvertrag zeigt, dass unsere Bemühungen<br />
von Erfolg gekrönt sind: Er enthält unter anderem ein explizites Bekenntnis<br />
zu dem Beitrag, den die Bioenergie zu den Zielen der Bundesregierung bei<br />
Energiewende und Klimaschutz leistet.<br />
Ebenso konnte der Fachverband konkrete Anknüpfungspunkte platzieren,<br />
die wir in der sich nun hoffentlich bald anschließenden Legislaturperiode<br />
nutzen können, um etwa für Verbesserungen des Ausschreibungsdesigns im<br />
80
Engagiert. Aktiv. Vor Ort. Und in Berlin: Der Fachverband Biogas e.V.<br />
EEG einzutreten, für eine Ausweitung der Vergärung<br />
von Wirtschaftsdünger sowie für die Weiterentwicklung<br />
der Treibhausgasminderungsquote, dem zentralen Förderinstrument<br />
für Biomethan als Kraftstoff.<br />
Fachverband Biogas erstellt<br />
Gärprodukt-Broschüre<br />
Aufgrund der steigenden düngerechtlichen Anforderungen<br />
an die Ausbringung und Lagerung von Gärprodukten<br />
in Deutschland ist das Interesse von Biogasanlagenbetreibern<br />
an innovativen Ausbringungs- und<br />
Aufbereitungstechniken, Betriebshilfsmitteln sowie<br />
Vermarktungskonzepten – auch im internationalen<br />
Markt – stark gestiegen. Nachdem der deutschsprachige<br />
Branchenführer „Güllekleinanlagen“ und die englischsprachigen<br />
Bioabfall- und Biomethanbroschüren<br />
(http://www.biowaste-to-biogas.com/, http://www.biogas-to-biomethane.com/)<br />
ein voller Erfolg waren und<br />
großen Anklang unter potenziellen Investoren fanden,<br />
wird diese Serie um eine deutschsprachige Gärprodukt-<br />
Broschüre „Düngen mit Gärprodukten – Anwendung,<br />
Aufbereitung und Vermarktung“ erweitert. Diese soll<br />
anschließend ins Englische übersetzt werden, um<br />
internationale Themen ergänzt und als „Digestate as<br />
fertilizer – application, upgrading and marketing“ publiziert<br />
werden.<br />
Beide Broschüren werden sich vom Layout und allgemeinen<br />
Aufbau, Auflage und Kooperationen stark<br />
an den bisherigen Broschüren orientieren und sollen<br />
im Sommer <strong>2018</strong> beziehungsweise in Englisch im<br />
Frühjahr 2019 erscheinen. In einem fachlichen Teil<br />
werden die Herstellung von Gärprodukten, rechtliche<br />
Rahmenbedingungen, Anwendungsmöglichkeiten,<br />
Aufbereitungstechniken und Vermarktungsstrategien<br />
dargestellt. Anschließend sollen dem Leser verschiedene<br />
Referenzanlagen – das heißt, Biogasanlagen mit innovativen<br />
Konzepten bei der Anwendung, Aufbereitung<br />
und Vermarktung von den hergestellten Gärprodukten –<br />
vorgestellt werden. Im zweiten Teil der Broschüre werden<br />
Firmen und deren Produkte/Dienstleistungen rund<br />
um die Gärproduktanwendung und -aufbereitung vorgestellt.<br />
Öffentlichkeitsarbeit <strong>2018</strong><br />
Wie immer zu Beginn eines Jahres haben sich die Öffentlichkeitsarbeiter<br />
des Fachverbandes Biogas zusammengesetzt,<br />
um einen Jahresplan zu erstellen. Die<br />
beiden Themenschwerpunkte, die sich in diesem Jahr<br />
herauskristallisiert haben, sind Artenvielfalt und Flexibilisierung.<br />
Im Zusammenhang mit der Artenvielfalt<br />
wollen wir die breite Palette von Energiepflanzen vorstellen,<br />
mit besonderem Fokus auf die Durchwachsene<br />
Silphie.<br />
Das Thema „Flexibilisierung“ steht unter dem Oberbegriff<br />
„BioBatterie“ und soll die Speicher- und Ausgleichsfunktion<br />
von Biogas anschaulich darstellen. Neben<br />
diesen Schwerpunkten wird die gesamte Palette<br />
der positiven Biogaseigenschaften je nach Anlass und<br />
Jahreszeit über verschiedene Kanäle, Informationen<br />
und Aktionen Beachtung finden.<br />
Zahlreiche traditionelle Veranstaltungen<br />
zu Jahresbeginn<br />
Das Referat Veranstaltungen hat im Januar bereits drei<br />
Projekte umgesetzt oder begleitet: Traditionell kurz<br />
nach dem Jahreswechsel am 4. und 5. Januar fanden<br />
die Biogastage Bad Waldsee mit über 130 Teilnehmern<br />
statt. Kaum eine Woche später präsentierte sich der<br />
Fachverband mit einem Ausstellungsstand und seinen<br />
Experten auf den Biogasinfotagen in Ulm.<br />
Als Mitveranstalter des 16. Internationalen Fachkongresses<br />
für erneuerbare Mobilität „Kraftstoffe der<br />
Zukunft“ in Berlin gestaltete der Fachverband den<br />
Vortragsblock zum Thema „Biomethan im Verkehrssektor<br />
in Deutschland“. Außerdem fanden Ende Januar/Anfang<br />
Februar die ersten Intensivschulungen der<br />
Fachverband Biogas Service GmbH im Jahr <strong>2018</strong> zum<br />
Thema Ausschreibungen statt. Bei bislang vier Schulungen<br />
in Osnabrück, Rendsburg, Ingolstadt und Bielefeld<br />
wurden mehr als 40 Teilnehmer entsprechend auf<br />
die anstehenden Ausschreibungen am 1. September<br />
<strong>2018</strong> vorbereitet.<br />
Umsetzungsfragen zur AwSV<br />
Die im Referat Genehmigung angesiedelten Themen<br />
nehmen aktuell Fahrt auf. Nach einer ersten behördenseitigen<br />
„Schockstarre“ nach dem Inkrafttreten<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann‘s!<br />
81
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Neuer Mitarbeiter<br />
Alexey Mozgovoy leitet seit Dezember letzten Jahres<br />
die neu geschaffene Stabsstelle Kraftstoff und Biomethan<br />
im Fachverband Biogas e.V. Neben den bereits etablierten<br />
Biogasnutzungspfaden wie Vor-Ort-Verstromung und<br />
Gasnetzeinspeisung gewinnt auch die Kraftstoffnutzung<br />
zunehmend an Bedeutung. Die Bündelung der Aktivitäten<br />
des Fachverbandes im Bereich Biomethan als Kraftstoff soll<br />
dabei durch die Stabsstelle erfolgen. Der studierte Gasversorgungs-<br />
und Energiesystemtechnikingenieur beschäftigt<br />
sich bereits seit über zehn Jahren mit Themen der sicheren<br />
und nachhaltigen Energie- und Kraftstoffversorgung.<br />
der AwSV (Verordnung über Anlagen zum<br />
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)<br />
am 1. August 2017 kommen nun immer<br />
deutlicher die vonseiten des Fachverbandes<br />
bereits seit fast zwei Jahren thematisierten<br />
offenen Fragen im Hinblick auf den<br />
Vollzug der neuen Regelungen zum Tragen.<br />
Diese sind zum Beispiel: Bestimmung von<br />
Prüfzeitpunkten, Einsatz von Spurenelementen<br />
oder der Umgang mit überbetrieblicher<br />
Gärrestlagerung. Der Verband ist hier<br />
im Austausch mit diversen Landesministerien<br />
sowie der Bund-/Länderarbeitsgruppe,<br />
um praktikable Regelungen für die Branche<br />
zu entwickeln. Neben dem anlagenbezogenen<br />
Gewässerschutz beschäftigt auch die<br />
weiterhin anstehende Überarbeitung der<br />
TA Luft das Referat.<br />
Nachdem der Fachverband zum letzten<br />
bekannt gewordenen Entwurf der TA Luft<br />
unaufgefordert eine umfangreiche Stellungnahme<br />
abgegeben hatte, wird nun ein<br />
diesbezügliches Gespräch mit dem Bundesumweltministerium<br />
und dem Umweltbundesamt<br />
stattfinden. Neben übergeordneten<br />
bundesrechtlichen Themen stehen<br />
auch landesspezifische Themen an, wie<br />
zum Beispiel die geplante Änderung des<br />
Landesentwicklungsplanes NRW.<br />
Diskussionen zum<br />
Luftreinhaltebonus<br />
Hinsichtlich der Neuregelung der Emissionswerte<br />
für den Erhalt des Luftreinhaltebonus<br />
hatte die Bund-Länderarbeitsgemeinschaft<br />
Immissionsschutz (LAI) im<br />
Herbst 2017 eine neue Vollzugsempfehlung<br />
verabschiedet. In den vergangenen<br />
Tagen hatten die dazu relevanten Gremien<br />
nochmals über die unterjährige Umstellung<br />
diskutiert. Scheinbar gab es hierbei keine<br />
abschließende Entscheidung, ob der unterjährige<br />
Stichtag so bestehen bleibt oder<br />
der Stichtag auf den Jahreswechsel nach<br />
hinten geschoben wird.<br />
Hinsichtlich der geplanten neuen BImSchV<br />
zur Umsetzung der MCP-Directive (Medium<br />
Combustion Plant Directive) sickert in Gesprächen<br />
mit zuständigen Behörden durch,<br />
dass bei den NO x<br />
-Abgasgrenzwerten keine<br />
unmittelbare Absenkung der bisher geltenden<br />
500 Milligramm pro Kubikmeter Abgas<br />
(mg/m³) in Aussicht steht. Kontroverse Diskussionen<br />
gibt es noch, ob für die Einhaltung<br />
der NO x<br />
-Grenzwerte zukünftig ein NO x<br />
-<br />
Sensor zu Anwendung kommen muss (siehe<br />
Schwerpunktthema ab Seite 24).<br />
Begleitung der TRAS 120<br />
Wie bereits mehrfach berichtet, wird derzeit<br />
unter Hochdruck an der Fertigstellung<br />
der Technischen Regel Anlagensicherheit<br />
Biogas (TRAS 120) durch den Arbeitskreis<br />
Biogas der Kommission für Anlagensicherheit<br />
(KAS) gearbeitet. Der Fachverband<br />
Biogas ist mit verschiedenen Referaten<br />
intensiv an den Diskussionen beteiligt und<br />
versucht auf Basis der bereits in der Stellungnahme<br />
eingebrachten Änderungsvorschläge<br />
die TRAS 120 auf ein praktikables<br />
und vernünftiges Niveau zu bringen.<br />
Schwerpunktthemen in den vergangenen<br />
Verhandlungen waren die neuen Qualifizierungsanforderungen<br />
für Betreiber,<br />
Beschäftigte, Planer und Errichter von<br />
Biogasanlagen sowie der Themenkomplex<br />
Schutzabstände von einzelnen Anlagenteilen<br />
zueinander und zu externen Einrichtungen<br />
wie Windrädern usw. Im weiteren<br />
Verlauf ist geplant, dass ein neuer<br />
TRAS-Entwurf bis zur nächsten Sitzung<br />
im Sommer erstellt wird und dieser dann<br />
in die Länderanhörung geht. Mit einer<br />
Veröffentlichung der TRAS 120 ist vermutlich<br />
Ende <strong>2018</strong> zu rechnen. Das Referat<br />
Hersteller und Technik ist nach wie<br />
vor mit dem Entwurf zur Anwendungsregel<br />
AR 4110 (Technische Anschlussregeln<br />
Mittelspannung) beschäftigt bzw.<br />
an der Erstellung eines Einheitspapiers<br />
des VDMA „Überwachung von stationären<br />
Verbrennungsmotoranlagen“ beteiligt.<br />
Referat International<br />
Ende Dezember wurde das unter Mitwirkung<br />
des Fachverbandes durchgeführte<br />
EU-Projekt BIOSURF erfolgreich abgeschlossen.<br />
Derzeit gibt es Überlegungen<br />
für ein Folgeprojekt. Im Rahmen eines in<br />
Südafrika bearbeiteten Projektes wird am<br />
20. Februar in Pretoria ein Workshop zur<br />
Vorstellung der aktuellen Projektergebnisse<br />
stattfinden. Weiterhin in Bearbeitung sind<br />
Projekte in den Ländern Kambodscha und<br />
Indien (Kammer- und Verbandspartnerschaft).<br />
In diesem Zusammenhang fand<br />
eine gemeinsam vom Fachverband Biogas,<br />
der Indian Biogas Association sowie dem<br />
Gujarat Energy Research and Management<br />
Institute (GERMI) organsierte Veranstaltung<br />
statt, um eine vom DBFZ erstellte Potenzialstudie<br />
mit den Stakeholdern abzustimmen.<br />
Die Veröffentlichung der Studie<br />
ist für den März geplant<br />
Auch in der EU-Politik bewegt sich einiges:<br />
Das EU-Winterpaket wird voraussichtlich<br />
noch in diesem Jahr abschließend behandelt.<br />
Die Energieeffizienzrichtlinie, die<br />
Erneuerbare-Energien-Richtlinie und die<br />
Governance-Richtlinie werden in den kommenden<br />
Monaten unter der bulgarischen<br />
Ratspräsidentschaft im sogenannten Trilogverfahren<br />
verhandelt. Für die Biogasbranche<br />
ergeben sich vor allem durch die<br />
Neufassung der Erneuerbare-Energien-<br />
Richtlinie wichtige Veränderungen, wie<br />
zum Beispiel die Einbeziehung der festen<br />
und gasförmigen Biomasse für die Stromund<br />
Wärmeproduktion in die Nachhaltigkeitskriterien<br />
sowie neue Ziele im Verkehrssektor,<br />
wie zum Beispiel Unterquoten<br />
im Verkehrssektor für Kraftstoffe aus Restund<br />
Abfallstoffen.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
82
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
DDL ®<br />
Nachrüstsatz<br />
für nachträgliche<br />
Montage bei<br />
Verwendung von<br />
Gliederketten oder<br />
Kompakt Dichtungen<br />
Verband<br />
Expandable SCHNELL, SCHNELL! Capacity<br />
Mit The dem housing DCL that ensures QUICK-LID®<br />
you meet<br />
current and future emission regulations<br />
Schnellwechselsystem<br />
die 20 mg<br />
Formaldehyd sichern.<br />
Dichteinsatz<br />
mit Befestigungslaschen<br />
für Behälterwand<br />
web www.ddl-dichttechnik.de<br />
Tel. (+49) 07153 61093-0<br />
Fax (+49) 07153 61093-029<br />
mail vertrieb@ddl-dichttechnik.de<br />
®<br />
DDL<br />
Durchführungstechnik<br />
Dichtsysteme<br />
Lutz<br />
DDL-Annonce_BIOGAS-Journal_85x118_4c_FIN.indd 1 05.02.18 15:08<br />
Der BHKW-Service von WELTEC.<br />
Immer in Ihrer Nähe.<br />
Ihre Vorteile<br />
• alle gängigen Motoren<br />
• langjährige & geschulte Mitarbeiter<br />
• 24/7 Notdienst<br />
Organic energy worldwide<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
04441-999 78-0<br />
info@weltec-biopower.de<br />
Erweiterbares Schnellwechselsystem für<br />
zukunftssichere Emissionsminderung<br />
Jedes DCL Quick-Lid Gehäuse hat Platz für zwei<br />
Elemente in verschiedenen Zelldichten um die<br />
Einhaltung aktueller und zukünftiger Emissionen zu<br />
sichern, während Ihr Budget geschont wird.<br />
Durch Einschub eines zweiten Elements können<br />
mit dem DCL Quick-Lid verschiedene TA-Luft<br />
Anforderungen wie 40, 30 oder 20mg Formaldehyd<br />
eingehalten werden.<br />
Erfahren Sie mehr auf www.DCL-inc.de<br />
83
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern<br />
Entlastungen bei den Netzentgelten<br />
im WEMAG-Netz in Aussicht<br />
Die Regionalgruppe war maßgeblich<br />
an zwei interessanten<br />
Fachveranstaltungen zum Ausklang<br />
des alten bzw. Start des<br />
neuen Jahres beteiligt. Etwa 80<br />
Teilnehmer waren der Einladung des Fachverbandes<br />
Biogas und der WEMAG zur 6.<br />
Biogasfachtagung nach Schwerin am 21.<br />
Dezember 2017 gefolgt. Mathias Groth,<br />
WEMAG-Referent für Einspeisemanagement<br />
und neue Märkte, wies unter anderem<br />
in seiner Begrüßung darauf hin, dass<br />
die Netzentgelte und die EEG-Umlage für<br />
<strong>2018</strong> fallen werden.<br />
Auch in den kommenden Jahren wird mit<br />
weiteren Entlastungen bei den Netzentgelten<br />
im WEMAG-Netz gerechnet. Nach einem<br />
kurzen Blick auf die Branchenzahlen<br />
durch den Regionalgruppensprecher Maik<br />
Orth wurden durch weitere Referenten interessante<br />
und relevante Fragestellungen<br />
und Herausforderungen für die Anlagenbetreiber<br />
thematisiert.<br />
So referierte Dr. Hartwig von Bredow über<br />
aktuelle rechtliche Fragen und ging dabei<br />
auch auf die kürzlich erfolgte Insolvenz des<br />
Direktvermarkters Clean Energy Sourcing<br />
ein. Dr. Dietrich Clemens von der Treurat<br />
+ Partner Unternehmensberatungsgesellschaft<br />
wies unter anderem auf mögliche<br />
Korrosionsschäden in der Biogasanlage<br />
durch Schwefel im Biogas und mögliche<br />
Vermeidungsstrategien<br />
hin, während Steffi<br />
Kleeberg vom Fachverband<br />
Biogas einen Überblick<br />
über die aktuellen<br />
Rahmenbedingungen<br />
aus Immissionsschutz<br />
und anlagenbezogenem<br />
Gewässerschutz gab.<br />
Die Wärmewende in<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
als wichtiger Baustein<br />
der Energiewende<br />
war Thema der ersten<br />
Fachveranstaltung des<br />
LEE-MV im neuen Jahr.<br />
„Die Klimaziele können<br />
nur erreicht werden,<br />
wenn die gesamte Wärmeversorgung<br />
schrittweise von<br />
Kohle, Öl und Erdgas auf 100<br />
Prozent grüne Energie umgestellt<br />
und gleichzeitig der Verbrauch<br />
gesenkt wird“, sagte Rudolf Borchert,<br />
1. Vorsitzender des LEE-<br />
MV, in seinem Eröffnungsstatement.<br />
Nachdem Ulf Sieberg vom Bundesverband<br />
Erneuerbare Energie<br />
e.V. in seinem Impulsvortrag die<br />
bundespolitischen Rahmenbedingungen<br />
der Wärmewende darstellte,<br />
beleuchteten die folgenden<br />
Präsentationen die Situation<br />
in Mecklenburg-Vorpommern. Die<br />
Rolle der Bioenergie für die Wärmewende<br />
in Mecklenburg-Vorpommern<br />
wurde durch den Regionalgruppensprecher<br />
vorgestellt.<br />
Der Fachverband Biogas ist mit<br />
der Regionalgruppe ein aktiver<br />
Partner des LEE-MV und leitet<br />
unter anderem die AG „Bioenergie“.<br />
Diese nahm im Jahr 2017 ihre Arbeit<br />
auf und bündelt die Akteure der Bioenergiebranche<br />
in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bioenergie<br />
derzeit einen Anteil von etwas mehr<br />
als 13 Prozent. In Summe aller erneuerbaren<br />
Energieträger liegt das Bundesland damit<br />
leicht über dem Bundesdurchschnitt.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Maik Orth<br />
IBZ Hohen Luckow<br />
Tel. 0 38 295/74 101<br />
E-Mail: ibz@ibz-hl.de<br />
Neuwahl der Vertreter der Regionalgruppe<br />
Nordwürttemberg-Nordbaden<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Regionalgruppensprecher Maik Orth (links)<br />
mit Mathias Groth, WEMAG-Referent für<br />
Einspeisemanagement und neue Märkte.<br />
Kontinuität ist in der flächengrößten<br />
baden-württembergischen<br />
Regionalgruppe (RG) angesagt –<br />
die bisherigen Vertreter sind auch<br />
in gleicher Funktion die neuen,<br />
von links: Gottfried Gronbach (stv.<br />
RG-Sprecher), Winfried Vees (Betreibersprecher),<br />
Dr. Birgit Eppler (RG-<br />
Sprecherin) und Ulrich Ramsaier<br />
(stv. Betreibersprecher).<br />
Foto: WEMAG/Stephan Rudolph-Kramer<br />
84
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
Regionalgruppe Niederbayern<br />
Nachverstromung<br />
mittels Dampfmotor<br />
Die Regionalgruppe Niederbayern lud zusammen mit<br />
der Firma AWN GmbH aus Unterneukirchen am 2. Januar<br />
zu einem Biogas-Praxistag nach Mitterskirchen<br />
ein. Themen der Veranstaltung waren Technik, Wirtschaftlichkeit,<br />
Vergütung und Fördermöglichkeiten<br />
der Nachverstromung mittels Dampfmotor. Den Fachvorträgen<br />
ging die Besichtigung einer Praxisanlage voraus.<br />
Über 70 Biogasanlagenbetreiber folgten der Einladung und informierten<br />
sich zum Thema Nachverstromung. Zu Beginn konnten<br />
die Teilnehmer die Anlage auf dem Betrieb von Stephan Kastenhuber<br />
besichtigen und Fragen an Richard Langlechner, Geschäftsführer<br />
der AWN GmbH, und den Anlagenbetreiber stellen.<br />
Im anschließenden Vortragsteil im Gasthaus Hamberger in Mitterskirchen<br />
ging Langlechner auf die Entwicklung und Geschichte<br />
der Technologie sowie auf die technische Wirkungsweise und den<br />
Aufbau des zuvor besichtigten Anlagentyps ein. Durch die Nachverstromung<br />
könne das Abgas der Biogasanlage für eine Dampferzeugung<br />
genutzt werden, ergänzte Jörg Lezuo, ebenfalls AWN GmbH.<br />
Damit könne beispielsweise zwischen 5 bis 9 Prozent mehr Strom<br />
erzeugt werden, ohne dass der Betrieb Wärme vermisse. Zudem<br />
erreiche die Anlage eine im Schnitt 12 Prozent höhere Stromkennzahl<br />
und die Stromgestehungskosten könnten gesenkt werden. Lezuo<br />
betonte auch den Vorteil für das Image von Biogasanlagen, da<br />
diese so ressourcenschonender und effizienter arbeiteten.<br />
Welche Fördermöglichkeiten für die Nachverstromung vorhanden<br />
sind, zeigte der Energieeffizienzberater Rudolf Cirbus. Eine Nachverstromungsanlage<br />
könne im Rahmen der KfW-Programme 294<br />
bzw. 494 mit bis zu 40 Prozent gefördert werden, wenn der erzeugte<br />
Strom ausschließlich zur Eigenversorgung genutzt werde, so<br />
Cirbus. Notwendig für einen solchen Zuschuss sei ein durch einen<br />
von der KfW zugelassenen Gutachter erstelltes Abwärmekonzept.<br />
Cirbus legte den Teilnehmern nahe, im Vorfeld eine Energieberatung<br />
Mittelstand durchzuführen. Diese Beratung werde durch das<br />
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit bis zu<br />
80 Prozent bezuschusst und erstelle unter anderem ein Abwärmekonzept,<br />
das für das KfW-Programm genutzt werden könne.<br />
Text: C.A.R.M.E.N. e.V.<br />
Vollgas im Fermenter.<br />
Entschwefelung<br />
Warum Entschwefelungs mittel?<br />
– Schnelle und zuverlässige Bindung von schädlichem<br />
Sulfid und Schwefelwasserstoff<br />
– Fördert den Methanertrag und die Spurenelementverfügbarkeit<br />
– Schnelle Reaktivität durch amorphe Struktur des<br />
Eisenhydroxids<br />
Produktempfehlung:<br />
MethaTec ® Detox S Premium<br />
MethaTec ® Detox S Turbo<br />
Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.<br />
MethaTec ® Detox S Aktiv<br />
MethaTec ® Detox S „feucht“<br />
Besichtigung der Nachverstromungsanlage<br />
auf dem Betrieb von Stephan Kastenhuber.<br />
www.terravis-biogas.de<br />
85<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
Johannes Joslowski, Tel.: 0251 . 682-2056<br />
johannes.joslowski@terravis-biogas.de<br />
Jens Petermann, Tel.: 0251 . 682-2438<br />
jens.petermann@terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Regionalgruppe Schwarzwald-Südbaden<br />
Regionalgruppe erstmals mit Kreisvertretern<br />
Beim gut besuchten Regionalgruppentreffen<br />
im November<br />
stellte Geschäftsführer Dr. Stefan<br />
Rauh die Ergebnisse der<br />
ersten Ausschreibungsrunde für<br />
Biogas nach EEG 2017 vor. Er erläuterte die<br />
Konsequenzen daraus für die Verbandspolitik<br />
– ein Vortrag, den jeder Biogas-Interessierte<br />
gehört haben sollte. Hier die wesentlichen<br />
Kernbotschaften:<br />
1. Geringe Beteiligung mit nur 23 Prozent<br />
des Ausschreibungsvolumens – 27,6 MW<br />
von netto 122,6 MW.<br />
2. 9 von 33 Geboten wurden ausgeschlossen<br />
(= 13,4 MW), zumeist aus formalen<br />
Gründen.<br />
3. Unerwartet 17 Bestands-Biogasanlagen<br />
(11x NawaRo), aber nur 4 Neuanlagen<br />
(1x Biomethan, 2x Sat-BHKW).<br />
Die starke Regionalgruppenvertretung Schwarzwald-Südbaden (von rechts) mit den Landkreis-Vertretern:<br />
Ulrich Winkler (Waldshut), Philipp Ewald (Betreibersprecher), Steffen Benne (Tuttlingen), Harald Reinbold<br />
(Emmendingen), Wolfram Wiggert (Breisgau-Hochschwarzwald), Alois Frey (Schwarzwald-Baar), Bernd<br />
Grieshaber (stellvertretender Betreibersprecher), Matthias Teufel (Rottweil), Raphael Baumert (Offenburg),<br />
Otto Körner (Regionalgruppensprecher). Es fehlen Markus Traber (Konstanz) und Bernd Roth (stellvertretender<br />
Regionalgruppensprecher).<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
4. Die Zuschlagswerte sind zumeist die<br />
Maximalwerte; der niedrige durchschnittliche<br />
Zuschlagswert von 14,3<br />
ct/kWh rührt von einer sehr großen<br />
Anlage mit fester Biomasse (9,86 ct/<br />
kWh) und vier Abfall-BGA (begrenzt<br />
auf Vergütungshöhe der letzten drei<br />
Jahre) her.<br />
5. Die mindestens doppelte Überbauung<br />
wurde von fünf Biogasanlagen durch<br />
Halbierung der Bemessungsleistung<br />
realisiert.<br />
Wegen der geringen Beteiligung ist diese<br />
Ausschreibungsrunde nicht repräsentativ.<br />
Aufgrund der geringen Beteiligung müssen<br />
gleichwohl die Rahmenbedingungen verbessert<br />
werden, um den Bestand zu sichern<br />
und zumindest einen gewissen Neubau anzureizen.<br />
Dazu zählen unter anderem:<br />
1. Zwei Ausschreibungen pro Jahr (statt<br />
nur einer).<br />
2. Verlängerung des Vergütungszeitraumes<br />
bei vorzeitigem Wechsel (statt Verlust<br />
von bisheriger EEG-Vergütung).<br />
3. Gebotshöchstwerte anheben für Neuund<br />
Bestands-BGA, siehe französisches<br />
Modell.<br />
4. Güllevergärung außerhalb Ausschreibung<br />
stärken.<br />
5. Außerdem: Fachrecht aus dem EEG<br />
raus (150-Tage + Maisdeckel), Ausschreibung<br />
auf Bemessungsleistung<br />
umstellen, Flexdeckel streichen, Gülle-<br />
Bestandsanlagen erhalten usw.<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
Mobile Werkstatt Hagemeier e.K.<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 (0) 9826 / 6583 - 0 · info@aprovis.com<br />
www.aprovis.com<br />
86
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
Etliches davon wird im Bundeswirtschaftsministerium<br />
positiv gesehen<br />
oder zumindest nicht abgelehnt. Eine<br />
Erhöhung der Höchstzuschlagswerte<br />
erscheint unrealistisch, da das Ministerium<br />
Biogas nicht dauerhaft im<br />
Strombereich sieht. Gleichwohl ist eine<br />
intensive Begründung pro Biogas da,<br />
wenn es zur Reduktion der winterlichen<br />
Dunkelflaute beiträgt und gleichzeitig<br />
noch erneuerbare Wärme bereitstellt.<br />
Im Rahmen der Veranstaltung wurde<br />
die neue Vertretung der Regionalgruppe<br />
mit Otto Körner als wiedergewähltem<br />
Sprecher und Philipp Ewald als<br />
neuem Betreiberbeirat gewählt. Als ihre<br />
Vertreter wirken neu mit Bernd Roth<br />
und Bernd Grieshaber. Damit beginnt<br />
gleichzeitig ein gebotener Generationswechsel<br />
und die Einbeziehung jungen,<br />
frischen Engagements. Erstmalig<br />
ergänzen Kreisvertreter aus acht von<br />
neun Landkreisen die satzungsgemäße<br />
Regionalgruppenführung (siehe Foto).<br />
Durch verstärkte Basiseinbindung soll<br />
die Mitbestimmung in der Fachverbandspolitik<br />
erhöht werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent Süd<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
Tel. 07 71/18 59 98 44<br />
E-Mail: otto.koerner@biogas.org<br />
Von links: Petra Zahnen (WKN AG), Hans-Ulrich Martensen (Fachverband Biogas), Reinhard Christiansen<br />
(BWE SH), Ove Petersen (watt 2.0 e.V.) und Markus Andresen (GP JOULE GmbH).<br />
Schleswig-Holstein: Neuer Landesverband<br />
Erneuerbare Energien gegründet<br />
Kiel – Gemeinsam stark: unter diesem Motto wurde<br />
am 17. Januar in Rendsburg eine gemeinsame Interessenvertretung<br />
der Erneuerbare-Energien-Branche<br />
Schleswig-Holstein gegründet. Der neue Landesverband<br />
Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (LEE<br />
SH) verfolgt das Ziel, die Energiewende im Norden<br />
weiter voranzutreiben. Dabei sollen die Kräfte der<br />
Spartenverbände gebündelt und sinnvoll eingesetzt<br />
werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen und<br />
die Chancen der Energiewende für die schleswigholsteinische<br />
Wirtschaft stärker zu nutzen. Im Fokus<br />
des neuen Verbandes wird die gemeinsame Arbeit<br />
für die Themen der übergeordneten Energiepolitik<br />
stehen. Die Schwerpunkte und Aufgaben der Spartenverbände<br />
bleiben daneben weiterhin bestehen.<br />
Das Interesse an der Gründungsveranstaltung war<br />
hoch, insgesamt 40 Mitglieder bekundeten bei diesem<br />
ersten Aufschlag ihren Beitritt zum LEE SH. Bei<br />
einer anschließenden ersten Mitgliederversammlung<br />
wurde dann satzungsgemäß sowohl ein geschäftsführender<br />
als auch ein erweiterter Vorstand gewählt.<br />
Geschäftsführender Vorstand:<br />
ffVorstandsvorsitzender:<br />
Reinhard Christiansen.<br />
ffStellvertretender Vorsitzender &<br />
Schatzmeister: Hans-Ulrich Martensen.<br />
ffStellvertretender Vorsitzender &<br />
Schriftführer: Ove Petersen.<br />
ffStellvertretender Vorsitzender:<br />
Markus Andresen.<br />
ffStellvertretende Vorsitzende: Petra Zahnen.<br />
In den erweiterten Vorstand wurden gewählt:<br />
Christian Andresen, Marko Bartelsen, Martin<br />
Grundmann, Heiko Hansen, Marten Jensen,<br />
Torsten Levsen, Arne Petersen.<br />
Dosiertechnik vom Marktführer<br />
Wirtschaftlich | Zuverlässig | Sicher<br />
Rondomat<br />
PolyPro + Rondomat<br />
PolyPro + Multimix<br />
Für alle Substrate von 5 – 246 m 3<br />
Fliegl Agrartechnik GmbH | D-84453 Mühldorf | Telefon: +49 (0) 8631 307-0 | biogas@fliegl.com<br />
87
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Fotos: Ulrich Drochner<br />
Zunehmende Auflagen sind kaum<br />
noch wirtschaftlich zu stemmen<br />
Die Regionalgruppe Münsterland des Fachverbandes<br />
Biogas e.V. besuchte während eines Treffens<br />
die Biogasanlage von Hugo Nienhaus. Auf<br />
dem Foto links ist ein überdachtes Fahrsilo zu<br />
sehen, auf dessen Dach eine Fotovoltaikanlage<br />
installiert wurde. Auf dem rechten Bild sind der<br />
Feststoffeintrag sowie die Gärbehälter zu sehen.<br />
Regional<br />
büro<br />
West<br />
Am 23. Januar lud das<br />
Dienstleistungszentrum<br />
ländlicher Raum (kurz<br />
DLR) Eifel ins Hotel Lindenhof<br />
in Wittlich ein.<br />
Die bereits seit mehreren<br />
Jahren etablierte Veranstaltung<br />
stand dieses Jahr ganz im Zeichen der<br />
Zukunft der Biogasbranche. Ulrich Drochner,<br />
Regionalreferent West, informierte die<br />
Zuhörer – nach der Begrüßung durch Dr.<br />
Herbert von Francken-Welz (u. a. Leiter der<br />
Fachgruppe Energie und Landwirtschaft<br />
beim DLR) – über das Thema Ausschreibung<br />
und Ideen zur Wirtschaftlichkeit nach<br />
der 20-jährigen EEG-Vergütung.<br />
Im darauffolgenden Vortrag von Gepa Porsche<br />
(Leiterin des Referats Genehmigung)<br />
machte sich leider ein wenig Ernüchterung<br />
unter den rund 50 Gästen breit. Der Vortrag<br />
„Auswirkungen der AwSV auf landwirtschaftliche<br />
Biogasanlagen“ war für alle<br />
anwesenden Betreiber wichtig, denn eine<br />
Umwallung ist eventuell nötig. Mit der TA<br />
Luft, der TRAS und der AwSV und den damit<br />
verbundenen Investitionen kommen<br />
viele Anlagen an ihre wirtschaftliche Grenze.<br />
Der dritte Vortrag von Lutz Heuer von<br />
der Landwirtschaftskammer Rheinland-<br />
Pfalz über das Thema „Neue bauliche Anforderungen<br />
an Fahrsilo-, Gülleanlagen und<br />
Fermenter“ ließ einen Betreiber aus dem<br />
Publikum es treffend formulieren: „Wie sollen<br />
wir bei den ganzen Auflagen mit 15 bis<br />
17 Cent pro Kilowattstunde weitermachen<br />
können?“<br />
Nach der Mittagspause führte Arno Grün<br />
vom DLR Eifel die Regelungen der neuen<br />
Düngeverordnung aus und stellte den „Düngeplaner“,<br />
eine Software für Landwirte in<br />
Rheinland-Pfalz vor. Danach kam Bernhard<br />
Schültken, Betreiber aus Delbrück (bei Paderborn),<br />
zu Wort. Er stellte sein Anlagenkonzept<br />
vor, denn vor mehreren Jahren hat<br />
er aufgehört, Mais einzusetzen.<br />
An den Diskussionen war festzustellen,<br />
dass die Veranstaltung des DLR und des<br />
Kooperationspartners Energieagentur<br />
Rheinland-Pfalz den Puls der Zeit getroffen<br />
hat. Der Fachverband Biogas e.V. unterstützt<br />
seit Jahren mit Vorträgen diese<br />
Veranstaltung. In Zukunft ist geplant, hier<br />
auch als Kooperationspartner beziehungsweise<br />
Mitveranstalter aufzutreten.<br />
Rhede – Am 31. Januar traf sich die Regionalgruppe<br />
Münsterland auf der Biogasanlage<br />
von Hugo Nienhaus. Diese Anlage wurde<br />
2005 gebaut, aber stetig erweitert. Im Substratmix<br />
setzt er viel Gülle und Mist sowie<br />
Zuckerrüben und Mais ein. Dieses Jahr ist<br />
geplant, eventuell komplett auf den Einsatz<br />
von Mais zu verzichten. Die Rübenwaschanlage<br />
konnte auch begutachtet werden,<br />
die während des Sturms „Frederike“ leider<br />
beschädigt wurde.<br />
Nach der Anlagenführung ging es in einem<br />
nahegelegenen Gasthof weiter. Hermann<br />
Josef Benning, Regionalgruppensprecher<br />
Münsterland, begrüßte die Gäste und führte<br />
gleich zu Anfang die Wahl des Betreiberratssprechers<br />
durch. André Kückmann,<br />
Betreiber aus Havixbeck, wurde als neuer<br />
Betreiberratssprecher für Münsterland einstimmig<br />
gewählt.<br />
Nach der Wahl sprach Benning noch den<br />
Landesentwicklungsplan NRW an. Nach<br />
derzeitigem Stand werden keine Sondergebietsausweisungen<br />
für Biogasanlagen in<br />
NRW ausgegeben. Dies kommt besonders<br />
dann zum Tragen, wenn zum Beispiel ein<br />
Wärmenetz gebaut werden soll. Die Anlage<br />
sprengt dann die Privilegierungsgrenze von<br />
2,3 Millionen Nm³ Biogas. Die Privilegierung<br />
fällt und es muss eine Sondergebietsausweisung<br />
gestattet werden. Der Fachverband<br />
ist hier an der Sache dran, derzeit<br />
warten wir noch auf den Entwurf, der für die<br />
Verbändeanhörung freigegeben wird.<br />
Nach der Wahl hielt Martin Friebe vom<br />
TÜV Süd einen Vortrag über den Formaldehydbonus<br />
und die damit verbundenen<br />
Änderungen bei den Grenzwerten. Die Firma<br />
PBB-Biogasberatung aus Soltau stellte<br />
den dritten Vortrag und informierte über die<br />
prozessbiologischen Gefahren beim Substratwechsel<br />
und dem Winterbetrieb. Stephan<br />
Schapitz und Olivier Schultz zeigten<br />
anhand praktischer Beispiele die Schwierigkeiten<br />
auf, mit denen sich viele Betreiber<br />
auseinandersetzen müssen.<br />
Zum Schluss führte Ulrich Drochner zu einem<br />
Thema aus, das gerade in aller Munde<br />
ist: „Was ist zu tun, wenn man ‚Fremdgülle‘<br />
aus einem Betrieb einsetzt, der von<br />
der afrikanischen Schweinepest betroffen<br />
ist?“ Auch wenn die Seuche auf dem eigenen<br />
Betrieb anfällt, sind Maßnahmen zu<br />
ergreifen, diese wurden vom Referenten angesprochen.<br />
Der Fachverband arbeitet hier<br />
sehr intensiv an einer Arbeitshilfe, diese<br />
soll nach Abstimmung mit den Behörden<br />
veröffentlicht werden.<br />
Autor<br />
M.Sc. Ulrich Drochner<br />
Regionalreferent West<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Corneliusstr. 16-18<br />
40215 Düsseldorf<br />
Tel. 02 11/99 433 695<br />
E-Mail: ulrich.drochner@biogas.org<br />
88
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
LEE spricht mit Umweltminister Lies<br />
Regional<br />
büro<br />
NORD<br />
Nach den Wahlen im November<br />
letzten Jahres<br />
wurde schnell eine Landesregierung<br />
gebildet und<br />
der ehemalige Wirtschaftsminister<br />
Lies wurde neuer<br />
Umweltminister. Keine<br />
schlechte Konstellation für den Landesverband<br />
Erneuerbare Energien (LEE), der<br />
Umwelt- und Wirtschaftsfragen immer miteinander<br />
verbinden muss. Themen beim<br />
Ministergespräch waren bundespolitische<br />
Weichenstellungen, aber auch niedersächsische<br />
Fragen.<br />
So brachten die Vertreter der Biogasbranche<br />
einen konkreten Antrag zur Änderung<br />
der AwSV mit. Wenn die Potenziale der<br />
Güllevergärung gerade in Niedersachsen<br />
gehoben werden sollen, muss es möglich<br />
sein, die vergorene Gülle im gleichen Lager<br />
wie das Ausgangsprodukt unterzubringen.<br />
Momentan sieht die AwSV hier unterschiedliche<br />
Standards vor. Es wurde vereinbart,<br />
die Problematik auf Arbeitsebene weiter<br />
zu verfolgen. Es bestand Einigkeit darüber,<br />
dass eine vermehrte Güllevergärung auf jeden<br />
Fall zu forcieren sei.<br />
Ein weiteres Thema war das Einspeisemanagement.<br />
Während in Schleswig-Holstein<br />
mit dem Netzbetreiber eine Vereinbarung<br />
getroffen wurde, Biogasanlagen mit Wärmeversorgung<br />
nur nachrangig zu schalten,<br />
werden in Niedersachsen Biogasanlagen im<br />
Rahmen des Einspeisemanagements auch<br />
mit Wärmenetzen auf null heruntergefahren.<br />
Hier besteht dringender Handlungsbedarf.<br />
Auch hier wurden weitere Gespräche<br />
auf Arbeitsebene vereinbart, um zu einer<br />
Lösung ähnlich der in Schleswig-Holstein<br />
zu kommen. Abschließend lud Biogasanlagenbetreiber<br />
Thorsten Kruse den Minister<br />
ein, sich ein Bild von Biogasanlagen in seiner<br />
Region zu machen.<br />
Nordhannover:<br />
Mitgliederservice vor Ort<br />
Kurz bevor die Konformitätserklärung abgegeben<br />
werden muss, ist es schon guter<br />
Brauch, ein Regionalgruppentreffen in<br />
Dorfmark durchzuführen, wo sämtliche<br />
Fragen der Anlagenbetreiber fachkundig<br />
durch den Referatsleiter Mitgliederservice<br />
Georg Friedl erläutert wurden. In diesem<br />
Jahr nahm der Luftreinhaltebonus einen<br />
breiten Raum ein. Georg Friedl erläuterte<br />
ausführlich die unterschiedlichen Grenzwerte<br />
und insbesondere die Notwendigkeit,<br />
ab Juli <strong>2018</strong> die 20-Milligramm-Grenze<br />
bei Formaldehyd einzuhalten, um den Bonus<br />
weiter erhalten zu können.<br />
Eine weitere intensiv diskutierte Thematik<br />
war die Umsetzung der Düngeverordnung<br />
und die Problematik der Lagerung. Ärgerlich<br />
sind für die Betreiber die vielen offenen<br />
Fragen in der Umsetzung, sodass bei<br />
Planungen große Unsicherheit herrscht.<br />
Gerade Betreiber, die in neue Lagerkapazitäten<br />
investieren oder sonstige genehmigungsrechtliche<br />
Änderungen haben, sehen<br />
sich mit der Forderung konfrontiert, grundsätzlich<br />
neun Monate zu lagern. Hier steht<br />
der Fachverband mit dem Ministerium im<br />
Gespräch und verhandelt über einen klarstellenden<br />
Erlass durch das Ministerium.<br />
Immer wieder diskutiert wird, ob eine<br />
Konformitätserklärung abgegeben werden<br />
muss. Hier machte Georg Friedl deutlich,<br />
dass es in der Verantwortung des Anlagenbetreibers<br />
liegt, seine Daten bis zum 28.<br />
Februar vollständig dem Netzbetreiber<br />
vorzulegen. Die Konformitätserklärung sichert<br />
den Betreiber ab, egal, wie die Energieversorger<br />
damit umgehen. Die intensive<br />
Diskussion war sehr gut und es zeigte sich,<br />
dass in jedem Jahr andere Schwerpunkte<br />
bei diesen Treffen behandelt werden.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Silke Weyberg<br />
Regionalreferentin Nord<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Ostring 6 · 31249 Hohenhameln<br />
Tel. 0 51 28/33 35 510<br />
E-Mail: silke.weyberg@biogas.org<br />
89
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Voller Erfolg –<br />
die 12. Biogastage Bad Waldsee<br />
Auf EU-Ebene für<br />
Biogas erfolgreich: der<br />
Europaabgeordnete<br />
Norbert Lins (zweiter<br />
von links) mit Dr.<br />
Stefan Rauh (links),<br />
Franz-Josef Schenk und<br />
Otto Körner (rechts).<br />
Am 4. und 5. Januar fanden zum 12. Mal<br />
die Biogastage Bad Waldsee in der Schwäbischen<br />
Bauernschule statt. An beiden<br />
Tagen nutzten über 200 Besucher die<br />
„ausgebuchte“ Ausstellung und das mit<br />
15 Beiträgen sehr umfangreiche Tagungsprogramm.<br />
Neben den Themenschwerpunkten des<br />
Fachverbandes Biogas hatte die vorbereitende Gruppe<br />
aus den gewählten Vertretern der Regionalgruppe<br />
Südwürttemberg und dem Regionalbüro Süd die für die<br />
Praktiker wichtigen Fachfragen aus Politik, Recht und<br />
Technik ins Zentrum gerückt.<br />
Regional<br />
büro<br />
süd<br />
Die Stimmung bei diesem traditionellen Neujahrstreffen<br />
der oberschwäbischen Biogasfamilie war gut und<br />
machte Mut, wenngleich nicht zu übersehen ist, dass<br />
die Auflagenintensität für den Betrieb von Biogasanlagen<br />
deutliche existenzielle Fragen – nicht nur bei<br />
einzelnen Betrieben – aufwirft. Als ein Highlight berichtete<br />
der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins über<br />
brandneue Entwicklungen in Sachen Greening.<br />
Verbesserungen betreffen unter anderem die Anerkennung<br />
Bienen freundlicher Kulturen (BK) und der<br />
Durchwachsenen Silphie (DS) als ökologische Vorrangflächen.<br />
Entscheidend für die Ausdehnung der Anbaufläche<br />
in der Biogaslandwirtschaft ist dabei die Nutzbarkeit<br />
dieser Kulturen, dies trifft – leider – nur auf die DS<br />
zu. Das ist einerseits sehr erfreulich aufgrund des umfangreichen<br />
Mehrwertes der mit ihr verbundenen Umweltdienstleistungen.<br />
Und die DS wird damit weitere<br />
deutliche Flächenausdehnungen bundesweit erfahren.<br />
Kein Prophet muss man aber sein, um vorherzusagen,<br />
dass wegen der „Brache-Anforderung“ und damit<br />
Nicht-Nutzbarkeit der BK aus Sicht der Biogasbranche<br />
für diese Kultur ein Flop vorprogrammiert ist. Gleichwohl<br />
ist dies ein Beispiel für gelungene politische<br />
Arbeit von Europaabgeordneten. Denn im OMNIBUS-<br />
Verfahren ist es unter Federführung des bayerischen<br />
CSU-Europaabgeordneten Albert Deß gelungen, zwischen<br />
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der<br />
Kommission bereits Ende Oktober einen Kompromiss<br />
zu erarbeiten, der nun im Januar <strong>2018</strong> in Kraft treten<br />
konnte und unter anderem die genannte<br />
Regelung zum Greening enthält.<br />
Eine neue Denkrichtung zur Flexibilisierung<br />
forderte Rainer Weng als Poolsprecher<br />
Bayrisch-Schwaben Nord:<br />
Die bisherige Sicht einer maximal eingespeisten<br />
Strommenge (Grundlast)<br />
vergütet mit dem EEG-Preis müsse<br />
künftig ersetzt werden durch eine zwar<br />
ebenfalls maximale Strommenge, die<br />
aber qualitativ hochwertiger über das<br />
EEG hinaus als Kapazitätsreserve<br />
bereits heute bezahlt wird. Zwar beschränken<br />
sich die Erlöschancen auf<br />
die positive Sekundär-Regel-Leistung<br />
(SRL), da die übrige Regelenergie wegen<br />
Preisverfalls uninteressant wird<br />
(Primär-Regel-Leistung, neg. SRL und<br />
Minuten-Regel-Leistung). Aber die<br />
Märkte werden stärker schwanken, je<br />
mehr Atomkraftwerke und hoffentlich<br />
bald auch Kohlekraftwerke ausscheiden – und damit<br />
steigen wiederum die Erlöschancen. Die saisonale<br />
Verschiebung sollte dringend geprüft werden (Strompreise<br />
im Winter höher!) als auch eine an den Standort<br />
angepasste, maximale Überbauung. Und vor allem<br />
sind die Wärmeerlöse im Winter deutlich höher. Sein<br />
Fazit: Grundlast ist out! Und unausgesprochen kommt<br />
hinzu: Wer keine marktfähige Wärmenutzung hat, die<br />
auch ohne KWK-Bonus (in der Nach-EEG-Zeit) Erträge<br />
bringt, der wird es dann sehr, sehr schwer haben.<br />
Rainer Weng ist auch Sprecher der Betreiber im Bundesarbeitskreis<br />
Direktvermarktung des Fachverbandes<br />
Biogas e.V.<br />
Über Biogaslandwirt Michael Reber, der zum Thema<br />
„Aufbauende Landwirtschaft“ sprach, (siehe Videos<br />
auf YouTube), und Wolfgang Abler (CarboZert), der<br />
den Humusaufbau im Landbau als Einkommensquel-<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
90
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
le („CO 2<br />
-Senke“) für die Landwirtschaft aufbaut u.a.<br />
nach österreichischen Beispielen, wird aufgrund des<br />
wegweisenden Charakters im Biogas Journal noch eigenständig<br />
und ausführlich berichtet werden.<br />
Das gemeinnützige Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens<br />
(PFI) nimmt die spannenden Aufgaben wahr,<br />
aus Forschungsergebnissen Praxisanwendungen für<br />
Industrie und Gewerbe zu entwickeln, im Bereich Biogas<br />
seit 2002. Dr. Stefan Droege erläuterte dies am<br />
Beispiel einer Bioraffinerie und einer (damit kombinierten)<br />
Power-to-Gas-Anlage, beides Beauftragungen der<br />
Industrie. Neben den eingesetzten Technologien stach<br />
besonders die Sektorenkopplung ins Auge.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent SÜD<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
Tel. 07 71/18 59 98 44<br />
E-Mail: otto.koerner@biogas.org<br />
Beiden wurde<br />
„maßgeschneidert“<br />
verkauft!<br />
Unsere maßgeschneiderten Mikronährstoffmischungen basieren immer auf exakter<br />
Analyse und bedarfsindividueller Produktion. Jede einzelne Mischung. Garantiert.<br />
www.schaumann-bioenergy.eu · Telefon +49 4101 218-5400<br />
RZ_AZ_massgeschneidert_verkauft_210x99+3_171027.indd 1 27.10.17 19:47<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung<br />
oder Futterhülse<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
Auf Stahlplatte nach<br />
Kundenmaß<br />
In Tauchhülse für<br />
Blick um die Ecke<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-TT<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
Weitere Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0<br />
91
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Netzwerk Nachwachsende<br />
Rohstoffe startet in Sachsen<br />
Nossen – Unter dem Titel „Sächsischer Biomassetag –<br />
Etablierung eines Netzwerkes Nachwachsende Rohstoffe<br />
in Sachsen“ luden das Sächsische Landesamt für Umwelt,<br />
Landwirtschaft und Geologie (LfULG), der Sächsische<br />
Landesbauernverband (SLB) und der Verein zur<br />
Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen<br />
Freiberg e.V. (kurz Biomasseverein) am 16. Januar<br />
Diskussionsrunde mit den Referenten, von links: Lukas Rohleder (energy saxony),<br />
Andreas W. Poldrack (VEE Sachsen), Prof. Dr. Peter Heck (IfaS), Torsten Brückner<br />
(Sachsen-Leinen), Dr. Kerstin Jäkel (LfULG) und Moderator Dr. Uwe Bergfeld (LfULG).<br />
Foto: LfULG Sachsen<br />
ins Landwirtschafts- und Umweltzentrum in Nossen ein.<br />
Der Fokus der Veranstaltung lag auf der Gründung eines<br />
sachsenweiten Netzwerkes zur stofflichen und energetischen<br />
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen.<br />
Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Energiewende<br />
und schließlich auch der Endlichkeit der<br />
fossilen Rohstoffe steigt das Bewusstsein für die Notwendigkeit<br />
der Bioenergienutzung und der stofflichen<br />
Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Auch die immer<br />
kürzer werdende Verbindlichkeitsdauer von politischen<br />
Rahmenbedingungen gerade in der Landwirtschaft<br />
lässt regionale Netzwerke immer wichtiger werden.<br />
Mit dem Ziel der Förderung nachwachsender Rohstoffe<br />
in Sachsen wurde das Netzwerk NAWARO Sachsen gegründet.<br />
Dieses Netzwerk dient als Vermittlungsstelle<br />
für Akteure, die im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe<br />
vorwiegend im ländlichen Raum aktiv sind, zum<br />
Erfahrungsaustausch aus der Praxis sowie zur Unterstützung<br />
neuer Ansätze. Bei dem vom Staatsministerium<br />
für Umwelt und Landwirtschaft geförderten Projekt<br />
wird eine Onlineplattform für Anbieter und Nutzer von<br />
NAWARO (zum Beispiel Silagen, Holz) und Dienstleistungen<br />
(zum Beispiel Wärme) entstehen.<br />
Zum Informationsaustausch dient ein NAWARO-Newsletter,<br />
der von den Akteuren mit Leben gefüllt werden<br />
kann. Außerdem sollen neue praxisnahe Forschungsvorhaben<br />
initiiert und Exkursionen zu Praxisbeispielen<br />
angeboten werden, erklärte Erik Ferchau (Biomasse-<br />
www.michael-kraaz.de<br />
bewährte<br />
Produkte !<br />
Tragluftdächer<br />
Silodächer<br />
Feststoffdosierer<br />
Schubboden-<br />
Trockner<br />
Konzentrator /<br />
Gärresttrockner<br />
Siebkörbe<br />
Separatoren<br />
mobil/stationär<br />
Tel. 051 32 / 588 663<br />
92
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Nutzen Sie die Flexibilisierungsprämie<br />
und sichern Sie sich<br />
Verband<br />
neue Einkünfte neben der Landwirtschaft!<br />
verein), der dieses Projekt auf der Tagung<br />
vorstellte. Neben dem Biomasseverein als<br />
Koordinator initiierten folgende Partner das<br />
Netzwerk: Agrargenossenschaften Agraset<br />
Naundorf e.G. und „Bergland“ Clausnitz<br />
e.G., die beide mehrere Biogasanlagen betreiben<br />
und unter anderem in der Bereitstellung<br />
und Nutzung von Holzbrennstoffen<br />
aktiv sind, Sachsen-Leinen e.V. für die<br />
stoffliche Nutzung von nachwachsenden<br />
Fasern, die Gruppe Freiberger Land e.G.<br />
(GFL) zur Direktvermarktung von Biogasstrom<br />
und der SLB. Weiterhin dazu gekommen<br />
sind der Fachverband Biogas mit der<br />
Regionalgruppe Sachsen und das Umweltinstitut<br />
Leipzig (UIL).<br />
Eingebettet war die Vorstellung des NAWA-<br />
RO-Netzwerks von zahlreichen Vorträgen.<br />
Dr. Kerstin Jäkel (LfULG) referierte über<br />
den aktuellen Stand und die Rahmenbedingungen<br />
von nachwachsenden Rohstoffen<br />
in Sachsen. In Anbetracht der aktuellen<br />
Situation der CO 2<br />
-Reduzierung, des Klimaschutzes,<br />
der Energiewende und der Bioökonomie<br />
unterstrich sie die Wichtigkeit<br />
des Vorhabens für einen Wandel hin zur<br />
Bioökonomie und zur Ressourceneffizienz.<br />
Prof. Dr. Peter Heck (IfaS, Trier) unterstrich<br />
die Aussagen mit erfolgreichen Beispielen<br />
aus der Praxis zur Förderung der ländlichen<br />
Bioökonomie: „Geld bleibt in der Region,<br />
Beschäftigung wird geschaffen.“ Neben<br />
Beispielen von Bioenergiedörfern gab er<br />
Tipps für Netzwerke von der Bürgerbeteiligung<br />
bis hin zur Finanzierung.<br />
Ebenso wurden erfolgreiche Praxisbeispiele<br />
vorgestellt. So betreibt zum Beispiel die<br />
ökologisch soziale Stiftung Zschadraß Projekte<br />
zur Energiegewinnung aus Biomasse<br />
und Erneuerbaren Energien. Aus den<br />
daraus erzielten dauerhaften finanziellen<br />
Erträgen werden regionale und soziale<br />
Projekte auf dem Gebiet der Kinder- und<br />
Jugendarbeit oder neue innovative Umweltprojekte<br />
gefördert. Christoph Hänel<br />
stellte das betriebliche Gesamtkonzept der<br />
Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz<br />
e.G. mit dem Schwerpunkt der Ölsaatenverarbeitung<br />
und der Wärmenutzung aus<br />
Biogas und Holzhackschnitzeln vor. Die<br />
Genossenschaft baut verstärkt auf regionale<br />
Stoff- und Wirtschaftskreisläufe.<br />
Über die Entwicklung der stofflichen Nutzung<br />
von Flachs und Hanf referierte Torsten<br />
Brückner (Sachsen-Leinen e.V.). Die<br />
Möglichkeiten, Naturfasern in formbare<br />
Matten zu verarbeiten und deren Einsatzgebiete<br />
in der Automobilindustrie zeigte<br />
Frank Mehlhorn von der Isowood GmbH<br />
aus Rudolstadt auf. Ebenso mit dabei<br />
waren Vertreter der Sächsischen Energieagentur<br />
(SAENA GmbH), dem industrienahen<br />
Netzwerk Energy Saxony e.V. und dem<br />
VEE Sachsen e.V., Vereinigung zur Förderung<br />
der Nutzung Erneuerbarer Energien.<br />
Auch neue Ideen fehlten nicht. Den Möglichkeiten<br />
zukünftiger Ansätze widmete<br />
sich Dr. Johann Rumpler (Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt).<br />
Er berichtete über neue Perspektiven<br />
zur verstärkten thermischen als<br />
auch stofflichen Nutzung von Stroh und<br />
Spreu. Aktuelle Forschungsergebnisse in<br />
Bezug auf die Ernteverfahren beziehungsweise<br />
-technik wurden von ihm vorgetragen.<br />
Als Abschluss der gelungenen Veranstaltung<br />
sprach Torsten Krawczyk (SLB)<br />
über die Zukunft des Netzwerkes und betonte<br />
dabei ausdrücklich die Wichtigkeit<br />
der Landwirte und der engen Zusammenarbeit<br />
mit Kommunen für die anstehenden<br />
Entwicklungen.<br />
In Zukunft wird es kein nachhaltiges<br />
Wirtschaftssystem ohne nachwachsende<br />
Rohstoffe geben. Die gesellschaftliche<br />
Herausforderung der Energiewende und<br />
der Substitution von Erdölprodukten kann<br />
nur durch Bündelung von lokalen Akteuren<br />
und Vorreitern auf diesen Gebieten gelingen.<br />
Daraus resultiert eine Stärkung von<br />
bestehenden beziehungsweise die Schaffung<br />
von neuen Wertschöpfungsketten im<br />
ländlichen Raum.<br />
Alle interessierten Land- und Forstwirte,<br />
bestehende Netzwerke, Vereine, Unternehmen,<br />
Kommunen und Dienstleister sind<br />
herzlich eingeladen, sich am Netzwerk zu<br />
beteiligen. Bereits die 120 Teilnehmer der<br />
Veranstaltung, deren Anzahl die Erwartungen<br />
weit übertroffen hatte, bekundeten<br />
zahlreich ihr Interesse am Netzwerk NA-<br />
WARO in Sachsen. Das Projekt zum Aufbau<br />
des Netzwerkes wird gefördert über die<br />
Richtlinie BesIN (Besondere Initiativen)<br />
durch das SMUL Sachsen.<br />
Autoren<br />
Erik Ferchau und Jürgen Wellerdt<br />
Verein zur Förderung von<br />
Biomasse und nachwachsenden<br />
Rohstoffen Freiberg e.V.<br />
Hauptstr. 13 · 09623 Clausnitz<br />
E-Mail: ferchau@biomasse-freiberg.de<br />
E-Mail: wellerdt@biomasse-freiberg.de<br />
93<br />
Mit PlanET <strong>2018</strong><br />
in die Flexprämie<br />
Mit dem PlanET Rendite-Konzept<br />
„BHKW Flex“ sind Sie auf der<br />
sicheren Seite:<br />
• Rendite finanziert Ihre Investition<br />
• Stabiles Ertragsmodell für<br />
Altanlagen<br />
• Sicherer Einstieg in die Flexibilitätsprämie<br />
Unsere Lösung für Bestandsanlagen:<br />
Das PlanET Gasmanagement.<br />
PlanET eco ® Gasakku<br />
• Herstellerunabhängige<br />
Flex-Technik<br />
• Einfache Nachrüstung<br />
• Kostengünstiger Speicherraum<br />
www.planet-biogas.com<br />
Telefon 02564 3950 - 191
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Koalitionsvertrag<br />
Bioenergie soll helfen,<br />
Klimaziele zu erreichen<br />
Gastbeitrag von Dr. Peter Röttgen, Geschäftsführer des<br />
Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE)<br />
Das Jahr <strong>2018</strong> wird für die Energiepolitik<br />
entscheidend: Im Koalitionsvertrag haben<br />
sich Union und SPD zum Pariser Klimaschutzabkommen<br />
und zu einem deutlich<br />
schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energie<br />
in allen Sektoren bekannt. Das ist ein positives Signal<br />
seitens der Politik, denn es zeigt, dass Erneuerbare<br />
Energie die einzige Lösung einer<br />
sauberen Energieversorgung ist.<br />
Nun müssen rasch konkrete Maßnahmen<br />
folgen, um das Potenzial<br />
für Treibhausgaseinsparungen<br />
und für die Modernisierung unserer<br />
Energiewirtschaft nutzen zu<br />
können.<br />
Im Koalitionsvertrag wird das Ausbauziel<br />
für Erneuerbare Energien<br />
im Stromsektor auf 65 Prozent im<br />
Jahr 2030 verankert. Aus Sicht<br />
des BEE stellt dies eine politische<br />
Trendwende im Strombereich dar.<br />
Die vorgesehenen Sonderausschreibungen für Windenergie<br />
Onshore und Photovoltaikanlagen sind erste<br />
Anzeichen dafür, dass die Politik den Ausbau Erneuerbarer<br />
Energien beschleunigen wird. In den Folgejahren<br />
muss der jährliche Ausbau für alle Erneuerbare-<br />
Energien-Technologien signifikant erhöht und gesichert<br />
werden. Hierzu sind im Koalitionsvertrag jedoch noch<br />
keine Details enthalten.<br />
Der BEE wird darauf achten, dass die Ziele des Koalitionsvertrages<br />
im Stromsektor auch tatsächlich durch<br />
einen höheren Ausbau umgesetzt werden. Positiv ist<br />
die ausdrückliche Erwähnung der Bioenergie, die zur<br />
Erreichung der Klimaziele im Energie- und Verkehrssektor<br />
beitragen soll. So soll der Bestand von Bioenergieanlagen<br />
im Zuge der EEG-Ausschreibungen weiterentwickelt<br />
werden. Ebenso ist eine Weiterentwicklung<br />
der Treibhausgas-Minderungsquote (THG-Quote) zur<br />
Unterstützung von Biokraftstoffen im Verkehrssektor<br />
angekündigt.<br />
Im Stromsektor haben wir viel erreicht: 36 Prozent<br />
der Bruttostromerzeugung werden in Deutschland aus<br />
Erneuerbarer Energie gewonnen. Auf diesem Erfolg<br />
dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Vielmehr müssen<br />
neue Möglichkeiten für die Integration der Erneuerbaren<br />
Energie im Stromnetz geschaffen werden. Die<br />
Stromnetze haben mehr Potenzial, als derzeit genutzt<br />
wird, aber auch über die Gas- und Wärmenetze kann<br />
viel Energie aufgenommen und zum Verbraucher transportiert<br />
werden.<br />
Es gilt hier mehr Schnittstellen zwischen den Sektoren<br />
zu schaffen, damit die Energie auch in allen Sektoren<br />
genutzt werden kann. Mehr Sektorenkopplung entlastet<br />
die Netze, schafft mehr Flexibilität und spart Kosten für<br />
Redispatch und Einspeisemanagement. Die Sektorenkopplung<br />
ist ein Garant für die Integration Erneuerbarer<br />
Energie in Wärme, Industrie und Mobilität. Und sie<br />
ist der Schlüssel für eine volkswirtschaftlich sinnvolle<br />
und ressourceneffiziente Transformation des Energiesystems<br />
hin zu einer treibhausgasarmen Versorgung.<br />
Eine aktuelle Studie von Fraunhofer IEE und E4Tech im<br />
Auftrag des BEE zeigt nun, welche Hindernisse überwunden<br />
werden müssen, damit die Sektorenkopplung<br />
ihr volles Potenzial für den Klimaschutz und die Modernisierung<br />
der Energiewirtschaft entfalten kann.<br />
Erneuerbare Energien können allerdings wesentlich<br />
mehr zum Klimaschutz und zur wirtschaftlichen Entwicklung<br />
beitragen, als von der Großen Koalition vorgesehen<br />
– und dies zu immer günstigeren Preisen. Die<br />
neue Regierung sollte alles daran setzen, um die Klimaziele<br />
2020 noch zu erreichen und das vorhandene<br />
Potenzial für Klimaschutz und die Modernisierung der<br />
Energiewirtschaft tatsächlich zu nutzen. Ein übergreifendes<br />
Konzept, wie die Politik eine nachhaltige Marktdynamik<br />
für Erneuerbare Energien im Besonderen und<br />
CO 2<br />
-Einsparung im Allgemeinen zur Erreichung der<br />
Klimaziele entfachen will, fehlt leider noch. Mit einem<br />
realistischen CO 2<br />
-Preis wären Erneuerbare Energien<br />
bald wettbewerbsfähig.<br />
In den Bereichen Wärme und Verkehr lässt die Große<br />
Koalition derzeit konkrete Ambitionen vermissen.<br />
Wir brauchen aber klare Ausbaupfade für Erneuerbare<br />
Energien im Wärme- und Verkehrssektor. Der Stillstand<br />
der letzten Jahre muss endlich überwunden werden.<br />
Moderne Technologien stehen längst zur Verfügung<br />
und deren internationales Wettbewerbspotenzial sollte<br />
nicht aufs Spiel gesetzt werden.<br />
Schon wesentlich ist die Ankündigung des Kohleausstiegs<br />
im Koalitionsvertrag. Nun müssen Rahmenbedingungen<br />
vereinbart werden, um einen qualifizierten<br />
Übergang sicherstellen zu können und allen Beteiligten<br />
Planungssicherheit zu geben.<br />
94
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
DIE FARBE DER HOFFNUNG<br />
IST GRÜN.<br />
DIE FABRE DER ABGASREINIGUNG<br />
IST WINGI.<br />
Repowering<br />
Flexibilisierung<br />
Gärrestaufbereitung<br />
Wärmespeicher<br />
Greenline GmbH & Co KG<br />
Jägerweg 12 · 24941 Flensburg<br />
Tel. 0461 3183364-0<br />
www.greenline-energy.de<br />
www.fabre.info*<br />
Die zukünftigen Grenzwerte<br />
für Formaldehyd (20 mg/m³)<br />
halten wir bereits jetzt ein.<br />
Gewinner:<br />
Preis des Handwerks 2017<br />
VR-InnovationsPreis Mittelstand<br />
Ideenwerk BW:<br />
„Champion für Abgaswäsche“<br />
Annette Clauß - Juli 2017<br />
*Besuchen Sie die Webseite nur, wenn Sie sich für preisgekrönte, innovative und<br />
umweltfreundliche Abgasreinigung und Abgaswäsche interessieren.<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
demselben Material<br />
25% bis 40% billiger<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Beratung · Planung · Fertigung · Montage<br />
seit<br />
1946<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA‘in Martina Beese<br />
RA Dr. Mathias Schäferhoff<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RA‘in Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände<br />
Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
Telefon (0 21 71) 70 98-0 · Telefax (0 21 71) 70 98-30<br />
www.stange-laermschutz.de · info@stange-laermschutz.de<br />
Made in Germany<br />
Qualität setzt sich durch – seit 1887<br />
• Tauchmotorrührwerke GTWSB<br />
mit/ohne Ex-Schutz<br />
• Tauchmotorpumpen AT<br />
• Drehkolbenpumpen DK<br />
• Vertikalpumpen VM/VG<br />
• Über-/Unterdrucksicherung<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co. KG • Hauptstraße 2–4 • 72488 Sigmaringen<br />
Telefon: +49 (0)7571 / 109-0 • E-Mail:info@eisele.de • www.eisele.de<br />
B<br />
EIS-ME-M-17009_AZ_Motiv-B_85x56.5_RZ.indd 1 31.01.17 18:38<br />
95
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Fotos: Fachverband Biogas e.V.<br />
Wie der Hackl Schorsch zum Fachverband kam<br />
Markus, hast du gehört? Der Hackl<br />
Schorsch sagt, dass Biogas ganz toll<br />
ist.“ Dieser Satz der Schwiegermutter<br />
von unserem Regionalreferenten Markus<br />
Bäuml war der Startschuss für unsere<br />
erfolgreiche Arbeit mit Georg Hackl. Dass Biogas<br />
ganz toll ist, das hat er in einer Talkshow beim Bayerischen<br />
Rundfunk gesagt. Zu dieser Zeit wusste der<br />
Hackl Schorsch noch nichts vom Fachverband Biogas –<br />
und wir wussten nicht, dass der Hackl Schorsch Biogas<br />
so gut findet.<br />
Und nachdem der Markus Bäuml über Jahre versucht<br />
hatte, seine Schwiegermutter von Biogas zu überzeugen<br />
und der Hackl das in einer halben Stunde geschafft<br />
hat – da hat sich der Markus gedacht: den brauchen<br />
wir, den Rodel-Olympiasieger. Er hat ihn angeschrieben,<br />
sie haben sich getroffen, sie haben über Biogas gesprochen<br />
und festgestellt, dass sie beide in die gleiche<br />
Richtung laufen, was ihre<br />
Vorstellung einer künftigen<br />
Energieversorgung angeht.<br />
Der erste Schritt war getan.<br />
Nicht gesucht, aber trotzdem<br />
gefunden. Es folgten<br />
offizielle Treffen mit Management<br />
und Geschäftsführung.<br />
Der Hackl wurde<br />
Mitglied im Fachverband<br />
Biogas und wir kamen dahingehend<br />
überein, es zunächst<br />
mal drei Jahre miteinander<br />
zu versuchen. Das<br />
war im Herbst 2014.<br />
Seitdem haben wir gemeinsam<br />
viel bewegt. Neun Videos<br />
zu den verschiedenen Aspekten der Biogasnutzung<br />
plus fünf Kurzfilme für Facebook, ein Interview<br />
mit MdB Artur Auernhammer, ein Statement zur Bundestagswahl<br />
im Rahmen der Sommertour, Grußworte<br />
während der Jahrestagungen und im Flyer, ein Pappaufsteller<br />
und der original Hackl-Rodel auf der Convention,<br />
diverse Beiträge im Biogas Journal, Teilnahme an Veranstaltungen<br />
wie dem ZLF, dem Streetlife in München,<br />
der Tarmstedter Ausstellung oder dem Rosenheimer<br />
Herbstfest. In Tarmstedt konnten wir dann auch mit<br />
eigenen Augen die These widerlegen, der Hackl sei im<br />
Norden nicht bekannt (man kam keine fünf Meter mit<br />
ihm voran, ohne dass nicht jemand mindestens „Das<br />
ist doch der Hackl Schorsch“ rief oder gar ein Selfie<br />
machen wollte).<br />
Darüber hinaus ist er auf eigene Initiative im BR zu den<br />
Sendungen „Mensch Otto“ und „Die blaue Couch“ eingeladen<br />
worden, hat in einer weiteren Talkshow explizit<br />
pro Biogas Stellung bezogen – und nicht zuletzt hat er<br />
im vergangenen Jahr in seinem Garten unsere neue Lieblingspflanze<br />
Durchwachsene Silphie ausgesät (Fotos davon<br />
folgen zu gegebener Zeit im Biogas Journal).<br />
Wer mit dem Hackl Schorsch unterwegs ist, der weiß,<br />
dass er keine Gelegenheit auslässt, um über die vielen<br />
Vorzüge von Biogas zu reden. Und mittlerweile ist er ein<br />
wahrer Experte, der nicht nur durch seine authentische<br />
Art überzeugt, sondern auch durch sein fundiertes Hintergrundwissen.<br />
Biogas liegt dem Hackl Schorsch am<br />
Herzen und es ist ihm ein wirkliches Bedürfnis, darüber<br />
zu sprechen. Und er ist ein gern gesehener Türöffner bei<br />
allen Projekten, die wir bislang mit ihm initiiert haben.<br />
In diesem Jahr wollen wir einen etwa 20-minütigen<br />
Schulfilm zum Thema Erneuerbare Energien mit ihm<br />
drehen. In dem Zusammenhang wird auch unser Unterrichtsmaterial<br />
überarbeitet. Im Biogas Journal wird<br />
er sich weiterhin regelmäßig zu Wort melden, seine Medienkontakte<br />
wollen wir nutzen, seine Online-Präsenz<br />
verbessern und ihn beim Aufbau seiner Homepage unterstützen<br />
– und sicherlich wird es auch in diesem Jahr<br />
wieder zwei bis drei Veranstaltungen geben, an denen<br />
der Hackl Schorsch für den Fachverband Biogas teilnehmen<br />
wird.<br />
Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Mit dem<br />
Hackl Schorsch haben wir einen bundesweit bekannten<br />
Fürsprecher gewonnen, um den uns die anderen EE-<br />
Verbände beneiden.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Andrea Horbelt<br />
Pressesprecherin<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
96
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Recht<br />
Clearingstelle EEG i KWKG<br />
Votum zu Satelliten-BHKW veröffentlicht<br />
Die Clearingstelle EEG | KWKG hat in einem Votum Fragen zur Einordnung eines räumlich von<br />
einer Biogasanlage abgesetzten BHKW als rechtlich eigenständige EEG-Anlage beantwortet.<br />
Von Isabella Baera<br />
Im Votum 2017/44 (abrufbar unter<br />
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.<br />
de/votv/2017/44) hat die Clearingstelle<br />
EEG | KWKG geklärt, ob im konkreten<br />
Einzelfall das aus einer Vor-Ort-Anlage<br />
herausversetzte Satelliten-BHKW, das unter<br />
anderem mit der Vor-Ort-Anlage über einen<br />
Wärmespeicher durch ein Wärmenetz<br />
verbunden ist, eine eigenständige Anlage<br />
im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes<br />
(EEG) darstellt.<br />
Dies hat die Clearingstelle verneint. Denn<br />
nach wertender Gesamtbetrachtung der in<br />
der Empfehlung 2012/19 (abrufbar unter<br />
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/<br />
empfv/2012/19) ausgearbeiteten Indizien<br />
ist das Satelliten-BHKW zwar räumlich, jedoch<br />
nicht betriebstechnisch hinreichend<br />
von der Vor-Ort-Anlage getrennt.<br />
Das Satelliten-BHKW wurde an einem von<br />
der Vor-Ort-Anlage räumlich abgegrenzten<br />
Standort errichtet, um dort einen eigenständigen<br />
Wärmeabnehmer zu versorgen.<br />
Zwischen beiden Standorten befinden<br />
sich mehrere Flächen, die durch Dritte<br />
genutzt werden (unter anderem ein anderer<br />
landwirtschaftlicher Betrieb) und<br />
keinerlei wirtschaftlichen Bezug zu diesen<br />
Standorten aufweisen. Das Satelliten-<br />
BHKW ist jedoch nicht betriebstechnisch<br />
unabhängig von der Vor-Ort-Anlage. Es zu<br />
versetzen und eine Gasleitung zu verlegen,<br />
ist zwar energetisch und ökonomisch<br />
sinnvoller gewesen, als das vorhandene<br />
Wärmenetz auszubauen. Doch versorgt das<br />
Satelliten-BHKW neben dem vorgenannten<br />
Wärmeabnehmer als seinem Primärwärmeabnehmer<br />
zusammen mit der Vor-<br />
Ort-Anlage, die ihrerseits Wärme an eigene<br />
Primärwärmeabnehmer (Fermenter, Gärresttrockner,<br />
Wärmeversorgungsgebiet A)<br />
liefert, eine gemeinsame Wärmesenke (Versorgungsgebiet<br />
B) mit garantierten Wärmemengen.<br />
Vor-Ort-Anlage und Satelliten-BHKW versorgen<br />
diese Wärmesenke funktionell als<br />
eine Einheit und sind in ihrer Betriebsweise<br />
untrennbar miteinander verbunden. Denn<br />
aufgrund der Abschalthierarchie, die die jederzeitige<br />
Wärmeversorgung des gemeinsamen<br />
Wärmeabnehmers sicherstellt, müsste<br />
das Satelliten-BHKW die Versorgung seines<br />
Primärwärmeabnehmers bei Ausfall der<br />
Vor-Ort-Anlage einstellen. Entsprechendes<br />
gilt für die Vor-Ort-Anlage im umgekehrten<br />
Fall. Die Wärmeversorgung aus dem<br />
Wärmespeicher ändert nichts an dieser<br />
Betrachtung, da die daraus bereitgestellte<br />
Wärme nicht ausreicht, um die jeweiligen<br />
Wärmeabnehmer durchgängig längerfristig<br />
mit Wärme zu versorgen, ohne dass Vor-Ort-<br />
Anlage und Satelliten-BHKW ihre Wärmebetriebskonzepte<br />
ändern müssten.<br />
Autorin<br />
Isabella Baera<br />
Rechtswissenschaftliche Koordinatorin<br />
der Clearingstelle EEG | KWKG<br />
Charlottenstraße. 65 · 10117 Berlin<br />
Tel. 030/206 14 16-0<br />
E-Mail: post@clearingstelle-eeg-kwkg.de<br />
Energiewende in Fahrt:<br />
Neuer natGAS-Kundendienst<br />
für den Flexbetrieb!<br />
SICHERE ERNTE.<br />
GARANTIERT.<br />
Direktvermarktung von Strom aus Biogas.<br />
Profitieren Sie von unseren Optimierungslösungen:<br />
100 % der Marktprämie, ohne Abzüge<br />
Monatliche Ausschüttung ohne weiteren<br />
Aufwand<br />
Einsatz moderner, sicherer Fernwirktechnik<br />
Garantierte Zusatzerlöse aus Viertelstunden-<br />
Energiehandel und Regelenergievermarktung<br />
Integrierter Ansatz von Stromhandel und<br />
Technik<br />
Haben Sie Fragen zur Flexibilisierung von Anlagen?<br />
natGAS Aktiengesellschaft Tel: +49 331 2004-153 /-207<br />
Jägerallee 37 H Fax: +49 331 2004-199<br />
14469 Potsdam info@natgas.de<br />
Deutschland<br />
www.natgas.de<br />
97
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2018</strong><br />
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum<br />
nächstmöglichen Zeitpunkt einen<br />
BioSaar GmbH<br />
Holzerweg 3<br />
66687 W adern-Lockweiler<br />
bewerbung@jakob-becker.de<br />
Betriebsleiter (m/w)<br />
für unsere Biogasanlage<br />
Ihre Aufgaben:<br />
I Betreiben der Biogasanlage<br />
I Überwachung, Kontrolle und Bedienung der Anlage<br />
I Instandhaltung, Pflege, Probeentnahmen<br />
I Wartung der Anlagen bzw. Maschinen in der Biogasanlage<br />
I Erstellen von Dokumentationen<br />
I Mitarbeiterführung<br />
Ihr Profil:<br />
I Abgeschlossene technische Ausbildung<br />
I Erfahrung im Betreiben einer Biogasanlage inkl. Biogas-<br />
Führerschein wäre von Vorteil<br />
I Sicherer Umgang mit EDV-gestützen Steuerungssystemen<br />
(SPS-Steuerung)<br />
I Führerschein Klasse B<br />
I Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie Bereitschaft zum<br />
Wochenenddienst<br />
Wir bieten Ihnen nach intensiver Einarbeitung anspruchsvolle,<br />
interessante Aufgaben sowie eine langfristige Perspektive in einem<br />
zukunftsorientierten Unternehmen und bieten individuelle, bedarfsgerechte<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten. Haben wir Ihr Interesse<br />
geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie bitte<br />
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer<br />
Gehaltsvorstellung an folgende Adresse:<br />
ioSaar<br />
Gesellschaft zur Behandlung biologischer Abfälle mbH<br />
Aktivkohle (0176) 476 494 69<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen Kohlefilter<br />
TOP-Aktivkohle mit 2,0% Kaliumjodid<br />
Aktivkohle-Filter befüllen oder durch uns befüllen<br />
lassen (kostet extra) und dabei deutlich sparen.<br />
Angebot: BigBag mit 0,5 to für nur<br />
1.499,00 € netto frei BGA in Deutschland<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
Komponenten für Biogasanlagen<br />
Tragluftfolienabdeckungen • gasdichte Rührwerksverstellungen<br />
Xylem Rührwerks- und Pumpentechnik • Schaugläser<br />
Wartungs- und Kontrollgänge • Über/Unterdrucksicherungen<br />
Emissionsschutzabdeckung, etc.<br />
Industriestraße 10 • 32825 Blomberg • info@nesemeier-gmbh.de<br />
Tel.: 05235/50287-0 • Fax 05235/50287-29<br />
98
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AUS EINER HAND<br />
FRÜHKAUFAKTION<br />
VitTerra N und VitTerra PK<br />
2 + 1 gratis<br />
Für die erfolgreiche<br />
„Wiederbelebung“ toter Ackerböden<br />
Steigerung der gesamtbiologischen Aktivität<br />
Verbesserung der Aufnahme von Nährstoffen<br />
Kostenreduktion beim Einsatz mineralischer<br />
Düngung und Fungiziden<br />
Ertragssteigerung<br />
Verbesserung der Qualitäten<br />
natürliche Wachstumsförderung<br />
von Haupt-, Seiten- und Feinwurzeln<br />
signifikante Verbesserung der Nährstoffund<br />
Wasser-Aufnahme<br />
Steigerung von Flächenproduktivität,<br />
Qualität und Erträgen<br />
nachhaltige Stärkung der Pflanzenund<br />
Boden-Gesundheit<br />
deutliche Reduzierung der Kunstdüngerkosten<br />
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AUS EINER HAND<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Sittensen - Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 10 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de<br />
99
Unser Kompetenzteam für Ihren<br />
Emissionsminderungsbonus.<br />
Wir garantieren die Einhaltung von 20 mg/Nm³ Formaldehyd!<br />
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Matthias Wawra<br />
Leiter Biogas<br />
E-Mail: matthias.wawra@emission-partner.der.de<br />
Telefon: +49 4498 92 326 207<br />
Betriebswirt<br />
Sebastian Kortmann<br />
Verkaufsleiter Nord<br />
E-Mail: sebastian.kortmann@emission-partner.de<br />
Telefon: +49 162 428 4119<br />
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Sebastian Miethe<br />
Verkaufsleiter Ost<br />
E-Mail: sebastian.miethe@emission-partner.deer.de<br />
Telefon: +49 152 547 806 90<br />
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Hermann Rothenaicher<br />
Verkaufsleiter Süd<br />
E-Mail: hermann.rothenaicher@emission-partner.de<br />
Telefon: +49 172 890 9148<br />
UNSERE ERFOLGSFORMEL:<br />
Niedrige Formaldehyd-Emissionen sind ein Zusammenspiel aus hervorragender Wartung,<br />
bester Katalysatortechnologie und gut vorbereiteter Emissionsmessung!<br />
www.EMISSION-PARTS.de<br />
FORMALDEHYD<br />
2 0 m g / N m ³<br />
HABEN SIE FRAGEN?<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
26683 Saterland-Ramsloh<br />
UNSERE EXPERTEN BERATEN SIE GERNE!<br />
Vertrieb<br />
Geschäftsbereich Biogas<br />
+49 4498 92 326 26<br />
info@emission-partner.de<br />
W rs Bioga!