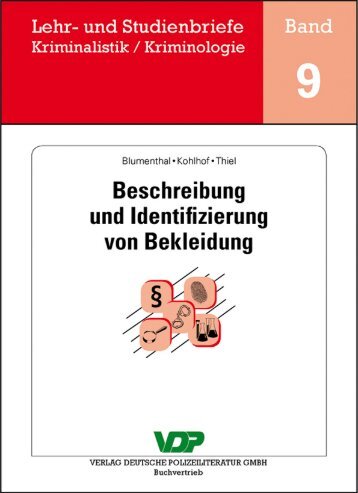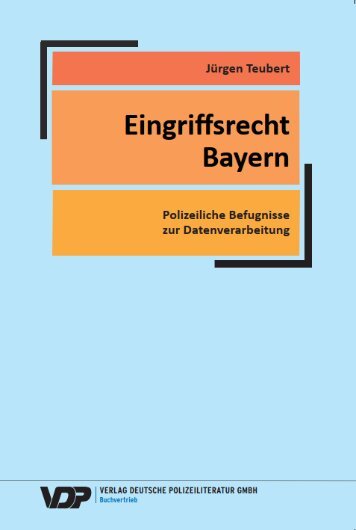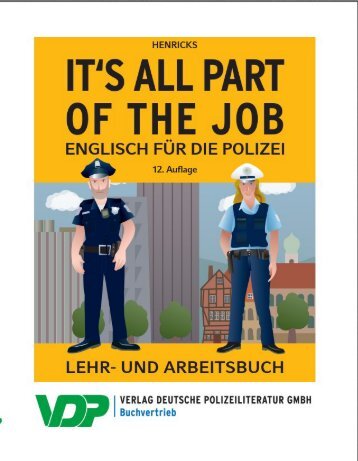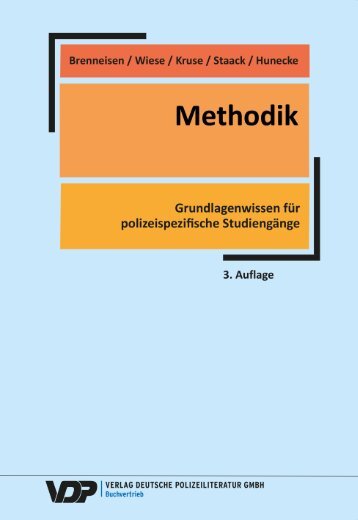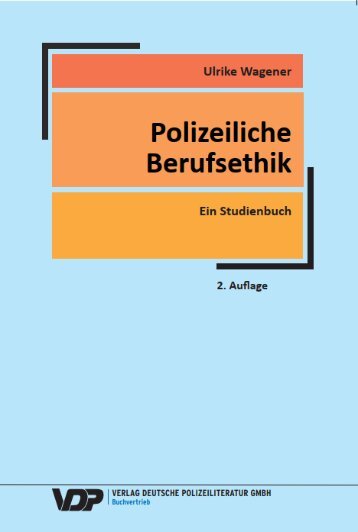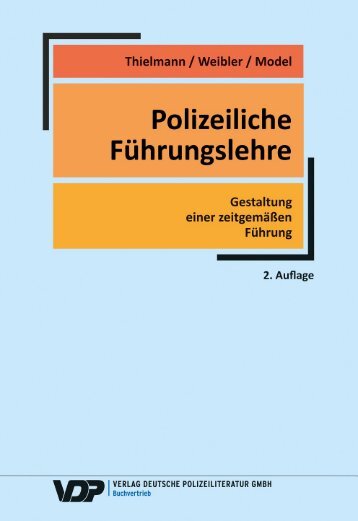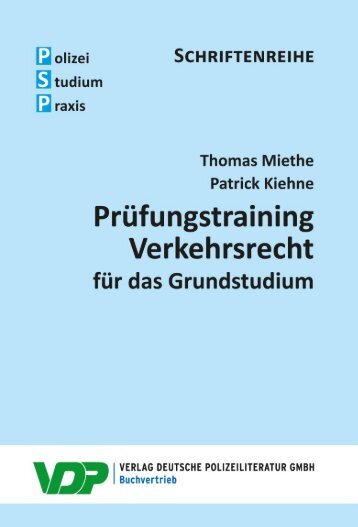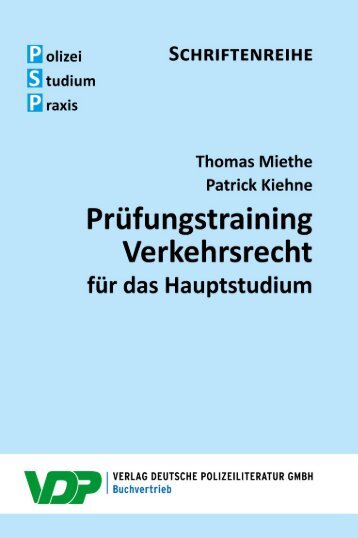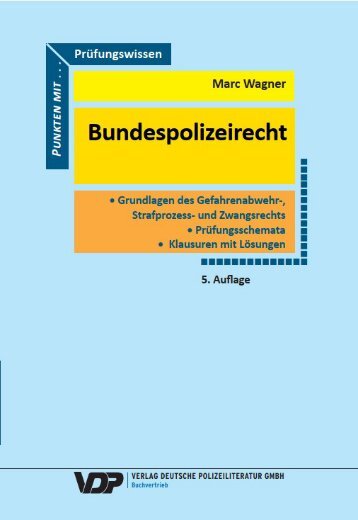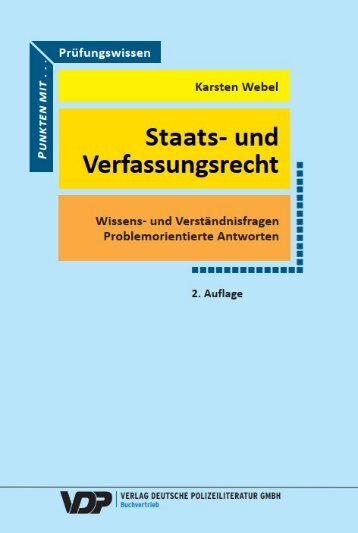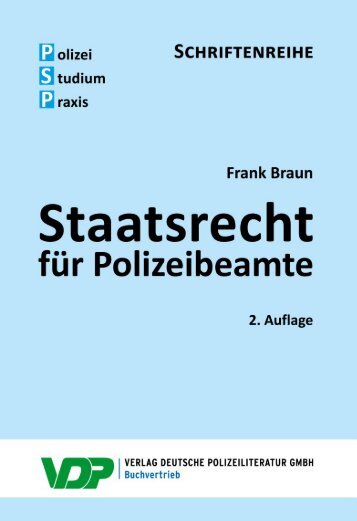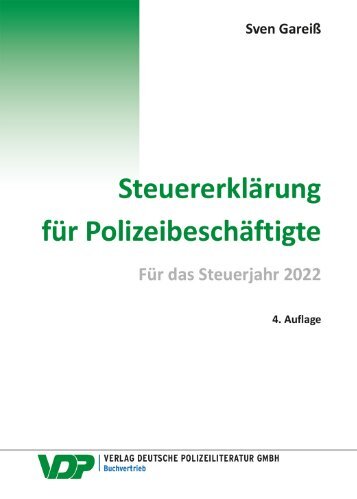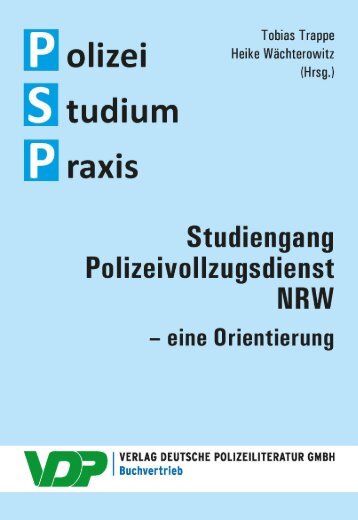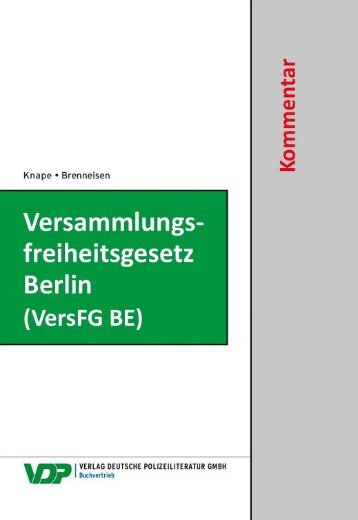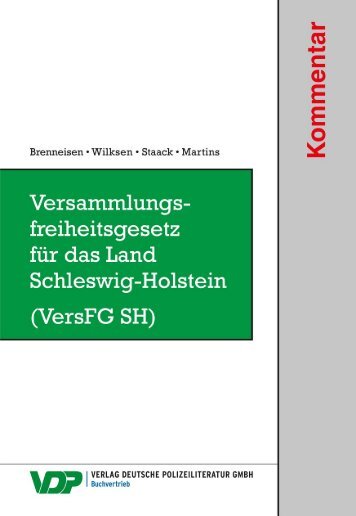VDP-BV Leseproben
Gewalt im öffentlichen Raum - Leseprobe
- Text
- Besondere
- Polizeilichen
- Alltagsgewalt
- Wahrnehmung
- Gatzke
- Wolfgang
- Entwicklung
- Polizeiliche
- Raum
- Gewalt
Vorwort der Herausgeber
Vorwort der Herausgeber Gewalt tritt als reales gesellschaftliches Phänomen in vielfältiger Art und in unterschiedlichem Ausmaß in Erscheinung. Das, was als Gewalt bezeichnet wird, bewegt sich in einem weiten Spektrum zwischen struktureller Gewalt, einer vorwiegend subjektiv empfundenen Gewalterfahrung, der Gewalt gegen Sachen, Aggression und psychischer Gewalteinwirkung bis hin zu schwersten Formen körperlicher Gewalt. Mit Blick auf die soziale Sichtbarkeit finden sich Gewalthandlungen einerseits im engen sozialen Milieu, d.h. für Dritte im Wesentlichen unerkannt, andererseits in der Öffentlichkeit – im öffentlichen Raum – in seinen vielfältigen Facetten und für jedermann erlebbar. Prinzipiell ist jeder Bürger der Gefahr ausgesetzt, Opfer von Gewalthandlungen im öffentlichen Raum zu werden. Es ist ein hochgradig von Emotionen bestimmtes Thema. Gewaltdelikte im öffentlichen Raum prägen aus der Sicht des Bürgers das Bild der Kriminalität in einem Gemeinwesen und die Meinung breiter Bevölkerungsschichten über den Erfolg oder Misserfolg der institutionellen Kriminalitätskontrolle und der Kriminalpolitik. Gewaltdelikte sind damit hochaktuell, polarisieren und sind in ihrer gesamtgesellschaftlichen Auswirkung von besonderer kriminalpolitischer Relevanz. So haben Berichte über Gewaltattacken, die eine besondere Brutalität oder Menschenverachtung der meist jungen, männlichen Täter offenbaren, neue Gewaltphänomene und terroristische Anschläge im eigenen Land das gesellschaftliche Klima in Deutschland verändert. Die innere Sicherheit scheint in Gefahr. Damit stehen politische Forderungen und Vorhaben im Raum, etwa die Ausweitung der Videoüberwachung, das Anheben der Polizeistärke, die Schaffung weiter gehender polizeilicher Befugnisse, eine konsequente justizielle Ahndung von Straftaten sowie die Verschärfung ausländerrechtlicher Bestimmungen. Leseprobe Deshalb ist zu fragen: Wie steht es tatsächlich um die alltägliche Gewalt auf der Straße, in den U-Bahnhöfen, Parks und Vergnügungsvierteln? Wie steht es um die Gewaltausübung im Kontext der Zuwanderung von Flüchtlingen? Trifft der medial verbreitete Eindruck einer durchgängig wachsenden Gewalt zu? Zu fragen ist aber auch: Welche Faktoren beeinflussen diese Gewaltphänomene im öffentlichen Raum? Wie sind sie zu erklären, wo kommen sie in besonderem Maße vor? Gibt es spezifische Tatörtlichkeiten, soziale Problemräume, an denen sich Gewalttaten häufen? Welche Einwirkungsmöglichkeit hat die Polizei, welche Konzepte sind Erfolg versprechend? Was kann sozialraumorientierte Polizeiarbeit bewirken? Ebenfalls im allgemeinen gesellschaftlichen Fokus steht aktuell das Wirken der Polizei und anderer staatlicher Organe, z.B. Feuerwehr und Rettungskräfte, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Es herrscht der Eindruck vor, dass sie 3
Vorwort der Herausgeber wachsender Respektlosigkeit und Gewalttätigkeit ausgesetzt sind. In welcher Weise setzt die Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ihrerseits Gewalt ein? Sind Polizeibeamte befähigt und in der Lage, in eskalierenden Konfliktlagen angemessen zu reagieren? Welche rechtlichen Bedingungen gelten und welche Mechanismen wirken, wenn ein Polizeibeamter rechtswidrig Gewalt anwendet? Wie ist dem von vornherein entgegenzuwirken? Wie ist der Befund zu diesen Fragen und welche Antworten sind darauf zu geben – gesellschaftlich, in der Politik und polizeifachlich? Es bleibt festzuhalten: Die Gewährleistung von Sicherheit vor Gewalt im öffentlichen Raum ist eine Kernfunktion des staatlichen Gewaltmonopols und damit eine Kernaufgabe der Polizei. Diese ist dabei an rechtsstaatliches Handeln gebunden und unterliegt in diesem Rahmen dem Primat der Politik. Die Autoren des vorliegenden Lehr- und Studienbriefs versuchen, in drei sehr unterschiedlichen, am Bedarf der Praxis ausgerichteten Beiträgen Antworten auf diese sicherheits- und gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen zu geben und polizeifachlich Orientierung zu bieten. So zeigt der Beitrag zur Entwicklung der Alltagsgewalt im öffentlichen Raum den deutlichen Rückgang der diesen Phänomenen zuzurechnenden Straftaten in den letzten zwanzig Jahren auf und nimmt dezidiert zu dem statistischen Anstieg von Gewaltdelikten im Kontext der Zuwanderung in den Jahren 2015/2016 Stellung. Der weitere Beitrag zu Erscheinungsformen und Erklärungsansätzen von Alltagsgewalt im öffentlichen Raum greift empirische Befunde zu den damit verbundenen Fragestellungen auf und beschreibt unter Darlegung erfolgreicher Praxismodelle die Möglichkeiten einer proaktiven, sozialraumorientierten Polizeiarbeit. Der dritte Beitrag setzt sich nach einer Beschreibung der Entwicklung von Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten und den Grundmaximen der polizeilichen Anwendung von Gewalt im Schwerpunkt mit den äußerst schwierigen, für die polizeiliche Praxis aber um so bedeutsameren Fragen des Umgangs mit ungerechtfertigter Gewaltanwendung durch Polizeibeamte auseinander. Dies mag bei erster Betrachtung kontrovers aufgenommen werden. Doch verdienen die damit verbundenen rechtlichen, aber mehr noch die Aspekte eines ethisch fundierten polizeilichen Handelns auch in sehr herausfordernden polizeilichen Einsatzsituationen gerade für die Zielgruppe berufsjunger Polizeivollzugsbeamter und -beamtinnen besondere Beachtung. Hierzu werden Ansätze einer konstruktiven Fehlerkultur aufgezeigt. Leseprobe Bei aller Unterschiedlichkeit der Beiträge vermittelt dieser Lehr- und Studienbrief einen differenzierten Überblick über die Themenfelder, die aktuell zu spezifischen Entwicklungen der Alltagskriminalität, ihren Erklärungsansätzen und Interventionsmöglichkeiten und den damit korrespondierenden Handlungsfeldern diskutiert werden. Wolfgang Gatzke Horst Clages 4
- Seite 2 und 3: Lehr- und Studienbriefe Krimina
- Seite 6 und 7: Inhaltsverzeichnis Vorwort der Hera
- Seite 8 und 9: Inhaltsverzeichnis Detlef Averdiek-
- Seite 10 und 11: Wolfgang Gatzke 1 Zur Entwicklung d
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...