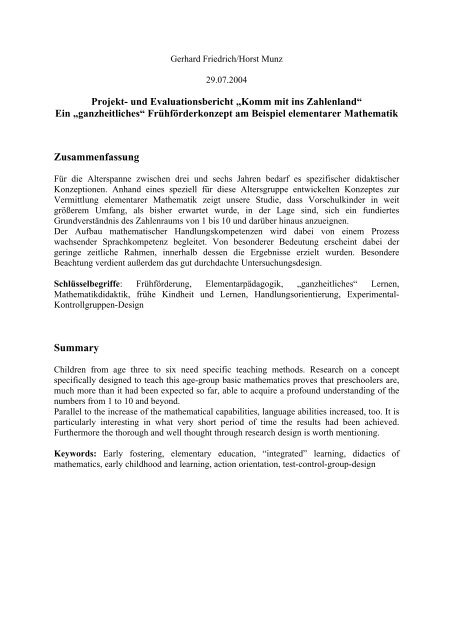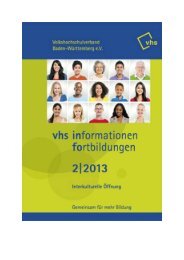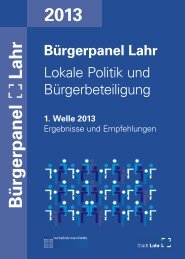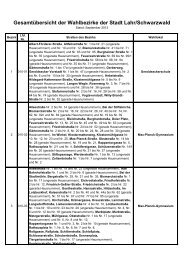Zahlenland?
Zahlenland?
Zahlenland?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gerhard Friedrich/Horst Munz<br />
29.07.2004<br />
Projekt- und Evaluationsbericht „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“<br />
Ein „ganzheitliches“ Frühförderkonzept am Beispiel elementarer Mathematik<br />
Zusammenfassung<br />
Für die Alterspanne zwischen drei und sechs Jahren bedarf es spezifischer didaktischer<br />
Konzeptionen. Anhand eines speziell für diese Altersgruppe entwickelten Konzeptes zur<br />
Vermittlung elementarer Mathematik zeigt unsere Studie, dass Vorschulkinder in weit<br />
größerem Umfang, als bisher erwartet wurde, in der Lage sind, sich ein fundiertes<br />
Grundverständnis des Zahlenraums von 1 bis 10 und darüber hinaus anzueignen.<br />
Der Aufbau mathematischer Handlungskompetenzen wird dabei von einem Prozess<br />
wachsender Sprachkompetenz begleitet. Von besonderer Bedeutung erscheint dabei der<br />
geringe zeitliche Rahmen, innerhalb dessen die Ergebnisse erzielt wurden. Besondere<br />
Beachtung verdient außerdem das gut durchdachte Untersuchungsdesign.<br />
Schlüsselbegriffe: Frühförderung, Elementarpädagogik, „ganzheitliches“ Lernen,<br />
Mathematikdidaktik, frühe Kindheit und Lernen, Handlungsorientierung, Experimental-<br />
Kontrollgruppen-Design<br />
Summary<br />
Children from age three to six need specific teaching methods. Research on a concept<br />
specifically designed to teach this age-group basic mathematics proves that preschoolers are,<br />
much more than it had been expected so far, able to acquire a profound understanding of the<br />
numbers from 1 to 10 and beyond.<br />
Parallel to the increase of the mathematical capabilities, language abilities increased, too. It is<br />
particularly interesting in what very short period of time the results had been achieved.<br />
Furthermore the thorough and well thought through research design is worth mentioning.<br />
Keywords: Early fostering, elementary education, “integrated” learning, didactics of<br />
mathematics, early childhood and learning, action orientation, test-control-group-design
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Rahmenbedingungen S. 3<br />
2. Das <strong>Zahlenland</strong>konzept: Eine „ganzheitliche“ Frühförderintention S. 4<br />
3. Die didaktische Grundidee S. 5<br />
4. Theoriehintergründe S. 5<br />
5. Akzeptanz bei Erzieherinnen, Erziehern und Eltern S. 7<br />
5.1 Die Antworten der Erziehrinnen und Erzieher S. 8<br />
5.2 Die Antworten der Eltern S. 8<br />
6. Das Untersuchungsdesign S. 9<br />
7. Ergebnisse der ersten Phase S. 11<br />
8. Ergebnisse der zweiten Phase S. 14<br />
9. Diskussion S. 24<br />
10. Effektivität S. 24<br />
11. Ausblick S. 25<br />
Veröffentlichungen S. 26<br />
Presseberichte S. 26<br />
Kontakt S. 26<br />
Anhang<br />
2
1. Rahmenbedingungen<br />
Die Durchführung des Projektes „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“ – es wird vom Ministerium<br />
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie von der Robert-Bosch-Stiftung<br />
gefördert – läuft seit Februar 2003.<br />
Vorrangiges Ziel des Projektes ist es, ein didaktisches Konzept zu entwickeln und zu<br />
evaluieren, welches zum Inhalt hat, den Zahlenraum von 1 bis 10 sowohl in die Lebenswelt<br />
der Kinder als auch in die pädagogische Arbeit im Kindergarten einzubinden. Dabei sollen<br />
nicht die Bildungsinhalte der ersten Klassenstufe aus dem Schulfach Mathematik in den<br />
Kindergarten vorverlegt werden, sondern es geht vielmehr darum, der kindlichen Neugierde<br />
sowie der Freude und der Ausdauer beim Lernen mit ausgewählten Inhalten zu begegnen.<br />
Die Kinder sollen mit Hilfe eines altersgemäßen Konzeptes einerseits in ihren<br />
mathematischen Kompetenzen bzw. in der Erweiterung ihres mathematischen<br />
„Handlungsspielraums“, andererseits aber auch in ihrer Sprachentwicklung gefördert<br />
werden. Für das pädagogische Fachpersonal bietet das Projekt eine Kompetenzerweiterung<br />
mit Blick auf den Bildungsauftrag der Kindergärten.<br />
Der Zeitraum Frühjahr 2003 bis Sommer 2003 gilt als erste Projektphase und der Zeitraum<br />
Sommer 2003 bis Sommer 2004 als zweite. Im Herbst 2004 soll die dritte und abschließende<br />
Phase beginnen.<br />
Für die beiden ersten Zeiträume wurden zwei Kindergärten (Projektkindergärten) zu<br />
Testzwecken ausgewählt. Die passenden Kontrollkinder wurden aus vier Kindergärten<br />
(Kontrollkindergärten) gewonnen.<br />
Das Projekt selbst wird jedoch aufgrund des großen Interesses und der positiven Resonanz<br />
zwischenzeitlich in mehr als 8 Kindergärten im Lahrer Raum angeboten. 1<br />
Erhebungen zur Akzeptanz des Projektes (bei Erzieherinnen, Erziehern und Eltern) wurden<br />
nur an solchen Kindergärten gemacht, die das Projekt mindestens einmal vollständig<br />
angeboten haben.<br />
Für die Evaluation der Lernfortschritte wurde jeweils zweimal, d. h. sowohl in<br />
Projektphase 1 als auch in Projektphase 2, mit vier festen Gruppen in den Projektkindergärten<br />
(Gruppengröße 9 bis 15 Kinder) gearbeitet. Die Gruppen trafen sich einmal in der Woche<br />
rund 50 bis 60 Minuten zu einem festen Termin, bei dem eine Zahl (gemäß unserem Konzept<br />
der „Zahl der Woche“) im Mittelpunkt stand. Insgesamt wurde also, dem Zahlenraum von 1<br />
bis 10 entsprechend, jede Gruppe nur 10 Stunden gezielt gefördert. Während der Woche<br />
wurden den Projektkindern die zur Zahl der Woche passenden Lernmaterialien in<br />
Freiarbeitsphasen zur Verfügung gestellt und die Erzieherinnen wiederholten Abzählreime,<br />
Spiele, Lieder und die Geschichten, wann immer sich ein situativer Zusammenhang ergab.<br />
Für die Durchführung der Projekthase 1 wurde ein Projektkindergarten im vorstädtischen und<br />
eher „ländlichen“ Einzugsgebiet von Lahr gewählt. Die Kinder dieses Kindergartens wechseln<br />
mit großer Wahrscheinlichkeit alle in die gleiche Grundschule, da sich diese im gleichen<br />
Gebäude befindet. 2 Die Eltern der Kinder kommen überwiegend aus sozial „behüteten“ und<br />
„sicheren“ Verhältnissen und der Anteil der Kinder von Spätaussiedlern liegt unter 15 %. Die<br />
Kontrollkinder der Projektphase 1 stammen aus zwei verschiedenen Kontrollkindergärten mit<br />
ähnlichen Beschreibungsmerkmalen.<br />
Informelle Gespräche mit den Erzieherinnen und Eltern sowie Eigenbeobachtungen ergaben<br />
in der Projektphase 1, dass über die Erkenntnisse der durchgeführten Tests hinausgehend<br />
mehrfach die Vermutung geäußert wurde, dass die Projektkinder ihre Sprachkompetenzen<br />
1<br />
2<br />
Landes- und bundesweit arbeiten bereits sehr viel mehr Kindergärten nach dem Konzept. Dies wissen wir<br />
aufgrund von Kontaktaufnahmen und Rückmeldungen.<br />
Dieses Auswahlkriterium ist im Hinblick auf die dritte Evaluationsphase von praktischem Vorteil. Hier soll<br />
es darum gehen, die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse zu untersuchen.<br />
3
verbesserten. Diese Hinweise führten dazu, dass wir die projektbedingten Veränderungen im<br />
Sprachverständnis, Sprachgedächtnis und in der Sprachproduktion in der zweiten Phase mit<br />
Hilfe eines Tests mit erfassen wollten.<br />
Zu diesem Zwecke wählten wir für die Projektphase 2 einen neuen Projektkindergarten aus,<br />
bei dem zu erwarten war, dass eine große Zahl an Kindern über schlechte und nicht<br />
altersgemäße Sprachkenntnisse verfügen. Die Motivation war hier, den erhofften Effekt<br />
deutlicher abbilden zu können. Im Projektkindergarten der zweiten Phase waren zurzeit der<br />
Datenerhebung über 85 % „Spätaussiedlerkinder“ mit zum Teil gravierenden<br />
Sprachdefiziten. Im Extremfall besaßen die Kinder keine Deutschkenntnisse (2 Kinder), da<br />
sie gerade erst nach Deutschland gekommen waren.<br />
Natürlich wählten wir auch die Kontrollkinder aus Kindergärten aus, die vergleichbare<br />
soziokulturelle Bedingungen aufwiesen.<br />
2. Das <strong>Zahlenland</strong>konzept: Eine „ganzheitliche“ Frühförderintention<br />
Was schon Heinrich Pestalozzi (1746–1827) forderte – eine gute Erziehung müsse mit „Kopf,<br />
Herz und Hand“ erfolgen –, entspricht auch unseren modernen Ansichten. Informationen, so<br />
ist zu vermuten, werden dann am besten gespeichert, wenn sie auf möglichst vielfältige Weise<br />
dargeboten und verarbeitet werden. Doch so berechtigt dieser Anspruch nach „ganzheitlichem<br />
Lernen“ ist, ist doch oft unklar, was darunter verstanden werden soll.<br />
Meist wird Ganzheitlichkeit – ganz im Sinne von Pestalozzi – auf der Subjektseite, also<br />
beim Lernenden, angesiedelt. Ganzheitliches Lernen beinhaltet dabei das möglichst vielfältige<br />
Zusammenspiel verschiedener Sinne, z. B. Augen, Tastsinn, Gehör, Gleichgewichtssinn und<br />
Bewegungssinn. Der Wahrnehmungsprozess bildet dabei ein ganzheitliches Ereignis, bei<br />
dem unterschiedliche Sinne eine Gesamtempfindung hervorbringen. Diese entsteht wiederum<br />
nicht unabhängig von Gefühlen und Persönlichkeitsmerkmalen und wird mit bisherigen im<br />
Gehirn gespeicherten Erinnerungen und Erfahrungen verbunden.<br />
Es geht aber auch darum, den ganzen Menschen mit der ganzen Sache zusammenzubringen.<br />
Bezogen auf unseren Lerngegenstand des Zahlenraums von 1 bis 10 beinhaltet ganzheitliches<br />
Lernen auf dieser Objektseite die gesamte sinnliche Erfahrung der Bedeutungsvielfalt dieser<br />
zehn Grundzahlen. Wir thematisieren deshalb den Anzahl- und Ordnungsaspekt der Zahlen<br />
ebenso, wie wir etwa Verbindungen zu geometrischen Formen, musikalischen Strukturen und<br />
– vor allem – zur konkreten Lebenswelt der Kinder einfließen lassen.<br />
Für das lernende Kind (Subjektseite) bedeutet dies, dass das „ganze Kind“ lernt, also mit allen<br />
Sinnen, mit seiner Sprache, seiner Motorik usw., und für die Didaktik (Objektseite) bedeutet<br />
dies, dass es ihr gelingen muss, den Lerngegenstand in seiner gesamten Breite in die<br />
Lebenswelt der Kinder einzubetten.<br />
Aus den bisherigen Ausführungen sollte hervorgehen, dass sich das <strong>Zahlenland</strong>konzept<br />
keineswegs auf „rein“ mathematische Inhalte beschränken kann. Solch ein Vorgehen wäre<br />
ganz gewiss auch zum Scheitern verurteilt.<br />
Neben grundlegenden Inhalten der elementaren Mathematik, wir bewegen uns überwiegend<br />
im Zahlenraum von 1 bis 10, umfasst „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“ eine generelle Förderung<br />
der Wahrnehmung, der Merkfähigkeit, der Motorik, des gesamten Ausdrucksvermögens<br />
und vor allen der Sprache. Gerade die Sprachentwicklung wird beim Aufbau<br />
mathematischer Kompetenzen implizit wirksam mitgefördert, da sie sich dabei allein<br />
aufgrund des Wissenszuwachses stetig ausdifferenziert. Das Konzept beinhaltet aber auch<br />
Elemente einer musikalischen Früherziehung. Die Vermittlung elementarer Mathematik mit<br />
Hilfe musikalischer bzw. gesanglicher und rhythmischer Elemente sowie mit Hilfe von<br />
„Zahlengeschichten“ fördert die Sprachentwicklung, so ist zu vermuten, nachhaltig.<br />
4
Zusammenfassend möchten wir deshalb betonen, dass es sich aus unserer Sicht beim Konzept<br />
„Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“ um ein „ganzheitliches“ Frühförderkonzept am Beispiel<br />
elementarer mathematischer Inhalte handelt.<br />
3. Die didaktische Grundidee<br />
Das Konzept bzw. die methodische Umsetzung des „<strong>Zahlenland</strong>es“ basiert auf einer<br />
einfachen Grundidee, nämlich auf der sehr konkreten Interpretation des aus der Didaktik<br />
der Mathematik stammenden Begriffs „Zahlenraum“. Dieser Begriff verweist auf den engen<br />
Zusammenhang der Zahlen zur Geometrie. Für diesen Zahlenraum von 1 bis 10 wurde nach<br />
einer mathematischen Systematik ein Ort geschaffen, in welchem die Zahlen „zu Hause sind“:<br />
das so genannte <strong>Zahlenland</strong>. 3<br />
In diesem „<strong>Zahlenland</strong>“ erhält jede Zahl von 1 bis 10 einen festen „Wohnort“ und in Form<br />
einer Zahlenpuppe einen spezifischen Charakter bzw. eine unverwechselbare Identität. Mit<br />
Hilfe dieser Zahlenpuppen, die in ihrer Form den einzelnen Ziffern nachempfunden sind und<br />
die zugleich den Anzahlaspekt der jeweiligen Zahl repräsentieren, lassen sich vielfältige<br />
Aktionen ausführen. (Die Puppe Eins trägt eine Zipfelmütze, die Zwei eine Brille ... die Neun<br />
besitzt 5 Zähne oben und 4 unten, die Zehn hat 2 mal 5 Finger.) Man kann sie sprechen und<br />
die Zahlenlieder singen lassen oder in vielfältige Spiele und insbesondere in die<br />
Handlungsabläufe unserer Zahlengeschichten integrieren.<br />
Das <strong>Zahlenland</strong> ist dementsprechend das pädagogische Äquivalent für den wissenschaftlichen<br />
Begriff des Zahlenraums. Im <strong>Zahlenland</strong> sind die Zahlen zu Hause, sie besitzen beseelte<br />
Eigenschaften und geben in personalisierter Weise ihre mathematischen Eigenschaften kund.<br />
4. Theoriehintergründe<br />
Seine methodischen Ideen schöpft das Projekt aus verschiedenen Wissensbereichen, von<br />
denen wir die drei wichtigsten in diesem Bericht aufführen möchten.<br />
Der erste Bereich ist die „Neurodidaktik“. Wir benutzen diesen Begriff als funktionalen<br />
Hilfsbegriff, um die Zusammenhänge zwischen den neurobiologischen Bedingungen des<br />
Menschen und seiner Lernfähigkeit zu beschreiben. Das Ziel einer Neurodidaktik wäre es<br />
demnach, eine Brücke zwischen relevanten Ergebnissen aus der Hirnforschung und der<br />
Pädagogik zu bauen. Die Schlüsselidee ist dabei die, dass die Plastizität des Gehirns – also<br />
seine materielle Form- oder Veränderbarkeit – in unauflöslicher Beziehung zueinander stehen.<br />
Wir sind der Überzeugung, dass erste Bausteine für diesen Brückenbau existieren.<br />
Aus der Hirnforschung wissen wir beispielsweise, dass unser Gedächtnissystem gegenüber<br />
Ereignissen oder Episoden besonders leistungsfähig ist. Dies gilt insbesondere, wenn die<br />
Ereignisse einen Neuigkeitswert besitzen und uns bedeutsam erscheinen. Aber wir können<br />
uns nicht nur die Ereignisse gut merken, sondern auch die Orte, an denen sie stattfanden.<br />
Diesen beiden Tatsachen versuchen wir dadurch Rechnung zu tragen, indem jede Zahl einen<br />
festen Ort im Raum erhält und wir unsere Grundzahlen zu „Zahlereignissen“ werden lassen.<br />
Aus diesem Grund arbeiten wir neben vielgestaltigen Spielen vor allem mit Zahlenliedern,<br />
Zahlengeschichten oder auch Abzählreimen mit dem Ziel, die Zahlen in episodische<br />
Handlungsabläufe einzubetten.<br />
3<br />
Die dazu notwendige Raumgestaltung ist in jedem Kindergarten- oder Klassenzimmer mit verhältnismäßig<br />
einfachen Mitteln leicht durchführbar.<br />
5
Eine Geschichte über die Eins erzählt etwa von der Eins und ihrem Einhorn, dem der freche<br />
Zahlkobold Kuddelmuddel sein Horn gestohlen hat und das deshalb nun ein „Keinhorn“ ist.<br />
Die Geschichte der Zwei handelt davon, dass die Zwei sich darüber ärgert, weil die Menschen<br />
meinen, sie stottere, obwohl das gar nicht stimmt, denn alle alle Zweien Zweien reden reden<br />
so so wie wie sie sie.<br />
Es gibt eine Drei, die drei Wünsche erfüllen kann, eine kranke Vier, deren Krankheit dazu<br />
führt, das alle Viererdinge (Tischbeine, Autobereifung usw.) durcheinander geraten, oder eine<br />
Fünf, die internationalen Besuch von 5 Kindern aus den 5 Kontinenten bekommt usw.<br />
Korrespondierend zu diesen Zahlengeschichten arbeiten wir mit Zahlenliedern, die sich<br />
bezüglich des Textinhaltes an diesen Märchen orientieren, zugleich jedoch streng<br />
„mathematisch“ komponiert wurden. So singt die „Eins“ ihr Lied mit nur einem einzigen Ton<br />
im Einertakt. Die „Zwei“ entsprechend mit zwei Tönen im 2/4 Takt, die „Drei“ liebt den<br />
Walzer und kommt mit genau drei Tönen aus usw.<br />
Der zweite Bereich ist die Entwicklungspsychologie in Verbindung mit der<br />
Elementarpädagogik.<br />
Bei der Begegnung der Vorschulkinder mit der Welt der elementaren Mathematik bzw. der<br />
Zahlen arbeiten wir ganz bewusst mit so genannten Anthropomorphismen. Darunter versteht<br />
man ganz allgemein die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften oder Verhaltensweisen auf<br />
nichtmenschliche Objekte oder auch Tiere. Seit Piaget spricht man in diesem Zusammenhang<br />
auch von Animismus. In unserem Konzept werden gezielt konstruierte Anthropomorphismen<br />
(in Form personalisierter Zahlen) als didaktische Hilfsmittel eingesetzt.<br />
Kinder der Alterstufe von 3 bis 6 Jahren betrachten die Dinge um sich herum wesentlich<br />
stärker emotional als rational und sie haben ihre eigene, altersbedingte kognitive Erlebnis-<br />
und Denkweise. Daher kommt es, dass sie Gegenständen Gefühle, Leben und Absichten<br />
unterstellen. Die Dinge der kindlichen Umwelt sind entweder brav oder böse, freundlich oder<br />
unfreundlich, sie schauen für das Kind vertrauenerweckend oder beängstigend aus.<br />
Kinder in diesem Alter sind außerdem vom magischen und finalistischen Denken geprägt.<br />
Dabei werden Vorgänge, die eine logische Ursache haben, als geheimnisvoll erlebt und so<br />
gedeutet, als könne man sie durch Zauberei, durch Magie und – vor allem – durch eigene<br />
Wünsche beeinflussen. Alles, was geschieht, hat einen bestimmten Zweck oder verfolgt eine<br />
bestimmte Absicht.<br />
Vor diesem entwicklungspsychologischen Hintergrund kann es beim Thema „Mathematik im<br />
Kindergarten“ nicht darum gehen, Inhalte des Grundschulunterrichts in typisch „fachlich<br />
orientierter“ Manier vorwegzunehmen. Uns geht es vielmehr darum, Kindern einen<br />
altersgemäßen Zugang zur Welt der Zahlen anzubieten.<br />
Bisherige Konzepte der mathematischen Früherziehung entwickeln ihre Ideen meist<br />
ausgehend von der Mathematik, erst danach wird nach konkreten Anwendungen in der<br />
Lebenswelt der Kinder gesucht. Es gilt, dieses Prinzip umzukehren, da die Mathematik eine<br />
eigene und sehr nüchterne Logik hat, welche das emotionale, magische, anthropomorphe<br />
und märchenhafte Denken unserer Kinder nicht berücksichtigt.<br />
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum der methodische Weg, die Grundlagen der<br />
elementaren Mathematik in eine fantasievolle Welt zu projizieren, in der die Zahlen in<br />
beseelter und personalisierter Weise ihre mathematischen Eigenschaften kundtun und in der<br />
z. B. auch ein Zahlenkobold sein Unwesen treibt und eine Zahlenfee fürs Rechnen zuständig<br />
ist, für die Kinder eine große Motivation darstellt.<br />
Der dritte Bereich ist die Didaktik der elementaren Mathematik. Hier bewegen wir uns auf<br />
verschiedenen Handlungs- und Erfahrungsbereichen, z. B. der Zahlenstadt, den Zahlengärten<br />
mit ihren besonderen Häusern und Türmen und dem Zahlenweg. Es geht darum, der Vielfalt<br />
verschiedener Zahlbedeutungen möglichst umfassend gerecht zu werden.<br />
6
Bei der Zahl Fünf sieht dies etwa so aus: Der Zahlengarten der Zahl Fünf befindet sich<br />
zwischen dem der Vier und dem der Sechs (ordinaler Zahlaspekt). Der Garten selbst ist als<br />
regelmäßiges Fünfeck konstruiert (geometrischer Aspekt) und kann an jeder Ecke verziert<br />
werden (Eins-zu-Eins-Zuordnung). Im Garten befindet sich ein Haus mit fünf Fenstern<br />
(kardinaler Zahlaspekt) und aufsteckbarer Hausnummer (Kodierungsaspekt) sowie ein<br />
Zahlenturm, mit dessen Hilfe Zahlzerlegungen (Rechenaspekt: 1 + 4 oder 3 + 2)<br />
veranschaulicht bzw. konstruiert werden können.<br />
Eine besonders erfolgreiche Methode, Kindern den Ordnungsaspekt der Zahlen erfahrbar zu<br />
machen, ist die Verwendung eines Zahlenweges, bei dem die Bewegung der Kinder als<br />
Stützfunktion in den mathematischen Lernprozess eingreift. Die Motorik spielt nachweislich<br />
eine große Bedeutung beim Verarbeiten, Speichern und Erinnern von Informationen. Dies<br />
bestätigen z. B. auch vielfältige Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindern, die eine Lese-<br />
Rechtschreibschwäche haben. 4<br />
Die wichtigste Aktivität auf dem Zahlenweg ist deshalb das Gehen auf den Ziffern, verbunden<br />
mit lautem oder stillem Zählen. Kognitive Leistungen werden dabei unterstützt durch<br />
Bewegung: Wo stehe ich gerade auf dem Zahlenweg? Welche Zahl kommt vor mir und<br />
welche direkt hinter mir? Schafft es ein Kind diese Fragen ohne Hilfe zu beantworten –<br />
vielleicht sogar mit verbundenen Augen -, so hat es bereits ein abstraktes Bild des so<br />
genannten Zahlenstrahls verinnerlicht. Gerade für den Zahlenweg gibt es eine Fülle von<br />
Lernmöglichkeiten. In unserem Projekt benutzen wir den Zahlenweg von 0 bis 20.<br />
Die drei genannten Wissensbereiche sind hier exemplarisch genannt, um zu verdeutlichen,<br />
dass das „<strong>Zahlenland</strong>konzept“ seine Ideen aus verschiedenen Disziplinen schöpft.<br />
5. Akzeptanz bei Erzieherinnen, Erziehern und Eltern<br />
Ein wichtiges Anliegen erschien uns neben der Untersuchung der Lernergebnisse die<br />
Beantwortung der Frage, inwieweit unser Konzept auf Akzeptanz bei den Beteiligten (vor<br />
allem Elternakzeptanz und Erzieherinnen- bzw. Erzieherakzeptanz) stößt. Die Entwicklung<br />
bzw. Evaluation eines didaktischen Konzeptes macht längerfristig nur dann einen Sinn, wenn<br />
es die Chance hat, in die Alltagspraxis adaptiert zu werden. Eine „akademische<br />
Trockenübung“ erschien uns nicht erstrebenswert, selbst wenn sie die erhofften Lernerfolge<br />
liefern sollte.<br />
Verfolgt man solch einen Anspruch, ist es wichtig, das Konzept so zu konstruieren, dass es<br />
auf die didaktische Handlungskompetenz der Erzieherinnen und Erzieher zielt bzw. diese<br />
herausfordert. Ein Lernprogramm in Sinne einer lernpsychologischen Instruktionsanweisung<br />
erschien uns nicht erstrebenswert.<br />
Es gilt, ein methodisches Rahmenkonzept maximalen Inhaltes so vorzugeben, dass es situativ<br />
an die soziokulturellen und individuellen Voraussetzungen und Bedingungen angepasst<br />
werden kann. Diese Anpassung und Konkretisierung kann jedoch nur der Pädagoge vor Ort<br />
leisten.<br />
Aus diesem Grunde sollte das Konzept auch dafür offen sein, didaktische und methodische<br />
Ideen der Erzieherinnen und Erzieher aufzugreifen und umzusetzen.<br />
Um die Einstellung aller Beteiligten zum „<strong>Zahlenland</strong>“ zu erkunden, haben wir sowohl für die<br />
Erzieherinnen und Erzieher als auch für die Eltern der Projektkinder alle uns wichtig<br />
4<br />
Hans Joachim Michel (Hg.) FRESCH, Freiburger Rechtschreibschule, AOL Verlag 77839 Lichtenau.<br />
7
erscheinenden Aspekte in Fragen gekleidet. Am Ende lagen uns Antworten von insgesamt<br />
142 Eltern sowie 34 Erzieherinnen vor.<br />
5<br />
4.1 Die Antworten der Erzieherinnen<br />
Neben den Fragen zum engeren Bereich des Konzeptes 5 zielten wir bei den Erzieherinnen<br />
vor allem auch darauf ab, ob sie das Konzept für „alltagstauglich“ (s. Fragen 5, 6 und 7)<br />
halten und ob sie den Eindruck haben, dass sich bei den Kindern neben den Fortschritten<br />
im Bereich von Zahlen und Mengen auch ganz allgemeine Lernfortschritte beobachten<br />
lassen (Frage 11).<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
97<br />
100<br />
Die Antworten der Erzieherinnen<br />
94<br />
97<br />
87<br />
97<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges<br />
Es fällt sofort auf, dass die Antwort „nein“ nie gegeben wird, bei 8 von 11 Fragen gibt es<br />
über 90 % Zustimmung. Die beteiligten Erzieherinnen stimmen also mit großer<br />
Mehrheit darin überein, dass das Projekt seinen Ansprüchen genügt, dass es Spaß macht,<br />
alltagstauglich ist und dass allgemeine Lernfortschritte zu beobachten sind. Alle befragten<br />
Erzieherinnen bejahen, dass es ihnen leicht fiele, das Konzept weiter zu empfehlen (Frage<br />
8), auch die Frage nach der Schlüssigkeit des Konzeptes (Frage 2) wird zu 100 % bejaht.<br />
Die Fragebögen können im Anhang eingesehen werden.<br />
77<br />
100<br />
ja<br />
tw<br />
nein<br />
97<br />
100<br />
86<br />
94<br />
8
4.2 Die Antworten der Eltern<br />
Die 5 Fragen an die Eltern versuchen deren Einstellung zum Konzept, deren Information<br />
über das Konzept und deren Eindrücke zur Wirkung des Konzeptes auf ihre Kinder zu<br />
erfassen.<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100<br />
0<br />
86<br />
5<br />
Die Elternantworten<br />
88<br />
90<br />
1 1 0 1<br />
1 2 3 4 5 Ges<br />
Auch bei den Eltern sind „nein“-Antworten äußerst selten (die 5 % bei Frage 2 hängen<br />
mit der Erzählbereitschaft der Kinder zusammen, haben also nur indirekt etwas mit dem<br />
Projekt zu tun), alle Befragten befürworten das Projekt „<strong>Zahlenland</strong>“ (Frage 1).<br />
6. Das Untersuchungsdesign<br />
Zur Evaluation des Projektes „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“ bot sich zumindest für die erste<br />
Projektphase ein klassisches Experimental-Kontrollgruppen-Design mit zwei Testungen<br />
(vor Beginn des Projektes und danach; Pretest-Posttest-Design) an.<br />
Die Experimentalgruppe durchläuft das Projekt „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“, die<br />
Kontrollgruppe erhält diese spezifische Förderung nicht.<br />
Um einen eventuellen Projekt- bzw. „Trainingseffekt“ nachweisen zu können, lag es nahe,<br />
Testaufgaben aus Schuleingangsuntersuchungen zu verwenden.<br />
97<br />
ja<br />
teilw<br />
nein<br />
92<br />
9
Ausgewählt wurden Aufgaben aus dem „Kieler Einschulungsverfahren“ (KEV) 6<br />
� Mengen erfassen und Mengen herstellen<br />
� Farben- und Formauffassung<br />
� Zahlen nachsprechen, Zahlengedächtnis<br />
� Allgemeine Denkfähigkeit<br />
� Detailbeachtende Wahrnehmung<br />
Der „Test“ der ersten Phase umfasst 8 Aufgaben, in denen es maximal 31 Punkte zu erreichen<br />
gibt. Für eine zufrieden stellende Testdurchführungs- und Auswerteobjektivität wurde nicht<br />
zuletzt seitens der beteiligten Erzieherinnen Sorge getragen (standardisierte Anweisungen und<br />
klare Bepunktungsregeln).<br />
Das Untersuchungsdesign der Projektphase II gleicht dem der Phase I. Auch hier gibt es<br />
wieder eine Experimental- und eine Kontrollgruppe (Projektkinder PROKIS und<br />
Kontrollkinder KOKIS) und selbstverständlich zur Überprüfung des Effektes den Vortest<br />
und den Nachtest.<br />
Drei ganz wesentliche, die Aussagefähigkeit der Untersuchung deutlich erweiternde<br />
Unterschiede zur Projektphase I sind jedoch zu beachten:<br />
� Projektkinder und Kontrollkinder stammen aus Lahrer Kindergärten, die einen sehr<br />
hohen Anteil an Spätaussiedlerkindern aufweisen, an Kindern also, die mit der Sprache<br />
Deutsch zum Teil erhebliche Probleme haben. Die Rückmeldungen der Erzieherinnen aus der<br />
Phase I haben unsere Vermutung bestärkt, dass das <strong>Zahlenland</strong>konzept ein umfassendes<br />
Förderprogramm ist, d. h. dass Förderung auch im Bereich Sprache zu erwarten sein wird.<br />
Der Versuch, mit Kindern zu arbeiten, die sprachlich einen zum Teil erheblichen<br />
Entwicklungsrückstand aufweisen, erschien uns deshalb besonders reizvoll, zumal die<br />
Kindergartenstruktur in Lahr uns diese Möglichkeit eröffnete.<br />
� Jedem Projektkind wurde ein Kontrollkind zugeordnet, das ihm nicht nur in den<br />
Variablen Alter und Geschlecht glich, vielmehr musste diesmal auch der Vortest-<br />
Gesamtwert dem des Projektkindes gleichen oder zumindest sehr nahe kommen. Da in der<br />
Vortestphase sehr viele Kontrollkinder getestet werden konnten, war es möglich, diese<br />
strenge Zuordnung zu treffen. Das Arbeiten mit Paarlingen (matched pairs) muss bei einer<br />
Kontrolluntersuchung als ideal angesehen werden.<br />
� Die getesteten Dimensionen wurden um eine sprachliche erweitert. Aus dem<br />
Kieler Einschulungsverfahren (KEV) kam die Aufgabe 6 (Einzeluntersuchung) dazu, in der<br />
die Kinder aufgefordert werden, zu vorgelegten Bildern eine Geschichte zu erzählen. Aus<br />
den „diagnostischen Einschätzskalen“ (DES) 7 wurden 4 Aufgaben entnommen. In der einen<br />
Aufgabe wird kontrolliert, welche Inhalte aus einer vorgelesenen kurzen Geschichte die<br />
Kinder noch erinnern, die drei weiteren Aufgaben prüfen, inwieweit verbale Instruktionen<br />
unterschiedlicher Komplexität befolgt werden können.<br />
Erfasst werden also wesentliche Elemente sowohl der aktiven als auch der passiven<br />
Sprachkompetenz der Kinder.<br />
6<br />
7<br />
Fröse, Sigrun, Mölders, Ruth und Wallrodt, Wiebke: Das „Kieler Einschulungsverfahren“ (KEV), 1986,<br />
Weinheim: Beltz Test Gesellschaft.<br />
Barth, Karlheinz: Die diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes<br />
und der Schulfähigkeit, 2002, München, Basel: E. Reinhardt.<br />
10
7. Ergebnisse der ersten Phase<br />
In Projektphase I wurde in Gruppen gearbeitet, die relativ altershomogen waren.<br />
Wie bereits erwähnt und auch aus der Veränderung des Untersuchungsdesigns ersichtlich, gab<br />
es Schwerpunkte in den Zielen der Projektphasen. So galt es in der ersten Phase zunächst<br />
einmal „nur“ den Nachweis zu führen, dass das Projekt „allgemeine Lernerfolge“ liefert.<br />
Wären diese nicht vorhanden, wäre eine Fortsetzung des Projektes natürlich sinnlos gewesen.<br />
Die Ergebnisse der ersten Projektphase werden in den folgenden Graphiken dargestellt, dabei bedeuten:<br />
pre: Gruppenmittelwert vor Projektbeginn<br />
post: Gruppenmittelwert nach dem Projekt<br />
PK: bezeichnet immer eine bestimmte Gruppe Projektkinder<br />
KK: bezeichnet immer eine bestimmte Gruppe Kontrollkinder (Kinder ohne Training)<br />
z.B. PK4;1: Projektkinder mit einem Durchschnittsalter von 4 Jahren u. 1 Monat<br />
SAF: Schulanfänger<br />
wbl: weiblich<br />
ml: männlich<br />
PROKIS: alle Kinder, die am Projekt teilgenommen haben<br />
KOKIS: alle Kontrollkinder (nicht gefördert)<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Gruppenvergleiche<br />
pre post<br />
PK4;1 PK4;9 PKSAF PKml PKwbl PROKISKOKIS KK4;2 KK5;1 KKml KKwbl<br />
Hoch signifikante Verbesserungen 8 gibt es ausschließlich bei den PROKIS (Projektkinder), die Kontrollkinder<br />
(KOKIS) verschlechtern sich sogar tendenziell.<br />
Am meisten „profitieren“ jüngere Kinder bzw. Kinder mit niedrigen Ausgangswerten. Der Punktezuwachs bei<br />
den Jüngsten (PK4;1) ist in der Tat beachtlich, denn sie erreichen im PostTest fast das Niveau der Schulanfänger<br />
vor Beginn des Trainings. Man sollte sich vor Augen halten, dass der durchgeführte Test ein<br />
Schuleingangsverfahren und die benannte Kindergruppe gerade mal 4 Jahre alt ist.<br />
Mädchen profitieren in gleicher Weise vom Training wie Jungen, es fällt allerdings auf, dass die<br />
Kontrollmädchen tendenziell absinken.<br />
8<br />
Die Signifikanzprüfung erfolgt über die t-Verteilung nach einem t-Test für korrelierende Stichproben. Die<br />
Irrtumswahrscheinlichkeiten sind wie folgt definiert: 5 % = signifikant; 1 % = sehr signifikant und 0,1 % =<br />
hoch signifikant.<br />
11
In der folgenden Graphik „Differenzen pre/post“ werden die o. g. Befunde nochmals verdeutlicht, ein<br />
Projekteffekt wird sichtbar, ebenso die Tatsache, dass sich bei den Kontrollkindern „nichts bewegt“ hat.<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
10,8<br />
Differenzen pre/post<br />
7,4<br />
-0,3<br />
-1,6<br />
PK4;1 PK4;9 PKSAFPKml PKwbl PROKISKOKIS KK4;2 KK5;1 KKml KKwbl<br />
Aus den Graphiken „Alle Projektkinder“ u. „Alle Kontrollkinder“ lassen sich die Entwicklungen jedes einzelnen<br />
Kindes ablesen. Kein einziges Projektkind „verschlechtert“ sich, zwei halten das Pretestergebnis und die übrigen<br />
44 „legen z. T. ganz erheblich zu“.<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
3<br />
5<br />
7<br />
9<br />
11<br />
Alle Projektkinder (PROKIS)<br />
13<br />
15<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
33<br />
35<br />
pre post<br />
37<br />
39<br />
41<br />
43<br />
45<br />
12
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Alle Kontrollkinder (KOKIS)<br />
pre post<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Wenn Veränderungen von Testleistungen dokumentiert werden sollen, bietet sich neben dem Vergleich der<br />
Gruppenmittelwerte auch die Darstellung der Veränderung der Quartilwerte an. Dies soll im Folgenden<br />
geschehen.<br />
Es bedeuten:<br />
Q0: der kleinste gemessene Wert<br />
Q1: das untere Quartil (25 % Quartil)<br />
Q2: der Median (50 % Quartil)<br />
Q3: das obere Quartil (75 % Quartil)<br />
Q4: der größte gemessene Wert<br />
Die anderen Symbole entsprechen dem bisher Dargestellten.<br />
Sehr eindrucksvoll wird belegt, dass sich die PROKIS deutlich nach oben verschieben, denn der niedrigste<br />
gemessene Wert liegt im Post-Test bei 10, Q1 post sowie Q2 post liegen sogar über Q2 und Q3 pre.<br />
Bei den KOKIS gibt es kaum Veränderungen der Quartilwerte, Q1 steigt leicht an, der niedrigste gemessene<br />
Wert (Q0) dagegen sinkt sogar ab.<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Quartilwerte im Vergleich<br />
PK pr<br />
PK po<br />
KK pr<br />
KK po<br />
13
8. Ergebnisse der zweiten Phase<br />
Eine weitere Veränderung gegenüber der Projektphase I ist darin zu sehen, dass mit den<br />
PROKIS in Projektphase II prinzipiell altersgemischt gearbeitet wurde.<br />
Gruppenvergleiche Projektphase II<br />
Testkennwerte<br />
� Die Gesamtleistung (Ges): Punktzahl in allen 13 Testaufgaben<br />
� Anschauungsgebundenes Denken (AD): Punktzahl in 7 Testaufgaben<br />
� Verbale Fähigkeiten (VF): Punktzahl in 6 Testaufgaben<br />
Verglichene Gruppen<br />
Wie bereits aus Phase I bekannt, hinzu kommen:<br />
b4: bis 4 Jahre alt (maximal 48 Monate)<br />
4b5: zwischen 4 und 5 Jahre alt (49 bis 60 Monate)<br />
ä5: älter als 5 Jahre (61 Monate und älter)<br />
schl: Kinder mit eher schlechten Vortestergebnissen<br />
mitt: Kinder mit mittelguten Vortestergebnissen<br />
gut: Kinder mit guten Vortestergebnissen<br />
Gruppenvergleich „Gesamtpunkte“<br />
Die Ergebnisse der Projektphase I bestätigen sich insofern, als auch diesmal Zuwächse nur auf Seiten der<br />
Projektkinder (13,9 vs. KK 0,4) (alle Zuwächse sind hoch signifikant gesichert) zu vermerken sind.<br />
Mädchen und Jungs profitieren in ähnlicher Weise, allerdings liegen die Zugewinne der Mädchen (14,8) etwas<br />
über denen der Jungs (13,2).<br />
Die ausgewählten Altersgruppen verbessern sich alle hoch signifikant, allerdings profitieren im Gegensatz zur<br />
Projektphase I diesmal eher die älteren Kinder in besonderer Weise. Die Zuwächse der 4b5 liegen bei 14,9, die<br />
der ä5 bei 14,1 und die der „Kleinen“ bei 11,6.<br />
In jedem Fall aber erreichen oder übertreffen die Jüngeren zum Projektende die Ausgangsleistungen der<br />
jeweils älteren Gruppe.<br />
Während die KK ml um 1,2 zulegen (das ist nicht signifikant), verschlechtern sich die KK wbl um 0,6. Dies ist<br />
ein interessantes Ergebnis am Rande, das wir aus der Projektphase I bereits kennen.<br />
14
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
G pr<br />
G po<br />
Gesamtpunkte<br />
PROKIS KOKIS PK ml KK ml PK wbl KK wbl PK b4 KK b4 PK 4b5 KK 4b5<br />
Gruppenvergleich „anschauungsgebundenes Denken“<br />
In der Tendenz entsprechen die Ergebnisse beim anschauungsgebundenen Denken (AD) absolut dem<br />
Gesamtresultat. Zugewinne gibt es auch hier nur bei den Projektkindern (6,53 vs. KOKIS 0,2), auch hier sind<br />
alle Zuwächse hoch signifikant (Ausnahme PK b4 „nur“ signifikant) gesichert.<br />
Die Mädchen profitieren leicht mehr als die Jungs (6,9 vs. 6,3) und die älteren Kinder profitieren auch mehr<br />
als die ganz jungen (7 bzw. 7,2 vs. 4).<br />
Was für die Gesamtleistung zutrifft, gilt auch hier, die jeweils Jüngeren erreichen die Ausgangsleistung der<br />
jeweils Älteren.<br />
Auch in diesem Testbereich profitieren die KK ml (0,54) etwas (nicht signifikant), während dies bei den KK wbl<br />
(-0,1) nicht zu erkennen ist.<br />
15
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Anschauungsgebundenes Denken<br />
AD pr<br />
AD po<br />
PROKIS KOKIS PK ml KK ml PK wbl KK wbl PK b4 KK b4 PK 4b5 KK 4b5<br />
Gruppenvergleich „verbale Fähigkeiten“<br />
Das Kernstück der Projektphase II (das Miterfassen der Veränderungen der verbalen Fähigkeiten) bringt ein<br />
Ergebnis, das mit den zuvor genannten Trends absolut übereinstimmt. Dies bedeutet, dass offenbar auch im<br />
Bereich Sprache eine Förderung durch das <strong>Zahlenland</strong>konzept stattgefunden hat. Die mitgeteilten Ergebnisse<br />
sind auch hier wieder hoch signifikant bzw. in einem Fall (PF b4) sehr signifikant gesichert.<br />
Bei VF profitieren nun allerdings die Mädchen etwas stärker als die Jungs (8,5 vs. 7,9).<br />
Im Gegensatz zu AD haben hier die jüngeren PROKIS etwas mehr hinzugewonnen als die älteren (8,2 bzw. 8,9<br />
vs. 7,7).<br />
Die jeweils jüngere Gruppe übertrifft sogar die Ausgangsleistungen der jeweils älteren z. T. recht deutlich.<br />
Die Tendenz, dass die KK ml zwar nicht signifikant, aber immerhin in der Tendenz Zugewinne zu verzeichnen<br />
haben, zeigt sich bei den verbalen Fähigkeiten recht deutlich (0,7 vs. -1,1), die KK wbl verschlechtern sich sogar<br />
tendenziell.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
VF pr<br />
VF po<br />
Verbale Fähigkeiten<br />
16
Gruppenvergleiche „Ausgangsleistung“<br />
Aus der Projektphase I war bekannt, dass besonders die Kinder mit schlechten Ausgangsleistungen (Vortest)<br />
hohe Zugewinne zu verzeichnen hatten. Dies ist in gewisser Weise auch nicht verwunderlich, da für Kinder mit<br />
recht guten Ausgangsleistungen „testbedingte“ Grenzen der Entwicklung nach oben bestehen.<br />
In der Projektphase II lässt sich dieser Effekt bei den Gesamttestleistungen (G) in etwa bestätigen, die<br />
„Schlechten“ (schl) verbessern sich um 14,2, die „Mittleren“ (mitt) um 15,5 und die „Guten“ (gut) „nur“ um 10,1<br />
Punkte.<br />
Die „Schlechten“ erreichen am Ende (G po) beinahe die Ausgangsleistungen der „Mittelguten“, die<br />
„Mittelguten“ ihrerseits übertreffen die Ausgangsleistungen der „Guten“.<br />
Auch beim anschauungsgebundenen Denken (AD) entdecken wir diesen Effekt (schl = 6,4, mitt = 6,8 und<br />
gut = 5) in ähnlicher Weise.<br />
Auch hier ist es so, dass die „Schlechten“ im Post-Test fast an die Pre-Test-Werte der „Mittelguten“<br />
heranreichen und jene am Ende die Ausgangsdaten der „Guten“ übertreffen.<br />
Bei den verbalen Fähigkeiten (VF) profitieren offensichtlich die „Schlechten“ am deutlichsten (9,9), gefolgt<br />
von den „Mittelguten“ (8,5) und den „Guten“ (5). Bei der Einzelauswertung der Tests konnte immer wieder<br />
festgestellt werden, dass es durch das Projekt gelingen kann, Kinder im wahrsten Sinne des Wortes „zum<br />
Sprechen“ zu bringen.<br />
Hier erreichen die „Schlechten“ das Niveau der Ausgangsleistungen der „Mittelguten“.<br />
Auch dies ist ein Beleg für den besonderen Fördereffekt des „<strong>Zahlenland</strong>es“ im Bereich der Sprache.<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Gruppenvergleiche "Ausgangsleistung"<br />
PK schl<br />
KK schl<br />
PK mitt<br />
KK mitt<br />
PK gut<br />
KK gut<br />
G pr G po AD pr AD po VF pr VF po<br />
Dokumentation der Entwicklung der einzelnen Kinder<br />
Anschauungsgebundenes Denken<br />
Bei den PROKIS bestätigt sich der Trend aus Projektphase I, d. h. wir können bei nahezu allen Kindern zum<br />
Teil deutliche Zugewinne feststellen. Lediglich bei 2 Kindern bleibt die Leistung gleich, ein Kind<br />
17
verschlechtert sich um einen Punkt. Da dieser Zugewinneffekt so deutlich zu Tage tritt und bei so gut wie allen<br />
Kindern zu beobachten ist, darf er in einen ursächlichen Zusammenhang mit dem <strong>Zahlenland</strong>konzept gebracht<br />
werden.<br />
Bei den KOKIS ist in Bezug auf mögliche Zugewinne wenig feststellbar. Bei den meisten Kindern bleiben die<br />
Leistungen nahezu unverändert, bei einigen gibt es allerdings etwas zu beobachten, was uns in dieser Stärke aus<br />
der Projektphase I nicht bekannt war. Sie verbessern sich leicht, und was noch auffälliger ist, einige<br />
verschlechtern sich z. T. auch.<br />
Beide Effekte scheinen mit Faktoren zusammenzuhängen, die unmittelbar in der Testsituation wirksam werden<br />
und die am ehesten mit dem Begriff Motivation resp. Leistungsmotivation zu belegen sein dürften. Die KOKIS<br />
in Projektphase II haben mehrheitlich einen deutlich problematischeren sozialen Hintergrund als die Kinder der<br />
Projektphase I und es war schwieriger, sie für die Testsituationen zu motivieren. Bei den PROKIS war dies<br />
zumindest beim Vortest ähnlich, beim Nachtest allerdings waren die Kinder fast ausnahmslos – auch dies ein<br />
Effekt des Programms – zur Teilnahme motiviert.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
3<br />
5<br />
prAD<br />
poAD<br />
7<br />
9<br />
PROKIS Anschauungsgebundenes Denken<br />
11<br />
13<br />
15<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
33<br />
35<br />
37<br />
39<br />
41<br />
43<br />
45<br />
18
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1<br />
3<br />
5<br />
prAD<br />
poAD<br />
7<br />
Verbale Fähigkeiten<br />
9<br />
KOKIS Anschauungsgebundenes Denken<br />
11<br />
13<br />
15<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
Bei den PROKIS sehen wir dasselbe Bild wie beim anschauungsgebundenen Denken, d. h. bis auf 3 Kinder gibt<br />
es zum Teil satte Zugewinne. Da auch diese Entwicklung quasi einheitlich verläuft, darf auch sie als<br />
Fördereffekt des „<strong>Zahlenland</strong>es“ angesehen werden.<br />
Die Instabilität der Testwerte der KOKIS, die sich zumindest bei einem Teil der Kinder bereits beim<br />
anschauungsgebundenen Denken gezeigt hat, wird bei den verbalen Fähigkeiten noch deutlicher. Dies ist<br />
allerdings nicht verwunderlich, denn sprachliche Leistungen zu erbringen setzt ein höheres Maß an Motivation<br />
voraus als dies bei den Aufgaben im Bereich AD der Fall ist.<br />
Festzuhalten bleibt dennoch, dass bei den KOKIS in keiner Weise ein gleichmäßiger Aufwärtstrend zu erkennen<br />
ist, wie wir dies bei den PROKIS konstatieren konnten.<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
33<br />
35<br />
37<br />
39<br />
41<br />
43<br />
45<br />
19
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
3<br />
3<br />
5<br />
5<br />
7<br />
Gesamtleistungen<br />
prVF<br />
poVF<br />
9<br />
prVF<br />
poVF<br />
7<br />
9<br />
11<br />
11<br />
13<br />
13<br />
15<br />
15<br />
PROKIS Verbale Fähigkeiten<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
KOKIS Verbale Fähigkeiten<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
Wie zu erwarten bestätigt sich im Gesamtergebnis bei den PROKIS der stabile und satte Aufwärtstrend. Es<br />
gibt nur ein einziges Kind, das sich leicht verschlechtert.<br />
Bedenkt man die Gesamtzahl der möglichen Punkte, dann gibt es bei den KOKIS überwiegend keine großen<br />
Veränderungen. Die Schwankungen nach unten und nach oben, die wir schon bei AD und VF festgestellt<br />
haben, gibt es logischerweise auch bei den Gesamtleistungen zu dokumentieren.<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
33<br />
33<br />
35<br />
35<br />
37<br />
37<br />
39<br />
39<br />
41<br />
41<br />
43<br />
43<br />
45<br />
45<br />
20
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
PROKIS Gesamtleistungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
3<br />
5<br />
7<br />
prGes<br />
poGes<br />
prGes<br />
poGes<br />
9<br />
11<br />
13<br />
KOKIS Gesamtleistungen<br />
15<br />
Veränderung der Messwertreihen<br />
Anschauungsgebundenes Denken<br />
17<br />
19<br />
21<br />
23<br />
25<br />
27<br />
29<br />
31<br />
33<br />
35<br />
37<br />
39<br />
41<br />
43<br />
45<br />
21
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
PKADpr<br />
KKADpr<br />
PKADpo<br />
KKADpo<br />
Anschauungsgebundenes Denken<br />
Quartilwerte im Vergleich<br />
Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4<br />
Sehr deutlich ist zu erkennen, dass sich bei den KOKIS die Quartilpunkte praktisch nicht verändern, d. h. sie<br />
liegen beim Post-Test quasi auf demselben Wert wie beim Pre-Test.<br />
Bei den PROKIS dagegen verändern sich alle Quartilwerte außer Q0. Zum Teil sind die Veränderungen<br />
beachtlich, sie dokumentieren eindrucksvoll die Zugewinne der gesamten Gruppe.<br />
Verbale Fähigkeiten<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
PKVFpr<br />
KKVFpr<br />
PKVFpo<br />
KKVFpo<br />
Verbale Fähigkeiten<br />
Quartilwerte im Vergleich<br />
Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4<br />
Auch hier ein ganz ähnliches Bild. Bei den KOKIS ist kaum eine Veränderung auszumachen (Q1 und Q4 fallen<br />
22
im Vergleich zum Pre-Test sogar leicht ab), bei den PROKIS sind positive Veränderungen bei allen, in<br />
erheblicher Größe bei den Quartilwerten 1–3 auszumachen.<br />
Gesamttestwerte<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
PKGpr<br />
KKGpr<br />
PKGpo<br />
KKGpo<br />
Gesamttest<br />
Quartilwerte im Vergleich<br />
Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4<br />
Wie zu erwarten bestätigen sich bei den Gesamtwerten die deutlichen Tendenzen aus AD und VF. Wesentliche<br />
Verschiebungen der Quartilpunkte (eindeutig nach oben) gibt es wiederum nur bei den PROKIS.<br />
9. Diskussion<br />
Die Projekterfahrungen zeigen, dass eine Altersdifferenzierung die Fördereffekte in unserem<br />
Projekt nicht begünstigen. Da sich sowohl in Phase I als auch in Phase II ähnlich positive<br />
Effekte bei den PROKIS eingestellt haben, war es offensichtlich unerheblich, ob innerhalb<br />
einer Gruppe Kinder mit ähnlichem oder ganz unterschiedlichem Lebensalter anzutreffen<br />
waren.<br />
Es scheint so, dass die „Welt der Mathematik“ bzw. die „Welt der Grundzahlen“ verbunden<br />
mit praktischen Könnenserfahrungen einen hohen Eigenmotivationswert für Kinder dieser<br />
Alterstufe besitzen.<br />
Der Fördereffekt<br />
Die Hinweise aus der Projektphase I, dass mit dem „<strong>Zahlenland</strong>“ quasi automatisch auch eine<br />
Sprachförderung stattzufinden scheint, können mit den Zahlen der Projektphase II<br />
eindrucksvoll als belegt angesehen werden.<br />
Die Aussage, dass das <strong>Zahlenland</strong>konzept ein umfassendes Förderprogramm ist, welches<br />
nicht nur auf die Entwicklung des Zahlbegriffs bei Kindern reduziert werden darf, gewinnt<br />
mit Blick auf die Projektphase II immer mehr an Gewicht. Hätten wir geeignete Testaufgaben<br />
auch für andere Bereiche (z. B. Rhythmus) gefunden, so wäre es nicht erstaunlich gewesen,<br />
wenn auch in diesen Bereichen die PROKIS im Gegensatz zu den KOKIS „zugelegt“ hätten.<br />
Nimmt man die Ergebnisse der beiden Projektphasen zusammen, müssen wir festhalten, dass<br />
durch die Arbeit mit dem „<strong>Zahlenland</strong>“ neben spezifischen (z. B. Zahlbegriff, Mengen- und<br />
23
Formauffassung) auch ganz allgemeine (z. B. Sprachförderung) Fördereffekte zustande<br />
kommen. Diese Effekte können mit dem vorgestellten Untersuchungsdesign ganz eindeutig<br />
belegt werden.<br />
Im Gegensatz zu vielen Projekten im Bereich der Pädagogik, deren Effizienz zwar behauptet<br />
oder durch Befragungen der Beteiligten „belegt“ werden, haben wir hier „harte Daten“<br />
(Testergebnisse) vorgelegt, die es erlauben, die Hypothese eines mehrfachen<br />
Fördereffektes aufrecht erhalten zu können. Nicht mehr, aber auch nicht weniger können<br />
wir aufgrund der empirischen Datenlage aussagen.<br />
10. Effektivität<br />
Zur Frage der Effektivität des <strong>Zahlenland</strong>konzeptes sollte bedacht werden, in welch kurzer<br />
Zeit sich die dargestellten Erfolge abzeichneten. Das <strong>Zahlenland</strong>programm wurde in 11<br />
Wochen durchgeführt (aufgrund von Ferien- oder Feiertagen verlängerte sich der geplante<br />
10-wöchige Förderzeitraum in beiden Projektkindergärten um genau eine Woche). Auch<br />
wurden in den Einzelstunden in Gruppen mittlerer Größe (9 bis 15 Kindern) und dabei sowohl<br />
in altersgruppierten Gruppen (3- bis 4-Jährige, 4- bis 5-Jährige und 5- bis 6-Jährige in der<br />
ersten Phase) als auch altersgemischten Gruppen (in der zweiten Phase) gearbeitet.<br />
Offensichtlich hatte die Variable der Gruppenzusammensetzung nach spezifischen<br />
Altersklassen oder in altersgemischten Gruppen keinen nennenswerten Einfluss auf die<br />
erzielten Ergebnisse.<br />
Die nachgewiesenen Lernzuwächse ereigneten sich insofern in beachtlich kurzer Zeit und<br />
dabei in Gruppengrößen, die in Kindergärten realisierbar sind.<br />
Nimmt man zu den empirischen Befunden die Ergebnisse der Akzeptanzbefragungen hinzu,<br />
so scheint uns das Förderkonzept auch unter Effektivitätsaspekten gut geeignet, in den Kanon<br />
elementarpädagogischer Bildungsmaßnahmen aufgenommen zu werden, denn es zeigt<br />
deutliche Fördereffekte, es wird gut angenommen und erscheint den Erzieherinnen und<br />
Erziehern für den ganz normalen Kindergartenalltag tauglich. Dieser Aspekt kann nicht stark<br />
genug betont werden, denn eine ganze Reihe von Trainingsprogrammen funktioniert leider<br />
nur unter „Laborbedingungen“, bzw. der Transfer auf die Alltagssituation z. B. in der Schule<br />
gelingt nur sehr unvollkommen.<br />
11. Ausblick<br />
In der sich nun anschließenden dritten Projektphase ist unter anderem vorgesehen, die<br />
teilnehmenden Kinder in der Grundschule wissenschaftlich zu begleiten und zu klären, ob sie<br />
in der Schule besser zurechtkommen als Kinder, die nicht mit diesem Konzept gefördert<br />
worden sind. (Evaluation in Bezug auf den Übergang in die Grundschule und in Bezug auf die<br />
Nachhaltigkeitswirkung der erzielten Ergebnisse). Bezüglich des Übergangs in die<br />
Grundschule ist die Hypothese dabei die, dass die geförderten Kinder aufgrund ihres<br />
Wissensvorsprungs einen nachhaltigen schulischen Vorteil haben werden. Es spricht vieles<br />
dafür, dass das kulturelle Wissen, welches Kinder bereits mit in die Schule bringen, eine der<br />
wichtigsten Größen dafür ist, wie erfolgreich die weitere Schulkarriere verlaufen wird.<br />
24
Weiter sollen zwei Kindergärten im Gesamt verglichen werden: der zentrale<br />
Projektkindergarten, in dem das Konzept zum steten Bestandteil täglicher Arbeit geworden<br />
ist, und ein Kontrollkindergarten, bei dem dies nicht der Fall ist.<br />
Eine konzeptionelle Weiterentwicklung (z. B. mit Mathematik im Freien bzw. im Pausenhof)<br />
und inhaltliche Ausdehnung des gesamten Projektes (z. B. auch im Hinblick auf Team- bzw.<br />
Sozialkompetenz) ist steter Bestandteil der weiteren Verwirklichung.<br />
25
Veröffentlichungen zum Thema<br />
Friedrich, G. (2003). Die Zahlen halten Einzug in den Kindergarten. Ein Projekt zur<br />
mathematischen Frühförderung. In: Herder Verlag; Kindergarten heute, Januar (S.<br />
34–40).<br />
Friedrich, G. u. Bordihn, A. (2003). Spot: So geht´s – Spaß mit Zahlen und Mathematik im<br />
Kindergarten. Sonderheft der Zeitschrift „kindergarten heute“. Freiburg: Herder Verlag.<br />
Friedrich, G. (2003). Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>. Wo Kinder spielend Mathematik lernen. In:<br />
Forum Schule, Landesinstitut für Schule NRW, Ausgabe 2/2003 (S. 27).<br />
Friedrich, G. (2004). Die Brücke von zwei Seiten her bauen. Was kann die Neurodidaktik der<br />
Erziehung bieten? In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik. Ausgabe 2/2004 (S.<br />
36–38).<br />
Friedrich, G. u. Galgóczy, V. (2004). Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>. Eine spielerische Entdeckungsreise<br />
in die Welt der Mathematik. Freiburg: Christophorus.<br />
Friedrich, G. u. Munz, H. (2004). Mit den Zahlen auf Du und Du. Vorschulkinder entdecken<br />
das <strong>Zahlenland</strong>. In: Magazin Schule, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW,<br />
Frühjahr 2004 (S. 24–25).<br />
Friedrich, G. u. Munz, H. (2004). <strong>Zahlenland</strong> im Kindergarten. Ein ganzheitliches<br />
Förderkonzept am Beispiel elementarer Mathematik. In: KiTa aktuell; NRW, Ausgabe.<br />
4/2004 (S. 86–89).<br />
Internetseite: www.kuhbach.de (Link: <strong>Zahlenland</strong> im Kindergarten)<br />
Berichte in der Presse<br />
Die ZEIT; Nr. 40/03. Im Land der märchenhaften Zahlen.<br />
Gehirn & Geist; Nr. 4/2003. (Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung). Spektrum<br />
der Wissenschaft. Reportage: Zahlenspiele im Kindergarten.<br />
Gesundheit (Apothekenzeitschrift); September 2003. Mit Mathe auf Du und Du. Reportage<br />
über ein badisches Modellprojekt.<br />
Frankfurter Rundschau; Nr. 257/2003). Geh’ zur Drei. Warten auf den Zahlenmann.<br />
Spielen und lernen (Die Zeitschrift für Eltern und Kinder); März 2004. Reportage: Spielend<br />
lernen im <strong>Zahlenland</strong>.<br />
Badische Zeitung; 24.06.04. Meine Freunde leben im <strong>Zahlenland</strong>. In Kuhbach beschäftigen<br />
sich Kindergartenkinder seit eineinhalb Jahren mit Mathematik – und zeigen<br />
erstaunliche Resultate.<br />
Mittelbadische Presse; 29.06.04. Die Eins trägt eine Zipfelmütze. Mit dem Projekt „Komm<br />
mit ins <strong>Zahlenland</strong>“ soll Kindern der Mathematik-Zugang erleichtert werden.<br />
Schwarzwälder Bote; 23.07.04. Schritt für Schritt hinein ins <strong>Zahlenland</strong>. Schon die Kleinsten<br />
Lernen in Lahr spielerisch die Mathematik kennen / Bundesweit einzigartiges Projekt.<br />
Landesschau aktuell Baden-Württemberg; 27.07.04. Kurzreportage in den<br />
Landesnachrichten<br />
Die lokale Presse (Lahrer Zeitung, Offenburger Tageblatt und Badische Zeitung) hat<br />
mehrfach und umfangreich über das Projekt informiert.<br />
Kontakt<br />
Email: friedrich-lahr@t-online.de und Horst.Munz@ifk.kv.bwl.de oder<br />
Kiga.Kubach@gmx.de<br />
26
Kindergarten Kuhbach; Frau Schönle-Walter; Schulstraße 4; 77933 Lahr<br />
Anhang:<br />
Wie bereits erwähnt, folgen nun die Fragebogen, die den Eltern („Fragen an die Eltern“)<br />
und den Erzieherinnen und Erziehern („Fragen an die Erzieherinnen und Erzieher“)<br />
vorgelegt wurden.<br />
OBERSCHULAMT FREIBURG<br />
– Schulpsychologische Beratungsstelle in Offenburg –<br />
„Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“<br />
Fragen an die Eltern<br />
Liebe Eltern,<br />
wir bitten Sie, pro Frage jeweils nur eine für Sie zutreffende Antwort anzustreichen.<br />
1. Befürworten Sie es, wenn im Kindergarten das Projekt „Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“<br />
durchgeführt wird?<br />
ja teilweise nein<br />
2. Hat Ihnen Ihr Kind zu Hause von diesem Projekt erzählt?<br />
ja ein wenig nein<br />
Kinder sind unterschiedlich, die einen erzählen oft, andere seltener und wieder andere so gut<br />
wie nie etwas davon, was sie im Kindergarten erlebt haben.<br />
Zu welcher Gruppe gehört Ihr Kind eher?<br />
es erzählt oft es erzählt selten es erzählt nie<br />
3. Wenn Ihnen Ihr Kind etwas von seinen Erlebnissen im Projekt erzählt hat, waren die<br />
Schilderungen positiv?<br />
ja teilweise nein<br />
4. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind Dinge gelernt hat, die auf die Schule vorbereiten?<br />
ja teilweise nein<br />
27
5. Haben Sie den Eindruck, dass Ihrem Kind die Teilnahme am Projekt gut getan hat?<br />
ja teilweise nein<br />
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!<br />
OBERSCHULAMT FREIBURG<br />
– Schulpsychologische Beratungsstelle in Offenburg –<br />
„Komm mit ins <strong>Zahlenland</strong>“<br />
Fragen an die Erzieherinnen und Erzieher<br />
Wir bitten Sie, pro Frage jeweils eine für Sie zutreffende Antwort anzustreichen.<br />
1. Das Projekt stellt den Versuch dar, Kindern eine positive Herangehensweise an<br />
Mathematik zu ermöglichen.<br />
Glauben Sie, dass der Projektansatz diesem Anspruch gerecht wird?<br />
ja teilweise nein<br />
2. Ist das Konzept für Sie schlüssig und verständlich?<br />
ja teilweise nein<br />
3. Lässt das Konzept genügend Freiraum, auch eigene Ideen umzusetzen?<br />
ja teilweise nein<br />
4. Hat Ihnen die Durchführung Spaß gemacht?<br />
ja teilweise nein<br />
5. Halten Sie die Durchführung des Konzeptes auch im Alltag Ihrer Einrichtung für möglich?<br />
ja teilweise nein<br />
6. Erlebten Sie das Projekt als eine Bereicherung Ihrer pädagogischen Arbeit?<br />
28
ja teilweise nein<br />
7. Würden Sie das Konzept gerne zu einem beständigen Teil Ihrer Arbeit machen?<br />
ja teilweise nein<br />
8. Fällt es Ihnen leicht, das Konzept weiter zu empfehlen?<br />
ja teilweise nein<br />
9. Die meisten Kinder waren mit Freude bei der Sache.<br />
ja nein<br />
10. Die meisten Kinder werden durch das Konzept für Zahlen in der Umwelt sensibilisiert.<br />
ja nein<br />
11. Die meisten Kinder haben über ein mathematisches Grundverständnis hinausgehend<br />
auch ganz allgemeine (Lern-)Fortschritte gemacht (z. B. Wahrnehmung, Konzentration,<br />
Sprache, Selbstbewusstsein etc.).<br />
ja nein<br />
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!<br />
29