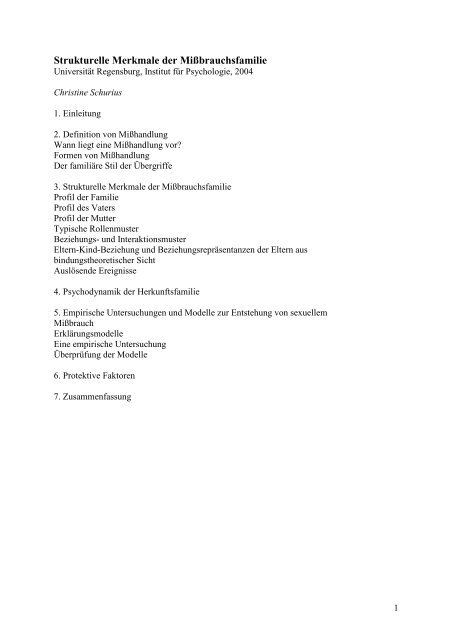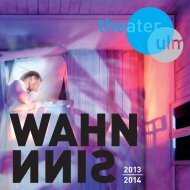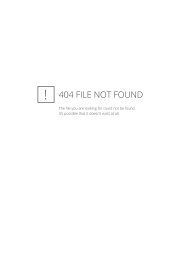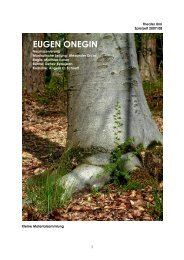Strukturelle Merkmale der Missbrauchsfamilie - Theater Ulm
Strukturelle Merkmale der Missbrauchsfamilie - Theater Ulm
Strukturelle Merkmale der Missbrauchsfamilie - Theater Ulm
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Strukturelle</strong> <strong>Merkmale</strong> <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie<br />
Universität Regensburg, Institut für Psychologie, 2004<br />
Christine Schurius<br />
1. Einleitung<br />
2. Definition von Mißhandlung<br />
Wann liegt eine Mißhandlung vor?<br />
Formen von Mißhandlung<br />
Der familiäre Stil <strong>der</strong> Übergriffe<br />
3. <strong>Strukturelle</strong> <strong>Merkmale</strong> <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie<br />
Profil <strong>der</strong> Familie<br />
Profil des Vaters<br />
Profil <strong>der</strong> Mutter<br />
Typische Rollenmuster<br />
Beziehungs- und Interaktionsmuster<br />
Eltern-Kind-Beziehung und Beziehungsrepräsentanzen <strong>der</strong> Eltern aus<br />
bindungstheoretischer Sicht<br />
Auslösende Ereignisse<br />
4. Psychodynamik <strong>der</strong> Herkunftsfamilie<br />
5. Empirische Untersuchungen und Modelle zur Entstehung von sexuellem<br />
Mißbrauch<br />
Erklärungsmodelle<br />
Eine empirische Untersuchung<br />
Überprüfung <strong>der</strong> Modelle<br />
6. Protektive Faktoren<br />
7. Zusammenfassung<br />
1
1. Einleitung<br />
In Deutschland hat die Fachwelt erst ab den 70er Jahren begonnen, sich mit dem Thema <strong>der</strong><br />
Kindesmißhandlung in Familien zu beschäftigen. Man hat festgestellt, daß man diese<br />
Problematik nicht unter den Bereich „Asozialität“ fallen lassen kann, die bei „normalen“<br />
Familien nicht auftritt (Hirsch, 1994). Es wurde erkannt, daß die körperliche Mißhandlung<br />
von Kin<strong>der</strong>n in allen Schichten vorkommen kann. Der Mißbrauch von Kin<strong>der</strong>n ist somit als<br />
gesamtgesellschaftliches Problem anzusehen. Mittlerweile ist <strong>der</strong> sexuelle Mißbrauch<br />
enttabuisiert und fast schon zu einem Modethema geworden, zumindest in den Medien und in<br />
<strong>der</strong> Forschung. Die betroffenen Familien treten damit aber nach wie vor nicht gerne an die<br />
Öffentlichkeit. Vielen Studien zu Folge wird mit einer hohen Dunkelziffer bei <strong>der</strong> Häufigkeit<br />
von sexuellem Mißbrauch gerechnet. Es zeigte sich, daß vor allem <strong>der</strong> Mißbrauch innerhalb<br />
<strong>der</strong> Familie aufgrund von Scham o<strong>der</strong> Furcht oft nicht angezeigt wird (Russell, 1986; Drajer,<br />
1990, zitiert nach Engfer, 1992).<br />
Die ökonomischen Kosten von Kindesmißhandlung sind beträchtlich, Cicchetti und Olsen<br />
(1990, zitiert nach Dornes, 1997) schätzen sie auf Milliarden Dollar in den USA. Doch als<br />
schwerwiegen<strong>der</strong> sind wohl die „menschlichen Kosten“ zu beurteilen, die durch die<br />
Mißhandlung von Kin<strong>der</strong>n entstehen. Bei den Opfern besteht ein erhöhtes Risiko für<br />
Delinquenz, Drogenabhängig o<strong>der</strong> Aggressivität und Persönlichkeitsstörungen (a.a.O., S. 78).<br />
Auch die an<strong>der</strong>en Familienmitglie<strong>der</strong> erkranken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit<br />
seelisch o<strong>der</strong> körperlich, als die Normalbevölkerung (Joraschky, 1997)<br />
Es ist wichtig, daß sich die Gesellschaft dieser Problematik stellt und sie nicht einfach<br />
verdrängt. Viele Untersuchungen haben gezeigt, daß die therapeutische Behandlung von<br />
Mißbrauchsopfern und <strong>der</strong>en Familien enorme Erfolge bei <strong>der</strong> Bewältigung dieser Erlebnisse<br />
erzielen kann.<br />
Um Interventions- und Präventionsprogramme sinnvoll und effektiv gestalten zu können, ist<br />
es notwendig die Hintergründe und Auslöser für ein solches Geschehen zu kennen. Die<br />
folgende Arbeit beschäftigt sich mit den strukturellen <strong>Merkmale</strong>n in den Mißbrauchsfamilien.<br />
Zunächst werden Definitionen und Formen <strong>der</strong> Mißhandlung dargestellt, es wird auf die<br />
strukturellen <strong>Merkmale</strong> <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie und <strong>der</strong> Herkunftsfamilie <strong>der</strong> Eltern<br />
eingegangen. Modelle zur Entstehung des sexuellen Mißbrauchs und auch protektive Faktoren<br />
innerhalb <strong>der</strong> Familie werden vorgestellt.<br />
2. Definition von Mißhandlung<br />
Damit eine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema Kindesmißhandlung möglich ist,<br />
muß zunächst <strong>der</strong> Mißhandlungsbegriff genauer definiert werden. Im folgenden wird jeweils<br />
eine Definition für Kindesmißhandlung und eine für sexuellen Mißbrauch dargestellt.<br />
„Kindesmißhandlung ist eine gewaltsame psychische o<strong>der</strong> physische Beeinträchtigung von<br />
Kin<strong>der</strong>n durch Eltern o<strong>der</strong> Erziehungsberechtigte. Diese Beeinträchtigungen können durch<br />
elterliche Handlungen ( wie bei körperlicher Mißhandlung, sexuellem Mißbrauch) o<strong>der</strong><br />
Unterlassungen ( wie bei emotionaler und physischer Vernachlässigung) zustande kommen.„<br />
(Engfer, 1992, S. 960)<br />
„Unter sexuellem Mißbrauch versteht man die Beteiligung noch nicht ausgereifter Kin<strong>der</strong> und<br />
Jugendlicher an sexuellen Aktivitäten, denen sie nicht verantwortlich zustimmen können, weil<br />
sie <strong>der</strong>en Tragweite noch nicht erfassen. Dabei benutzen bekannte o<strong>der</strong> verwandte ( meist<br />
männliche) Erwachsene, Kin<strong>der</strong> zur eigenen sexuellen Stimulation und mißbrauchen das<br />
vorhandene Macht- o<strong>der</strong> Kompetenzgefälle zum Schaden des Kindes.„ (Engfer, 1992, S.<br />
1006)<br />
2
Wann liegt eine Mißhandlung vor?<br />
Diese Frage hängt unter an<strong>der</strong>em vom Alter des Kindes ab. Laut Engfer (1986, zitiert nach<br />
Dornes, 1997) und Dornes (1997) ist bei Säuglingen und Kleinkin<strong>der</strong>n jede körperliche<br />
Bestrafung als Mißhandlung anzusehen, da <strong>der</strong> Organismus in diesem Alter bekanntermaßen<br />
äußerst empfindlich ist. Dagegen liegt bei älteren Kin<strong>der</strong>n dann eine physische Mißhandlung<br />
vor, „wenn nachweisbar ist, daß Kin<strong>der</strong> von ihren Eltern wie<strong>der</strong>holt und immer wie<strong>der</strong><br />
ausufernd gezüchtigt werden“ (Engfer 1986, S.10, zitiert. nach Dornes 1997). Eine leichte<br />
Bestrafungsform, wie <strong>der</strong> „Klapps auf den Po“, bei älteren Kin<strong>der</strong>n wird von Dornes (1997)<br />
nicht als Mißhandlungsform gesehen, son<strong>der</strong>n als Ausdruck situativer Überfor<strong>der</strong>ung, falls<br />
ansonsten eine liebevolle Beziehung besteht.<br />
Formen von Mißhandlung<br />
Es existieren verschiedene Formen von Mißhandlungen. Häufig werden folgende vier<br />
unterschieden (Dornes, 1997):<br />
Physische Mißhandlung: körperliche Bestrafung<br />
Emotionale Mißhandlung: z.B. durch Drohungen, ständiger Kritik o<strong>der</strong> Einsperren<br />
Vernachlässigung: körperliche und seelische Bedürfnisse werden vernachlässigt<br />
Sexueller Mißbrauch: z.B. Inzest, Anleistung zur Prostitution<br />
In folgen<strong>der</strong> Arbeit soll es um den sexuellen Mißbrauch gehen und dabei hauptsächlich um<br />
den innerfamiliären Mißbrauch, deshalb wird synonym für sexuellen Mißbrauch auch <strong>der</strong><br />
Begriff Inzest verwendet.<br />
Der familiäre Stil <strong>der</strong> Übergriffe<br />
Mißhandlungen können nicht nur verschieden Formen annehmen, son<strong>der</strong>n auch<br />
unterschiedlich motiviert sein. Larson und Maddock (1986, zitiert nach Joraschky, 1997)<br />
unterscheiden folgende Klassen von „Inzestfamilien“:<br />
Zuneigungs-Mißbrauch: In solchen Familien hat <strong>der</strong> Inzest die Funktion von<br />
Zuneigungsaustausch, körperliche Mißhandlungen finden nicht statt. Für diesen häufigsten<br />
Inzesttyp besteht eine sehr günstige Prognose.<br />
Erotik-Mißbrauch: In diesen Familien sind viele Bereiche stark sexualisiert. Die<br />
Familienmitglie<strong>der</strong> sehen Sexualität in <strong>der</strong> Familie als selbstverständlich an. Auch hier<br />
bestehen gute Chancen auf Besserung.<br />
Macht-Mißbrauch: Hier hat <strong>der</strong> sexuelle Mißbrauch eine feindselige Funktion, er findet als<br />
Ausdruck von Strafe und Erniedrigung statt. Es kommen auch körperliche Mißhandlungen<br />
vor. Inzest unter Geschwistern tritt hauptsächlich bei diesem Familientyp auf. Die Prognosen<br />
sind weniger gut.<br />
Gewalt-Mißbrauch: Der sexuelle Übergriff findet in Form von Vergewaltigung und oft auf<br />
sadistische Weise statt. Zudem wird körperliche Gewalt angewendet. Die Täter sind häufig<br />
psychopathologisch auffällig. Es besteht wenig Aussicht auf Besserung in diesen Familien.<br />
Summit und Kryso (1978, zitiert nach Hirsch, 1994) nehmen eine noch genauere<br />
Klassifizierung vor. Sie unterscheiden zehn Erscheinungsformen von Inzest:<br />
- Zufälliger sexueller Kontakt in <strong>der</strong> Familie<br />
- Die Ideologie, sexueller Kontakt sei gut für das Kind<br />
-Psychotische Reaktion <strong>der</strong> Erwachsenen<br />
- Isolation von sozialen Gruppen<br />
- Wahrer endogamischer Inzest<br />
- Frauenfeindlicher Inzest<br />
- „Imperious incest„<br />
3
- Pädophilie<br />
- Vergewaltigung des Kindes<br />
- „Perverser Inzest“<br />
3. <strong>Strukturelle</strong> <strong>Merkmale</strong> <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie<br />
Sexueller Mißbrauch innerhalb <strong>der</strong> Familie verursacht die schwerwiegendsten Folgen<br />
unter allen familiären Problematiken. Sexueller Mißbrauch kann nicht anhand eines einfachen<br />
Ursache-Wirkungsmodells erklärt werden, vielmehr ist er als multifaktoriell bedingtes<br />
Geschehen anzusehen (Dornes, 1997). Der wichtigste Bedingungsfaktor für das<br />
Zustandekommen von Mißbrauchshandlungen ist die Struktur und Psychodynamik, die in <strong>der</strong><br />
Familie vorherrscht. Ob letztendlich ein Übergriff stattfindet o<strong>der</strong> nicht, hängt aber nicht nur<br />
von familiären son<strong>der</strong>n auch von situativen Faktoren ab. Deshalb sollen auch auslösende<br />
Ereignisse, obwohl sie nicht zu den strukturellen <strong>Merkmale</strong>n <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie zählen,<br />
am Ende dieses Abschnitts angesprochen werden.<br />
Profil <strong>der</strong> Familie<br />
Weinberg hat 1955 erstmals Zuordnungen von Inzestfamilien zu bestimmten Familientypen<br />
vorgenommen. Inzwischen weiß man, daß Mißbrauchsopfer vorwiegend aus <strong>der</strong> sog.<br />
„endogamen Familie„ stammen, 40% (Braun-Scharm und Frank, 1989, zitiert nach Joraschky,<br />
1997) bis 80% (Justice und Justice, 1979, zitiert nach Joraschky, 1997) werden zu diesem Typ<br />
gezählt. Diese Familien wirken unauffällig und sozial angepasst. Nach Außen verhärten sie<br />
die Grenzen, innerhalb <strong>der</strong> Familie gibt es dafür keine Grenzen. Unter den<br />
Familienmitglie<strong>der</strong>n herrscht ein gespannter Zusammenhalt mit Konfliktvermeidung,<br />
Verlassenheits- und Desintegrationsängsten. Bedürfnisse nach seelischer und körperlicher<br />
Wärme werden sexualisiert. In zahlreichen Studien hat sich die soziale Isolation <strong>der</strong> Familie<br />
als ein Hauptprädiktor für sexuelle Übergriffe erwiesen (Finkelhor, 1978; Sgroi, 1982;<br />
Mrazek & Kempe, 1981, zitiert nach Joraschky, 1997). Eine Schichtspezifität konnte nicht<br />
bestätigt werden, dafür aber Hinweise auf stereotype Rollenbil<strong>der</strong> bei den<br />
Familienmitglie<strong>der</strong>n (Herman & Hirschman, 1981, zitiert nach Joraschky, 1997).<br />
Profil des Vaters<br />
Auch über den typischen mißbrauchenden Vater kann man aufgrund zahlreicher Studien ein<br />
Profil erstellen. 85% dieser Väter passen in „das Bild des passiven, emotional und sozial<br />
abhängigen Täters“ (Joraschky, 1997, S. 81). Sie sind zwar sozial unauffällig, haben aber<br />
Schwierigkeiten bei Beziehungen mit erwachsenen Frauen (a.a.O., S. 81). Laut Mrazek und<br />
Bentovim (1981) und Rosenfeld (1979) sind diese Männer introvertiert, schüchtern und<br />
nehmen eine enge Beziehung mit <strong>der</strong> Tochter auf, da sie sich <strong>der</strong> gewachsen fühlen (a.a.O., S.<br />
81). 15% <strong>der</strong> Täter kann man dem tyrannischen Typus zuordnen. Sie sehen die<br />
Familienmitglie<strong>der</strong> als ihren Besitz und Gewalt als legitimes Mittel, um ihre Macht<br />
durchzusetzen (a.a.O., S. 81). Als weitere Charakteristika für die Täter wurden narzisstische<br />
Defizite, ein fragiles Selbstbewusstsein, mangelnde emotionale Identifikation und Unfähigkeit<br />
zu Empathie festgestellt (a.a.O, S. 81.).<br />
Profil <strong>der</strong> Mutter<br />
Außerdem wurden typische Charakterzüge von betroffenen Müttern analysiert. In den 60er<br />
Jahren entstand zum einen das Profil <strong>der</strong> dominanten Mutter, die sich kalt und aggressiv<br />
zeigte, zum an<strong>der</strong>en das <strong>der</strong> submissiven Mutter, die sich durch Masochismus und<br />
Abhängigkeit auszeichnete. Mittlerweile findet man häufig die „silent“- Mutter, die nur<br />
4
unbewusst die Tochter ausgrenzt und die unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen kann,<br />
vom Bagatellisieren bis hin zu aktiven Schutzmaßnahmen (Joraschky, 1997).<br />
Typische Rollenmuster<br />
Neben den Charakteristika <strong>der</strong> Eltern von Mißbrauchsopfern hat man sich auch mit<br />
typischen Beziehungsstrukturen und Rollenmustern in Mißbrauchsfamilien beschäftigt.<br />
Joraschky (1997) beschreibt folgende Typen:<br />
Die Vater-Exekutive: In dieser Familie ist <strong>der</strong> Vater die dominanteste und mächtigste Person.<br />
Die Mutter wird wie ein Kind behandelt. Sie ist vom Vater abhängig und fühlt sich deshalb<br />
erleichtert, wenn die Tochter viele ihrer Funktionen übernimmt.<br />
Die Mutter-Exekutive: Hier hält die Mutter die dominante und mächtige Position inne. Der<br />
Vater zeigt jugendliches Verhalten und pflegt sexuelle Kontakte zu seiner Tochter, die wie<br />
Spielereien unter Geschwistern scheinen.<br />
Die chaotische Struktur: In dieser Familie befinden sich alle Mitglie<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> selben<br />
Generationsebene. Niemand übernimmt hier Verantwortung. Es können auch sexuelle<br />
Kontakte unter den Geschwistern auftreten.<br />
Der entfremdete Vater: Zwischen dem Vater und <strong>der</strong> Familie besteht eine emotionale Distanz.<br />
Er nähert sich <strong>der</strong> Familie auf Generationsebene <strong>der</strong> Tochter an. Sein Verhalten ist for<strong>der</strong>nd<br />
und aggressiv.<br />
Stieffamilien: Bei diesen Familien besteht ein erhöhtes Risiko für sexuelle Übergriffe, laut<br />
Finkelhor (1980) besteht eine fünfmal größere Wahrscheinlichkeit als in an<strong>der</strong>en Familien.<br />
Erklärbar ist dies durch die geringere Eltern-Kind-Bindung vom Säuglingsalter an. Außerdem<br />
herrschen häufiger gestörte Strukturen, da solche Familien weniger Zeit hatten, ein<br />
funktionales System zu entwickeln.<br />
Beziehungs- und Interaktionsmuster<br />
Hehl und Werkle (1993) haben anhand einer retrospektiven Studie die Beziehungsstrukturen<br />
in Mißbrauchsfamilien untersucht und mit „normalen“ Familien verglichen. Als signifikant<br />
fanden sie die geringe Durchsetzungsfähigkeit des Mißbrauchssopfers innerhalb <strong>der</strong> Familie.<br />
Für die Beziehungsintensitäten unter den Familienmitglie<strong>der</strong>n ergaben sich keine bedeutenden<br />
Unterschiede. Auffällig war die geringe positive Zuwendung <strong>der</strong> Mutter zum<br />
Mißbrauchsopfer. Die Beziehung <strong>der</strong> Eltern ist gespaltener und von stärkeren<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen geprägt, als in Familien ohne Mißbrauch. Madonna et al. (1991, zitiert<br />
nach Joraschky, 1997) untersuchten die interaktionellen Muster von Inzestfamilien mit dem<br />
Beavers-Timberlan-Familiy-Evaluation-Scale und verglichen sie mit Nicht-Inzestfamilien.<br />
Bei den Mißbrauchsfamilien fanden sie undefinierte Grenzen, Rollen- und<br />
Aufgabenverteilungen, starre Grenzen nach Außen, vermin<strong>der</strong>te Offenheit, Akzeptanz und<br />
Empathie, eine schwache Koalition <strong>der</strong> Eltern. Die Annäherung und Distanzierung zwischen<br />
den Familienmitglie<strong>der</strong>n ist eingeschränkt, elterliche Fürsorge erfolgt vor allem sexualisiert.<br />
Typisch für diese Familien sind Konfliktvermeidung und Probleme mit <strong>der</strong> Kommunikation<br />
und Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen.<br />
Eltern-Kind-Beziehung und Beziehungsrepräsentanzen <strong>der</strong> Eltern aus bindungstheoretischer<br />
Sicht<br />
Auch die Bindungsforschung hat sich mit typischen Verhaltensweisen mißhandeln<strong>der</strong> Eltern<br />
beschäftigt. Kropp und Haynes (1987, zitiert nach Dornes, 1997) betonen die Probleme <strong>der</strong><br />
Eltern, Emotionen im Gesichtsausdruck des Säuglings zu erkennen und ihre Angewohnheit,<br />
negative Emotionen als positive zu interpretieren. In einer Studie von Frodi und Lamb (1980)<br />
5
eagierten mißhandelnde Mütter mit mehr Aversion und Stress beim Anblick schreien<strong>der</strong><br />
Säuglinge als die Kontrollgruppe. Erstaunlicherweise zeigten sie auch beim Anblick<br />
lächeln<strong>der</strong> Babys Stress (a.a.O., S. 73). Auch Bauer und Twentyman (1985) stellen eine<br />
„generelle Übererregbarkeit mißhandeln<strong>der</strong> Eltern“ im Umgang mit Kin<strong>der</strong>n fest (a.a.O., S.<br />
73). Dornes (1997) vermutet, daß unmittelbar vor <strong>der</strong> Mißhandlung Hilflosigkeit, Ohnmacht<br />
und Wut, die bei den Eltern vorherrschenden Affekte sind. Laut Herrenkohl und Herrenkohl<br />
(1979) beschreiben Eltern ihr mißhandeltes Kind negativer als ein nicht mißhandeltes<br />
Geschwister (a.a.O., S. 73). Weiterhin sehen mißhandelnde Eltern ihre Kin<strong>der</strong> als schwieriger<br />
und charakterlich negativer, als nicht mißhandelnde (a.a.O., S. 73). Man kann also von einer<br />
Wahrnehmungsverzerrung dieser Eltern sprechen, aus psychoanalytischer Sicht entsteht diese<br />
durch die Projektion negativer Selbstanteile auf das Kind (Steele und Pollock 1968,<br />
a.a.O., S. 74).<br />
Interessant ist es auch, die Beziehungsrepräsentanz mißhandeln<strong>der</strong> Eltern zu betrachten.<br />
Bisher gibt es nur wenige Studien dazu. Crittenden et al. (1991) haben ein modifiziertes<br />
Erwachsenenbindungsinterview bei solchen Eltern durchgeführt (a.a.O., S.75).<br />
Mißhandelnde Eltern wurden dabei v.a. als „distanziert“ klassifiziert. Das heißt, sie haben viel<br />
verdrängt und erinnern sich nur wenig an die Vergangenheit. Ihr Erzählstil ist inkohärent,<br />
inkonsistent und nicht flüssig. Vernachlässigende Eltern und solche, die sowohl<br />
vernachlässigten, als auch mißhandelten, wurden vorwiegend als „verstrickt“ eingestuft. Die<br />
Erzählungen dieser Personen sind geprägt von einem tiefsitzenden Groll und <strong>der</strong> Neigung,<br />
den Eltern alles recht machen zu wollen. Diese Leute scheinen ihre Vergangenheit noch nicht<br />
bewältigt zu haben.<br />
Auslösende Ereignisse<br />
In einer Vielzahl von inzestuösen Übergriffen findet vor <strong>der</strong> Tat Alkohol- o<strong>der</strong><br />
Drogenmißbrauch statt (Cole und Putnam 1992; Finkelhor 1978; Maisch 1972; Virkkunen<br />
1974, zitiert nach Joraschky, 1997, S. 83). Dabei ist <strong>der</strong> Rauschzustand nicht<br />
als Ursache des Mißbrauchs zu sehen, son<strong>der</strong>n als enthemmen<strong>der</strong> Faktor. Er reduziert<br />
die Hemmschwelle beim Vater einer ohnehin Inzestgefährdeten Familie (Finkelhor 1984,<br />
a.a.O., S. 84). Für das Zustandekommen von Mißbrauchshandlungen ist außerdem <strong>der</strong><br />
„Gelegenheitsfaktor“ enorm wichtig. Dieser Faktor spielt bei gefährdeten Familie eine Rolle,<br />
wenn die Mutter über einen längeren Zeitraum abwesend ist und Vater und Tochter alleine<br />
sind (a.a.O., S.84). Auch akuter Stress in <strong>der</strong> Familie kann als auslösendes Ereignis gesehen<br />
werden (a.a.O., S. 84). Wenn beispielsweise ein Familienmitglied den Arbeitsplatz verliert,<br />
eine schwerwiegende Krankheit auftritt o<strong>der</strong> sich die Familienzusammensetzung än<strong>der</strong>t, kann<br />
dies zur enormen Belastung für die gesamte Familie werden.<br />
4. Psychodynamik <strong>der</strong> Herkunftsfamilie<br />
Um die Entstehungsbedingungen für sexuellen Mißbrauch analysieren zu können, reicht es<br />
nicht aus, nur die Eltern des Opfers zu betrachten. Man muss auch einen Blick auf die<br />
Herkunftsfamilie <strong>der</strong> Eltern richten. Wie oben dargestellt, existieren in <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie<br />
gestörte Beziehungsmuster, <strong>der</strong>en Ursprung findet man oft in den Herkunftsfamilien. Die<br />
Angst vor dem Verlassenwerden spielt in <strong>der</strong> Herkunftsfamilie des Täters eine wichtige Rolle<br />
(Lustig et al. 1966, zitiert nach Joraschky, 1997, S. 82). Die Kindheit wird überschattet von<br />
Trennungen und Verlust (Weiner 1962, a.a.O., S. 82) sowie von Zurückweisung durch die<br />
Eltern (Gutheil und Avery 1977, a.a.O., S. 82). Zum eigenen Vater, <strong>der</strong> als gewalttätig und<br />
gefürchtet o<strong>der</strong> die Familie früh verlassend geschil<strong>der</strong>t wird, besteht eine schlechte Beziehung<br />
(Gebhard et al. 1965, a.a.O., S. 82). Die Mutter wird oft als „gleichgültig, kritisch, sehr<br />
religiös und streng beschrieben“ (a.a.O., S. 82).<br />
6
Häufig liegen entwe<strong>der</strong> sehr enge Beziehungen zu den dominanten Müttern vor o<strong>der</strong> aber<br />
Todesfälle o<strong>der</strong> Depressionen <strong>der</strong> Mütter (Parker und Parker 1986, a.a.O., S. 83). Die<br />
Kindheit <strong>der</strong> Täter ist insgesamt von emotionaler Vernachlässigung und Deprivation geprägt.<br />
Der Vater <strong>der</strong> Herkunftsfamilie mütterlicherseits verlässt früh die Familie. Seine Frau reagiert<br />
auf dieses Verlassenwerden häufig mit feindseligem Verhalten gegenüber <strong>der</strong> Tochter. Die<br />
Mutter wird als kalt, for<strong>der</strong>nd und kontrollierend beschrieben (Joraschky,1997). Auch die<br />
Mütter verlassen schließlich früh die Familie (Lustig et al. 1966, a.a.O., S. 83).<br />
„Vorherrschend ist das Bild einer in <strong>der</strong> Kindheit deprivierten Mutter voller Zurückweisung,<br />
Verlassenheit, Ambivalenz.“ (a.a.O., S. 83).<br />
5. Empirische Untersuchungen und Modelle zur Entstehung von<br />
sexuellem Mißbrauch<br />
Erklärungsmodelle<br />
Abbildung 5.1: Familiendynamisches Schema zur Entstehung von Inzest, Hirsch (1994),<br />
S. 147<br />
Mit seinem familiendynamischen Modell nimmt Hirsch (1994) eine vorwiegend<br />
tiefenpsychologische Herangehensweise an den sexuellen Mißbrauch vor. Als wichtigstes<br />
äußeres Charakteristikum <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie nennt er die soziale Isolation. Der Grund für<br />
diesen engen Familienzusammenschluss ist seiner Meinung nach die paranoide Persönlichkeit<br />
<strong>der</strong> Eltern, ihre Unfähigkeit soziale Kontakte aufrecht zu halten. Laut Eist und Mandel (1968,<br />
zitiert nach Hirsch, 1994) entsteht eine solche paranoide Familienstruktur durch die massive<br />
Trennungsangst aller Familienmitglie<strong>der</strong>. Hirsch betont auch die Dysfunktionalität in diesen<br />
Familien. In einer Untersuchung von Madonna et al. (1991, zitiert nach Hirsch, 1994) zeigten<br />
Inzestfamilien in verschiedenen Bereichen signifikant mehr Dysfunktionalität als<br />
Kontrollfamilien. Als ausschlaggebendes inneres Merkmal <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> sieht<br />
Hirsch die Trennungsangst, die er sowohl beim Opfer als auch bei den Eltern vermutet.<br />
7
Funktion des Inzests sei deshalb die Aufrechterhaltung <strong>der</strong> Familienhomöostase. Kempe<br />
(1978, zitiert nach Hirsch, 1994) stellte als weiteres Charakteristikum von<br />
Mißbrauchsfamilien die sog. „Parentifizierung„ fest, das heißt die Tochter wird in die Rolle<br />
<strong>der</strong> Mutter gedrängt. Diese Rollenumkehr entstehe durch väterliche und mütterliche<br />
Projektion von Bedürfnissen und Feindseligkeiten, die eigentlich den eigenen Müttern gelten,<br />
auf die Tochter. Auch Gutheil und Avery (1977, zitiert nach Hirsch, 1994) stellen bei den<br />
Müttern von Inzestfamilien den Wunsch nach Bemutterung fest. Die Rollenumkehr führe<br />
immer zu Überfor<strong>der</strong>ung und Schuldgefühlen beim Kind. Durch diesen enormen Druck und<br />
<strong>der</strong> übertragenen Verantwortung für die gesamte Familie sei auch das Schweigen des Opfers<br />
über den Mißbrauch zu erklären. Hirsch versteht die ödipale Rivalität zwischen Tochter und<br />
Mutter als Ursache für das enge Bündnis, das die Tochter mit dem Vater eingeht und welches<br />
dieser dann für sexuelle Übergriffe ausnutzt. Der Vater mißbrauche die Tochter nicht nur zur<br />
sexuellen Befriedigung, son<strong>der</strong>n auch zum Ausdruck eigener Aggressionen gegenüber seiner<br />
Ehefrau.<br />
Furniss (1984, 1986, zitiert nach Hehl und Werkle, 1993) geht von einem Familienmodell aus,<br />
in welchem <strong>der</strong> Vater nach außen hin die mächtigere Stellung inne hat, tatsächlich aber die<br />
Mutter die Familie dominiert. Der Mutter stehe deshalb so viel Macht zu, weil sie sich ihrem<br />
Ehemann sexuell entziehen könne und er somit emotional von ihr abhängig sei. Der<br />
Familienvater sei stark geprägt von frühen Kindheitserfahrungen, aufgrund <strong>der</strong>er er in seiner<br />
Frau einen Mutterersatz suche. Er leide außerdem unter Trennungsängsten, die es ihm trotz<br />
schwerwiegen<strong>der</strong>, ehelicher Konflikte unmöglich machen würden, seine Frau zu verlassen<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Sexualbeziehungen einzugehen. Laut Furniss hat <strong>der</strong> inzestuöse Mißbrauch in<br />
diesen Familien zwei Funktionen. Entwe<strong>der</strong> diene er <strong>der</strong> Konfliktvermeidung, die Tochter<br />
würde zur Sexualpartnerin des Vaters, damit erst gar keine innerfamiliären Konflikte<br />
entständen. Könnten diese Konflikte nicht vermieden werden, habe <strong>der</strong> Mißbrauch die<br />
Funktion <strong>der</strong> Konfliktregulierung. Die Mutter, die sich ihrem Ehemann sexuell entziehe,<br />
opfere ihm die Tochter als Ersatz, damit sie selbst vor dessen Aggressionen verschont<br />
bliebe.<br />
In diesem Modell werden die Risikofaktoren schlechte Beziehung zwischen den Eltern und<br />
schlechte Beziehung <strong>der</strong> Tochter zu einem Elternteil gut erklärt. Diese beiden Faktoren<br />
wurden in zahlreichen Untersuchungen (Finkelhor & Hotaling, 1984; Finkelhor, 1986; Peters,<br />
1984, zitiert nach Hehl & Werkele, 1993) als die aussagekräftigsten Prädiktoren für sexuellen<br />
Mißbrauch festgestellt. Die schlechte Beziehung <strong>der</strong> Eltern erklärt Furniss mit <strong>der</strong> sexuellen<br />
Verweigerung <strong>der</strong> Ehefrau. Allerdings geht er nicht darauf ein, warum <strong>der</strong> Mann in seiner<br />
Frau einen Mutterersatz sucht und warum wie<strong>der</strong>um die Frau einen Mann heiratet, <strong>der</strong> in ihr<br />
seine Mutter sucht. Laut Hehl und Werkele (1993) wird in diesem Modell zu wenig Gewicht<br />
auf die Herkunftsfamilie <strong>der</strong> Ehefrau gelegt. Ihrer Meinung nach wird auch nicht endgültig<br />
geklärt, warum die Mutter ihre eigene Tochter dem Vater als Sexualpartner opfert.<br />
Abelmann-Vollmer (1987, zitiert nach Hehl und Werkle, 1993) findet an<strong>der</strong>e<br />
Erklärungsmechanismen für den sexuellen Mißbrauch innerhalb <strong>der</strong> Familie. Er sieht die<br />
Unterlegenheit <strong>der</strong> Mutter gegenüber dem Vater als ausschlaggebend für die schlechte<br />
Beziehung zwischen den beiden. Um von den For<strong>der</strong>ungen des dominanten Vaters verschont<br />
zu bleiben, biete die Mutter ihm die Tochter an. Aus dieser Situation heraus entstehe einen<br />
Rivalität zwischen Mutter und Tochter, welche wie<strong>der</strong>um die schlechte Beziehung zwischen<br />
den beiden erkläre.<br />
Auch Abelmann-Vollmer bezieht die beiden Hauptprädiktoren für sexuellen Mißbrauch in<br />
sein Modell mit ein. Hehl und Werkele (1993) kritisieren, daß nicht erläutert wird, woher die<br />
Unterlegenheit <strong>der</strong> Mutter rührt und warum letztendlich eine Rivalität zwischen Mutter und<br />
Tochter zustande. Ihrer Ansicht nach wird außerdem zu wenig auf den Vater eingegangen,<br />
warum er so mächtig ist und warum er sich nicht eine an<strong>der</strong>e Frau nimmt.<br />
8
Forward (1990, zitiert nach Hehl und Werkele, 1993) versteht die Mißbrauchsfamilie als eine<br />
Familie, die sich im Ungleichgewicht befindet. Mißhandlungen und inzestuöse Übergriffe<br />
fänden zum Zwecke <strong>der</strong> Aufrechterhaltung des vom Zusammenbruch bedrohten<br />
Familiensystems statt. Innerhalb <strong>der</strong> Familie komme es zur Verschmelzung <strong>der</strong> persönlichen<br />
Grenzen. Für die mißbrauchte Tochter komme es gar nicht in Frage, die sexuellen<br />
Annäherungen des Vaters auffliegen zu lassen o<strong>der</strong> sich zu wehren, da sie davon überzeugt<br />
sei, es sich aus Loyalität zur Familie gefallen lassen zu müssen. In solchen Familien gäbe es<br />
keine Grenzen zwischen Eltern und Kin<strong>der</strong>n. Der Vater benütze die Tochter als Partnerersatz,<br />
um sich den eigentlichen Eheproblemen zu entziehen. Forward bezeichnet ein solches<br />
Familiensystem als „verstrickt“. Unter „Verstrickung“ versteht man, daß Grenzen zwischen<br />
den Generationen verwischt werden und Grenzen nach außen verhärtet werden (Minuchin,<br />
1977, zitiert nach Hehl und Werkele, 1993). Äußere Einflüsse werden abgewehrt, damit es<br />
nicht zur Auslösung innerfamiliärer Konflikte und vor allem nicht zu <strong>der</strong>en Aufarbeitung<br />
kommt.<br />
Nach Hehl und Werkele erklärt dieses Modell gut, warum <strong>der</strong> Mißbrauch von <strong>der</strong> Tochter<br />
gedeckt wird. Allerdings stehe das Modell im Wi<strong>der</strong>spruch zu den beiden Hauptprädiktoren<br />
für Mißbrauch. Anstelle <strong>der</strong> schlechten Beziehung zwischen den Eltern und zwischen <strong>der</strong><br />
Tochter und einem Elternteil geht Forward von einer guten Beziehung zwischen allen<br />
Familienmitglie<strong>der</strong>n aus.<br />
Eine empirische Untersuchung<br />
Hehl und Werkele (1993) haben sich durch diese Modelle für ihre Untersuchung von<br />
familiären Beziehungsstrukturen bei sexuellem Mißbrauch anregen lassen. Ihr Ziel war es, die<br />
beson<strong>der</strong>en Beziehungsstrukturen <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilien, <strong>der</strong> Herkunftsfamilien <strong>der</strong> Partner<br />
in <strong>der</strong> Kindheit mißbrauchter Frauen und <strong>der</strong> Gegenwartsfamilien mißbrauchter Frauen<br />
herauszufinden.<br />
Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> oben genannten Theorien setzten die Autoren folgende<br />
Hypothesen fest:<br />
1. Die Beziehung zwischen den Eltern ist schlecht, aber auf eine bestimmte Weise<br />
auch verstrickt.<br />
2. Die Beziehung zwischen einem Elternteil und <strong>der</strong> mißbrauchten Tochter ist<br />
schlecht und gleichzeitig verstrickt.<br />
3. Die schlechte Beziehung <strong>der</strong> Eltern führt nicht zur Trennung, son<strong>der</strong>n über<br />
Wechselwirkungsprozesse zum Mißbrauch.<br />
4. Über die Herkunftsfamilie des Partners einer Frau, die früher mißbraucht wurde,<br />
und über die Familienstruktur <strong>der</strong> Jetzt-Familie früher mißbrauchter Frauen können keine<br />
gezielten Hypothesen formuliert werden.<br />
Untersucht wurden 80 Frauen mit mindestens einem Kind. Anhand eines Fragebogens zur<br />
sexuellen Entwicklung wurde ermittelt, ob sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in <strong>der</strong> Kindheit<br />
mißbraucht wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mißbraucht wurden o<strong>der</strong> ob sie nicht<br />
einzuordnen waren.<br />
Die emotionalen Beziehungen zwischen den Familienmitglie<strong>der</strong>n wurden durch zwei<br />
Messinstrumente erfasst. Zum einen wurde <strong>der</strong> Familien-Skulptur-Test verwendet, dieser mißt<br />
die Durchsetzungskraft, die Zuwendung und Interaktionshäufigkeit in <strong>der</strong> Familie, jeweils aus<br />
Sicht eines Familienmitglieds. Außerdem wurde <strong>der</strong> Herkunftsfamilien-Fragebogen<br />
eingesetzt, <strong>der</strong> die Hauptdimensionen „gespalten versus integriert“ und „gebunden versus<br />
autonom“ und die Nebendimensionen „Verantwortung übernehmen versus Verantwortung<br />
abschieben“ und „starke Auseinan<strong>der</strong>setzung versus geringe Auseinan<strong>der</strong>setzung“ ermittelt.<br />
9
Bei <strong>der</strong> Untersuchung sollten die Probandinnen die Skulptur ihrer Herkunftsfamilie, wie sie<br />
diese im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren erlebt haben, die Skulptur <strong>der</strong> Herkunftsfamilie<br />
ihres Partners, aus dessen Sicht im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren, und schließlich ihre<br />
Gegenwartsfamilie auf dem Familienbrett stellen. Anschließend bekamen sie den<br />
Herkunftsfamilien-Fragebogen und den Fragebogen zur sexuellen Entwicklung.<br />
Im Familien-Skulptur-Test zeigte sich bei den mißbrauchten Frauen eine signifikant<br />
niedrigere Durchsetzungsfähigkeit als bei nicht mißbrauchten. In Mißbrauchsfamilien besteht<br />
auch weniger positive Zuwendung <strong>der</strong> Mutter zum Kind. Der Herkunftsfamilien-Fragebogen<br />
erfasst bei den Eltern von Mißbrauchsfamilien eine deutlich stärkere Spaltung und stärkere<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen als in <strong>der</strong> Kontrollgruppe. Außerdem sind diese Familien tendenziell<br />
weniger gebunden und übernehmen weniger Verantwortung füreinan<strong>der</strong>. Das einzig<br />
signifikante Ergebnis bezüglich Herkunftsfamilie des Partners ist die sehr gute Beziehung des<br />
Partners einer mißbrauchten Frau zu seiner Mutter. Im Familien-Skulpturen-Test <strong>der</strong><br />
Gegenwartsfamilie zeichnet sich eine deutlich positivere Zuwendung mißbrauchter Mütter zu<br />
ihren ältesten Kin<strong>der</strong>n und auch umgekehrt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu ihren Müttern ab, als bei nicht<br />
mißbrauchten Müttern. Die demographischen Daten zeigen, daß es in Mißbrauchsfamilien<br />
viel seltener zur Scheidung kommt als in Kontrollfamilien. Dagegen lassen sich die<br />
Herkunftsfamilien <strong>der</strong> Partner von mißbrauchten Frauen sowie die Gegenwartsfamilien dieser<br />
Frauen überzufällig häufig scheiden.<br />
Die Hypothese, nach <strong>der</strong> in Mißbrauchsfamilien eine starke Bindung o<strong>der</strong> Verstrickung<br />
vorliegt, kann in dieser Studie nicht bestätigt werden. In diesen Familien ist sogar im<br />
Vergleich zur Kontrollgruppe eine Tendenz zum Autonomiebestreben <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong><br />
zu beobachten. Die Annahme <strong>der</strong> emotionalen Spaltung <strong>der</strong> Eltern in Mißbrauchsfamilien<br />
wird in dieser Untersuchung bestätigt. Für die Spaltung <strong>der</strong> Eheleute sprechen auch die in<br />
Mißbrauchsfamilien erhöhten Distanzwerte und geringeren Zuwendungswerte zwischen den<br />
Eltern. Außerdem kann die signifikant niedrige Zuwendung <strong>der</strong> Mutter zur Tochter als ein<br />
Zeichen <strong>der</strong> Familienspaltung mit <strong>der</strong> Mutter auf <strong>der</strong> einen Seite und Tochter und Vater auf<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite gesehen werden. Auch die in Mißbrauchsfamilien verstärkten<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen und die Neigung, Verantwortung abzuschieben, weisen in Richtung<br />
Autonomiebestreben und Spaltung. Für die Tatsache, daß es in Mißbrauchsfamilien<br />
signifikant seltener zu Trennungen kommt, haben die Autoren keine Erklärung parat, sie<br />
vermuten den Ursprung dafür in den Herkunftsfamilien <strong>der</strong> Eltern.<br />
Überprüfung <strong>der</strong> Modelle<br />
Das Modell von Hirsch (1994) konnte durch die Studie von Hehl und Werkele (1993) nicht<br />
ausreichend überprüft werden. Nur die von Hirsch prognostizierte, schlechte Beziehung<br />
zwischen Mutter und Tochter wurde auch in dieser Untersuchung gefunden. Auch das Modell<br />
von Forward (1990) kann kaum bestätigt werden. Statt <strong>der</strong> von Forward vermuteten<br />
Verstrickung stellten Hehl und Werkele eine Spaltung <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> fest. Die als<br />
signifikant häufig herausgefundenen Auseinan<strong>der</strong>setzungen in Mißbrauchsfamilien sprechen<br />
ebenfalls gegen die vorhergesagte Konfliktvermeidung.<br />
Die Studie von Hehl und Werkele stimmt im Punkt <strong>der</strong> schlechten Mutter-Tochter- Beziehung<br />
mit dem Modell von Abelmann-Vollmer (1987) überein. Die Unterlegenheit <strong>der</strong> Mutter als<br />
Erklärung hierfür, stellt allerdings einen klaren Wi<strong>der</strong>spruch zu den gefundenen Ergebnissen<br />
dar. Denn es konnte keine geringere Durchsetzungsfähigkeit o<strong>der</strong> weniger Einfluß <strong>der</strong> Mutter<br />
festgestellt werden.<br />
Das Modell von Furniss (1984,1986) erklärt, laut Hehl und Werkele (1994), die Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> Studie am besten. Eine Übereinstimmung findet sich bei <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Mutter als aktiver<br />
Person, die eine dominante Funktion in <strong>der</strong> Familie übernimmt. Die als signifikant niedrig<br />
aufgezeigte Trennungsrate bei Mißbrauchsfamilien wird von Furniss aufgrund von<br />
10
Trennungsangst und emotionaler Abhängigkeit des Vaters vorhergesagt. Auch die in <strong>der</strong><br />
Untersuchung herausgefundene Spaltung <strong>der</strong> Eheleute steht im Einklang mit Furniss Modell.<br />
Laut Furniss wurde die Tochter von ihren Eltern immer nur zur Verwirklichung ihrer eigenen<br />
Interessen ausgenutzt, dies erklärt die geringe Durchsetzungsfähigkeit des Opfers sehr gut.<br />
6. Protektive Faktoren<br />
Nun wurden bereits die typischen <strong>Merkmale</strong> von Mißbrauchsfamilien und kausale Modelle<br />
zum Zustandekommen des sexuellen Mißbrauchs vorgestellt. Um das Thema <strong>der</strong> strukturellen<br />
<strong>Merkmale</strong> <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie zu vervollständigen und als positiver Ausblick zum<br />
Abschluß dieser Arbeit, sollen nun die genannten Risikofaktoren in den Familien durch<br />
Schutzfaktoren ergänzt werden. Denn auch solche Faktoren können in Mißbrauchsfamilien<br />
vorliegen und sind Hauptangriffspunkt für eine eventuelle Therapie.<br />
Zunächst soll auf die protektiven Faktoren inzestvulnerabler Familien eingegangen werden,<br />
die das Risiko für ein tatsächliches Zustandekommen von Inzest min<strong>der</strong>n. Einen wichtigen<br />
Einfluß kann die soziale Unterstützung durch Freunde o<strong>der</strong> die Familie haben, wenn sich z.B.<br />
die Tochter einer Bezugsperson außerhalb <strong>der</strong> Mißbrauchsfamilie anvertrauen kann<br />
(Joraschky, 1997). Auch familiäre Ressourcen im Bereich <strong>der</strong> Konfliktbewältigungsfähigkeit,<br />
des emotionalen Austausches o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Problemlösefähigkeit können einen Schutz vor<br />
letztendlichen Mißbrauchshandlungen darstellen (a.a.O., S. 84).<br />
Die allgemeine Protektionsforschung untersucht Schutzfaktoren gegen die langfristig<br />
ungünstigen Folgen negativer Kindheitserfahrungen. In Übereinstimmung mit diesem<br />
Forschungszweig fand Zimrin (1986, zitiert nach Dornes, 1997) für relativ unbeeinträchtigte<br />
Kin<strong>der</strong> heraus, daß diese optimistischer und intelligenter waren und mindestens eine<br />
vertrauensvolle Beziehung in <strong>der</strong> Gegenwart o<strong>der</strong> Vergangenheit pflegten. Zimrin betrachtete<br />
die Entwicklung von 28 mißhandelten Kin<strong>der</strong>n bis 14 Jahre nach <strong>der</strong> Mißhandlung. Neun <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> zeigten sich nach dieser Zeit eher unbeschadet, an diesen konnte er die Schutzfaktoren<br />
untersuchen.<br />
Für den Fall, daß es in einer Familie bereits zu Mißbrauchshandlungen gekommen ist, kann<br />
man die Faktoren o<strong>der</strong> Umstände betrachten, die eine Durchbrechung des<br />
Mißhandlungszyklus ermöglichen. Die Zahlen <strong>der</strong> intergenerationellen Transmission von<br />
Mißhandlung sind erschreckend hoch. Für Personen, die in einer Inzestfamilie aufgewachsen<br />
sind, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, daß sie o<strong>der</strong> ihr Partner später die eigenen<br />
Kin<strong>der</strong> mißhandeln. Denn sie haben in ihrer Kindheit nicht gelernt, wie die Grenzen von<br />
Privatsphäre und Sexualität eingehalten werden und haben diese, laut Hirsch (1994), im Sinne<br />
einer Über-Ich-Störung nicht internalisiert. Fallers (1989, zitiert nach Hirsch, 1994)<br />
Untersuchung von 154 Mißbrauchsfamilien ergab, daß mehr als ein Drittel <strong>der</strong> Väter und die<br />
Hälfte <strong>der</strong> Mütter sexuellen Mißbrauch in <strong>der</strong> eigenen Kindheit erfahren haben o<strong>der</strong> ihm<br />
begegnet sind. Im Anbetracht dieser Zahlen scheint es enorm wichtig, <strong>Merkmale</strong> und<br />
Verhaltensweisen von Personen herauszufinden, die den Mißhandlungszyklus durchbrochen<br />
haben. Hunter und Kilstrom (1979, zitiert nach Dornes, 1997) konnten in ihrer Studie zeigen,<br />
daß sich sog. „Nichtwie<strong>der</strong>holer“ von „Wie<strong>der</strong>holern“ dadurch unterscheiden, daß sie weniger<br />
sozial isoliert waren und offener und mit angemesseneren Gefühlen über die Mißhandlungen<br />
sprechen konnten. Sie schienen die Vergangenheit besser bewältigt zu haben. Egeland (1988,<br />
zitiert nach Dornes) fand drei Hauptunterschiede heraus, Nichtwie<strong>der</strong>holer hatten in <strong>der</strong><br />
Kindheit mindestens eine Bezugsperson, <strong>der</strong> sie sich anvertrauen konnten, und/o<strong>der</strong> hatten<br />
irgendwann eine längere Psychotherapie gemacht und /o<strong>der</strong> lebten gegenwärtig in einer<br />
befriedigenden Beziehung. Pianta et al. (1989, zitiert nach Dornes, 1997) untersuchten<br />
Mütter, die ihre Kin<strong>der</strong> über ein Jahr hinaus mißhandelten, und solche, die die Mißhandlung<br />
einstellten. Die meisten <strong>der</strong>er, die die Mißhandlungen beendeten, waren Teilnehmer eines<br />
Interventionsprogramms. Eine supportive Beziehungserfahrung in <strong>der</strong> Gegenwart o<strong>der</strong><br />
11
Vergangenheit scheint einen großen Einfluß auf die Bewältigung von traumatischen<br />
Kindheitserlebnissen zu haben. Laut Dornes (1997, S. 76) ist es weniger<br />
die Tatsache <strong>der</strong> Mißhandlung die Nichtwie<strong>der</strong>holer und Wie<strong>der</strong>holer unterscheidet, son<strong>der</strong>n<br />
die „Art und Weise, wie sie diese Tatsachen durcharbeiten, betrauern und in ihr Leben<br />
integrieren.“ Dieser Aspekt ist <strong>der</strong> einzig positive an dem bisher dargestellten Thema, denn er<br />
zeigt, daß eine Therapie für Mißbrauchte und <strong>der</strong>en Familien sehr sinnvoll sein kann.<br />
7. Zusammenfassung<br />
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den strukturellen <strong>Merkmale</strong>n, die in<br />
Mißbrauchsfamilien vorherrschen. Sehr viele Forscher und Autoren haben sich bereits mit<br />
diesem Thema beschäftigt und zahlreiche Charakteristika von Mißbrauchsfamilien<br />
herausgefunden. Es wurden verschiedene Arten von Familien untersucht, auch die Methodik<br />
<strong>der</strong> Studien unterschied sich. Dennoch zeigen die gefundenen Ergebnisse keine<br />
Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeiten und weisen grob in die gleiche Richtung. Als Hauptprädiktor für<br />
sexuellen Mißbrauch konnte in den meisten Untersuchungen die schlechte Beziehung<br />
zwischen den Eltern und eine schlechte Beziehung <strong>der</strong> Tochter zu mindestens einem Elternteil<br />
festgestellt werden. Der Grossteil <strong>der</strong> Familien, in denen sexuelle Übergriffe stattfanden,<br />
konnte dem sog. „endogamen„ Familientyp zugeordnet werden. Mißbrauchsfamilien zeichnen<br />
sich durch soziale Isolation nach Außen und Grenzstörungen und Rollenumkehr innerhalb <strong>der</strong><br />
Familie aus. Oft wird die Ursache hierfür in den Herkunftsfamilien <strong>der</strong> Eltern gesucht. Einige<br />
Forscher vermuten, daß die in <strong>der</strong> eigenen Kindheit deprivierten Eltern unter massiven<br />
Trennungsängsten leiden und <strong>der</strong> Mißbrauch zur Kompensation frühkindlicher Bedürfnisse<br />
durchgeführt wird. Ein universelles Erklärungsmodell für sexuellen Mißbrauch gibt es jedoch<br />
nicht. Der sexuelle Mißbrauch kann nicht als einfaches Ursache-Wirkungs-Modell aufgefaßt<br />
werden, son<strong>der</strong>n ist vielmehr als multifaktorielles Geschehen zu verstehen. Obwohl<br />
<strong>Merkmale</strong> festgestellt wurden, die für sehr viele Mißbrauchsfamilien zutreffen, kann man<br />
diese Familien nicht auf einige wenige Eigenschaften reduzieren. Und umgekehrt treten die<br />
gefundenen Faktoren auch bei zahlreichen Familien auf, in denen es nicht zum Mißbrauch<br />
kommt. Auch wenn dieser Forschungsbereich sehr sinnvoll ist, besteht dabei doch die Gefahr<br />
<strong>der</strong> Stereotypisierung <strong>der</strong> betroffenen Familien. Vielleicht wäre statt <strong>der</strong> vielen quantitativen<br />
Forschung, künftig mehr qualitative Forschung angebracht.<br />
8. Literaturverzeichnis<br />
Dornes, M. (1997). Vernachlässigung und Mißhandlung aus Sicht <strong>der</strong> Bindungstheorie.<br />
In T. U. Egle, S. O. Hoffmann, P. Joraschky (Hrsg.), Sexueller Mißbrauch,<br />
Mißhandlung, Vernachlässigung. Erkennung und Behandlung psychischer und<br />
psychosomatischer Folgen früher Traumatisierungen. (S. 65-78). Stuttgart.<br />
Engfer, A. (1992). Kindesmißhandlung und sexueller Mißbrauch. In R. Oerter, L.<br />
Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie. (S. 960-966, 1006-1015). Weinheim:<br />
Psychologie Verlags Union.<br />
Hehl, F. J.; Werkele, R. (1993). Eine retrospektive Untersuchung von familiären<br />
Beziehungsstrukturen bei sexuellem Mißbrauch –Eine Pilotstudie. Zeitschrift für<br />
Familienforschung, 1993, 5, 215-248<br />
Hirsch, M. (1994). Realer Inzest. Psychodynamik des sexuellen Mißbrauchs in <strong>der</strong><br />
Familie. Heidelberg. 3. Auflage.<br />
12
Joraschky, P. (1997). Sexueller Mißbrauch und Vernachlässigung in Familien. In T. U.<br />
Egle, S. O. Hoffmann, P. Joraschky (Hrsg.), Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung,<br />
Vernachlässigung. Erkennung und Behandlung psychischer und psychosomatischer<br />
Folgen früher Traumatisierungen. (S. 79-92). Stuttgart.<br />
13