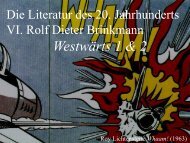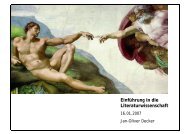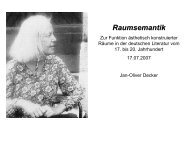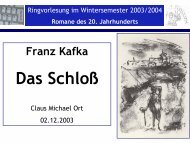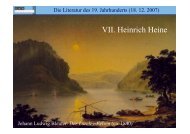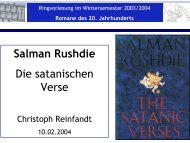Protokoll - Literaturwissenschaft-online
Protokoll - Literaturwissenschaft-online
Protokoll - Literaturwissenschaft-online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schlüsseltexte der Literaturgeschichte<br />
3. Frühaufklärung / Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato<br />
Das 18. Jahrhundert kann allgemein als Jahrhundert der ›Aufklärung‹ gelten. In<br />
literaturgeschichtlicher Hinsicht bildet die Theaterreform Johann Christoph Gottscheds (Versuch<br />
einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen, 1729) das entscheidende Initialereignis der<br />
Abgrenzung vom Barock.<br />
In der Regel wird die Epoche ›Aufklärung‹ in die drei Phasen Früh-, Hoch- und Spätaufklärung<br />
unterteilt: 1) Die insbesondere von Gottsched geprägte ›Frühaufklärung‹ hält am Primat der<br />
Rationalität fest und propagiert eine ›vernünftige‹ Dichtung. − 2) Für die ›Hochaufklärung‹ (ab ca.<br />
1750) steht insbesondere Gotthold Ephraim Lessing, der die Emotionalität über die Rationalität<br />
stellt (→ Abkehr von der stoizistischen Ethik); von diesem Zeitpunkt an entsteht Literatur, die im<br />
Wesentlichen schon unserem heutigen Leseverständnis entspricht und daher ›natürlich‹ wirkt. − 3)<br />
Als Vertreter der ›Spätaufklärung‹ kann u. a. Karl Philipp Moritz benannt werden, der mit seinem<br />
Interesse an ›Erfahrungsseelenkunde‹ eine Skepsis gegenüber die Prinzip der Vernünftigkeit<br />
formuliert und − im Gegensatz zu Gottsched UND Lessing − das Schöne strikt vom Nützlichen<br />
abgrenzt.<br />
Wie das barocke Denken geht auch die Frühaufklärung vom Grundprinzip der Vergänglichkeit alles<br />
Irdischen aus, zieht daraus jedoch schon gegenläufige Konsequenzen: Statt die Endlichkeit des<br />
Lebens pessimistisch als vanitas zu deuten, folgern die Menschen der Aufklärung daraus die<br />
Möglichkeit der Perfektibilität (Prozess der Vervollkommnung). Die Aufklärung behauptet also ein<br />
optimistisches Weltbild: Gerade weil auf Erden nichts von Dauer ist, kann es Fortschritt geben.<br />
Die Epochenbezeichnung ist als meteorologische Metapher zu begreifen und nimmt die Sonne bzw.<br />
das Licht als Symbol. Schon die Zeitgenossen haben diese Phase als ›Aufklaren‹ (›enlightenment‹,<br />
›lumières‹, ›illuminismo‹) nach einer Zeit der Dunkelheit verstanden: Das ›innere Licht‹ der −<br />
jedem Menschen angeborenen − Vernunft ermöglicht das Begreifen der Welt, ohne sich noch auf<br />
Autoritäten verlassen zu müssen (›Offenbarung‹ wird dabei überflüssig). So spricht die Epoche<br />
vielen alten Autoritäten ihre Geltung ab und konstituiert die Menschen als mündige Bürger, die ihr<br />
Dasein selbst kritisch hinterfragen können.<br />
Basis der frühaufklärerischen Philosophie ist Leibniz‘ Formel von der ›besten aller möglichen<br />
Welten‹ (Essais de Théodicée, 1710): Als unendlicher Verstand hat Gott unter allen ›möglichen‹<br />
Welten notwendig die ›beste‹ ausgewählt, sodass alle ›Übel‹ sinnvoll und daher gerechtfertigt sein<br />
müssen.<br />
© www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.uni-kiel.de<br />
1
3. Frühaufklärung / Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato SS 2010<br />
Schlüsseltexte der Literaturgeschichte<br />
Johann Christoph Gottsched<br />
Johann Christoph Gottsched (1700-1766) hat den wohl wichtigsten Beitrag zur<br />
literarischenFrühaufklärung geleistet. Insbesondere sein Versuch einer Critischen Dichtkunst vor<br />
die Deutschen (1729) leitet eine umfassende Theaterreform in Deutschland ein, deren Einfluss bis<br />
heute wirksam ist:<br />
1) Literarisierung des Theaters: Aufführungen sollen auf schriftlich fixierten Texten basieren, was<br />
zum einen die Schauspieler diszipliniert und zum anderen dem Publikum die Möglichkeit gibt,<br />
Aufführungen zu kritisieren (→ Entstehung einer Theaterkritik)<br />
2) Soziale Verbesserung / Nationaltheater: Gottsched propagiert einen hohen gesellschaftlichen<br />
Nutzen des Theaters als Bildungs- und Moralisierungsinstitution; daher muss der Staat das Theater<br />
durch finanzielle Förderung unterstützen und Schauspielerei zu einem anerkannten Beruf machen<br />
(→ u. a. Alterssicherung für Schauspieler).<br />
Gottsched vertritt in seiner Critischen Dichtkunst den Ansatz, dass ein Dichter seinem Werk jeweils<br />
einen Lehrsatz zu Grunde legen soll, um die entsprechende Wahrheit auf sinnliche Weise (daher<br />
besonders eindringlich) zu vermitteln. Auf dem Theater führt eine strikt kausal motivierte Handlung<br />
vor, auf welche Weise falsches Verhalten ins Unglück führt − das Publikum begreift daran die<br />
entsprechende Kausalität und lernt so, sich vor ähnlichen Fehlern zu hüten. Notwendige Grundlage<br />
für Gottscheds Dramen-Konzept ist der Vorrang der Handlung vor den Charakteren: Statt einer<br />
Identifikation mit den handelnden Figuren über Sympathieentwicklung (so später bei Lessing) muss<br />
eine kritische Distanz zum Vorgeführten die rationale Analyse unterstützen.<br />
Gottscheds Rationalismus wird in seinem philosophischen Lehrbuch Erste Gründe der gesdammten<br />
Weltweisheit näher ausformuliert. 1 Grundlegend sind seine zweiwertige Logik (»Denn unser<br />
Erkenntniß ist entweder wahr oder falsch«) 2 sowie seine Korrespondenztheorie der Wahrheit, nach<br />
der es objektive Wahrheit geben kann. Außerdem vertritt er das Prinzip des ›zureichenden Grundes‹<br />
(»Alles was ist, hat einen zureichenden Grund, warum es vielmehr ist, als nicht ist«). 3 Das bedingt<br />
die Forderung nach strikter Kausalität aller dramatischen Handlungen sowie die klare<br />
Unterscheidung von Tugend und Laster (→ zweiwertige Ethik).<br />
1<br />
Johann Christoph Gottsched: Erste Gründe Der Gesamten Weltweisheit, Darinn alle Philosophische Wissenschaften in<br />
ihrer natürlichen Verknüpfung abgehandelt werden. Zum Gebrauch Academischer Lectionen […]. Erster, Theoretischer<br />
Theil / Andrer Practischer Theil. Leipzig 1733/34.<br />
2<br />
Weltweisheit I, 115.<br />
3<br />
Weltweisheit I, 118.<br />
© www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.uni-kiel.de<br />
2
3. Frühaufklärung / Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato SS 2010<br />
Schlüsseltexte der Literaturgeschichte<br />
Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato<br />
Gottscheds Trauerspiel Sterbender Cato kann als ein Musterdrama angesehen werden, an dem sein<br />
theoretisches Konzept abzulesen ist. Es wurde 1731 in Leipzig uraufgeführt und feierte zunächst<br />
große Erfolge. Nach dem Wandel der Poetik um 1750 verschwindet es jedoch schnell von den<br />
deutschen Bühnen. Sterbender Cato ist die erste bekannte deutsche Vers-Tragödie des 18.<br />
Jahrhunderts und hält sich streng an die klassizistischen Vorgaben (Einheitlichkeit / Stilreinheit).<br />
Dem Prinzip des aptum/decorum folgend gestaltet das Trauerspiel einen ›hohen‹ Stoff (historischer<br />
Konflikt der klassischen Antike) im hohen Stil (Alexandriner-Verse). Sterbender Cato hält sich<br />
streng an die drei aristotelischen Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, praktiziert eine strenge<br />
Stilreinheit (keine Vermischung von tragischen mit komischen Motiven) und verzichtet im Interesse<br />
aufklärerischer ›Natürlichkeit‹ konsequent auf barocke Bildlichkeit/Allegorien (der bilderreiche<br />
Sprachstil des Barock gilt jetzt als ›Schwulst‹).<br />
Gottscheds Cato basiert zu einem Großteil auf der Übertragung zweier Quellen (François-Michel-<br />
Chrétien Deschamps: Caton d'Utique, 1715 − Joseph Addison: Cato. A Tragedy, 1713), weicht<br />
jedoch in einem besonders wichtigen Punkt von seinen Vorbildern ab (genau das ermöglicht den<br />
›moralischen Lehrsatz‹).<br />
Der Cato-Stoff basiert auf Ereignissen während der Römischen Bürgerkriege im Übergang von der<br />
Republik zur Kaiser-Herrschaft. Der zentrale Konflikt ist die Konfrontation zwischen dem Senator<br />
Cato (Inbegriff des sittenstrengen Republikaners) und Caesar, der nach Alleinherrschaft strebt.<br />
Historisch folgte auf die militärische Niederlage des Caesar-Gegners Marcus Porcius Cato (Cato<br />
Uticensis) 46 v. Chr. sein Selbstmord. Als Lutheraner kann Gottsched Catos Freitod aber nicht<br />
positiv bewerten (als Martyrium für die Freiheit), sondern muss ihn als Fehler/Versagen darstellen.<br />
Zu diesem Zweck erweitert Gottsched die Schluss-Szene um einen wichtigen Aspekt: Caesar bietet<br />
Cato, der militärisch im Nachteil ist, einen Kompromiss an; trotz seiner aussichtslosen Lage lehnt<br />
Cato jedoch ab. Dass dies von Unvernunft und Starrsinn zeugt, zeigt sich bei Catos Selbstmord<br />
zweifelsfrei: Im selben Augenblick trifft die Nachricht ein, dass Hilfstruppen unterwegs sind, mit<br />
deren Hilfe Caesar zu besiegen wäre, wenn Cato das Kommando übernimmt − durch Catos<br />
übereiltes Handeln kann es zu diesem Erfolg nicht mehr kommen.<br />
Cato ist in Gottscheds Bearbeitung also ein Held mit einem ›Fehler‹ bzw. einer habituellen<br />
Schwäche (Hamartia), der durch seine übersteigerte Tugend- bzw. Freiheitsliebe selbst zur<br />
›Ursache‹ seines Unglücks wird. Als exemplarischer Lehrsatz für die Zuschauer kristallisiert sich<br />
heraus, dass man sich vor Fanatismus hüten muss und nie glauben darf, vor Fehlern geschützt zu<br />
sein. In diesem Sinne formuliert Catos Schluss-Satz die entscheidende Botschaft: »Der Beste kann<br />
ja leicht vom Tugendpfade wanken «.<br />
© www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.uni-kiel.de<br />
3
3. Frühaufklärung / Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato SS 2010<br />
Zitate<br />
Schlüsseltexte der Literaturgeschichte<br />
Definition im ›Adelung‹:<br />
»Aufklären, verb. reg. act. wieder klar, heiter machen. 1)<br />
Eigentlich. Das Wetter, der Himmel klärt sich auf. Bey<br />
aufgeklärten Himmel. 2) Figürlich. (a) Sein Gesicht klärt<br />
sich allgemach auf, wird heiter. (b) Deutlich machen,<br />
erklären. Ich hoffe, daß sich indessen das Räthsel<br />
aufklären soll. Klären sie mir doch diese Stelle ein wenig<br />
auf. (c) Viele deutliche Begriffe beybringen. Ein<br />
aufgeklärtes und unbefangenes Gewissen. Ein<br />
aufgeklärter Verstand, der viele deutliche Begriffe hat.<br />
Aufgeklärte Zeiten, da man von vielen Dingen klare und<br />
deutliche Begriffe hat.« 4<br />
Alexander Pope – An Essay on Man<br />
»Know then thyself, presume not God to scan;<br />
The proper study of mankind is Man.« (II, v. 1f.)<br />
»All Nature is but Art, unknown to thee;<br />
All Chance, Direction, which thou canst not see;<br />
All Discord, Harmony, not understood;<br />
All partial Evil, universal Good:<br />
And, spite of pride, in erring Re[a]son's spite,<br />
One truth is clear, ›Whatever is, is right.‹ « (I, v. 289-294)<br />
Leibniz - Theodizee<br />
»Or cette suprême sagesse, jointe à une bonté qui n’est pas moins infinie qu’elle, n’a pu manquer de<br />
choisir le meilleur.«<br />
(›Nun konnte diese höchste Weisheit, verbunden mit einer Güte, die nicht weniger unendlich ist als<br />
sie selbst, nichts anderes als das Beste wählen.‹) 5<br />
Immanuel Kant – Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung?<br />
»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« 6<br />
Johann Christoph Gottsched – Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen<br />
Zum Lehrsatzprinzip<br />
»Der Poet wählet sich einen moralischen Lehrsatz, den er seinen Zuschauern auf eine sinnliche Art<br />
einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabel, woraus die Wahrheit eines Satzes<br />
erhellet. Hiernächst suchet er in der Historie solche berühmte Leute, denen etwas ähnliches<br />
begegnet ist: und von diesen entlehnet er die Namen, für die Personen seiner Fabel; um derselben<br />
4<br />
Johann Christoph Adelung : Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart : mit beständiger<br />
Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Revidiert und berichtigt von Franz Xaver<br />
Schönberger. Wien 1808, Sp. 503. Der ›Adelung‹ ist auch <strong>online</strong> einzusehen unter: www.ub.unibielefeld.de/diglib/adelung/grammati/.<br />
5<br />
Wilhelm Gottfried Leibniz: Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal (1710),<br />
Erster Teil, Kap. 8.<br />
6<br />
Immanuel Kant: Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? In: Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen.<br />
Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Hg. Von Erhard Bahr. Stuttgart 1986<br />
(rub 9714).<br />
© www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.uni-kiel.de<br />
4
3. Frühaufklärung / Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato SS 2010<br />
Schlüsseltexte der Literaturgeschichte<br />
also ein Ansehen zu geben. Er erdenket sodann alle Umstände dazu, um die Hauptfabel recht<br />
wahrscheinlich zu machen: und das werden die Zwischenfabeln, oder Episodia nach neuer Art,<br />
genannt. Dieses theilt er dann in fünf Stücke ein, die ohngefähr gleich groß sind, und ordnet sie so,<br />
daß natürlicher Weise das letztere aus dem vorhergehenden fließt; bekümmert sich aber weiter<br />
nicht, ob alles in der Historie wirklich so vorgegangen, oder ob alle Nebenpersonen wirklich so, und<br />
nicht anders geheißen haben.« 7<br />
Zum Nützlichkeitsgedanken<br />
»Die Absicht jeder Gesellschaft ist die Beförderung der gemeinen Wohlfahrt: Daher soll ein jedes<br />
Mitglied derselben, soviel in seinem Vermögen steht, dazu beyzutragen suchen.« 8<br />
Zur Korrespondenztheorie der Wahrheit<br />
»Uebereinstimmung unsrer Erkenntniß mit den Dingen selbst« 9<br />
Zur zweiwertigen Ethik<br />
»Die Tugend ist eine Fertigkeit seine Handlungen nach dem Gesetze der Natur einzurichten« 10<br />
Laster = »Fertigkeit dem Gesetze der Natur zuwieder zu handeln« 11<br />
Johann Christoph Gottsched – Sterbender Cato<br />
Portius:<br />
» […] Da lief ein Segel ein von des Pompejus Sohne,<br />
Das brachte Zeitung mit, daß er kein Sorgen schone,<br />
Die Völker Spaniens um Beistand anzuflehn,<br />
Daß er des Vaters Tod gerochen könne sehn.<br />
Stünd hier ein Cato nur an dieses Heeres Spitze,<br />
Da wär es uns und Rom vielleicht was mehrers nütze!« (V, 7, S. 82, v. 1583-1588)<br />
»Lebt wohl und Rom getreu! Ihr Götter! hab ich hier<br />
Vielleicht zu viel getan: Ach! So vergebt es mir!<br />
Ihr kennt ja unser Herz und prüfet die Gedanken!<br />
Der Beste kann ja leicht vom Tugendpfade wanken.« (V, 8, S. 84, v. 1637-1640) 12<br />
Weiterführende Literatur<br />
Albert Meier: Dramaturgie der Bewunderung. Untersuchungen zur politisch-klassizistischen<br />
Tragödie des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1993 (speziell S. 36-129).<br />
Albert Meier: Gottsched und die Tragödie in der deutschen Frühaufklärung. In: Osloer und Kieler<br />
Studien zur germanistischen Literatur- und Sprachwissenschaft. Herausgegeben von John Ole<br />
Askedal. Oslo 1999, S. 61-70.<br />
Heide Hollmer: Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato. In: Interpretationen. Dramen vom<br />
Barock bis zur Aufklärung. Stuttgart 2000, S. 177-199 (rub 17512).<br />
7<br />
Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst. Unveränderter photomechanischer Nachdruck der<br />
4., vermehrten Auflage, Leipzig 1751. 5. Auflage. Darmstadt 1962, S. 611.<br />
8<br />
Weltweisheit II, 211f.<br />
9<br />
Weltweisheit I, 90.<br />
10<br />
Weltweisheit I, 115.<br />
11<br />
Weltweisheit II, 38.<br />
12<br />
Johann Christoph Gottsched: Sterbender Cato. Im Anhang: Auszüge aus der zeitgenössischen Duskussion über<br />
Gottscheds Drama. Hg. Von Horst Steinmetz. Stuttgart 1964 (rub 2097).<br />
© www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.uni-kiel.de<br />
5