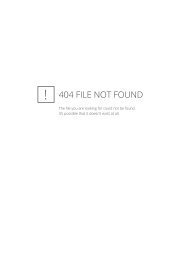9. Umweltmedizinische Jahrestagung - bei der IGUMED
9. Umweltmedizinische Jahrestagung - bei der IGUMED
9. Umweltmedizinische Jahrestagung - bei der IGUMED
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>9.</strong> <strong>Umweltmedizinische</strong><br />
<strong>Jahrestagung</strong><br />
Hamburg<br />
2. und 3. Oktober 2009<br />
Handwerkskammer Hamburg<br />
D I E R E F E R E N T E N<br />
D A S P R O G R A M M
Danksagung<br />
Für die Teilnahme und Unterstützung <strong>bei</strong> <strong>der</strong> <strong>9.</strong> <strong>Umweltmedizinische</strong>n<br />
<strong>Jahrestagung</strong> möchten wir uns <strong>bei</strong> folgenden Firmen herzlich bedanken:<br />
Baubiologie Layher www.baubiologie.de<br />
H. Buschkühl www.buschkuehlgmbh.com<br />
Demeter www.demeter.de<br />
Dr. Nie<strong>der</strong>maier Pharma www.nie<strong>der</strong>maier-pharma.de<br />
Heck Bio-Pharma www.heck-bio-pharma.com<br />
hypo-A www.hypo-a.de<br />
Ins� tut für Medizinische Diagnos� k (IMD) www.imd-berlin.de<br />
Kanne Bro� runk www.kanne-bro� runk.de<br />
Lebensbaum www.lebensbaum.de<br />
Lehmanns Fachbuchhandlung www.lob.de<br />
Medizinisches Labor Bremen www.mlhb.de<br />
Naturkost Nord www.naturkost-nord.de<br />
Pedrazzini Dental www.pedrazzini-dental.de<br />
Pes� zid Ak� ons-Netzwerk (PAN) www.pan-germany.org<br />
Phadia www.diagnos� cs.com<br />
Regionalverband Umweltberatung Nord www.umweltberatung-nord.de<br />
St. Leonhards Quelle www.st-leonhards-quelle.de<br />
Voelkel www.voelkeljuice.de<br />
Viathen www.viathen.de<br />
War� g Nord www.war� g.de/analy� k<br />
Tagesklinik Dr. Volz & Dr. Scholz www.zahnklinik.de<br />
Zentrum für Zahnmaterialtestung www.dental-diagnos� k.de
Grußwort<br />
Sehr geehrte Teilnehmer/Innen <strong>der</strong> <strong>9.</strong> <strong>Umweltmedizinische</strong>n <strong>Jahrestagung</strong>!<br />
Wir begrüßen Sie herzlich zu <strong>der</strong> <strong>9.</strong> <strong>Umweltmedizinische</strong>n <strong>Jahrestagung</strong> in<br />
Hamburg.<br />
Wir freuen uns, Ihnen ein vielseitiges Programm zu bieten, das neben<br />
Wissenstransfer und Meinungsaustausch auch Raum für kontroverse Diskussionen<br />
schaffen soll.<br />
Wir, die umweltmedizinischen Verbände <strong>IGUMED</strong>, dbu, ÖÄB, DGUHT und<br />
BUND, zusammen mit dem Labor Dr. Fenner und Kollegen, möchten dieses<br />
Jahr das Thema <strong>der</strong> chronischen Erkrankungen herausstellen. Unter beson<strong>der</strong>er<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Schwerpunkte Pestizide und Ernährung im wissenschaftlichen<br />
Hauptprogramm werden Ihnen in zwei weiteren Workshops interessante Vorträge<br />
zu Amalgam- und Schimmelpilzexpositionen geboten.<br />
Ziel ist es, für zwei Tage eine gemeinsame und interessante Plattform zu schaffen,<br />
um aus verschiedenen Blickpunkten dazu <strong>bei</strong>zutragen, den chronisch kranken<br />
Patienten eine bessere Versorgung bieten zu können.<br />
Ein beson<strong>der</strong>er Höhepunkt unserer Veranstaltung ist <strong>der</strong> öffentliche Festvortrag<br />
von Dr. Hermann Kruse zum Thema:<br />
Ernährung und Lebensmittelbelastungen – Die Grenzen <strong>der</strong> Toxikologie<br />
Dieses Thema haben wir zum Anlass genommen, Ihnen ein Nahrungsmittelangebot<br />
ausschließlich aus biologisch erzeugtem Anbau zu servieren, das Ihnen <strong>der</strong> Koch<br />
vom Remter im Hause <strong>der</strong> Handwerkskammer zubereiten wird. Die neuen<br />
Besucher <strong>der</strong> Tagung hoffen wir damit rundherum auf den Geschmack zu bringen,<br />
damit wir Sie ggf. auch <strong>bei</strong> <strong>der</strong> nächsten <strong>Jahrestagung</strong> 2010 wie<strong>der</strong> begrüßen<br />
dürfen.<br />
Zahlreiche Aussteller haben uns bereits im Vorfeld sehr umfangreich mit<br />
Informationen und nicht zuletzt durch ihre Bereitschaft mit einem Stand<br />
teilzunehmen, unterstützt. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich<br />
bedanken.<br />
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge o<strong>der</strong> Kritik haben, sprechen Sie uns bitte<br />
direkt an o<strong>der</strong> schicken uns eine Mail, www.fennerlabor@fennerlabor.de,<br />
damit wir Ihre Anregungen und Vorschläge als Verbesserungen <strong>bei</strong> kommenden<br />
Veranstaltungen berücksichtigen können.<br />
An dieser Stelle sei allen, die zum Gelingen <strong>der</strong> <strong>Jahrestagung</strong> <strong>bei</strong>getragen haben,<br />
sehr herzlich gedankt und allen Gästen und Referenten wünschen wir einen<br />
schönen Aufenthalt in Hamburg.<br />
Ihr<br />
Dr. E. Schnakenberg Dr. Th. Fenner
Peter Jennrich<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin / Naturheilverfahren<br />
Marienstrasse 1<br />
97070 Würzburg<br />
0931-3292207<br />
peter_jennrich@yahoo.de<br />
www.tierversuchsfreie-medizin.de<br />
Schwermetalle: die toxische Bedeutung für den Menschen<br />
Seitdem Amalgam als Zahnersatzmaterial Verwendung � ndet, bewegt es die<br />
Gemüter. Für die Einen ist es ein Werkstoff par excellence, für die An<strong>der</strong>en<br />
aufgrund des Quecksilbergehaltes ein unverantwortbares Gesundheitsrisiko.<br />
Doch das Thema „Schwermetalle“ umfasst nicht nur Amalgam und Quecksilber.<br />
Auch Blei, Cadmium, Nickel und weitere potentiell toxische Metalle können<br />
beträchtlichen gesundheitlichen Schaden anrichten.<br />
Auf molekularer Ebene führen toxische Metalle zu einer Störung vitaler<br />
Reaktionsabläufe. Dies umfasst:<br />
a) die Schädigung von Enzymen, Rezeptoren, Carriermolekülen<br />
b) die Blockierung biochemischer Reaktionsabläufe (ATP Bereitstellung; Gluthationbereitstellung)<br />
c) Reaktionen mit Nucleinsäuren (zytostatische immunsuppressive Effekte;<br />
Mutationen, Tumoren)<br />
d) die Membranschädigung von Zellwänden und Zellorganellen<br />
e) den direkten Ein� uß auf die Regulation zellulärer Signalwege (NF- k B)<br />
Ein gut erforschter Pathomechanismus beschreibt die Bildung freier Radikale,<br />
die Bildung von Stickstoffradikalen, sowie die Entstehung von Peroxinitrit durch<br />
toxische Metalle. Der daraus entstehenden Schädigung <strong>der</strong> Mitochondrien wird<br />
eine Schlüsselfunktion <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Entstehung von Krankheiten und degenerativen<br />
Alterungsprozessen zugeschrieben. Wird diesem Mechanismus kein Einhalt<br />
geboten, so sind die Zelldegeneration mit entsprechen<strong>der</strong> Funktionseinschränkung<br />
<strong>der</strong> zugehörigen Organe die Folge.<br />
Im täglichen medizinischen Alltag haben wir es nur sehr selten mit einer hohen<br />
Konzentration eines einzelnen toxischen Metalls zu tun. Hingegen ist die Belastung<br />
des Menschen mit einer Vielzahl niedrig konzentrierter potentiell toxischer Metalle<br />
über eine lange Zeit an <strong>der</strong> Tagesordnung. Um die Bedeutung und die möglichen<br />
Auswirkungen dieser niedrig dosierten Belastungen richtig einschätzen zu können<br />
verdient die Haber`sche Regel beson<strong>der</strong>er Beachtung. Sie besagt, dass <strong>bei</strong> langer<br />
Expositionsdauer geringe Wirkstoffkonzentrationen die gleiche toxische Wirkung<br />
nach sich ziehen , die <strong>bei</strong> hohen Dosen und kurzer Expositionsdauer auftreten.<br />
Die Multikausalität <strong>der</strong> Schwermetalle för<strong>der</strong>t die Entstehung somatischer<br />
und psychischer Beschwerden. Die Auswirkungen von chronisch niedrig
Peter Jennrich<br />
dosierten Schwermetallbelastungen umfassen das ganze Spektrum einer<br />
allgemeinmedizinischen Sprechstunde.<br />
Umso wichtiger sollte für jeden kausal denkenden und handelnden Mediziner die<br />
Kenntnis um Diagnose und Therapie von Schwermetallbelastungen sein.<br />
Die Frage welcher Mensch von einer Schwermetallbelastung betroffen sein kann,<br />
beantwortet <strong>der</strong> Medizinische Dienst <strong>der</strong> Krankenkassen in Bayern (MDK) klar<br />
und eindeutig. Er stellt in einem sozialmedizinischen Gutachten fest, dass <strong>bei</strong> allen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e älteren Menschen in Europa von einer Schwermetallbelastung durch<br />
Ernährung und Inhalation von Schadstoffen ausgegangen werden muss. Schade ist<br />
nur, dass die daraus sich ergebenden Konsequenzen – nämlich Zugang zu Diagnose<br />
und Therapie von chronischen niedrig dosierten Schwermetallbelastungen für<br />
alle gesetzlich krankenversicherten Patienten- den Versicherten in <strong>der</strong> Regel<br />
vorenthalten werden.<br />
Peter Jennrich<br />
Werdegang:<br />
01.2000 zunächst als Jobsharing Assistent in einer Allgemeinarztpraxis tätig<br />
0<strong>9.</strong>2003 Gründung einer eigenen Privatarztpraxis<br />
10.2008 Übernahme eines allgemeinmedizinischen Kassenarztsitzes.<br />
Spezialgebiete:<br />
Ausbildung zum Clinical Metal Toxicologist im Rahmen des International Board<br />
of Clinical Metal Toxicology (IBCMT)<br />
Mitglied und Medizinischer Berater des IBCM Mitglied und wissenschaftlicher<br />
Berater <strong>der</strong> deutschen Ärztegesellschaft für klinische Metalltoxikologie (KMT)<br />
Autor des Buches „Schwermetalle – Ursache für Zivilisationskrankheiten“<br />
EDITION CO`MED 10/2007.
Dr. Dierk Remberg<br />
Zahnarzt<br />
Lehmweg 17<br />
20251 Hamburg<br />
Telefon 040. 42 10 100<br />
info@zahnaerztefalkenried.de<br />
www.zahnaerztefalkenried.de<br />
Ausleittherapien in <strong>der</strong> Zahnmedizin<br />
Einleitung<br />
• Warum ist Entgiftung so wichtig?<br />
• Anamnese, Diagnose, gängige Testverfahren<br />
o Klinisch<br />
o naturheilkundlich<br />
Unspezi� sche Ausleitungstherapie<br />
• Konzepte für Ausleittherapien,<br />
• Mittel für die Aktivierung <strong>der</strong> Entgiftungsorgane<br />
Spezi� sche Ausleitungstherapie<br />
• Klinische Verfahren<br />
• Naturheilkundlich komplementäre Verfahren<br />
Was sind die häu� gsten Störfel<strong>der</strong> Kopf-/Kieferbereich und wie werden sie<br />
behandelt?<br />
• Tote Zähne / chronische Entzündung<br />
o Chirugie, Wurzelfüllungen mit Kondensationstechnik,<br />
Mikroskop, Ausleitungsmittel<br />
• Tonsillen<br />
o Neuraltherapie, Procain<br />
• Metallbelastungen, dentale Legierungen,<br />
o Schwermetallentgiftung, DMSA, Labor- und Gusstechnik, Cave<br />
Löten, Laserschweißungen<br />
• Leerkieferbereiche<br />
o Ausleitungsmittel<br />
• Kieferhöhlen<br />
o Neuraltherapie<br />
• Materialbelastungen, Kunststoffe<br />
• Kiefergelenke, Biss, HWS
Dr. Dierk Remberg<br />
Dr. med. dent. Dierk Remberg<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1959<br />
1984 Staatsexamen an <strong>der</strong> Universität Hamburg<br />
1990 Nie<strong>der</strong>lassung und Teilhaber in <strong>der</strong> Gemeinschaftspraxis<br />
seit 1994 Kurse/Vorträge über ganzheitliche Gemeinschaftspraxiskonz<br />
epte und Integration von ganzheitlicher Zahnmedizin in ein Konzept mo<strong>der</strong>ner<br />
Zahnmedizin<br />
„Quali� ziertes Mitglied“ <strong>der</strong> Internationalen Gesellschaft für ganzheitliche<br />
Zahnmedizin e.V.<br />
Dr. Frank Bartram<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Umweltmedizin<br />
Augustinergasse 8<br />
91781 Weißenburg i. Bay.<br />
Tel.: 09141/86190<br />
www.bartram-umweltmedizin.de<br />
Erkrankungen durch Dentalersatzstoffe<br />
Teil 1 : Symptome <strong>bei</strong> Erkrankungen, ausgelöst / unterhalten durch nahezu<br />
beliebige Dentalwerkstoffe<br />
Teil 2 : Systematik Dentalwerkstoffe<br />
Teil 3 : Diagnosepfade zur Veri� zierung einer Erkrankung durch Dentalwerkstoffe<br />
Teil 4 : Therapeutische Maßnahmen<br />
Teil 5 : Ausblick in die Zukunft : UmweltZahnMedizin<br />
Dr. med. Frank Bertram<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1949<br />
Abitur, 1965<br />
Studium Biologie bis Vordiplom
Dr. Frank Bartram<br />
Studium Humanmedizin<br />
1976 Staatsexamen Universität Kiel<br />
Assistenzarztausbildung mit Schwerpunkten Chirurgie und Innere Medizin an<br />
verschiedenen Krankenhäusern in Nord- und Süddeutschland<br />
ab 1.4.1980 Nie<strong>der</strong>lassung als Allgemeinmediziner im Nordschwarzwald in<br />
eigener Praxis<br />
1992 Umsiedlung nach Bayern, Standort: Augustinergasse 8, weiterhin als<br />
Kassenarzt.<br />
Spezialgebiete:<br />
überregionale Fachpraxis für Umweltmedizin, die Praxis nimmt nicht an <strong>der</strong><br />
sog. hausärztlichen Grundversorgung teil. Nach Schaffung des Fachbereichs<br />
Umweltmedizin Ausbildung nach den Kriterien <strong>der</strong> Bundesärztekammer<br />
seit Beginn <strong>der</strong> Ausbildung zum Umweltmediziner (1994) als Dozent für diesen<br />
Ausbildungsgang tätig,<br />
Schwerpunkt :<br />
Objektivierung von umweltbedingten Erkrankungen. Anerkennungsurkunde<br />
„Umweltmedizin” : 1995 durch die Bayerische Ärztekammer.<br />
Seit Anfang 1993 bisher (Stand: 03/06) knapp 8.000 Patienten mit<br />
umweltassoziierten Krankheiten behandelt.<br />
Seit 1994 kontinuierliche Dozententätigkeit für die Aus- und Weiterbildung im<br />
Fachbereich Umweltmedizin.<br />
2001 – 2002 im Auftrag des luxemburgischen Gesundheitsministeriums<br />
wesentliche Mitbeteiligung an <strong>der</strong> Ausbildung von ca. 50 luxemburger<br />
Ärzten(innen) als Umweltmediziner nach den Kriterien <strong>der</strong> Bundesärztekammer.<br />
Europaweite Betreuung von Firmen in Schadstoff belasteten Gebäuden.<br />
Lehraufträge an den Hochschulen Hildesheim und Wismar : Themenbereich<br />
Bauen, Wohnen und Gesundheit.<br />
Seit 2007 umweltmedizinische Betreuung <strong>der</strong> Curricula zur Erlangung des<br />
Zusatztitels „UmweltZahnMedizin.
Dr. Martin Klehmet<br />
Zahnarzt<br />
Emslandstr.9<br />
28259 Bremen<br />
www.biologisch-vertraegliche-zahnmedizin.de<br />
Metallfreier Zahnersatz für jede Indikation<br />
Wir wissen heute, dass auch die Zahnmedizin mit ihren Materialien und Techniken<br />
für die Physiologie des menschlichen Organismus häu� g als belastende Umwelt<br />
gewertet werden muss. Vor allem die (Schwer-) Metalle aus konservieren<strong>der</strong><br />
und prothetischer Zahnheilkunde müssen hier genannt werden. Nach einem<br />
kurzen Bezug auf die Toxikologie, die Immunologie und die Matrixbelastung von<br />
in diesen Therapien herkömmlich gebräuchlichen Metallen sollen anhand von<br />
ausgiebigen bildlichen Falldokumentationen Möglichkeiten dargestellt werden, die<br />
es ermöglichen, jeden Fall metallfrei zu therapieren, so wie es bisher nur mit Hilfe<br />
von Metallen möglich war.<br />
Es wird auf die Technik <strong>der</strong> Zirkoniumdioxydkeramik sowohl <strong>bei</strong> festsitzendem<br />
Zahnersatz (Kronen und Brücken) als auch für den kombiniert festsitzendherausnehmbaren<br />
Zahnersatz einschließlich Geschiebe-, Steg- und<br />
Teleskoptechnik eingegangen. Weiter soll <strong>der</strong> Unterschied von chemoplastischen<br />
zu thermoplastischen Kunststoffen technisch aber auch in Bezug auf die<br />
toxikologische wie immunologische Belastung dargestellt werden. Metallfreie<br />
Implantate in Verbindung mit einer klaren „non-metal“-Strategie runden das<br />
therapeutische Arsenal ab.<br />
Dr. medic-stom/RU Martin Klehmet<br />
Werdegang:<br />
Schulausbildung:<br />
1971: Abitur Eichenschule Scheeßel (Privatschule – Internat)<br />
1972-1973 Bundeswehr<br />
Berufsausbildung:<br />
1973 Studienreise (4 Monate) Mittel-,West- und Südosteuropa<br />
1973 Immatrikulation Universität Cluj-Napoca (Rumänien)<br />
1974-79 Studium <strong>der</strong> Stomatologie (Mundheilkunde) einschließlich eines<br />
Grundstudiums Allgemeinmedizin<br />
1979 Staatsexamen und Verleihung des akad. Titels: Dr. Medic-Stomatolog<br />
(Thema: Implantologie)<br />
Beru� icher Werdegang:<br />
1979-1980 Assistenz <strong>bei</strong> Prof. Dr. Dr. Pruin<br />
1980-1982 Assistenz <strong>bei</strong> Prof. Dr. Hemken
Dr. Martin Klehmet<br />
1983 Zahnarzt-Praxisgründung in Bremen–Grolland<br />
1994 Aufgabe <strong>der</strong> Implantologie wg. <strong>der</strong> immunologischen Titanproblematik.<br />
Aufgabe <strong>der</strong> allgemeinen Amalgamtherapie<br />
Spezialgebiete:<br />
1995 Erar<strong>bei</strong>tung von Gaumen- u. Unterzungenbügelfreien Komfortlösungen<br />
auch <strong>bei</strong> Verlust <strong>der</strong> Seitenzähne<br />
1996 Interdisziplinäre Zusammenar<strong>bei</strong>t mit Ärzten u. Heilpraktikern <strong>bei</strong> <strong>der</strong><br />
Mundraumsanierung chronisch kranker Patienten<br />
1997 Entwicklung <strong>der</strong> „all in one“ Prothetik im Praxislabor (nur 1 Metall)<br />
1998 Metallfreie Teilprothetik und metallfreie große Brücken (Praxislabor).<br />
Mitgliedschaft GZM (intern. Gesellschaft.für ganzheitliche Zahnmedizin)<br />
2005 Wie<strong>der</strong>aufnahme <strong>der</strong> Implantologie aber metallfrei (kein Titan).<br />
Spezialgebiete<br />
Veranstalter des norddeutschen Symposions für ganzheitliche Medizin,<br />
Zahnmedizin, Pharmazie, heilpraktische Kunst und Physiotherapie im Netzwerk<br />
Dr. Volker von Baehr<br />
Facharzt für Laboratoriumsmedizin<br />
Institut für Medizinische Diagnostik<br />
Nicolaistraße 22, 12247 Berlin<br />
email: v.baehr@imd-berlin.de<br />
www.imd-berlin.de<br />
Labordiagnostische Möglichkeiten in <strong>der</strong> Zahnmedizin<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Medizin beherrscht heute weitestgehend die Seuchen früherer<br />
Jahre, dafür nehmen aber die chronischen entzündungsbedingten Krankheiten<br />
einen immer höheren Stellenwert ein. Millionen Menschen in Deutschland<br />
leiden an chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Allergien, Diabetes,<br />
Rheuma, Magen-, Darm- o<strong>der</strong> Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, Herz-<br />
Kreislauferkrankungen o<strong>der</strong> Parodontitis um nur die wichtigsten zu nennen.<br />
Die Fortschritte <strong>der</strong> Hochleistungsmedizin haben die Komplikationen <strong>der</strong><br />
Erkrankungen gemin<strong>der</strong>t, nicht aber <strong>der</strong>en Häu� gkeit. Vor allem <strong>bei</strong> jüngeren<br />
Patienten werden die Diagnosen immer häu� ger gestellt. Jedes dritte Kind hat im<br />
Alter von 8 Jahren allergische Sensibilisierungen.<br />
Warum werden diese Erkrankungen häu� ger? Es ist unbestritten, dass die<br />
Entzündung, das heißt die Aktivierung unseres Immunsystems den Schlüssel<br />
nahezu aller systemischen Erkrankungen darstellt. Man weiß heute, dass
Dr. Volker von Baehr<br />
eine Vielzahl individueller Trigger- und Kofaktoren als Auslöser chronisch<br />
entzündlicher Krankheiten bedeutsam sind. Diese Entwicklungen sind für die<br />
Zahnmedizin bedeutungsvoll. Sie sind gezwungen, Fremdmaterialien in den Körper<br />
ihrer Patienten dauerhaft einzubringen. Jedes Material kann aber einen Trigger für<br />
chronische Entzündungen darstellen denn es geht Wechselwirkungen mit dem<br />
Organismus ein. An<strong>der</strong>erseits werden Zahnärzte aber auch mit <strong>der</strong> Situation<br />
konfrontiert, dass immer mehr ihrer Patienten schon an chronisch entzündlichen<br />
Erkrankungen leiden. Bei ihnen müssen sie gezielt nach unverträglichen Materialien<br />
o<strong>der</strong> Störfaktoren suchen und zusätzliche entzündliche Reize vermeiden, um den<br />
bestehenden Erkrankungsprozess nicht zu beschleunigen. Der Zahnarzt ist dafür<br />
auf eine quali zierte Labordiagnostik angewiesen.<br />
Noch vor wenigen Jahren standen nahezu ausschließlich Allergien auf Metalle im<br />
Fokus des Interesses. Für diese Problematik haben sich <strong>der</strong> Lymphozytentransf<br />
ormationstest (LTT) und seine Durchführungsvarianten als valide diagnostische<br />
Labormethoden etabliert. Die rasante Entwicklung <strong>der</strong> Dentalersatzstoffe, die<br />
Implantologie aber auch die Erweiterung des Wissens über immuntoxikologische<br />
Phänomene und die erkannte Bedeutung systemischer Entzündungsreaktionen hat<br />
die Labordiagnostik für die Zahnmedizin in den letzten Jahren umfassend erweitert.<br />
Für einige Fragestellungen ist <strong>der</strong> LTT in seiner Standardausführung an Grenzen<br />
gestoßen. Zum Beispiel konnte die Problematik <strong>der</strong> „Titanunverträglichkeit„<br />
erst erfolgreich durch breite Anwendung von zytokinbasierten Testmethoden<br />
aufgear<strong>bei</strong>tet werden. Für den Nachweis vieler komplexer Ersatzstoffe einschließlich<br />
<strong>der</strong> Acrylate mussten Standardprotokolle des LTT individuell modi ziert werden.<br />
Sensibilisierungen auf organische Abbauprodukte wie Mercaptane und Thioether<br />
sind auf Grund ihrer Zytotoxizität mit dem LTT gar nicht nachweisbar, son<strong>der</strong>n<br />
erfor<strong>der</strong>ten hochsensitive Zytokinanalysen. Effektorzelltypisierung erlauben heute<br />
auch die sichere Zuordnung zum latenten o<strong>der</strong> zytotoxischen Reaktionstyp<br />
<strong>bei</strong> bestehen<strong>der</strong> Sensibilisierung. Was vor wenigen Jahren noch wenigen<br />
Universitätsklinika vorenthalten war, wird heute von vielen Medizinern und<br />
Zahnmedizinern als <strong>bei</strong>nahe selbstverständlich diagnostisch angewendet.<br />
Dr. med. Volker von Baehr<br />
Werdegang:<br />
Studium <strong>der</strong> Medizin an <strong>der</strong> Humboldt-Universität Berlin 1990-1996, anschließend<br />
Tätigkeit im Institut für Medizinische Immunologie an <strong>der</strong> Charité Berlin.<br />
Beru icher Werdegang:<br />
1997-1999 Tätigkeit in den Medizinisch Immunologischen Laboratorien München<br />
(Dr. Bieger)<br />
2000 Nie<strong>der</strong>lassung in Berlin, seit 2002 Leitung des immunologisch orientierten
Dr. Volker von Baehr<br />
Speziallabors im Institut für Medizinische Diagnostik Berlin<br />
Spezialgebiete:<br />
Optimierung und klinische Validierung zellulärer immunologischer Testverfahren<br />
Entwicklung zytokinbasierter zellulärer Immunteste zum Nachweis von Zahnersa<br />
tzmaterialsensibilisierungen.<br />
Untersuchungen zur Pathogenese von Lokalanästhetika-Sensibilisierungen<br />
Implantat-assoziierte Arthritis<br />
Dr. Joachim Mutter<br />
Praxis für Umwelt- und Integrative Medizin<br />
Lohnerhofstrasse 2<br />
78467 Konstanz<br />
Tel: ++49(0)7531/ 8139682<br />
Fax: ++49(0)7531/ 991604<br />
www.zahnklinik.de<br />
jo.mutter@web.de<br />
jm@zahnklinik.de<br />
Amalgam – Update in <strong>der</strong> Zahnmedizin<br />
Zahnamalgam (im Folgenden „ZA“) ist kontrovers wegen seines Gehalts an<br />
giftigen Schwermetallen. Es besteht neben Ag, Sn, Cu, Zn mindestens zur Hälfte<br />
aus elementarem Quecksilber (Hg). Im Gegensatz zu an<strong>der</strong>en Schwermetallen<br />
verdampft Hg ständig aus ZA-Füllungen und reichert sich in den Organen an:<br />
ZA-Träger weisen dort bis zu 12-mal höhere Hg-Konzentrationen auf. ZA ist als<br />
hochgiftiger Son<strong>der</strong>müll eingestuft; Hg gilt als giftigstes nicht-radioaktives Element.<br />
In Zellversuchen erweist es sich als zehnfach giftiger als Pb, dessen Toxizität weit<br />
unterhalb of� zieller Grenzwerte nachgewiesen ist. Von ZA-Herstellern (z.B.<br />
Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie), allen Zahnärzteverbänden und Vertretern <strong>der</strong><br />
universitären „Schul- Umweltmedizin“ wird seit Jahrzehnten behauptet, Amalgam<br />
sei völlig unschädlich; die zahlreichen Beschwerden von ZA-Träger werden meist<br />
als „psychologisch“ bedingt angesehen. In neueren Publikationen, z.B. in einem von<br />
prominenten universitären Wissenschaftlern verfassten Leitartikel im Deutschen<br />
Ärzteblatt (2008; 105 (30): 523-531) wird sogar praktisch empfohlen, <strong>bei</strong> solcherlei<br />
Patienten keinerlei weiterführende Diagnostik mehr durchzuführen. Vielmehr<br />
sollten solchen Patienten mittels „Risiko-Kommunikation“ klargemacht werden,<br />
dass die Sorgen vor Amalgam, aber auch vor Mobilfunk o<strong>der</strong> Nanopartikeln,<br />
unberechtigt seien, bzw. eine psychotherapeutische Unterstützung anzuraten sei.<br />
Auch Regierungsstellen, die sich mit <strong>der</strong> Prüfung o<strong>der</strong> Zulassung von Amalgam<br />
befassen, geben unisono mit <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Industrie und Zahnärzteverbänden
Dr. Joachim Mutter<br />
verbreiteten Meinung weltweit Entwarnung vor Amalgam. wie die jüngsten Beispiele<br />
in <strong>der</strong> EU-Kommission (SCENIHR und SCHER), dem Robert-Koch-Institut,<br />
Abteilung Umweltmedizin o<strong>der</strong> dem BfArM zeigen. Zusammenhänge zwischen<br />
ZA und schweren Krankheiten, wie z.B. Multiple Sklerose, Alzheimer, ALS<br />
werden geleugnet und diesbezügliche wissenschaftliche Hinweise ignoriert o<strong>der</strong><br />
sogar bekämpft. Diese Haltung wird ungeprüft von Politik und Rechtssprechung<br />
übernommen und Einwände von Betroffenen o<strong>der</strong> Beschwerden werden mit<br />
einheitlichen Schreiben abgewiesen. Da<strong>bei</strong> zeigt sich oft, dass Studien falsche bzw.<br />
sehr selektiv zitiert werden und verharmlosende Informationen gegeben werden.<br />
Es bestehen Hinweise dafür, dass Quecksilberdampf stärker neurotoxisch wirkt<br />
als Methyl-Quecksilber aus Fisch. Neuere Publikationen weisen auf das Risiko von<br />
Nierenschädigungen, neuropsychologischen Beeinträchtigungen, Induktion von<br />
Autoimmunerkrankungen o<strong>der</strong> Sensibilisierungen, gesteigerte oxidative Belastung,<br />
Autismus, Haut- und Schleimhautreaktionen und unspezi� sche Beschwerden durch<br />
Amalgamexposition hin. Auch die Alzheimer-Erkrankung o<strong>der</strong> die Entwicklung<br />
einer MS wird z.T. mit einer Quecksilberexposition in Zusammenhang gebracht.<br />
Es bestehen, möglicherweise erblich bedingt o<strong>der</strong> erworben, unterschiedliche<br />
interindividuelle Emp� ndlichkeiten zur Entstehung von negativen Effekten durch<br />
Amalgambelastungen. Quecksilbermessungen in Biomarkern sind aufgrund<br />
fehlen<strong>der</strong> Korrelation zu den Quecksilberkonzentrationen in den Organen nur<br />
bedingt zur Abschätzung <strong>der</strong> Quecksilberbelastung <strong>der</strong> kritischen Organe geeignet.<br />
Eine Amalgamentfernung konnte in einigen Studien <strong>bei</strong> einem relevanten Teil <strong>der</strong><br />
Patienten zur dauerhaften Verbesserung verschiedener und meistens chronischer<br />
Beschwerden führen.<br />
Die meisten Zellversuche mit Quecksilber wird durch anorganisches Hg (z.B.<br />
Quecksilberchlorid) durchgeführt. Dieses wird aber zu weniger als 15% im<br />
Gastrointestinaltrakt resorbiert, während <strong>der</strong> aus Amalgamfüllungen austretende<br />
Hg-Dampf zu 100% über die Lungenalveolen ins Blut gelangt; er durchdringt auch<br />
Schleimhäute und Bindegewebe des Mund-, Nasen- und Rachenraums. Der sich<br />
nach Aufnahme durch <strong>der</strong> Lunge im Blut be� ndliche Hg-Dampf überwindet – im<br />
Gegensatz zu anorganischem Hg - die Blut-Hirn-Schranke, gelangt ins ZNS und<br />
dort ins Zellinnere. Innerhalb <strong>der</strong> Zelle wird Quecksilberdampf durch Enzyme<br />
(z.B. Katalase) zu dem anorganischem Hg-Ion (Hg 2+ ) oxidiert. Dieses tritt mit<br />
intrazellulären (z.B. Tubulin) und -nukleären Strukturen (z.B. Erbsubstanz) in<br />
Verbindung und zerstört o<strong>der</strong> hemmt sie praktisch irreversibel.<br />
Es macht daher einen großen Unterschied, ob sich anorganisches Hg außerhalb<br />
o<strong>der</strong> innerhalb von Zellen be� ndet: Außerhalb ist es weniger toxisch, da es nicht<br />
ohne weiteres in die Zelle gelangt; innerhalb ist es hochgiftig. Bei ZA-Trägern<br />
spielt jedoch die Belastung mit Hg-Dampf, <strong>der</strong> innerhalb <strong>der</strong> Zellen zu einer <strong>der</strong><br />
giftigsten Hg-Formen umgewandelt wird, die Hauptrolle. (Intrazellulär gebundenes<br />
anorganisches Hg wird extrem langsam ausgeschieden.)
Dr. Joachim Mutter<br />
Die Befunde werden im Lichte neuer wissenschaftlichen Erkenntnisse diskutiert.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Berücksichtigung aller verfügbaren Daten kann Amalgam we<strong>der</strong><br />
medizinisch, ar<strong>bei</strong>tsmedizinisch noch ökologisch als sicheres Zahnfüllungsmaterial<br />
bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, dass die volkswirtschaftlichen Kosten durch<br />
Amalgamnebenwirkungen und Entsorgung <strong>bei</strong> weitem unterschätzt werden.<br />
Dr. med. Joachim Mutter<br />
Werdegang:<br />
1984 – 87 Berufsausbildung zum Energiegeräteelektroniker im Kraftwerk<br />
1990 – 92 Meß-und Regeltechniker in <strong>der</strong> Firma Roche AG, sowie Elektroniker<br />
in <strong>der</strong> Firma Rota Yokogawa<br />
1992 – 99 Medizinstudium/ Universität Freiburg. Promotion: AG Hirnforschung<br />
Freiburg (Prof. Dr. B. Fischer, Prof. Dr. T. Mergner)<br />
1998 - 99 Praktisches Jahr<br />
2000 - 01 Kreiskrankenhaus, Innere Medizin<br />
2001 - 08 Universitätsklinik Freiburg, Institut für Umweltmedizin und Hygiene<br />
Ambulanz für Umweltmedizin und Uni-Zentrum Naturheilkunde<br />
Spezialgebiete<br />
1999-2008 Weiterbildungen in Regulationsdiagnostik, Kinesiologie,<br />
Ernährungsmedizin, Mentalfeldtherapie, mitochondriale Medizin, ganzheitliche<br />
Krebsmedizin, Neuraltherapie, Orthomolekular-Medizin, Naturheilverfahren und<br />
Akupunktur (B-Diplom, Januar 2004)<br />
28.1.08 Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin<br />
Zusatzbezeichnung: Naturheilverfahren (2005), Akupunktur (2008)
Prof. Dr. Hans-Peter Leimer<br />
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
HAWK Hildesheim<br />
Am Forst 27<br />
D-38302 Wolfenbüttel<br />
Fon +49 5331 9717 30<br />
Fax +49 5331 9717 31<br />
info@building-physics.net<br />
www.building-physics.net<br />
Innenraumbelastung durch Schimmelpilze – Bauphysikalische und<br />
<strong>Umweltmedizinische</strong> Aspekte<br />
Seit Anfang <strong>der</strong> 70er Jahre sind gesundheitliche Aspekte Bestandteil <strong>der</strong> Beurteilung<br />
des Raumklimas. In das Blickfeld wurden diese Problemstellungen gerückt, als sich<br />
infolge Nutzung von Gebäuden gesundheitliche Beeinträchtigungen einstellten.<br />
Dieses Phänomen, das anfangs noch ausschließlich Bürogebäude betraf, wurde<br />
als „sick building syndrome“ bezeichnet. Man war <strong>der</strong> Meinung, dass Gebäude<br />
„krank“ machen. Experten gehen davon aus, dass z. Zt. noch etwa 20 Prozent <strong>der</strong><br />
Menschen davon betroffen sind. Als Ursachen werden in <strong>der</strong> Regel Schadstoffe<br />
angenommen, die in Innenräumen vorkommen. Dazu zählen Ausdünstungen aus<br />
neu eingebauten Materialien, wie etwa Kleber aus Bodenbelägen, aus Möbeln und<br />
Dämmmaterialien o<strong>der</strong> aus damls eingesetzten PVB Dichtungsmassen. Zudem<br />
können Bürogeräte wie Drucker, Kopierer o<strong>der</strong> Computer Ozon freisetzen.<br />
Klimaanlagen führen <strong>bei</strong> unsachgemäßer Wartung ebenfalls raumklimatischen<br />
Problemen. Sie führen Pollen, Pilzsporen und Keime aus <strong>der</strong> Außenluft in den<br />
Innenraum. Bei Verwendung von geeigneten Filtersystemen in den Anlagen und<br />
Leitungsführungen können die Anteile zwar reduziert werden, <strong>bei</strong> ungeeigneten<br />
Filtern o<strong>der</strong> seltenem Filterwechsel erhöht sich jedoch das Risiko von<br />
Schimmelpilzwachstum sowohl in <strong>der</strong> Anlage als auch im Raum.<br />
Diese Problematik erweiterte sich mit den Jahren auch auf den Bereich des privaten<br />
Wohnens. Hier waren es u. a. die Emissionen von PCP o<strong>der</strong> Lindan aus den mit<br />
Holzschutzanstrichen versehenen Hölzern. In Unkenntnis ihrer Gefährlichkeit<br />
wurden Holzschutzmittel in den 70er Jahren, eigentlich für den Außenbereich<br />
entwickelt, aus dekorativen Gründen auch im Innenbereich eingesetzt. Es hat sich<br />
gezeigt, dass Holzschutzmittel auch Jahre nach ihrer Anwendung in <strong>der</strong> Raumluft<br />
noch nachweisbar sind. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten dazu betragen,<br />
dass viele Phänomene aufgeklärt und <strong>der</strong> Baustof� ndustrie Vorgaben geliefert<br />
wurden, um geeignete, neue Bauprodukte zu entwickeln. Mitte <strong>der</strong> 80er Jahre<br />
führten erhöhte Anfor<strong>der</strong>ungen des Wärmeschutzes in Teilen zu einem falsch<br />
verstandenen Umgang mit dem Thema Energieeinsparung. Bei <strong>der</strong> Instandsetzung<br />
wurden dichte Fenster in schlecht gedämmte Gebäudeaußenwände eingebaut.<br />
Die Gebäudedichtheit wurde in diesem Falle zwar deutlich erhöht, gleichzeitig<br />
die hygienisch erfor<strong>der</strong>liche Luftwechselrate mit <strong>der</strong> Außenluft massiv verringert.
Prof. Dr. Hans-Peter Leimer<br />
Die Folge war neben erhöhten Immissionswerten in den Wohnungen, z.B. aus<br />
Formaldehyd <strong>der</strong> Pressspanplatten o<strong>der</strong> VOC (Volatile Organic Compounds),<br />
auch eine Erhöhung <strong>der</strong> rel. Luftfeuchte, die zu einem Tauwasserausfall und<br />
erheblichem Schimmelpilzwachstum in den Wohnungen, vorrangig im Bereich von<br />
Wärmebrücken, führte bzw. führen konnte. Ein reduziertes Lüftungsverhalten <strong>der</strong><br />
Nutzer, durch den „übertriebenen“ Wunsch so zusätzlich Energie einzusparen,<br />
verschärfte diese Situation.<br />
Betrachte man diese Zusammenhänge, würde es zu dem Schluss führen, dass<br />
Energie einzusparen zu einer erhöhten Gesundheitsgefährdung führt. Jedoch,<br />
im Gegenteil! Mit bauphysikalisch richtig geplanten Maßnahmen wird nicht nur<br />
<strong>der</strong> Wärmeschutz eines Gebäudes erhöht und <strong>der</strong> Energieverbrauch gesenkt,<br />
die Tauwassergefahr an <strong>der</strong> raumseitigen Bauteilober� äche und somit das<br />
Pilzwachstum auf den Wandober� ächen reduziert, son<strong>der</strong>n auch die Behaglichkeit<br />
und das Raumklima deutlich verbessert.<br />
Die Ausweitung des Mobilfunks und <strong>der</strong> dazugehörigen Basisstationen seit<br />
den frühen 90er Jahren gibt Anlass, die Ein� üsse <strong>der</strong> Sendestationen und die<br />
Einwirkung von elektromagnetischen Wellen von außen auf ein Gebäude und den<br />
hier lebenden Menschen zu untersuchen. Viele Zusammenhänge sind jedoch noch<br />
unerforscht. Hier muss, wie schon <strong>bei</strong> den Betrachtungen <strong>der</strong> raumluftspezi� schen<br />
Belange, die interdisziplinäre Forschung zwischen Medizinern und Bauphysikern<br />
ansetzen.<br />
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Arch. Hans-Peter Leimer<br />
Werdegang:<br />
Dipl.-Arch. in TFH Berlin<br />
Dipl.-Ing (Bauingenieurwesen) in TU Braunschweig<br />
1984 bis 1989 wissenschaftlicher Mitar<strong>bei</strong>ter am Institut für Baukonstruktion und<br />
Holzbau, TU Braunschweig<br />
Promotion HAB Weimar<br />
Seit 1990 selbstständige Tätigkeit in <strong>der</strong> BBS INGENIEURGesellschaft<br />
Seit 2000 Professur für Baukonstruktion und Bauphysik an <strong>der</strong> Hochschule für<br />
angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim<br />
Seit 2001 Leiter des BBS Institut - Forschungs- und Materialprü� nstitut für<br />
angewandte Bauphysik und Werkstoffe des Bauwesens<br />
Seit 2007 Leitung des Institutes für angewandte Bauphysik und Qualitätssicherung<br />
an <strong>der</strong> Hefei University - China
Dr. Frank Bartram<br />
Innenraumbelastung durch Schimmelpilze – Bauphysikalische und<br />
<strong>Umweltmedizinische</strong> Aspekte<br />
Als Folge eines Wasserschadens im Jahr 2003 an <strong>der</strong> Gebäude-Westseite durch<br />
massiven Regen fanden sich <strong>bei</strong> über 50% aller Mitar<strong>bei</strong>ter, einschließlich des<br />
Managements folgende Symptomkomplexe: Husten, Auswurf, Halskratzen,<br />
Konjunktivitis, Hautjucken, deutlicher Mangel an körperlichem Leistungsvermögen,<br />
erheblicher Mangel an Konzentrationsver-mögen. Im Winter 2005 wurde ein<br />
schwedisches Speziallabor für Innenraumbefall durch Mikroorganismen (Pegasus/<br />
Schweden) herangezogen.<br />
Analyseergebnisse:<br />
Massiver Befall mit Mikroorganismen: Bakterien und Schimmelpilze (Gefundene<br />
Schimmelpilze in allen Geschossebenen: Aspergillus spp. , Penicillium spp. und<br />
Stachybotrys).<br />
<strong>Umweltmedizinische</strong> Fragestellung:<br />
Ist es beweisbar, dass die Erkrankungen zahlreicher Mitar<strong>bei</strong>ter <strong>der</strong> Firma<br />
(wesentlich) induziert wurden durch die Exposition zu Schimmelpilzen im<br />
Betriebsgebäude?<br />
Ergebnis:<br />
Anzahl <strong>der</strong> untersuchten Angestellten n = 26. Interpretation von drei<br />
unterschiedlichen Laboranalysen, die bzgl. <strong>der</strong> von Pegasus gefundenen<br />
Schimmelpilze Aspergillus spp., Penicillium spp. und Stachybotrys abgeleitet<br />
wurden. Zur Analyse herangezogen wurden Laborwerte, die die individuelle<br />
allergische Sensibilisierungsreaktion <strong>der</strong> Schimmelpilz-exponierten Angestellten<br />
nachweisen o<strong>der</strong> ausschließen sollte. Diese Befunde wurden im Dezember 2005<br />
<strong>bei</strong> den 26 Angestellten nach Durchführung <strong>der</strong> Zwischenanamnese zur Kontrolle<br />
wie<strong>der</strong>holt.<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beschwerden nach Standortwechsel:<br />
Schlechter: kein Patient = 0%, Keine Än<strong>der</strong>ung: 6 Patienten (in dieser Kategorie<br />
hatten 3 Personen auch im Sommer 2005 keine Beschwerden): = 23%. Leicht<br />
gebessert: 5 Patienten = 19%. Sehr viel besser: 13 Patienten = 50%. Alle<br />
Angestellten mit verbesserten Beschwerden total: 18 = 69%.<br />
Es wird im Vortragsteil Dr. Bartram kurz auf die Handhabung des Sick Building<br />
Syndroms in Japan eingegangen.<br />
Interpretation / Schlussfolgerung:<br />
Die genaue Erwägung und Abwägung dieser Ergebnisse zeigen, dass die betroffene<br />
Firma keine an<strong>der</strong>e Wahl hatte als den Wechsel des Gebäudes, wie nach<br />
umweltmedizinischer Analyse empfohlen und durchgeführt, am 01. September<br />
2005, zur Wie<strong>der</strong>-Etablierung <strong>der</strong> Gesundheit <strong>der</strong> Angestellten unter wesentlich<br />
verbesserten Bedingungen und für eine prosperierende Existenz <strong>der</strong> Firma in<br />
Zukunft.<br />
(Curriculum Vitae siehe Vortrag Erkrankungen durch Dentalwerkstoffe)
Dr. Regine Szewzyk<br />
Umweltbundesamt, FG II 1.4<br />
Postfach 1406<br />
06813 Dessau-Roßlau<br />
www.umweltbundesamt.de<br />
Sensibilisierung von Kin<strong>der</strong>n gegenüber Schimmelpilzen<br />
Untersuchungen im Rahmen des Kin<strong>der</strong>-Umwelt-Surveys (KUS)<br />
Der KUS ist <strong>der</strong> vierte Umwelt-Survey des Umweltbundesamtes und das Umweltmodul<br />
des aktuellen Kin<strong>der</strong>- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) des Robert<br />
Koch-Instituts (RKI). Ziel <strong>der</strong> von 2003 bis 2006 bundesweit durchgeführten<br />
Querschnittsstudie war es, für die Beschreibung <strong>der</strong> Belastung von Kin<strong>der</strong>n in<br />
Deutschland durch Umweltfaktoren eine umfangreiche und repräsentative Datengrundlage<br />
zu erheben. Im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie wurde <strong>bei</strong> einer<br />
Unterstichprobe des KUS <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> Exposition gegenüber<br />
Schimmelpilzsporen in <strong>der</strong> Wohnung und einer Sensibilisierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> gegenüber<br />
bestimmten Schimmelpilzarten untersucht.<br />
Die bisherigen allergologischen Testsysteme zur Feststellung einer Sensibilisierung<br />
gegenüber Schimmelpilzen berücksichtigen Schimmelpilze, die im Innenraum relevant<br />
sind, nur unzureichend. Im KUS wurde <strong>bei</strong>m allergologischen Screening ein<br />
erweitertes Spektrum an Schimmelpilzen hinsichtlich <strong>der</strong> Sensibilisierung <strong>bei</strong> allen<br />
Kin<strong>der</strong>n (n = 1538-1575) getestet.<br />
Zusätzlich zu den in kommerziellen Tests zum allergologischen Screening enthalten<br />
Schimmelpilzen (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus), die im<br />
Rahmen des KiGGs durchgeführt wurden, wurden vier Schimmelpilze, die im<br />
Innenraum bedeutend sind aufgenommen (Aspergillus versicolor, Penicillium<br />
(notatum)chrysogenum, Wallemia sebi, Eurotium spp.). Außerdem wurde Alternaria<br />
alternata – ein Schimmelpilz, <strong>der</strong> typischerweise saisonal in <strong>der</strong> Außenluft<br />
vorkommt – als Vergleich in das allergologische Screening einbezogen.<br />
Kin<strong>der</strong>, die einen positiven Befund von IgE (= 0,35 IU/ml im Blutserum) gegen<br />
Innenraumschimmelpilze aufwiesen wurden als Fälle de� niert. Diese wurden mit<br />
Kontrollen (< 0,35 IU/ml) im Verhältnis 1:3 (Fälle n=66, Kontrollen n=198), nach<br />
Alter, Geschlecht sowie Wohnregion (altes/neues Bundesland) gematcht. Die<br />
Teilnehmer wurden erneut in ihren Haushalten besucht und zu Indikatoren für<br />
eine mögliche Schimmelexposition befragt. In den Kin<strong>der</strong>- o<strong>der</strong> Wohnzimmern<br />
wurden Proben zur Sporenbelastung <strong>der</strong> Raumluft und des Bodenstaubs genommen.
Dr. Regine Szewzyk<br />
Ergebnisse<br />
Bei den untersuchten Kin<strong>der</strong>n wurden Sensibilisierungen gegenüber allen getesteten<br />
Schimmelpilzen nachgewiesen. Die Sensibilisierungsrate war <strong>bei</strong> Alternaria<br />
alternata (5,0 %) und Penicillium chrysogenum (4,8 %) am höchsten. Bei drei Kin<strong>der</strong>n<br />
wurde eine Sensibilisierung gegenüber Wallemia sebi nachgewiesen, einem<br />
Schimmelpilz, von dem bisher angenommen wurde, dass er keine allergischen<br />
Reaktionen auslöst.<br />
Schimmelpilze <strong>der</strong> Gattung Alternaria wurden nur in Ausnahmefällen im Innenraum<br />
in relevanten Konzentrationen nachgewiesen. Die Sensibilisierung gegenüber<br />
diesem Schimmelpilz ist daher auf die in <strong>der</strong> Außenluft saisonal vorkommenden<br />
erhöhten Sporenkonzentrationen zurückzuführen. Alle an<strong>der</strong>en Schimmelpilze<br />
kommen bevorzugt im Innenraum o<strong>der</strong> sowohl im Innenraum als auch in <strong>der</strong> Außenluft<br />
vor und wurden <strong>bei</strong> den weiteren Auswertungen daher als im Innenraum<br />
vorkommende Schimmelpilze o<strong>der</strong> kurz unter dem Begriff „Innenraumschimmelpilze“<br />
zusammengefasst. Insgesamt waren 8,3 % <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> gegenüber Innenraumschimmelpilzen<br />
(inklusive Cladosporium herbarum) sensibilisiert. Wie zu erwarten<br />
nahm die Sensibilisierungsrate (p = 0,01) und die Anzahl <strong>der</strong> Schimmelpilzsensibilisierungen<br />
mit dem Alter <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu. Zwischen Geschlecht und Sensibilisierung<br />
gegenüber „Innenraumschimmelpilzen“ ergab sich keine signi� kante Abhängigkeit.<br />
Zudem zeigten die Sporenmessungen <strong>der</strong> Fall-Kontroll-Studie, dass nach den Kriterien<br />
<strong>der</strong> UBA-Leitfäden in 17 % bis 27 % <strong>der</strong> untersuchten Kin<strong>der</strong>zimmer ein<br />
Schimmelbefall als wahrscheinlich angenommen werden kann. In weiteren 12 % bis<br />
22 % konnte ein Befall nicht ausgeschlossen werden. Gemessener und sichtbarer<br />
Schimmelbefall standen in einem signi� kanten Zusammenhang.<br />
Zwischen <strong>der</strong> gemessenen Sporenkonzentration und einer Sensibilisierung <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> bestand dagegen kein Zusammenhang. Beim Vergleich <strong>der</strong> Wohnungsuntersuchungen<br />
zeigte sich aber, dass in den Kin<strong>der</strong>zimmern o<strong>der</strong> Wohnzimmern<br />
<strong>der</strong> Fälle signi� kant (p = 0,05) häu� ger sichtbarer Schimmelpilzbefall auftrat als in<br />
den Wohnungen <strong>der</strong> Kontrollen.<br />
Außerdem wurden für die Wohnungen <strong>der</strong> Fälle öfter angegeben, dass in den<br />
letzten Jahren eine Grundsanierung stattgefunden hatte (p = 0,05). Die erhöhte<br />
Anzahl von Fällen in Wohnungen mit starken Sanierungsaktivitäten kann zum einen<br />
daran liegen, dass zuvor ein starker Schimmelpilzbefall vorhanden war. Es ist<br />
aber auch möglich, dass die während <strong>der</strong> Sanierung verwendeten o<strong>der</strong> aus neuen<br />
Bauprodukten entweichenden Chemikalien einen zusätzlichen Risikofaktor für<br />
eine Sensibilisierung darstellen [3].<br />
Im KUS wurde außerdem mit Hilfe von Fragebögen das Auftreten von Schimmelpilzbefall<br />
in den Wohnungen und die Gebäudecharakteristik abgefragt. In 15 % <strong>der</strong><br />
Wohnungen wurde sichtbarer Schimmelpilzbefall festgestellt. Ein� uss auf das Auf-
Dr. Regine Szewzyk<br />
treten von sichtbarem Schimmelpilzbefall hatten das Alter des Hauses sowie die<br />
Art und die Lage des Hauses. Das Auftreten von Schimmelpilzbefall war signi� kant<br />
höher (p = 0,001) in Wohnblocks und Mehrfamilienhäusern, in alten Häusern und<br />
in städtischer Umgebung.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Die bisherigen Testsysteme zur Feststellung einer Schimmelpilzallergie sind unzureichend.<br />
Die Ergebnisse des KUS zeigen, dass <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n gegenüber allen getesteten<br />
Schimmelpilzen, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung, Sensibilisierungen<br />
auftraten. Dies ist ein starker Hinweis, dass alle Schimmelpilze Allergien<br />
auslösen können. Es müssen Allergnextrakte für Innenraum-relevante Schimmelpilze<br />
entwickelt und in allergologischen Testsystemen verwendet werden.<br />
Schimmelpilzbefall in <strong>der</strong> Wohnung ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer<br />
Schimmelpilzsensibilisierung <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n. Schimmelpilzbefall sollte daher unbedingt<br />
vermieden und <strong>bei</strong>m Auftreten umgehend saniert werden. Die Ergebnisse des<br />
KUS zeigen, dass vermehrt in Wohnblocks und Mehrfamilienhäusern, in älteren<br />
Häusern und städtischer Umgebung Probleme mit Schimmelpilzbefall auftreten.<br />
Bei <strong>der</strong> anstehenden Sanierung älterer Wohnungen ist unbedingt darauf zu achten,<br />
dass Wärmedämmmaßnahmen mit ausreichenden Lüftungsmaßnahmen einhergehen,<br />
um Schimmelpilzbefall zu vermeiden. Dazu sollte eine verstärkte Information<br />
<strong>der</strong> Öffentlichkeit und <strong>der</strong> beteiligten Kreise (Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften,<br />
Architekten) statt� nden. Wärmedämmmaßnahmen sind gerade auch im<br />
sozialen Wohnungsbereich wichtig, um die Heizungskosten zu senken. Es besteht<br />
sonst die Gefahr, dass aus Kostengründen nicht ausreichend geheizt wird („fuel<br />
poverty“) mit <strong>der</strong> Folge massiven Schimmelpilzwachstums.<br />
Dr. rer. nat. Regine Szewzyk<br />
Werdegang:<br />
1977 – 1982 Studium <strong>der</strong> Biologie an <strong>der</strong> Universität Tübingen<br />
1983-1987 Diplom- und Doktorar<strong>bei</strong>t am Lehrstuhl „Mikrobielle Ökologie“ <strong>der</strong><br />
Universität Konstanz<br />
1988-1990 Post-doc <strong>bei</strong> Prof. Dr. Staffan Kjelleberg, Universität Göteborg,<br />
Schweden<br />
1990-1994 Wissenschaftliche Mitar<strong>bei</strong>terin am Schwedischen<br />
Seuchenhygienischen Institut (Swedish Institute for Infectious Disease Control),<br />
Stockholm, Schweden seit Dez. 1994 Fachgebietsleiterin FG „Mikrobiologie und<br />
Parasitologie“ am Umweltbundesamt
Lutz Höhne<br />
Zahnarzt<br />
Bahnhofstr. 24<br />
67246 Dirmstein<br />
Tel.: 06238 – 2110<br />
Fax: 06238 – 3057<br />
Email: lc.hoehne@t-online.de<br />
www.zahnarzt-hoehne.de<br />
Gerne übersehen: Lokale Aspergillosen in <strong>der</strong> Zahnheilkunde<br />
Ursachen für Erkrankungen durch Schimmelpilze werden in <strong>der</strong> Regel in einer<br />
fehlerhaften Bauweise gesucht. Hier ist bekanntermaßen eine zielgerichtete<br />
Zusammenar<strong>bei</strong>t zwischen fachkundigem Mediziner und Architekt/Baubiologen<br />
unabdingbar, um einen Expositionsstop zu erreichen.<br />
Die Sanierung eines Wohnhauses kann außerordentlich teuer werden. Gerne wird<br />
da<strong>bei</strong> übersehen, dass sich Schimmelpilze auch lokal im Körper ansiedeln können.<br />
Die übersehene lokale Schimmelpilzbelastung kann den eigentlich erwarteten<br />
gesundheitlichen Effekt durch Bausanierung verhin<strong>der</strong>n.<br />
Eine umfassende Anamnese o<strong>der</strong> auch die Überweisung zum Zahnarzt könnte<br />
sich hier für manche Patienten segensreich auswirken. Nicht selten � ndet man<br />
im zahnärztlichen Bereich lokale Aspergillosen, die sich nicht durch die übliche<br />
standardisierte Diagnostik feststellen lassen. Beispielsweise können nicht mit<br />
Antibiotika therapierbare NNH Probleme hinweisgebend auf einen lokalen<br />
Schimmelpilz sein.<br />
Die zunehmende Zahl endodontisch behandelter Zähne birgt neben dem<br />
Vorteil <strong>der</strong> erhaltenen Kaufähigkeit auch immer das Risiko einer Infektion durch<br />
Mikroorganismen, wo<strong>bei</strong> sich neben diversen Bakterien durchaus auch Candida<br />
Hefen und Schimmelpilze � nden. Einerseits � ndet sich in jedem dieser Zähne<br />
nekrotisiertes organisches Gewebe als Substrat, an<strong>der</strong>erseits bieten wir mit<br />
Zirkonoxid als fast ausschließlich verwendetem WF Material den Pilzen einen<br />
fantastischen Nährboden, vergleichbar mit <strong>der</strong> Gipskartonplatte unter <strong>der</strong><br />
Dachneigung. Einmal in� ziert werden wir den Schimmelpilz nicht mehr los.<br />
Hier ist zielgerichtet über Anamnese und entsprechen<strong>der</strong> Diagnostik vom<br />
Zahnarzt eine Aspergillose auszuschließen und im gemeinsamen Konzept mit dem<br />
Umweltarzt die Strategie des Expositionsstopps zu entwickeln.<br />
Lutz Höhne<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1952<br />
Studium <strong>der</strong> Medizin / Zahnmedizin in Antwerpen / Belgien 1972 /73
Lutz Höhne<br />
ab 1974 Studium <strong>der</strong> Zahnmedizin in Frankfurt mit Examen 1979<br />
Beru� icher Werdegang: in eigener Praxis in Dirmstein / Pfalz seit 1.4.1981 als<br />
Allgemeinzahnarzt tätig,<br />
1980 Hinwendung zu ganzheitlicher Behandlungsweise,<br />
seit 1998 Organisator und Mo<strong>der</strong>ator eines regionalen Qualitätszirkels (ZÄZ),<br />
ab 2000 zunehmend Schwerpunkt in wissenschaftlicher Diagnostik chronischer<br />
Erkrankungen,<br />
2003 Ausbildung in Karlsruhe zum Mo<strong>der</strong>ator von Qualitätszirkeln,<br />
Spezialgebiete: Initiator und zahnärztlicher Projektleiter im Ar<strong>bei</strong>tskreis<br />
Zahnmedizin des Deutschen Berufsverbandes <strong>der</strong> Umweltmediziner seit 2004,<br />
Initiator und Referent des Curriculums UmweltZahnMedizin von Ärzten,<br />
Zahnärzten und Heilpraktikern im Bereich <strong>der</strong> Umwelt-ZahnMedizin,<br />
Dr. Detlef Bock<br />
Institut für Biologie, Bauen & Umwelt<br />
42579 Heiligenhaus<br />
Veilchenweg 4<br />
Tel.: 02054 – 9384750<br />
Email: ibbu-institut.bock@t-online.de<br />
Standardisierte Analyse und Sanierung von Schimmelpilzschäden in<br />
Innenräumen<br />
Da sich <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne Mensch den größten Teil des Tages - etwa 20 Stunden<br />
- in geschlossenen Innenräumen aufhält, kommt <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Raumluft eine<br />
wesentliche Bedeutung für Gesundheit und Wohlbe� nden zu. Eine gute Luftqualität<br />
hängt nicht nur davon ab, wie und wie oft die Bewohner lüften, welchen Aktivitäten<br />
sie nachgehen, und welche Haushaltschemikalien angewendet werden.<br />
Auch im Zusammenhang mit Feuchteschäden können im Innenraum erhebliche<br />
Belastungen mit Schimmelpilzen auftreten, die zu gesundheitlichen Problemen<br />
führen können.<br />
Da man laut UMWELTBUNDESAMT (2005) davon ausgehen muss, dass<br />
Schimmelpilze gesundheitliche Probleme verursachen können, es aber nicht
Dr. Detlef Bock<br />
möglich ist, tolerierbare Schimmelpilzkonzentrationen festzulegen, sollte aus<br />
Vorsorgegründen jede Schimmelpilzquelle im Innenraum als hygienisches Problem<br />
betrachtet und beseitigt werden.<br />
Schimmelpilzschäden, die durch Schimmelpilzwachstum in/an Bauteilen und<br />
Ober� ächen entstehen, sind im Innenraum ein bedeutendes hygienisches Problem.<br />
Schimmelpilzschäden können wertmin<strong>der</strong>nde, gesundheitsgefährdende o<strong>der</strong><br />
nutzungseinschränkende Folgen haben.<br />
Da<strong>bei</strong> ist laut UMWELTBUNDESAMT (2002) zu beachten, dass Schimmelpilzschäden<br />
sichtbar und/o<strong>der</strong> nicht sichtbar und/o<strong>der</strong> verdeckt vorliegend sein können. Da<strong>bei</strong><br />
werden Schimmelschäden bereits ab einer befallenen Material� äche von 0,5 m 2<br />
einer großen Biomasse zugeordnet und als Kategorie 3-Schaden identi� ziert.<br />
Zur Erfassung und Bewertung von Schimmelpilzschäden gibt es laut VDI (2008)<br />
kein Standardverfahren. Die Vorgehensweise, <strong>der</strong> Untersuchungsumfang und<br />
die Untersuchungsverfahren sind abhängig vom jeweiligen Anlass und <strong>der</strong><br />
Aufgabenstellung.<br />
Für die Erfassung und Bewertung von Schimmelpilzquellen in Innenräumen sind<br />
Begehungen durch sachverständige Personen vor <strong>der</strong> Messung unverzichtbar.<br />
Die mit <strong>der</strong> Durchführung befassten Fachleute sollten neben bautechnischen<br />
und bauphysikalischen Kenntnissen auch über ausreichendes Fachwissen in den<br />
Bereichen Innenraumlufthygiene und Mikrobiologie verfügen. Untersuchungen<br />
erfolgen mit dem Ziel <strong>der</strong> Ermittlung von Schimmelpilzquellen in Innenräumen.<br />
Zur Absicherung von Augenscheinbefunden und Klärung von<br />
Verdachtssituationen stehen dem Sachverständigen verschiedene messtechnische<br />
Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Da<strong>bei</strong> handelt es sich um Verfahren<br />
zur Ermittlung <strong>der</strong> Schimmelpilzkonzentration in Materialien o<strong>der</strong> an<br />
Materialober� ächen, zur Messung <strong>der</strong> Schimmelpilzkonzentration in <strong>der</strong> Raumluft<br />
und zur Bestimmung <strong>der</strong> Schimmelpilzkonzentration im Hausstaub.<br />
Anlass für eine mikrobiologische Untersuchung des Innenraumes können sein:<br />
- sichtbare Schimmelpilzschäden<br />
- Materialfeuchtigkeit ohne sichtbaren Schaden<br />
- bauphysikalische Auffälligkeiten ohne sichtbaren Schaden<br />
- gesundheitliche Beschwerden ohne sichtbaren Schaden<br />
- Geruchsbelästigung ohne sichtbaren Schaden<br />
- Kontrolluntersuchungen während und nach einer Sanierung<br />
Bei sichtbaren Schimmelpilzschäden mit bekannter Ursache steht die Sanierung<br />
mit Ursachen-beseitigung im Vor<strong>der</strong>grund, mikrobiologische Untersuchungen<br />
sind in vielen Fällen nicht erfor<strong>der</strong>lich. In Verdachtsfällen ohne augenscheinlich<br />
erkennbare Quellen kann geprüft werden, ob eine erhöhte Schimmelpilzkonzentr<br />
ation im Innenraum vorliegt.<br />
Laut ROBERT-KOCH-INSTITUT (2007) ist anhand einer qualitativen<br />
Expositionsabschätzung eine grobe Einstufung <strong>der</strong> gesundheitlichen Gefährdung<br />
<strong>der</strong> Raumnutzer möglich. Um das Gesundheitsrisiko dann einzugrenzen, ist eine<br />
Differenzierung und <strong>der</strong> Nachweis einzelner Schimmelpilzarten erfor<strong>der</strong>lich.
Dr. Detlef Bock<br />
Bei einem nachgewiesenen Schimmelpilzschaden und diagnostizierter<br />
Schimmelpilzallergie o<strong>der</strong> vorliegen<strong>der</strong> Immunsuppression ist von einer<br />
gesundheitlichen Gefährdung durch eine zusätzliche Schimmelpilzexposition<br />
auszugehen.<br />
Da neuere Untersuchungen des UBA (2009) ergeben haben, dass <strong>bei</strong><br />
Schimmelpilzbefall nicht nur Schimmelpilze son<strong>der</strong>n auch bestimmte myzelbildende<br />
Bakterien - so genannte Actinomyceten - in hohen Konzentrationen auftreten,<br />
wird gefor<strong>der</strong>t, in jedem Fall Actinomyceten <strong>bei</strong> <strong>der</strong> künftigen Beurteilung<br />
gesundheitlicher Effekte durch feuchte Baumaterialien und Schimmelpilzbefall zu<br />
berücksichtigen.<br />
Laut des aktuellen Forschungsvorhabens des UBA können gesundheitliche<br />
Wirkungen <strong>bei</strong> Schimmelpilzbefall auch durch Bakterien wie die Actinomyceten<br />
<strong>der</strong> Gattungen Streptomyces, Nocardiopsis, Nocardia, verursacht werden.<br />
Bei Untersuchungen wurde gezeigt, dass die auftretenden Actinomyceten und<br />
Extrakte <strong>der</strong> befallenen Baumaterialien schädlich für lebende Zellen in Zellkulturen<br />
sein können.<br />
Bei fachgerechter Schimmelpilzsanierung (siehe hierzu den Schimmelpilz-<br />
Sanierungsleitfaden des UBA 2005) werden sowohl die Schimmelpilze als auch<br />
die Actinomyceten beseitigt, so dass für die Sanierung von Feuchteschäden mit<br />
Actinomyceten keine zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen erfor<strong>der</strong>lich sind. Da<strong>bei</strong><br />
hat die Sanierung von Schimmelbefall in <strong>der</strong> Wohnung laut UBA (2009) fachgerecht<br />
und zudem ohne den Einsatz von Desinfektionsmittel zu erfolgen.<br />
Diese neuen Erkenntnisse sollten eine beson<strong>der</strong>e Verp� ichtung zur fachgerechten<br />
Sanierung von Schimmelpilzschäden sein, damit keine sogenannten Altschäden<br />
entstehen können und über lange Zeit bestehen bleiben. Denn <strong>bei</strong> Altschäden,<br />
<strong>bei</strong> denen <strong>der</strong> Schaden zwar abgetrocknet ist und es nicht mehr zu einem<br />
Biomassezuwachs kommt, nimmt die Belastung <strong>der</strong> Umgebung nur langsam mit<br />
<strong>der</strong> Zeit ab.<br />
Dr. rer. nat. Detlef Bock<br />
Werdegang:<br />
1981 nach Abitur, Bundeswehr und Universitätsstudium <strong>der</strong> Biologie, Chemie,<br />
Physik und Zellbiologie<br />
1996 Gründung eines Sachverständigenbüro für Schadfaktoren in Innenräumen.<br />
Ar<strong>bei</strong>tsschwerpunkte:<br />
Elektromagnetische Fel<strong>der</strong>, Fogging, Schimmelpilze und Umweltschadstoffe<br />
2001 Gründung des interdisziplinären Institut für Biologie, Bauen & Umwelt<br />
(IBBU)<br />
Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften<br />
Organisation von Fachkongressen
Dr. Thomas Fenner<br />
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie<br />
Facharzt für Laboratoriumsmedizin<br />
MVZ Labor Dr. Fenner und Kollegen<br />
Bergstr. 14<br />
20095 Hamburg<br />
Tel.: 040 309 55 0<br />
Fax: 040 309 55 13<br />
Email : fennerlabor@fennerlabor.de<br />
www.fennerlabor.de<br />
Labordiagnostik <strong>bei</strong> Schimmelpilzexposition<br />
Die Labordiagnostik <strong>bei</strong> Schimmelpilzbelastungen unterteilt sich in zwei<br />
unterschiedliche Vorgehensweisen. Zum einen besteht die Möglichkeit<br />
des Nachweises des Schimmelpilzes im Innenraum selbst. Zum an<strong>der</strong>en<br />
versucht man diagnostisch die Reaktion <strong>der</strong> betroffenen Personen in einem<br />
schimmelpilzbelasteten Umfeld hinsichtlich <strong>der</strong> individuellen Reaktion und<br />
seiner individuellen Entgiftungsmöglichkeiten einzugrenzen, um daraus auch eine<br />
Therapiestrategie abzuleiten.<br />
Der Nachweis von Schimmelpilzen in Innenräumen kann orientierend über sog.<br />
Sedimentationsplatten erfolgen. Mit dieser Methode kann semiquantitativ ermittelt<br />
werden, ob eine Belastung <strong>der</strong> Innenraumluft mit Schimmelpilzsporen statt� ndet.<br />
Diese Meßmethode ist ungenau, abhängig von Feuchtigkeit <strong>der</strong> Luft, Öffnungszeit,<br />
Ausstattung <strong>der</strong> Wohnung und Standort <strong>der</strong> Platten abhängig. Parallel dazu<br />
können aus befallenen Feuchtigkeitsschäden, auf denen sichtbar ein Wachstum<br />
von Schimmel statt� ndet zur Anzucht und Typisierung eingeschickt werden.<br />
Eine genauere Abgrenzung ermöglicht die Luftkeimmessung mit einem<br />
Luftkeimsammler. Hier werden Messungen aus Innen- und Außenluft durchgeführt,<br />
die dann eine Aussage hinsichtlich Konzentration, möglicher Kontaminationsquellen<br />
und Art <strong>der</strong> Schimmelpilze zulassen. Den unterschiedlichen Schimmelpilznachweisen<br />
im Innenraum ist gemeinsam, dass neben <strong>der</strong> Belastungsabschätzung, für weitere<br />
Labortestungen des Betroffenen <strong>der</strong> Erreger vorliegt, <strong>der</strong> auch in <strong>der</strong> Wohnung<br />
anzutreffen ist. Für einige humanmedizinische Testverfahren ist erfor<strong>der</strong>lich, auf<br />
die individuellen Schimmelpilze in <strong>der</strong> Wohnung zurückgreifen zu können. Die<br />
Luftkeimmessung sollten auch immer mit einer Begehung <strong>der</strong> Wohnung einher<br />
gehen, um Feuchtigkeitsschäden nachzuweisen. Die Anwesenheit von Schimmel ist<br />
immer von Feuchtigkeit abhängig.<br />
Die Untersuchung des Betroffenen/Erkrankten unterteilt sich ebenfalls in<br />
unterschiedliche Vorgehensweisen mit verschiedenen Testmethoden. Allgemeine<br />
Laborparameter wie C-reaktives Protein (CRP) Blutsenkungsgeschwindigkeit<br />
(BSG) und die Bestimmung des großen Blutbildes erlauben die Aussage, ob eine<br />
akute o<strong>der</strong> chronische Infektion vorliegt. Spezialparameter wie die Lymphozytendi
Dr. Thomas Fenner<br />
fferenzierung (T4/T8), Immunglobuline o<strong>der</strong> die Elektrophorese können Aufschluss<br />
über die generelle körpereigene Abwehrlage, mit bestimmten Infektionserregern<br />
wie Bakterien, Viren o<strong>der</strong> Pilzen fertig zu werden, geben. Die Nierenfunktion mit<br />
Kreatinin, Harnsäure und Harnstoff und die Leberfunktion mit Cholinesterase und<br />
yGT sollte ebenfalls als Vitalparameter überprüft werden.<br />
Spezi� schere Testverfahren sind <strong>der</strong> Ausschluss einer Allergie vom Soforttyp, die<br />
an das Immunglobulin E gebunden ist, o<strong>der</strong> die Immunreaktion vom verzögerten<br />
Typ, die Immunglobulin G gebunden ist. Bei <strong>der</strong> Allergie vom Soforttyp<br />
erlaubt die Bestimmung des Gesamt-IgE eine Aussage, ob eine Allergie vor<br />
liegt. Mit sog. Gruppenantigenen kann im positiven Fall nachgewiesen werden,<br />
ob diese Allergie auch gegen verschiedene Schimmelpilze gerichtet ist. Auch<br />
die Einzelallergene stehen zur Verfügung, so dass man in <strong>der</strong> Regel gegen die<br />
häu� gsten Schimmelpilze die z.B. mikrobiologisch in einer Wohnung nachgewiesen<br />
wurden, die persönliche Emp� ndlichkeit prüfen kann. Gleichzeitig sollte mit einem<br />
PRIK-Test, <strong>bei</strong> dem einzelne Schimmelpilzextrakte in die Haut eingeritzt werden,<br />
die Emp� ndlichkeit auf einzelne Schimmelpilzspezies nachgewiesen werden.<br />
Weitere Methoden sind nasale Provokationsteste o<strong>der</strong> <strong>der</strong> sog. RAST-Test<br />
aus dem Blut. Liegt keine Allergie vom Soforttyp vor, kann <strong>der</strong> Nachweis eine<br />
Immunreaktion vom verzögerten Typ vorgenommen werden. Hier können die<br />
klinischen Beschwerden sehr unterschiedlich ausfallen und von Kopfschmerzen,<br />
Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Gelenkbeschwerde u.v.m. reichen. Lei<strong>der</strong> tragen<br />
nicht alle gesetzlichen Krankenkassen in diesem Fall den indizierten Lymphozyten<br />
Transformationstest (LTT). Der Vorteil des LTT ist auch, dass ganz individuell<br />
ausgetestet werden kann, ob <strong>der</strong> betroffene Patient auf die in <strong>der</strong> Wohnung<br />
nachgewiesenen Schimmelpilze reagiert.<br />
Ein etwas weniger sensitives Verfahren zum vorscreenen wäre hier <strong>der</strong> Nachweis<br />
von präzipitierende Antikörpern gegen Schimmelpilze im Blut. Häu� g ist die Meinung<br />
vertreten, dass man <strong>bei</strong> einer Schimmelpilzexposition in <strong>der</strong> Wohnung diese auch<br />
in Trachealsekret o<strong>der</strong> im Stuhl als Ausscheidungsprodukte nachweisen kann. Dies<br />
sind nicht validierte Methoden, die keinen klinischen Bezug aufweisen. Ebenso ist<br />
<strong>der</strong> Nachweis von Candida Antigen o<strong>der</strong> Aspergillus Antikörpern im Blut kein<br />
Nachweisverfahren, mit dem eine Expostion nachgewiesen werden kann. Beide<br />
Verfahren komme nur in <strong>der</strong> Intensivmedizin <strong>bei</strong> schwer immunsuppremierten<br />
Patienten, Tumorpatienten, knochen-markstransplantierte o<strong>der</strong> HIV-Patienten in<br />
lebensbedrohlichen Situationen mit hohem Fieber sinnvollerweise zum Einsatz.<br />
Aussage über die Belastung des Immunsystems o<strong>der</strong> die individuelle<br />
Entgiftungsleistung geben die Bestimmung z. B. <strong>der</strong> Vitamine E, C, B6, B12, o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Spurenelemente Selen und Zink.<br />
Spezielle Aussagen über die Entgiftungsleistung erlauben die Bestimmung<br />
bestimmter Entgiftungsenzyme wie Gluthation, NAD, Superoxiddismutase o<strong>der</strong><br />
das Malondialdehyd.<br />
Weitere Laborparameter sind individuell von den angegebenen klinischen
Dr. Thomas Fenner<br />
Beschwerden zur Abwägung <strong>der</strong> Differentialdiagnosen notwendig und werden<br />
hier nicht weiter aufgelistet.<br />
Eine recht junge Disziplin ist die Pharmakogenetik. Sie untersucht die angeborenen,<br />
genetisch bedingten Faktoren, die eine reduzierte Entgiftungsleistung eines Patienten<br />
individuell erheblich beeinträchtigen können. Hierzu zählen die Glutahthion-S-<br />
Transferase, das NAT-Genom, die Superoxiddismutase o<strong>der</strong> die verschiedenen<br />
genetisch festgelegten Cytochrom P450 Enzyme <strong>der</strong> Leber. Kommt es bereits<br />
angeboren zu einem Ausfall o<strong>der</strong> Mangel bestimmter Entgiftungsenzyme, so muss<br />
<strong>der</strong> Körper aufwendige Nebenwege zur Entgiftung von Schimmelpilzgiften o<strong>der</strong><br />
� üchtigen Substanzen die Schimmelpilze freisetzen. Resultat ist in diesen Fällen<br />
<strong>bei</strong> Schimmelpilzkontakt eine ausgeprägtere klinische Beschwerdesymptomatik.<br />
Weitere Informationen zu einzelnen Laborparametern o<strong>der</strong> diesem Thema<br />
� nden sie z.B. auch unter www.fennerlabor.de.<br />
Dr. med. Thomas Fenner<br />
Werdegang<br />
geb.: 1958<br />
Studium <strong>der</strong> Humanmedizin in Hamburg, Freiburg i. Breisgau, Wien/Österreich<br />
Facharzt Mikrobiologie, Laboratoriumsmedizin, Zusatzbezeichnung<br />
Umweltmedizin und Infektiologie, Fachkunde Krankenhaushygiene<br />
Aufbau und aufsichtsführen<strong>der</strong> Facharzt <strong>der</strong> Zentraldiagnostik des Bernhard<br />
Nocht Institutes für Tropenmedizin Hamburg (BNI)<br />
bis heute assoziiertes Mitglied des BNI<br />
Nie<strong>der</strong>gelassener Facharzt im MVZ Dr. Fenner und Kollegen<br />
Obmann des Berufsverbandes für Mikrobiologie in Hamburg<br />
Leitung Qualitätszirkel MCS <strong>der</strong> KV-Hamburg<br />
Veröffentlichungen von Büchern:<br />
1985 Kurzlehrbuch Immunologie im Jungjohannverlag in Neckarsulm<br />
1993 Diagnostik von Probleminfektionen im Schattauerverlag Stuttgart<br />
1996 Ökomanagement in Klinik und Praxis im Schattauerverlag<br />
1998 im Schattauerverlag Stuttgart. Therapie von Infektionen 2003 II. Au� age<br />
sowie diverse Mitautorenschaften
RA Wolfgang Baumann<br />
Annastr. 28<br />
97072 Würzburg<br />
Tel. 0931 / 46046 - 0<br />
Fax: 0931 / 46046 - 70<br />
E-mail: info@baumann-rechtsanwaelte.de<br />
Straf- und zivilrechtliche Haftung für Fehler <strong>bei</strong> Maßnahmen <strong>der</strong><br />
Innenraumanalytik und <strong>bei</strong> umweltmedizinischen Behandlungen<br />
Die Belastung von Räumen mit Umweltgiften hat die Gerichte in den letzten Jahren<br />
in vielfacher Weise beschäftigt. Zunächst haben die Zivilgerichte Schutzrechte<br />
wegen einer Kontamination von Innenräumen eher zögerlich zugesprochen.<br />
Das lag sicherlich oft daran, dass zwar Gesundheitsschäden festgestellt worden<br />
waren; <strong>der</strong> kausale Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> Exposition mit Umweltgiften<br />
und Erkrankungen konnte aber oft nicht dargestellt o<strong>der</strong> unter Beweis gestellt<br />
werden.<br />
Zwischenzeitlich ist das Informationsniveau über die gesundheitsschädigenden<br />
Wirkungen von Raumgiften gestiegen. Es gibt zunehmend auch fachliche<br />
Spezialisten für Schadstoff belastete Innenräume, die zum Teil eigene Methoden<br />
für die Dokumentation und Diagnose sowie die Sanierung <strong>bei</strong> Schadstoff bedingter<br />
Innenraumbelastung entwickelt haben. Des Weiteren gibt es auf Umweltmedizin<br />
spezialisierte Ärzte, die sich um Patienten mit Krankheitsbil<strong>der</strong>n bemühen, welche<br />
ihre Ursache in einer Exposition mit Schadstoffen aus Innenräumen haben können.<br />
Die Zusammenar<strong>bei</strong>t zwischen <strong>bei</strong>den Berufsgruppen ist nicht immer zufrieden<br />
stellend.<br />
Der vorgesehene Beitrag befasst sich mit strafrechtlichen und zivilrechtlichen<br />
Haftungsfragen 1 . Es geht also darum, inwieweit fehlgeschlagene Empfehlungen<br />
aufgrund von unzureichen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> fehlerhafter Innenraumanalytik zu<br />
strafrechtlichen Sanktionen bzw. zivilrechtlichen Ansprüchen Betroffener führen<br />
können. Des Weiteren wird untersucht, in welchem Umfang die Umweltmediziner<br />
für Fehldiagnosen o<strong>der</strong> falsche Therapien haften. Entscheidend ist da<strong>bei</strong> <strong>der</strong><br />
jeweilige P� ichtenkreis und die sich daraus ergebene Verantwortlichkeit.<br />
1 Einen ähnlichen Überblick gibt <strong>der</strong> Beitrag von Eiding/Baumann, „Zur rechtlichen Einstufung von<br />
Innenraumschadstoffen – Umweltmedizin aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Juristen“ in <strong>der</strong> Zeitung für Umweltmedizin, Heft 3/<br />
1997, S. 134-138 und ein weiterer Aufsatz von Baumann, „Rechte von Mietern <strong>bei</strong> schadstoffbelasteten Räumen“,<br />
in <strong>der</strong> genannten Zeitschrift Heft 4/2005, S. 282-286.
RA Wolfgang Baumann<br />
RA Wolfgang Baumann<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1949<br />
Studium <strong>der</strong> Rechtswissenschaften in Würzburg<br />
Assessorexamen 1975<br />
Wissenschaftlicher Mitar<strong>bei</strong>ter am Institut für Völkerrecht, Europarecht und<br />
internationales Wirtschaftsrecht <strong>der</strong> Universität Würzburg von 1975 bis 1982<br />
seit 1983 Rechtsanwalt<br />
seit 1989 Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Senior Lawyer <strong>der</strong> Kanzlei BAUMANN<br />
Rechtsanwälte Würzburg<br />
seit 2005 Mitglied <strong>der</strong> Sitzungsversammlung <strong>der</strong> Bundesrechtsanwaltskammern
Dr. Andreas Gies<br />
Leiter Abt. Umwelthygiene<br />
Umweltbundesamt, Abteilung II 1<br />
Corrensplatz 1<br />
14195 Berlin<br />
fon: 030 8903 1601<br />
fax: 030 8903 1830<br />
www.umweltbundesamt.de<br />
Hormonwirksame Chemikalien<br />
Die Diskussion über die hormonelle Wirksamkeit von Chemikalien ist seit zwanzig<br />
Jahren ein wichtiger Aspekt <strong>der</strong> Toxikologie und <strong>der</strong> Umweltmedizin. Zahlreiche<br />
Stoffe sind in <strong>der</strong> Lage, in die hormonelle Steuerung des Körpers einzugreifen.<br />
Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Diskussion standen lange Zeit Chemikalien, die wie das<br />
menschliche Östrogen wirken. Nonylphenol, Bisphenol A und Ethinylöstradiol aus<br />
<strong>der</strong> Umwelt waren hier die prominentesten Beispiele. Nicht min<strong>der</strong> bedeutend<br />
als Risiko für die menschliche Gesundheit sind jedoch auch anti-androgene<br />
Chemikalien wie die Phthalate, pp’DDE und Pestizide wie Vinclozolin.<br />
Die gesundheitliche Bewertung dieser Chemikalien ist beson<strong>der</strong>s schwierig, da<br />
Exposition und Wirkung zeitlich oft auseinan<strong>der</strong> liegen. Pränatale Exposition mit<br />
hormonwirksamen Chemikalien zeigt sich oft erst in <strong>der</strong> Pubertät, wenn z.B.<br />
die Spermienproduktion gestört wird, es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass<br />
Dosis-Wirkungskurven nicht monoton sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht<br />
Einzelstoffe die Effekte auslösen, son<strong>der</strong>n das Gemisch umweltrelevanter und<br />
ungebundener Chemikalien. Bisher ist es nicht gelungen, für Umwelthormone<br />
adäquate Bewertungsstrategien zu entwickeln, die eine nachhaltige Politik zur<br />
Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Exposition unterstützen würde.<br />
Dr. rer. nat. Andreas Gies<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1952<br />
Promotion in Biologie an <strong>der</strong> FU Berlin 1985. Nach <strong>der</strong> Leitung von<br />
Forschungsprojekten zu quantitativen Struktur-Wirkungs-Beziehungen an <strong>der</strong> FU<br />
Berlin und zur Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Tieranzahl <strong>bei</strong> toxikologischen Tests am Max<br />
von Pettenkofer-Institut des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes seit 1988 am<br />
UBA. Leitung <strong>der</strong> Fachgebiete Umweltforschung, Umweltberichterstattung und<br />
Wirkungen auf Ökosysteme. Seit 2007 Leiter <strong>der</strong> Abteilung Umwelthygiene am<br />
Umweltbundesamt.
Dr. Werner Mischke<br />
Facharzt für Innere Medizin<br />
Endokrinologie und Diabetologie<br />
Abendrothsweg 24<br />
20251 Hamburg<br />
Tel.: 040 422 3004<br />
Fax: 040 429 35525<br />
Email: Dr.Mischke@t-online.de<br />
Umwelterkrankungen und Differentialdiagnostik aus<br />
endokrinologischer Sicht<br />
Die klinische Umweltmedizin umfasst die medizinische Betreuung von<br />
Einzelpersonen mit gesundheitlichen Beschwerden o<strong>der</strong> auffälligen Befunden, die<br />
von ihnen selbst o<strong>der</strong> ärztlicherseits mit Umweltfaktoren in Verbindung gebracht<br />
werden. Diese Erkrankungen haben sehr häu� g einen langen Verlauf, und sie<br />
weisen initial unspezi� sche Symptome auf. Auch zahlreiche endokrinologische<br />
Krankheitsbil<strong>der</strong> werden erst nach langem Vorlauf auffällig. Ihre Symptome sind<br />
ebenfalls oft unspezi� sch. Daher ist es erfor<strong>der</strong>lich, dass <strong>der</strong> Umweltmediziner <strong>bei</strong><br />
seinen differentialdiagnostischen Überlegungen endokrinologische Krankheitsbil<strong>der</strong><br />
berücksichtigt bzw. in seine Diagnostik einschließt. Welche Endokrinopathien in<br />
<strong>der</strong> Praxis eine Rolle spielen und wie sei erkannt werden können, wird erläutert.<br />
Dr. med. Werner Mischke<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1944<br />
1964 Abitur<br />
1964-70 Studium Humanmedizin, Berlin und Hamburg<br />
1971 Promotion<br />
1977 Facharzt für Innere Medizin<br />
Spezialgebiet:<br />
Endokrinologie und Diabetologie seit 1981<br />
Nie<strong>der</strong>gelassen 1979-2008
Prof. Dr. Herbert Schmitz<br />
MVZ Labor Dr. Fenner und Kollegen<br />
Bergstr. 14<br />
20095 Hamburg<br />
Tel.: 040 309 55 0<br />
Fax: 040 309 55 13<br />
www.fennerlabor.de<br />
Zunahme humaner Infektionen durch Zecken<br />
Durch Zecken (Ixodes ricinus) werden vor allem die Borreliose und die<br />
Zeckenenzephalitis auf den Menschen übertragen. Die Borreliose tritt<br />
in Deutschland mit einer Häu� gkeit von ca. 1:1000 auf. Schwere Fälle mit<br />
Arthritis o<strong>der</strong> neurologischen Symptomen sind auch wegen <strong>der</strong> effektiven<br />
Behandlungsmöglichkeiten selten. Auch die Zeckenenzephalitis kommt bislang<br />
durch die effektive Impfung gegen die Virusinfektion relativ selten vor. Da die<br />
Vermehrung <strong>der</strong> Erreger durch höhere Körpertemperaturen in den Zecken<br />
begünstigt wird, wird sich eine Erhöhung <strong>der</strong> Durchschnittstemperaturen<br />
durch die Klimaerwärmung auch auf die Ausbreitung <strong>der</strong> Zecken- übertragenen<br />
Krankheiten auswirken. Dies ist bereits heute in einigen Nordeuropäischen<br />
Staaten zu beobachten.<br />
Prof. Dr. med. Herbert Schmitz<br />
Werdegang:<br />
bis 1979 Apl. Professor (Mikrobiologie) am Hygiene-Institut Freiburg.<br />
Veröffentlichungen zur Verbreitung <strong>der</strong> Zeckenenzephalitits in Südbaden.<br />
1980- 2005 Leiter <strong>der</strong> Virologischen Abteilung am Bernhard-Nocht Institut für<br />
Tropenkrankheiten. Ar<strong>bei</strong>ten über HIV, Lassa- , Filo- und Flaviviren.<br />
Jetzt: assoziierter Mitar<strong>bei</strong>ter im Bernhard-Nocht Institut und Mitglied des MVZ<br />
Labors Dr. Fenner und Kollegen.
Dr. Volker von Baehr<br />
Immunologische Effekte als Verursacher umweltmedizinischer Erkrankungen<br />
Entzündungserkrankungen sind die „Epidemie des 21. Jahrhun<strong>der</strong>ts“. In <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
Deutschland leidet inzwischen je<strong>der</strong> dritte Patient an einer <strong>der</strong> klassischen<br />
systemischen Entzündungserkrankungen wie Diabetes, Erkrankungen des<br />
rheumatischen Formenkreises, an<strong>der</strong>en Autoimmunerkrankungen, chronischen<br />
Infektionen und Darmerkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen o<strong>der</strong> zum Teil<br />
multiplen Allergien. Und diese Erkrankungen nehmen zum Teil dramatisch zu. Ein<br />
Beispiel? 1960 litten noch weniger als 5 % <strong>der</strong> Bevölkerung an Allergien, heute sind<br />
es mehr als 20%. Die mo<strong>der</strong>ne Medizin kann die Krankheitsprozesse lin<strong>der</strong>n, nicht<br />
aber das Auftreten <strong>der</strong> Erkrankungen. Was sind die Ursache für diese gefährliche<br />
Entwicklung?<br />
Die Genetik kann keinesfalls den rasanten Anstieg in den letzten 40 Jahren erklären.<br />
Viele <strong>der</strong> genannten Erkrankungen haben auch nicht eine isolierte Ursache.<br />
Tatsache ist, dass diese Erkrankungen als immunologische Erkrankungen anzusehen<br />
sind. Die Entzündung steht im Mittelpunkt des Geschehens.<br />
Es gilt als sicher, dass eine Vielzahl individueller Trigger- und Kofaktoren als Auslöser<br />
chronisch entzündlicher Krankheiten bedeutsam sind. In unserer mo<strong>der</strong>nen<br />
Gesellschaft müssen wir uns immer häu� ger und mit immer komplexeren Fremdstoffen<br />
auseinan<strong>der</strong>setzen, die in <strong>der</strong> Summe den Entzündungsauslöser darstellen<br />
und somit auf dem Boden genetischer Prädispositionen und biochemischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
die „Volkskrankheiten“ bedingen. Die mo<strong>der</strong>ne Medizin trägt lei<strong>der</strong><br />
sogar ihren Teil <strong>bei</strong>. Eingriffe in die biologische Integrität <strong>der</strong> Menschen sind zur<br />
<strong>bei</strong>nahe täglichen Routine geworden. Gemeint sind Fremdmaterialien im Bereich<br />
<strong>der</strong> Zahnmedizin, Orthopädie o<strong>der</strong> Chirurgie, medikamentöse und hormonelle<br />
Therapien, immunstimulierende o<strong>der</strong> immunsuppressive Behandlungen. Häu� g<br />
vergisst man, dass jedes Eingreifen in den Organismus Auswirkungen auf den<br />
gesamten Körper hat. Die Spezialisierung in <strong>der</strong> Medizin bedingt lei<strong>der</strong>, dass Nebenwirkungen<br />
und Folgeerkrankungen oft nicht erkannt werden, wenn diese nicht<br />
in unmittelbarem Zusammenhang zum spezi� schen Organsystem <strong>der</strong> eigenen<br />
Disziplin stehen.<br />
Das gesunde Immunsystem ist in <strong>der</strong> Lage, eine Entzündung zu verhin<strong>der</strong>n bzw.<br />
sie auf ein sinnvolles Mass zu begrenzen. Die noch heute nicht selten geäußerte<br />
Annahme, das Immunsystem wäre lediglich dafür verantwortlich, Viren, Bakterien<br />
o<strong>der</strong> Tumorzellen zu eliminieren, ist längst wi<strong>der</strong>legt. Man spricht heute immer<br />
häu� ger von <strong>der</strong> immunologischen Regulationskompetenz. Die regulatorischen T-<br />
Lymphozyten wurden in den letzten Jahren als die wichtigsten „Bremszellen“ unseres<br />
Körpers identi� ziert. Zudem sind genetische Polymorphismen bekannt, die<br />
eine Prädisposition für chronische Entzündungsverläufe bedingen. Beide Marker<br />
sind heute wesentliche Bestandteile in <strong>der</strong> umweltmedizinischen Labordiagnostik.
Dr. Volker von Baehr<br />
Viele umweltmedizinische Erkrankungen sind Systemerkrankungen. Das System<br />
ist auf vielfältige Weise gestört und wird somit anfällig. Umweltfaktoren sind dann<br />
die Trigger für chronische Entzündungen, vor allem dann, wenn Patienten darauf<br />
sensibilisiert sind. Die immunologische Labordiagnostik zielt daher auf die Beantwortung<br />
folgen<strong>der</strong> Fragen:<br />
1. Liegt eine chronische Entzündung vor?<br />
2. Ist eine Schädigung <strong>der</strong> immunologischen Regulationskompetenz vorhanden?<br />
3. Was sind die individuell verantwortlichen Entzündungsauslöser?<br />
4. Welche Faktoren sind für die Schädigung des Immunsystems verantwortlich und<br />
müssen folglich vermieden werden?<br />
(Curriculum Vitae siehe Vortrag Labordiagnostische Möglichkeiten in <strong>der</strong><br />
Zahnmedizin)<br />
Dr. Frank Bartram<br />
Therapieoptionen<br />
Basis aller Maßnahmen im Fachbereich Kurative Umweltmedizin ist das Prinzip:<br />
Expositionsvermeidung / -vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>jenigen Substanz(en), die messbar/<br />
nachweislich die Erkrankung auslösen/unterhalten.<br />
Fortschritte in <strong>der</strong> umweltmedizinischen Diagnostik / Analytik in den letzten<br />
15 Jahren führen mittlerweile häu� g zu klaren Diagnosen und zum Nachweis<br />
eindeutiger Zusammenhänge zwischen erkrankungsauslösenden Substanzen aus<br />
<strong>der</strong> Umwelt und <strong>der</strong> Symptomatik <strong>der</strong> Erkrankten.<br />
Ein mögliches Scheitern des Prinzips „Expositionsvermeidung” zeigt sich immer<br />
öfter an den sozialen Verhältnissen, in denen die Erkrankten leben. Beispielsweise<br />
kann <strong>bei</strong> eindeutigem Nachweis einer krankheitsauslösenden Exposition am<br />
Ar<strong>bei</strong>tsplatz <strong>der</strong> erkrankte Familienvater nicht einfach einen an<strong>der</strong>en Ar<strong>bei</strong>tsplatz<br />
bekommen. O<strong>der</strong> Mieter, die in einer Wohnung residieren, in <strong>der</strong> z B versteckte,<br />
krank machende Schimmelpilze vorhanden sind, um nur 2 Beispiele zu nennen.<br />
In <strong>der</strong>artigen Fällen müssen therapeutische Maßnahmen im Sinn einer<br />
Überbrückungshilfe durchgeführt werden. Symptomlin<strong>der</strong>nd sind Substitutionen<br />
mit antioxidativ wirksamen Substanzen, de� nierten Vitaminen und Vitalstoffen.<br />
Auch naturheilkundige Maßnahmen können Verbesserungen erreichen.<br />
Weitere Entwicklung wirksamer Überbrückungsmaßnahmen wird notwendig<br />
sein, wo<strong>bei</strong> im weiten Sinn antiin� ammatorische Maßnahmen zentrale Punkte sein<br />
werden. Sehr gute Erfolge zeigen sich <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Gabe von reduziertem Glutathion,<br />
auch gerade <strong>bei</strong> stark ausgeprägten umweltassoziierten Erkrankungen wie CFS<br />
und MCS.<br />
(Curriculum Vitae siehe Vortrag Erkrankungen durch Dentalwerkstoffe)
Prof. Dr. Uthe Ernst-Muth<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Wulfsdal 14<br />
22587 Hamburg<br />
Tel. 040 - 51 90 97 01<br />
Fax 040 - 51 90 96 97<br />
Email: praxis@dr-ernst-muth.de<br />
www.dr-ernst-muth.de<br />
Ernährungsberatung <strong>bei</strong> älteren Patienten<br />
Auch früher gab es Menschen, die ein hohes und sehr hohes Alter erreichten.<br />
Aber erst Ende des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts ist Langlebigkeit etwas, was die<br />
meisten Menschen <strong>der</strong> westlichen Welt erwarten können. Die durchschnittliche<br />
Lebenszeit in Deutschland beträgt für Männer 79,2 Jahre und für Frauen 83 Jahre.<br />
Den typischen Rentner, die typische Rentnerin, gibt es nicht. Es gibt eine große<br />
Variationsbreite in <strong>der</strong> Gestaltung dieser Lebensphase, abhängig von biologischen,<br />
psychischen und sozialen Umständen. Es ergeben sich große, unausgeschöpfte<br />
Lebenschancen, und die Ernährung spielt da<strong>bei</strong> eine wichtige Rolle in <strong>der</strong><br />
Vorbeugung und in <strong>der</strong> Therapie von Krankheiten.<br />
Die Ernährung des älteren Patienten muss berücksichtigen, dass <strong>der</strong> Körper<br />
weniger Kalorien verbraucht (z.B. eine Frau mit 30 Jahren 2200 kCal, mit 75<br />
Jahren 1680 kCal). Die Muskulatur wird weniger. Um dem entgegen zu wirken,<br />
ist neben regelmäßiger Bewegung auf die Zufuhr von hochwertigem Eiweiß zu<br />
achten (1 g EW/kg Körpergewicht). Die Knochendichte nimmt ab. In Deutschland<br />
gibt es fast 8 Millionen Patienten über 50Jahre, die Osteoporose o<strong>der</strong> Osteopenie<br />
haben, jährlich erleiden davon ca. 100.000 Patienten eine osteoporosebedingte<br />
Oberschenkelhalsfraktur. Die Zufuhr von Calcium und Vitamin D ist erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Nährstoffe, vor allem auch Vitamine, werden nicht mehr so gut resorbiert wie in<br />
jüngeren Jahren, <strong>der</strong> Bedarf bleibt aber gleich. Das betrifft vor allem Vitamin C, D,<br />
B1, B2, B6, B12, Folsäure und Zink.<br />
Viele ältere Menschen vertragen Fett und fette Nahrungsmittel nicht mehr. Die<br />
Gesamtfett Zufuhr sollte nicht über 80 gr/Tag hinausgehen. Grundsätzlich sind<br />
Vollkornprodukte zu bevorzugen, werden aber nicht immer gut vertragen. Mit<br />
Zucker und zuckerhaltigen Nahrungsmitteln sollen ältere Menschen vorsichtig<br />
umgehen, denn oft besteht die Neigung zu Diabetes mellitus. Als Regel gilt, wie <strong>bei</strong><br />
jüngeren Patienten auch: fünf Portionen Obst o<strong>der</strong> Gemüse am Tag.<br />
Ganz wichtig ist die ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit, beson<strong>der</strong>s für ältere<br />
Patienten, <strong>der</strong>en Nierenfunktion eingeschränkt ist (1,5-2 l Kalorien arme<br />
Flüssigkeit). Das ist die Theorie. Im Alltag gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten.<br />
Das Essverhalten hängt in hohem Masse von den sozialen Gegebenheiten ab.<br />
Nur 22% <strong>der</strong> Menschen über 80 Jahre leben in Alters- und P� egeheimen, <strong>der</strong><br />
überwiegende Teil <strong>der</strong> Älteren lebt allein, o<strong>der</strong> betreut durch Angehörige, Freunde
Prof. Dr. Uthe Ernst-Muth<br />
o<strong>der</strong> ambulante Hilfen. Der Anteil <strong>der</strong> alleinlebenden älteren Frauen ist erheblich<br />
höher, bedingt durch die längere Lebenserwartung <strong>der</strong> Frauen und durch den<br />
Umstand, dass Frauen meistens ältere Männer heiraten, die früher sterben. Essen<br />
ist eine soziale Tätigkeit, d.h. allein schmeckt es nicht so gut. Schwierigkeiten <strong>bei</strong><br />
<strong>der</strong> Fortbewegung und <strong>bei</strong>m Tragen erschweren den Einkauf und die Zubereitung<br />
<strong>der</strong> Mahlzeiten. Gemüse zu kochen und die Zubereitung einer warmen Mahlzeit ist<br />
aufwendig. Oft ist die Rente klein und erlaubt nicht immer den Kauf hochwertiger<br />
Lebensmittel.<br />
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass eine gute Ernährung die Grundlage von<br />
körperlicher, aber auch geistiger Fitness ist. Und trotzdem wird die Möglichkeit<br />
einer Ernährungsberatung in <strong>der</strong> Arztpraxis o<strong>der</strong> <strong>bei</strong> den Krankenkassen<br />
überwiegend genutzt für Adipositas Behandlung o<strong>der</strong> wenn schwerwiegende<br />
Krankheiten aufgetreten sind, wie Diabetes mellitus und Herzinfarkt, ganz selten<br />
präventiv. Zwar lohnt es in jedem Alter ,schlechte Lebensgewohnheiten’ zu<br />
verän<strong>der</strong>n. Gerade Ernährungsgewohnheiten jedoch sind sehr eingeschliffen – für<br />
einen Mann bedeutet eine Mahlzeit mit Fleisch und Soße Lebensqualität. Aber:<br />
auch kleine Schritte können Verän<strong>der</strong>ungen bringen.<br />
Grundsätzlich sollte es möglich sein, mit einer vollwertigen Ernährung den<br />
Bedarf an allen Wirkstoffen auszugleichen. Nahrungsergänzungsmittel können<br />
eine vollwertige Ernährung nicht ersetzen. Nahrungsergänzungsmittel können<br />
allerdings notwendig sein zur Osteoporoseprophylaxe (Ca, Vit. D3), manchmal<br />
Folsäure und Vit. B12.<br />
Prof. Dr. med. Uthe Ernst-Muth<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1942<br />
Studium Humanmedizin in Berlin und Wien<br />
Landarztpraxis im Kraichgau<br />
1980 Übersiedlung nach Hamburg<br />
Tätigkeit in städtischen P� egeheimen<br />
25 Jahre Kassenarztpraxis (Facharzt Allgemeinmedizin,<br />
Naturheilkunde, Ernährungsmedizin, Psychosomatik) in <strong>der</strong> Innenstadt von<br />
Hamburg<br />
Seit 2009 Privatpraxis in Hamburg/Blankenese.
Prof. Dr. Jörg Steinmann<br />
MVZ Labor Dr. Fenner und Kollegen<br />
Bergstr. 14<br />
20095 Hamburg<br />
Tel.: 040 309 55 0<br />
Fax: 040 309 55 13<br />
www.fennerlabor.de<br />
Immunologie im Alter<br />
Das Immunsystem verän<strong>der</strong>t sich mit dem Altern substanziell. Es spiegelt damit<br />
Prozesse wi<strong>der</strong>, die genetisch angelegt sind und sich auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Einzelzellen,<br />
<strong>der</strong> Organe und schließlich des gesamten Körpers äußern.<br />
Entscheidende Alterungsprozesse, welche beson<strong>der</strong>s das Immunsystem verän<strong>der</strong>n,<br />
sind die Verkürzung <strong>der</strong> Telomeren, die die Zellteilung begrenzen, die Atrophie<br />
des roten Knochenmarks, die die Lymphozytenneubildung vermin<strong>der</strong>t und die<br />
Thymusinvolution, die die Reifung neuer T-Lymphozyten einschränkt.<br />
Diese Prozesse führen zu einer immer geringer werdenden Anzahl neuer<br />
Lymphozyten und damit zu einem immer kleineren Repertoire, d.h. es werden<br />
immer weniger Antigene erkannt. Die Verän<strong>der</strong>ungen im B-Lymphozytenrepertoire<br />
können als „Oligoklonale Banden“ sichtbar werden. Bei den T-Lymphozyten fällt<br />
vor allem <strong>der</strong> Verlust des CD28-Moleküls auf.<br />
Die Alterung des Immunsystems verläuft beschleunigt <strong>bei</strong> chronisch entzündlichen<br />
Erkrankungen, sie lässt sich vor allem durch angemessene körperliche Aktivität<br />
verzögern.<br />
Prof. Dr. med. Jörg Steinmann<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1957<br />
1978 – 1980 Studium <strong>der</strong> Pharmazie in Kiel<br />
1980 – 1986 Studium <strong>der</strong> Humanmedizin in Hamburg und Kiel<br />
1986 – 1993 Assistenzarzt Immunologie Universitätsklinikum Kiel<br />
1987 Promotion, Universität Kiel<br />
1993 Habilitation, Ernennung zum Oberarzt des Instituts für Immunologie<br />
Universitätsklinikum Kiel<br />
1996 Weiterbildung Klinische Chemie, Zentrallabor, Universitätsklinikum Kiel<br />
1997 Weiterbildung Medizinische Mikrobiologie, Institut für Mikrobiologie, Universitätsklinikum<br />
Kiel<br />
1998 Weiterbildung Innere Medizin, 2. Medizinische Klinik, Universitätsklinikum<br />
Kiel<br />
1998 Ernennung zum apl. Professor für Immunologie, Universität Kiel
Prof. Dr. Jörg Steinmann<br />
2000 Facharztanerkennung für Laboratoriumsmedizin<br />
2007 Nie<strong>der</strong>lassung, Mitglied <strong>der</strong> Sozietät des Labors Dr. Fenner und Kollegen,<br />
Hamburg<br />
Prof. Dr. Xaver Baur<br />
Zentralinstitut für Ar<strong>bei</strong>tsmedizin und Maritime Medizin<br />
Seewartenstr. 10<br />
20459 Hamburg<br />
Tel. 040-428 894 500/501<br />
FAX 040-428 894 514<br />
email: baur@uke.uni-hamburg.de<br />
www.uke.de<br />
Pestizide in Containern<br />
Der weltweite Warenumschlag, <strong>der</strong> zum überwiegenden Teil mittels Containern<br />
erfolgt, hat in den letzten drei Jahrzehnten enorm zugenommen. Zum Schutz<br />
<strong>der</strong> transportierten Güter, aber auch zur Verhin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbreitung<br />
von Schädlingen, werden Container und Massenfrachter häu� g begast. Die<br />
vorschriftsgemäße Deklaration unterbleibt da<strong>bei</strong> in den allermeisten Fällen, wie<br />
eigene Untersuchungen belegen. Etwa ein Fünftel <strong>der</strong> Importcontainer ist mit<br />
Begasungsmitteln belastet. Häu� g kommen hohe Konzentrationen von toxischen<br />
Industriechemikalien wie Formaldehyd, Benzol, Toluol hinzu. Dies betrifft vor<br />
allem Importcontainer mit Schuhen und Textilien aus Fernost. Damit ergibt sich<br />
eine nicht unerhebliche Gesundheitsgefährdung für Personen, die mit dem Inhalt<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gasatmosphäre von Containern in Kontakt kommen, also vor allem von<br />
Mitar<strong>bei</strong>tern <strong>der</strong> Logistikbranche, Hafenar<strong>bei</strong>tern, Zollbeamten, Lagerar<strong>bei</strong>tern,<br />
Bediensteten des Großhandels. Aus Einzelfallbeobachtungen ist auch ein Risiko<br />
des Kunden/Verbrauchers ableitbar.<br />
Neben akuten und chronischen toxischen Wirkungen <strong>der</strong> Begasungsmittel <strong>bei</strong><br />
Überschreitungen <strong>der</strong> Luftgrenzwerte sind <strong>bei</strong> kanzerogenen Substanzen wie<br />
Brommethan und 1,2-Dichlorethan auch in niedrigen Konzentrationen kumulative<br />
Effekte zu beachten.<br />
Es sind umfassende Maßnahmen zur Reduktion <strong>der</strong> dargestellten weltweiten
Prof. Dr. Xaver Baur<br />
Gesundheitsrisiken erfor<strong>der</strong>lich, die von <strong>der</strong> intensivierten Aufklärung und<br />
systematischen lokalen Überwachung über eine geeignete Sekundärprävention bis<br />
hin zu internationalen Abstimmungen und Sanktionen reichen.<br />
Prof. Dr. med. Xaver Baur<br />
Werdegang:<br />
Ausbildung zum Landwirt<br />
Zweiter Bildungsweg und Studium <strong>der</strong> Humanmedizin an <strong>der</strong> Ludwig-<br />
Maximilians-Universität (LMU) München Facharzt für Ar<strong>bei</strong>tsmedizin, Facharzt<br />
für Innere Medizin mit den Teilgebieten Lungen- und Bronchialheilkunde und<br />
Kardiologie, Bereichsbezeichnungen Allergologie und Umweltmedizin.<br />
Habilitationsschrift (Medizinische Fakultät <strong>der</strong> LMU)<br />
Beru� icher Werdegang: 01.03.1990 bis 31.06.2000 Direktor des Berufsgenossenschaftlichen<br />
Forschungsinstituts für<br />
Ar<strong>bei</strong>tsmedizin (BGFA) in Bochum<br />
seit 01.07.2000 Ordinarius für Ar<strong>bei</strong>tsmedizin an <strong>der</strong> Universität Hamburg,<br />
Direktor des Zentralinstitutes für Ar<strong>bei</strong>tsmedizin und Maritime Medizin in<br />
Hamburg<br />
Spezialgebiete:<br />
Beratung und klinische Untersuchungen <strong>bei</strong> ar<strong>bei</strong>ts- und umweltbedingten<br />
Gesundheitsstörungen<br />
Prävention von Pneumokoniosen und Atemwegserkrankungen<br />
Pathophysiologie des Berufsasthmas einschließlich Allergenstruktur-forschung<br />
Standardisierung und Qualitätssicherung <strong>der</strong> Lungenfunktionsprüfung<br />
Leitlinienerstellung zur Diagnostik und Begutachtung von Berufskrankheiten<br />
Gesundheitsgefährdung durch Begasungsmittel und toxische Industriechemikalien<br />
Gesundheitsschutz und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> Schifffahrt<br />
Ethik in <strong>der</strong> Ar<strong>bei</strong>tsmedizin.
Prof. Dr. Wolfgang Huber<br />
Internist<br />
Nephrologie – Umweltmedizin<br />
Adlerstraße 1/5<br />
69123 Heidelberg – Wieblingen<br />
www.praxisverbund-heidelberg.de<br />
Klinische Erfahrungen <strong>bei</strong> Belastungen mit PCP, HCH und<br />
Pyrethroiden<br />
Entzündung ist eine charakteristische Antwort von biologischem Gewebe auf einen<br />
äußerlich o<strong>der</strong> innerlich ausgelösten Reiz mit <strong>der</strong> Funktion den Schädigungsreiz zu<br />
beseitigen o<strong>der</strong> zu reparieren. Entzündungsprozesse sind nicht nur auf bakterielle<br />
und virale Erkrankungen begrenzt, sie werden ebenfalls <strong>bei</strong> Chemikalien- und<br />
Metallbelastungen beobachtet. Chronische Erkrankungen werden durch die<br />
Progredienz des Entzündungsprozesses bestimmt. Auf molekularbiologischer<br />
Ebene stehen Leistungsmin<strong>der</strong>ung, Morbidität und Altern in engem Zusammenhang<br />
zum chronisch oxidativen Stress.<br />
Entzündungsprozesse chronisch degenerativer Art und Entzündungsprozesse<br />
ausgelöst durch biologische Pathogene, Chemikalien- und Metallexposition<br />
werden hinsichtlich <strong>der</strong> Parallelität in <strong>der</strong> Pathogenese neu bewertet werden<br />
müssen. Es bestehen Parallelen <strong>bei</strong> Entzündungsprozessen, <strong>bei</strong> chronisch<br />
degenerativen internistischen Prozessen und <strong>bei</strong> Entzündungsprozessen durch<br />
chlororganische Schadstoffe im Sinne vermehrter Entzündungszeichen (vermehrte<br />
In� ammation) und Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Abwehrlage. Die klinischen Erfahrungen und<br />
diagnostischen Möglichkeiten <strong>bei</strong> Belastungen mit PCP, HCH und Pyrethroiden<br />
werden aufgezeigt.<br />
Prof. Dr. med. Wolfgang Huber<br />
Werdegang:<br />
geb.:1940<br />
Universität Heidelberg, 1965<br />
1967 – 1975: I. Medizinische Klinik des Klinikums Mannheim <strong>der</strong> Universität<br />
Heidelberg (Assistenzarzt und Wissenschaftlicher Assistent)<br />
1974: Facharzt für Innere Medizin<br />
1976: Venia Legendi für das Fach Innere Medizin<br />
1975 – 1998: Abteilung Nephrologie/Hämodialyse, Rehabilitationsklinik<br />
Heidelberg-Wieblingen, Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg (Leiten<strong>der</strong> Arzt)<br />
1979: Teilgebietsbezeichnung Nephrologie<br />
1986: Professor (Prof. Dr. med. apl.) Medizinische Fakultät Mannheim <strong>der</strong><br />
Universität Heidelberg
Prof. Dr. Wolfgang Huber<br />
1992-1993: Fachgutachter im Holzschutzmittelprozess Frankfurt<br />
1995: Zusatzbezeichnung Umweltmedizin<br />
Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbandes <strong>der</strong> Umweltmediziner (dbu)<br />
1998: Privatpraxis für Umweltmedizin<br />
Spezialgebiete:<br />
Pestizide, Lösungsmittel, chlororganische Kohlenwasserstoffe, Fungizide,<br />
Nierenerkrankungen durch Schadstoffbelastung, MCS, CFS<br />
Angela von Beesten<br />
Ärztin<br />
Auf <strong>der</strong> Worth 34<br />
27389 Vahlde<br />
Tel.: 04267 – 1770<br />
Fax: 04267 – 8243<br />
Email: avonbeesten@dgn.de<br />
www.oekologischer-aerztebund.de<br />
Gentechnisch verän<strong>der</strong>te P� anzen und Pestizide: Medizinische<br />
Relevanz für den Menschen<br />
In den USA begann erstmals 1995 <strong>der</strong> kommerzielle Anbau von gentechnisch<br />
verän<strong>der</strong>ten (gv) P� anzen. Inzwischen werden in 22 Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Welt<br />
vorwiegend vier gv P� anzenarten auf etwa 125 Millionen Hektar angebaut: Soja<br />
(53%), Mais (30%), Baumwolle (12%) und Raps (5%). Hauptanbaulän<strong>der</strong> sind die<br />
USA mit 62,5 Mill. Hektar gefolgt von Argentinien mit 21,0 Mill. Hektar und<br />
Brasilien mit 15,8 Mill. Hektar.<br />
Die bisher vermarkteten gv P� anzen sind überwiegend Nahrungs- und<br />
Futterp� anzen. Dennoch werden sie zu nahezu hun<strong>der</strong>t Prozent mit folgenden<br />
Eigenschaften ausgestattet:<br />
1. Herbizidresistenz (HR)<br />
Durch gentechnisch eingefügte Resistenzgene aus Bakterien werden die P� anzen<br />
unemp� ndlich gegen ein nicht selektives Totalherbizid. Das heißt, dass sie im<br />
Gegensatz zu allen an<strong>der</strong>en P� anzen nicht eingehen, wenn sie mit dem Gift<br />
besprüht werden. Hauptsächlich kommt da<strong>bei</strong> Glyphosat (Handelsname Roundup)<br />
zum Einsatz, das von Monsanto 1974 auf den Markt gebracht wurde. Dieses<br />
Breitbandherbizid gelangt über die Blätter in die P� anze und hemmt dort das<br />
Enzym EPSP-Synthetase. Dieses Enzym spielt im Stoffwechsel <strong>der</strong> meisten P� anzen
Angela von Beesten<br />
eine wichtige Rolle für die Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren. Wenn die<br />
P� anze Glyphosat aufgenommen hat, stellt sie das Wachstum ein und stirbt ab.<br />
Die gentechnisch eingefügten Resistenzgene hingegen sind unemp� ndlich gegen<br />
Glyphosat und sorgen somit dafür, dass die P� anzen die Behandlung mit dem<br />
Totalherbizid überstehen. Neben Glyphosat wurden auch HR-P� anzen entwickelt,<br />
die das Totalherbizid Glufosinat tolerieren, das von Bayer entwickelt wurde und<br />
unter den Handelsnamen Liberty Link und Basta vermarktet wird.<br />
63 Prozent <strong>der</strong> kommerziell angebauten gv P� anzen enthalten die<br />
Herbizidresistenz.<br />
2. Insektengiftigkeit<br />
Diese Eigenschaft wird in P� anzen erzeugt, indem man ihnen ein Bakteriengen<br />
eines Bodenbakteriums (Bazillus thuringiensis) einp� anzt das bewirkt, dass die<br />
P� anze nach dem Eingriff in je<strong>der</strong> ihrer Zellen ein Toxin (Bt Toxin) produziert, das<br />
dem Gift des Bodenbakteriums ähnlich ist. Von diesem Toxin sterben Fraßinsekten<br />
wie z.B. <strong>der</strong> Maiszünsler aber auch Nichtzielorganismen, wenn sie an <strong>der</strong> P� anze<br />
fressen. Um <strong>der</strong> Entwicklung von resistenten Insekten entgegenzuwirken, werden<br />
auch gv P� anzen geschaffen, die mehr als ein Bt-Gen besitzen. Insektengiftigkeit<br />
wird vorwiegend <strong>bei</strong> Mais und Baumwolle eingesetzt.<br />
15 Prozent <strong>der</strong> kommerziell angebauten gv P� anzen sind mit Insektengiftigkeit (Bt-<br />
Toxin) ausgestattet.<br />
3. Kombinierte Resistenzen<br />
Der US-Chemieriese Dow Chemical will zusammen mit Monsanto neue gv-<br />
Maissorten auf den Markt bringen, die acht verschiedene Resistenzen gegen<br />
diverse Pestizide enthalten.<br />
Kombinierte Resistenzen (HR/Bt) sind <strong>bei</strong> 22 Prozent <strong>der</strong> kommerziell angebauten<br />
P� anzen angelegt.<br />
Die vier größten, weltweit tätigen Agrochemiekonzerne DuPont, Syngenta,<br />
Monsanto und Bayer bestimmen heute weitgehend Forschung, Entwicklung und<br />
Vermarktung transgener P� anzen, nennen mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Patente auf<br />
transgene P� anzen ihr Eigentum und sind für 56% <strong>der</strong> Forschung und Entwicklung<br />
im Bereich <strong>der</strong> Agrogentechnik verantwortlich (1). Sie machen mit ihren<br />
Gentechnikkreationen ein doppeltes Geschäft, denn sie verdienen an dem von<br />
nun an unzertrennlichen Paar: dem Totalherbizid und dem gentechnisch darauf<br />
„zugeschnittenen“ Saatgut.<br />
Die Ernährung mit einem Cocktail aus gentechnisch verän<strong>der</strong>ten Nahrungsp� anzen<br />
und Pestiziden birgt neue gesundheitliche Risiken, die bisher nicht getestet wurden.<br />
Die kommerziell vermarkteten Produkte aus dem Gentechniklabor werden nach<br />
wie vor als vollkommen unschädlich angepriesen. Bei <strong>der</strong> Risikobetrachtung<br />
von gv P� anzen wurden die Wirkungen <strong>der</strong> in ihnen enthaltenen und mit ihnen<br />
angewendeten Pestizide strä� ich außer acht gelassen. Pestizide sind chemische<br />
Gifte, die in Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzt werden, um unerwünschte
Angela von Beesten<br />
Wildkräuter, Pilze und Fraßinsekten an Kulturp� anzen zu töten. In <strong>der</strong><br />
Vergangenheit hat sich immer wie<strong>der</strong> gezeigt, dass die zunächst als segensreich<br />
angekündigten Pestizide ihre toxischen Wirkungen nicht nur an den Zielorganismen<br />
entfalteten. Schädigungen am Erbgut, an Nerven-, Hormon- und Immunsystem,<br />
Unfruchtbarkeit und Krebserkrankungen waren und sind die tragischen Folgen <strong>der</strong><br />
Anwendung von Dioxin, PCB, Lindan usw.. Erst vor wenigen Monaten wurde die<br />
durch das inzwischen verbotene Paraquat ausgelöste Alzheimer-Erkrankung eines<br />
Landwirts in Deutschland als Berufskrankheit anerkannt.<br />
Inzwischen mehren sich Hinweise darauf, dass auch die mit den gv P� anzen<br />
angewendeten Herbizide die Gesundheit gefährden.<br />
Glyphosat wird von Argentinischen Umweltorganisationen seit mindestens<br />
fünf Jahren dafür verantwortlich gemacht, dass immer mehr Menschen, die in<br />
<strong>der</strong> Nähe von genmanipulierten Sojafel<strong>der</strong>n leben, an Krebs, Missbildungen,<br />
Nierenschäden sowie an Haut- und Atemwegserkrankungen leiden. Eine bislang<br />
nicht veröffentliche Studie <strong>der</strong> Universität von Buenos Aires und des Nationalrates<br />
für Forschung in Naturwissenschaft und Technik (CONICET) kam in diesem Jahr<br />
zu dem Ergebnis, dass Glyphosat <strong>bei</strong> Embryonen von Amphibien zu Missbildungen<br />
führt. Die Forscher gehen davon aus, dass die Ergebnisse auch auf Menschen<br />
übertragbar sind (2).<br />
Eine aktuelle französische Studie <strong>der</strong> Universität Caen zeigt, dass Rückstände des<br />
Glyphosat-Herbizids Roundup, die <strong>bei</strong> den meisten auf dem Markt be� ndlichen<br />
Gentech-Lebens- und Futtermitteln nachweisbar sind, auf menschliche Zellen<br />
schädlich und sogar tödlich wirken können – selbst <strong>bei</strong> sehr niedrigen Mengen<br />
(3).<br />
Das Totalherbizid Glufosinat, das von BAYER unter den Namen BASTA und<br />
LIBERTY vertrieben wird, gehört zur Gruppe <strong>der</strong> 22 Pestizide, die nach <strong>der</strong> neuen<br />
EU-Pestizidgesetzgebung vom Markt genommen werden sollen. Die Verordnung<br />
des Europaparlaments sieht vor, dass krebserregende, erbgutschädigende und<br />
fortp� anzungsgefährdende Substanzen keine neue Zulassung erhalten dürfen.<br />
Der Wirkstoff Glufosinat ist als reproduktionstoxisch klassi� ziert und verursacht<br />
Missbildungen <strong>bei</strong> Föten. Studien zeigen, dass Glufosinat auch die Entwicklung<br />
des menschlichen Gehirns beeinträchtigen und Verhaltensstörungen hervorrufen<br />
kann. Schwedische Gesundheitsbehörden hatten schon 2006 ein Verbot <strong>der</strong><br />
Substanz gefor<strong>der</strong>t. Dem Verbot des Wirkstoffs Glufosinat muss die Konsequenz<br />
eines Zulassungsstopps für gv P� anzen mit Glufosinat-Resistenz folgen. Diese<br />
sollte auch von Ärzteorganisationen konsequent eingefor<strong>der</strong>t werden.<br />
Der französische Forscher G.E. Seralini for<strong>der</strong>t, zur Bewertung herbizidresistenter<br />
P� anzen diese genau so wie Pestizide nach <strong>der</strong> Pestizidrichtlinie CEE/91/<br />
414 zu beurteilen (4). Demnach müsste ein neues Pestizid zur Prüfung <strong>der</strong><br />
subchronischen Toxizität drei Monate an drei verschiedene Spezies verfüttert
Angela von Beesten<br />
werden – in <strong>der</strong> Regel an Ratten, Mäuse und Hunde. Chronische Toxizitätsstudien,<br />
Kanzerogenitätsstudien über 24 Monate, Reproduktionstoxische Studien über<br />
mindestens zwei Generationen sowie Neurotoxische Untersuchungen müssten<br />
durchgeführt werden. Laut Seralini gibt es absolut keinen wissenschaftlichen<br />
Grund, diese Experimente nicht auch auf die aktuellen GV-P� anzen zu übertragen.<br />
Bei fehlenden Toxizitätstests erscheint es unverantwortlich, Menschen und Tiere<br />
zukünftig lebenslang mit gv P� anzen mit Herbizidtoleranz ernähren zu wollen, wenn<br />
noch nicht einmal dreimonatige Toxizitätstests durchgeführt werden müssen.<br />
Angela von Beesten:<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1950<br />
Beru� icher Werdegang:<br />
1971 Abschluß Kin<strong>der</strong>krankenschwester, danach Berufstätigkeit in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendpsychiatrischen Abteilung <strong>der</strong> Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster.<br />
1975 Abschluß Fachhochschulstudium Sozialpädagogik (grad.) in Münster (Westf.),<br />
danach<br />
Berufstätigkeit in <strong>der</strong> öffentlichen Jugendhilfe, Drogen- und Suchtberatung in<br />
Münster und Reken (Westf.).<br />
Studium <strong>der</strong> Humanmedizin an <strong>der</strong> Westf. Wilhelmsuniversität Münster und <strong>der</strong><br />
Universität Hamburg<br />
1987 ärztliche Approbation, danach Assistenzarztzeit.<br />
Seit 1990 als Ärztin in eigener Praxis mit Schwerpunkt Homöopathie,<br />
Naturheilverfahren und Psychotherapie tätig.<br />
Spezialgebiete:<br />
2001 Mitbegrün<strong>der</strong>in und Sprecherin <strong>der</strong> Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen<br />
Grüne Gentechnik“ (Helvesiek) im Zusammenhang mit einem Freisetzungsversuch<br />
mit gentechnisch verän<strong>der</strong>tem Mais <strong>der</strong> Firma Monsanto.<br />
2002 Delegierte <strong>der</strong> Ar<strong>bei</strong>tsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) <strong>bei</strong>m<br />
„Diskurs Grüne Gentechnik“ <strong>der</strong> Bundesregierung.<br />
2002 Initiatorin und Mitbegrün<strong>der</strong>in des Umwelt- und Kulturvereins Sambucus<br />
e.V., 1. Vorsitzende.<br />
2003 Initiatorin und Mitbegrün<strong>der</strong>in des „Bündnis für gentechnikfreie Landwirtschaft<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen – Bremen – Hamburg“, Bündnissprecherin bis 2005.<br />
Seit 2003 Leiterin des AK Gentechnik im Ökologischen Ärztebund<br />
2004 bis 2009 gleichberechtigte Vorsitzende des Ökologischen Ärztebundes.<br />
Verfasserin diverser Artikel zum Thema Agro-Gentechnik und Buch „Den<br />
Schatz bewahren – Plädoyer für die gentechnikfreie Landwirtschaft“ (2005, Hrsg.<br />
Sambucus e.V.).
RA Wilhelm Krahn-Zembol<br />
Lüneburger Str. 36<br />
21403 Wendisch Evern<br />
Tel.: 04131 - 93 56 56<br />
Fax: 04131 - 93 56 57<br />
Email: ra@zembol.eu<br />
Rechtsberatung in <strong>der</strong> Umweltmedizin<br />
Auch wenn ich in meinem anwaltlichen Spezialbereich, in dem ich tagtäglich<br />
mit umweltmedizinischen Streitfragen befasst bin, erfreulicherweise feststellen<br />
kann, dass ich in sehr vielen rechtlichen Verfahren für meine Mandanten im<br />
Ergebnis erfolgreich bin, bleibt insgesamt aber zur Rechtslage im Bereich <strong>der</strong><br />
Umweltmedizin grundsätzlich festzustellen, dass wir das tatsächliche Ausmaß<br />
Gesundheitsschädigungen durch Umweltverän<strong>der</strong>ungen und -zerstörung durch<br />
den Menschen bis heute rechtlich nicht ansatzweise ausreichend rechtlich<br />
aufgear<strong>bei</strong>tet haben. Zur grundsätzlichen Dimension dieser Herausfor<strong>der</strong>ung:<br />
In den letzten 100 Jahren hat <strong>der</strong> Mensch die Erde mehr verän<strong>der</strong>t als in 1<br />
Million Jahren zuvor. Das Ausmaß selbst verursachter globaler und lokaler<br />
Umweltzerstörungen, Schadstoff- und Strahlenbelastungen hat weltweit<br />
Auswirkungen für alle Menschen. Statistisch wird zwar eingeräumt, dass z. B.<br />
mehrere Tausend Menschen pro Jahr in Nordrhein-Westfalen vorzeitig an<br />
umweltbedingten Krebserkrankungen (Luftbelastungen) sterben. Konkrete<br />
Anerkennungen von Schädigungswirkungen in Einzelfällen gibt es rechtlich<br />
aber nicht. Über 50 Millionen Stoffe haben wir inzwischen in unserer Umwelt<br />
festgestellt. 100.000 Chemikalien werden weltweit davon industriell verar<strong>bei</strong>tet.<br />
Im Berufskrankheitenrecht in Deutschland sind dagegen bisher lediglich 68<br />
Listenberufskrankheiten rechtlich anerkannt. Und die ‚of� zielle Umweltmedizin’<br />
vertritt bis heute die Auffassung, dass es keinerlei Umwelterkrankungen in <strong>der</strong><br />
Bevölkerung gibt!<br />
Ein zentraler Rechtsbegriff für die rechtliche Anerkennung umweltbedingter<br />
Schädigungen ist, ob diese als „wissenschaftlich allgemein anerkannt“ eingeordnet<br />
werden. Mit dem Begriff „wissenschaftlich allgemein anerkannt“ werden<br />
umweltmedizinische Diagnosen, die auf dem neuesten wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisstand beruhen, oft rechtlich nicht anerkannt, oft auch, weil das Ergebnis<br />
nicht gewollt ist. Unser <strong>der</strong>zeitiges Recht hinkt insofern den tatsächlichen<br />
(Schädigungs-) Abläufen eklatant hinterher. Zusätzliche Gründe dafür sind zahlreiche<br />
rechtlich ungelöste Problemstellungen: die Vielzahl <strong>der</strong> Schädigungsabläufe, lange<br />
Latenzzeiten, fehlende Wahrnehmung und Dokumentation <strong>der</strong> Vielzahl <strong>der</strong><br />
Expositionen, fehlen<strong>der</strong> Nachweis konkreter Schädiger, häu� g rechtlich nicht<br />
nachweisbare Kausalität etc.
RA Wilhelm Krahn-Zembol<br />
Zahlreiche Grenzwerte schützen in <strong>der</strong> Regel zwar vor akuten<br />
Schädigungswirkungen, die unmittelbar nach Exposition eintreten und deshalb<br />
relativ einfach zugeordnet werden können, o<strong>der</strong> auch vor Erkrankungen, die<br />
bereits wissenschaftlich abschließend in ihrer Ätiologie erforscht und statistisch<br />
signi� kant (z. B. durch randomisierte Studien) nachgewiesen sind o<strong>der</strong> durch<br />
epidemiologische Daten belegt sind. Chronische Schädigungen, erst recht durch<br />
Zusammenwirken verschiedenster Belastungen werden jedoch weitgehend nicht<br />
erfasst. Rechtlich erfolgt zudem oft durch die Gerichte nicht einmal eine konkrete<br />
Überprüfung <strong>der</strong> streitgegenständlichen Grenzwertregelungen durch neutrale<br />
Beweisaufnahme. Vielfach werden weitergehende Gefährdungen auch unterhalb<br />
of� zieller Grenzwerte z.B. des Bundesverordnungsgebers pauschal von Gerichten<br />
für lediglich hypothetisch und damit rechtlich unbeachtlich erklärt.<br />
Dass in <strong>der</strong> Wissenschaft und Medizin kontroverse Auffassungen zu Einzelthemen<br />
vertreten werden, gehört typischerweise zur Entwicklung wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisgewinns. Im Bereich <strong>der</strong> Umweltmedizin stoßen wir auf das<br />
Kuriosum, dass zwei vollkommen gegensätzliche Richtungen bestehen: Einerseits<br />
die „of� zielle“ Umweltmedizin, die Umwelterkrankungen weitgehend für<br />
ausgeschlossen erachtet, an<strong>der</strong>erseits die praktische, kurative Umweltmedizin,<br />
die mit sehr viel weiterreichenden Schädigungswirkungen <strong>bei</strong> einer Vielzahl von<br />
Menschen in <strong>der</strong> täglichen ärztlichen Praxis konfrontiert ist.<br />
Of� ziell werden in unserer Rechtsordnung in Deutschland beson<strong>der</strong>s emp� ndliche<br />
Personengruppen, zu denen auch umwelterkrankte Menschen gehören (z. B. MCS-<br />
Kranke), rechtlich nicht geschützt. Obwohl z.B. die Multiple Chemikaliensensitivität<br />
(MCS) von <strong>der</strong> Weltgesundheitsorganisation als physisches und nicht psychisches<br />
Krankheitsgeschehen klassi� ziert wurde (T78.4 im ICD-10-GM) und diese<br />
Diagnosen-Klassi� kation u.a. nach dem Sozialgesetzbuch V (Krankenversicherun<br />
gsrecht) in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland rechtlich verbindlich ist, wird diese<br />
Diagnosen-Klassi� kation von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (wie z. B. <strong>der</strong><br />
Deutschen Rentenversicherung Bund) und vielen Gutachtern und auch Gerichten<br />
nicht berücksichtigt. Im Berufskrankheitenrecht werden MCS-Erkrankungen bis<br />
heute nicht anerkannt. Die Anerkennung dieses Krankheitsbildes würde den<br />
bisherigen, inzwischen veralteten Rahmen des Berufskrankheitenrechts (ein Stoff<br />
- eine Wirkung, Monokausalität) sprengen, obwohl wissenschaftlich längst belegt<br />
ist, dass gerade durch hohe Ar<strong>bei</strong>tsplatzkonzentrationen eine generalisierte, nichtspezi�<br />
sche Sensitivität gegenüber unterschiedlichsten Chemikalien entstehen<br />
kann.<br />
Generell wird das Ausmaß <strong>der</strong> tatsächlichen Schädigungswirkungen auch<br />
rechtlich nicht ansatzweise adäquat erfasst. In <strong>der</strong> Ar<strong>bei</strong>ts- und Umweltmedizin<br />
besteht of� ziell eine vollkommen irreführende Datenlage. Wie zahlreiche Beru<br />
fskrankheitenverfahren selbst für Schwerstgeschädigte zeigen, werden aufgrund
RA Wilhelm Krahn-Zembol<br />
unterschiedlichster ar<strong>bei</strong>ts- und umweltmedizinischer Missstände, ebenso aber<br />
auch z. T. unzumutbar hoher rechtlicher Beweisanfor<strong>der</strong>ungen zahlreiche beru� ich<br />
bedingte Schädigungen nicht anerkannt. Vorsichtig formuliert ist festzustellen, dass<br />
entgegen <strong>der</strong> allgemeinen Vorstellung, dass jede beru� ich bedingte Erkrankung<br />
grundsätzlich zu entschädigen ist, umgekehrt rechtlich letztlich lediglich ein sehr<br />
geringer Teil <strong>der</strong> beru� ich bedingten Schädigungen auch rechtlich anerkannt<br />
wird!<br />
Vor diesem Hintergrund, dass bereits von dieser Ar<strong>bei</strong>tsmedizin beru� ich bedingte<br />
Schädigungen weitgehend nicht anerkannt werden, ergibt sich „folgerichtig“ aus<br />
dieser Sicht, dass dann erst recht keine entsprechenden Gefährdungen bzw.<br />
Gesundheitsschädigungen <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Allgemeinbevölkerung eintreten können.<br />
Folgerichtig geht die ar<strong>bei</strong>tsmedizinisch geprägte Umweltmedizin, die lei<strong>der</strong> auch<br />
nach wie vor of� ziell rechtlich als maßgeblich erachtet wird, davon aus, dass es<br />
dann erst recht in <strong>der</strong> Bevölkerung (fast) keine Umwelterkrankungen gibt.<br />
Vollkommen an<strong>der</strong>s stellt sich das Bild aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> kurativ orientierten<br />
Umweltmedizin dar, die sowohl empirisch als auch wissenschaftlich begründet<br />
zahlreiche Schädigungsabläufe <strong>bei</strong> Umwelterkrankten feststellen und belegen<br />
kann. Wie in <strong>der</strong> Allgemeinmedizin kommt <strong>der</strong> Labordiagnostik auch aus<br />
umweltmedizinischer Sicht (im Sinne <strong>der</strong> kurativen Umweltmedizin) ein hoher<br />
Stellenwert zur Objektivierung des jeweils vorliegenden umweltmedizinischen<br />
Krankheitsbildes zu. Zwar ist festzustellen, dass vielfach einzelne Laborparameter<br />
für sich allein nicht ausreichen, um ein Krankheitsbild zu objektivieren, dass aber<br />
selbstverständlich <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Diagnosestellung auch Laborparameter je nach Sachlage<br />
eine wesentlich mitentscheidende Rolle zur Objektivierung eines Krankheitsbildes<br />
spielen können.<br />
Die rechtliche Anerkennung von umweltbedingten Schädigungen setzt nach <strong>der</strong><br />
deutschen Rechtslage einerseits voraus, dass <strong>der</strong> entsprechende Schädigungsablauf<br />
abstrakt-wissenschaftlich nachgewiesen und belegt ist, zum an<strong>der</strong>en, dass ein<br />
entsprechen<strong>der</strong> Schädigungszusammenhang im konkreten Fall bewiesen werden<br />
kann. Damit bleibt mangels angeblich fehlen<strong>der</strong> wissenschaftlicher Anerkennung<br />
entsprechen<strong>der</strong> (genereller) Schädigungsabläufe dann die große Vielzahl<br />
tatsächlicher (konkreter) Schädigungen in Deutschland rechtlich sanktionslos,<br />
zu Lasten <strong>der</strong> jeweils Geschädigten und letztlich aber auch zu Lasten <strong>der</strong><br />
Gesamtbevölkerung, welche selbst aus den schon eingetretenen Schädigungen auf<br />
diese Art und Weise nicht lernen kann.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Umweltmedizin erleben wir das vielleicht vergleichbare Kuriosum,<br />
wie wir es in <strong>der</strong> Klimaforschung erlebt haben. Auch dort gab es einen großen<br />
Teil von Klimaforschern, die lange Zeit bemüht waren zu belegen, dass es<br />
keine (menschengemachten) Klimaverän<strong>der</strong>ungen (erst recht nicht erheblichen
RA Wilhelm Krahn-Zembol<br />
Ausmaßes) gibt. Heute wissen wir, dass es heftige Klimaverän<strong>der</strong>ungen dieser<br />
Art gibt und dass diese eine große Herausfor<strong>der</strong>ung für die ganze Menschheit<br />
darstellen.<br />
Auch die Umweltmedizin konfrontiert uns zunächst zwar mit unangenehmen<br />
Ergebnissen. Diese jedoch zu ignorieren, bedeutet, weiteres Leiden und<br />
gesundheitliche Schädigungen für eine Vielzahl von Menschen in <strong>der</strong> Zukunft<br />
weiterhin in Kauf zu nehmen und die notwendigen Schritte zur Än<strong>der</strong>ung dieser<br />
Abläufe zu unterlassen.<br />
Grundsätzlich werden wir uns deshalb die Frage stellen müssen, ob wir weiterhin<br />
wissenschafts- und rechtsdogmatischen Maßstäben den Vorrang einräumen wollen<br />
und damit zu „wirklichkeitsfremden“ Ergebnissen gelangen, o<strong>der</strong> ob sich aufgrund<br />
<strong>der</strong> jetzt schon nachweisbaren Schädigungswirkungen durch Umweltschadstoffe<br />
etc. nicht vielmehr die Notwendigkeit ergibt, sowohl medizinisch-wissenschaftlich<br />
als auch rechtlich adäquatere Antworten auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen unserer<br />
Zeit zu � nden. Darin liegt dann auch die Chance, wenigstens zukünftig vielfältiges<br />
weiteres Leiden zu verhin<strong>der</strong>n und statt zu einer immer weiteren Verdrängung<br />
und damit Eskalation <strong>der</strong> Probleme zu ihrer Lösung (!) zu � nden.<br />
RA Wilhelm Krahn-Zembol<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1955<br />
Schulausbildung:<br />
1973 Abitur<br />
Beru� iche Ausbildung:<br />
1974-1976 Banklehre <strong>bei</strong> einer alten hanseatischen Großbank<br />
1976-1980/81 Jurastudium in Hamburg, längere Auslandspraktika in Banken in<br />
London und Paris<br />
1982-1984 Referendariat, davon über ein Jahr <strong>bei</strong>m Umweltbundesamt in Berlin<br />
Beru� icher Werdegang:<br />
Forschungstätigkeit sowie diverse Tätigkeiten, u.a. als Jurist in einem großen<br />
deutschen Umweltverband<br />
ab 1992 bis heute selbständig als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei<br />
Spezialgebiete:<br />
ausschließlich tätig <strong>bei</strong> umweltrechtlichen, umweltmedizinischen und<br />
toxikologischen Problemstellungen, bundesweite Tätigkeit, einschließlich<br />
Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof. Zu meinen Mandanten<br />
gehören privat Betroffene, Geschädigte und Umwelterkrankte ebenso wie z.<br />
B. Städte, Gemeinden o<strong>der</strong> gemeinnützige Organisationen, ebenso Ärzte in<br />
Verfahren, welche die Umweltmedizin betreffen.
Dr. Anke Bauer<br />
Fachkliniken Nordfriesland gGmbH<br />
Krankenhausweg 3<br />
25821 Bredstedt<br />
Email: dr-anke-bauer@web.de<br />
www.fkinf.de<br />
Schweregrad und Versorgung <strong>Umweltmedizinische</strong>r Krankheiten<br />
Die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen erlebt zur Zeit ein<br />
erhebliches Interesse in Forschung und Politik. Zu <strong>der</strong> medizinischen Versorgung<br />
von Patienten mit chronischen umweltmedizinischen Störungsbil<strong>der</strong>n liegen<br />
bisher keine Daten aus Deutschland o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n vor. Jedoch sind in<br />
allen bekannten Untersuchungen Patienten mit chronischen umweltmedizinischen<br />
Störungen (P ) im Vergleich mit Bevölkerungsstichproben gesundheitlich-<br />
UM<br />
funktionell deutlich beeinträchtigt: Die gesundheitsbezogene Lebensqualität von<br />
P liegt im SF-36 (Fragebogen zum Gesundheitszustand) im Bereich von Patienten<br />
UM<br />
mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen bzw. Herzinsuf� zienz/Herzschwäche<br />
und in einigen Bereichen sogar darunter (Eis et al. 2003). Die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität von P ist im NHP (Nottingham Health Pro� le) insbeson<strong>der</strong>e in den<br />
UM<br />
Bereichen „Energie“ und „Schmerzen“ erheblich beeinträchtigt und schlechter als<br />
<strong>bei</strong> stationären Patienten <strong>der</strong> Psychosomatik o<strong>der</strong> <strong>bei</strong> Diabeteskranken (Schwarz<br />
et al. 2006). Spezi� sche Symptome (SL-SUM des Neurotox-Fragebogens) treten<br />
<strong>bei</strong> den P signi� kant häu� ger und schwerer auf als in <strong>der</strong> Bevölkerung o<strong>der</strong> <strong>bei</strong><br />
UM<br />
psychosomatischen Patienten (Schwarz et al. 2006).<br />
Der mittlere Leidensdruck <strong>der</strong> P nach dem SCL-90-R (Symptom-Check-List-90-<br />
UM<br />
Revised) entspricht in allen Skalen annähernd denen von lösemittelexponierten<br />
Ar<strong>bei</strong>tern mit Lösemittelsyndrom vom Typ 2a, die schon vielfach beschrieben<br />
wurden (Baker et al., 1990, Karlsson et al. 2000, Eis et al. 2003). P mit UM<br />
einer komorbiden Diagnose aus dem Abschnitt „F“ des ICD-10 (z.B.<br />
Anpassungsstörungen, Depressionen, Angststörungen) sind in allen Bereichen<br />
beson<strong>der</strong>s schwer betroffen (Schwarz et al. 2006).<br />
Die hier präsentierten Ergebnisse zur Versorgungslage von P am Beispiel von<br />
UM<br />
MCS (Multiple Chemical Sensitivity) entstammen einer eigenen aktuellen online-<br />
Pilotstudie (Bauer et al. 2009) mit 25 MCS-Patienten (P ) einer Selbsthilfegruppe<br />
MCS<br />
aus dem Postleitzahlbereich 2.<br />
Ergebnisse: Im Mittel vergingen 12,8 Jahre bis zur Diagnosestellung <strong>der</strong> MCS. Vor<br />
<strong>der</strong> umweltmedizinischen Erstdiagnose gaben die Betroffenen im Durchschnitt<br />
74,8 Arztbesuche und 2,2 Klinikaufenthalte zur Klärung ihrer Beschwerden an.<br />
Erstmalig eine umweltmedizinische Diagnose erhielten die P im wesentlichen von<br />
MCS<br />
nie<strong>der</strong>gelassenen Umweltmedizinern (52%), Ärzten in einer Klinik mit Abteilung
Dr. Anke Bauer<br />
für Umweltmedizin (36%) sowie Hausärzten/ Allgemeinmedizinern (12%) Die<br />
aktuelle Betreuung wird im wesentlichen von Hausärzten/ Allgemeinmedizinern<br />
(44%) geleistet. Nur 40% bzw. 32% <strong>der</strong> P sind aktuell von nie<strong>der</strong>gelassenen<br />
MCS<br />
Umweltmedizinern bzw. Ärzten in einer Klinik mit Abteilung für Umweltmedizin<br />
betreut. Es sind lange Wartezeiten auf Termine sowie weite Entfernungen, die<br />
die Betroffenen auf dem Weg zu umweltmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten<br />
zurücklegen, auffällig.<br />
Müssen die Patienten mit sonstigen behandlungsbedürftigen Erkrankungen an<strong>der</strong>e<br />
Ärzte o<strong>der</strong> Krankenhäuser aufsuchen, treffen sie auf erhebliche Barrieren. Das<br />
Verständnis des dortigen medizinischen Personals für die Intoleranzreaktionen <strong>der</strong><br />
Betroffenen insbeson<strong>der</strong>e gegenüber Medikamenten und Duftstoffen und zum Teil<br />
gegenüber Nahrungsmitteln erscheint gering. Dieses deutet auf eine erhebliche<br />
Ausbildungslücke hin. Die Zufriedenheit mit <strong>der</strong> medizinischen Versorgung<br />
allgemein, war <strong>bei</strong> den P MCS gering und liegt auf einer Skala von 0-10 nur <strong>bei</strong> d=2,6,<br />
wo<strong>bei</strong> 60% Werte zwischen 0-3 (geringe Zufriedenheit), 24% Werte zwischen<br />
4-6 (mittlere Zufriedenheit) und 8% Werte zwischen 7-10 angaben (hohe<br />
Zufriedenheit).<br />
Fazit: Zusammengefasst ergibt sich das Bild einer erheblichen medizinischen<br />
und umweltmedizinischen Unterversorgung <strong>der</strong> P MCS . Die Zeiten bis zur<br />
Diagnose sind so lang, dass bereits zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstdiagnose mit einer<br />
erheblichen Chroni� zierung zu rechnen ist, welche den therapeutischen<br />
Erfolg negativ beein� usst und seelische Beeinträchtigungen verursacht. Ist eine<br />
umweltmedizinische Diagnose gestellt, so kann aufgrund langer Wartezeiten auf<br />
Termine und langer Anfahrtswege kaum eine durchgängige umweltmedizinische<br />
Versorgung erfolgen, die dem Anspruch eines „Patientenmanagements“ wie es <strong>bei</strong><br />
an<strong>der</strong>en chronischen Erkrankungen üblich ist, auch nur annähernd gerecht wird.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> oft umfassenden umweltmedizinischen Therapievorschläge ist<br />
für die Betroffenen entsprechend schwierig. Falls die Betroffenen eine sonstige<br />
medizinische Behandlung in Anspruch nehmen müssen, treffen sie auf Unkenntnis<br />
und Unverständnis. Die Zufriedenheit <strong>der</strong> Betroffenen mit ihrer medizinischen<br />
Versorgung ist überwiegend und begründet gering.<br />
Dr. rer. nat. Anke Bauer<br />
Werdegang:<br />
Nach dem Studium <strong>der</strong> Ökotrophologie hat Dr. rer.nat. Anke Bauer an dem<br />
Institut für Umwelttoxikologie <strong>der</strong> Christian-Albrechts-Universität zu Kiel<br />
promoviert.<br />
Als wissenschaftliche Mitar<strong>bei</strong>terin <strong>der</strong> Fachkliniken Nordfriesland betreut sie<br />
seit dem Jahr 2001 dort angesiedelte Forschungsprojekte (Publikationsliste:<br />
www.fklnf.de).<br />
MCS
Dr. Anke Bauer<br />
Die Fachkliniken Nordfriesland gehören zu den wenigen Einrichtungen in<br />
Deutschland, die stationäre, ambulante und rehabilitative Therapien für<br />
umweltmedizinische Patienten anbieten.<br />
Dr. Kurt E. Müller<br />
Dermatologie, Berufs<strong>der</strong>matologie,<br />
Umweltmedizin<br />
Leutenhofen 19<br />
87448 Waltenhofen/Allgäu<br />
T: 08303 92 97 284<br />
F: 08303 92 97 285<br />
Katecholamine <strong>bei</strong> umweltmedizinischen Patienten: Diagnostik und<br />
Therapie<br />
Die Katecholamine bestehen aus dehydriertem Benzol (Katechol-) und einer<br />
Aminogruppe. Zu ihnen gehören die Monoamine Dopamin (DA), Noradrenalin<br />
(NA) und Adrenalin (A). Das Indolamin Serotonin und das Imidazol<strong>der</strong>ivat Histamin<br />
sind ebenfalls Monoamine, allerdings keine Katecholamine. Deren Biosynthese<br />
erfolgt aus L-Phenylalanin, das mit <strong>der</strong> Nahrung aufgenommen wird. In Anwesenheit<br />
von Phenylalaninhydroxylase und unter Verbrauch von Tetrabiopterin, Folsäure<br />
und Sauerstoff, wird es zu L-Tyrosin metabolisiert. Tyrosinhydroxylase steuert<br />
mit Calciumcitrat die Bildung von Dihydroxyphenylalanin (L-DOPA), das durch<br />
DOPA-Decarboxylase und Vitamin B6 als Kofaktor in 3,4-Dihydroxyphenyle<br />
thanolamin (DA) unter Freisetzung von CO2 umgewandelt wird. Die daraus<br />
folgende Metabolisierung von NA wird durch das Enzym Dopamin-Monooxidase<br />
in Anwesenheit von oxidiertem Vitamin C unter Abspaltung von Wasser geregelt.<br />
In dem letzten Schritt <strong>der</strong> Reaktionskette katalysiert Phenylethanolamin-N-<br />
Methyltransferase Adrenalin, wo<strong>bei</strong> energiereiches S-Adenosylmethionin (SAMe)<br />
und die Vitamine B6, B12 und Folsäure benötigt werden. Bei <strong>der</strong> Reaktion wird S-<br />
Adenosylhomozystein freigesetzt. Für die Katabolisierung <strong>der</strong> Katecholamine wird<br />
das Enzym Catecholamin-O-Methyltransferase (COMT) benötigt, das L-DOPA zu<br />
Vanillinmilchsäure, DA zu Homovanillinsäure und NA und A zu Vanillinmandelsäure<br />
durch Interaktion mit Monoaminoxidasen (MAO) metabolisiert.<br />
Homozygote (Met/Met) o<strong>der</strong> heterozygote (Val/Met) Polymorphismen von<br />
COMT min<strong>der</strong>n die Aktivität des Enzyms gegenüber <strong>der</strong> Val/Val Konstellation,<br />
so dass hierdurch eine verstärkte und verlängerte Wirkung <strong>der</strong> Katecholamine<br />
<strong>bei</strong> gleichzeitig erhöhter Persistenz von intermediär auftretenden Aldehyden<br />
resultiert. Das Enzym regelt neben <strong>der</strong> Methylierung <strong>der</strong> Katecholaminen
Dr. Kurt E. Müller<br />
auch die von Xenobiotika (u.a. Heterozyklen, xenobiotische Phenole,<br />
Dihydroxyphenyl<strong>der</strong>ivate) und ist auch an <strong>der</strong> Metabolisierung von Dioxinen<br />
und Furanen beteiligt. Medikamente werden abgebaut, aber auch in ihren aktiven<br />
Metaboliten umgewandelt. Bei Frauen entstehen durch COMT-De� zit in erhöhtem<br />
Umfang Katecholöstrogene, die die Wirkung <strong>der</strong> Katecholamine verstärken.<br />
Gemeinsam sind sie immunsuppressiv und erhöhen das Risiko chroni� zierter<br />
Infekte insbeson<strong>der</strong>e mit intrazellulären Erregern <strong>bei</strong> <strong>bei</strong>den Geschlechtern. Bei<br />
Frauen mit verlangsamter Metabolisierung treten Gebärmutterhals- und Mamma-<br />
Carcinome gehäuft auf. Die erhöhte Präsenz von Katecholaminen steigert in<br />
<strong>der</strong> Regel das geistige und körperliche Leistungsvermögen einschließlich <strong>der</strong><br />
sportlichen Leistungsfähigkeit. Es erhöht langfristig allerdings auch das Risiko<br />
kardiovaskulärer Komplikationen wie Hypertonie, koronare Herzkrankheit o<strong>der</strong><br />
apoplektischer Insulte o<strong>der</strong> Hirninfarkte.<br />
Der Nachweis <strong>der</strong> verlangsamten Katabolisierung <strong>der</strong> Katecholamine gelingt<br />
durch humangenetische Untersuchung <strong>der</strong> Enzymaktivität von COMT. Bei guter<br />
Kenntnis des Phänotyps ist die Übereinstimmung von humangenetischer Analyse<br />
und klinischer Einschätzung hoch. Es wurde eine positive Korrelation von ~<br />
90% erreicht. Damit ist die umweltmedizinische Diagnostik wesentlich exakter,<br />
als die an<strong>der</strong>er Disziplinen, für die <strong>der</strong> Sachverhalt ebenfalls von Bedeutung ist.<br />
Die Bestimmung <strong>der</strong> Neurotransmitter im Urin und des Cortisols im Speichel<br />
ergänzt das diagnostische Pro� l insbeson<strong>der</strong>e in Bezug auf die zu treffenden<br />
Therapiemaßnahmen sinnvoll. Es ergeben sich verschiedene Konstellationen, die<br />
unterschiedlich therapeutische Strategien erfor<strong>der</strong>lich machen:<br />
• erhöhte Katecholaminspiegel mit o<strong>der</strong> ohne Reduktion von Serotonin und/<br />
o<strong>der</strong> Cortisol<br />
• Vermin<strong>der</strong>ung von NA und A <strong>bei</strong> erhöhtem bis deutlich erhöhtem DA mit<br />
und ohne Absenkung von Serotonin und/o<strong>der</strong> Cortisol<br />
• Reduktion aller Katecholamine mit o<strong>der</strong> ohne Min<strong>der</strong>ung von Serotonin und/<br />
o<strong>der</strong> Cortisol<br />
Für die physiologische Therapie sind folgende Substanzen erfor<strong>der</strong>lich:<br />
L-Phenylalanin, L-DOPA, Tyrosin, SAMe, 5-Hydroxytryptophan (5-HTP),<br />
L-Tryptophan, N-Acetyl-cystein (NAC), die Vitamine B3, B5, B6, B12, C,<br />
Tocopherole, Folsäure, Calcium, Magnesium, Mangan, Selen, Zink. Die durch<br />
Umweltein� üsse und/o<strong>der</strong> iatrogen verursachte erhöhte Beanspruchung <strong>der</strong><br />
Metabolisierung durch Methylierung muss vor <strong>der</strong> Therapie geregelt und ggf.<br />
abgestellt werden.<br />
Dr. med. Kurt E. Müller<br />
Werdegang:<br />
geb.: 1947
Dr. Kurt E. Müller<br />
1966-1972 Studium <strong>der</strong> Medizin an den Universitäten Köln und Würzburg.<br />
Promotion über die metabolischen Effekte von Betablockern. Internistische<br />
Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Onkologie<br />
ab 1977 Weiterbildung zum Facharzt für Dermatologie an <strong>der</strong> Universität Ulm.<br />
Seit 1981 als Dermatologe in eigener Praxis tätig. Tätigkeitsschwerpunkte:<br />
Allergologie, Umweltmedizin, Berufs<strong>der</strong>matologie und Präventive Medizin.<br />
Dozent für Umweltmedizin im Masterstudiengang Präventionsmedzin an <strong>der</strong><br />
Dresden Inernational University (DIU).<br />
Spezialgebiete:<br />
Sachverständiger in nationalen und internationalen Kommissionen.<br />
Zahlreiche wissenschaftliche und berufspolitische Publikationen, Buch<strong>bei</strong>träge,<br />
zahlreiche Vorträge.<br />
Wissenschaftlicher Beirat in Fachzeitschriften und <strong>bei</strong> wissenschaftlichen Studien.<br />
Gründungsmitglied des Deutschen Berufsverbands <strong>der</strong> Umweltmediziner (dbu)<br />
und dessen Vorsitzen<strong>der</strong> von 1996 bis 2004.<br />
Dr. Richard Straube<br />
Facharzt für Innere Medizin<br />
Facharzt für Nephrologie<br />
INUS Medical Center<br />
Dr.-Adam-Voll-Str. 1<br />
93437 Furth im Wald<br />
Tel.: 09973 500 54 0<br />
www.inus-world.de<br />
Email: richard.straube@inus.de<br />
Therapeutische Apherese<br />
Eine Reihe neuer bzw. längst bekannter Stoffwechselerkrankungen sind nach<br />
dem Stand <strong>der</strong> medizinischen Wissenschaft <strong>der</strong> Therapeutischen Apherese als<br />
pathobiochemisch einzig begründbarer Therapieweg in Bezug auf Vermeidung<br />
von schwerwiegenden Folgezuständen (z.B. Nierenversagen, Schlaganfall)<br />
zugänglich. Dies umso mehr, weil gezeigt werden konnte, dass die Pharmakologie/<br />
Pharmazeutische Industrie keine begründbaren und wirksamen Konzepte<br />
entwickeln konnte.<br />
Lipoprotein(a): Das Partikel wurde 1963 (Berg-Schweden)schon entdeckt. Wie<br />
kein an<strong>der</strong>es Partikel unterliegt es einem ausgeprägten Polymorphismus, <strong>der</strong><br />
die Aggressivität hinsichtlich <strong>der</strong> Progression und des Zeitpunktes. Die Genetik<br />
folgt strikt dem Mendelschen Erbgang; insgesamt sind zur Kon� guration 11<br />
verschiedene Allelen identi� ziert. Biochemisch ist Lp(a) mit dem Plasminogen<br />
einem Gerinnungsprotein strukturell verwandt und unterscheidet sich nur durch
Dr. Richard Straube<br />
die Anzahl von tertiären ausgebildeten „Kringeln“ (sog. Kurz- und Langkringel).<br />
Vom Genlocus liegt es in unmittelbarer Nachbarschaft des Genortes für die<br />
Fibrinogensynthese. In vivo bildet Lp(a) mit Fibrinogen einen Gerinnungskomplex<br />
<strong>der</strong> <strong>bei</strong> arteriosklerotischer Wand zu einem unmittelbaren Verschluss des Gefäßes<br />
führen kann. Bei essentieller Hypertonie ist die Messung von Lp(a) Stand <strong>der</strong> Dinge.<br />
In Studien ist bewiesen worden, dass ausschließlich die Therapeutische Apherese<br />
das Teilchen effektiv reduzieren kann und in Studien ist <strong>der</strong> lebensrettende Effekt<br />
mittlerweile gezeigt worden (Klasse 1b evidenzbasiert). Die Behandlung ist seit<br />
Juni 2008 vor dem Gemeinsamen Bundesausschuss als Kassenp� ichtige Leistung<br />
zugelassen worden.<br />
Morbus Refsum: Eine recht wenig diagnostizierte genetische Erkrankung (Sigvard<br />
Refsum 1946 entdeckt), die meist unter den Bil<strong>der</strong>n Nierenversagen, Schlaganfall<br />
und unklare Neuropathie und mehr o<strong>der</strong> wenig frühe Erblindung abläuft. Bekannt<br />
sind heute autosomal homozygote und autosomal heterozygote Erbgänge.<br />
Homozygote Erbanlagen beginnen in <strong>der</strong> frühen Kindheit mit progressiver<br />
Erblindung und schwerer Polyneuropathie; heterozygote werden erst im<br />
Erwachsenenalter sichtbar und laufen mit zumeist mit Schlaganfall, Polyneuropathie<br />
und Nierenversagen ab.<br />
Ursache ist ein genetischer Defekt <strong>der</strong> mikrosomalen Entgiftungskaskade für<br />
p� anzliche langkettige Fettsäuren, wozu eine Entgiftungskaskade aus 3 Enzymen<br />
benötigt wird: Phytansäureoxidase, Pristansäureoxidase und Pipecolinsäureoxidase.<br />
Sind ein o<strong>der</strong> mehrere Enzyme gestört, so kommt es zur Ablagerung komplexer<br />
p� anzlicher Fettsäuren und ihrer Vorstufen: Phytansäure, Pristansäure und<br />
Pipecolinsäure. Die Beson<strong>der</strong>heit dieser Produkte besteht darin, dass sie sich<br />
an Lipoproteine binden (LDL, HDL, VLDL). Diese Beson<strong>der</strong>heit führt dazu dass<br />
diese Abbauprodukte über die Lipid� ltrationsapherese in beson<strong>der</strong>er Weise aus<br />
dem Stoffwechsel entfernt werden können. Da<strong>bei</strong> kommt es zu Besserung <strong>der</strong><br />
schweren Polyneuropathie und drohende Erblindung und Nierenversagen kann <strong>bei</strong><br />
regelmäßiger Behandlung (wöchentlich bis 14 tägig) verhin<strong>der</strong>t werden.<br />
Spätborreliose: Es gilt die Frage zu klären, warum Patienten nach <strong>der</strong> Exposition<br />
mit Borrelien via Insekten und Zeckenstichen gesund bleiben und an<strong>der</strong>e<br />
schwer erkranken. Es lag nahe die Suche nach <strong>der</strong> Antwort in genetische<br />
Polymorphismen <strong>der</strong> intrazellulären Entgiftungskaskade de Phase I und II zu<br />
suchen. Eine Kohortenstudie zu diesem Thema an unserem Borreliosezentrum<br />
Bayerischer Wald, hat uns weiter gebracht. Verglichen wurden unsere Patienten<br />
mit nicht an Borreliose erkrankten umweltmedizinischen Patienten. Gemessen<br />
wurden die Polymorphismen <strong>der</strong> Phase I und II. Da<strong>bei</strong> � elen auf, dass <strong>bei</strong> den<br />
Borreliose Patienten regelmäßige wie<strong>der</strong>kehrende „Triplets und Doubletten“ an<br />
enzymgenetischen Kombinationen nachzuweisen waren, die in dieser Form <strong>bei</strong>m<br />
borreliosefreien Patienten nicht zu � nden waren. Im Einzelnen wurde gefunden:
Dr. Richard Straube<br />
Genetische<br />
Polymorphismen<br />
Umweltpatienten<br />
(Borreliosefrei)<br />
Spätborreliosepatienten<br />
GSTM1/T1/P1 18% 60%<br />
GSTM1/P1 20% 53%<br />
NAT2/SOD2 41% 65%<br />
CYP1A2/NAT2/SOD2 25% 43%<br />
Paraoxonase 65% 22%<br />
GSTM1 42% 34%<br />
GSTP1 71% 40%<br />
CY1A2/NAT2 62% 44%<br />
Die eingeschränkte Fähigkeit zur Entgiftung führt zur Kumulation von in� ammatorisch<br />
wirksamen und immunsupprimierenden toxischen und Pathoproteinen, die<br />
<strong>der</strong> Therapeutischen Apherese als spezielle Immun� ltration bzw. Chemopherese<br />
<strong>bei</strong> nachgewiesenen Schwermetallen (Zahn-Quecksilber) zugänglich sind. Da<strong>bei</strong><br />
werden nicht mehr messbar hohe und abnorme zirkulierende Immunkomplexe<br />
gefunden, die auf ein dekompensiertes Autoimmungeschehen <strong>der</strong> Klasse III nach<br />
Coombs und Gell hinweisen und mit den dazugehörigen Bil<strong>der</strong>n des rheumatischen<br />
Formenkreises übereinstimmen. Die Behandlung, die in regelmäßigen Abständen<br />
durchgeführt werden muss, bringt den Patienten Lin<strong>der</strong>ung und langfristig<br />
Remission ihres schweren und langjährigen Leidens.<br />
Dr. med. Richard Straube<br />
Werdegang:<br />
Seit 1.1.2007 Ltd. Arzt für Innere Medizin/Nephrologie und Apherese,<br />
Internationale Apheresestation INUS Medical Center; zuvor Ltd. Oberarzt <strong>der</strong><br />
nephrologischen Klinik am Johanniter Kliniukm Oberhausen von 2003 – 2006,<br />
sowie von 1990 – 2003 1.Oberarzt <strong>der</strong> Nephrologischen Klinik am Klinikum<br />
Lüdenscheid.<br />
Studium <strong>der</strong> Medizin an <strong>der</strong> Johann-Wolfgang Goethe Universität und Promotion<br />
in Biochemie.<br />
Praktisches Jahr am St.Josefs-Hospital/Wiesbaden und Weiterbildung zum<br />
Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Pulmonologie, Kardiologie,<br />
Infektionskrankheiten. Weiterbildung Teilgebietsbezeichnung Nephrologie;<br />
Spezialisierung auf Therapeutische Apherese und Hypertensiologie sowie<br />
Speicherkrankheiten.<br />
1984 Quali� kation zum Koronarsportgruppenarzt;1988 Rettungsarzt;1998
Dr. Richard Straube<br />
Hyperbare/Tauchmedizin; 1990 Ernährungsmedizin; Ltd. Notarzt 1990; Klinischer<br />
Manager 1995-1997; Gesundheitsökonom 2004-2005 am Fre<strong>der</strong>ic Institute of<br />
Economics/Institut Prof. Braunschweig, Köln; Hypertensiologe (DHL) 2005; ab<br />
2007 Fortbildung zum Umweltmediziner über den dbu und EUROPAEM<br />
Zusatzausbildung: physikalische Therapie und Ernährungsmedizin 1984 und 1990;<br />
Qualitätsmanager 2005<br />
Lizenzierter Ausbil<strong>der</strong> für Notärzte vor <strong>der</strong> Ärztekammer NRW; Fachausbil<strong>der</strong><br />
für Fachp� ege in Intensivmedizin, Nephrologie, Dialyse und Transplanation am<br />
Klinikum Lüdnescheid und Oberhausen.<br />
Aufbau von ambulanten Bereichen für selten und schwere<br />
Stoffwechselkrankheiten, 2xlige Zulassung zur KV-ärztlichen Versorgung<br />
mittels Apherese für angeborene Fettstoffwechsel und Rheumakrankheiten in<br />
Lüdenscheid und Oberhausen.<br />
Spezialgebiet: Seit 2007 Aufbau <strong>der</strong> Internationalen Apheresestation im INUS<br />
Medical Center, sowie TÜV Certi� zierung DIN ISO 9001-2000 <strong>der</strong> Einheit in<br />
2007 und akuell DIN ISO 9001-2008<br />
Gründung des Borreliosezentrums Bayerischer Wald - Furth im Wald zum 2008<br />
und Zerti� zierung 2009 mit ISO 9000-2008
Wir bedanken uns <strong>bei</strong> unseren Sponsoren.
Labor Dr. Fenner und Kollegen<br />
Medizinisches Versorgungszentrum<br />
für Labormedizin und Humangenetik<br />
Dr. med. Claus Fenner • Dr. med. Thomas Fenner<br />
Dr. med. Ernst Krasemann • Dr. med. Ines Fenner<br />
Prof. Dr. med. Holger-Andreas Elsner<br />
Prof. Dr. med. Jörg Steinmann<br />
Dr. med. Carmen Lensing<br />
Prof Dr. med. Herbert Schmitz<br />
Fachärzte für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie u.<br />
Infektionsepidemiologie, Hygiene u. Umweltmedizin,<br />
Transfusionsmedizin und Humangenetik<br />
In Praxisgemeinschaft mit<br />
Dr. med. Thilo Hartmann<br />
Facharzt für Pathologie<br />
In Kooperation mit<br />
Dr. rer. nat. Eckart Schnakenberg<br />
Pharmako- und Toxikogenetik<br />
Tel.: (040) 30955 - 0<br />
Fax: (040) 309 55 - 13<br />
Bergstraße 14 • 20095 Hamburg<br />
Email: fennerlabor@fennerlabor.de<br />
www.fennerlabor.de<br />
Organisation <strong>der</strong> <strong>9.</strong> <strong>Umweltmedizinische</strong> <strong>Jahrestagung</strong><br />
Labor Dr. Fenner und Kollegen<br />
Medizinisches Versorgungszentrum<br />
für Labormedizin und Humangenetik