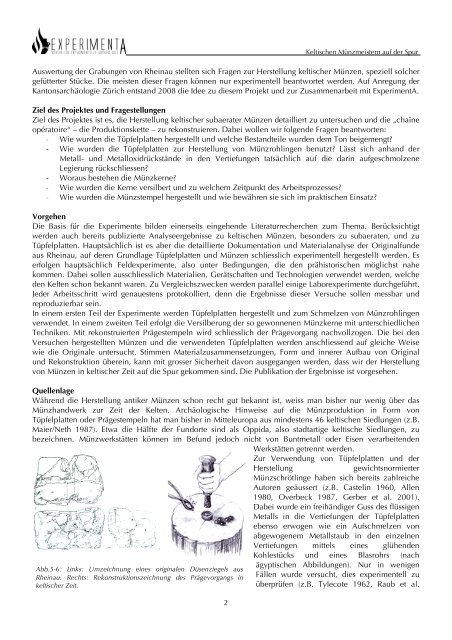keltischen Münzen - ExperimentA
keltischen Münzen - ExperimentA
keltischen Münzen - ExperimentA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2<br />
Keltischen Münzmeistern auf der Spur<br />
Auswertung der Grabungen von Rheinau stellten sich Fragen zur Herstellung keltischer <strong>Münzen</strong>, speziell solcher<br />
gefütterter Stücke. Die meisten dieser Fragen können nur experimentell beantwortet werden. Auf Anregung der<br />
Kantonsarchäologie Zürich entstand 2008 die Idee zu diesem Projekt und zur Zusammenarbeit mit <strong>ExperimentA</strong>.<br />
Ziel des Projektes und Fragestellungen<br />
Ziel des Projektes ist es, die Herstellung keltischer subaerater <strong>Münzen</strong> detailliert zu untersuchen und die „chaîne<br />
opératoire“ – die Produktionskette – zu rekonstruieren. Dabei wollen wir folgende Fragen beantworten:<br />
- Wie wurden die Tüpfelplatten hergestellt und welche Bestandteile wurden dem Ton beigemengt?<br />
- Wie wurden die Tüpfelplatten zur Herstellung von Münzrohlingen benutzt? Lässt sich anhand der<br />
Metall- und Metalloxidrückstände in den Vertiefungen tatsächlich auf die darin aufgeschmolzene<br />
Legierung rückschliessen?<br />
- Woraus bestehen die Münzkerne?<br />
- Wie wurden die Kerne versilbert und zu welchem Zeitpunkt des Arbeitsprozesses?<br />
- Wie wurden die Münzstempel hergestellt und wie bewähren sie sich im praktischen Einsatz?<br />
Vorgehen<br />
Die Basis für die Experimente bilden einerseits eingehende Literaturrecherchen zum Thema. Berücksichtigt<br />
werden auch bereits publizierte Analyseergebnisse zu <strong>keltischen</strong> <strong>Münzen</strong>, besonders zu subaeraten, und zu<br />
Tüpfelplatten. Hauptsächlich ist es aber die detaillierte Dokumentation und Materialanalyse der Originalfunde<br />
aus Rheinau, auf deren Grundlage Tüpfelplatten und <strong>Münzen</strong> schliesslich experimentell hergestellt werden. Es<br />
erfolgen hauptsächlich Feldexperimente, also unter Bedingungen, die den prähistorischen möglichst nahe<br />
kommen. Dabei sollen ausschliesslich Materialien, Gerätschaften und Technologien verwendet werden, welche<br />
den Kelten schon bekannt waren. Zu Vergleichszwecken werden parallel einige Laborexperimente durchgeführt.<br />
Jeder Arbeitsschritt wird genauestens protokolliert, denn die Ergebnisse dieser Versuche sollen messbar und<br />
reproduzierbar sein.<br />
In einem ersten Teil der Experimente werden Tüpfelplatten hergestellt und zum Schmelzen von Münzrohlingen<br />
verwendet. In einem zweiten Teil erfolgt die Versilberung der so gewonnenen Münzkerne mit unterschiedlichen<br />
Techniken. Mit rekonstruierten Prägestempeln wird schliesslich der Prägevorgang nachvollzogen. Die bei den<br />
Versuchen hergestellten <strong>Münzen</strong> und die verwendeten Tüpfelplatten werden anschliessend auf gleiche Weise<br />
wie die Originale untersucht. Stimmen Materialzusammensetzungen, Form und innerer Aufbau von Original<br />
und Rekonstruktion überein, kann mit grosser Sicherheit davon ausgegangen werden, dass wir der Herstellung<br />
von <strong>Münzen</strong> in keltischer Zeit auf die Spur gekommen sind. Die Publikation der Ergebnisse ist vorgesehen.<br />
Quellenlage<br />
Während die Herstellung antiker <strong>Münzen</strong> schon recht gut bekannt ist, weiss man bisher nur wenig über das<br />
Münzhandwerk zur Zeit der Kelten. Archäologische Hinweise auf die Münzproduktion in Form von<br />
Tüpfelplatten oder Prägestempeln hat man bisher in Mitteleuropa aus mindestens 46 <strong>keltischen</strong> Siedlungen (z.B.<br />
Maier/Neth 1987). Etwa die Hälfte der Fundorte sind als Oppida, also stadtartige keltische Siedlungen, zu<br />
bezeichnen. Münzwerkstätten können im Befund jedoch nicht von Buntmetall oder Eisen verarbeitenden<br />
Werkstätten getrennt werden.<br />
Zur Verwendung von Tüpfelplatten und der<br />
Herstellung gewichtsnormierter<br />
Münzschrötlinge haben sich bereits zahlreiche<br />
Autoren geäussert (z.B. Castelin 1960, Allen<br />
1980, Overbeck 1987, Gerber et al. 2001).<br />
Dabei wurde ein freihändiger Guss des flüssigen<br />
Metalls in die Vertiefungen der Tüpfelplatten<br />
ebenso erwogen wie ein Aufschmelzen von<br />
abgewogenem Metallstaub in den einzelnen<br />
Vertiefungen mittels eines glühenden<br />
Kohlestücks und eines Blasrohrs (nach<br />
Abb.5-6: Links: Umzeichnung eines originalen Düsenziegels aus<br />
Rheinau. Rechts: Rekonstruktionszeichnung des Prägevorgangs in<br />
keltischer Zeit.<br />
ägyptischen Abbildungen). Nur in wenigen<br />
Fällen wurde versucht, dies experimentell zu<br />
überprüfen (z.B. Tylecote 1962, Raub et al.