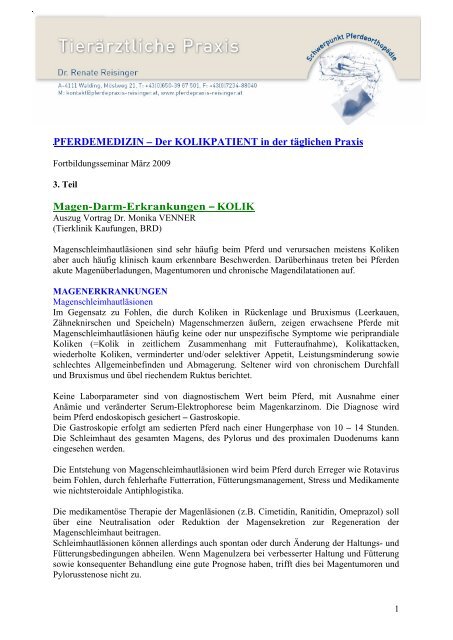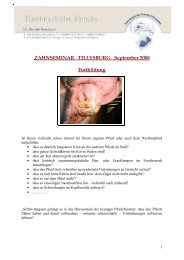Koliken-3 - Dr. Renate Reisinger
Koliken-3 - Dr. Renate Reisinger
Koliken-3 - Dr. Renate Reisinger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PFERDEMEDIZIN Der KOLIKPATIENT in der täglichen Praxis<br />
Fortbildungsseminar März 2009<br />
3. Teil<br />
Magen-Darm-Erkrankungen KOLIK<br />
Auszug Vortrag <strong>Dr</strong>. Monika VENNER<br />
(Tierklinik Kaufungen, BRD)<br />
Magenschleimhautläsionen sind sehr häufig beim Pferd und verursachen meistens <strong>Koliken</strong><br />
aber auch häufig klinisch kaum erkennbare Beschwerden. Darüberhinaus treten bei Pferden<br />
akute Magenüberladungen, Magentumoren und chronische Magendilatationen auf.<br />
MAGENERKRANKUNGEN<br />
Magenschleimhautläsionen<br />
Im Gegensatz zu Fohlen, die durch <strong>Koliken</strong> in Rückenlage und Bruxismus (Leerkauen,<br />
Zähneknirschen und Speicheln) Magenschmerzen äußern, zeigen erwachsene Pferde mit<br />
Magenschleimhautläsionen häufig keine oder nur unspezifische Symptome wie periprandiale<br />
<strong>Koliken</strong> (=Kolik in zeitlichem Zusammenhang mit Futteraufnahme), Kolikattacken,<br />
wiederholte <strong>Koliken</strong>, verminderter und/oder selektiver Appetit, Leistungsminderung sowie<br />
schlechtes Allgemeinbefinden und Abmagerung. Seltener wird von chronischem Durchfall<br />
und Bruxismus und übel riechendem Ruktus berichtet.<br />
Keine Laborparameter sind von diagnostischem Wert beim Pferd, mit Ausnahme einer<br />
Anämie und veränderter Serum-Elektrophorese beim Magenkarzinom. Die Diagnose wird<br />
beim Pferd endoskopisch gesichert Gastroskopie.<br />
Die Gastroskopie erfolgt am sedierten Pferd nach einer Hungerphase von 10<br />
14 Stunden.<br />
Die Schleimhaut des gesamten Magens, des Pylorus und des proximalen Duodenums kann<br />
eingesehen werden.<br />
Die Entstehung von Magenschleimhautläsionen wird beim Pferd durch Erreger wie Rotavirus<br />
beim Fohlen, durch fehlerhafte Futterration, Fütterungsmanagement, Stress und Medikamente<br />
wie nichtsteroidale Antiphlogistika.<br />
Die medikamentöse Therapie der Magenläsionen (z.B. Cimetidin, Ranitidin, Omeprazol) soll<br />
über eine Neutralisation oder Reduktion der Magensekretion zur Regeneration der<br />
Magenschleimhaut beitragen.<br />
Schleimhautläsionen können allerdings auch spontan oder durch Änderung der Haltungs- und<br />
Fütterungsbedingungen abheilen. Wenn Magenulzera bei verbesserter Haltung und Fütterung<br />
sowie konsequenter Behandlung eine gute Prognose haben, trifft dies bei Magentumoren und<br />
Pylorusstenose nicht zu.<br />
1
Akute Magenüberladung<br />
Eine Magenüberladung kann primär vorliegen, wenn Pferde eine zu große Menge an Futter<br />
(meist Kraftfutter, z.B. Pferd in die Futterkammer ausgebrochen) in kurzer Zeit einnehmen. In<br />
anderen Fällen ist die Magenüberladung sekundär zu einem mechanischen oder funktionellen<br />
Dünndarmileus (Dünndarmverschluss).<br />
In beiden Fällen zeigt das Pferd akute Koliksymptome mit beeinträchtigtem Kreislauf. Zur<br />
Behandlung der primären Magenüberladung wird der Magen über eine Nasenschlundsonde<br />
entleert. Bei der sekundären Magenüberladung wird für eine Entlastung des Magens durch das<br />
Abhebern von Reflux (=Rückfluss von Darminhalt in den Magen) und vor allem das<br />
medikamentelle oder chirurgische Beheben des Dünndarmileus gesorgt.<br />
Chronische Magendilatation<br />
Die chronische Magendilatation ist sehr selten und wird als Folge einer Wandschwäche<br />
gesehen. Betroffene Pferde zeigen eine Leistungsschwäche, rezidivierende milde <strong>Koliken</strong>,<br />
langsames Fressverhalten und im späteren Verlauf auch akute Kolikschmerzen.<br />
Die Prognose ist ungünstig.<br />
Magentumoren<br />
Die Magentumoren sind meistens Plattenepithelkarzinome, die erst im fortgeschrittenem<br />
Stadium diagnostiziert werden. Der Patient ist abgemagert, frisst wenig, zeigt rezidivierende<br />
Kolik und speichelt vermehrt. Prognose in Faust (= aussichtslos).<br />
Pylorusstenose<br />
Die Pylorusstenose ist sehr selten. Sie wird bei jungen Pferden (meist unter 6 Jahren)<br />
diagnostiziert. Die Patienten sind abgemagert, liegen viel und zeigen eine langsame<br />
Futteraufnahme und Leistungsschwäche. Die Betrachtung des Pylorus bei der Gastroskopie<br />
führt zur Diagnose.<br />
Die Prognose ist in Faust.<br />
DÜNNDARMERKRANKUNGEN<br />
Missbildungen<br />
Zu den insgesamt seltenen Missbildungen des Dünndarms (DÜD) beim Pferd stellt das<br />
Meckel-Divertikel die häufigste dar.<br />
Betroffene Tiere sind oft jahrelang oder sogar lebenslang beschwerdefrei. Aufgrund der<br />
gestörten anatomischen Verhältnisse besteht jedoch eine hohe Prädisposition an akuter oder<br />
chronischer Kolik zu erkranken.<br />
Akute entzündliche Erkrankungen<br />
Bei Fohlen in den ersten drei Lebenswochen verursacht Rotavirus sporadisch aber auch<br />
endemisch auf einigen Gestüten eine lebensbedrohliche Enteritis. Erkrankte Fohlen zeigen<br />
einen anfangs gräulich pastösen, später flüssigen Durchfall und eine hochgradige<br />
Dehydratation und Anorexie. Erregernachweis im Kot.<br />
Beim erwachsenen Pferd sind akute Entzündliche Erkrankungen des DÜD selten in Europa.<br />
Dabei spielt die Duodeno-Jejunitis die Hauptrolle. Betroffene Pferde zeigen akute<br />
Koliksymptome mit erheblicher Kreislaufbeeinträchtigung, eine Magenüberladung und<br />
meistens rektal fühlbare dilatierte Dünndarmschlingen. Die Ursache ist meistens unbekannt.<br />
2
Chronisch entzündliche Erkrankungen<br />
Das Bakterium Lawsonia intracellularis verursacht bei älteren Fohlen im Absetzalter eine<br />
chronische Dünndarm-Enteritis. Die Lawsonia-Erkrankung ist in Europa selten.<br />
Charakteristisch ist ein chronischer Krankheitsverlauf mit Abmagerung, Teilnahmslosigkeit<br />
und Kümmern.<br />
Beim erwachsenen Pferd stellt die granulomatöse Enteritis die häufigste chronische DÜD<br />
Erkrankung dar. Die Ursache ist unbekannt und der Krankheitsverlauf meistens chronisch<br />
gekennzeichnet durch rezidivierende milde <strong>Koliken</strong> und Abmagerung.<br />
Mechanische Veränderungen<br />
Hernien, Volvulus und Invagination stellen die häufigsten mechanischen Veränderung des<br />
DÜD beim Pferd dar. Diese Erkrankungen verursachen stets eine akute Kolik, die sich rasch<br />
als chirurgisch darstellt.<br />
Funktionelle Veränderungen<br />
Der paralytische Ileus des DÜD ist meistens sekundär zu einer mechanisch bedingten<br />
Dilatation des DÜD oder zu einer Manipulation des Darms während eines chirurgischen<br />
Eingriffs. Betroffene Pferde zeigen Koliksymptome, Apathie und Anorexie.<br />
DICKDARMERKRANKUNGEN<br />
<strong>Dr</strong>. Martin KUMMER FVH, DECVS<br />
(Pferdklinik, Vetsuisse Fakultät Universität Zürich, CH)<br />
Der Dickdarm (DID) des Pferdes besteht aus dem Blinddarm (Caecum), dem grossen<br />
Grimmdarm (Colon ascendens) und dem kleinen Grimmdarm (Colon descendens). Die<br />
grossen Gärkammern Caecum und Colon ascendens fassen zusammen etwa 120 l. Das Colon<br />
descendens ist ca. 3-4 Meter lang. Die Hauptfunktion des Dickdarmes liegt in der Absorption<br />
von Wasser und Elektrolyten und in der mikrobiellen Fermentation (siehe Fütterung & Kolik).<br />
Es werden dabei ca. 20 30 % des Körpergewichtes täglich absorbiert, das heisst für ein 500<br />
kg schweres Pferd ca. 100<br />
150 Liter. Des weiteren haben Caecum und Colon eine<br />
Speicherfunktion, welches über längere Zeit eine mikrobielle Fermentation und Absorption<br />
von freien Fettsäuren erlaubt.<br />
Häufigkeitsverteilung der Dickdarmkoliken<br />
Ca. 60-65% der gastrointestinalen Kolikursachen sind im Bereich des Dickdarms anzusiedeln:<br />
(Daten aus Dissertation Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig, 2000)<br />
33 % Verstopfung Colon ascendens<br />
22 % Dickdarmverlagerung<br />
9 % Verstofpung Colon descendens<br />
9 % Verlagerung DID in Milz-Nieren-Raum<br />
7 % Torsio coli (DID Verdrehung > 180°)<br />
7 % Kolitis<br />
6 % Meteorismus<br />
6 % Caecumobstipation<br />
1 % Mesokolonruptur<br />
3
Verstopfungen des Dickdarms<br />
Obstipation Colon ascendens<br />
Ist die häufigste Erkrankungen des Dickdarms. Die Symptomatik solcher <strong>Koliken</strong> ist in der<br />
Regel mild und intermittierend. Die Pferde zeigen zudem Inappetenz, verringerter Kotabsatz,<br />
reduzierte Wasseraufnahme, häufiges Liegen und Umschauen zum Bauch. Normalerweise<br />
führt eine konservative Therapie zum Ziel. In seltenen Fällen bei über mehrere Tage<br />
persistierenden Obstipationen, beginnenden Darmwandschaden oder sekundärer<br />
Colonverlagerungen muss eine chirurgische Therapie durchgeführt werden.<br />
Die allgemeine Prognose bei Colonobstipationen kann als gut bezeichnet werden. Falls aber<br />
eine chirurgische Intervention unumgänglich ist, wird die Prognose vorsichtiger.<br />
Obstipation des Caecums<br />
Kann akut einmalig auftreten oder dann chronisch rezidivierend sein. Die<br />
Caecumobstipationen beginnen jeweils mit milder Symptomatik, welche sich dann bis zu<br />
hochgradig entwickeln kann. Bei der chronischen Form zeigen die Pferde häufiges Liegen,<br />
Abmagerung und Leistungsabfall.<br />
Die Indikation zur Operation besteht bei hochgradiger Obstipation des Caecumkörpers bei<br />
bestehender Rupturgefahr. Die Prognose ist deutlich vorsichtiger als bei der Colonobstipation,<br />
da das Risiko einer Ruptur oder auch der Chronizität besteht.<br />
Obstipation des Colon descendens<br />
Ist oft auf schlechte Zahnpflege, Heu minderer Qualität, Bewegungsmangel oder<br />
Wassermangel zurückzuführen. Es wird auch in dieser Problematik eine konservative<br />
Therapie bevorzugt; jedoch wenn nötig auch chirurgisch eingegriffen.<br />
Dickdarmverlagerungen<br />
Verlagerung des Colons in den Nieren-Milz-Raum (NMR)<br />
Die Ursache dafür ist unbekannt. Es wird angenommen, dass es aufgrund von<br />
Gasansammlungen und/oder Verstopfungen im Colon ascendens zu einer Lageveränderung<br />
des DID an der linken Bauchseite zwischen Milz und Bauchwand bzw. bis hinauf zwischen<br />
Milz und Niere (NMR) kommt.<br />
Die Pferde zeigen sehr oft milde, manchmal auch intermittierende Symptomatik, selten ist<br />
heftige Kolik. Wenn es die Koliksymptomatik zulässt, ist zuerst eine konservative Therapie<br />
angezeigt; jedoch wenn nötig auch chirurgisch eingegriffen.<br />
Torsio coli<br />
Dabei dreht sich das Colon ascendens häufig um 360°. Die Pferde zeigen sehr oft perakute,<br />
hochgradige, unstillbare Kolik. Bei diesen Patienten muss so rasch als möglich eine<br />
chirurgische Therapie eingeleitet werden. Die Prognose hängt stark von der vorgefundenen<br />
Darmwandschädigung ab. Postoperative Komplikationen wie Thrombophlebitis, Hufrehe,<br />
chronischer Proteinverlust über die geschädigte Darmschleimhaut usw. sind anzutreffen.<br />
4
Kolitis / Typhlocolitis<br />
Die Colitis (Dickdarmentzündung) beim Pferd kann aus mehreren Gründen hervorgerufen<br />
werden. Dazu gehören die Salmonellose, Cyathostominose (siehe Endoparasiten & Kolik),<br />
Potomac Horse Fever, Medikamente wie z.B. nichtsteroidale Antiphlogistika oder gewisse<br />
Antibiotika und die Colitis X. Bei der Colitis X geht man heute davon aus, dass es durch ein<br />
Toxin von Clostridium perfringens Typ B verursacht wird.<br />
Zunächst zeigen die Pferde Apathie und Inapetenz, dann Koliksymptomatik mit profusem,<br />
übelriechendem Durchfall. Wenig später kommt es zu einer starken Endotoxämie, welche sich<br />
typischerweise durch ziegelrote bis zyanotische Schleimhäute äussert. Bei diesen Patienten ist<br />
es wichtig, dass die nötigen Absonderungs- und Schutzmassnahmen getroffen werden bis eine<br />
Salmonellose mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.<br />
Solche Patienten brauchen eine sehr aufwändige, intensive Therapie und trotzdem bleibt die<br />
Prognose vorsichtig.<br />
Meteorismus (Gaskolik, Tympanie)<br />
Gasansammlung kann im gesamten Gastrointestinaltrakt oder nur in gewissen Abschnitten<br />
auftreten.<br />
Beim primären Meteorismus liegt eine alimentäre Ursache zu Grunde. Da ist die Aufnahme<br />
von jungem Gras, Klee, erhitztem Grünfutter, Obst, Brot, Getreideschrot zu erwähnen, welche<br />
generell zu einer verstärkten mikrobiellen Aktivität führt.<br />
Beim sekundären Meteorismus liegt eine Passagestörung im Darmtrakt vor.<br />
Bei sehr starker Symptomatik kann durch den massiven <strong>Dr</strong>uck auf das Zwerchfell das<br />
Allgemeinbefinden sehr stark gestört sein.<br />
Bei erfolgloser konservativer Therapie ist die Chirurgie unumgänglich, wobei bei primärem<br />
Meteorismus die Prognose als gut bezeichnet werden kann.<br />
Mesocolonruptur<br />
Die Ruptur des Mesocolon (= Riss der Dickdarmaufhängung) ist hauptsächlich eine<br />
Komplikation der Stute bei der Geburt. Dabei wird das Gekröse (=Darmaufhängung) durch<br />
abrupte Bewegungen des Fohlens während der Geburt zerrissen. Die Koliksymptomatik ist<br />
variabel und tritt meist in den ersten 24 Stunden nach der Geburt auf.<br />
Die chirurgische Therapie besteht im Entfernen des nekrotischen Darmstückes. Jedoch ist der<br />
Darm oft soweit nach distal/hinten geschädigt, dass eine erfolgversprechende Operation kaum<br />
noch möglich ist; daher ist die Prognose vorsichtig.<br />
5