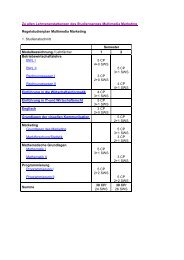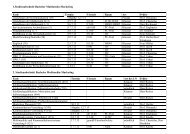Download - Fachhochschule Schmalkalden
Download - Fachhochschule Schmalkalden
Download - Fachhochschule Schmalkalden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Alles Bio? – neue Ansätze von Biopolymeren<br />
in der Produktentwicklung<br />
R. Schlutter, Prof. Dr.-Ing. T. Seul, Prof. Dr.-Ing. M. Koch<br />
FH <strong>Schmalkalden</strong>, 98574 <strong>Schmalkalden</strong>, r.schlutter@fh-sm.de<br />
Zusammenfassung<br />
Der Vortrag stellt den Stand der Technik in der Anwendung von biobasierten,<br />
nicht biologisch abbaubaren Kunststoffen dar. Es wird auf verschiedene Anwendungen<br />
eingegangen und das Potential der biobasierten Kunststoffe aufgezeigt.<br />
Daneben werden erste Ergebnisse hinsichtlich der Kennwertermittlung ausgewählter<br />
biobasierter Kunststoffe präsentiert. Im Speziellen wird auf die thermischen<br />
Kennwerte und die Fließkurven der betrachteten biobasierten Kunststoffe<br />
eingegangen.<br />
Ein kurzer Ausblick über die im Folgenden notwendigen Arbeiten wird gegeben.<br />
Die Ziele der Forschungsarbeit werden genannt.<br />
1 Einleitung<br />
Abbildung 1: kompostierbare Kunststofftüte aus PLA-Blends [1]<br />
<strong>Fachhochschule</strong> <strong>Schmalkalden</strong> 1
Ungefähr 90% der heute gefertigten Kunststoffteile werden über Spritzgießen<br />
hergestellt. Daneben werden immer neue Anwendungsgebiete für technische<br />
Kunststoffteile erschlossen, die immer extremeren Umweltbedingungen ausgesetzt<br />
sind. Als Beispiele seien hier Teile unter der Motorhaube im Ansaugtrakt<br />
oder Luftfiltersystem oder Implantate im menschlichen Körper genannt. Außerdem<br />
wird die Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung immer wichtiger, was den<br />
Einsatz neuer Werkstoffe bedingt.<br />
2 Definition „Biopolymere“<br />
Abbildung 2: Anwendung von Biopolymeren [2]<br />
Jedes Jahr werden weltweit ca. 220 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt und<br />
verbraucht. Die jährliche Wachstumsrate liegt bei ungefähr 5% pro Jahr. Davon<br />
entfallen jedoch erst 0,1% auf Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
produziert werden. Hier sind alle Kunststoffe eingeschlossen, die einen Anteil an<br />
nachwachsenden Rohstoffen von deutlich über 50% Gewichtsanteil haben [3].<br />
Bei biobasierten Kunststoffen oder Biopolymeren handelt es sich nicht um eine<br />
einheitliche Produktklasse. Die einzelnen Produkte können sich erheblich voneinander<br />
unterscheiden. Es handelt sich jedoch nicht um eine neue Werkstoffart<br />
sondern um eine Untergruppe der Kunststoffe. Biobasierende Kunststoffe haben<br />
den gleichen Aufbau und daher auch die gleichen Verarbeitungs- und Funktionseigenschaften,<br />
wie sie bei petrochemisch gewonnen Kunststoffen ermittelt<br />
wurden [4]. In [4] werden die bereits bestehenden Biopolymere mit entsprechenden<br />
konventionell hergestellten Polymeren in materialtechnischer Hinsicht<br />
verglichen. Daneben werden der chemische Aufbau, die Herstellung sowie die<br />
11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 2
Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften und die Entsorgungsvorschriften<br />
für Biopolymere diskutiert.<br />
Der Begriff „Biobasierend“ hat im Allgemeinen zwei Bedeutungen. Zum einen<br />
bedeutet es, dass Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Stärke, Cellulose<br />
oder Zucker hergestellt werden. Solche Kunststoffe müssen nicht zwingend<br />
biologisch abbaubar sein. Zum anderen bedeutet es, dass solche Kunststoffe<br />
biologisch abbaubar sind. Hier sind aber auch Kunststoffe mit eingeschlossen,<br />
die aus erdölbasierten Polymeren gewonnen werden. In Abbildung 3 sind die<br />
verschiedenen Teile der Kunststofffamilie mit jeweils zwei Vertretern dargestellt.<br />
Abbildung 3: die Kunststofffamilie [5]<br />
Im Rahmen der Arbeit wird nur die erste Gruppe von Kunststoffen, die aus<br />
nachwachsenden Materialien hergestellt werden (in Abbildung 3 unten links),<br />
betrachtet. Dabei ist es wichtig, dass diese biobasierten Kunststoffe nicht biologisch<br />
abbaubar sind, da sie sonst nicht in der Lage sind, schwierigsten Bedingungen<br />
zu widerstehen.<br />
3 Potentiale und heutige Einsatzgebiete<br />
Der Kunststoffhersteller DuPont hat das Ziel im Jahr 2010 einen Umsatz von<br />
8 Milliarden Euro mit auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden Kunststoffen<br />
zu erzielen [6]. Hier spiegelt sich das gewaltige Potential dieser Kunststoffe wieder,<br />
auch wenn der Großteil an biobasierten Kunststoffen biologisch abbaubar<br />
ist.<br />
Stand der Technik ist bereits, dass vereinzelt Biopolymere unter der Motorhaube<br />
eingesetzt werden können. In [7] wird der Einsatz von Polyamid 5.10 und Polyamid<br />
6.10 aus nachwachsenden Rohstoffen im Luftfiltersystem eines Ottomotors<br />
<strong>Fachhochschule</strong> <strong>Schmalkalden</strong> 3
eschrieben. Das Polyamid 6.10 wird mit Glasfasern und Mineralien verstärkt.<br />
Basis für die Herstellung dieser Polyamide ist Sebazinsäure, welche aus Rhizinusöl<br />
gewonnen wird. Insgesamt besteht das Polyamid 6.10 zu 60% aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen. Das Polyamid 5.10 erreicht nahezu 100%. Es wird aus<br />
Monomeren der Sebazinsäure und Diaminopentan hergestellt. Das Diaminopentan<br />
wird fermentativ durch Bakterien gewonnen, die beispielsweise Zucker umsetzen.<br />
Das genannte Polyamid 5.10 ist normalen Polyamiden in mechanischer<br />
Hinsicht nicht unterlegen. Außerdem nehmen beide Polyamide weniger Wasser<br />
auf und fließen besser als petrochemisch gewonnene Polyamide.<br />
Die Idee, Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen, wurde das<br />
erste Mal während des zweiten Weltkrieges von Ford getestet. Im Ergebnis stand<br />
ein Auto, dass nur halb so schwer war wie vergleichbare Modelle. Allerdings<br />
blieb dieses Auto eine Studie [6].<br />
Heute wird beispielsweise Polyester aus Mais produziert. Hier sind keine hohen<br />
Temperaturen und Drücke zur Herstellung der biobasierten Kunststoffe notwendig.<br />
Allerdings eignen sich diese Kunststoffe nicht für technische Bauteile sondern<br />
allenfalls als Dämmmaterial. [6]<br />
Ein anderer Entwicklungsansatz zur Herstellung von Biopolymeren wird in [8]<br />
beschrieben. Hier wird auf die Möglichkeit eingegangen, dass Bakterien fermentativ<br />
kurzkettige Alkohole, wie Methanol oder Ethanol herstellen. Diese reagieren<br />
dann mit Hilfe eines Katalysators und der Zugabe von Kohlendioxid zu Polycarbonaten.<br />
Diese sind biologisch abbaubar und ähneln in ihren Eigenschaften<br />
Polyethylen und Polypropylen. Die Herstellung dieser Biopolymere ist jedoch<br />
im Vergleich zu petrochemisch hergestellten Polymeren immer noch zu teuer.<br />
Im Allgemeinen werden die Biopolymere in Biopolymere erster, zweiter und<br />
dritter Generation unterschieden. Die erste Generation der Biopolymere entstand<br />
in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Diese waren jedoch sehr teuer<br />
und hatten im Vergleich zu konventionellen Polymeren unausgereifte Materialeigenschaften.<br />
Die zweite Generation der Biopolymere entstanden aus der Weiterentwicklung<br />
der ersten Generation. Sie haben ihren Schwerpunkt vor allem auf der biologischen<br />
Abbaubarkeit und finden Anwendung in der Verpackungsindustrie und bei<br />
anderen kurzlebigen Produkten, zum Beispiel kompostierbare Mulchfolien.<br />
Die dritte Generation der Biopolymere umfasst die nicht bioabbaubaren Polymere.<br />
Sie sind geeignet für technische Kunststoffteile, beispielsweise in der Automobilindustrie.<br />
Allerdings liegen zu diesen Biopolymeren noch keine Kenntnisse<br />
über deren Langzeitverhalten, wie Kriechvorgänge, thermische Beständigkeit<br />
oder UV-Beständigkeit vor. Auch im Bereich der rheologischen Kennwerte liegen<br />
momentan nur lückenhafte Informationen vor [4].<br />
11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 4
In absehbarer Zeit wird es aufgrund des Konkurrenzdenkens der Hersteller von<br />
Biopolymeren keine einheitlichen und umfassenden Werkstoffkennwerte und Informationen<br />
geben.<br />
Abbildung 4: Potentiale der Biopolymere [1]<br />
In [1] (Abbildung 4) wird geschätzt, dass der Anteil an biobasierten, nicht biologisch<br />
abbaubaren Kunststoffen von 30.000t auf 575.000t im Jahr 2011 anwachsen<br />
wird, was das gewaltige Potential dieser neuen Kunststoffklasse zeigt. Das<br />
heutige Haupteinsatzgebiet dieser Kunststoffe liegt vor allem im Sport- und Freizeitbereich.<br />
So werden biobasierte Kunststoffe in Gehäusen für Mobiltelefone<br />
verwendet, aber auch Skischuhe werden heute schon aus PLA und Bambusfasern<br />
hergestellt. Daneben setzen sich die biobasierten Kunststoffe auch immer mehr<br />
im Automobil, vor allem im Innenraum, durch. Hier werden sie vorrangig als<br />
Dämmstoffe, atmungsaktive Sitzpolster oder in Oberflächenteilen verwendet.<br />
Als Rohstoff für Kraftstoffleitungen sind sie sich besonders in Asien auf dem<br />
Vormarsch.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Herstellung der Biopolymere<br />
noch am Anfang steht. Zukünftig werden neue Monomere und Polymere entwikkelt<br />
werden. Es werden aber auch neue Blends und Faserzusätze und Additive<br />
entwickelt. Daher ist es momentan wichtig, biobasierte Kunststoffe weiter zu<br />
entwickeln und Kenntnisse über ihre Verarbeitbarkeit und Eigenschaften zu gewinnen<br />
sowie die bereits bestehenden Produkte weiter zu optimieren.<br />
<strong>Fachhochschule</strong> <strong>Schmalkalden</strong> 5
4 Ziele<br />
Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung von Verarbeitungs-, und Konstruktionsrichtlinien<br />
für die Produktentwicklung mit biobaserten Kunststoffen, sowie die Etablierung<br />
der biobasierten Kunststoffe in der fertigenden Industrie.<br />
Nebenziel ist die Erstellung von Datensätzen von Biopolymeren, die zu Fließsimulationen<br />
verwendet werden können.<br />
Als Nicht-Ziel sei an dieser Stelle die Entwicklung neuer Biopolymere genannt.<br />
5 Prinzipieller Aufbau der Guideline<br />
Die Produktentwicklung beschreibt den Prozess von der Idee für ein neues<br />
Produkt bis zur fertigen Umsetzung dieser Idee in ein konkretes Produkt und<br />
wird nach VDI 2222 [9] in vier Phasen unterteilt.<br />
In der Planungsphase werden die grundlegenden Vorgaben wie Designvorgaben,<br />
die Funktion des Produktes oder mögliche Stückzahlen für die Realisierung des<br />
Produktes zusammengestellt. Die Angaben sind allgemein zu halten, da hier<br />
noch keine technische Umsetzung der Ideen in Produkte erfolgt.<br />
In der Konzeptphase werden die Produktideen technisch umgesetzt. Dazu<br />
werden die Vorgaben in eine Anforderungsliste überführt. Aus dieser wird<br />
dann die ideale technische Lösung ausgearbeitet und bewertet. Als Ziel kann<br />
beispielweise formuliert werden, dass Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
hergestellt werden.<br />
In der Entwurfsphase werden die ausgewählten Konzepte in konkrete<br />
Konstruktionen überführt. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der<br />
Dimensionierung, der Werkstoffauswahl und der Gestaltung. In dieser Phase<br />
werden die Konstruktionsprinzipien geklärt; das heißt, ob sämtliche Funktionen<br />
in einem Bauteil vereint werden können oder ob das gesamte Produkt aus<br />
einzelnen Bauteilen und Funktionsgruppen zusammengebaut wird.<br />
In der letzen Phase, der Ausarbeitungsphase werden die Einzelteile optimiert.<br />
In der Erstellung von Kunststoffprodukten wird dieser Schritt zumeist schon<br />
in der Entwurfsphase durch den intensiven Einsatz von Simulationssoftware<br />
durchgeführt. In dieser Phase werden außerdem die Einzelteilzeichnungen,<br />
Stücklisten und Anweisungen erstellt. Heute werden in der Regel keine komplett<br />
bemaßten Zeichnungen erstellt. In Zeichnungen werden die Hauptmaße und die<br />
Prüfmaße für die Qualitätssicherung dargestellt. Abschließend werden Prototypen<br />
gebaut, da sich hier die Funktionen am besten erproben lassen. Sollten in diesem<br />
Stadium Fehler auftreten, so muss der Produktentwickler in die zweite Phase<br />
zurückkehren und den Produktentwicklungsprozess erneut durchlaufen.<br />
11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 6
6 Durchzuführende Arbeiten<br />
Anfangs werden die durchzuführenden Versuche theoretisch analysiert.<br />
Dabei werden nach den Forderungen der entsprechenden DIN-Normen<br />
Protokollvorlagen erstellt, die das Auswerten der Versuche aus dem dritten<br />
Arbeitspaket erleichtern. Im Ergebnis stehen Tabellen und Protokolle zum<br />
Auswerten und Prozessparameter für die zu prüfenden biobasierten Kunststoffe.<br />
Im Weiteren erfolgt die Auswahl der zu prüfenden biobasierten Kunststoffe. Die<br />
Erwartungen an die ausgewählten biobasierten Kunststoffe werden in einem<br />
Sollzustand festgehalten und mit einem Meilenstein eingefroren.<br />
Ausgehend von den Ergebnissen der theoretischen Analyse werden die Versuche<br />
durchgeführt, um die Verarbeitbarkeit der gewählten biobasierten Kunststoffe<br />
festzustellen und um gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen.<br />
Anfangs wird die Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 ermittelt. Anschließend<br />
werden die Glasübergangstemperatur, die Schmelztemperatur sowie die<br />
Enthalpie mittels dynamischer Differenzkalometrie nach DIN EN ISO 11357-1<br />
bestimmt. Parallel wird eine thermogravimetrische Analyse nach DIN EN ISO<br />
11358 durchgeführt, um die Massenänderung in Abhängigkeit der Temperatur zu<br />
messen. Im Weiteren werden Versuche durchgeführt, um die Stabilität gegenüber<br />
thermischer Oxidation festzustellen. Die Bestimmung des thermischen<br />
Ausdehnungskoeffizienten mittels Dilatometer stellt eine weitere Versuchsreihe<br />
dar. Mit der Schmelz- und der Glasübergangstemperatur ist es möglich, die<br />
Viskosität nach ISO 11443 und das p-v-T-Diagramm nach ISO 17744 mittels<br />
Kapillarrheometer abzubilden. Hierbei wird außerdem betrachtet, wie sich die<br />
thermische Zersetzung der biobasierten Kunststoffe auf diese Kenngrößen und<br />
damit auch auf deren Verarbeitbarkeit auswirken.<br />
Im Anschluss an diese Untersuchungen werden Probekörper nach<br />
DIN EN ISO 294 durch Spritzgießen hergestellt, um mechanische Kennwerte<br />
ermitteln zu können. Hierbei werden Zugstäbe, Biegeproben, Kerbschlagproben<br />
und Härteprüfkörper gespritzt.<br />
Mit Hilfe der Probekörper können unter Anderem der Elastizitätsmodul für<br />
Zug und die Streckgrenze sowie die Bruchspannung und die Bruchdehnung<br />
bei verschiedenen Temperaturen nach DIN EN ISO 527 sowie die<br />
Kugeleindruckhärte nach DIN EN ISO 2039-1 und die Kerbschlagarbeit nach<br />
DIN EN ISO 179 bestimmt werden. Außerdem werden die Biegeeigenschaften<br />
nach DIN EN ISO 178 bestimmt.<br />
Zum Ende liegt das Hauptaugenmerk darin, aus den gewonnenen Ergebnissen<br />
Rückschlüsse für die Verbesserung der betrachteten biobasierten Kunststoffe zu<br />
ziehen. Dabei wird ein Sollzustand definiert, der mit dem ermittelten Istzustand<br />
verglichen wird. Dieses Arbeitspakt wird in enger Zusammenarbeit mit den be-<br />
<strong>Fachhochschule</strong> <strong>Schmalkalden</strong> 7
teiligten Projektpartnern realisiert. Werden hierbei gravierende Mängel in der<br />
Handhabbarkeit und Verwendung der biobasierten Kunststoffe festgestellt, so<br />
können diese behoben werden. In diesem Fall schließt sich eine erneute Prüfung<br />
nach Arbeitspaket 3 an.<br />
Sind die ermittelten Ergebnisse zufriedenstellend, erfolgt abschließend die Formulierung<br />
von Verarbeitungs- und Konstruktionsrichtlinien, die den Umgang<br />
mit den betrachteten biobasierten Kunststoffen erleichtern und so zu deren Akzeptanz<br />
bei der Produktentwicklung beitragen sollen.<br />
Daneben werden aus den Ergebnissen Fließkurven zur Beschreibung des Fließverhaltens<br />
der Biopolymere und p-v-T-Diagramme zum Abschätzen des Schwindungsverhaltens<br />
erstellt. Zusammen mit den anderen gemessenen Daten werden<br />
Datensätze für die Spritzguss-simulationssoftware Moldflow erstellt.<br />
Literatur<br />
[1] Käb, H.: Eine logische Entwicklung, in Kunststoffe. (August 2009), Seite 12-19<br />
[2] N.N.: http://www..kunststoffforum.de/ information/news_artikel.php?id=5376,<br />
aufgerufen am 14.03.2010<br />
[3] N.N.: http://www.european-bioplastics.org/index.php?id=5: Biokunststoffe, 07.<br />
August 2009<br />
[4] ENdrEs, H.-J.; siEbErt-ratHs, a. : technische Biopolymere. München: Carl Hanser<br />
Verlag, 2009, 1. Auflage<br />
[5] rEimEr, V.; KüNKEl, a.; PHiliPP, s.: Sinn oder Unsinn von Bio, in Kunststoffe. (August<br />
2008), Seite 32-36<br />
[6] KircHEr W.: Highlights: Leichtbau und Bio, in Kunststoffe. (November 2007),<br />
Seite 90-93.<br />
[7] GrEiNEr, r.; scHäfEr, H.-J.: Neuer Standard in der Materialanwendung: Biopolyamide,<br />
in Konstruktion. (Juni 2009), Seite 4f<br />
[8] mENGEs, G.: CO2 - Klimakiller oder Rohstoff für Kunststoffe, in Kunststoffe. (Oktober<br />
2008), Seite 78-84<br />
[9] Vdi-ricHtliNiE 2222-1: Konstruktionsmethodik: Methodisches Entwickeln von<br />
Lösungsprinzipien (Juni 1997)<br />
11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 8