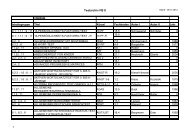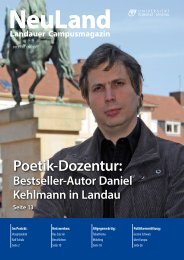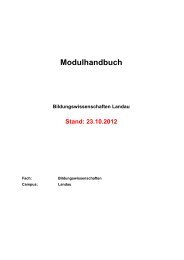Kristin Westphal Stimme. Geste. Blick. - Universität Koblenz · Landau
Kristin Westphal Stimme. Geste. Blick. - Universität Koblenz · Landau
Kristin Westphal Stimme. Geste. Blick. - Universität Koblenz · Landau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kristin</strong> <strong>Westphal</strong><br />
<strong>Stimme</strong>. <strong>Geste</strong>. <strong>Blick</strong>.<br />
– Der Körper als Bezugspunkt für Lern- und Bildungsprozesse<br />
Einstimmung<br />
Angefragt haben Sie mich, Ihnen die phänomenologische Perspektive<br />
für eine pädagogische Forschung nahe zu bringen. Diese Perspektive<br />
fragt in personaler, sozialer wie kultureller Dimensionierung nach<br />
dem Verhältnis von Natur-Kultur, Individuum und Gesellschaft.<br />
Diese Dimensionierungen finden wir auch im Schulischen wieder.<br />
Dort werden die Erfahrungen der Beteiligten gebrochen und<br />
transformiert durch die Ordnung und Machtinstanz der Institution<br />
Schule. Unterricht ist ein höchst komplexes Geschehen, an dem<br />
viele Faktoren und Ebenen beteiligt sind, die sich wechselseitig<br />
bedingen und bestimmen. Es ist von daher nicht verwunderlich, dass<br />
es bis heute nicht d i e Schultheorie gibt und die<br />
Erziehungswissenschaft über keine eigenständige Theorie verfügt.<br />
Erkenntnisse über diesen komplexen Zusammenhang können wohl nur im<br />
Verbund von mehreren wissenschaftstheoretischen und methodischen<br />
Zugängen möglich sein. Hier bespreche ich einen Zugang, der<br />
bislang eher am Rande schultheoretischer Erörterungen zu finden<br />
ist. Die nachfolgenden Ausführungen sind dann weniger auf<br />
normative, programmatische Sachverhalte hin ausgerichtet, sondern<br />
zielen auf die Frage nach einem Selbst- und Weltverhältnis des<br />
Individuums, das als miteinander verschränkt beschrieben wird in<br />
Unterscheidung zu Positionen, die das Subjekt als kognitiv<br />
sinnkonstituierend in den Mittelpunkt von Erfahrung stellen.<br />
Für eine Fundierung von Wirklichkeit und eine Erweiterung im<br />
Umgang mit Wirklichkeiten und Möglichkeiten kommt dem Leib/Körper<br />
– so die Behauptung – in pädagogischen Zusammenhängen eine<br />
grundlegende Rolle zu. Darüber rückt die performative Praxis eines<br />
pädagogischen und ästhetischen Geschehens in den <strong>Blick</strong>. An einem<br />
Beispiel wird der These nachgegangen, dass sich kulturelle Praxen<br />
in Körperhaltungen, in einem leiblichen Ausdrucksverhalten<br />
präsentieren und einen anderen Zugang als die diskursiven und<br />
kognitiv orientierten ermöglichen. Thematisiert werden neben einem<br />
Einblick in verschiedene Forschungsrichtungen die Grenzen des<br />
pädagogischen Verstehens in schulischen und außerschulischen
Bildungsprozessen. Ein Filmauschnitt zeigt uns, wie sich zwischen<br />
Lehrer und Schüler, Kind und Erwachsener Sinnstiftungsprozesse<br />
vollziehen. Die Beobachtung und Analyse der Szene soll dazu<br />
beitragen, die These zu veranschaulichen, dass unser Verhältnis<br />
zur Welt grundlegend medial, das meint vermittelt durch Andere und<br />
Anderes angelegt ist, hier festgemacht an Sprache, genauer: der<br />
Verflechtung von Körpersprache und Sprechen. Den Abschluss bildet<br />
ein kurzer Ausblick auf eine pädagogisch-anthropologisch<br />
orientierte Bildungstheorie. Als Impuls für die nachfolgende<br />
Abhandlung beginne ich mit einem Zitat, das beispielhaft<br />
kenntlich machen soll, worin die Schwierigkeiten und Defizite für<br />
eine Schul- und Unterrichtsforschung bestehen.<br />
Schuldefinitionen<br />
1. Der Schüler ist ein Kind, das zur Schule geht. Die Schule ist<br />
eine Institution, die aus Kindern Schüler macht. Die Schule ist<br />
auch eine Fiktion, aber sie hält sich für wirklich und wird für<br />
den Schüler zur Wirklichkeit. Der Schüler ist ein Kind, das in der<br />
Fiktion Schule lebt. Je besser es geschult ist, desto wirklicher<br />
wird die Schule. Schließlich wird die Schule zur Welt. Dann gibt<br />
es nur noch Schule, und in der Schule gibt es alles. In der Schule<br />
stimmt alles. Auf jede Frage gibt es eine Antwort. Zu jeder<br />
Tatsache gibt es die richtige Frage. Die Tatsachen werden in der<br />
Schule festgestellt. Alle Tatsachen zusammen heißen Stoff. Die<br />
Wirklichkeit der Welt wird in der Schule zu Stoff. Der Stoff wird<br />
in der Schule durchgenommen. Je öfter der Stoff durchgenommen ist,<br />
desto dünner wird er. Bald läßt er sich Jahr für Jahr mühelos<br />
durchdrehen. Jetzt ist die Wirklichkeit ganz zu Stoff geworden.<br />
Auf jede Frage gibt es nun eine Antwort. Alles stimmt nun. Jetzt<br />
hält die Schule die Schule für Schule.<br />
2. Der Schüler ist ein Kind, das zur Schule geht. Der Schüler sitzt am Schülerpult. Er sitzt ruhig.<br />
Der Schüler paßt auf. Der Schüler merkt auf. Er streckt die Hand auf, wenn der Lehrer eine Frage<br />
gestellt hat. Die Hand des Schülers streckt den Zeigefinger auf. Der Schüler antwortet. Er spricht<br />
deutlich. Er macht einen ganzen Satz. Immer bevor der Schüler den Mund aufmacht, streckt er die<br />
Hand auf ...<br />
(Ernst Eggimann: Die Landschaft des Schülers, Zürich 1973, 7–9)<br />
Diese Wortspiele, die an Wittgenstein oder Gertrude Stein erinnern<br />
lassen, haben neben dem humorvollen Anteil auch einen ernsten, der
für das, was ich im Folgenden erörtern möchte, zum Ausgangspunkt<br />
genommen wird. Der Text wurde von dem Lehrer und Autor Ernst<br />
Eggimann 1973 geschrieben. Seine Beschreibung von Schule und<br />
Schüler war für diese Zeit noch neu bzw. wieder neu und sicher<br />
provokativ. Aus heutiger Sicht spiegelt sich darin eine<br />
konstruktivistische bzw. systemtheoretische Sichtweise, wie sie in<br />
inzwischen in vielfältiger und ausdifferenzierter Weise die<br />
Diskussionen beherrscht. Ich möchte diese Position ergänzend mit<br />
der phänomenologischen Betrachtung verknüpfen, die nicht allein<br />
von der Schule und dem Schüler spricht. Diese thematisiert darüber<br />
hinaus, dass z. B. der Schüler immer ein auch konkretes Kind<br />
meint. Denn nicht allein die Schule steht repräsentativ für die<br />
Erwartungen an den Einzelnen, sondern umgekehrt ist auch zu<br />
berücksichtigen, dass der Einzelne dazu beiträgt, was und wie<br />
Schule ist. Das heißt, im Mittelpunkt meines Interesses stehen der<br />
Lehrer und der Schüler als soziale Akteure im pädagogischen<br />
Geschehen (vgl. Lippitz 1999, 42). Dieser <strong>Blick</strong> bleibt uns in<br />
diesem Text verwehrt. Interessant ist an dem Text die sehr<br />
konkrete Beschreibung eines – allerdings abstrakt gehaltenen –<br />
Schülerverhaltens unter Einbeziehung körperlicher Handlungsweisen.<br />
Diese lassen sich lesen, wie über Handlungen gesellschaftliche<br />
Normen und Werte einverleibt werden. Der Körper als leiblich-<br />
sinnliches Medium ist aber auch Vollzugssinn im Kontext<br />
schulischer Rituale und Inszenierungen, er ist aktiv mitwirkend am<br />
Geschehen zugleich, Handlungen vollziehen sich durch Bewegen,<br />
Wahrnehmen, Sprechen und tragen zu den Deutungen über und von<br />
Schule bei. Meyer-Drawe differenziert diese „Aktivität“ wie folgt:<br />
„Das Ich eignet sich seine Welt nicht an, indem es sie mit<br />
Konstruktionen überspannt. Es „empfängt“ sie und bringt sie in<br />
einer Art Reprise zum Ausdruck, zur Sprache. Der leiblichen<br />
Orientierung in der Welt gehört die sprachliche Organisation zu.<br />
Sprache drückt die Spannung zwischen Situiertheit und<br />
Objektivierung aus, da sie in der Lage ist, sich auf Anwesendes<br />
wie Abwesendes zu beziehen. Sprache ordnet die Situation, während<br />
die Wahrnehmung in ihr aufgeht.“ (Meyer-Drawe 2003, 2) Wenn man<br />
davon ausgeht, dass Erziehen, Bilden oder Unterrichten bedeutet,<br />
in der Ordnung eines pädagogischen Raums wie den der Schule, und<br />
in einer pädagogischen Sphäre – wie es Mollenhauer formuliert,<br />
wiederum Ordnungen herzustellen, in denen ein Gewebe von
Bedeutungen und Sinnzuschreibungen produziert wird, dann ergeben<br />
sich Fragen in zwei Richtungen:<br />
1. Auf der Makroebene: Welche Kultur, welche Symbolsysteme<br />
entwickelt eine Gesellschaft? Und wie spiegelt und<br />
transformiert sich die Kultur in der Schule?<br />
Wie wird in dieser hergestellt und verändert, was von außen<br />
als Kultur in die Schule mitgebracht wird?<br />
2. Auf einer Mikroebene: Welche Bedeutungszusammenhänge<br />
erschließt sich der Einzelne aus den pädagogischen<br />
Inszenierungen und Gegenständen und wie vollzieht sich das?<br />
Wie drückt sich dies nicht nur kognitiv, sondern auch<br />
körperlich-sinnlich aus? Wie vollzieht sich die Verflechtung<br />
der Außen- mit der Innenperspektive?<br />
Hintergrund des Themas: Kultur – Schule – Schüler<br />
Schule und Bildung sind in hochkomplexen Gesellschaften mit einer<br />
unüberschaubaren Medienkultur fast die einzige Instanz, die<br />
notgedrungener Weise Ordnungen schaffen muss, damit systematische<br />
Lernprozesse für eine nachwachsende Generation ermöglicht werden.<br />
Sie ist nicht nur inhaltlich, sondern auch im Vergleich zu<br />
gesellschaftlichen Systemen wie in Südamerika ohne eine<br />
institutionalisierte Bildungsinstitution – die Instanz, die in<br />
grundlegende Kultur- und Ordnungsmuster einführt. Damit meine ich<br />
auch Zeit-, Raum- und Ordnungsstrukturen und die systematische<br />
Auseinandersetzung zwischen den Generationen und die<br />
institutionalisierte Dauerreflexion über Sinn, Bedingungen und<br />
Ziele von Gesellschaft, Bildung und Kultur. Schule und Unterricht<br />
sind eine Institutionalisierung von Erziehung. Man kann bei aller<br />
Kritik nicht über die kulturelle Leistung und die<br />
Sozialisationsfunktion von Schule hinweggesehen.<br />
Die Ausrichtung der Erziehungswissenschaften auf<br />
sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Kontext von Erziehung,<br />
Bildung und Unterricht führte mit den 70er Jahren dazu, die Frage<br />
nach einer kulturellen Perspektive abzuspalten. Das hat zu tun mit<br />
unserer an naturwissenschaftlichen Denkmodellen orientierten<br />
Kultur, die die Gegenüberstellung von Kultur und Gesellschaft wie<br />
auch andere Dualismen produziert hat, die weit zurückreichen und
auch in neueren Ansätzen zu einer einseitigen Rekonstruktion von<br />
Gesellschaft und Kultur beitragen (vgl. Duncker 1994, 47).<br />
Es ist derzeit ein großes Interesse in der Erziehungswissenschaft<br />
an kulturwissenschaftlichen Fragestellungen zu beobachten, ein<br />
Interesse an performativen Verfahren und an der Untersuchung von<br />
kulturellen Praxen (Fischer-Lichte, Wulf ). Diese kulturelle Wende<br />
hat ihre Wurzeln in den 50er Jahren, beeinflusst von der<br />
Ethnologie, die mit der Methode der Feldforschung zu einer<br />
Neubestimmung des Kulturbegriffs gelangte, die für die Erforschung<br />
kultureller Praxen auch im erziehungswissenschaftlichen Interesse<br />
neuerlich von Belang sind. Mit der Performativität richtet sich in<br />
der Folge der <strong>Blick</strong> auf eine kontextuell situierte Praxis, die als<br />
diskursiv verankerte Praxisorientierung erscheint. „Die Struktur<br />
eines Ereignisses ist nicht im Vorfeld geklärt, sondern entsteht<br />
erst im Diskurs selbst.“ (Roa/Köpping 2000, 2f.) Kultur lässt sich<br />
aus dieser Perspektive dann nicht mehr nur als Bestand, Stoff oder<br />
Inhalt – wie es Eggimann vorschwebt – beschreiben.<br />
Sinnbildungsprozesse in pädagogischen Inszenierungen<br />
Der kulturelle Forschritt liegt heute insbesondere darin, dass wir<br />
wissen, dass Handlungen verschiedene Bedeutungen haben können, die<br />
kontextgebunden sind, d. h phänomenologisch gesprochen in einer<br />
sozial-historischen Mit-welt und Ding-Welt leiblich/körperlich<br />
verankert sind. Ferner wissen wir, dass Erziehung auf einer<br />
Unterscheidung zwischen Kind und Erwachsenem beruht, die im Sinne<br />
von Elias eine kulturell erworbene Unterscheidung ist. Sie ist<br />
nicht von Natur aus gegeben, sondern Ergebnis eines<br />
Auseinanderrückens von Kindern und Erwachsenen – nach Mollenhauer<br />
mit dem 15. Jahrhundert einher gehend mit einer gesellschaftlichen<br />
Arbeitsteilung und dem Aufkommen der Naturwissenschaften – und<br />
ergänzend sei betont mit der Entwicklung der Schrift einher geht<br />
(vgl. Mollenhauer 1983, 77). In einem eigenen pädagogischen Raum<br />
zeigen die Erwachsenen Kindern die Welt nicht wie sie ist, sondern<br />
das, was sie dafür halten. (Scholz 2000, 10). Indem Schule die<br />
Kultur der Erwachsenen präsentiert, repräsentiert sie den in<br />
dieser Kultur als Kontext geltenden Bedeutungszusammenhang der<br />
Beziehung von Kind und Erwachsenen und von Individuum,<br />
Gesellschaft und Kultur. Die kulturell erworbenen<br />
Verhaltensmöglichkeiten von Erwachsenen zeigen sich selbst als
zentraler Inhalt institutionalisierten Lehrens. Die Institution<br />
präsentiert sie als Repräsentationen in Texten bzw. Bildern, Tönen<br />
oder, wie es Eggimann formuliert, in Form von „Stoffen“. Die<br />
Unterscheidung von Kind und Erwachsener wird jedoch auch in der<br />
Schule gelebt. Wulf drückt dieses Verhältnis von Repräsentation<br />
und Präsentation folgendermaßen aus:<br />
„In den institutionalisierten sozialen Räumen besteht die<br />
Erwartung, daß die in ihnen tätigen Menschen z. B. Rituale<br />
inszenieren, sie aufführen und sich dadurch als Mitglieder der<br />
jeweiligen Institution darstellen. Die sich dabei vollziehenden<br />
Prozesse bleiben partiell unbewußt und wirken daher nachhaltig.<br />
Der Schulraum ist dafür ein gutes Beispiel. Dieser in einer<br />
Institution geschaffene Raum ist mit spezifisch gesellschaftlichen<br />
Funktionen verbunden, deren Erfüllung an diesem Ort verlangt und<br />
durchgesetzt wird. Im Schulraum erfolgt das Lernen in rituellen<br />
Inszenierungen. Mit ihrer Hilfe werden neue Verhaltensformen<br />
entwickelt und in die Körper der Kinder eingeschrieben. Diese<br />
Bewegungen werden einerseits vom Schüler auf seine persönliche<br />
Weise vollzogen, andererseits orientieren sie sich an den im Raum<br />
der Schule vorgegebenen Verhaltensmodellen, Vorschriften und<br />
Normen.“ (Wulf 1999, 17)<br />
Die Art des Verhältnisses von Lehrendem und zu Belehrenden<br />
vollzieht sich in pädagogischen Situationen und Ritualen, an denen<br />
beide mitbeteiligt sind. Das umfasst die Sinndeutung von<br />
gesellschaftlichem Wissen, das auch den Körper, seine Haltungen<br />
und <strong>Geste</strong>n einbezieht. Das Bildungssubjekt handelt und antwortet<br />
aus dem Geschehen, aus der Begegnung mit dem Anderen und den<br />
Dingen heraus. „Es konstituiert und manifestiert sich hier eine<br />
bestimmte Weise des In-der-Welt-Seins, das schöpferische Prozesse<br />
der Gestaltung und Umgestaltung fokussiert, in denen die<br />
Generierung von Bedeutungen in Abhängigkeit von Veränderungen<br />
erfolgt, die durch Handlungen – sich bewegen, sprechen, wahrnehmen<br />
– hervorgebracht werden.“ (vgl. Fischer-Lichte, die Joas zitiert;<br />
1998, 22) Scholz versteht pädagogische Situationen sogar als<br />
ästhetische Gebilde, die von den Beteiligten geschaffen werden und<br />
die gleichzeitig wieder ihre Interaktion bestimmen. Als<br />
ästhetische Gebilde richte sich die Aufmerksamkeit nicht auf die<br />
bewussten Intentionen, die Programme, die Normen, die Kognition<br />
etc., sondern auf eine Leiblichkeit, die all diese Momente<br />
integriere (vgl. Scholz 2000). Handlungsvollzüge beziehen
akustische, haptische, visuelle, leibliche bzw. körperliche,<br />
atmosphärische also materielle Gegebenheiten in die<br />
Auseinandersetzung mit Welt bzw. Wirklichkeit ein. Dabei wird aus<br />
der Sicht des Subjekts das Selbst- und Weltbild gleichermaßen<br />
berührt. Welt steht demzufolge dem Lernenden nicht mehr gegenüber<br />
im Sinne einer Repräsention eines Symbols, sondern wird als Teil<br />
von Wirklichkeit anerkannt, indem er selbst spricht, sich selbst<br />
zum Beispiel in der Rede, in der Bewegung, in der <strong>Geste</strong> oder als<br />
Gegenstand anzeigt.<br />
Der Psychologe Bruner bemerkt in seinem Buch The culture of<br />
education, „that meanings provide a basis for cultural exchange.<br />
It ist the culture that provides the tools for organizing and<br />
understanding our worlds in communicable way. Without those tools,<br />
wether symbolic or material, man is not a naked ape but an empty<br />
abstraction.“ (1996, 3) Sinngemäß heißt das, ... dass<br />
Sinnbildungsprozesse die Voraussetzung für eine kulturelle<br />
Veränderung oder Bewegung seien. Und es sei die Kultur, die uns<br />
das Werkzeug zur Verfügung stellt, um die Wege für den Umgang und<br />
für ein Verständnis unserer Welten (man achte auf den Plural! d.<br />
A.) zu kommunizieren. Ohne diese Werkzeuge, weder symbolische noch<br />
materielle, wäre der Mensch eine leere Abstraktion. Bruner setzt<br />
in Hinsicht auf das Potential zu lernen auf die Kreativität und<br />
Aktivität des Individuums auf seinem jeweils kontextgebundenen<br />
kulturellen Hintergrund. „Lerarning and thinking are always<br />
situated in a cultural setting and always dependant upon the<br />
utilization of cultural resources.“ (Bruner 1996, 4)<br />
Einige dieser Äußerungen machen deutlich, dass Kulturen etwas<br />
sind, das sich die Menschen selbst geschaffen haben: also einen<br />
geschichtlichen, kontextualen, veränderlichen und intentionalen<br />
Zusammenhang darstellt. Kulturen sind aber nicht allein nur das,<br />
worüber wir sprechen, sondern sie umfassen vor allem das, womit<br />
und wie wir kommunizieren. Wimmer kennzeichnet Kulturen als eine<br />
Sphäre diskursiver Ordnungen und symbolischer Praktiken, die die<br />
Eingliederung des Individuums in die Gesellschaft und dieser in<br />
die Umwelt erst ermögliche und strukturiere. (Wimmer 2002).<br />
Kulturen sind weder als absolut noch als abgeleitet zu verstehen<br />
oder als Vorhandene, der man abgelöst davon – gegenübersteht.<br />
Kulturen sind vielmehr fortlaufende Kommunikationsprozesse und als<br />
solche beschreibbar. Sie beziehen die Erfahrungswirklichkeiten der<br />
am Erziehungsgeschehen Beteiligten mit ein und werfen die Frage
auf, wie wir wissen, was wir wissen (vgl. Meyer-Drawe 1996, S.<br />
85f). Geht die Unterrichtsforschung dieser Möglichkeit nach? Ich<br />
möchte diese Frage am Beispiel der Interpretativen<br />
Unterrichtsforschung überprüfen.<br />
Unterrichtsforschung<br />
Eines lässt sich zunächst positiv vermerken. Es gibt bereits die<br />
verschiedenen Forschungsrichtungen wie die Kindheits- und<br />
Jugendforschung, Biografie- und Unterrichtsforschung etc., die<br />
längst Erziehungswissenschaft unter kultureller Perspektive<br />
betreibt und sich dem Wandel der Sozialisationsbedingungen von<br />
Kindheit und Jugend, den Strukturen von Subjektivität und<br />
Intersubjektivität, mithin allen Rahmenbedingungen von Erziehungs-<br />
und Bildungsprozessen zuwendet als Voraussetzung für weitergehende<br />
Konzepte und Stellungnahmen (vgl. Wimmer 2001, 293) Die Frage nach<br />
der Qualität der sich neu formierenden Verhältnisse und ihrer<br />
Logik stehe allerdings noch aus, stellt Wimmer fest.<br />
„Die Nebenwirkungen der Handlungen in pädagogisch-praktischem<br />
Mikro – wie in wissenschaftlich-technischen Weltmaßstab zeigen,<br />
daß sich die Welt nicht die Gesetze durch unseren Verstand<br />
vorschreiben läßt, daß die Menschen von ihren Handlungen selbst<br />
überrascht werden.“ (ebd).<br />
Am Beispiel der Interpretativen Unterrichtsforschung möchte ich<br />
diese angedeutete Problematik vertiefen. Zwei Hauptperspektiven<br />
tragen diesen Forschungsansatz nach Krummheuer: Unterricht als<br />
Kontexte kognitiver Prozesse zu erfassen in Hinsicht auf die<br />
Situativität dieser Prozesse und die Frage, wie die Bedeutungen<br />
von Handlungen die Interaktionen den Unterrichtsalltag selbst<br />
mitkonstituieren (Krummheuer 1999, 15f.) Doch was auffällt ist,<br />
dass die Interpretative Unterrichtsforschung wie es auch von der<br />
Objektiven Hermeneutik bekannt ist, ihre Daten immer erst dann<br />
aufnimmt, wenn gesprochen wird. D.h. ihre Forschungsmethoden sind<br />
kognitiv und diskursiv orientiert, und sie arbeitet mit Modellen<br />
einer rationalen Verlust- und Gewinnrechnung. Deutlich wird diese<br />
Zielbestimmung an folgendem Zitat:<br />
„Schule ist eine Institution, in der es zentral um Verbesserungen<br />
geht, und zwar um die Verbesserung von Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten der Schüler, d. h. um bessere Lernergebnisse. Das
soll durch eine Optimierung der Lernprozesse, durch einen<br />
„besseren“ Unterricht erreicht werden. (Krummheuer 1999, 14)<br />
Diesem Ansatz ist entgegenzuhalten, dass Situationen nicht allein<br />
diskursiv, sondern auch präsentativ zu erfassen sind. Das bedeutet<br />
für die Unterrichtsforschung, sich viel stärker als bisher auf den<br />
Körper und seine Haltungen einzulassen und damit einerseits auf<br />
die Bilder, Metaphern und Erzählungen und andererseits daraus<br />
hervorgehend auf beschreibbare Griffe, Konzeptionen. Mit anderen<br />
Worten, Kulturen sind nicht allein aus den in ihnen dominierenden<br />
Kalkülen heraus zu verstehen, als vielmehr über ihre Rückbindung<br />
an die Wünsche, Ängste, Erwartungen als deren bewegendes Motiv von<br />
und in Sozietäten. Emotionen, Leiblichkeit sind dann nicht als<br />
defizitäre Modi von Rationalität, sondern als deren Basis zu<br />
begreifen. Situationen sind dann von den Beteiligten durch<br />
Deutungen gestaltete soziale und emotionale Räume, die durch<br />
unsere Leiblichkeit in Bewegung gehalten wird.<br />
Scholz bemerkt: „Die Art und Weise der Beziehung zwischen den<br />
Personen und Dingen konstituiert wiederum eine Atmosphäre, die von<br />
dem einzelnen Individuum her gesehen von dem bestimmt wird, was<br />
die Dinge und die anderen mitbringen, mit welcher Konstruktion der<br />
Situation man die Situation selbst wahrnimmt und was man an nicht<br />
verfügbaren, z. B. biografischen Momenten selbst einbringt.“<br />
(Scholz, 2000, 10.)<br />
Hier hat die neuere Pädagogische Phänomenologie erhebliche<br />
Vorarbeiten geleistet. Mit dem Konzept Lebenswelt und<br />
Leiblichkeit, Atmosphäre hat sie in den letzten Jahrzehnten ein<br />
wissenschaftliches Instrumentarium erarbeitet, mit dem sie für<br />
einen inhaltlichen Ertrag für Theorie und Praxis der Erziehung und<br />
Unterricht den Boden bereitet hat. 1 Einige Begrifflichkeiten möchte<br />
ich, bevor ich fortfahre, an dieser Stelle klären:<br />
1 Zu erwähnen ist Van Manen und Levering, die in der Tradition der Utrechter<br />
Schule zahlreiche phänomenologisch orientierte Einzelfallstudien auf der<br />
methodologischen Grundlage der Integration von geisteswissenschaftlichhermeneutischen<br />
und narrativen Methoden vorstellen. In der nach-Husserlschen<br />
Tradition bewegen sich Forschungen von Lippitz, Meyer-Drawe, Rittelmeyer,<br />
Loch und Bräuer, indem sie den Erfahrungsbegriff aufnehmen und eine kritische<br />
Rekonstruktion der Genealogie menschlicher Rationalitätsformen vornehmen<br />
(vgl. Lippitz, 1999, 2001) Mit <strong>Blick</strong> auf empirische Forschung in der<br />
Musikpädagogik sind die Ansätze von Kreutz, der Musikunterricht unter<br />
emotionalen Aspekten untersucht, hervorzuheben. Vgl. auch Bastians Studien,<br />
die allerdings auch dieser hier vorgetragenen Kritik anheim fallen. Bastian,<br />
H.G. (2000). Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an<br />
Berliner Grundschulen. Mainz: Schott International. Bastian, Hans Günther &<br />
Kreutz, Gunter (Hg.) (im Druck) Musik und Humanität. Mainz: Schott-<br />
International. Kreutz, Gunter (2000). Wie kommt das Gefühl in die Musik?
Lebenswelt – Waldenfels spricht von Lebenswelt auch als Hörwelt -<br />
meint, dass sie immer schon auf bestimmte Weise interpretiert und<br />
praktisch verfügbar gemacht ist (Waldenfels 2000, 100).<br />
Leiblichkeit meint hier kurz zusammengefasst im Sinne von Merleau-<br />
Ponty die zweideutige Seinsweise des Leibes: Ambiguität nennt er<br />
das. Weder lässt sie sich eindeutig der Natur noch der Kultur<br />
zuordnen. Plessner fasst diese Doppelheit als „exzentrische<br />
Position“ des Menschen. Diese schließt gleichzeitig ein Körpersein<br />
und Körperhaben ein. Er ist weder allein Leib, noch hat er allein<br />
Leibkörper. Die Äußerung „Ich bin mein Leib“ thematisiert das<br />
Fungieren des Leibes in dem, was ich selber bin. Und „Ich habe<br />
einen Körper“ bedeutet, ich kann von mir Abstand nehmen, soweit,<br />
dass ich mich selber wie ein Naturding betrachte. Er ist beteiligt<br />
an der Konstitution von Welt. Dieses Verständnis vom LeibKörper<br />
sind Selbstdifferenzierungsprozesse und keine Außenbeschreibung<br />
(vgl. Waldenfels 2000).<br />
Das prominente Beispiel von Merleau-Ponty mit dem Würfel, den ich<br />
nie von allen Seiten gleichzeitig betrachten kann, macht deutlich,<br />
dass unsere Wahrnehmung immer unvollständig und perspektivisch<br />
ausgerichtet ist und eine Strukturierungsleistung darstellt. Das,<br />
was fehlt, muss ich mir mit Hilfe meiner Erfahrungen vorstellen.<br />
Ich kann immer nur einen Teil der Wirklichkeit erfassen und bin<br />
durch meinen Standort gebunden. Das trifft auch auf die Erfahrung<br />
mit einem Medium bzw. Gegenstand wie Musik zu.<br />
„Wirklichkeit“ begreife ich nicht als positivistisches Faktum,<br />
sondern als Phänomenbereich, in dem sich etwas als etwas in einer<br />
bestimmten Hinsicht zeigt. Sinn und Bedeutungen erweisen sich als<br />
Artikulationen von Wirklichkeit. Demzufolge sind wir nicht zwei<br />
Wirklichkeiten ausgesetzt, einer praktischen und einer kognitiven,<br />
sondern einer einzigen Wirklichkeit, die zugleich vorgegeben ist<br />
und hervorgebracht wird (Waldenfels 1998, 216). Menschliche<br />
Erfahrung widerfährt mir, sie bleibt offen und ist nicht im voraus<br />
Emotionen als Gegenstand von empirischer Forschung und Musikunterricht.<br />
Diskussion Musikpädagogik, 6(2), 66-77. Kreutz, Gunter, Bongard, Stephan &<br />
von Jussis, Julia (2002). Kardiovaskuläre Wirkungen beim Musikhören. Zur<br />
Bedeutung von musikalischer Expertise und Emotion. Musicae Scientiae, 257-<br />
278. Kreutz, Gunter (in Vorbereitung). Lernbereich Musik. In J. Kahlert, S.<br />
Binder & G. Lieber (Hrsg.). Ästhetische Bildung in der Grundschule – Zugänge<br />
zum begegnungsintensiven Lernen (Arbeitstitel) (erscheint beim Verlag<br />
Westermann, Braunschweig)
egelbar. Sie befindet sich in einem ständigen Umstrukturierungs-<br />
bzw. Verfestigungsprozess.<br />
Die pädagogische Forschung, Kindheits- und Jugendforschung hat bis<br />
heute sehr wenige Berührungspunkte mit der Unterrichtsforschung.<br />
Die Gründe hierfür sind schon benannt. Letztere berücksichtigt<br />
prinzipiell nicht bzw. nur eingeschränkt die Perspektive von<br />
Kindern. Der Fokus dieser Forschung richtet sich auf Ergebnisse<br />
und Effektivität im Sinne: Wie mache ich einen besseren Unterricht<br />
und hat das allein kognitiv sinnkonstituierende Subjekt im <strong>Blick</strong>.<br />
Es wäre wünschenswert, wenn die Unterrichtsforschung aus dieser<br />
Einengung heraus die Impulse, wie sie in der pädagogischen<br />
Forschung entwickelt worden sind, aufgreifen könnte.<br />
Kinder aus der Perspektive von Erwachsenen<br />
Perspektiven von Kindern aus Forschersicht erfassen zu wollen,<br />
führt uns im Sinne von Husserl von vornherein zu einem Paradoxon:<br />
zu der Erfahrung, dass mir der Andere nur in der Weise zugänglich<br />
wird, indem ich ihn als unzugänglich erfahre. Wenn Erwachsene sich<br />
über die Kindheit Gedanken machen, so impliziert das, dass das<br />
Kind nicht in der Perspektive des Erwachsenen aufgeht. Kinder in<br />
ihrer anderen sinnlich-leiblich bedingten Perspektivität erfahren<br />
Welt und Sozialität anders als Erwachsene. Der Andere wird nur in<br />
seiner Appräsenz präsent, die Beziehung zu Anderen ist<br />
gleichzeitig durch Entzug bestimmt. Pädagogisches Handeln bedeutet<br />
dann, neuen Handlungssinn aus der Differenz der Partner zu<br />
generieren (vgl. Lippitz 1999, 44).<br />
Kindheit als Mythos (Lenzen), Kindheit als Konstrukt von<br />
Erwachsenen (Scholz/Honig/Alan), Kinder als Fremde (Meyer-<br />
Drawe/Waldenfels/Lippitz), diese Sichtweisen haben in den letzten<br />
Jahrzehnten dazu geführt, ein Bewusstsein in ganz<br />
unterschiedlicher Weise im erziehungswissenschaftlichen Denken zu<br />
entwickeln, Kindheit als eine Entwicklungsphase – als Ausschnitt<br />
eines Erziehungsprozesses zu betrachten und zu differenzieren vom<br />
Erwachsenenalter. Sie lässt sich auch verstehen als Aspekt einer<br />
Kinderkultur (Scholz/Göhlich/Wulf/Zirfas). Wichtig ist in diesen<br />
neueren Ansätzen, Kindheit wird nicht mehr abgespalten oder als
Enklave betrachtet, Kinder werden nun als (Mit-)Produzenten ihrer<br />
Entwicklung untersucht (Honig u.a. 1999, 9). 2<br />
Vorläufer waren Forschungsansätze wie die von Muchow/Muchow, auch<br />
Piaget und nicht zuletzt die Säuglingsforschung und die<br />
nachhusserlschen phänomenologischen Ansätze (wie Utrechter<br />
Schule), die Kinder nicht nur als Forschungsobjekte sehen, sondern<br />
als sprachbegabte Subjekte mit eigenen Erfahrungen und<br />
Wissensformen (Alanen 1994, 93). In dieser These liegt für mich<br />
ein erster wichtiger Bezugspunkt zur pädagogischen Forschung mit<br />
Ausrichtung auf eine Rezeptions- bzw. Erwerbsforschung, wie sie<br />
auch für die Musikpädagogik interessant ist.<br />
Im Kontext der Diskurse um das Generationsverhältnis wird nicht<br />
zuletzt immer wieder betont die Unvorhersehbarkeit/Unbestimmtheit<br />
– auf die Zukunft bezogen – im Erziehungsgeschehen, das offene,<br />
das dezentrierte, das fremde Moment ..., das auf uns selbst<br />
zurückzuführen ist. In der Pädagogik wird dies unterschiedlich<br />
gewertet und interpretiert. Einerseits als Mangel, wenn Kindheit<br />
als utopischer Ort und als kostbare Erinnerung an eine<br />
unwiderrufliche Vergangenheit gehütet wird: Kindheit als Metapher<br />
der Sehnsucht nach einem längst verlorenen und unerreichbaren<br />
Zustand der Ursprünglichkeit und Freiheit. Andererseits, wenn<br />
dieser Mangel als produktiv aufgefasst wird. Eine Auffassung, die<br />
ich teile. Sie beobachtet, dass das Verhältnis zwischen Kindern<br />
und Eltern oder allgemein zwischen Erwachsenen immer in<br />
asymmetrischer Form auftritt. Weder kann ein Kind seine Kindheit<br />
überspringen noch ein Erwachsener wieder Kind sein. Diese<br />
Beziehungsstruktur ist irreversibel und außerordentlich<br />
wirkungsvoll und dient der Einführung in die menschliche<br />
Gemeinschaft. Damit ist ein zweiter Bezugspunkt für eine<br />
2 Die oben genannten Forschungsrichtungen arbeiten mit unterschiedlichen<br />
Fragestellungen und Methoden. Fragt die sozialwissenschaftliche Ausrichtung nach<br />
den Bedingungen der Möglichkeiten, unter denen Kinder aufwachsen, verfolgt die<br />
Kultursemiotik – dazu gehört z. B. Christoph Wulf – den Werte- und Sinnwandel,<br />
dem Kindheit und Gesellschaft und ihre Institutionen unterliegt. Die<br />
nachhusserlsche Phänomenologie (Lippitz/Meyer-Drawe), mit der ich mich<br />
insbesondere auseinandergesetzt habe, fokussiert ihre Fragen auf die Genesis von<br />
Kommunikationsprozessen und beschreibt bzw. reflektiert, wie sich<br />
Bildungsprozesse vollziehen. Sie begreift ihre Vorgehensweise als offen,<br />
prozessual, dezentriert und dialogisch, als ein zukunftgerichtetes Projekt, das<br />
immer wieder neu zu beschreiben ist (vgl. <strong>Westphal</strong> 2002, Lippitz 2001).
pädagogischen Forschung genannt, der Fremderfahrung im<br />
zwischenmenschlichen Bereich insbesondere zwischen Kindern und<br />
Erwachsenen thematisiert. Der nachfolgende Exkurs greift diesen<br />
Aspekt genauer auf.<br />
Exkurs: „Wieweit kann man zählen?<br />
Eine Szene aus dem Film „Etre et Avoir“ „Sein und Haben“ von<br />
Nicolas Philibert (Europäischer Dokumentarfilmpreis 2002 PRIX<br />
ARTE)<br />
Vorbemerkungen zum Material<br />
Der Film „Etre et Avoir“, „Sein und Haben“ thematisiert<br />
insbesondere das dialogische Verhältnis zwischen Lehrer und<br />
Schüler als ein Ineinandergreifen von Selbst- und<br />
Fremdartikulationen, Sprechen und Handeln. Ein Schuljahr hat der<br />
Regisseur Philibert eine Landschule in der Auvergne in Frankreich<br />
mit 13 Schülern zwischen 4 und 11 Jahre Situationen zwischen<br />
Lehrer und Schülern und den Eltern, die Umgebung der Schüler und<br />
Landschaft sowie Portraits eingefangen und kunstvoll zu einem Film<br />
montiert. Zu bedenken ist: Der Film erzählt aus einem anderen<br />
Kulturkreis und einer anderen Unterrichtskultur. Die heterogene<br />
und kleine Besetzung der Schulgruppe ergibt sich durch die<br />
regionale und geografische Lage in der Auvergne, gekennzeichnet<br />
von eher Armut und Landflucht. Zu bedenken ist außerdem, der Film<br />
arbeitet mit starken ästhetischen Mitteln 3 : In einem ruhigen,<br />
langsamen Rhythmus und verweilenden Perspektiven wirken starke<br />
impressionistisch gehaltene Bilder auf den Zuschauer ein. Das<br />
führt dazu, sich eher eine romantische Vorstellung der<br />
französischen Schulverhältnisse auf dem Land zu machen. Ich<br />
unterstelle: Das Gegenteil dürfte der Fall sein.<br />
Eine kleine Szene soll hier zum Ausgangspunkt für unsere<br />
Beobachtung dienen. Der Lehrer ist mit seinen Schülern in der<br />
weiterführenden Schule zu Besuch. Sie befinden sich in der<br />
Bibliothek dieser Schule. Der kleine Jo-Jo, 5 Jahre hat sich ein<br />
3 Der Anspruch eines Dokumentarfilmes ist, die Bilder sprechen zu lassen, möglichst unverfälscht zu transportieren,<br />
was im schulischen Alltag einer kleinen französischen Dorfschule passiert. Konstantin Mitgutsch hebt hervor, dass<br />
Philibert die Kinder wie ein Maler beobachtet. „Der Maler aber projiziert das Bild, welches er wahrnimmt auf ein neues<br />
Objekt und stellt seine Sicht dar. Im Transformieren und Transportieren liegt die Kunst des filmischen Malers<br />
Philibert.“ (Mitgutsch, <strong>Universität</strong> Wien, unv. Manuskript. Bildung als Phänomen in Theorie und Praxis. 2003) Und die<br />
ist subjektiv.
Buch mit Tieren ausgesucht und entdeckt mit seinem Lehrer, dass<br />
das Buch 100 Seiten hat: Anlass für den Lehrer mit Jo-Jo ins<br />
Gespräch zu kommen zu der Frage: Wie weit kann man zählen? Nachdem<br />
Jojo an Hand des Buches die Zahlen überprüft, meint er, man könne<br />
bis 100 zählen. Auf die Frage, ob es Zahlen gebe, die über die<br />
Hundertergrenze hinausschreiten, meint der Schüler, dass es die<br />
Zahl 1000 ebenfalls gebe. Als Herr Lopez wissen will, ob diese<br />
Zahl ebenfalls überschritten werden könnte, kommentiert Jojo die<br />
Idee des Lehrers mit einem einfachen „Non“. Als der Lehrer<br />
beginnt, die Zahlen 1001 und 1002 aufzuzählen, verändert sich<br />
Jojos Meinung. Er beginnt mitzuzählen: „1003 und 1005.“ Als der<br />
Lehrer fragt, ob man auch die Zahl 2020 verbalisiert werden könne,<br />
blickt dieser auf das Heft seiner Sitznachbarin und deklariert mit<br />
einem „Non“ die Frage des Lehrers. Als der Lehrer andeutet, dass<br />
es sehr wohl weiter ginge, sieht Jojo diesen vermeidlichen<br />
Tatbestand ein und beginnt wieder weiterzuzählen. Als er bei<br />
Hunderttausend aufhört, postuliert er wiederum, dass hiermit die<br />
höchste Zahl erreicht sei. Nach einer kurzen Nachdenkpause, sagt<br />
Jojo: „Eine Milliarde“ und beginnt weiter zu zählen, bis er von<br />
seinem Umfeld abgelenkt aufhört zu zählen und nicht mehr weiter<br />
zählen will.<br />
Vorbemerkungen zum Beobachten der Beobachtung<br />
Wir beobachten im Folgenden eine Beobachtung, die sich selbst zum<br />
Ziel gesetzt hat zu beobachten. Das „Sein“ der Kinder im<br />
Schulalltag einer französischen Dorfschule soll möglichst<br />
unverfälscht dokumentiert werden. Die Kamera verweilt von daher<br />
bei den Gesichtern, den <strong>Geste</strong>n, bei der Atmosphäre sowie der<br />
Umgebung der Kinder. Doch zeigt uns der <strong>Blick</strong> von Philibert durch<br />
die Kamera ein subjektives, ein spezifisches „Sein“, welches für<br />
diesen Film transformiert und modelliert wurde. Zwischen „Sein“<br />
und „Haben“ tut sich eine Lücke auf, die für unsere Analyse dieser<br />
Beobachtung zu berücksichtigen ist. An die Wirklichkeit als solche<br />
gelangen wir sicher nicht. Nach mehrmaligem Sehen dieser<br />
ausgewählten Interaktion zwischen dem Lehrer und Jo-Jo schält sich<br />
heraus, dass die Beobachtung der <strong>Stimme</strong> und <strong>Geste</strong> wie der <strong>Blick</strong><br />
als ein Zugang für die Interpretation dienen können. <strong>Stimme</strong>,<br />
<strong>Geste</strong>, <strong>Blick</strong> sind in ganz besonderer Weise daran beteiligt, den<br />
zwischenmenschlichen, pädagogischen oder ästhetischen Raum zu
strukturieren. Es zeigt sich, dass der Körper mehr als ein<br />
Vermittler von Information ist, er ist gleichzeitig Empfindungs-<br />
und Handlungsträger von Wahrnehmungen und Ausdrucksorgan. Der<br />
Dialog in der Szene zwischen Jo-Jo und seinem Lehrer lässt nach<br />
mehrmaligen Sehen da aufmerken, wo er unterbrochen bzw. aufgestört<br />
zu sein scheint? Hierzu einige Anmerkungen:<br />
<strong>Blick</strong>richtungen<br />
Hiersein bedeutet zugleich Dortsein, wo die Anderen sind, wo sich<br />
etwas Wichtiges abspielt. Festmachen lässt sich dies an den<br />
<strong>Blick</strong>richtungen des kleinen Jo-Jos. Eine <strong>Blick</strong>richtung nimmt er<br />
zum Buch hin ein, die zweite zum fragenden Lehrer und eine dritte<br />
bewegt sich in den Raum insbesondere in Richtung zweier<br />
Mitschüler, die sich streiten.<br />
Der Lehrer verfolgt die Absicht, Jo-Jo den Zahlenraum – ein Thema,<br />
das an ein zuvor gezeigtes Gespräch in der Schule anknüpft – als<br />
unendlichen verständlich zu machen, in einer neuen Situation das<br />
Gelernte zu zeigen. Das Sprechen entfaltet sich im Hören, im<br />
Antworten auf das, was der Andere sagt bzw. fragt. Was der Lehrer<br />
sagt und fragt, ist bestimmt durch die Gesprächssituation. Elias<br />
benutzt zur Beschreibung dieser Zwischensphäre, die sich hier<br />
zwischen Lehrer und Schüler im Sprechen entfaltet – das Bild der<br />
Verflechtung, bei der verschiedene Linien ineinander laufen<br />
(Elias, 1987, 53f.). Der Lehrer nimmt die Aufmerksamkeit, die das<br />
Buch und der Streit der Mitschüler für den kleinen Jo-Jo bedeuten<br />
wahr und bezieht diese Geschehnisse in das Gespräch mit ein.<br />
Zweimal berührt er Jo-Jo mit der Hand an dessen Schulter, um ihn<br />
im Gespräch zu halten. Oder an einer anderen Stelle spricht er mit<br />
Jo-Jo die Zahlen zusammen, zum Teil die Antwort vorgebend, zum<br />
Teil mittragend. Es entsteht auf diese Weise ein insbesondere vom<br />
Lehrer initiiertes Zusammenspiel, in dem der Lehrer in das Spiel –<br />
in das Antworten des kleinen JoJos „einstimmt“, aber auch<br />
bestimmt, aber auch im Bestimmen wieder von Jo-Jo bestimmt wird.<br />
Es ist dann nicht immer ganz klar, was auf das Konto der eigenen<br />
Handlung von Jo-Jo geht und was auf das Konto der fremden<br />
Handlung, also des Lehrers geht (vgl. Waldenfels 2000, 290). Das<br />
Zwischen differenziert sich und setzt sich im Sinne von Elias<br />
nicht aus Einzelleistungen zusammen. Handeln bedeutet ein<br />
Ineinandergreifen von eigenem und fremden Tun, es ist nicht<br />
deckungsgleich, es findet immer auch ein Entzug statt, eine
Überlagerung bzw. Verschiebung von Verdecken und Entdecken. Der<br />
Dialog entsteht und besteht aus Lücken und produziert auf diese<br />
Weise Überschüsse. Mal kommen die beiden zusammen, mal stockt und<br />
entgleitet der Dialog und fängt sich wieder neu, bis er sich in<br />
einer neuen Situation auflöst.<br />
<strong>Stimme</strong><br />
In dieser kleinen Sequenz sagt Jo-Jo neunmal „Non“. Würde man nur<br />
die Transkription lesen, wäre das „Non“ im semantischen Sinne<br />
immer oder fast immer gleich zu deuten sein. Kommt die sichtbare<br />
Körpersprache hinzu, die Intonation, wie Jo-Jo das „Non“ sagt und<br />
in Verbindung mit welcher Mimik, erweitert sich die Möglichkeit<br />
der Deutung.<br />
Das „Non“ erfährt unter Hinzuziehung von Mimik und Intonation<br />
gänzlich unterschiedliche Aussagen. Mal ist es ein „Non“, das<br />
meint: „Nein, lass mich mit den Zahlen in Ruhe, „Schauen Sie Herr<br />
Lehrer, die Tiere...“ Mal ist es ein „Non“, das fragend ist oder<br />
Unsicherheit ausdrückt bzw. nach Sicherheit sucht, ob die Zahlen<br />
denn wirklich schon zu Ende sind. Auch kann an einer Stelle das<br />
„Non“ sogar als „Oui“ gedeutet werden.<br />
Die Mimik des kleinen Jo Jos verändert sich, wenn die<br />
Aufmerksamkeit auf die Anstrengung geht, die Zahlen zu benennen,<br />
dann ziehen sich seine Augen zusammen. Geht die Aufmerksamkeit in<br />
den Raum, zu dem Streit seiner Mitschüler und entzieht sich Jo-Jo<br />
den Fragen des Lehrers, hebt er die Augenbrauen angestrengt hoch<br />
angesichts der Kontakte Lehrer-Buch-Mitschüler.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen. Der Dialog zwischen dem Lehrer<br />
und Schüler kennzeichnet sich durch Bezug und Entzug. Die<br />
Körpersprache des Lehrers ist zu großen Teilen bestimmend,<br />
vereinnahmend. Die körperliche Nähe, die gleiche Augenhöhe, der<br />
Handkontakt des Lehrers lässt darauf deuten, dass sich hier der<br />
Lehrer im Bewusstsein seiner Rolle als Lehrer durchsetzen möchte.<br />
Der Lehrer ist in seiner Körperlichkeit dem 5-jährigen Jo-Jo weit<br />
überlegen, er ist schlicht größer, älter (kurz vor seiner Pension)<br />
und sprachgewandter. Indem er sich auf die gleiche Höhe setzt,<br />
also Nähe herstellt, entsteht eine doppelte, eine paradoxe Aussage<br />
bzw. Situation: ich bin der Stärkere, wende mich aber dir auf<br />
gleicher Höhe zu. Jo-Jo ist in dieser Hinsicht durchaus als ein
Opfer zu sehen. Er ist dem Lehrer ausgesetzt, er muß dem Lehrer<br />
zuhören. Es ist sein Lehrer. Aber: er weiß damit auch umzugehen.<br />
Zum Lachen bringen uns die Versuche des kleinen Jo-Jos, sich – wie<br />
auch an anderen Stellen des Films – dem zu entziehen. Er führt in<br />
solchen Momenten sozusagen die Situation, indem er den Führenden<br />
führt (vgl. Foucault 1999, 306). Das wird insbesondere an der<br />
Sprechweise von Jo-Jo wie er das Nein sagt, dass ganz<br />
unterschiedlich gedeutet werden kann, an der Inszenierung der<br />
Rede, an der Sprache wie sie selbst spricht, hörbar und nicht<br />
zuletzt an der Mimik und den <strong>Blick</strong>richtungen, die seine<br />
Aufmerksamkeit, sein Interesse an dem Geschehen herum wie an den<br />
vielen Tieren im Buch kenntlich machen.<br />
Der Körper im pädagogischen Kontext, in der Schule ist auch der,<br />
der diszipliniert und<br />
sozialisiert wird. Das Zuhören, das Zählen, das Nach- und<br />
Mitsprechen spielt dabei eine große<br />
Rolle. Zähle ich nicht im Takt, falle ich aus dem gemeinsamen<br />
Musizieren z. B. heraus. Es ist<br />
eine notwendige, zu übende, zu disziplinierende Maßnahme, um<br />
miteinander kommunizieren<br />
zu können. Die Frage ist nur, ob dem kleinen Jo-Jo auf diese Art<br />
und Weise das Zählen nicht<br />
eher ausgetrieben wird. Bzw. es stellt sich die Frage, was lernt<br />
er hier stattdessen?<br />
Den Film habe ich bereits vielen Studierenden gezeigt. Er wurde<br />
fast durchweg positiv aufgefasst.<br />
Warum? Der Lehrer wird gerade auf Grund der <strong>Geste</strong>, sich auf die<br />
Höhe des kleinen Jungen zu<br />
begeben, als Mensch wahrgenommen, der sich dem Jungen zuwendet und<br />
sich auf ihn einlässt,<br />
der Verständnis und Offenheit für das eigene „Sein“ von Jo-Jo<br />
zeigt. Wahrgenommen wird er<br />
weniger in der Rolle als Lehrer, der hier möglicherweise ein eher<br />
tradiertes Autoritätsverhältnis<br />
vorstellt. Ein zentriertes Machtverhältnis zwischen Lehrer und<br />
Schüler liegt nicht vor. Doch<br />
stellt sich schon die Frage: Welche latenten<br />
Sozialisationsprozesse laufen ab, wie sie sich im eher<br />
subtilen Zusammenspiel des Aufeinanderabstimmens von Unterschieden<br />
im Lehrer-Schüler
Verhältnis typisch sind? Ich denke, hier zeigt sich die<br />
pädagogische Kommunikation als ein<br />
differentes Kräfteverhältnis, das sich überkreuzt, aufeinander<br />
bezieht, konvergiert oder sich im<br />
Gegenteil zu widersprechen und aufzuheben trachten. Die<br />
Wirkungsweisen dieser Handlungen<br />
bedeuten hier eine Veränderung der Situation oder Führen der<br />
Führungen (Ricken 2002, 169).<br />
Nicht zu unterschätzen ist, wie die ästhetische Formgebung auf die<br />
Rezeption wirkt. Die Frage<br />
ist, inwiefern die Perspektive des Films das Verhältnis von Lehrer<br />
und Schüler als differentes<br />
Machtverhältnis eher einebnet, statt transparent zu halten. Die<br />
Sehnsucht nach einer Instanz<br />
eher schürt, die die Verantwortung trägt. Die Reaktionen der<br />
Zuschauenden lässt das vermuten.<br />
Die Wünsche und Vorstellungen eines Lehrer-Schülerverhältnisses<br />
als Utopie werden geweckt.<br />
Utopie als Zukunftsbezug bedeutet nach de Haan: „Die Schule als<br />
gesellschaftlich ausdifferenziertes<br />
System ist der Ort, an dem diese utopischen Entwürfe angeregt,<br />
ausphantasiert und durchgespielt werden<br />
könnten.“ (de Haan 1996, 231f.) Doch setzt das den <strong>Blick</strong> auf die<br />
Gegenwart – als wünschbare<br />
und nicht wünschbare – und die Vergangenheit voraus.<br />
Scholz schreibt: „Schüler und Lehrer handeln gemeinsam im Sinne<br />
eines sozialen Handelns im Rahmen sozialer und politischer<br />
Gegebenheiten in einer Gesellschaft. Von daher stellt sich die<br />
Frage, wie Schüler lernen können, die Gegebenheiten, in denen sie<br />
leben zu verstehen, lernen können, darin zu handeln und lernen<br />
können, über ihre Handlungen zu reflektieren. Voraussetzung dafür<br />
ist, dass die Beziehung zwischen Individuen und Rahmen zum<br />
Gegenstand der Betrachtung werden.“ (2003, S.9) Diese<br />
Diskursfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz, um sich als<br />
Individuum in einem kulturellen und sozialen Raum wie den der<br />
Schule zurecht zu finden. Und diese Diskursfähigkeit, in die sich<br />
auch der kleine Jo-Jo schon mit seinen 5 Jahren zielsicher einübt<br />
hat einen doppelten Boden. Sie bedeutet mehr als die<br />
Verwirklichung von Intentionen. „Dieses Mehr besteht in der Art
und Weise, in der Handelnde ihre Ziele realisieren.“ Im Wie. (Wulf<br />
2001a, 9)<br />
In dieser kleinen Kommunikation einer Lernsituation überlagern<br />
sich diesen Beobachtungen und Reflexionen zufolge mehrere<br />
Sinnstrukturen, die am Lernprozess mitwirken. So ist das Lernen<br />
unter den gesellschaftlich gegebenen Rahmungen abhängig von der<br />
Situation und dem Horizont, in dem es sich zeigt. Im Weiteren ist<br />
der Gegenstand der Betrachtung, das Buch mit den vielen Tieren für<br />
das Kind von Bedeutung im Gegensatz zu der Bedeutung der Zahlen,<br />
die der Lehrer ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Außerdem<br />
spielen die leibliche Verfasstheit und die Atmosphäre eine Rolle<br />
ebenso wie die Handlungen der Beteiligten, wie sie die<br />
Möglichkeiten aufgreifen und dadurch die Situation bestimmen. Und<br />
nicht zuletzt wirkt die Selbst- und Fremdwahrnehmung auf die<br />
gestellte Lernaufforderung ein. Die Sprache wiederum benennt und<br />
ordnet und weist zugleich über die Erfahrung und über ihre eigene<br />
Objektivierung hinaus. (vgl. Stieve 2003, 91f.)<br />
Ausblick<br />
Welche Paradigmen eröffnen sich aus den Beobachtungen für einen<br />
Lern- und Bildungsbegriff? Die Überlegungen machen deutlich, dass<br />
nicht von einem Subjekt ausgegangen wird. Das Sprechen und Hören<br />
stellt sich als ein Vorgang und ein Ereignis zwischen Menschen<br />
dar, die im responsiven Feld aktiv werden können, deren Teil und<br />
nicht deren Initiator sie sind. Das Geschehen unterliegt<br />
verantwortend den einzelnen Individuen und wird mehr als nur von<br />
einem Individuum ausdifferenziert. Jede soziale Beziehung ist in<br />
diesem Sinne Fremderfahrung. Wird die Aufmerksamkeit auf das<br />
Geschehen in pädagogischen Interaktionen gelenkt, so gelangt die<br />
Verwobenheit des Subjekts mit seiner Welt in den Vordergrund und<br />
wie ein Ereignis auf die Subjekte zu einwirkt. Im Wahrnehmungsakt<br />
stoßen wir auf die Differenz zwischen dem Wahrgenommenen und dem<br />
Wahrnehmenden, d. h. eine Verflechtung von Subjekten mit ihren<br />
„Gegenständen“ in Zwischenwelten des Sinns und Bedeutens. Die<br />
Artikulationsweisen im Spiel dieser Differenzen basieren nicht auf<br />
fassbaren Identitäten und eindeutigen Positionierungen. In dieser<br />
Theorie sind die Rollen zwischen den am Dialog Beteiligten nicht<br />
eindeutig zwischen Hörer und Sprecher verteilt. Von daher erleben<br />
die Beteiligten auf wechselnde Weise das Sehen und Tun als
Eingriff und Widerfahrnis. Passivität und Aktivität treten dann<br />
nicht mehr als Gegensatzpaar auf, sondern artikulieren sich als<br />
ein verschränktes Verhältnis in vielfältigen Dosierungen. Wir<br />
haben es in diesem Denkmodell nicht mehr mit einem Subjekt zu tun,<br />
das als aktives Zentrum aller Konstituierungen gedacht wird und<br />
einer Welt gegenüber steht, sondern als eines, das mit Welt<br />
verschränkt ist. 4<br />
Die soziale Kontextgebundenheit sprachlicher Äußerungen und die<br />
konkrete Erfüllung ihres Redesinns in einer inter-subjektiven<br />
Praxis bedeutet demzufolge mehr als Nachahmung. Erst über konkrete<br />
Sprecherfahrungen, die mit der Kopräsenz eines Anderen<br />
einhergehen, erfahren wir über die Worte hinausgehend andere<br />
Ausdrucksgestalten wie den <strong>Blick</strong>, die Hände, die Haltung des<br />
Körpers, den Klang der <strong>Stimme</strong>, die Lautgebung etc. Mit anderen<br />
Worten, es treten bestimmte <strong>Geste</strong>n als Fundament der Kommunikation<br />
in Erscheinung. Die Sprache ist so gesehen selbst als eine<br />
bestimmte Ausdrucksgebärde zu verstehen (vgl. MEYER-DRAWE 1984,<br />
201). Diese Grundannahmen bestimmen das Verstehen von <strong>Geste</strong>n, wie<br />
es an dem Filmausschnitt exemplifiziert werden sollte. 5 Im<br />
pädagogischen Geschehen verweisen Einmaligkeit und<br />
Wiederholbarkeit von <strong>Geste</strong>n und Sprache aufeinander. Sie tragen<br />
zur Gemeinschaftsbildung in der Weise bei, indem die sprachlich-<br />
interaktiven Formen des sozialen Austauschs jeden egologischen<br />
Bewussteinsraum sprengen. Handeln, Sprechen und andere soziale<br />
Spielarten von Erfahrungen sind vielmehr in einem Zwischenreich<br />
der Interaktion angesiedelt (vgl. LIPPITZ 2001b, 147). Sie sind<br />
heterogen und dezentriert verfasst und gehen aus verschiedenen<br />
Lebenszusammenhängen hervor. Die hier vorgestellte Perspektive auf das<br />
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft begreift Sozialität<br />
ausgehend vom Verhältnis zum Anderen. Meyer-Drawe spitzt die Frage<br />
nach der Alterität in Anbindung an die Doppeldeutigkeit unserer<br />
leiblichen Existenz und die Leibgebundenheit der Vernunft,<br />
derzufolge die Fremdheit nicht von außen auf uns einbricht,<br />
4 Diese Position setzt sich ab zu postmodernen und posthistorischen Entwürfen des Menschen. Das Subjekt existiert<br />
nicht mehr als Akteur, es geht ins Objekt über. (vgl. Baudrillard 1987, 74)<br />
5 Ausdruck läßt sich nicht allein an diskriminerbaren Merkmalen festmachen, er beruht auf komplexen<br />
Gesamteindrücken. „Die Elemente, die die Kamera darstellt, sind nicht die Elemente, die die Sprache darstellt. Sie sind<br />
tausendmal zahlreicher.“ schreibt Susanne Langer. Die formalen Merkmale des Bildes gehören nach Langer einer<br />
präsentativen Ordnung an. Ihre Struktur sei ganzheitlich, beruhe auf Simultanietät der Erfassung, Konkretheit,<br />
Unübersetzbarkeit, konnotativer Semantik und Indifferenz gegenüber den Worten mit ihrem Anspruch auf Wahrheit.
sondern unserer eigenen Leiblichkeit selbst bereits inhärent ist,<br />
folgendermaßen zu:<br />
„Bildung bedeutet in dieser Perspektive gerade nicht<br />
Identitätsfindung, sondern Gestaltung einer unausweichlichen<br />
Fremdheit mit uns selbst, also eine konflikthafte Lebensformung<br />
unter historischen, gesellschaftlichen, aber auch naturgegebenen<br />
Bedingungen.“ (Meyer-Drawe 1999, 154)<br />
Der Zusammenhang von Schule, Schüler und Kultur, wie er uns<br />
eingangs im Zitat von Eggimann vorgestellt wird, zeigt uns ein<br />
Verständnis im Sinne einer solchen Identitätsfindung. Dem Schüler<br />
wird über die „Stoffe“ Kultur vermittelt. In schulischen<br />
Inszenierungen wird die <strong>Geste</strong>nsprache der Kinder überformt. Dem<br />
habe ich nun ein Konzept gegenüberstellt, das pädagogische<br />
Inszenierungen als Sinnstiftungsprozesse begreift. Kultur und<br />
Schule werden in dieser Theorie als Geschehen – ein Zwischen- und<br />
Antwortgeschehen – in einem Kontext verstanden, der durch die<br />
Beteiligten nicht nur kognitiv, sondern auch leiblich konstituiert<br />
wird. Von da aus stellen sich Verweisungsbezüge auf die Inhalte,<br />
Bestände und Stoffe unserer Kultur her. In diesem Verständnis geht<br />
es nicht darum, Kultur von außen an die Individuen heranzutragen.<br />
Sinnprozesse erfolgen vielmehr in Handlungsvollzügen, in denen<br />
Ereignisse oder pädagogische Situationen auf ihre Veränderbarkeit<br />
hin erfahren, eigene Gewissheiten relativiert werden können. Wir<br />
haben es mit einem komplexen, responsiven Geschehen zu tun, das<br />
subjektdezentriert verläuft: zwischen Sinnstiftung, Sinnvorgabe<br />
findet eine Auseinandersetzung ein. Merleau Ponty drückt dies so<br />
aus: Die Verwirklichung von Sinn, dessen Verflüssigung im<br />
körperlichen Ausdruck einer Gebärde, Stimmlichkeit oder<br />
Räumlichkeit sei dann eine wahrhaftige Neuschöpfung (Merleau-Ponty<br />
1994, 432). Die phänomenologische Vorgehensweise ist selbst ein<br />
Prozess, der sich immer wieder neu beschreibt und am konkreten<br />
Fall, in einem spezifischen Kontext auf seinem jeweiligen<br />
Hintergrund und Horizont neu reflektiert und überprüft. Das<br />
traditionelle Denken der Repräsentation, das von einer<br />
dichotomischen Trennung zwischen Subjekt und Objekt ausgeht, wird<br />
von kritischer Seite aus befragt. Die kommunikative Funktion von<br />
Sprache hier insbesondere in der Verflechtung von von Körper und<br />
Wie tonale Elemente gewinnt ein Bild erst durch den Zusammenhang der Teile an Bedeutung. Langer, in: Seewald<br />
1997, 108.
Sprache – und das gilt in ganz besonderer Weise für die<br />
musikalische Sprache – und die Bedingung der Rezeption und<br />
Produktion rücken bei dieser Vorgehensweise in den Vordergrund.<br />
(vgl. <strong>Westphal</strong> 2002, 98)<br />
Mehrperspektivität, Pluralität, die Frage nach Eigenem und<br />
Fremden, Differenz und Kontingenz schälen sich als Paradigmen für<br />
die Beschreibung einer Schul- und Kulturtheorie als fortlaufenden<br />
Prozess heraus, die aus der Re/Konstruktion und Reflexion<br />
kultureller Praxen selbst für Forschung und Praxis leitend sein<br />
können, und aus der Begrenzung, Bildung als Funktion – wie es die<br />
systemtheoretischen Analysen verfolgen – allein zu definieren oder<br />
als normatives Legitimationsinstrument – wie es die klassische<br />
Bildungstheorie versucht – zu bestimmen, den Diskurs bereichern,<br />
erweitern oder gar vorantreiben kann.<br />
Literatur<br />
ALANEN, L.: Zur Theorie der Kindheit. In: Sozialwissenschaftliche<br />
Literatur Rundschau Heft 28/1994, S. 93–112<br />
AUSTIN, John Langshaw: How to Do Things with Words. Oxford 1962.<br />
Dt.: Zur Theorie der Sprechakte, übers. von E. v. Savigny,<br />
BRUNER, Jerome: The Culture of Education. Cambridge, London 1996<br />
DUNCKER, Ludwig: Lernen als Kulturaneignung. Weinheim 1994<br />
EGGIMANN, Ernst: Die Landschaft des Schülers. Zürich 1973<br />
ELIAS, N.: Die Gesellschaft der Individuen. Frankfurt/M. 1987<br />
FISCHER-LICHTE, Erika: Auf dem Wege zu einer performativen Kultur.<br />
In: Fischer-Lichte (Hg.): Kulturen des Performativen.<br />
Paragrana, Band 7 Berlin 1998, Heft 1, S. 13–29<br />
FOUCAULT, Michel: Das Subjekt und die Macht. In: Dreyfus, Hubert<br />
L./Rabinow, Paul: Michel Foucault: Jenseits von<br />
Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt/M.1994, S. 241–261<br />
GEERTZ, Cifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen<br />
fremder kultureller Systeme. Frankfurt/M. 1987<br />
HAAN, Gert, de: Kulturorientierte Umweltbildung in der Grundschule.<br />
In: S. George/I. Prote (Hrsg.): Handbuch zur politischen<br />
Bildung in der Grundschule. Schwalbach/Ts. 1996<br />
HONIG, Michael-Sebastian/LANGE, Andreas/LEU, Hans Rudolf: Eigenart<br />
und Fremdheit. In: Dies. (Hrsg.): Aus der Perspektive von Kindern?<br />
Zur Methodologie der Kindheitsforschung. Weinheim und München<br />
1999.
HONIG, M.-S./LEU, H.R., NISSEN, U.: Kindheit als Sozialisationsphase<br />
und als kulturelles Muster. Zur Strukturierung eines<br />
Forschungsfeldes. In: Dies. (Hrsg.): Kinder und Kindheit.<br />
Weinheim/München 1996, S. 9–30.<br />
JOAS, Hans: Die Kreativität des Handelns. Frankfurt/M. 1996<br />
KRÄMER, Sybille: Sprache, <strong>Stimme</strong>, Schrift. Sieben Thesen über<br />
Performativität als Medialität. In: Paragrana 7, Berlin 1998,<br />
1, S. 33–57<br />
KRUMMHEUER, Goetz: Grundlagen und Beispiele interpretativer<br />
Unterrichtsforschung. Opladen 1999<br />
LIPPITZ, Wilfried: Lebenswelt oder die Rehabilitierung<br />
vorwissenschaftlicher<br />
Erfahrung. Weinheim 1980<br />
Aspekte einer phänomenologisch orientierten pädagogisch-<br />
anthropologischen Erforschung von Kindern. Anmerkungen zur<br />
aktuellen These der Kindheitsforschung: das Kind als „sozialer<br />
Akteur“. In: Vierteljahreszeitschrift für wissenschaftliche<br />
Pädagogik, Heft 2/99, S. 238–247<br />
Phänomenologische Forschungen in der deutschen<br />
Erziehungswissenschaft. In: Bauer, W./Lippitz, W./Marotzki,/<br />
W./Ruhloff, J./Schäfer, A./Wulf, Ch. (Hg.): 3. Jahrbuch<br />
Erziehungs- und Bildungsphilosophie, Hohengehren 2001a, S.173–<br />
199<br />
Die biografische Perspektive auf das Kind – aus<br />
phänomenologisch-erziehungswissenschaftlicher Sicht. In:<br />
Behnken, Imbke/Zinnecker, Jürgen (Hg.): Kinder – Kindheit –<br />
Lebensgeschichte. Ein Handbuch, Seelze-Velber 2001b<br />
Fremdheit und Differenz. Frankfurt/M. 2003<br />
MEYER-DRAWE, Käte: Sozialität und Leiblichkeit. München 1984<br />
Vom anderen lernen. In: Borelli, M./Ruhloff, R.:<br />
Gegenwartspädagogik Bd. 2, Opladen 1996, S. 85–98<br />
/WALDENFELS, B.: Das Kind als Fremder. In:<br />
Vierteljahreszeitschrift für wissenschaftliche Pädagogik<br />
64, 1988, 271–287<br />
Die Not der Lebenskunst. Phänomenologische Überlegungen zur<br />
Bildung als Gestaltung exzentrische Lebensverhältnisse. Fünf<br />
Überlegungen. In: Dietrich/Müller (Hg.): Bildung und<br />
Emanzipation. München 1999, S. 147–154<br />
Stimmgewalten. In: Mensik, Dagmar/Liebsch, Burkhard: Gewalt<br />
verstehen. 2003
Vorwort. In: Stieve, Claus: Vom intimen Verhältnis zu den<br />
Dingen. Würzburg 2003<br />
MERLEAU-PONTY, M.: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966<br />
Keime der Vernunft. München 1994<br />
MOLLENHAUER: Vergessene Zusammenhänge. München 1983<br />
/Wulf: Ästhetik/Aisthesis. Wahrnehmung und Bewußtsein.<br />
Weinheim 1996<br />
MUCHOW, M./MUCHOW, H.-H.: Der Lebensraum des Großstadtkindes. Mit<br />
einer Einführung von Jürgen Zinnecker. Bensheim 1978 (reprint<br />
Martin Riegel Verlag, Hamburg 1935)<br />
RICKEN, Norbert: Bruch mit dem Einen: Differenz, Pluralität,<br />
Sozialität. In: Bauer. W./Lippitz, W. et al: Weltzugänge.<br />
Hohengehren 2002<br />
ROA, Ursula/Köpping, Klaus Peter: Die performative Wende: Leben–<br />
Ritual–Theater. In: Im Rausch des Rituals. 2000, S.3–31<br />
SCHOLZ, Gerold: Die Konstruktion des Kindes. Über Kinder und<br />
Kindheit Opladen 1994<br />
Konkrete Kinder – Überlegungen einer Kindheitsforschung aus<br />
der Perspektive von Kindern. MS 2000<br />
STIEVE, Claus: Vom intimen Verhältnis zu den Dingen. Würzburg 2003<br />
WIMMER, Michael: Pädagogik als Kulturwissenschaft. Programmatische<br />
Überlegungen zum Status der Allgemeinen Erziehungswissenschaft.<br />
In: ZfE Beiheft 1/02, Opladen 2002, S.109–122<br />
WALDENFELS, Bernhard: Antwortregister. Frankfurt/M. 1994<br />
Grenzen der Normalisierung, Frankfurt/M. 1998<br />
Das leibliche Selbst. Frankfurt/M. 2000<br />
Lebenswelt als Hörwelt. In: Ehrenforth, Karl-Heinrich (Hrsg.):<br />
Musik. Unsere Welt als Andere. Würzburg 2001<br />
WESTPHAL, K.: Wirklichkeiten von <strong>Stimme</strong>n. Grundlegung einer Theorie<br />
der medialen Erfahrung. Frankfurt/M. 2002<br />
Woher kommen die Bedeutungen? Sprechen und Zu/Hören als Geben<br />
und Nehmen in schulischen Ritualen. Beitrag zum Symposium von<br />
Wulf, Christoph: Innovation und Ritual. Familie, Jugend und<br />
Schule. In: ZfE, Beiheft 1 Berlin 2004<br />
WULF, Christoph /GÖHLICH, Michael/ZIRFAS, Jörg: Grundlagen des<br />
Performativen. Weinheim 2001<br />
Wulf, Christoph: Mimesis in <strong>Geste</strong>n und Ritualen. In: Paragrana 7,<br />
Berlin 1998, Heft 1, S. 241–263
Zeit und Ritual. In: Bilstein/Miller-Kipp/Wulf:<br />
Transformationen der Zeit. Weinheim 1999, S. 112–122<br />
Filmausschnitt<br />
PHILIBERT, Nicolas: Sein und Haben. Europäischer Dokumentarfilmpreis<br />
2002 Prix Arte.<br />
Eine Produktion der Maia Film in Koproduktion mit Arte Cinema,<br />
Les Films d`Ici. Centre National de Documentation Pedagogique<br />
etc. und Unterstützung von Ministère de L`Education Nationale.<br />
Pädagogische Chancen liegen sowohl im Bereich individuell-biographischer wie auch in<br />
Gruppenprozessen, wobei idealer Weise individuelles und gemeinschaftliches Erleben als optimale<br />
Grundlage zur Entfaltung musikalisch-emotionaler Erfahrungen miteinander verbunden sind. Es<br />
sollte pädagogisches Ziel sein, Schülerinnen und Schülern die selbstregulatorischen Wirkungen von<br />
Musik zu verdeutlichen und die Reflexion emotionaler Bedeutungen von Musik in ihren sowohl<br />
soziokulturellen als auch psychobiologischen Prägungen zu ermöglichen. Ausgangspunkt können<br />
Untersuchungen der Ausdruck/Eindruck-Beziehungen sein, in denen musikalische Strukturen mit<br />
intendierten (stereotypen) emotionalen Bedeutungen verbunden sind. Dem müsste sich eine<br />
Ausweitung der Perspektive auf psychologische, physiologische und soziale Ebenen musikalischer<br />
Gefühlswirkungen anschließen. Musikpräferenzen, subjektive Bewertungen von Musik, Stilen oder<br />
Genres, trennen beispielsweise vielerorts Unterrichtskonzepte der Lehrer von den Erwartungen an<br />
den Unterricht seitens der Schülerinnen und Schüler. Eine Auflösung dieser Opposition kann nur<br />
von zwei Seiten gelingen, nämlich einerseits die Bereitschaft, objektiv valente musikalische<br />
Kunstwerke der Individuation des musikalischen Geschmacks unterzuordnen; andererseits durch<br />
die Integration von Klassenverbänden in gemeinschaftliches musikalisches Handeln, um<br />
entsprechende Musikerfahrungen zu ermöglichen.<br />
Die Vermittlung von Grundlagen psychologischer Vorgänge, die spezifisch sind für musikalische<br />
Tätigkeiten, könnte im Rahmen geeigneter didaktischer Vorgehensweisen den Prozess des<br />
Musiklernens wesentlich bereichern. Die Entstehung von musikbezogenen Emotionen und ihre<br />
Verquickung mit sowie auch Abgrenzung von der alltäglichen Gefühlswirklichkeit kenntlich zu<br />
machen, könnte sich nicht allein zur Formulierung neuer, äußerst relevanter Lernziele, sondern auch<br />
im Interesse des pädagogischen Prozesses insgesamt als nützlich erweisen.<br />
Kritisch zu bemerken bleibt, dass wesentliche Bereiche musikalischer Erfahrung, nämlich eben<br />
Stimmungen, Gefühle und Emotionen, auch nach diesen Untersuchungen noch weit unterforscht<br />
sind. Übersichten zu den einzelnen Themenfeldern in den hier vorgelegten Studien legen nahe, dass<br />
eine tatsächlich ausgewogene Musikdidaktik, in die kognitive und emotive Elemente musikalischer<br />
Erfahrung einfließen und mit Bewusstheit über die hiermit assoziierten Vorgänge reflektiert werden<br />
können, erst in einem eigenständigen Forschungs- und Evaluationsprozess zu erarbeiten wäre.<br />
Allerdings könnten die vorliegenden Studien durchaus Anregung sein, dem integrativen Ansatz der
Musikpädagogik (Reinecke, Rauhe, & Ribke, 1975; Kleinen, 1994) als Modell einer solchen,<br />
ausgewogenen Didaktik, entsprechende Grundlagen zuzuführen.