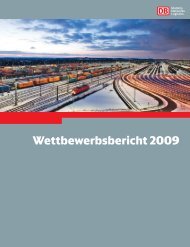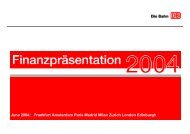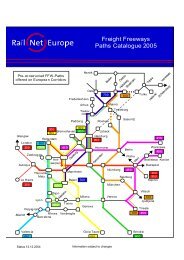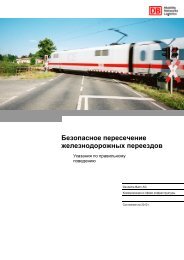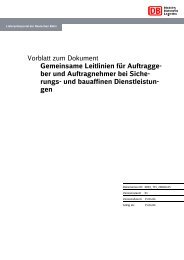Faktenblatt Schaudepot DB Museum Nürnberg - Deutsche Bahn AG
Faktenblatt Schaudepot DB Museum Nürnberg - Deutsche Bahn AG
Faktenblatt Schaudepot DB Museum Nürnberg - Deutsche Bahn AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Faktenblatt</strong><br />
<strong>Schaudepot</strong> <strong>DB</strong> <strong>Museum</strong> <strong>Nürnberg</strong><br />
(Berlin/<strong>Nürnberg</strong>, 29. Februar 2012)<br />
Lage Freigelände des <strong>DB</strong> <strong>Museum</strong>s<br />
Ausstellungsfläche 250 m²<br />
Exponate 40 Großobjekte & Objektgruppen<br />
Feuerbüchse der Lokomotive „Adler“<br />
Baujahr 1935<br />
Herstellungsort Ausbesserungswerk Kaiserslautern<br />
Material Kupfer<br />
Dorpmüller-Gleismesser<br />
Baujahr um 1920<br />
Heinrich Dorpmüller erfand 1880 ein fahrbares Gleismessgerät, mit dem<br />
Abweichungen in der Höhenlage des Gleises sowie der Regelspurweite<br />
aufgezeichnet werden konnten. Die Räder der rechten Seite sind durch Federn<br />
beweglich gelagert. Die Bewegungen werden über ein Gestänge und einen<br />
Schreibstift auf einen Papierstreifen übertragen und so die Abweichungen<br />
aufgezeichnet. Nach diesen Aufzeichnungen konnte dann die Instandsetzung<br />
des Gleises geplant und durchgeführt werden.<br />
Schienenfahrrad<br />
Baujahr um 1920<br />
Schienenfahrräder gehören zu der Fahrzeuggruppe der Draisinen.<br />
Schienenfahrräder wurden von den <strong>Bahn</strong>meistereien vorgehalten, um die<br />
vorgeschriebenen Streckenbegehungen durch den <strong>Bahn</strong>meister schneller<br />
durchführen zu können.<br />
Feuerspritze<br />
Baujahr um 1880<br />
Zur Brandbekämpfung wurden auf kleineren <strong>Bahn</strong>höfen handbediente<br />
Feuerspritzen bereit gehalten. Diese Feuerspritze war bei der Königlichen<br />
Eisenbahndirektion Köln (rechtsrheinisch) auf der Station Walmerod im<br />
Westerwald eingesetzt.<br />
Sitzbank der 3. Klasse eines Reisezugwagens<br />
Baujahr um 1930<br />
Die früher als Holzklasse bezeichnete 3. Klasse wurde mit lattenbeplankten<br />
Sitzbänken ausgerüstet. Die Sitze waren der Körperform angepasst. Für<br />
längere Reisen bot die damalige Mitropa das „Mitropa-Reisekissen“ an, mit dem<br />
man sich die Reise in der Holzklasse etwas gemütlicher gestalten konnte.<br />
Herausgeber: <strong>DB</strong> Mobility Logistics <strong>AG</strong><br />
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland<br />
Verantwortlich für den Inhalt:<br />
Leiter Kommunikation Oliver Schumacher<br />
Dr. Rainer Mertens<br />
Teamleiter Ausstellung / PR<br />
Tel. +49 (0) 911 219-1233<br />
www.dbmuseum.de<br />
Achim Stauß<br />
Sprecher Konzern<br />
Tel. +49 (0)30 297-61190<br />
Fax +49 (0)30 297-61919<br />
presse@deutschebahn.com<br />
www.deutschebahn.com/ presse<br />
2012 AS/SL 1/4
<strong>Faktenblatt</strong><br />
Abfahrtstafel vom <strong>Bahn</strong>hof Linz/Rhein<br />
Baujahr um 1920<br />
Derartige Abfahrtstafeln wurden bis in die 1980er Jahre auf kleineren und<br />
mittelgroßen <strong>Bahn</strong>höfen verwendet, um den Druck von Aushangfahrplänen zu<br />
ersparen. Die Buchstaben und Ziffern waren austauschbar, so dass die Pläne<br />
zu den Fahrplanwechseln aktualisiert werden konnten.<br />
Zugzielanzeiger Bauart <strong>Deutsche</strong> Reichsbahn<br />
Baujahr um 1960<br />
Auf größeren <strong>Bahn</strong>höfen wurden bereits ab 1880 Zugzielanzeiger aufgestellt.<br />
Die ersten Geräte wurden noch mechanisch durch den Aufsichtsbeamten auf<br />
dem jeweiligen <strong>Bahn</strong>steig bedient. Aber bereits um 1910 kamen elektrisch<br />
bedienbare Zugzielanzeiger zum Einsatz. Der gezeigte Anzeiger wurde von der<br />
<strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn beschafft und im gesamten ostdeutschen Raum bis vor<br />
wenigen Jahren verwendet.<br />
Zugzielanzeiger Bauart <strong>Deutsche</strong> Bundesbahn<br />
Baujahr um 1980<br />
Seit Ende der 1980er Jahre beschaffte die <strong>Deutsche</strong> Bundesbahn<br />
computergesteuerte Zugzielanzeiger, die nach und nach die<br />
lochkartengesteuerten Zugzielanzeiger ersetzten. Heute sind diese Anzeiger<br />
bereits wieder überholt und werden durch Nachfolgemodelle mit LED-Anzeige<br />
ersetzt.<br />
Kurbelstellwerk<br />
Baujahr 1894<br />
Eisenbahnunternehmen Königlich Bayerische Staatseisenbahn<br />
Die süddeutschen Eisenbahnverwaltungen bevorzugten das rein mechanische<br />
Stellwerk, in dem auch die <strong>Bahn</strong>hofsblockeinrichtungen mechanisch durch<br />
Drahtzüge bedient wurden. Die <strong>Bahn</strong>hofsblockeinrichtungen sichern die<br />
Zugfahrten innerhalb der <strong>Bahn</strong>höfe, mit ihnen wird die entsprechende<br />
Fahrstraße gesichert und das Signal freigegeben.<br />
Mechanisches Stellwerk Bauart Jüdel<br />
Baujahr um 1900<br />
Bei diesem Stellwerk erfolgt der Verschluss der Weichen durch<br />
Parallelverschlussbalken. Die Signalschubstangen werden über Kurvenrollen<br />
angetrieben. Die Fahrstraßenhebel werden durch den darüber befindlichen<br />
Stationsblock (System Siemens & Halske) freigegeben.<br />
Die Firma Jüdel aus Braunschweig war eine der großen Signalbauanstalten in<br />
Deutschland. Ihre Stellwerke kamen in großer Stückzahl bei den deutschen<br />
Staatsbahnen zum Einsatz. Auch heute befinden sich noch einige Anlagen in<br />
Betrieb.<br />
Herausgeber: <strong>DB</strong> Mobility Logistics <strong>AG</strong><br />
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland<br />
Verantwortlich für den Inhalt:<br />
Leiter Kommunikation Oliver Schumacher<br />
Dr. Rainer Mertens<br />
Teamleiter Ausstellung / PR<br />
Tel. +49 (0) 911 219-1233<br />
www.dbmuseum.de<br />
Achim Stauß<br />
Sprecher Konzern<br />
Tel. +49 (0)30 297-61190<br />
Fax +49 (0)30 297-61919<br />
presse@deutschebahn.com<br />
www.deutschebahn.com/ presse<br />
2012 AS/SL 2/4
<strong>Faktenblatt</strong><br />
Elektromechanisches Stellwerk<br />
Baujahr 1901<br />
Hersteller Siemens & Halske<br />
Die Firmen Siemens & Halske und UEG/AEG beschäftigten sich schon um<br />
1890 mit der Entwicklung elektromechanischer Stellwerke. Ziel war es, die<br />
Weichenwärter von der schweren körperlichen Arbeit des Weichenstellens zu<br />
entlasten, indem die Weichen und Signale mit einem motorischen Antrieb<br />
versehen wurden. Der Verschluss der Weichen wurde wie beim mechanischen<br />
Stellwerk durch Fahrstraßen- und Signalschubstangen mechanisch hergestellt.<br />
Das ausgestellte Stellwerk ist noch mit getrennten Fahrstraßen- (grüne Hebel)<br />
und Signalhebeln (rote Hebel) ausgerüstet. Bereits bei der Fortentwicklung im<br />
Jahr 1907 wurden der Fahrstraßen- und der Signalhebel in einem Hebel - dem<br />
Fahrstraßensignalhebel - vereinigt. Die elektromechanischen Stellwerke<br />
standen vorrangig in großen <strong>Bahn</strong>höfen mit regem Zug- und Rangierbetrieb.<br />
Stellwerk Dr S 2<br />
Baujahr um 1960<br />
Die <strong>Deutsche</strong> Bundesbahn beschaffte in den 1950er und 1960er Jahren für<br />
kleine und mittlere <strong>Bahn</strong>höfe die Stellwerksbauart Dr S 2. Dieses<br />
Relaisstellwerk wurde für <strong>Bahn</strong>höfe mit maximal acht Weichen konzipiert. Die<br />
gesamte Relaisausrüstung fand in einem Relaisschrank Platz. Mit dieser<br />
Stellwerksbauart konnten viele der alten und personalintensiven mechanischen<br />
Stellwerksanlagen ersetzt werden.<br />
Schnelllaufender Großdieselmotor (teilweise aufgeschnitten)<br />
Baujahr 1970<br />
Hersteller MTU<br />
Nennleistung 1840 kW = 2500 PS bei 1500 U/min<br />
Höchstdrehzahl 1575 U/min<br />
Hub/Bohrung 230/230 mm<br />
Hubvolumen je Zylinder 9560 cm³<br />
Einspritzverfahren Direkteinspritzung<br />
Einspritzpumpen 2 Bosch-Blockpumpen<br />
Regelung Drehzahlregler System Woodward<br />
Kraftstoffverbrauch bei Volllast 505 l/h Stunde<br />
Diese Großdieselmotoren wurden für die ab 1968 eingesetzten<br />
Streckenlokomotiven der Baureihen 215 und 218 der Bundesbahn beschafft.<br />
Sie verliehen den Lokomotiven eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Der<br />
Dieselmotor arbeitet nach dem Viertaktprinzip und ist mit einem<br />
Abgasturbolader und Wasserkühlung mit Ladeluftkühlung ausgerüstet. Die<br />
zwölf Zylinder sind in V-Form mit unten liegender Nockenwelle angeordnet.<br />
Herausgeber: <strong>DB</strong> Mobility Logistics <strong>AG</strong><br />
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland<br />
Verantwortlich für den Inhalt:<br />
Leiter Kommunikation Oliver Schumacher<br />
Dr. Rainer Mertens<br />
Teamleiter Ausstellung / PR<br />
Tel. +49 (0) 911 219-1233<br />
www.dbmuseum.de<br />
Achim Stauß<br />
Sprecher Konzern<br />
Tel. +49 (0)30 297-61190<br />
Fax +49 (0)30 297-61919<br />
presse@deutschebahn.com<br />
www.deutschebahn.com/ presse<br />
2012 AS/SL 3/4
<strong>Faktenblatt</strong><br />
Dieselmotor (teilweise aufgeschnitten), Typ F 6 L 714<br />
Hersteller Klöckner Humboldt Deutz <strong>AG</strong> Köln<br />
Leistung 128 PS<br />
Drehzahl pro Minute 2150<br />
Zylinderbohrung 120mm<br />
Hub 140mm<br />
Hubraum 9500cm³<br />
Arbeitsverfahren Viertakt<br />
Motoren dieses Typs wurden bei der <strong>Deutsche</strong>n Bundesbahn in den 1950er<br />
und 1960er Jahren in Baumaschinen (z.B. Gleisstopfmaschinen) eingebaut.<br />
Auch in <strong>Bahn</strong>dienst-LKW der Marke Magirus Deutz wurden diese Motoren<br />
verwendet.<br />
Neigungsanzeiger<br />
Baujahr um 1900<br />
Zur Zeit des Dampflokbetriebes war es wichtig zu wissen, wie die<br />
Neigungsverhältnisse auf der befahrenen Strecke sind. Das Lokpersonal konnte<br />
so die Fahrweise und Bedienung der Lokomotive entsprechend den<br />
Streckenverhältnissen anpassen. Neigungsanzeiger, wenn auch in<br />
vereinfachter Form und ohne Angabe des Neigungsverhältnisses, waren<br />
letztmalig in der Signalordnung von 1959 enthalten.<br />
Weichenfarbsignale<br />
Baujahr um 1870<br />
Eisenbahnunternehmen Königlich Bayerische Staatseisenbahn<br />
Um die Stellung der Weichen anzuzeigen, wurden in der Frühzeit des<br />
Eisenbahnwesens so genannte Weichenfarbsignale eingesetzt. Die hier<br />
gezeigten Signale verwendete die Bayerische Staatseisenbahn ab 1870.<br />
Letztmalig wurden sie im Signalbuch von 1907 als künftig nicht mehr<br />
anzuwendende Signale aufgeführt.<br />
Gleissperrsignal<br />
Baujahr 1907<br />
Eisenbahnunternehmen Königlich Bayerische Staatseisenbahn<br />
Zur Kennzeichnung eines Gleisabschlusses (Prellbock), zur Anzeige, ob eine<br />
Gleissperre auf oder abgelegt ist, oder zur Abriegelung eines Nebengleises<br />
wurden Gleissperrsignale verwendet. Das Gleissperrsignal der bayerischen<br />
Staatseisenbahn war noch vereinzelt bis in die 1960er Jahre auf den<br />
<strong>Bahn</strong>anlagen in Bayern zu finden.<br />
Herausgeber: <strong>DB</strong> Mobility Logistics <strong>AG</strong><br />
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland<br />
Verantwortlich für den Inhalt:<br />
Leiter Kommunikation Oliver Schumacher<br />
Dr. Rainer Mertens<br />
Teamleiter Ausstellung / PR<br />
Tel. +49 (0) 911 219-1233<br />
www.dbmuseum.de<br />
Achim Stauß<br />
Sprecher Konzern<br />
Tel. +49 (0)30 297-61190<br />
Fax +49 (0)30 297-61919<br />
presse@deutschebahn.com<br />
www.deutschebahn.com/ presse<br />
2012 AS/SL 4/4