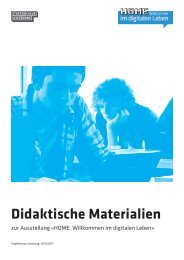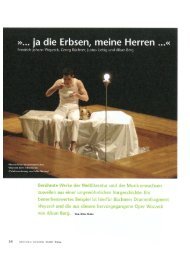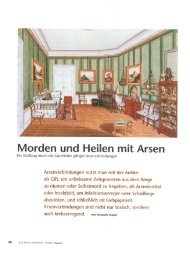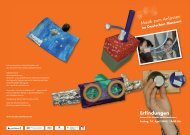Das Verhältnis des Menschen zur Natur - Deutsches Museum
Das Verhältnis des Menschen zur Natur - Deutsches Museum
Das Verhältnis des Menschen zur Natur - Deutsches Museum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> <strong>Verhältnis</strong> <strong>des</strong> <strong>Menschen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Natur</strong><br />
– eine kurze Geschichte <strong>des</strong> Umweltbewußtseins<br />
<strong>Das</strong> <strong>Verhältnis</strong> <strong>des</strong> <strong>Menschen</strong> zu seiner Umwelt unterscheidet sich in verschiedenen Kulturen<br />
und hat sich im Laufe der Geschichte oftmals gewandelt. Es wird durch religiöse oder<br />
ethische Vorstellungen, durch die technische Möglichkeiten der jeweiligen Gesellschaft und<br />
nicht zuletzt durch die Bedürfnisse der <strong>Menschen</strong> geprägt. <strong>Das</strong> umweltpolitische Handeln<br />
hingegen wird ganz entscheidend von akuten Umweltproblemen bestimmt, sei es die<br />
Beseitigung von Gestank in mittelalterlichen Städten, eine drohende Seuchengefahr oder<br />
unser heutiges Bestreben, den Klimawandel zu verlangsamen.<br />
<strong>Natur</strong>vorstellungen bis <strong>zur</strong> Neuzeit<br />
Die Vorstellung von einer Harmonie in der <strong>Natur</strong> ist uralt und findet sich in den<br />
Überlieferungen vieler Völker. Paradebeispiel dafür sind nordamerikanische Indianerstämme,<br />
die daran glauben dass <strong>Menschen</strong>, Tiere und Pflanzen ein Ganzes bilden, das nur dann<br />
weiterlebt, wenn alle seine Teile leben.<br />
Ganz anders waren die Vorstellungen in der Antike: Hier galt der Mensch als das höchste<br />
Wesen in der <strong>Natur</strong>. Es war seine Bestimmung, die <strong>Natur</strong> zu formen, zu zähmen und dadurch<br />
zu „verbessern“. Diese Auffassung zeigte sich z.B. in der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
riesiger Flächen oder im Bau von schnurgeraden Straßen und Aquädukten.<br />
Während die Griechen und Römer Geschichte und <strong>Natur</strong> zyklisch auffassten, entstand im<br />
Judentum und später im Christentum die Vorstellung vom linearen Verlauf natürlicher und<br />
historischer Prozesse. Nach dieser Vorstellung erneuert sich die <strong>Natur</strong> nicht mehr selbst; sie<br />
hat einen Anfang und ein Ende. Der Mensch hat damit die Aufgabe einzugreifen, um sie zu<br />
schützen und zu pflegen.<br />
Im Hochmittelalter riefen Bevölkerungszunahme und Aufschwung <strong>des</strong> Städtewesens massive<br />
Umweltprobleme hervor. Die Lan<strong>des</strong>herren und Stadträte reagierten pragmatisch, indem sie<br />
umweltbelastende Betriebe, wie Gerbereien oder Färbereien außerhalb der Stadtmauern und<br />
flussabwärts ansiedelten sowie Vorformen einer Kanalisation und Müllabfuhr einführten. Die<br />
Umweltbelastungen wurden also aus der Stadt ins Umland verlagert. Die Frage nach den<br />
Ursachen wurde jedoch nicht gestellt.<br />
Aufbruch in die moderne <strong>Natur</strong>wissenschaft<br />
Ab dem 16. Jahrhundert begann man in Europa naturwissenschaftlich zu forschen und lernte<br />
die Gesetze der <strong>Natur</strong> zu verstehen und anzuwenden. <strong>Das</strong> führte zunächst zu der Vorstellung,<br />
dass die Welt wie ein Räderwerk funktioniere, <strong>des</strong>sen Einzelteile optimal aufeinander<br />
abgestimmt seien. Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, kam dann der Gedanke<br />
auf, dass sich die <strong>Natur</strong> selbst reguliere, ohne dass das Eingreifen Gottes erforderlich sei. Eine<br />
Zerstörung der <strong>Natur</strong> war nach beiden Auffassungen nicht möglich.<br />
Erst zu Beginn <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts galt die <strong>Natur</strong> nicht mehr nur als Material menschlichen<br />
Gestaltungswillens, in der Romantik wurde sie vielmehr zu einem Bereich, der aus eigenem<br />
Recht und eigener Würde existierte und sich mehr dem Gefühl als dem Verstand erschloss.<br />
Zugleich zog die Industrielle Revolution eine bis dahin beispiellose Belastung der Umwelt<br />
durch Schadstoffe nach sich. Technische und juristische Schutzmaßnahmen beschränkten sich<br />
allerdings genau wie im Mittelalter immer noch darauf, sichtbare und übelriechende Stoffe<br />
einzudämmen. Es dominierte nach wie vor der Glaube an die schier unbegrenzte<br />
Selbstreinigungskraft der <strong>Natur</strong>.
Die Vorstellungen von einer idealen Umwelt im Wandel der Zeit: Die Burbacher Hüttenwerke 1876 mit<br />
einem Strahlenkranz aus Feuer und Rauch (Zeichnung von G. Arnould, Foto: <strong>Deutsches</strong> <strong>Museum</strong>) und eine<br />
(fast) unberührte alpine Landschaft 2005 (Foto: PixelQuelle.de)<br />
Umweltschutz heute<br />
Nicht zuletzt wegen massiver Umweltzerstörungen veränderte sich der Blick auf die <strong>Natur</strong> im<br />
letzten Drittel <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts noch einmal grundlegend: Die <strong>Natur</strong> wurde <strong>zur</strong> Umwelt,<br />
die nicht mehr länger als vom <strong>Menschen</strong> getrennt gesehen wurde, sondern die Grundlage<br />
seines Lebens bildet.<br />
Die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit dem Thema "Umwelt" führte <strong>zur</strong><br />
Gründung von internationalen Umweltorganisationen und „grünen“ Parteien. Veränderungen<br />
in der Umwelt werden heute wissenschaftlich erforscht, die Industrie setzt sich mit dem<br />
Umweltschutz auseinander und die Wirtschaft beginnt, die Erhaltung und Wiederherstellung<br />
der Umwelt als neuen Markt zu entdecken.<br />
Gleichzeitig sind die Eingriffe der stetig wachsenden Weltbevölkerung in die Umwelt so groß<br />
wie nie und die Auswirkungen <strong>des</strong> „Ozonloches“ oder der globalen Erwärmung lassen sich<br />
nicht mehr durch regionale Maßnahmen beseitigen: Genau wie die Umweltprobleme ist auch<br />
die Umweltpolitik zu einer internationalen Angelegenheit geworden, die das gemeinsame<br />
Bemühens aller herausfordert.