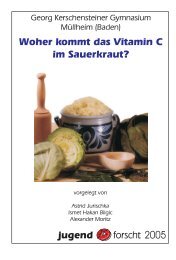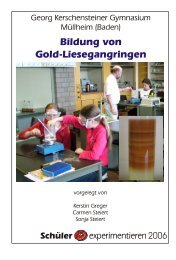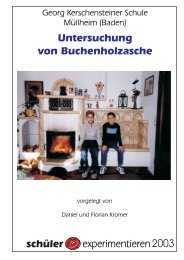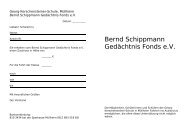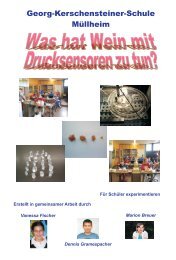Über die Entstehung des Auggener Bohnerzjaspis - Georg ...
Über die Entstehung des Auggener Bohnerzjaspis - Georg ...
Über die Entstehung des Auggener Bohnerzjaspis - Georg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Georg</strong>-Kerschensteiner Schule<br />
Technisches Gymnasium Müllheim<br />
<strong>Über</strong> <strong>die</strong> <strong>Entstehung</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Auggener</strong> <strong>Bohnerzjaspis</strong><br />
vorgelegt von<br />
Ekaterina Ditz (18)<br />
Dennis Gramespacher (18)<br />
Marco Schmidlin (13)<br />
jugend forscht<br />
d<br />
ju n<br />
t<br />
h<br />
an der <strong>Georg</strong>-Kerschensteiner Schule<br />
Technisches Gymnasium Müllheim<br />
ge<br />
c<br />
s<br />
r<br />
o<br />
f<br />
1978-2009
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis.........................................................................................................1<br />
Abbildungsverzeichnis.................................................................................................2<br />
Einleitung.......................................................................................................................3<br />
1 Zur Geologie <strong>des</strong> Oberrheingrabens ...............................................................4<br />
2 Arbeiten zur Klärung der <strong>Entstehung</strong>sgeschichte <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong><br />
<strong>Bohnerzjaspis</strong> ....................................................................................................5<br />
2.1 Kieselgel als Modell für einen Jaspis in seiner frühen Entwicklungsphase .........6<br />
2.2 <strong>Entstehung</strong> der Färbung <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> Jaspis....................................................6<br />
2.2.1 Einbau von Eisenionen in ein Kieselgel ...............................................................7<br />
2.2.2 Eindiffusion von Eisenionen in ein Kieselgel........................................................8<br />
2.3 <strong>Entstehung</strong> der Bänderung <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> Jaspis .............................................10<br />
3 Wasserabgabe bei unseren Kieselgelen .......................................................13<br />
4 Danksagung .....................................................................................................14
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Ein Jaspis aus Auggen mit beeindruckender Bänderung. .......................5<br />
Abbildung 2: Kieselgel in das Eisen(III)-sulfat (3 g) bei der Herstellung eingelagert<br />
wurde, und anschließend mit Ammoniaklösung überschichtet wurde (von<br />
links NH3/H2O: 10/10, 5/15, 20/0, Kontrolle nach 3 Monaten). ............................7<br />
Abbildung 3: Kieselgel mit eindiffun<strong>die</strong>rten Eisen(III)-Ionen (1.25 g Eisen(III)sulfat);<br />
links: nach 2 Wochen Diffusion, mitte: Stunden nach der<br />
<strong>Über</strong>schichtung mit Ammoniak, rechts: nach 3 Monaten. ..................................8<br />
Abbildung 4: Ausfällung von Eisenhydroxid im Gel ohne Basenzusatz, bei der<br />
Verwendung von Eisen(III)-chlorid. .....................................................................9<br />
Abbildung 5: Ein <strong>Auggener</strong> Jaspis mit besonders ausgeprägter Bänderung..............10<br />
Abbildung 6: Liesegangringe in einem Kieselgel (Eisen(III)-sulfat mit Ammoniak<br />
überschichtet), ganz rechts: sich durchdringende Liesegangringe durch<br />
Rissbildung hervorgerufene Bidirektionale Eindiffusion von Ammoniak............11<br />
Abbildung 7: Liesegangringe mit engem Abstand, Entstanden bei der<br />
Verwendung von Eisen(III)-chlorid im Gel und Kalziumhydroxid in der<br />
<strong>Über</strong>schichtung..................................................................................................12<br />
Abbildung 8: <strong>Entstehung</strong> von formschönen Gipseinkristallen, bei der Verwendung<br />
von Eisen(III)-sulfat im Gel und Kalziumhydroxid in der <strong>Über</strong>schichtung..........12<br />
Abbildungsnachweis<br />
Abbildung 1 und 5 stammen von Herrn Fritz Schmidlin, <strong>die</strong> restlichen Abbildungen<br />
wurden von uns selbst angefertigt.<br />
2
Einleitung<br />
Die Anregung uns mit dem Thema <strong>Bohnerzjaspis</strong> zu beschäftigen geht auf<br />
Herrn Fritz Schmidlin, dem Opa unseres Gruppenmitglieds Marco Schmidlin<br />
zurück. Fritz Schmidlin beschäftigt sich seit frühester Kindheit mit dem<br />
<strong>Auggener</strong> Jaspis in allen seinen Facetten.<br />
Im <strong>Auggener</strong> Ortsteil Hach betreibt Herr Fritz Schmidlin eine Mineraliengalerie.<br />
Man kann dort auch eine beeindruckend große Sammlung fluoreszierender<br />
Mineralien besichtigen. In einer angegliederten Werkstatt bearbeitet er<br />
außerdem eine Vielzahl unterschiedlicher Gesteine u.a zu Schmuck von hoher<br />
Qualität.<br />
In jüngster Zeit brachte er zwei Bücher heraus, <strong>die</strong> dem Thema <strong>Bohnerzjaspis</strong><br />
gewidmet sind. Er geht darin auch auf denkbare <strong>Entstehung</strong>sbedingungen <strong>des</strong><br />
<strong>Auggener</strong> Jaspis ein.<br />
Man kann verschiedene Hypothesen über <strong>die</strong> Bildungsbedingungen <strong>die</strong>ses<br />
Minerals formulieren. Unser Ziel war es, mit Hilfe von Experimenten<br />
möglicherweise eine Reihe von Besonderheiten im Aufbau <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong><br />
<strong>Bohnerzjaspis</strong> erklären zu können, <strong>die</strong> Rückschlüsse auf <strong>die</strong> damaligen<br />
<strong>Entstehung</strong>sbedingungen ermöglichen sollten.<br />
3
1 Zur Geologie <strong>des</strong> Oberrheingrabens<br />
,,Vor ca. 80 Mill. Jahren begann der Einbruch <strong>des</strong> Rheingrabens und ist bis<br />
heute noch nicht abgeschlossen. Mit Beginn <strong>des</strong> Binnenmeeres wurden Teile<br />
<strong>des</strong> weißen Juras aufgelöst, also auch <strong>die</strong> darin vorhandenen weißen<br />
Jaspisknollen.“ 1 Beim Abbau <strong>des</strong> Kalksteins im Isteiner Steinbruch findet man<br />
somit regelmäßig weiße Jaspisknollen. Auf der Gemarkung Auggen gibt es<br />
Bohnerzvorkommen (also Eisenerz), <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Farbe <strong>des</strong> dort vorkommenden<br />
Jaspis verantwortlich sind. Man spricht <strong>des</strong>halb auch vom <strong>Bohnerzjaspis</strong>. Die<br />
Färbung schwankt zwischen braun (Eisenhydroxid) und rot (Eisenoxid).<br />
Die im Rheingraben befindlichen Thermalquellen (Bad Bellingen, Bad<br />
Krozingen, Badenweiler) sowie Erdverschiebungen im Bereich der Altstadt<br />
Staufen zeigen, <strong>die</strong> auch heute noch vorhandenen geologischen Aktivitäten an<br />
(im letzten Fall sogar vom Mensch initiiert).<br />
1<br />
Fritz Schmidlin, „<strong>Bohnerzjaspis</strong>, <strong>Entstehung</strong> – Faszination“, J.H.Röll Verlag, Dettelbach, 2004,<br />
Bd. 1, 8.<br />
4
2 Arbeiten zur Klärung der <strong>Entstehung</strong>sgeschichte<br />
<strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> <strong>Bohnerzjaspis</strong><br />
Jaspis ist eine Varietät <strong>des</strong> mikrokristallinen Silikats Chalcedon, und ist durch<br />
hohe Beimengungen von Verunreinigungen oft intensiv gefärbt. Die<br />
Beimengung von Goethit [Eisenoxyhydrat, FeO(OH)] verursacht eine gelbbraune<br />
Färbung. Hämatit (Eisenoxid, Fe2O3) als Beimengung verursacht<br />
dagegen eine rote Färbung <strong>des</strong> Jaspis. 2 Grüner Jaspis mit Beimengungen von<br />
Chlorit (ein Alumosilikat) werden in Auggen nicht gefunden 3 .<br />
Abbildung 1: Ein Jaspis aus Auggen mit beeindruckender Bänderung.<br />
2 J. Falbe, M. Regitz (Hrsg.), Römpp Chemielexikon, Thime Verlag Stuttgart, 9. Aufl., 1989.<br />
3 Persönliche Mitteilung von Fritz Schmidlin, Hach/Auggen.<br />
5
Wir hatten <strong>die</strong> Absicht <strong>die</strong> <strong>Entstehung</strong>sgeschichte <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> Jaspis zu<br />
erhellen. Wir widmeten uns in unserer Arbeit folgenden Fragen:<br />
- Wie kommt es zur ausgeprägten Braun- und Rotfärbung <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong><br />
Jaspis?<br />
- Wie entstehen <strong>die</strong> dunkel-hellen-Bänderungen im Jaspis?<br />
Um Experimente zu <strong>die</strong>ser Thematik durchführen zu können, benötigten wir ein<br />
Modellsystem, das das Verhalten von Jaspis in seinem frühen<br />
Entwicklungsstadium zeigen sollte.<br />
2.1 Kieselgel als Modell für einen Jaspis in seiner frühen<br />
Entwicklungsphase<br />
Von Kieselgel ist bekannt, dass es <strong>die</strong> Diffusionsgeschwindigkeiten von<br />
gelösten Salzen extrem herabsetzt, so dass auch das Kristallwachstum schwer<br />
löslicher Kristalle langsam und in guter Qualität durch eine doppelte Umsetzung<br />
gelingt. 4,5 Die Diffusion ist aber noch nicht so sehr eingeschränkt wie z.B. in<br />
kristallinen oder amorphen Festkörpern wie Steinsalz oder Glas, in denen <strong>die</strong><br />
Diffusion praktisch gänzlich zum Erliegen kommt, und Diffusionsprozesse nur<br />
über sehr lange Zeiträume beobachtbar sind.<br />
Wir wollten Kieselgele einsetzen um sie als Modell für einen Jaspis in einem<br />
frühen Entwicklungsstadium zu benutzen, der höhere<br />
Diffusionsgeschwindigkeiten für Salze erlauben sollte als ein völlig gealterter<br />
Jaspis, <strong>die</strong> aber deutlich kleiner sein sollten als in wässrigen Lösungen. All<br />
<strong>die</strong>se Kriterien werden von Kieselgel erfüllt. Ein weiterer Vorteil <strong>die</strong>ser Gele ist<br />
ihre einfache Herstellung aus Natronwasserglas (Na0-4SiO2-4) und Säure.<br />
2.2 <strong>Entstehung</strong> der Färbung <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> Jaspis<br />
Wie oben bereits erwähnt, entsteht Färbungen von Jaspis durch Beimengungen<br />
von Eisenoxid (Fe2O3, rot) und dehydratisiertem Eisenhydroxid [FeO(OH),<br />
braun]. Eine Fragestellung unserer Arbeit war: Wie kommen <strong>die</strong><br />
entsprechenden eisenhaltigen Verunreinigungen in den Jaspis?<br />
Es sind zwei Wege möglich:<br />
4 H. K. Henisch, „Crystal Growth in Gels“, Dover Publications, 2 nd Ed. 1996.<br />
5 S. Müller, O. Schäfer, „Synthese von Opalen, Abschließende Projektberichte“, <strong>Georg</strong>-<br />
Kerschensteiner Schule, Müllheim, 2007, 502-522.<br />
6
- lösliche Eisenverbindungen sind bei der Jaspisentstehung zugegen und<br />
werden in den „jungen“ Jaspis eingelagert.<br />
- oder nach der <strong>Entstehung</strong> <strong>des</strong> Jaspis, diffun<strong>die</strong>ren gelöste Eisenverbindungen<br />
in Jaspis und gehen mit der Zeit in <strong>die</strong> farbgebenden Verbindungen<br />
Eisenhydroxid oder Eisenoxid über.<br />
Wir untersuchten beide Möglichkeiten an einem Modellkieselgel.<br />
2.2.1 Einbau von Eisenionen in ein Kieselgel<br />
Ein Kieselgel in einem Reagenzglas wurde unter Anwesenheit von Eisen(III)sulfat<br />
mit unterschiedlichen Konzentrationen hergestellt und mit verschieden<br />
starken Ammoniaklösungen überschichtet (Abb. 2). 6<br />
Abbildung 2: Kieselgel in das Eisen(III)-sulfat (3 g) bei der Herstellung eingelagert wurde, und<br />
anschließend mit Ammoniaklösung überschichtet wurde (von links NH3/H2O: 10/10, 5/15, 20/0,<br />
Kontrolle nach 3 Monaten).<br />
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass keine Braunfärbung durch<br />
Eisenhydroxid zu beobachten war, im Gegenteil es war sogar eine Aufhellung<br />
der vormals gelben Gele feststellbar (je mehr Ammoniak, <strong>des</strong>to heller). Der<br />
Befund, dass freie Eisenionen nicht mit Kaliumthiocyanat [bildet mit Eisen(III)-<br />
Ionen das tiefrote Fe(SCN)3] nachweisbar waren, legt den Schluss nahe, dass<br />
6 Herstellungsvorschrift: Eine salzsaure wässr. Lösung (14 ml 32%ige Salzsäure in 200 ml<br />
Wasser) von Ameisensäure [1 ml, 85% (v/v)] und Eisen(III)-sulfat (Riedel-DeHaën,<br />
entwässert, Eisengehalt: 21-23%; 1.0 g, 3.0 g bzw. 5.0 g) wurde unter unter pH-Kontrolle<br />
langsam bei Raumtemp. mit einer Lösung von Natronwasserglas (Merck, 60 ml) in 150 ml<br />
Wasser versetzt, bis ein pH-Wert von 4.5 erreicht war. Nach <strong>Über</strong>führung der Lösung in fünf<br />
100 ml Reagenzgläser wurde 24 h lang bei Raumtemp. gelieren gelassen. Nach dem<br />
Gelieren wurden <strong>die</strong> vier der jeweils fünf Reagenzgläser mit unterschiedlich starken<br />
7
das Eisen chemisch nicht mehr nachweisbar in <strong>die</strong> Gelstruktur eingebaut<br />
wurde, und so kein Eisenhydroxid mehr gebildet werden kann.<br />
2.2.2 Eindiffusion von Eisenionen in ein Kieselgel<br />
Als nächstes untersuchten wir das Verhalten von unterschiedlich konzentrierten<br />
Eisen(III)-sulfatlösungen<br />
Modellkieselgel.<br />
bezüglich ihres Diffusionsverhaltens in unser<br />
7<br />
Abbildung 3: Kieselgel mit eindiffun<strong>die</strong>rten Eisen(III)-Ionen (1.25 g Eisen(III)-sulfat); links: nach<br />
2 Wochen Diffusion, mitte: Stunden nach der <strong>Über</strong>schichtung mit Ammoniak, rechts: nach 3<br />
Monaten.<br />
Ammoniak-Lösungen überschichtet {5/10/15 bzw. 20 ml Ammoniaklösung [25% (m/m)] und<br />
15/10/5 bzw. 0 ml Wasser}.<br />
7 Herstellungsvorschrift: Eine wässr. Lösung von HCl (14 ml 32%ige Salzsäure in 200 ml<br />
Wasser) und Ameisensäure [1 ml, 85% (v/v)] wurde unter unter pH-Kontrolle langsam bei<br />
Raumtemp. mit einer Lösung von Natronwasserglas (Merck, 60 ml) in 150 ml Wasser<br />
versetzt, bis ein pH-Wert von 4.5 erreicht war. Nach <strong>Über</strong>führung der Lösung in fünf 100 ml<br />
Reagenzgläser wurde 24 h lang bei Raumtemp. gelieren gelassen. Nach dem Gelieren<br />
wurden <strong>die</strong> Gele mit einer Eisen(III)-sulfat-Lösung (Riedel-DeHaën, entwässert, Eisengehalt:<br />
21-23%: 0.25 g, 0.75 g und 1.25 g) in je 5 ml Wasser und 0.12 ml konz. H2SO4<br />
überschichtet. Nach zwei Wochen wurde mit Ammoniaklösung [25% (m/m)] überschichtet.<br />
8
Diese Experimente zeigen zum einen, dass im stark Sauren (Zusatz von<br />
Schwefelsäure) Eisen(III)-Ionen in das Kieselgel eindiffun<strong>die</strong>ren, und bei<br />
Basenzugabe Eisenhydroxid im Gel ausgefällt wird. Die dabei gemachte<br />
Beobachtung, dass Eisen(III)-Ionen förmlich aus dem Gel herausgezogen<br />
werden (Aufhellung <strong>des</strong> Gels im unteren Bereich) ist an <strong>die</strong>ser Stelle<br />
erwähnenswert.<br />
Abbildung 4: Ausfällung von Eisenhydroxid im Gel ohne Basenzusatz, bei der Verwendung<br />
von Eisen(III)-chlorid.<br />
Bei der Verwendung von Eisen(III)-chlorid 8 wird schon ohne Basenzusatz im<br />
unteren Bereich der Reagenzgläser braunes Eisenhydroxid ausgefällt, was<br />
wohl auf <strong>die</strong> geringeren Protonenkonzentration durch <strong>die</strong> Salzsäure<br />
zurückgeführt werden kann (Abb. 4).<br />
Festzuhalten ist, dass Eisen(III)-Ionen nur in erheblich saurem Milieu in<br />
Kieselgele eindiffun<strong>die</strong>ren können, da es sonst zur Ausfällung von<br />
Eisenhydroxid kommt.<br />
Von der Geologie <strong>des</strong> Rheingrabens her, spricht nichts gegen <strong>die</strong> Möglichkeit,<br />
dass Eisen(III)-Ionen durch Säuren (z. B. Schweflige Säure aus SO2) aus<br />
8 Vorschrift wie bei 7 mit folgenden Änderungen: Verwendung von Eisen(III)-chlorid (wasserfrei)<br />
(1.75 g) in Wasser (5 ml) und Salzsäure [32% (m/m), 0.12 ml] als erste<br />
<strong>Über</strong>schichtungslösung. Ohne <strong>Über</strong>schichtung von Ammoniak.<br />
9
oxidischen Eisenerzen freigesetzt wurden. In Schwefliger Säure löst sich<br />
Bohnerz aus Auggen merklich. 9<br />
2.3 <strong>Entstehung</strong> der Bänderung <strong>des</strong> <strong>Auggener</strong> Jaspis<br />
Die <strong>Entstehung</strong> der Hell-Dunkel-Bänderung im <strong>Auggener</strong> Jaspis zu erhellen<br />
hatten wir uns zur Aufgabe gestellt. Zur Zeit kursieren zwei Theorien darüber,<br />
wie <strong>die</strong>se Bänderungen entstanden sein könnten:<br />
- Aufwachsen verschiedener Schichten mit unterschiedlicher<br />
Zusammensetzung (Farbe)<br />
- Bänderung durch Liesegangringbildung im noch „jungen“ Jaspis<br />
Abbildung 5: Ein <strong>Auggener</strong> Jaspis mit besonders ausgeprägter Bänderung.<br />
9 Aus einer mit SO2-gesättigten wässr. Lösung, in dem zwei Wochen lang gepulvertes Bohnerz<br />
lag, konnten Eisen(III)-Ionen sowohl als Berliner Blau als auch Eisenthiocyanat<br />
nachgewiesen werden.<br />
10
Wir untersuchten hauptsächlich <strong>die</strong> Möglichkeit, ob sich in einem Eisen(III)haltigem<br />
Kieselgel Liesegangringe bilden können. 10<br />
Wir stellten wie oben beschrieben ein Modellkieselgel her, das mit Eisen(III)-<br />
Ionen (aus dem enstsprechenden Sulfat oder Chlorid) beladen wurde. Nach<br />
dem Eindiffun<strong>die</strong>ren wurde das Gel basisch überschichtet.<br />
Abbildung 6: Liesegangringe in einem Kieselgel (Eisen(III)-sulfat mit Ammoniak überschichtet),<br />
ganz rechts: sich durchdringende Liesegangringe durch Rissbildung hervorgerufene<br />
Bidirektionale Eindiffusion von Ammoniak.<br />
Bei Verwendung von Eisen(III)-sulfat und Ammoniak entstanden gut<br />
ausgebildete Liesegangringe im Kieselgel (Abb. 6). Liesegangringe entstanden<br />
ebenfalls bei der Konstellation Eisen-(III)-chlorid/Kalziumhydroxid nur sind in<br />
<strong>die</strong>sem Fall <strong>die</strong> Ringe viel enger beieinander und entstehen an der<br />
Geloberfläche (Abb. 7).<br />
Im Fall der Konstellation Eisen(III)-sulfat/Kalziumhydroxid bilden sich nach<br />
mehreren Wochen sehr gut ausgebildete Gipseinkristalle im Kieselgel (Abb. 8).<br />
10 Herstellungsvorschrift: Eine wässr. Lösung von HCl (14 ml 32%ige Salzsäure in 200 ml<br />
Wasser) und Ameisensäure [1 ml, 85% (v/v)] wurde unter unter pH-Kontrolle langsam bei<br />
Raumtemp. mit einer Lösung von Natronwasserglas (Merck, 60 ml) in 150 ml Wasser<br />
versetzt, bis ein pH-Wert von 4.5 erreicht war. Nach <strong>Über</strong>führung der Lösung in fünf 100 ml<br />
Reagenzgläser wurde 24 h lang bei Raumtemp. gelieren gelassen. Nach dem Gelieren<br />
wurde je<strong>des</strong> Reagenzglas mit einer Lösung von Eisen(III)-sulfat (Riedel-DeHaën,<br />
entwässert, Eisengehalt: 21-23%; 2.0 g) und konz. H2SO4 (0.12 ml) in Wasser (5 ml)<br />
überschichtet. Nach zwei Wochen wurde mit Ammoniaklösung [12.5% (m/m)] überschichtet.<br />
11
Abbildung 7: Liesegangringe mit engem Abstand, Entstanden bei der Verwendung von<br />
Eisen(III)-chlorid im Gel und Kalziumhydroxid in der <strong>Über</strong>schichtung. 11<br />
Abbildung 8: <strong>Entstehung</strong> von formschönen Gipseinkristallen, bei der Verwendung von<br />
Eisen(III)-sulfat im Gel und Kalziumhydroxid in der <strong>Über</strong>schichtung. 12<br />
11 10<br />
Versuchvorschrift wie bei mit folgenden Unterschieden: Eisenhaltige<br />
<strong>Über</strong>schichtungslösung: Eisen(III)-chlorid (wasserfrei, 2.5 g), Salzsäure [32% (m/m), 0.12 ml]<br />
in Wasser (5 ml); Basische <strong>Über</strong>schichtungslösung: Calciumhydroxidaufschlämmung.<br />
12 10<br />
Versuchvorschrift wie bei mit folgenden Unterschied: Basische <strong>Über</strong>schichtungslösung:<br />
Calciumhydroxidaufschlämmung.<br />
12
3 Wasserabgabe bei unseren Kieselgelen<br />
Da der <strong>Auggener</strong> Jaspis im wesentlichem aus wasserfreiem Silikat besteht,<br />
muß ein „Jungjaspis“ nach der Aufnahme der farbgebenden Verunreinigungen<br />
einen erheblichen Wasserverlust durchlaufen haben.<br />
Wir wollten auch <strong>die</strong>se Wasserabgabe bei unserem Modellkieselgel<br />
nachvollziehen. Dazu wurde bei einem Kieselgel der Salzgehalt (entstanden<br />
durch <strong>die</strong> Herstellung aus Wasserglas und Säure) durch Waschen mit demin.<br />
Wasser parktisch vollständig entfernt.<br />
Bei Trocknung an der Luft zeigte sich, dass <strong>die</strong> Wasserabgabe sehr langsam<br />
(über Monate) erfolgen muss, da es sonst zur fortgesetzter Rissbildung kommt,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> Form zerstört. Das Volumen <strong>des</strong> Gels kontrahiert im Laufe der Zeit<br />
zunehmend und wird dabei immer härter.<br />
Man kann den Trocknungsvorgang erheblich beschleunigen (auf ein fünftel der<br />
Zeit), wenn man im Autoklav bei 25 bar über Kalziumchlorid (wasserfrei)<br />
trocknet.<br />
Die braunen Eisenhydroxide im <strong>Auggener</strong> Jaspis gehen beim Glühen unter<br />
Wasserabgabe in rotes Eisenoxid über. 13 Das gleiche Resultat erhielten wir<br />
beim Glühen eines Fragments unserer eisenhydroxidhaltigen getrockneten<br />
Kieselgele.<br />
13<br />
Fritz Schmidlin, „<strong>Bohnerzjaspis</strong>, <strong>Entstehung</strong> – Faszination“, J.H.Röll Verlag, Dettelbach, 2004,<br />
Bd. 1, 63.<br />
13
4 Danksagung<br />
Wir danken der Schulleitung der <strong>Georg</strong>-Kerschensteiner Schule in Müllheim<br />
Frau Beate Wagner und Herrn Reinhold Berger für ihre rege Anteilnahme am<br />
Fortschritt unserer Forschungen. Ein besonderer Dank gilt unserem<br />
betreuenden Lehrer Herrn Otto Schäfer für seine fachliche und motivierende<br />
Betreuung. Ebenfalls danken wir Herrn Dr. rer. nat. Dipl. chem. Stefan Müller für<br />
<strong>die</strong> fachliche und textliche Hilfestellung.<br />
Herrn Fritz Schmidlin danken wir für <strong>die</strong> Bereitstellung von Bildern und<br />
Ausstellungsstücken.<br />
14