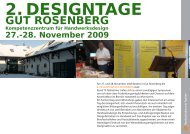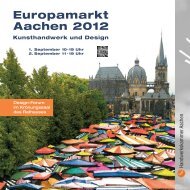Dokumentation 4. Designtage Gut Rosenberg
Dokumentation 4. Designtage Gut Rosenberg
Dokumentation 4. Designtage Gut Rosenberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
HANDWERK TRIFFT DESIGN<br />
<strong>4.</strong> DESIGNTAGE<br />
GUT ROSENBERG<br />
Kompetenzzentrum für Handwerksdesign<br />
1<strong>4.</strong>-15. Oktober 2011<br />
1
HANDWERK TRIFFT DESIGN<br />
Für Lehrer und Ausbilder in Schulen, Kammern und Betrieben waren die <strong>4.</strong> <strong>Designtage</strong> eine Möglichkeit, unsere Arbeit<br />
kennen zu lernen und in die Welt des Handwerkdesigns einzutauchen, mit uns zu diskutieren und zu experimentieren.<br />
Für die Interessierten bot sich drei Tage die Möglichkeit, Entwürfe zu einem „Canoe“ zu entwickeln und<br />
gemeinsam in der Gruppe ein solches zu bauen. Alle weiteren Teilnehmer waren eingeladen, in dem zweitägigen<br />
Symposium an Vorträgen und Workshops teilzunehmen. Samstags hatten wir die Gelegenheit, zwei Betriebe von<br />
Akademieabsolventen kennen zu lernen. Die gewählten Beispiele eines Meisterbetriebs mit Gestaltungsschwerpunkt<br />
und eines Planungsbüros mit Spezialisierung im handwerklichen Bereich sind charakteristisch für die Berufsbilder der<br />
Akademieabsolventen.<br />
Wir bedanken uns für die Teilnahme und Ihr reges Interesse!<br />
Wolfgang Kohl<br />
Leiter der Akademie für Handwerksdesign<br />
1
Begrüßung Ass. Ralf W. Barkey,<br />
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen<br />
2
Vortrag von Professor James Skone<br />
Universität für Angewandte Kunst in Wien<br />
„Die Angewandte“<br />
hier klicken um den<br />
Vortrag zu lesen...<br />
„Kunstschaffende haben in inspirierten<br />
Momenten das Gefühl, um jeden Preis Kunst<br />
machen zu müssen; auch wenn das ihre<br />
ökonomische oder bürgerliche Existenz, ihr<br />
Familienleben oder auch ihre Gesundheit<br />
ruinieren mag“<br />
Wofür es sich zu leben lohnt, Robert Pfaller 2011<br />
3
Die Entwicklung der Designbildung<br />
Fachtagung für Dozenten, 13. Oktober 2011<br />
mit Professor James Skone<br />
Universität für Angewandte Kunst in Wien<br />
4
Entwicklung und Bau eines „Canoes“<br />
Dietmar Mechsner, Meisterdesigner, Tischlerei Mechsner, Bernau<br />
Michael Dumke, Bootsbauer, Student Akademie für Handwerksdesign, Tischlerwerkstatt<br />
Unter der Leitung von Dietmar Mechsner und Michael Dumke wurden nach Einweisung der<br />
Teilnehmer in die Theorie des Canoebaus Modelle entwickelt, die anschließend gebaut wurden.<br />
6
Entwerfen für Auszubildende<br />
Dipl. Des. Elmar Heimbach, Akademie für Handwerksdesign<br />
9
Entwurf und Umsetzung von Fotogrammen - Praxisseminar<br />
Dr. Hans Präffcke, Akademie für Handwerksdesign<br />
10
Zeichnen im Entwurfsalltag - Praxisseminar<br />
Professor Edward Zoworka, Akademie für Handwerksdesign<br />
11
Schmiede Münks - Meerbusch<br />
www.schmiede-muenks.de<br />
Raum.4 - Köln<br />
www.raumpunkt<strong>4.</strong>de<br />
12
Vortrag von Professor James Skone<br />
Universität für Angewandte Kunst in Wien<br />
1
Design vermitteln<br />
Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wurde auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die<br />
ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.<br />
Kunstschaffende haben in inspirierten Momenten<br />
das Gefühl, um jeden Preis Kunst machen zu müssen;<br />
auch wenn das ihre ökonomische oder bürgerliche<br />
Existenz, ihr Familienleben oder auch ihre Gesundheit<br />
ruinieren mag. 1<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
2
Wenn wir uns mit Thema Designvermittlung beschäftigen, ins besonders welche Aufgabe dabei Lehrende übernehmen,<br />
stellt sich zwangsläufig vorerst die Frage, was uns Design überhaupt bringen soll.<br />
Ich möchte mich mit dem eingangs dargestellten Zitat vom Philosophen Robert Pfaller ganz bewusst von dem reinen<br />
Nutzengedanken befreien, der derzeit allgegenwärtig zu sein scheint. Wenn wir nur nutzenorientiert handeln, werden wir<br />
nur Mittelmaß produzieren.<br />
Designer sein ist daher kein Beruf, sondern eine Berufung<br />
Ich möchte mit Pfaller fortsetzen.<br />
„Wenn man beobachtet, unter welchen Umständen Menschen, die kein Künstler sind, jemals beginnen, Kunstwerke<br />
anzufertigen, dann sticht eine Bedingung schnell hervor: nämlich die der Liebe – in allen Abstufungen und Bedeutungen<br />
des<br />
Wortes. Verliebte produzieren zum Beispiel Collagen als Liebesbeweise für Geliebte; Erwachsene erfinden Lieder als<br />
Geburtstagsdarbietungen für ihre Freunde; Kinder fertigen Zeichnungen an als Weihnachtsgeschenke für Eltern und<br />
Großeltern“. 2<br />
Vielleicht kann man den Begriff „Liebe“ in diesem Kontext den Pathos entziehen indem man den Begriff durch „Empathie“<br />
ersetzt, also durch die Bereitschaft auf jemanden zuzugehen und für seine Bedürfnis etwas zu schaffen, das ihm Freude<br />
bereitet. Dann ist anwenderorientiertes Design auch eine Form von Geben, oder durch das Produkt „eine Beziehung“ zu<br />
jemanden herstellen.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
3
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
4
Als Beispiel möchte ich Ihnen Yvon Chouinard vorstellen, den Gründer von Patagonia bzw. seines vorhergehenden<br />
Unternehmens, The Great Pacific Iron Works, einen Unternehmer, dessen gesamte Haltung beachtenswert ist und daher<br />
ein geeignetes Modell für beispielhaftes schöpferisches Denken und Handeln. Für Chouinard dient Design der von ihm<br />
hergestellten Ausrüstung als Ausdrucksmittel seiner ganz-heitlichen Lebensphilosophie.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
5
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
6
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
7
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
8
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
9
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
10
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
11
Chouinard war einer der bedeutendsten Kletterer und Bergsteiger der 50er und 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts in<br />
Amerika und hat mit seinen Ideen großen Einfluss auf den internationalen Alpinismus.<br />
Er dachte ursprünglich nie daran Unternehmer im wirtschaftlichen Sinne zu werden und sah sich nicht als Designer,<br />
sondern wollte nur neue Kletterrouten in einem Stil erschließen, den er „Clean Climbing“ nannte, Klettern ohne Spuren<br />
zu hinterlassen. Dazu brauchte er entsprechende Kletterausrüstung, die er selbst herstellte. Er brachte sich daher mit<br />
17Jahren das Schmieden autodidaktisch bei und daraus entstand dann eine kleine Hardware Firma mit dem ambitionierten<br />
Namen The Great Pacfic Iron Works nahe Los Angeles. Er war Kletterpionier, Handwerker, Designer, Schriftsteller<br />
und wurde daraus (fast zwangsläufig) zum Unternehmer. In Folge gründete er Patagonia und wurde zu einem der<br />
erfolgreichsten Outdoor Bekleidungsunternehmer der USA in den 90er Jahren. Er engagierte sich für den Umweltschutz<br />
seit an Beginn. 1984 stellte Patagonia die ersten Fleece Jacken aus PET Flasche her. 30% des Jahreseinkommens wird für<br />
Umweltaktivitäten eingesetzt.<br />
Alles was Chouinard erschließt, erfindet, herstellt und kommuniziert hat einen hohen praktischen, ästhetischen und<br />
ökologischen Anspruch. Seine tiefe Beziehung zur Umwelt und seiner Tätigkeit wird durch Design ausgedrückt, sei es<br />
durch die Linienführung einer Kletterroute, deren Begehungsstil, die Formgebung der Produkte bis hin zum Design der<br />
Kommunikationsmittel. 3<br />
Was können wir von ihm lernen?<br />
Bei Chouinard sind zwei wesentliche Faktoren Erfolgs bestimmend:<br />
Seine „Liebe zu seinem Tun“, also hohe Motivation<br />
und<br />
Sein durch Erfahrung erworbenes „implizites Wissen“<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
12
Wenn wir davon ausgehen, Schöpferisches Denken und Handeln sei „geben“ wollen, dann muss es eine Aufgabe der<br />
Lehrenden sein dieses Gefühl erlebbar zu machen. Die Erfahrung zu vermitteln, dass etwas Neues zu entdecken, zu<br />
erfinden, zu gestalten große Befriedigung geben kann. Deshalb sind wir als Designlehrende vor allem als Motivatoren<br />
gefragt.<br />
Bei den altgriechischen Symposien, die eigentlich Trinkgelage rund um philosophische Diskussionen waren, gab es den<br />
Symposiarchen, dessen Aufgabe es war die Stimmung aufrecht zu halten, zuzusehen, dass jeder den gleichen Grad an<br />
Trunkenheit hatte und freie Rede und spontanes Handeln zu fördern. 4 Das ist zwar ein koketter Vergleich, aber vielleicht<br />
hat die Aufgabe von Designlehrenden gewisse Ähnlichkeiten.<br />
Wissen über Ideenfindung, Gestaltungsentscheidungen oder gestalterisches Handeln ist zu einem großen Teil „tacit<br />
knowledge“, also implizites Wissen, „learning by doing“ „Können ohne sagen zu können, wie“ (im Gegensatz zu explizitem<br />
Wissen, also Wissen, dass kommunizierbar ist, verbalisierbar, objektivierbar, technisierbar. 5<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
13
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
14
Formen der Vermittlung<br />
Um neu denken zu können, bedarf es vorerst die Bereitschaft sich vom Status Quo zu entfernen und Bestehendes<br />
grundlegend zu hinterfragen. Ein Beispiel für Perspektivwechsel ist die Tetrelemmaaufstellung von den Systemikern<br />
Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer, 6 die, ausgehend von einem Konzept der indischen Logik meinen es gäbe im<br />
Entscheidungsprozess nur die Wahl zwischen dem Einen oder dem Anderen, oder Beides, jedoch auch die Alternative<br />
den Fragenkomplex zu verlassen, aus dem System „auszusteigen“ und eine völlig neue Entscheidungsalternative zu<br />
entwickeln.<br />
Bezogen auf den Designprozess, wäre dieser „Ausstieg“ der gewünschte Perspektivenwechsel, der Neues entstehen<br />
lässt. Ich bin jedoch der Meinung, dass es einen weiteren Schritt bedarf, um die neue Idee wirklich auch einem<br />
gesellschaftlichen Nutzen zuzuführen und das bedeutet die Idee so zu adaptieren, sie in eine Form zu bringen, dass der<br />
Nutzen für eine bestimmte Anwendergruppe gegeben ist. Sie also wieder „in das System zurückzuführen“.<br />
Designpädagogik kann als ein eigenständiges Gestaltungsparadigma verstanden werden, eine partizipative Arbeitsform,<br />
wo Lehrende sich in der Situation der gemeinsamen Problemlösung als „Unwissende“ auf Augenhöhe mit den<br />
Studierenden gleichsam „auf eine Reise begeben“, da sie genauso wenig wie die Studierenden das Endergebnis des<br />
Gestaltungsprozesses/die Lösung nicht kennen. Das einzig „Wissende“ an ihnen ist ihre Erfahrung, die sie nur durch<br />
ihre Begleitungstätigkeit im Rahmen der konkreten Aufgabe einbringen können. Dazu müssen sie das Vertrauen der<br />
Studierenden erlangen. Sie sind Mentoren, Coaches, Guides, deren Hauptaufgabe darin besteht ihre Schützlinge zu<br />
motivieren, indem sie sie auffordern mit Grenzen zu spielen, Zweifel und Ängste abzubauen und gelegendlich auch<br />
ungehorsam zu sein. Ihre Authorität sollte bestimmt sein durch Authentizät, Empathie ohne Kumpelhaftigkeit und<br />
ehrlichem Förderungwillen. Humor kann dabei einen großen Beitrag leisten. Das bedeutet konkret:<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
15
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Kalkulierte Risikobereitschaft fördern. Dies vor allem durch die Ermöglichung des Scheiterns, also dem Schützling die<br />
Sicherheit zu geben, dass ev. Scheitern nicht als Fehler gilt.<br />
Mutige Ideen einfordern und jeden Versuch diesbezüglich zu fördern.<br />
Die Rolle des Begleiters einnehmen, der nicht die „richtige“ Antwort kennt, sondern vorausschauend aus den Ideen des<br />
Studierenden Potenziale erkennen kann und dem Studierenden dabei hilft, diese Potenziale selbst zu erkennen. (Ihm/ihr<br />
Möglichkeitsräume eröffnet).<br />
Den individuellen Kreativitätsprozess des Studierenden wahrnehmen und sich als Coach darauf einstellen.<br />
(Unterschiedliche Formen des Arbeitsrythmus respektieren).<br />
Die individuellen Talente des Studierenden fördern. Jeder hat seine Qualitäten in unterschiedlichen Feldern. (Z.B.:<br />
konzeptionelle Ideenentwicklung, technisches Erfindertum, hohes ästhetisches Bewusstsein).<br />
Dies sollte man auch den Studierenden auch vermitteln und ihre Stärken loben, jedoch auch konstruktive und<br />
differenzierte Kritik üben. Ehrliches Feed Back geben ohne dabei vernichtend zu sein. Sie unterstützen ihre Quellen der<br />
Inspiration und Ideen zu erforschen.<br />
Perfektionswille und Qualitätsanspruch bei den Studierenden fördern.<br />
Neugier wecken und Wissensquellen nennen.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
16
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
17
Motivation durch Reflexion<br />
- Motivationskurve<br />
Ein wesentlicher Teil der gestalterischen Selbsterfahrung ist das Erkennen des<br />
eigenen schöpferischen Prozesses, wie des persönliche Biorythmus (bin ich Tag- oder Nachtmensch), der Einfluss von<br />
Raumsituationen auf die gestalterische Befindlichkeit, wann Gruppenarbeit dem alleinigen Arbeiten vorzuziehen ist,<br />
welche<br />
Rahmenbedingungen für die Ideenentwicklung notwendig sind.<br />
Dazu kann es helfen den Ablauf eines Projektes mittels einer Kurve oder Grafik (x- Achse ist Zeitachse, y-Achse ist<br />
Motivation) aufzuzeichnen und zu reflektieren, was die Höhen und Tiefen ausgelöst haben. Diese kann z.B. bei Teamarbeit<br />
in eine durch alle Teilnehmer fortgesetzte Linie entstehen, die individuell beim Zeichnen kommentiert wird. (Thinking out<br />
loud). . Es sind dazu sicher auch andere grafische Darstellung denkbar, wie in Form einer Landkarte oder Routenskizze.<br />
- Arbeitstagebuch<br />
Darin sollte alles, was in irgendeiner Form für eine bestimmte Aufgabe relevant erscheint dokumentiert werden, ob<br />
Clippings aus Zeitschriften, Gedankennotizen, Skizzen usw. Der Nutzen dieser <strong>Dokumentation</strong> ist zu erkennen, dass alles<br />
was man in eine bestimmte „Form“ bringen möchte, also niederschreiben oder skizzieren, dadurch Klarheit erlangt<br />
bzw. bei späteren Aufgaben als Referenz für bestimmte Strategien oder Arbeitsmethoden, sprich zu prüfen, warum man<br />
bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Vor allem erlernt man dabei eine Art forschende Methodik einzusetzen.<br />
Man hat z.B. in Britischen Schulen damit begonnen Schülern bei der Erarbeitung von Werkstücken dazu aufzufordern<br />
jeden neuen Schritt per Foto durch das Mobiltelefon schnell zu dokumentieren. Danach wird darüber reflektiert warum<br />
bestimmte Gestaltungsentscheidungen (spontan) erfolgt sind.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
18
- Weiters<br />
- Regelmäßige Einzelgespräche und Kleingruppengespräche<br />
- Reviews: Dabei geht es aber nicht so sehr, dass die Studierenden eine passive Rolle einnehmen und der Lehrende als<br />
„Experte“ die Arbeiten kritisiert, sondern, dass die Studierende sich darüber im Klaren werden, welche Denk- oder<br />
Handlungsbarrieren für sie im Augenblick bestehen und sie mit vorbereiteten Fragen den Lehrenden um Rat fragen, im<br />
Sinne von: Was für Info, Rat oder Stellungnahme benötige ich um weitermachen zu können?<br />
Anforderungen an die Lehrenden<br />
- Man muss junge Menschen mögen.<br />
- Man muss Geduld und Fähigkeit besitzen, um zuzuhören und zuzusehen, ohne sofort einzugreifen. (Wie Eltern mit ihren<br />
Kindern)<br />
- Konsequenz besitzen, um bestimmte Leistungen einzufordern.<br />
- Ehrliches Interesse an den Ideen der Studierenden haben<br />
- Bereitschaft selbst aus diesen Prozessen zu lernen.<br />
Lernziele für die Studierenden<br />
- Wahrnehmung der Bedeutung von forschender Neugier (Research for Design) für das Entstehen von Neuem.<br />
- Wissen was man wie für wen entwirft<br />
- Förderung der gestalterischen Bewusstseinsbildung (Erkennen der Designfunktionen, der Möglichkeiten der<br />
Ideenfindung, das Erkennen von Potenzialen).<br />
- Erfahrung des eigenen schöpferischen Potentials<br />
- Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit jedes Schaffenden.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
19
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
Tetralemmaaufstellung<br />
20
Der Desigprozess<br />
Wie könnte man den Designprozess darstellen und welche Bedeutung hat das Verständnis dieses Prozesses für die<br />
Qualität des Neuen?<br />
Dazu möchte ich den Prozess, ausgehend von meiner eigenen 30jährigen Erfahrung<br />
mit unterschiedlichsten Gestaltungsfeldern, wie folgt beschreiben, und ihn in Beziehung setzen zur Theorie von Donald<br />
Schön. 7<br />
Vorerst: Es gibt nicht „den Prozess“. Jeder Gestalter hat letztendlich seine eigene Methode. Gerade dieses „Nicht<br />
Fassbare“ , „Nicht Messbare“, dieses schöpferische Mysterium birgt die ganze Kraft der menschlichen Kreativität<br />
in sich. Trotzdem: Es gibt Muster, die individuell variierbar sind. Eine Möglichkeit ist diesen Prozess als eine Serie<br />
von Untersuchungs- und Handlungs“blasen“ zu beschreiben, wo man „divergent“ in der Suche nach der Lösung sich<br />
möglichst vorerst „öffnet“, Wissen und Erkenntnisse sammelt, diese neu ordnet, darüber reflektiert, dann daraus<br />
einen Schluss zieht und die Aufgabe „konvergent“ klarer formuliert. Jede Designaufgabe ist im Grunde ein „ill<br />
defined poblem“ 8 , die in Schritten genauer definiert werden muss. Die ersten Schritte sind im Grunde Research in die<br />
unterschiedlichsten Bereiche, auch die Entwicklung von gestalterischen Hypothesen, also das experimentelle Herstellen<br />
von Lösungsvorschlägen, Skizzen, Modelle etc. sind Formen der Untersuchung. Laut Eric Dishman liegt in der Form der<br />
Beobachtung das Potenzial für wirklich Neues in der Erfindung der Untersuchungsmethode 9 .<br />
Donald Schön (Reflective Practioner) nennt diesen Prozess der Aufgabendefinition „Problem Setting“ oder „Re-framing<br />
the Problem“ 10 . Dabei nähern wir uns einer komplexen, vielschichtigen Aufgabenstellung indem wir aus dem Kontext<br />
unseres Interesses die Fragen benennen, die uns vorerst interessieren und uns einen Einstieg in die Aufgabe ermöglichen<br />
und erstellen einen Rahmen, eine Perspektive der Untersuchung.<br />
Zuletzt entwickelt sich aus diesem Prozess immer konkreter eine Form.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
21
Würde man jedoch rein methodisch solche Prozesse durchlaufen, dann bedeutet dies nicht unbedingt, dass dabei<br />
originelle Ideen entstehen. Wesentlich dabei ist eines der Phänomene eines schöpferischen Geistes, nämlich, dass<br />
dieser den Zufall auch mitwirken lässt. Die Serendipität kann dann den „Whow“ Faktor auslösen, wenn parallel zum<br />
Untersuchungsprozess der Designer, sie (ganz opportunistisch) Einflüsse aus völlig anderen Feldern oder Situationen<br />
in den Kontext ihre Arbeiten einfließen lassen. Je besser die Fähigkeit dieser Vernetzung, die Fähigkeit großer<br />
Kontextsprünge, desto radikaler die Idee. Trotzdem all dies ist nur mit einem „vorbereiteten“ Geist möglich.<br />
Ich möchte in Folge ein paar Methoden darstellen, wie ich versucht habe mich mit Studierenden Aufgaben spielerisch,<br />
neugierig und lustvoll zu nähern.<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
22
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
23
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
24
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
25
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
Problem<br />
setting<br />
...a process in<br />
which,(...) we name<br />
the things to which we<br />
will attend and frame<br />
the context in which<br />
we will attend to them.<br />
Reframing the<br />
Problem.<br />
Donald A Schön,<br />
The Reflective<br />
Practioner, Seite 40<br />
Der Zufall<br />
trifft auf den<br />
„vorbereiteten“<br />
Geist.<br />
26
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
27
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
28
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
29
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
30
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
31
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
Figuren + Designdinge<br />
Version für 7- bis 12-Jährige<br />
Vienna Design Week 2008<br />
32
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
33
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
34
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
35
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
36
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
37
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
38
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
39
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
40
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
41
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
42
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
43
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
44
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
45
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
46
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
47
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
48
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
49
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
50
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Fußnoten:<br />
Pfaller Robert, Wofür es sich zu leben lohnt, Elemente materialistischer Philosophie (Wien 2011), S.173<br />
Ebenda S.178<br />
Vergleiche: Chouinard Yvon, Let My People Go Surfing, The Education of a Reluctant Businessman (New York 2005)<br />
www.patagonia.com<br />
Vergleiche: http://de.wikipedia.org/wiki/Symposiarch (Zugriff: 2<strong>4.</strong>11.2011)<br />
Vergleiche: Polanyi Michael, The Tacit Dimension, (New York 1967)<br />
Vergleiche: http://de.wikipedia.org/wiki/Tetralemma_%28Strukturaufstellung%29<br />
Vergleiche: Schön Donald A, The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action (Farnham, Surry 1991)<br />
Kimbell Richard, Stables Kay, Researching Design Learning. Issues and Findings from Two Decades of Research and<br />
Development (London 2008)<br />
S164 – 166).<br />
„Design research methods are themselves „products“ that need to be designed for different audiences, purposes<br />
and contexts“. Dishman Eric, Designing for the New Worlds. In: Brenda Laurel (ed.) Design Research Methods and<br />
Perspectives. (MIT 2003) S48.<br />
Schön Donald A, The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action (Farnham, Surry 1991), S40 - 41<br />
zurück zur <strong>Dokumentation</strong>...<br />
51