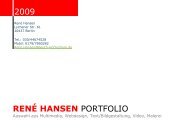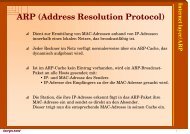HCI / MCK
HCI / MCK
HCI / MCK
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TFH Berlin<br />
<strong>HCI</strong> I<br />
Zusammenfssung<br />
<strong>HCI</strong> / <strong>MCK</strong><br />
Was gab es in diesem<br />
Semester zu lernen?<br />
In 45 Folien durchs<br />
Semester<br />
TFH Berlin<br />
© Ilse Schmiedecke 2008
Was ist <strong>HCI</strong>?<br />
Die Lehre von der Qualität<br />
der Schnittstelle<br />
zwischen Mensch und interaktivem Gerät<br />
<strong>HCI</strong> 2<br />
Interaktion und<br />
Interface<br />
Usability:<br />
– effektiv, effizient, zufriedenstellend<br />
Design:<br />
– visuell ansprechend<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 2
Was ist <strong>HCI</strong>?<br />
Ein Arbeitsfeld für<br />
Korrekte<br />
Kreative<br />
Kleinliche<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 3<br />
K<br />
o<br />
r<br />
r<br />
Visionäre
2. Modelle<br />
Interaktion begreifen durch Modelle<br />
1. Nutzungserlebnis<br />
2. Kommunikationsparadigmen<br />
3. Mentale Modelle<br />
4. Handlungsmodelle<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 4
Nutzungserlebnis<br />
angenehme<br />
und unangenehme<br />
Nutzungserlebnisse<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 5
Kommunikationsparadigmen<br />
Kommunikationsparadigmen:<br />
- Computer als Arbeitsmittel (Ressource)<br />
der Mensch setzt den Computer ein<br />
- Computer als Werkzeug (Funktion oder Automat)<br />
der Mensch bedient den Computer<br />
2.2 Kommunikationsparadigmen<br />
- Computer als Kommunikationspartner (Assistent, Partner, Überwacher oder<br />
Ausführender)<br />
der Mensch kommuniziert mit dem Computer<br />
- Computer als Medium (Mittler zur Anwendungswelt)<br />
der Mensch interagiert über den Computer<br />
- Computer als Künstliche Realität (der Computer wird unsichtbar)<br />
der Mensch bewegt sich in einer künstlichen Welt<br />
Als was<br />
erscheint mir der<br />
Computer?<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 6
Mentale und Handlungsmodelle<br />
2 Bereiche der Schwierigkeit<br />
– Verständnis mentale Modelle<br />
– Handhabung Handlungsmodelle<br />
Mentale Modelle<br />
– Komplexität und Kohärenz<br />
– Modell-Inkompatibilitäten<br />
Handlungsmodelle<br />
– Aufwand<br />
– intellektuell und manuell / sensorisch<br />
– von der Idee zur Durchführung und Bewertung<br />
– auf verschiedenen Abstraktionsebenen<br />
– dargestellt als "Abstand" zwischen Ebenen:<br />
Transformationsdistanz<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 7
Mentale Modelle<br />
Der (System-)Designer<br />
– entwirft das konzeptuelle Modell<br />
– bildet es auf ein funktionales Modell der Software ab<br />
Der Benutzer<br />
– besitzt ein mentales Modell der Realität (Fachwissen)<br />
– erwirbt ein mentales Modell des Systems<br />
Das System<br />
– stellt ein implementiertes Modell von Realität und technischer Funktion dar<br />
– realisiert damit das Systemverhalten<br />
Hilfsmittel zur Erkennung von Missverständnissen:<br />
Modell-Inkompatibilitäten<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 8
Modellkalkül<br />
(Pseudo-Mathe, eher Steno):<br />
Wer besitzt Modelle? Und wovon?<br />
Wovon? immer vom Arbeitsbereich A (UoD, universe of discourse)<br />
Wer? der Benutzer B<br />
- der Experte!!!<br />
der Systemdesigner D<br />
- der Analytiker<br />
das System S<br />
- das implementierte Modell,<br />
das die Systemreaktionen definiert<br />
(mentales Modell des Programmierers)<br />
Also B(A), D(A), S(A)<br />
Müssen nicht zwangläufig harmonieren !!!<br />
Und wenn nicht, gibt’s Missverständnisse<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 9
Handlungsmodelle<br />
Modelle über das Wie der Arbeit.<br />
Ziel: Arbeit soll leicht zu erledigen sein<br />
Modelltypen:<br />
– Modell der Transformationsdistanzen<br />
– IFIP-Modell<br />
– 6-Ebenen-Modell<br />
2.4. Handlungsmodelle<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 10
Klassische Handlungsmodelle<br />
Organisationsschnittstelle<br />
Dialogschnittstelle<br />
Werkzeugschnittstelle<br />
Ein-/Ausgabeschnittstelle<br />
TFH Berlin<br />
Modell der Transformationsdistanzen Gliederung der Benutzungsschnittstelle<br />
nach dem IFIP-Modell<br />
Kombination der Modelle<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 11
Das 6-Ebenen-Handlungs-Modell<br />
1. Intentionale Ebene<br />
Anwendungsgebiet und<br />
Zweck<br />
2. Pragmatische Ebene<br />
Arbeitsziele und<br />
Verfahren<br />
3. Semantische Ebene<br />
Arbeitsobjekte und<br />
Operationen<br />
4. Syntaktische Ebene<br />
Ein- und Ausgaberegeln<br />
5. Lexikalische Ebene<br />
Zeichen und Alphabete<br />
6. Sensomotorische Eb.<br />
Motorik und Sensorik<br />
Tätigkeiten Bewertung Methoden Bewertung<br />
Verfahren<br />
Operationen<br />
E-Syntax<br />
E-Alphabet<br />
Motorik<br />
Interpretation<br />
Zustände<br />
Struktur<br />
Wahrnehmg<br />
Sensorik<br />
Prozeduren<br />
Zustandsänderungen<br />
Ausgabesynthese<br />
Visualisierung<br />
Darstellung<br />
Interpretation<br />
semantische<br />
Analyse<br />
Strukturanalyse<br />
Erkennung<br />
Erfassung<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 12
3. Benutzer verstehen<br />
Physische Benutzereigenschaften:<br />
Sehen und visuelle Wahrnehmung<br />
Handmotorik<br />
Psychische Benutzereigenschaften<br />
Gedächtnisformen<br />
Kognition<br />
Benutzermodelle<br />
Benutzerklassen<br />
Benutzerprofile<br />
Personae (fiktive Benutzer)<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 13
Zusammenfassung:<br />
Sehvermögen des gesunden Auges<br />
Sehfeld zentral unterhalb der Mitte<br />
Schärfelücke am seitlichen Rand<br />
Farbwahrnehmung adaptiosabhängig<br />
Adaption benötigt Zeit Blendung<br />
Adaption und Farbwahrnehmung "altern" deutlich<br />
Weniger als 5% der Sehzellen Zäpfchen (Farbsehen)<br />
Feine Strukturen und Schrift benötigen SW-Kontrast<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 14
Visuelle Entlastung<br />
aufgrund von Alterung / Erkrankung / Sehschwäche<br />
aufgrund von Umgebungsbedingungen<br />
Kontrast gleicht Schärfemängel aus<br />
Möglichst keine Farbschrift, niemals auf farbigem Hintergrund<br />
Rot-Grün-Kontrast vermeiden, niemals zentral sinntragend<br />
einsetzen!<br />
Adaption entlasten<br />
Zentrales Sehfeld optimal nutzen<br />
Nebenbelastung vermeiden!<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 15
Visuelle Wahrnehmung<br />
Unbewusste Vorverarbeitung<br />
Erkennen bekannter Strukturen<br />
"Vorsortierung" der visuellen Information<br />
Unterdrückung von Dauerreizen<br />
(Hintergrundstrukturen)<br />
Gestaltgesetze:<br />
Erklärungen der Vorverarbeitung<br />
über 100 Gestaltgesetze formuliert<br />
TFH Berlin<br />
mit 4 Hauptgesetzen gut zu erfassen:<br />
–Gesetz der Nähe<br />
–Gesetz der Ähnlichkeit<br />
–Gesetz der Geschlossenheit<br />
–Gesetz der Prägnanz<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 16
3.4 Motorik (Hände)<br />
Handmotorik<br />
zentral für die Eingabe<br />
Grundlegende feinmotorische Fähigkeiten<br />
Ergonomische Gestaltung<br />
der Eingabegeräte<br />
GUI-Gestaltung muss Treffsicherheit<br />
berücksichtigen<br />
Einschränkungen durch Alter<br />
und Behinderung<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 17
3.4 Exkurs: Alternative Eingabeformen<br />
Sprach- Ein/Ausgabe<br />
• Menschen mit Behinderungen<br />
• Bedienung während manueller Arbeit<br />
• in Situationen, in denen eine manuelle<br />
Bedienung nicht geeignet ist<br />
(Lebensmittelverabeitung, Diagnostik)<br />
Gesten und Augenbewegungen<br />
für spezielle Anwendungen<br />
Tragbare und taktile Interfaces<br />
Motion-Capturing<br />
Ultrafeine Instrumentenführung (Feinmechanik, Chemie, Chirurgie)<br />
Hirnstromsteuerung<br />
Bewegungssensoren<br />
i-phone Spielschnittstelle<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 18
3.5 Gedächtnis und Kognition<br />
Gedächtnisforschung ist Teil der<br />
Psychologie<br />
– daher "psychische<br />
Benutzereigenschaft"<br />
Kognition steht für menschliche<br />
Informationsverarbeitung:<br />
– Erkennen, Durchdenken,<br />
Anwenden ...<br />
Gedächtnis ist zentral für die<br />
Interaktion:<br />
– Keine Interaktion ohne Kognition<br />
– Keine Kognition ohne Gedächtnis<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 19
Gedächtnisarten<br />
Modell:<br />
Reizaufnahme durch sensorisches<br />
System (Auge, Ohr)<br />
TFH Berlin<br />
Zwischenspeicherung der Rohdaten<br />
und unbewusste Vorverarbeitung im<br />
sensorischen Gedächtnis<br />
Durch Wahrnehmung gefilterte Weitergabe<br />
an das Kurzzeitgedächtnis,<br />
Arbeitsspeicher für bewusste<br />
Problemlösung<br />
Durch Interesse selektierte Weitergabe<br />
an das Langzeitgedächtnis.<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 20
Gedächtnisarten<br />
• Sensorisches Gedächtnis:<br />
- ikonischer (12 Chunks, 0,5 sec Persistenz)<br />
- und echoischer Speicher (bis 5 sec. Persistenz)<br />
• KZG (Kurzzeit-Gedächtnis)<br />
- Arbeitsspeicher<br />
- 7 +/- 2 Chunks, 15-30 sec.<br />
- störungsanfällig<br />
- Informationsverlust durch Überlastung<br />
- auffrischbar durch Wiederholung<br />
• LZG (Langzeit-Gedächtnis)<br />
- Unbegrenzte Kapazität und Persistenz<br />
- Zugriffszeit 8 sec/Chunk<br />
- Recall / Recognition (leichterer Zugang zum Wissensnetz)<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 21
Kognition:<br />
Gedächtnis und Informationsverarbeitung<br />
©<br />
Kognition als Systemmodell:<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 22
3.1 Benutzerklassen<br />
Alle Benutzer sind verschieden ☺<br />
3.1 Benutzerklassen<br />
Am deutlichsten wirken sich Unterschiede in Wissen<br />
und Erfahrung aus!<br />
Wissen und Erfahrung<br />
– Fachkenntnis<br />
Fachmann Laie<br />
– Programmerfahrung<br />
– Computererfahrung<br />
Experte Anfänger<br />
Computerfreak Computerlaie<br />
<strong>HCI</strong>-Kriterien<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 23
3.1.1 Benutzerklassen<br />
<strong>HCI</strong>-Benutzerklassen:<br />
Gelegenheitsbenutzer<br />
Ungeübte Benutzer<br />
Routinebenutzer<br />
Experte<br />
3.1 Benutzerklassen<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 24
3.1.4 Computererfahrung<br />
Computererfahrung<br />
– grundsätzlich orthogonale Kategorie<br />
Computererfahrung<br />
Anna<br />
Beate<br />
Christine<br />
Programmerfahrung<br />
Wer kann helfen, wenn<br />
• das Programm sich nicht mehr mit dem Server verbindet?<br />
• ein völlig falscher Wert eingegeben und gespeichert wurde?<br />
• die Daten beim Kopieren in ein anderes Programm verfälscht werden?<br />
3.1 Benutzerklassen<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 25
3.2 Benutzerprofil<br />
Wichtige Kategorien eines Benutzerprofils<br />
jeweils spezifisch zu ergänzen (z.B. Sprachkenntnis, Kultur,...)<br />
– Benutzerklasse<br />
– Computererfahrung<br />
– Fachkenntnis<br />
– Rolle im Anwendungsbereich<br />
– Häufigkeit der Benutzung<br />
– Zahl und Umfang der Aufgaben am System<br />
– körperliche Fähigkeiten / Handicaps<br />
– Alter<br />
Möglichst grobe Bewertungsskalen Typbildung!<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 26
3.2.1 Personae<br />
Benutzerprofile sind wichtig<br />
– im Interaktionsentwurf<br />
– bei der Evaluation (z.B. Auswahl der Testbenutzer)<br />
3.2 Beutzerprofil<br />
Zu einer Software gehören typischerweise mehrere Benutzerprofile<br />
– mit verschiedenen Aufgaben und Kompetenzen<br />
– Usability bezieht sich auf alle!<br />
Persona *) als Repräsentant eines Profiltyps<br />
– künstlich konstruiert<br />
– benannt<br />
– schafft handhabbare Begrifflichkeit<br />
– z.B. ArthurAdmin, SimonSonntagsfahrer...<br />
TFH Berlin<br />
*)Lit: The inmates are running the asylum (Cooper 1999)<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 27
Barrieren der Computernutzung<br />
Nutzungsbarrieren erfahren:<br />
blinde Nutzer<br />
sehbehinderte Nutzer<br />
motorikgestörte Nutzer (auch temporär)<br />
gehörlose Nutzer<br />
lernbehinderte Nutzer<br />
alte Nutzer<br />
Fotoquelle: www.webforall.info<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 28
Barrierefreiheit formal<br />
W3C: Web Content Accessability Guide 1 (WCAG1)<br />
und WCAG2 (seit 2003, noch nicht verabschiedet)<br />
Deutschland:<br />
Barrierefreie Informationstechnologie-<br />
Verordnung (BITV) seit 2002 gültig<br />
– 14 Grundanforderungen<br />
– jeweils mit Details in 2 Prioritätenlisten<br />
Beides gilt nur für Internet-Seiten<br />
Richtlinien aber grundsätzlich auch Kriterien für andere<br />
Benutzerschnittstellen<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 29
4. Interaktionsgestaltung<br />
Informationsdarstellung<br />
Gestaltungsgrundsätze<br />
– Grundsätze der Interaktionsgestaltung<br />
– Grundsätze der GUI-Gestaltung<br />
– WIMP-Grundsätze<br />
– Gestaltung von Kommandosprachen<br />
Innovative Interaktionsformen<br />
Interaktionsparadigmen<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 30
Codierungsformen<br />
für visuelle Darstellungen<br />
*<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 31<br />
Quelle: M.Herczeg, Modul <strong>MCK</strong> der VFH<br />
Die wichtigsten:<br />
• Text<br />
• Farbe<br />
• Anordnung<br />
• Grafik<br />
*) Anzahl der absolut, d.h. ohne<br />
Vergleich, unterscheidbaren Stufen.
Die wichtigsten Codierungsformen<br />
Texte:<br />
mächtigste Codierungsform mit der Fähigkeit nahezu jede Information<br />
zu repräsentieren.<br />
Farbe:<br />
sehr wirksame Codierungsform, vor allem zur Hervorhebung<br />
bestimmter Informationskategorien<br />
Probleme: Kontrast, Schärfe, Standardbedeutungen.<br />
Manipulationsmöglichkeiten durch Standardbedeutungen.<br />
Anordnung:<br />
Codierungsform auf der Basis der Gestaltgesetze zur Gruppierung und<br />
Isolation von Informationselementen.<br />
Chunking zur KZG-Entlastung.<br />
Manipulationsmöglichkeiten durch Fehlanordnung.<br />
Graphik:<br />
Codierungsform, vor allem zur Visualisierung komplexer oder<br />
umfangreicher Informationsmengen.<br />
Hohe Datenreduktion, gute Decodierbarkeit.<br />
Manipulationsmöglichkeiten durch Skalierung.<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 32
4.2.1. Gestaltungskriterien für Interaktionen<br />
Gleichförmigkeit<br />
– bei der Umsetzung der Interaktionsprimitiven<br />
(Zeigen, Selektieren, Aktivieren, Modifizieren)<br />
Sichtbarkeit<br />
– des Navigations- und Systemzustands<br />
Affordanz<br />
– unmittelbar erkennbare Bedienungsweise<br />
Nicht-Modalität<br />
– oder deutliche Anzeige des Systemmodus<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 33
4.2.2 Gestaltungskriterien für GUIs<br />
Minimalistisches Design<br />
- Reduktion, Ordnung, Zusammenfassung<br />
Abgestimmte visuelle Grundparameter<br />
- Größe. Kontrast, Proportion<br />
- Schichtung, Unterscheidung, Vorder-Hintergrund-Abstimmung<br />
Wahrnehmungsunterstützung<br />
- Visuelle Struktur entspricht logischer Struktur<br />
- Visuelle Strukturierung durch Symmetrie, Ausrichtung, optischen<br />
Größenausgleich, Abstände und Leerfelder, Einfärbung<br />
Struktur und Regelmaß<br />
- Inhaltliche Struktur (z.B. Hierarchie) aufgreifen<br />
- Gitter – Feldgrößen sorgfältig wählen, möglichst wenig Ausnahmen<br />
- Hauptlinien fensterübergreifend einheitlich<br />
Einheitliche Semiotik<br />
- Gestaltungsform der Sinnbilder (Strichzeichnung, Farbgrafik, Foto...)<br />
Harmonische Farbgestaltung<br />
Offener Text<br />
- kurze Beschriftungen, Textblöcke aufgebrochen oder teil-verborgen<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 34
4.2.3. WIMP-Interaktionselemente<br />
Fenster<br />
– Haupt, Unter- und Dialogfenster<br />
Menüs<br />
– Drop-down und Pop-up-Menüs<br />
Widgets<br />
– Knöpfe ("Schaltflächen" lt. MS-Terminologie)<br />
– Auswahllisten<br />
– Deiktische Werteingaben<br />
Meldungen und Warnungen<br />
About-Boxen und Splash Screens<br />
Werkzeugleisten<br />
Hilfemenüs<br />
Für jedes<br />
Element gibt es<br />
Regeln...<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 35
4.3 Innovative Interaktionsformen<br />
Zumeist durch innovative Eingabegeräte definiert<br />
Die zur Zeit wichtigsten:<br />
– Multi-Touch-Panel<br />
– Blickverfolgung<br />
– Hirnstrom-Interface<br />
– Bewegungssensoren<br />
– RFID und Wearables<br />
Sind (weitestgehend) auf die "klassischen" Interaktionsprimitiven<br />
und –paradigmen zurückführbar.<br />
Trend zu "immersiven" Technologien – Aufweichung der Grenze<br />
zwischen realer und virtueller Welt.<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 36
Entwicklung der Benutzerschnittstellen<br />
bis 1980<br />
– Konsolen, Fernschreiber<br />
ab 1980<br />
– erste GUIs, WIMP<br />
ab 1990<br />
– Multimedia<br />
– Gruppen-Interaktion<br />
– Touchscreen etc.<br />
– Web-Design<br />
ab 2000<br />
– Mobile Geräte, Wearables<br />
– Taktile Schnittstellen<br />
– Augmented Reality<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 37
4.4 Interaktionsparadigmen<br />
Entwicklung der Benutzungsschnittsstellen<br />
Die klassischen Interaktionsparadigmen:<br />
– Kommandosystem<br />
– Menü-Maske-System<br />
– Direkte Manipulation<br />
– Hypermedia<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 38
Interaktionsparadigmen - Belastung des LZG<br />
Kommandosystem:<br />
Starke Belastung des LZG!<br />
– Abhilfe durch (Pseudo-)Menüs und Hilfefunktionen,<br />
– Default-Parameter<br />
– Entlastung im Einzelfall durch Makrobildung.<br />
Menü-Maske:<br />
geführt: keine Belastung<br />
benutzernavigiert: mittlere bis starke Belastung des LZG.<br />
– Abhilfe: Thematisch gegliederte Navigationshilfen<br />
Direkte Manipulation:<br />
minimale Belastung des LZG durch Visualisierung<br />
Hypermedia:<br />
minimale Belastung des LZG<br />
TFH Berlin<br />
LZG-Belastung<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 39
Interaktionsparadigmen - Belastung des KZG<br />
TFH Berlin<br />
Kommandosystem:<br />
KZG-freundlich, da Arbeitsschritte und –ergebnisse sichtbar<br />
Menü-Maske:<br />
Geführte Systeme (Wizards) entlasten das KZG<br />
benutzernavigierte System beanspruchen das KZG;<br />
– Abhilfe: Historien- oder Ergebnisvisualisierung;<br />
– sinnvoll: Undo-Operation!<br />
Direkte Manipulation:<br />
ähnlich wie benutzernavigierte Menü-Maskensysteme;<br />
– Ergebnisvisualisierung erforderlich, da sonst keine Kontrolle;<br />
– Undo zwingend erforderlich<br />
Hypermedia:<br />
Linkverfolgung überfordert das KZG!<br />
– Navigationsvisualisierung,<br />
– Historie,<br />
– Vorgänger- und Nachfolgernavigation,<br />
– Suchraumvisualisierung KZG-Belastung<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 40
EN 9241 – 110<br />
Grundsätze der Dialoggestaltung<br />
Neuer Anwendungsbereich "Interaktive Systeme"<br />
Neue Definition Benutzungsschnittstelle:<br />
"Alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die<br />
Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer<br />
notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe<br />
mit dem interaktiven System zu erledigen."<br />
"Alte" Dialogkriterienliste<br />
– aber weiter präzisiert<br />
1. Aufgabenangemessenheit<br />
2. Selbstbeschreibungsfähigkeit<br />
3. Steuerbarkeit<br />
4. Erwartungskonformität<br />
5. Fehlertoleranz<br />
6. Individualisierbarkeit<br />
7. Lernförderlichkeit<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 41
6. Evaluation<br />
Voraussetzungen:<br />
– Definiertes Ziel<br />
– Definierte Annahmen<br />
– Definierte Methodik<br />
Dimensions-Raster:<br />
Benutzer – Experten<br />
Realität – Labor<br />
Untersuchung – Studie<br />
Quantitativ – Qualitativ<br />
Teuer – Kostengünstig<br />
TFH Berlin<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 42
Grundformen der Evaluation<br />
Durchgängige Evaluation<br />
– in allen Phasen des Entwurfs- und Realisierungsrungsprozesses<br />
– jeweils geeignete Form wählen<br />
Grundformen:<br />
– Expertenevaluation:<br />
• Analyse (Verwendung von Kriterienkatalogen, Modellen)<br />
• repräsentativer (kognitiver) Test<br />
– Benutzerstudie:<br />
TFH Berlin<br />
• Usability-Tests (Labor: automatische Protokollierung, Eye-Tracking, ...)<br />
• Benutzerbeobachtung (Feldstudie, Ethnographie)<br />
• Benutzerbefragung (Umfrage, Interview)<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 43
Heuristische Evaluation<br />
Benutzbarkeitsheuristiken:<br />
Expertenevaluation<br />
TFH Berlin<br />
1. Sichtbarkeit des Systemstatus<br />
2. Übereinstimmung zwischen System und<br />
der realen Welt<br />
3. Benutzerkontrolle und Freiheit der Interaktion<br />
4. Konsistenz und Einhaltung von Standards<br />
5. Fehlervermeidung<br />
6. Wiedererkennen anstelle von Erinnern<br />
Jacob Nielsen<br />
7. Flexibilität und Effizienz<br />
8. Ästhetisches und minimalistisches Design<br />
9. Hilfe für den Benutzer um Fehler wahrzunehmen, zu erkennen<br />
und zu beheben<br />
10. Hilfe und Dokumentation<br />
© schmiedecke 08 <strong>HCI</strong> 44
Das war der Pflichtstoff von <strong>HCI</strong> I<br />
☺<br />
Bleiben Sie offen für alles Neue<br />
- wenn es den Benutzern nützt!<br />
TFH Berlin