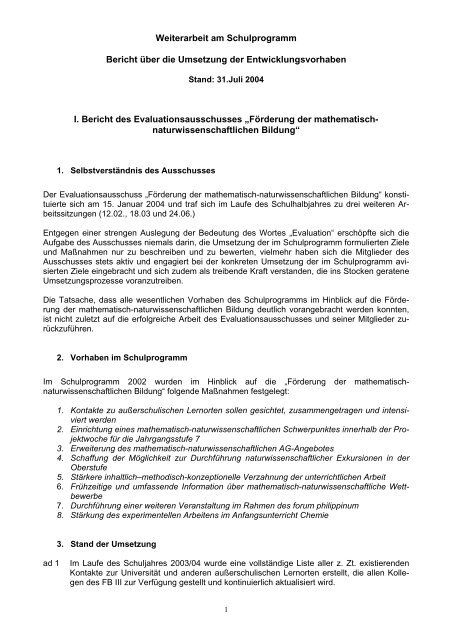gymnasium philippinum
gymnasium philippinum
gymnasium philippinum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Weiterarbeit am Schulprogramm<br />
Bericht über die Umsetzung der Entwicklungsvorhaben<br />
Stand: 31.Juli 2004<br />
I. Bericht des Evaluationsausschusses „Förderung der mathematischnaturwissenschaftlichen<br />
Bildung“<br />
1. Selbstverständnis des Ausschusses<br />
Der Evaluationsausschuss „Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung“ konstituierte<br />
sich am 15. Januar 2004 und traf sich im Laufe des Schulhalbjahres zu drei weiteren Arbeitssitzungen<br />
(12.02., 18.03 und 24.06.)<br />
Entgegen einer strengen Auslegung der Bedeutung des Wortes „Evaluation“ erschöpfte sich die<br />
Aufgabe des Ausschusses niemals darin, die Umsetzung der im Schulprogramm formulierten Ziele<br />
und Maßnahmen nur zu beschreiben und zu bewerten, vielmehr haben sich die Mitglieder des<br />
Ausschusses stets aktiv und engagiert bei der konkreten Umsetzung der im Schulprogramm avisierten<br />
Ziele eingebracht und sich zudem als treibende Kraft verstanden, die ins Stocken geratene<br />
Umsetzungsprozesse voranzutreiben.<br />
Die Tatsache, dass alle wesentlichen Vorhaben des Schulprogramms im Hinblick auf die Förderung<br />
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung deutlich vorangebracht werden konnten,<br />
ist nicht zuletzt auf die erfolgreiche Arbeit des Evaluationsausschusses und seiner Mitglieder zurückzuführen.<br />
2. Vorhaben im Schulprogramm<br />
Im Schulprogramm 2002 wurden im Hinblick auf die „Förderung der mathematischnaturwissenschaftlichen<br />
Bildung“ folgende Maßnahmen festgelegt:<br />
1. Kontakte zu außerschulischen Lernorten sollen gesichtet, zusammengetragen und intensiviert<br />
werden<br />
2. Einrichtung eines mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunktes innerhalb der Projektwoche<br />
für die Jahrgangsstufe 7<br />
3. Erweiterung des mathematisch-naturwissenschaftlichen AG-Angebotes<br />
4. Schaffung der Möglichkeit zur Durchführung naturwissenschaftlicher Exkursionen in der<br />
Oberstufe<br />
5. Stärkere inhaltlich–methodisch-konzeptionelle Verzahnung der unterrichtlichen Arbeit<br />
6. Frühzeitige und umfassende Information über mathematisch-naturwissenschaftliche Wettbewerbe<br />
7. Durchführung einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des forum <strong>philippinum</strong><br />
8. Stärkung des experimentellen Arbeitens im Anfangsunterricht Chemie<br />
3. Stand der Umsetzung<br />
ad 1 Im Laufe des Schuljahres 2003/04 wurde eine vollständige Liste aller z. Zt. existierenden<br />
Kontakte zur Universität und anderen außerschulischen Lernorten erstellt, die allen Kollegen<br />
des FB III zur Verfügung gestellt und kontinuierlich aktualisiert wird.<br />
1
ad 2 Im Zuge der Neuorganisation der Projektwoche konnte mit Beginn des Schuljahres 2002/03<br />
in der Jahrgangsstufe 7 eine naturwissenschaftliche Schwerpunktbildung vorgenommen<br />
werden. Als Organisations- und Arbeitsform wurde dabei die Stationenarbeit gewählt, die<br />
es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, naturwissenschaftliche Fragestellungen, die<br />
dem Unterricht entspringen, in kleinen, arbeitsfähigen Gruppen sowohl theoretisch als auch<br />
experimentell vertiefend zu behandeln.<br />
ad 3 Mit Beginn des Schuljahres 2003/04 wurde eine naturwissenschaftliche Wettbewerbs-AG<br />
eingerichtet, die sich vorrangig mit den physikalischen Wettbewerben der Sekundarstufe I<br />
beschäftigt. Auf Grund des guten Zuspruchs von Seiten der Schüler und der Vielzahl weitere<br />
Wettbewerbe - insbesondere im Bereich der Biologie und Chemie - wird erwogen, das<br />
Angebot auch auf Wettbewerbe dieser Fachrichtungen auszuweiten und im Rahmen des<br />
Nachmittagsangebots eine weitere naturwissenschaftliche Wettbewerbs - AG einzurichten.<br />
ad 4 Mit Hilfe einer schriftlichen Befragung aller Kolleginnen und Kollegen des FB III wurde der<br />
Frage nachgegangen, inwieweit es naturwissenschaftlichen Kursen ermöglicht wird, außerschulische<br />
Lernorte aufzusuchen. Zu diesem Zwecke wurden sämtliche Anträge auf Durchführung<br />
naturwissenschaftlicher Exkursionen des Schuljahres 2002/03 erfasst. Es zeigte<br />
sich, dass im Schuljahr 2002/03 alle Anträge auf Durchführung einer Exkursion durch die<br />
Schulleitung unterstützt und genehmigt wurden.<br />
ad 5 Im Laufe des Schuljahres 2003/04 wurde für die Sekundarstufe I eine Synopse der unterrichtlichen<br />
Inhalte der drei naturwissenschaftlichen Fächer erstellt.<br />
Zudem wurde auf Anregung des Evaluationsausschusses auf Fachbereichsebene ein sog.<br />
Normenausschuss eingerichtet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, anhand fünf zentraler<br />
Themenbereiche des naturwissenschaftlichen Unterrichts über die Fachgrenzen hinweg<br />
verbindliche Absprachen hinsichtlich der Verwendung von Begriffen und Modellen sowie<br />
des methodischen Vorgehens vorzubereiten und zu treffen.<br />
ad 6 In bewährter Weise werden die Schülerinnen und Schüler von ihren jeweils unterrichtenden<br />
Fachlehrern und –lehrerinnen über die Möglichkeit der Teilnahme an den verschiedenen<br />
naturwissenschaftlichen Wettbewerben informiert. Die Fachsprecher/innen stellen sicher,<br />
dass die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen frühzeitig und umfassend über die jeweils<br />
laufenden Wettbewerbe informiert werden. Von der Beauftragung einer einzelnen<br />
Person, die über alle mathematisch-naturwissenschaftlichen Wettbewerbe informiert, wird<br />
auf Grund der fachlichen Breite und der großen Anzahl der verschiedenen Wettbewerbe<br />
Abstand genommen.<br />
ad 7 Der Evaluationsausschuss musste leider feststellen, dass bisher keine weitere naturwissenschaftliche<br />
Veranstaltung im Rahmen des forum <strong>philippinum</strong> stattgefunden hat. Gründe<br />
für diesen Befund liegen in der Begrenztheit der personellen Ressourcen, vor allem aber<br />
darin, dass es schwierig erscheint, ein geeignetes naturwissenschaftliches Thema zu finden,<br />
um es so aufzubereiten, dass dieses auch in der Marburger Öffentlichkeit ein entsprechendes<br />
Interesse weckt.<br />
ad 8 Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2002/03 gelang es erstmalig, den Chemieunterricht in<br />
der Jahrgangsstufe 8 personell so auszustatten, dass in einer der beiden Unterrichtsstunden<br />
die Klassen geteilt werden konnten, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit<br />
zu eröffnen, den Umgang mit Experimentiermaterial und Chemikalien einzuüben und Schülerversuche<br />
durchzuführen. Auf der Basis dieser ersten Erfahrungen im Schuljahr 2002/03<br />
wurde durch die Fachschaft Chemie ein tragfähiges Konzept entwickelt, welches den organisatorischen<br />
Besonderheiten dieses Unterrichts (strenger Wechsel zw. experimenteller<br />
und theoretischer Arbeit, enge Kooperation/Absprache zwischen den beteiligten Kollegen<br />
und Kolleginnen etc.) gerecht wird.<br />
2
Dieses Konzept wurde vom Fonds der Chemischen Industrie auch in finanzieller Hinsicht<br />
als förderungswürdig erachtet, so dass die für dieses Projekt notwendigen Anschaffungen<br />
(Experimentiermaterial, Chemikalien etc.) getätigt werden konnten.<br />
4. Schwerpunkt der Evaluation<br />
Die von diesem Ausschuss zu überprüfenden Maßnahmen wurden im Schulprogramm unter der<br />
Überschrift „Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung“ aufgeführt, was bedeutet,<br />
dass diese Maßnahmen zum Zeitpunkt der Erstellung des Programms geeignet erschienen,<br />
zur Förderung der math.-nat. Bildung beizutragen. Vor diesem Hintergrund kann es also nicht ausreichend<br />
sein, allein den Stand der Umsetzung darzustellen, sondern vielmehr muss der Frage<br />
nachgegangen werden, ob die bereits umgesetzten Maßnahmen tatsächlich dazu beitragen, das<br />
explizit genannte Ziel (Förderung...) zu erreichen.<br />
In diesem Sinne hat der Evaluationsausschuss den Beschluss gefasst, die Wirksamkeit der Verstärkungsstunde<br />
im Chemieunterricht mittels eines Schülerfragebogens zu untersuchen.<br />
Zielsetzung dieses Fragebogens war es zum einen, das Interesse der Schülerinnen und Schüler<br />
an naturwissenschaftlichen Fächern insgesamt, den Stellenwert des Faches Chemie im Kanon<br />
aller Fächer sowie die Bedeutung des Experimentierens in der Jahrgangsstufe 8 im Hinblick auf<br />
Motivation und Verständnis zu untersuchen.<br />
Das Ergebnis dieses Fragebogens war überaus eindeutig. Im Folgenden einige Aussagen, zu denen<br />
die Schülerinnen und Schüler Stellung beziehen mussten, sowie die zugehörigen Anteile der<br />
Schülerinnen und Schüler, die dieser Aussage zustimmten.<br />
90 % Das Experimentieren macht mir Spaß.<br />
77 % Die wichtigsten Laborgeräte kann ich sicher handhaben.<br />
79 % Durch eigenes Experimentieren lerne ich mehr als durch Lehrerexperimente.<br />
72 % Chemie ist dann interessant, wenn mir Zusammenhänge klar werden.<br />
87 % Ich möchte auch weiterhin selbstständig experimentieren.<br />
84 % Das Experimentieren sollte in der Klasse 8 auch im 2. Halbjahr beibehalten werden.<br />
Die Ergebnisse des Fragebogens weisen eindeutig darauf hin, dass die Stärkung des selbstständigen<br />
Experimentierens ein probates Mittel ist, die experimentellen Fertigkeiten der Schülerinnen<br />
und Schüler zu stärken, ihre Motivation zu erhöhen sowie das Verständnis für die inhaltlichen Zusammenhänge<br />
zu verbessern. Es ist somit in besonderer Weise geeignet, zur „Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Bildung“ beizutragen.<br />
5. Konsequenzen für die weitere Arbeit<br />
Auf der Basis der hier vorgestellten Ergebnisse kann man für die Weiterentwicklung im Wesentlichen<br />
drei zentrale Arbeitsfelder benennen.<br />
Experimentalunterricht / Arbeitsgemeinschaften<br />
Im Rahmen des Nachmittagsangebotes soll eine weitere naturwissenschaftliche Wettbewerbs-AG<br />
mit dem Schwerpunkt biologisch-chemischer Wettbewerbe eingerichtet werden.<br />
Das erfolgreiche Konzept des Experimentalunterrichts Chemie in der Jahrgangsstufe 8 sollte auch<br />
auf das zweite Halbjahr ausgeweitet werden. Der gemeinsame Antrag der Fachschaft Chemie und<br />
des Evaluationsausschusses liegt der Schulleitung bereits vor.<br />
3
Methodisch-inhaltlich-konzeptionelle Verzahnung der Arbeit im FB III<br />
Auf der Basis der bereits erstellten Synopse unterrichtlicher Inhalte sollen im Rahmen des Normenausschusses<br />
konkrete Vorschläge zur Vereinheitlichung der Verwendung von Begriffen, Modellen<br />
und Methoden erarbeitet werden.<br />
Naturwissenschaftlicher Zweig am GP<br />
Im Zuge der Umstellung des neunjährigen gymnasialen Bildungsgangs auf acht Schuljahre soll der<br />
Wahlpflichtunterricht, der bisher in der Jahrgangsstufe 9 erteilt wird, an Bedeutung gewinnen und<br />
als naturwissenschaftlicher Schwerpunkt gleichberechtigt neben dem sprachlichen Schwerpunkt<br />
ausgebaut werden.<br />
Dieser Beschluss der Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz erfordert vom FB III ein hohes<br />
Maß eigenständiger konzeptioneller und curricularer Arbeit, die im Laufe des kommenden Schuljahres<br />
erbracht werden muss. Neben den bereits oben genannten Entwicklungsfeldern ist dieser<br />
Aspekt für die Weiterentwicklung des Gymnasium Philippinum von zentraler Bedeutung.<br />
gez. Dr. Schubert<br />
II. Bericht der Arbeitsgruppe „Formen des Lernens“<br />
1. Vorhaben im Schulprogramm<br />
Im Schulprogramm 2002 wurden für die Weiterentwicklung des Bereichs Methodenkompetenz und<br />
Methodenlernen folgende Schwerpunkte festgelegt:<br />
• Durchführung von Päd. Tagen zum Thema „Methodenkompetenz“<br />
• Sammlung angestrebter methodischer Kompetenzen der SchülerInnen<br />
• Verschriftlichung vorhandener Projekte<br />
• Neue Organisation der Projekttage<br />
2. Umsetzungsprozess<br />
Im Bereich Methodenkompetenz sind folgende Maßnahmen bereits umgesetzt und folgende Vorhaben<br />
realisiert worden:<br />
• Am 27./28. Februar 2003 fand ein Pädagogischer Tag statt zum Thema „ Pisa und die Folgen“<br />
unter besonderer Berücksichtigung der Methodenkompetenz.<br />
• Die Organisation der Projekttage vom 14.10-17.10.03 wurde überdacht und z. T. neu gestaltet<br />
(Planung der Projekttage durch einen Ausschuss von Eltern Lehrerinnen und Lehrern,<br />
Schülerinnen und Schülern; Festlegung der Projektthemen für die einzelnen Jahrgangsstufen;<br />
Beachtung der Belastung der Klassenlehrer/innen, Berücksichtigung der Zusammenarbeit<br />
mit Klassenlehrerinnen und -lehrern in neu zusammengesetzten Klassen).<br />
• In diesem Zusammenhang wurden die Projekte „Lernen lernen“ in der Jgst. 5 und die naturwissenschaftliche<br />
Stationenarbeit in der Jgst.7 wiederholt durchgeführt und positiv bewertet.<br />
• Entwicklung von Präsentationstechniken in der Jgst.7 durch den IKG-Unterricht (Power<br />
Point);<br />
• Vertiefung von Präsentationstechniken in der Jgst.9 durch Angebot einer Kleingruppen-AG<br />
(ca. 10 Std.) zum Thema „Rhetorik und Kommunikation“ für alle Schüler/innen der Jgst. im<br />
4
1. Halbjahr 03/04, die von ca 80% der Schüler/innen wahrgenommen und sehr positiv bewertet<br />
wurde (dieses Angebot kann jedoch nicht fortgeführt werden);<br />
• Vertiefung von Präsentationstechniken in der Jgst.11 im Fach POWi (Präsentation und Simulationsarbeiten);<br />
• Arbeit mit neuen Medien: Nutzung des Lernorts ’Staatsarchiv Marburg’ durch Geschichtsleistungskurse<br />
der Jgst.12/13 (Arbeit mit Originaldokumenten / digitalisierten Dokumenten);<br />
• Entwicklung des IT-Lehrplans Geschichte.<br />
3. Evaluationsmaßnahmen und Ergebnisse<br />
Am 13.1.04 konstituierte sich eine Arbeitsgruppe „Formen des Lernens“, die die Aufgabe hat, hinsichtlich<br />
der Methodenkompetenz der Lehrer/innen (Einsatz von Unterrichtsmethoden, v. a. offene<br />
Lernformen) und der Schüler/innen (Lern- und Arbeitstechniken) das bisher Geleistete zu evaluieren<br />
und weiter zu entwickeln. In den Arbeitssitzungen am 13.1.04, 18.3.04 und 1.7.04 wurden die<br />
folgenden Ergebnisse erarbeitet und der vorliegende Bericht verabschiedet.<br />
Hinsichtlich der unterrichtsrelevanten Methodenkompetenz der Lehrer/innen und der allgemeinen<br />
Methodenkompetenz der Schüler/innen wurde der Stand der Dinge durch 2 Fragebögen ermittelt,<br />
die durch die Fachschaften bzw. von jedem/r Kollegen/Kollegin beantwortet werden sollten.<br />
Die Auswertung der Fragebögen erfolgte durch den Ausschuss am 18.3.04 und ergab folgende<br />
Ergebnisse:<br />
Von den an das Kollegium ausgegebenen Fragebögen wurde ca. 1/3 beantwortet zurückgegeben.<br />
Die an die Fachschaften ausgegebenen Fragebögen wurden fast alle bearbeitet.<br />
Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten:<br />
a) Methodenkompetenz der Lehrer/innen:<br />
Im Unterricht kommt eine Vielfalt von Methoden zum Einsatz. In den letzten Jahren werden verstärkt<br />
neue Methoden v. a. offene Lernformen ausprobiert und eingesetzt; die Erfahrungen damit<br />
sind im wesentlichen positiv, wobei die Behinderung durch die Rahmenbedingungen als erheblich<br />
wahrgenommen werden. Dazu gehören die Klassengrößen sowie die Einzelstunden, die die Umsetzung<br />
von aufwendigeren Methoden erschweren, wenn nicht gar verhindern.<br />
Der Wunsch der Kolleg/innen nach Erweiterung der eigenen Methodenkompetenz und nach Möglichkeiten<br />
zum intensiven Austausch von Erfahrungen im Umgang mit Methoden zeigt die Bereitschaft<br />
zur Innovation und Weiterentwicklung und sollte in der Zukunft angemessen berücksichtigt<br />
werden, z.B. in schulinternen Fortbildungen der Fachschaften zu diesem Thema.<br />
b) Methodenkompetenz der Schüler/innen<br />
Die Fachschaften sehen keine Notwendigkeit über die Festlegungen durch die Lehrpläne hinaus<br />
weitere Fixierungen zu treffen.<br />
Die Kolleg/innen waren sich dennoch einig, dass die methodischen Kompetenzen der Schüler/innen<br />
weiterentwickelt werden müssen, vor allem gezielter und systematischer.<br />
Als Möglichkeiten der Umsetzung ergeben sich die Festlegung von Methodenschwerpunkten für<br />
die einzelnen Jgst., damit fächerübergreifend methodisches Arbeiten bzw. Arbeits- und Lerntechniken<br />
gefördert werden können.<br />
Diese sollten von den Fachlehrern einer Jgst. zusammen festgelegt werden.<br />
4. Konsequenzen für die weitere Arbeit<br />
Für die weitere Arbeit bedeuten diese Evaluationsergebnisse:<br />
Der im Februar 2002 durchgeführte Pädagogische Tag kann nur als ein erster Schritt zur Auseinandersetzung<br />
mit dem Thema Methodenkompetenz verstanden werden. Hier bedarf es der Weiterentwicklung.<br />
Konkret bedeutet dies:<br />
5
o weitere Fortbildungsveranstaltungen der Fachschaften, Fachkonferenzen zum Erfahrungs- und<br />
Materialaustausch hinsichtlich der Methodenkompetenz der Kollegen und Kolleginnen sind<br />
notwendig;<br />
o die Rahmenbedingungen für die Umsetzung offener Lernformen müssen günstiger gestaltet<br />
werden, d.h. Suche nach Lösungsmöglichkeiten;<br />
o Durchführung von Jahrgangskonferenzen zur gemeinsamen Festlegung und kontinuierlichen<br />
Umsetzung von methodischen Lernzielen;<br />
o systematische Fortführung der Ansätze zum Erlernen und Vertiefen der Präsentationstechniken<br />
und Verankerung im Curriculum;<br />
in diesem Zusammenhang verbindliche Festschreibung der Vermittlung von Präsentationstechniken<br />
in der Jgst. 11 im Fach Deutsch in Absprache mit den anderen Fachlehrern/lehrerinnen,<br />
kombiniert mit der Auflage, dass jede/r Schüler/in eine Präsentation in einem beliebigen<br />
Fach in der Jgst. 11 erstellen muss;<br />
o feste Einrichtung des Projekts „Lernen lernen“ in der Jgst. 5 (im Rahmen der Projekttage) und<br />
weitere Vertiefung dieses Themas im Unterricht (z.B. in der Klassenlehrerstunde;<br />
o die an der Schule durchgeführten Projekte (Sylt-Projekt, Ski-Fahrt der Jgst. 8) müssen verbindlich<br />
im Unterricht verankert werden. Dazu ist eine Verschriftlichung weiter notwendig;<br />
o die Organisation der nächsten Projekttage sollte auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen<br />
erfolgen (beibehalten werden sollten auf Grund der positiven Erfahrungen das Projekt<br />
„Lernen lernen“ in der Jgst. 5 sowie das naturwissenschaftliche Projekt in der Jgst. 7, das mit<br />
einem spezifischen Thema in Stationen organisiert wird);hierzu muss eine neue Arbeitsgruppe<br />
eingesetzt werden;<br />
o Nutzung des IT-Lehrplans Geschichte im Unterricht<br />
o Entwicklung des IT-Lehrplans Politik<br />
o die zunehmende Arbeit mit neuen Medien und die Betonung von Präsentationstechniken erfordern<br />
die entsprechende Ausstattung der Fach- bzw. Klassenräume.<br />
gez. Klamberg<br />
III. Bericht der Arbeitsgruppe „Außerunterrichtliche Angebote (Verlässliches Nachmittagsangebot“<br />
1. Vorhaben im Schulprogramm<br />
Um den berufstätigen Eltern entgegenzukommen und allen interessierten jüngeren Schülern/Schülerinnen<br />
eine pädagogisch sinnvolle Nachmittagsgestaltung zu offerieren, bietet das Philippinum<br />
ab dem Schuljahr 2002/2003 ein sog. „Verlässliches Nachmittagsangebot“ an.<br />
Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 bis 7, die von dem Nachmittagsangebot der Schule<br />
Gebrauch machen wollen, nehmen nach einer gemeinsamen warmen Mahlzeit im Schulcafé<br />
(13.05 Uhr - 13.30 Uhr) entweder<br />
a) nur an einer Hausaufgabenbetreuung (Mo - Do, 13.30 - 15.00 Uhr) oder<br />
b) an wechselnden Arbeitsgemeinschaften (Mo - Fr, 13.30 - 15.00 Uhr) und anschließend<br />
auf Wunsch an einer Hausaufgabenbetreuung (Mo - Do, 15.00 - 16.30 Uhr) teil.<br />
6
Den Eltern ist es freigestellt, an welchen Tagen ihre Kinder Angebot a) oder b) wahrnehmen; für<br />
die Planung ist aber eine verbindliche Anmeldung zu Beginn des Halbjahrs nötig.<br />
Das Mittagessen muss im Voraus bestellt und bezahlt werden.<br />
Die Arbeitsgemeinschaften (Musical, Chemie, Basketball, Chor, Fußball, Leichtathletik; Computer,<br />
Tischtennis, Tanz, Kunst, Erdkunde) und die Hausaufgabenbetreuung werden von Oberstufenschülern/-schülerinnen,<br />
Lehrern/Lehrerinnen, Eltern oder freien Mitarbeitern/-arbeiterinnen geleitet,<br />
die – mit Ausnahme der Lehrer/innen – dafür ein Honorar erhalten.<br />
2. Stand der Umsetzung<br />
Das Nachmittagsangebot ist inzwischen ein fest institutionalisierter Bestandteil des schulischen<br />
Lebens. Die überwiegende Mehrzahl unserer Schülerinnen und Schüler nehmen an einem oder an<br />
mehreren Angeboten teil. Sie sind mit der Atmosphäre, dem Lernangebot und den Leiter/innen<br />
zufrieden. 2/3 aller befragten Schüler/innen werden auch weiterhin an ihrer AG teilnehmen wollen,<br />
ein Drittel ist noch unschlüssig. Von 400 befragten Schülern und Schülerinnen wollen nur 9 keine<br />
AG mehr auswählen.<br />
Die Schwerpunkte Förderung schwächerer Schüler/innen (Stützkurse, Hausaufgabenbetreuung)<br />
als auch Neigungs- und Begabtenförderung (Arbeitsgemeinschaften verschiedenster Art) bilden<br />
das Fundament des Nachmittagsangebots.<br />
3. Schwierigkeiten und Probleme<br />
Gruppengröße: 15% der befragten Schüler/innen fanden ihre Gruppe zu groß.<br />
Material: Zum Teil wurde die materielle Ausstattung kritisiert (für den Computerunterricht wünschen<br />
sich die Schüler/innen schnellere Computer mit Flachbildschirmen, Tonboxen und CD-Rom-<br />
Laufwerken; für Chemie sollten Bunsenbrenner angeschafft werden; im Sport mangelt es an Tischtennisplatten<br />
und Tennisschlägern. Die Förderkurse würden gerne Filme über lateinische Sprache,<br />
Vokabeltrainer und Computerlernprogramme anschaffen. Die Musik-AGs benötigen Notenständer,<br />
Ersatzteile für Instrumente, neue Instrumente. Die Theater-AG braucht Kostüme und Requisiten.).<br />
Organisation: Die Leiter/innen der AGs wünschen sich mehr Unterstützung durch Eltern, Lehrer/innen<br />
und die Schulleitung. Sie würden gerne an Fortbildungen teilnehmen.<br />
Disziplinprobleme gibt es v.a. in der Hausaufgabenbetreuung: Die Schüler/innen sind mit dem<br />
Verhalten einzelner Teilnehmer/innen überfordert. Es gelingt ihnen nur schwer, Ruhe und Disziplin<br />
herzustellen.<br />
Probleme treten auf, wenn Schüler/innen während des Halbjahres aus der AG austreten wollen,<br />
obwohl die Teilnahme bis zum Ende des Schuljahres verpflichtend ist.<br />
Die Hallenkapazität reicht bei weitem nicht aus, um die gewünschten Sport-AGs durchzuführen.<br />
4. Ergebnisse<br />
Ergebnisse in Stützkursen und Hausaufgabengruppen vorzuweisen, ist nicht möglich.<br />
Die Ergebnisse aus den AGs wurden in Konzerten Theater-, Musicalaufführungen und mit Präsentationen<br />
am „Tag der offenen Tür“ vorgestellt.<br />
Als Erfolgsbescheinigung erhalten die Schüler/innen am Ende des Halbjahres – am Ende der AG –<br />
bei erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat oder einen Vermerk im Zeugnis.<br />
Als wichtigste Ergebnisse können angeführt werden, dass die überwältigende Mehrzahl der Schüler/innen<br />
gern in ihre AG geht und sich darin wohl fühlt und die Qualität und die Anforderungen den<br />
Erwartungen der Schüler/innen entsprechen und sie auch weiterhin am Nachmittagsangebot teilnehmen<br />
wollen.<br />
7
Die Anzahl der Stützkurse ist im Verlauf des Schuljahres erhöht worden, da die Nachfrage stieg.<br />
5. Überprüfung/Evaluierung der Ergebnisse<br />
Es wurden zwei Arten von Fragebögen (einmal für Leiter/innen, einmal für Schüler/innen) entwickelt,<br />
die die Atmosphäre, die Organisation und die Inhalte der einzelnen Nachmittagsangebote<br />
zum Thema hatten. Die Auswertung wurde durch die Arbeitsgruppe Nachmittagsangebot durchgeführt,<br />
und ihre Ergebnisse sind in diesen Bericht eingeflossen.<br />
6. Konsequenzen für die weitere Arbeit<br />
Wir werden versuchen, die geäußerten Materialwünsche so weit wie möglich zu erfüllen.<br />
Die AGs, die von den Schülern und Schülerinnen erfragt werden, versuchen wir im nächsten Jahr<br />
anzubieten, wenn wir die personellen und räumlichen Voraussetzungen dafür schaffen können:<br />
Töpfern, Werken, Mädchenfußball, Koch-AG.<br />
Unserem Wunsch nach mehr Lehrerstunden konnte bisher noch nicht entsprochen werden.<br />
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Nachmittagsangebots werden<br />
wir zu verstärken versuchen. Wir wollen sie noch besser unterstützen, v.a. die Leiter/innen der<br />
Hausaufgabenbetreuung, die mit ihren disziplinären Problemen überfordert sein können. Vorbereitende<br />
und die Betreuung begleitende Sitzungen zwischen Lehrern/Lehrerinnen und Schülern/<br />
Schülerinnen – ständige Kommunikation und regelmäßige monatliche Treffen, in denen Probleme<br />
besprochen werden -, sollen die Probleme mindern.<br />
Das Verlangen der Leiter/innen der Nachmittagsveranstaltungen nach Fortbildungsmöglichkeiten<br />
wollen wir ernst nehmen und an die entsprechenden Stellen dem Schulamt weiterleiten. Besonders<br />
für die jugendlichen Leiter/innen soll professionelle Hilfe angeboten werden. Wir wollen versuchen,<br />
solche Fortbildungen finanziell zu unterstützen.<br />
Die Zusammenarbeit mit TC und Musikschule soll fortgesetzt werden.<br />
Sind AGs oder Stützkurse zu groß, sollen sie geteilt und neue Leiter/innen verpflichtet werden.<br />
Materialkosten in diesem Schuljahr werden ausgegeben für die Anschaffung einer Tuba (Blechbläser-AG),<br />
Materialien im naturwissenschaftlichen Bereich (Chemie- und Bio-AG), Arbeitsmaterialien<br />
für Stützkurse, (v. a. Latein- Stützkurs), Basketballkörbe im Außenbereich der Schule und neue<br />
Bälle (Basketball-AG) sowie für Regale für die Bibliothek (AG Selbständiges Arbeiten).<br />
Wir wollen in naher Zukunft unsere Vorstellungen darüber entwickeln, wie im Rahmen der Neuorganisation<br />
der G8 Schule das Nachmittagsprogramm sinnvoll integriert werden kann. Ziel ist es,<br />
auch unter veränderten Bedingungen ein attraktives Angebot erhalten zu können.<br />
gez. L. Dingel<br />
IV. Bericht der Evaluationsgruppe „Schule als Arbeits-, Lern-, und Lebensraum“<br />
1. Abgrenzung des Evaluationsgegenstandes und Beschreibung der Lage in defizitären<br />
Bereichen<br />
8
Die Weite des Themas machte eine Konzentration auf ausgewählte Bereiche und Schwerpunktsetzung<br />
dort erforderlich, wo tatsächlich Veränderungen erreicht worden sind. In anderen Bereichen<br />
konnte nur eine Situationsbeschreibung vorgenommen und ggf. Handlungsbedarf signalisiert<br />
werden.<br />
Der dynamischste Bereich ist zur Zeit die Schülerbibliothek, weil sich hier eine Arbeitsgruppe aus<br />
Schülern, Eltern und Lehrern konstituiert hat, die konkrete Entwicklungsschritte in die Wege geleitet<br />
und in die Zukunft reichende Konzeptionen entwickelt hat. Auf sie wird unten ausführlicher eingegangen.<br />
Der federführend von der Schulleitung betriebene Aufbau eines Mensabereichs und Medienzentrums<br />
wurde von der Evaluationsgruppe nicht in ihre Arbeit einbezogen. Hier sind weit reichende<br />
Planungen im Gang.<br />
Nach einer Phase intensiver Aktivität und eines erheblichen Mitteleinsatzes vonseiten der Stadt<br />
Marburg ist im Bereich des Außengeländes und der Spiel- und Sportgeräte eine erhebliche Verbesserung<br />
der Gesamtsituation erreicht worden (zweites Fußballtor muss aufgestellt werden!),<br />
inzwischen allerdings auch eine Beruhigung der Entwicklungsdynamik eingetreten.<br />
Wenig oder gar nichts an positiven Entwicklungen hat es in folgenden Bereichen gegeben: Fachräume<br />
(z. T. erste Ansätze, z. B. PoWi, Handlungsbedarf, v. a. vonseiten der Fachschaften und<br />
der Schulleitung), Innenhof (trostlose Betonwüste trotz zurückliegender Initiativen zur künstlerischen<br />
und farblichen Gestaltung), Ruheräume (Mitbenutzung als Lager- und Materialraum), Pausenhalle<br />
(Überfrachtung mit Plakaten, nicht aktualisierte Vitrinen, Photowand), Treppenhäuser,<br />
Flure (positiv hier die Begrünung durch Einzelinitiative eines Kollegen), Klassenräume (trostlos,<br />
sehr eng, kein Mobiliar, kaum Kunst, Schülerarbeiten, Pflanzen etc.).<br />
Insgesamt wirkt der bauliche Zustand vernachlässigt bis heruntergekommen. Eine grundlegende<br />
Renovierung ist dringendes Desiderat. Darüber hinaus wäre durch Präsentation von Schülerarbeiten<br />
und Kunstobjekten eine wesentliche Verbesserung ohne allzu großen Mitteleinsatz (eventuell<br />
für Vitrinen) zu erreichen (eine Initiative in den Fluren des Hauptgebäudes hat mangels konservatorischer<br />
Maßnahmen keine Nachhaltigkeit erreicht).<br />
2. Bestandsaufnahme Schülerbibliothek und Maßnahmen<br />
Die dem Schulprogramm zugrunde liegende Beurteilung der Ausgangslage erwies sich bei näherer<br />
Betrachtung durch die Arbeits- und die Evaluationsgruppe als viel zu optimistisch. Zwar war ein<br />
mit Büchern gefüllter Raum von erheblicher Größe vorhanden, doch die Bestände waren veraltet,<br />
aleatorisch, kaum genutzt.<br />
Als Konsequenz wurde, vor allem in Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, das<br />
Vorhaben der Reorganisation und Aktualisierung der Gesamtbibliothek zurückgestellt. Stattdessen<br />
fiel die Entscheidung für einen Primat der Unterstufenbibliothek mit dem Ziel, von unten her eine<br />
Lesekultur durch gezielte Maßnahmen der Leseförderung und -sozialisation aufzubauen. Fernziel<br />
bleibt der Aufbau einer Gesamtbibliothek für Schüler/innen und Lehrer/innen. Positiv ist hervorzuheben,<br />
dass die Arbeitsgruppe Unterstützung durch Heranziehung außerschulischer Kompetenz<br />
suchte (Zusammenarbeit mit erfolgreichen Schülerbibliotheken und Leseprojekten anderer Schulen)<br />
sowie finanzielle Unterstützung durch Förderverein und Mittelzuweisung aus dem Nachmittagsangebot<br />
(vorerst ca. 6000 Euro) erhielt.<br />
3. Schwierigkeiten<br />
Probleme ergeben sich neben den begrenzten Mitteln durch Blockierung des zweiten Raumes<br />
durch ausgesonderte Buchbestände der Schülerbibliothek sowie ausgelagerte Bestände der historischen<br />
Lehrerbibliothek (Empfehlung: Veräußerung oder Umlagerung). Auch die gleichzeitige Nutzung<br />
der Räume durch die Hausaufgabenbetreuung erscheint untunlich. Eine Bibliothekskraft ist<br />
9
derzeit nicht finanzierbar (Konsequenz u. a. : eingeschränkte Öffnungszeiten). Desgleichen fehlen<br />
Mittel für Gestaltung der Innenarchitektur. Der Termin für die Antragstellung wurde in der Übergangssituation<br />
bei der Schulleitung leider verpasst. Die Stadt trägt aber die Kosten für Umbau und<br />
Renovierung sowie Verbindung von K14 und K15.<br />
4. Ergebnisse<br />
Räumliche Voraussetzungen geschaffen, Raumkonzept entwickelt, PC-Ausstattung vorhanden,<br />
Buchanschaffungen im Wert von 2500 Euro getätigt, Logowettbewerb läuft, „Leselümmelpodest“<br />
im Bau, für Münzkopiergerät wird Finanzierungsmöglichkeit gesucht.<br />
5. Evaluationsmethoden<br />
Befragung der Arbeitsgruppe, Fragebogen der Arbeitsgruppe, Begehungen des Gebäudes und<br />
des Geländes, Auswertung der Dokumentation zur Anschaffung von Spielgeräten.<br />
6. Weitere Arbeit<br />
Die Arbeitsgruppe Schülerbibliothek plant ein Eröffnungsfest (im Herbst), Publikation in den Medien,<br />
Maßnahmen zur Aktivierung der Benutzer, z. B. Schulung von Oberstufenschülern zu Bibliotheksassistenten<br />
und Nachmittagsangebote in der Bibliothek („Philosophie für Kids“, „Schmökerstunde“,<br />
Autorenlesungen, Lesenächte u. a.). Es wäre wünschenswert, wenn sich weitere Arbeitsgruppen<br />
den oben genannten Desiderata zuwenden würden, insbesondere der Gestaltung von<br />
Pausenhalle, Innenhof und Fluren. Auch hier wäre die Kontaktaufnahme mit anderen Schulen, die<br />
bereits erhebliche Verbesserungen erzielt haben, zu empfehlen. Sinnvoll erscheint vor allem eine<br />
Aktivierung der Schüler/innen über Klassen- und Kunstprojekte, um Problembewusstsein zu erzeugen<br />
und Impulse zur eigentätigen Verbesserung des Arbeits- Lern- und Lebensraums Philippinum<br />
zu erreichen.<br />
gez. Dr. Becht-Jördens<br />
V. Bericht der Arbeitsgruppe „Förderung der Mehrsprachigkeit durch vernetztes<br />
Sprachenlernen“<br />
1. Vorhaben im Schulprogramm<br />
Im Schulprogramm des Gymnasium Philippinum ist die Förderung der Mehrsprachigkeit durch vernetztes<br />
Sprachenlernen von zentraler Bedeutung. Als z. T. längerfristige Ziele und Maßnahmen<br />
figurieren:<br />
• Erstellung und Erprobung von Lehr- und Lernmaterial, das gemeinsame Wortstämme des Englischen,<br />
Französischen und Lateinischen deutlich macht<br />
• Vereinheitlichung der grammatischen Terminologie<br />
• Sichtung von erfolgreichen Unterrichtsprojekten<br />
• Einrichtung einer „Vernetzungskommission“ aus je einem Vertreter der Fächer Latein, Deutsch,<br />
Englisch, Französisch, Griechisch<br />
• Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen<br />
10
2. Stand der Umsetzung und Ergebnisse<br />
Auf dem Weg zur Umsetzung der im Schulprogramm fixierten Ziele / Maßnahmen sind erste Ergebnisse<br />
erreicht. So konnten auf der konstituierenden Sitzung der AG am 25.2.2004 zahlreiche<br />
Materialien zu Unterrichtsprojekten aus den Fächern Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch<br />
zusammengetragen werden, mit denen „vernetztes Lernen“ bereits erfolgreich praktiziert<br />
wurde.<br />
„Konkordanzen“ der im Latein-, Englisch- und Französischunterricht benutzten Lehrbücher für die<br />
Verknüpfung des französischen Wortschatzes mit dem lateinischen sowie des englischen mit dem<br />
lateinischen liegen für einzelne Klassenstufen vor, Arbeitsaufträge für die Weiterarbeit sind erteilt.<br />
Dabei sollen auch die Sprachen Spanisch und Italienisch einbezogen werden.<br />
Arbeitsblätter, die die Kenntnis der jeweiligen lateinischen Ursprungswörter überprüfen, sind für<br />
das Lehrwerk G 2000, A1 bis zu Unit 1 fertig gestellt.<br />
Die Fachkonferenz Latein hat sich auf ein verbindliches Farbmodell zum Unterstreichen der Satzteile<br />
geeinigt, das zunächst mit der Fachkonferenz Deutsch abgestimmt werden soll. Eine Synopse<br />
der im Unterricht beider Fächer verwendeten grammatikalischen Termini ist in Arbeit.<br />
3. Schwierigkeiten und Probleme<br />
Durch die unterschiedlichen Lerngegenstände der neu- und altsprachlichen Lehrbücher ist ein Parallelwortschatz<br />
nur selten gegeben. Synergieeffekte sind weiterhin lediglich eingeschränkt nutzbar,<br />
weil sich vor allem viele romanische Wörter aus dem Vulgär- bzw. Mittellatein herleiten.<br />
Ein Evaluationsplan konnte noch nicht entwickelt werden, weil die Arbeitskraft vieler Kolleginnen<br />
und Kollegen durch die Beschäftigung mit den neuen G8-Lehrplänen und den Konsequenzen der<br />
Schulzeitverkürzung für die Sprachenfolge am Gymnasium Philippinum stark in Anspruch genommen<br />
wurde.<br />
4. Perspektiven für die Weiterarbeit<br />
Im neuen Schuljahr sollen zunächst die o. g. Vokabellisten komplettiert und in Hinsicht auf deren<br />
Relevanz für das Erlernen der jeweiligen Wörter in den modernen Sprachen überprüft werden.<br />
Reliable Verfahren und Instrumente zur Erfolgsmessung sind zu entwickeln.<br />
Im Hinblick auf einen Schulversuch „Zwei Fremdsprachen in der Jahrgangsstufe 5“ müssen darüber<br />
hinaus Lerngegenstände und Arbeitstechniken des Latein- und Englischunterrichts koordiniert<br />
werden. Die Erfahrungen anderer Schulen („Biberacher Modell“) sollten dabei genutzt werden.<br />
Die Abstimmung der grammatischen Terminologie muss durch eine „Vernetzungskommission“ auf<br />
alle sprachlichen Fächer ausgeweitet werden.<br />
gez. Danielmeyer / Kramer<br />
11