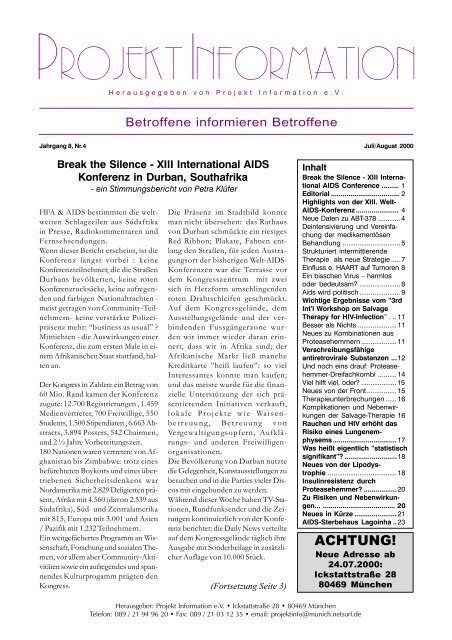Projekt Information eV
Projekt Information eV
Projekt Information eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
PROJEKT INFORMATION<br />
H e r a u s g e g e b e n v o n P r o j e k t I n f o r m a t i o n e . V .<br />
Betroffene informieren Betroffene<br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
Break the Silence - XIII International AIDS<br />
Konferenz in Durban, Southafrika<br />
- ein Stimmungsbericht von Petra Klüfer<br />
FIFA & AIDS bestimmten die weltweiten<br />
Schlagzeilen aus Südafrika<br />
in Presse, Radiokommentaren und<br />
Fernsehsendungen.<br />
Wenn dieser Bericht erscheint, ist die<br />
Konferenz längst vorbei : keine<br />
Konferenzteilnehmer, die die Straßen<br />
Durbans bevölkerten, keine roten<br />
Konferenzrucksäcke, keine aufregenden<br />
und farbigen Nationaltrachten -<br />
meist getragen von Community-Teilnehmern-<br />
keine verstärkte Polizeipräsenz<br />
mehr: “business as usual” ?<br />
Mitnichten - die Auswirkungen einer<br />
Konferenz, die zum ersten Male in einem<br />
Afrikanischen Staat stattfand, halten<br />
an.<br />
Der Kongress in Zahlen: ein Betrag von<br />
60 Mio. Rand kamen der Konferenz<br />
zugute: 12.700 Registrierungen , 1.459<br />
Medienvertreter, 700 Freiwillige, 550<br />
Students, 1.500 Stipendiaten , 6.663 Abstracts,<br />
3.894 Posters, 542 Chairmen,<br />
und 2 ½ Jahre Vorbereitungszeit.<br />
180 Nationen waren vertreten: von Afghanistan<br />
bis Zimbabwe: trotz eines<br />
befürchteten Boykotts und eines übertriebenen<br />
Sicherheitsdenkens war<br />
Nordamerika mit 2.829 Deligierten präsent,<br />
Afrika mit 4.560 (davon 2.539 aus<br />
Südafrika), Süd- und Zentralamerika<br />
mit 815, Europa mit 3.001 und Asien<br />
/ Pazifik mit 1.232 Teilnehmern.<br />
Ein weitgefächertes Programm an Wissenschaft,<br />
Forschung und sozialen Themen,<br />
vor allem aber Community-Aktivitäten<br />
sowie ein aufregendes und spannendes<br />
Kulturprogamm prägten den<br />
Kongress.<br />
Die Präsenz im Stadtbild konnte<br />
man nicht übersehen: das Rathaus<br />
von Durban schmückte ein riesiges<br />
Red Ribbon; Plakate, Fahnen entlang<br />
den Straßen, für jeden Austragungsort<br />
der bisherigen Welt-AIDS-<br />
Konferenzen war die Terrasse vor<br />
dem Kongresszentrum mit zwei<br />
sich in Herzform umschlingenden<br />
roten Drahtschleifen geschmückt.<br />
Auf dem Kongressgelände, dem<br />
Ausstellungsgelände und der verbindenden<br />
Fussgängerzone wurden<br />
wir immer wieder daran erinnert,<br />
dass wir in Afrika sind; der<br />
Afrikanische Markt ließ manche<br />
Kreditkarte ”heiß laufen”: so viel<br />
Interessantes konnte man kaufen;<br />
und das meiste wurde für die finanzielle<br />
Unterstützung der sich präsentierenden<br />
Initiativen verkauft,<br />
lokale <strong>Projekt</strong>e wie Waisenbetreuung,<br />
Betreuung von<br />
Vergewaltigungsopfern, Aufklärungs-<br />
und anderen Freiwilligenorganisationen.<br />
Die Bevölkerung von Durban nutzte<br />
die Gelegenheit, Kunstausstellungen zu<br />
besuchen und in die Parties vieler Discos<br />
mit eingebunden zu werden.<br />
Während dieser Woche haben TV-Stationen,<br />
Rundfunksender und die Zeitungen<br />
kontinuierlich von der Konferenz<br />
berichtet: die Daily News verteilte<br />
auf dem Kongressgelände täglich ihre<br />
Ausgabe mit Sonderbeilage in zusätzlicher<br />
Auflage von 10.000 Stück.<br />
(Fortsetzung Seite 3)<br />
Inhalt<br />
Break the Silence - XIII International<br />
AIDS Conference ......... 1<br />
Editorial ................................... 2<br />
Highlights von der XIII. Welt-<br />
AIDS-Konferenz ...................... 4<br />
Neue Daten zu ABT-378 ............ 4<br />
Deintensivierung und Vereinfachung<br />
der medikamentösen<br />
Behandlung ............................... 5<br />
Strukturiert intermittierende<br />
Therapie als neue Strategie ..... 7<br />
Einfluss e. HAART auf Tumoren 8<br />
Ein bisschen Virus – harmlos<br />
oder bedeutsam? ...................... 8<br />
Aids wird politisch ...................... 9<br />
Wichtige Ergebnisse vom ”3rd<br />
Int’l Workshop on Salvage<br />
Therapy for HIV-Infection” . .. 11<br />
Besser als Nichts ..................... 11<br />
Neues zu Kombinationen aus<br />
Proteasehemmern ................... 11<br />
Verschreibungsfähige<br />
antiretrovirale Substanzen ...12<br />
Und noch eins drauf: Proteasehemmer-Dreifachkombi<br />
.......... 14<br />
Viel hilft viel, oder? ................... 15<br />
Neues von der Front ................ 15<br />
Therapieunterbrechungen ...... 16<br />
Komplikationen und Nebenwirkungen<br />
der Salvage-Therapie 16<br />
Rauchen und HIV erhöht das<br />
Risiko eines Lungenemphysems<br />
.................................17<br />
Was heißt eigentlich ”statistisch<br />
signifikant”? ...........................18<br />
Neues von der Lipodystrophie<br />
..................................... 18<br />
Insulinresistenz durch<br />
Proteasehemmer? .................20<br />
Zu Risiken und Nebenwirkungen...<br />
..................................... 20<br />
Neues in Kürze ...................... 21<br />
AIDS-Sterbehaus Lagoinha ..23<br />
ACHTUNG!<br />
Neue Adresse ab<br />
24.07.2000:<br />
Ickstattstraße 28<br />
80469 München<br />
Herausgeber: <strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V. • Ickstattstraße 28 • 80469 München<br />
Telefon: 089 / 21 94 96 20 • Fax: 089 / 21 03 12 35 • email: projektinfo@munich.netsurf.de<br />
1
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Editorial<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
eine bizarre Meldung machte bereits vor der Eröffnung<br />
der 13. Internationalen AIDS-Konferenz die Runde:<br />
Thabo Mbeki, Präsident des Gastgeberlandes Südafrika,<br />
bleibt bei der These, dass das HI-Virus nicht der Auslöser<br />
für AIDS sei. Auch in der Eröffnungsrede zum Kongress<br />
bekannte er sich nicht eindeutig zu dem Zusammenhang<br />
von HIV und AIDS. Vielmehr stellte er hierbei<br />
wiederum Armut, Unterernährung, mangelnde Hygiene<br />
und andere Infektionskrankheiten in den Vordergrund.<br />
Zu allem Überfluss soll jetzt auch noch Thabo Mbeki’s<br />
AIDS-Beraterstab Studien zur Verlässlichkeit des ELISA-<br />
Testverfahrens zum Nachweis der HIV-Antikörper durchführen<br />
und die Übereinstimmung mit anderen Testverfahren<br />
prüfen. Auch das unterminiert die sowieso extrem<br />
geringe Bereitschaft in Südafrika, sich testen zu lassen.<br />
Die dringend nötige Hilfe für 4,3 Millionen HIV-<br />
Positive, z.B. zur Vermeidung der Mutter-Kind-Übertragung,<br />
ein verbesserter Zugang zu antiretroviralen Medikamenten<br />
und die Behandlung opportunistischer Infektionen<br />
wird durch diese desaströse Gesundheitspolitik<br />
noch weiter hinausgezögert; eine Verschwendung von<br />
Zeit und Resourcen. Trotz aller bedrückenden Wirrnisse,<br />
Durban ist der richtige Ort zur richtigen Zeit für die<br />
Internationale AIDS-Konferenz – wie es im Grußwort<br />
steht. Wenn auch nur für kurze Zeit ist die Katastrophe,<br />
allerdings schon lange vorhergesehen, in den Blickpunkt<br />
der Weltöffentlichkeit gerückt. Auch für andere Weltregionen,<br />
wie z.B. Russland und asiatische Länder konnte<br />
die Meldung über die explosive Epidemie im südlichen<br />
Afrika einen unüberhörbaren Alarm zum Aufwachen aus<br />
Sorglosigkeit und Ignoranz bedeuten. “Durchbrecht das<br />
Schweigen”, kein anderes Motto einer Welt-AIDS-Konferenz<br />
war je so wichtig für Änderungen der Politik im<br />
Tagungsland, für die Unterstützung durch die reichen<br />
Länder, für weitaus mehr Anstrengungen und Geld für<br />
die Erforschung von Impfstoffen und auch ein Umdenken<br />
der Pharmafirmen. Was kann Prävention in afrikanischen<br />
Ländern mit vielen Millionen von HIV-Infizierten<br />
bewirken, wo Mentalität, Religion, Aberglauben und<br />
Tradition den Gebrauch von Kondomen fast ausschließen.<br />
Anders als in Südafrika mit seiner unheilvollen<br />
Gesundheitspolitik hat aber Uganda eine beeindruckende<br />
Verminderung der Neuinfektionen erreicht, durch<br />
eine von der Regierung finanzierte, von hohen Politikern<br />
persönlich mitgetragene Aufklärung und Prävention<br />
– auch mit Kondomen. Die bisher erfolgreichen<br />
Präventionsmuster der westlichen Industrienationen können<br />
hier nur bedingt Vorbild sein. Es müssen eigene<br />
Präventionsstrategien, getragen von einer sozialen und<br />
politischen Mobilisierung, entwickelt werden. Wie sollen<br />
diese Botschaften bei dem verbreiteten Analphabetismus<br />
überhaupt ankommen? Nur massive Community-<br />
Aktivitäten auf Freiwilligenbasis, permanente Aufklärung<br />
2<br />
in Schulen und Gemeinden kann das Wissen um den<br />
eigenen Schutz und den der anderen bewirken. Langfristig<br />
kann nur so ein drohender sozialer Kollaps durch<br />
AIDS abgewendet werden. Dabei ist vor allem unsere<br />
finanzielle Unterstützung in diesem Krieg gegen AIDS<br />
erforderlich. Ich erinnere mich an AIDS-Veranstaltungen<br />
bei uns, bei denen Referenten eine Dollarnote an<br />
die Wand projezierten – Geld, das Wichtigste für Prävention<br />
und die Entwicklung wirksamer Therapien. Weil’s<br />
doch anders ist, wenn man selbst am Ort des Geschehens<br />
ist, hat die AIDS-Aktivistin Petra Klüfer aus Hamburg<br />
für uns einen Artikel aus Durban “live” verfasst.<br />
Die einen hoffen vergeblich auf Medikamente, andere<br />
möchten am liebsten eine Pause von der HAART machen.<br />
Sei es wegen gravierender Nebenwirkungen oder<br />
auch schlicht aus Überdruss vor einem Pillenschlucken<br />
für den Rest des Lebens. So war denn auch die von<br />
Anthony Fauci präsentierte Stop-and-go-Strategie, sprich<br />
strukturierte, intermittierende Behandlung eine von vielen<br />
gern gehörte Botschaft.<br />
“Off and on”, die ART wie einen Lichtschalter ein- und<br />
auszuschalten, ein verführerischer Gedanke, aber lange<br />
noch nicht ausreichend erforscht und belegt – sehr kleine<br />
Studien und wenige, bisher nicht tragfähige Daten.<br />
Aber selbst von erfahrenen Behandlern wird das Thema<br />
“Drug holidays” sehr kontrovers diskutiert. Lesen Sie dazu<br />
unseren Bericht auf Seite 7.<br />
„Ein bisschen Virus”, von manchen Patienten unter erfolgreicher<br />
HAART mit Erschrecken erlebt, berichtet<br />
darüber, was es mit den “viralen blips” auf sich hat.<br />
Auch politisch hat der Kongress in Durban Staub aufgewirbelt,<br />
die Welt-Aids-Konferenz erzwang einen<br />
Bewertungswandel. Stefan Boes bringt Ihnen die Hintergründe<br />
näher.<br />
Etwas überrascht es schon: die unzureichende<br />
Compliance soll nach einem Bericht aus Durban der<br />
grösste Risikofaktor für ein Therapieversagen sein, mehr<br />
dazu in der nächsten Ausgabe. Könnte die Therapievorbereitung<br />
der Patienten durch unsere Ärzte doch etwas<br />
zu kurz kommen? Das <strong>Information</strong>sengagement von<br />
Therapieaktivisten auch in dieser Frage wird von manchen<br />
Behandlern belächelt und als ziemlich überflüssig<br />
angesehen. Mehr zum neuen Stand der Medikamentenentwicklung<br />
und vielen anderen interessanten Ergebnissen<br />
aus Durban bereiten wir bereits für die nächste Ausgabe<br />
vor.<br />
Schwerpunktthema diesmal ist auch die Salvagetherapie.<br />
Zu wünschen ist, dass es auch in diesem eher frustrierendem<br />
Bereich bald Anlass zu mehr Hoffnung gibt.<br />
Ihr Peter Lechl
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
Natürlich sind die statistischen Zahlen mit den Prognosen,<br />
wie viele Waisenkinder zu erwarten sind,<br />
wie sich das Lebensalter bis zum Jahre 2010 in Südafrika<br />
auf 36 Jahre reduzieren wird (in Botswana<br />
z.B. auf 29) bekannt. Täglich 1.500 Neuinfektionen<br />
in Südafrika, 5.000 infizierte Babies werden jeden<br />
Monat geboren, aber meine Fantasie reicht bei weitem<br />
nicht, mir vorzustellen, dass sich hinter diesen<br />
Zahlen Leben verbirgt, ein einzelner Menschen und<br />
wahres Leiden.<br />
Am Flughafen von Johannesburg nahm mich Xolani in<br />
Empfang, eine 29jährige Frau, die vor 3 Wochen ihre<br />
Schwester beerdigt hatte. Ihre Mutter liegt mit Vollbild Aids<br />
(nach ihren Schilderungen) in einem kleinen Bergdorf 120<br />
km von Durban entfernt, nur versorgt von einer alten<br />
Heilerin. Eine medizinische Betreuung gibt es nicht. Die<br />
Tochter kann es sich finanziell nicht leisten, einen Arzt dort<br />
hinzuschicken. Wie man denn eine Infektion erkenne, war<br />
ihre Frage. Ihr Freund habe schon öfter geschwollene<br />
Lymphknoten gehabt, aber ihr gesagt, das sei normal, Realität<br />
in einem Land, das derart mit HIV und Aids konfrontiert<br />
ist, und wo doch Aufklärung und immer wieder<br />
Aufklärung betrieben wird – was läuft falsch?<br />
Etwa 2.000 der Kongressteilnehmer waren HIV-Infizierte<br />
aus aller Welt, was bereits in Genf anfing. ”Bridging the<br />
Gap” setzte sich hier verstärkt fort, war doch das erste<br />
Mal in der Geschichte der Welt-AIDS-Konferenz der Gastgeber<br />
ein afrikanisches Land.<br />
Die täglichen Ausgaben der Zeitungen waren voll mit<br />
gesundheitspolitischen Kommentaren, Berichten, Interviews<br />
und vor allem Kommentaren zu der politischen<br />
Haltung von Präsident Thabo Mbeki, der in seiner mit<br />
Spannung erwartete Eröffnungsrede seine Zuhörer enttäuschte;<br />
da er von der Theorie seiner Beratung, dass nämlich<br />
HIV kein Aids hervorrufe, nicht abwich. Für ihn ist<br />
immer noch Armut der Grund Nummer eins. Ein Südafrikaner,<br />
Lucky Mazibouki, kommentierte nach der Eröffnung,<br />
er und seine Kollegen fühlen sich verraten, verunsichert<br />
und weiterhin diskriminiert.<br />
Die Durban-Deklaration, unterzeichnet von 5.000 Wissenschaftlern,<br />
in der erklärt wird, dass eine HIV-Infektion<br />
Aids hervorruft, hätte eigentlich diese Debatte beenden<br />
sollen, um endlich die Versäumnisse der jetzigen Regierung<br />
global anzugehen.<br />
Luckys Enttäuschung wurde durch die Rede Nelson<br />
Mandelas in der Abschlussveranstaltung wieder gemildert:<br />
“Wir müssen unsere Schwierigkeiten überwinden, wir<br />
müssen jetzt handeln. AIDS hat in Afrika mehr Leben<br />
gekostet, als die Summe aller Kriegstoten, aller Hungersnöte<br />
und Überschwemmungen”.<br />
Der Chairman des Kongresses, Prof. Jerry Coovadia meinte<br />
zu Nelson Mandelas Rede: ”Es wurden so viele Fragen<br />
diplomatisch zwischen den Zeilen beantwortet: diese Rede<br />
war Musik in meinen Ohren..”. Entsprechend war das<br />
Presseecho: ”Das Haus brennt und Mr. Mbeki sitzt<br />
und rätselt, ob ein Streichholz oder ein Feuerzeug<br />
das Feuer entflammt hat.”<br />
”Ich bin hier, da ich es mir leisten kann, das Leben<br />
zu erkaufen” erklärte Richter Edward Cameron,<br />
Supreme Court Judge und Acting Judge of the<br />
Constitutional Court of Southafrika , ein bekannter<br />
schwuler Südafrikaner. Nach der Ermordung der<br />
Aidsaktivistin Gugu Dlamini in einem der nahegelegenen<br />
Townships nach einer Sitzung mit anderen<br />
Betroffenen, hat er seine Infektion öffentlich gemacht,<br />
um allen Südafrikanern zu demonstrieren, dass ganz<br />
Südafrika betroffen ist, von der weißen Upperclass bis hin<br />
zu den Ärmsten der Armen: Frauen ohne Rechte, ohne<br />
Erziehung, ohne Unterstützung von Familie und Umfeld.<br />
Die Arbeit der Internationalen Community forcierte sich<br />
auf Networking, Solidarität und Unterstützung der fast<br />
verzweifelten Versuche, den Zugang zu Therapien zu erkämpfen.<br />
Der u.a. von TAC ( Treatment Action Campaign ) initiierte<br />
Demonstrationsmarsch für billigere Medikamente –<br />
begleitet von Vertretern der Kirche, Aktivisten von<br />
NAPWA aus Südafrika, Gewerkschaftsvertretern und<br />
Winnie Mandela , spiegelte die Wut der Aktivisten wider.<br />
TAC erwägt wegen der Vorenthaltung von Therapien eine<br />
Klage gegen die Südafrikanische Regierung.<br />
Frauen Südafrikas stehen wieder in der ersten Reihe. Nach<br />
dem engagierten und erfolgreichen Einsatz gegen die<br />
Apartheid ist AIDS das Ziel: die Änderung der Rolle der<br />
Afrikanischen Frau und die Mitverantwortung für die Eindämmung<br />
der Endemie. Die geschlechtsbedingten Rollen<br />
müssen erst einmal beseitigt werden, bevor der eigentliche<br />
„Feind“, nämlich HIV & AIDS, attackiert werden kann.<br />
Bittere Realität: Nahe bei Durban in Richards Bay sind in<br />
einigen Haushalten 9 oder 12jährige Jungen der Haushaltsvorstand.<br />
Beide Eltern sind an den Folgen von Aids verstorben.<br />
Thobe Zungu (9) kehrt nach der Schule umgehend<br />
nach Hause zurück, um sich um die kleinen Geschwister<br />
zu kümmern. Eine Sozialarbeiterin schaut hin und<br />
wieder nach dem Rechten - auch nach Thobes 4jähriger<br />
Schwester, die HIV+ ist. Die Mutterrolle übernimmt eine<br />
16-jährige Cousine, finanziell unterstützt werden sie von<br />
einer Tante (selbst HIV+). Aber wie lange noch ? Das ist<br />
nur eine kleines Beispiel der unzähligen Aids-Weisen. Wenn<br />
kein Nachbar die Kinder mit Nahrungsresten versorgen,<br />
kümmert sich kaum jemand um sie. Und die Zahl der<br />
Haushalte mit Kindern als Ernährer wächst und wächst.<br />
Zum guten Schluss dieser Splitter: bei einer After Show<br />
Party der Community in der Disco Angelinas Cantina traten<br />
zugunsten eines Waisenhauses verschiedene Musikgruppen<br />
auf, u.a. eine Kwaito Gruppe (Kwaito ist der<br />
jüngste Rap der aus den Townships kommt) mit Texten<br />
zur Aids-Aufklärung und Prävention.<br />
3
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Highlights von der XIII. Welt-AIDS-Konferenz<br />
in Durban, Südafrika<br />
Neue Daten zu ABT-378 (Lopinavir, Kaletra ® )<br />
Zum neuen Proteasehemmer ABT-378 von Abbott, der<br />
bereits zur Zulassung eingereicht wurde liegen neue<br />
Daten für vorbehandelte und nicht vorbehandelte Patienten<br />
vor. Zur Verbesserung der Pharmakokinetik sind<br />
in jeder Kapsel 133 mg ABT-378 und 33 mg Ritonavir<br />
enthalten (deshalb auch die Bezeichnugn ABT-378/r) .<br />
Unvorbehandelte Patienten: 72-Wochen-Daten<br />
Im Rahmen einer Dosisfindungsstudie wurden 100<br />
unvorbehandelte Patienten zunächst mit 3 verschiedenen<br />
Dosierungen von ABT-378/Ritonavir behandelt:<br />
200 mg/100 mg, 400 mg/100 mg oder 400 mg/200<br />
mg, jeweils zweimal täglich zusammen mit d4T (Zerit ® )<br />
und 3TC (Epivir ® ). Nach 48 Wochen wurden alle Patienten<br />
auf das endgültige Dosierungsschema mit 400<br />
mg/100 mg ABT-378/Ritonavir umgestellt.<br />
Die Patienten wurden in zwei Gruppen rekrutiert. In<br />
der ersten Gruppe (32 Patienten) war die mittlere Viruslast<br />
100.000 Kopien/ml und die mittlere CD4-Zellzahl<br />
421/mm³. In der zweiten Gruppe (68 Patienten) war<br />
die mittlere Viruslast 79.000 Kopien/ml und die mittlere<br />
CD4-Zellzahl 301/mm³.<br />
Wie mittlerweile üblich, wurden die Daten nach unterschiedlichen<br />
Kriterien ausgewertet. Einmal werden die<br />
Daten aller Patienten, die bis zuletzt in der Studie verblieben<br />
(“on treatment”=OT) berücksichtigt, zum anderen<br />
wird jeder fehlende Messert, egal aus welchen<br />
Gründen, als Therapieversagen gewertet (“intention to<br />
treat” =ITT). Hier die Ergebnisse nach 72 Wochen:<br />
Gemessen an den Ergebnissen des 400-Kopien-Tests,<br />
schnitt ABT-378 bei Patienten mit einer Viruslast kleiner<br />
oder größer 100.000 Kopien/ml gleich gut ab,<br />
allerdings benötigten Patienten mit einer höheren Virus-<br />
4<br />
< 400 Kopien/ml<br />
OT ITT<br />
Gruppe 1 93% (25/27) 78% (25/32)<br />
Gruppe 2 100% (57/57) 84% (57/68)<br />
< 50 Kopien/ml<br />
OT ITT<br />
Gruppe 1 96% (26/27) 81% (26/32)<br />
Gruppe 2 96% (54/56) 79% (54/68)<br />
CD4-Anstieg<br />
Gruppe 1 304<br />
Gruppe 2 240<br />
last länger, bis sie unter der Nachweisgrenze waren.<br />
Nach 72 Wochen hatte nur ein Patient die Studie wegen<br />
Nebenwirkungen abgebrochen. Die häufigsten Nebenwirkungen<br />
waren:<br />
Nebenwirkung Gruppe 1 Gruppe 2<br />
Durchfall 19% (6) 22% (15)0<br />
Übelkeit 6% (2) 19% (13)<br />
Weicher Stuhlgang 19% (6) 3% (2)<br />
Schwäche 9% (3) 6% (4)<br />
Kopfschmerz 9% (3) 6% (4)<br />
Erbrechen 3% (1) 6% (4)<br />
Laborwertveränderungen Gruppe 1 Gruppe 2<br />
Gesamtchol. > 300 mg/dl 13% (4) 15% (10)<br />
Triglyzeride > 750 mg/dl 13% (4) 12% (8)<br />
erhöhte Leberwerte > 5x norm. 0% 12% (8)<br />
Vorbehandelte Patienten: 24-Wochen-Daten zusammen<br />
mit Efavirenz (Sustiva ® )<br />
Dies war eine Untersuchung an Patienten, die schon<br />
mit mehreren Proteasehemmern vorbehandelt waren,<br />
jedoch nicht mit NNRTI. Das beste Ansprechen zeigten<br />
Patienten mit 0 bis 5 Resistenzmutationen im Gen<br />
der HIV-Protease. Patienten mit mehr als 7 Resistenzmutationen<br />
sprechen eventuell auch auf ABT-378 nicht<br />
mehr gut an.<br />
57 Patienten erhielten ABT-378/r 400/100 mg zweimal<br />
täglich, zusätzlich zunächst 600 mg Efavirenz (Sustiva ® )<br />
einmal täglich und zwei Nukleosidanaloga nach Wahl<br />
des Arztes. Nach 14 Tagen wurde bei 28 zufällig ausgewählten<br />
Patienten die Dosis von ABT-378/r auf 533/<br />
133 mg zweimal täglich erhöht, da man eine Wechselwirkung<br />
mit Sustiva ® erwartete. Tatsächlich war die gemessene<br />
Menge von ABT-378 im Blut durch Sustiva ®<br />
erniedrigt (Reduktion der Talspiegel um 33% und der<br />
Gesamtexpositione um 25%).<br />
Hier die Ergebnisse der beiden Dosierungen von ABT-<br />
378/r nach 24 Wochen:<br />
< 400 Kopien/ml<br />
OT ITT<br />
400/100 mg 80% (20/25) 69%<br />
533/133mg 92% (23/25) 82%<br />
Die CD4-Zellen waren in beiden Gruppen um etwa 45<br />
Zellen/mm³ angestiegen.<br />
Die häufigsten Nebenwirkungen waren Durchfall und<br />
Schwäche. 4 Patienten traten vor Woche 24 wegen Nebenwirkungen<br />
aus der Studie aus.
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
Nebenwirkung 400/100 mg 533/133 mg<br />
Durchfall 7% 14%<br />
Schwäche 7% 14%<br />
Blutzucker > 250 mg/dl 10% 0%<br />
erhöhte Leberwerte > 5x norm. 0% 4%<br />
Triglyzeride > 750 mg/dl 31% 36%<br />
Quelle: NATAP, übersetzt/bearbeitet von Helmut B.<br />
Kommentar: ABT-378 scheint nach diesen Daten ein<br />
gut wirksamer Proteasehemmer zu sein. Die Ergebnisse<br />
bei mehrfach mit Proteasehemmern vorbehandelten<br />
Patienten sind etwas schwierig zu interpretieren,<br />
da die Patienten auch Sustiva ® , ebenfalls eine<br />
hochwirksame Substanz, erhielten, so dass der Beitrag<br />
der einzelnen Komponenenten zur Senkung der<br />
Viruslast nicht klar ist. Auf jeden Fall scheint die<br />
Dosiserhöhung von ABT-378 in der Kombination mit<br />
Sustiva ® gerechtfertigt. Etwas eigenartig finden wir,<br />
dass die Sustiva-typischen zentralnervösen Nebenwirkungen<br />
in der Tabelle nicht zu finden sind. Nach ersten<br />
Gesprächen mit Patienten, die bereits ABT-378<br />
erhalten, scheint die Verträglichkeit kurzfristig recht<br />
gut zu sein.<br />
Deintensivierung und Vereinfachung der medikamentösen<br />
Behandlung:<br />
Gar nicht so einfach!<br />
Von Dr. Graeme Moyle<br />
Die hochwirksame antiretrovirale Therapie mit drei oder<br />
mehr Medikamenten (HAART) hat den Verlauf einer<br />
HIV-1-Infektion drastisch verändert. Doch auch mit der<br />
HAART lässt sich HIV nicht völlig ausmerzen. Daher<br />
geht man heute bei der HIV-Behandlung von einer<br />
Verabreichung der antiretroviralen Medikamente für einen<br />
unbestimmten Zeitraum aus.<br />
In ersten Studien zur Deintensivierung wurde bei den<br />
Patienten zunächst in der Einleitungsphase mit HAART<br />
für in der Regel 24 Wochen die Viruslast dauerhaft unter<br />
50 Kopien/ml gesenkt, und man untersuchte dann<br />
den Effekt eines Wechels zu einer weniger intensiven<br />
und komfortableren Erhaltungstherapie, unter der sich<br />
jedoch die Unterdrückung der Virusvermehrung nicht<br />
durchhalten ließ. Eine mögliche Erklärung für den Misserfolg<br />
der weniger intensiven Erhaltungstherapie bei<br />
diesen Studien könnte die zu kurze Einleitungsphase<br />
sein.<br />
Inzwischen liegen neue Daten der ADAM-Studie<br />
darüber vor, inwiefern sich eine längere Einleitungsphase<br />
auf den Erfolg einer Behandlungsdeintensivierung auswirkt.<br />
Patienten ohne antiretrovirale Vorbehandlung<br />
erhielten als Einleitungsregime entweder 26 oder aber<br />
50 Wochen lang eine Viererkombination mit Stavudin<br />
(d4T, Zerit ® ) + Lamivudin (3TC, Epivir ® ) + Saquinavir<br />
(SQV, Invirase ® ) + Nelfinavir (NFV, Viracept ® ). Die<br />
Therapiedeintensivierung in der 26. Woche wurde gestoppt,<br />
nachdem eine Zwischenanalyse eine schlechtere<br />
Unterdrückung der Virusvermehrung unter der Erhaltungstherapie<br />
ergeben hatte. In der 50. Woche erhielten<br />
die Patienten, deren Viruslast in der 48. und 49.<br />
Woche jeweils unterhalb der Nachweisgrenze (< 50<br />
Kopien/ml) gelegen hatten, nach dem Zufallsprinzip<br />
(randomisiert) entweder die Erhaltungstherapie (d4T +<br />
NFV oder SQV + NFV) oder weiterhin die Viererkombination.<br />
Nach der Randomisierung wurde die<br />
Viruslast im Plasma monatlich kontrolliert. Als Therapieversagen<br />
galt, wenn in zwei aufeinander folgenden Messungen<br />
der Viruslast mehr als 100 Kopien/ml nachgewiesen<br />
wurden.<br />
Von den 65 Patienten, die die Studie begonnen hatten,<br />
wurden 16 in der 26. Woche randomisiert. Von den<br />
übrigen 49 Patienten wurden 17 in der 50. Woche<br />
randomisiert. Dabei erhielten sechs Patienten d4T +<br />
NFV und vier SQV + NFV. In diesen Studienarmen<br />
brach jeweils ein Patient die Studie nach der<br />
Randomisierung ab. Bei den acht Personen unter der<br />
weniger intensiven Behandlung wurde in vier Fällen<br />
Therapieversagen festgestellt, während in der Gruppe<br />
mit fünf auswertbaren Patienten mit Viererkombination<br />
die Therapie in einem Fall versagte (p=0,56). Nach der<br />
statistischen Analyse existierte zwischen den Gruppen<br />
der Patienten mit Therapiedeintensivierung ab der 26.<br />
Woche bzw. 50. Woche kein Unterschied in bezug auf<br />
die Zeitspanne, bis die Viruslast im Plasma auf 400<br />
Kopien/ml gestiegen war. Daraus folgerten die Autoren,<br />
dass sich die Virusvermehrung nach der<br />
Therapiedeintensivierung auch durch eine längere Einleitungsperiode<br />
nicht verzögern lässt.<br />
Einfachere Therapieformen<br />
Angesichts dieser enttäuschenden Ergebnisse ergibt sich<br />
als nächst beste Option die Überlegung, das<br />
Behandlungsregime zu vereinfachen, indem man die<br />
Häufigkeit der Einnahme und/oder die Tablettenmenge<br />
reduziert. Diese Möglichkeit wurde in verschiedenen<br />
Studien mit unterschiedlichen Medikamenten geprüft.<br />
Ausgehend von den im letzten Jahr veröffentlichten<br />
pharmakokinetischen Daten, denen zufolge 100 mg<br />
Ritonavir (Norvir ® ) in Kombination mit 1200 mg<br />
Indinavir (Crixivan ® ) zu höheren Indinavir-Spiegeln und<br />
einer ähnlichen oder sogar höheren Plateau-Konzentration<br />
von Indinavir im Vergleich zur herkömmlichen<br />
dreimal täglichen Dosierung führte, wurde an zwei italienischen<br />
Kliniken eine Fall-Kontroll-Studie durchgeführt.<br />
Dabei hatten Patienten, die unter Indinavir eine<br />
5
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Viruslast von weniger als 50 Kopien/ml aufwiesen, die<br />
Möglichkeit, auf eine einmal tägliche Verabreichung von<br />
1200 mg Indinavir + 100 mg Ritonavir umzusteigen.<br />
Als Vergleich dienten die Daten von Patienten, die<br />
Crixivan ® 800 mg alle acht Stunden erhielten.<br />
Die Beobachtungszeit von 16 Wochen schlossen 12<br />
Patienten ab. Ihre Viruslast betrug zu Studienbeginn<br />
weniger als 50 Kopien/ml während durchschnittlich 16<br />
Monaten, und sie hatten eine mittlere CD4-Zahl von<br />
369 Zellen/mm³. Ein Wiederanstieg der Viruslast auf<br />
über 400 Kopien/ml trat bei einem Patienten der<br />
Kontrollgruppe auf, jedoch bei keinem der Patienten<br />
unter vereinfachter Therapie. Allerdings hatten zwei<br />
Patienten der letztgenannten Gruppe und drei Kontrollprobanden<br />
in der 16. Woche eine Viruslast von über 50<br />
Kopien/ml. Es lässt sich nicht sagen, ob es sich dabei<br />
um vorübergehende “Blips” also kurzfristige, sprunghafte<br />
Anstiege der Virusvermehrung handelte. Bei zwei<br />
Patienten mit vereinfachter Therapie und einer Kontrollperson<br />
traten Nierensteine auf. Dies scheint nicht verwunderlich,<br />
da die Plasmaspitzenspiegel für Indinavir<br />
bei dieser Therapieform den Berichten zufolge etwa 80<br />
% höher sind als bei der dreimal täglichen Dosierung.<br />
Die pharmakokinetischen Eigenschaften einiger nichtnukleosidaler<br />
Reverse Transkriptase-Hemmer (NNRTIs)<br />
und Nukleosidanaloga sprechen für eine einmal tägliche<br />
Einnahme. In einer spanischen Studie mit<br />
unvorbehandelten, symptomlosen Patienten mit einer<br />
CD4-Zahl von über 500 Zellen/mm³ und einer Viruslast<br />
von über 5000 Kopien/ml wurde die einmal tägliche<br />
Gabe von jeweils 400 mg ddI (Videx ® ) und<br />
Nevirapin (Viramune ® ) im Vergleich zur zweimal täglichen<br />
Einnahme dieser Substanzen, immer in Kombination<br />
mit zweimal täglich d4T (Zerit ® , 40 mg), untersucht.<br />
Die Studienteilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip<br />
einer einmal täglichen (n=45) oder zweimal täglichen<br />
(n=44) Verabreichung zugeordnet. Über die Patientendaten<br />
zu Beginn der Studie wurde nichts mitgeteilt. Die<br />
mittlere Verringerung der Viruslast nach 12 Monaten<br />
betrug -1,84 log 10 Kopien/ml im Behandlungsarm mit<br />
einmal täglicher Einnahme und -1,78 log 10 Kopien/ml<br />
in der Gruppe mit zweimal täglicher Verabreichung<br />
(p=0,91). In der intention-to-treat-Analyse, bei der unabhängig<br />
vom Verlauf der Studie alle Teilnehmer berücksichtigt<br />
werden, betrug der Anteil der Patienten mit<br />
einer Viruslast von weniger als 200 Kopien/ml nach 12<br />
Monaten 73% (einmal tägliche Dosierung) bzw. 68%<br />
(zweimal tägliche Dosierung). Die prozentualen Anteile<br />
der Patienten mit weniger als 5 Kopien/ml betrugen<br />
entsprechend 40% bzw. 45%. Hinsichtlich des Anstiegs<br />
der CD4-Zellzahl war kein Unterschied festzustellen.<br />
6<br />
In einer Untergruppe von 11 Patienten mit einer Plasmaviruslast<br />
von unter 5 Kopien/ml nach 12 Monaten wurden<br />
Mandelbiopsien vorgenommen. Dabei wurde bei<br />
fünf Personen HIV-RNA im Lymphgewebe nachgewiesen<br />
(Mittel: 7750 Kopien/mg Gewebe; Streubereich:<br />
1020-33.007).<br />
Acht Prozent der Teilnehmer wechselten<br />
nebenwirkungsbedingt die Therapie. Während die Daten<br />
bezüglich der Virusmenge im Plasma eher für die<br />
einmal tägliche Gabe von ddI und Nevirapin bei nicht<br />
antiretroviral vorbehandelten Patienten sprechen, lassen<br />
die Zahlen zur Viruslast im Lymphgewebe doch einige<br />
Bedenken im Hinblick auf die mögliche Dauer der<br />
Wirksamkeit aufkommen.<br />
Ein neuer Ansatz der einmal täglichen Dosierung stand<br />
im Mittelpunkt einer weiteren Studie, bei der 2 NNRTIs,<br />
nämlich Efavirenz (EFV, Sustiva ® ) und Nevirapin (NVP,<br />
Viramune ® ), mit ddI (Videx ® )kombiniert wurden. Der<br />
Kombination von NNRTIs liegt die Überlegung zu<br />
Grunde, dass dadurch die Gesamtmenge an NNRTI<br />
im Plasma gesteigert wird und sich antiretrovirale Wirkungen<br />
möglicherweise addieren. Außerdem werden bei<br />
dieser Therapieform die Plasmakonzentrationen an<br />
Nukleosidanaloga beschränkt, was sich langfristig günstig<br />
auf die Verträglichkeit auswirken könnte. Die Studie<br />
wurde durchgeführt mit 15 nicht vorbehandelten und<br />
11 therapieerfahrenen Patienten, die 400 mg NVP, 600<br />
mg EFV und 400 mg ddI jeweils einmal täglich einnahmen.<br />
Die pharmakokinetische Wechselwirkung zwischen<br />
EFV und NVP, die zu einer etwa 30-prozentigen Verminderung<br />
des EFV-Spiegels führt, blieb also unberücksichtigt.<br />
In einer noch andauernden Studie zu dieser Kombination<br />
wird Efavirenz in einer Dosis von 800 mg/Tag mit<br />
einer Standarddosis NVP kombiniert. Bei den nicht<br />
vorbehandelten Patienten betrug die mittlere Viruslast<br />
zu Studienbeginn 4,59 log 10 Kopien/ml und die mittlere<br />
CD4-Zellzahl 351 Zellen/mm³. Nach 9 Behandlungsmonaten<br />
wiesen 12 von 12 auswertbaren Patienten eine<br />
Viruslast von weniger als 400 Kopien/ml auf und der<br />
CD4-Wert hatte sich um 351 Zellen/mm³ erhöht. Zu<br />
Studienbeginn hatten 9 von 11 vorbehandelten Patienten<br />
eine Viruslast von unter 400 Kopien/ml und eine<br />
mittlere CD4-Zellzahl von 368 Zellen/mm³. Nach 9<br />
Monaten wurden für 9 von 9 Patienten eine Viruslast<br />
von unter 400 Kopien/ml und ein Anstieg der CD4-<br />
Zellzahl um im Mittel 203 Zellen/mm³ verzeichnet. Von<br />
den 26 Patienten brachen fünf (19%) die Studie vorzeitig<br />
ab. Die Gründe waren in zwei Fällen Hautausschlag<br />
und bei drei Patienten Störungen des Zentralnervensystems.<br />
Diese Pilotstudie deutet darauf hin, dass eine<br />
Kombination aus zwei NNRTIs eventuell einen interessanten<br />
Ansatz darstellen könnte. Die einmal tägliche
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
Gabe von NVP + EFV + ddI muss weiter untersucht<br />
werden.<br />
Quelle: Medscape, übersetzt von Karin Boss<br />
Strukturiert intermittierende Therapie (SIT) als<br />
neue Strategie zur langfristigen HIV-Behandlung<br />
Von Dr. W. David Hard y<br />
Dr. Anthony Fauci, Direktor des US National Institute<br />
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), präsentierte<br />
eine innovative, kühne Strategie zur langfristigen<br />
HIV-Behandlung. Im Gegensatz zu seinen sonst mit<br />
Zahlen gespickten Präsentationen, brachte Dr. Fauci in<br />
Durban einen äußerst kreativen Beitrag zur HIV-Therapie,<br />
der sich auf nur geringes vorläufiges Datenmaterial<br />
stützte. Er beschrieb eine Behandlungsstrategie, die<br />
1. einen "permanenten" neuen immunologischen<br />
"Schwellenwert" zur Unterdrückung der Virusvermehrung<br />
ohne HAART (d.h. einen immunologischen<br />
Zustand vergleichbar dem eines HIV-positiven "longterm<br />
non-progressors") herbeiführen und 2. dank<br />
zwischengeschalteter medikamentenfreier Perioden weniger<br />
Nebenwirkungen, eine bessere Therapietreue und<br />
verminderte Kosten bewirken würde. Diese provokante<br />
Strategie scheint vergleichbar zu sein mit den strukturierten<br />
Therapieunterbrechungen ("structured<br />
treatment interruptions", STI), die erstmalig Dr. Franco<br />
Lori als Erklärung der verblüffenden anekdotischen<br />
Ergebnisse in Bezug auf seinen mittlerweile berühmten<br />
"Berliner Patienten" beschrieben hatte.<br />
Die virologischen Werte von Patienten, bei denen die<br />
Viruslast im Plasma nach einer zunächst guten Unterdrückung<br />
zwar nach Absetzen der HAART wieder angestiegen<br />
war, deren virologischer "Schwellenwert" aber<br />
den Wert vor der HAART nicht überschritt, liefern die<br />
Grundlage für die Ansicht, dass sich eine HAART mit<br />
periodischen Pausen möglicherweise rechtfertigen lässt.<br />
Dr. Fauci prägte für diese neue Behandlungsstrategie<br />
den Begriff "structured intermittent therapy" (strukturiert<br />
unterbrochene Therapie), oder kurz SIT. Ziel soll<br />
sein, die Gesamtdauer der HAART zu verkürzen und<br />
gleichzeitig die Viruslast im Plasma dauerhaft auf einem<br />
akzeptablen niedrigen Niveau zu halten. Steigt die<br />
Viruslast während der Therapiepause über einen vorher<br />
festgelegten Schwellenwert an, wird wieder mit der<br />
HAART eingesetzt.<br />
Dr. Fauci stellte vorläufige, kurzfristige Daten einiger<br />
weniger Patienten aus zwei noch laufenden Studien zur<br />
SIT vor. Bei allen Teilnehmern lag die Plasma-Viruslast<br />
zu Studienbeginn unter 50 Kopien/ml. In der ersten<br />
Untersuchung, bei der die Patienten zunächst acht Wochen<br />
lang eine nicht näher beschriebene HAART erhielten<br />
und dann eine vierwöchige Therapiepause einlegten,<br />
ließ sich anhand ausgewählter Ergebnisse für 7<br />
von 9 Patienten (geplant ist eine Gesamtzahl von 80)<br />
während zwei bis drei SIT-Zyklen bei sechs Patienten<br />
eine Tendenz zum geringeren Wiederanstieg der Viruslast<br />
in den therapiefreien Zeiträumen und bei einem<br />
Patienten eine steigende Viruslast erkennen. Die Gesamtzahl<br />
an CD4- und CD8-Zellen veränderte sich<br />
während der vier- bis neunmonatigen Beobachtungszeit<br />
nicht. Die Aktivität zytotoxischer T-Zellen erhöhte<br />
sich bei drei Patienten und blieb bei vier der getesteten<br />
Patienten unverändert.<br />
In der zweiten Untersuchung erhalten die Patienten 7<br />
Tage lang eine HAART und setzen dann 7 Tage lang<br />
mit der Behandlung aus. Für dieses Intervall entschied<br />
man sich auf Grund der Beobachtung, dass während<br />
einer 7-tägigen Therapiepause die Viruslast nur bei 3<br />
von 18 Patienten über die Nachweisgrenze anstieg und<br />
in jedem Fall weniger als 500 Kopien/ml betrug. Die<br />
Daten für sieben Patienten aus dieser Untersuchung ließen<br />
bei sechs Patienten keinen Wiederanstieg der ursprünglichen<br />
Viruslast (< 50 Kopien/ml) und in einem<br />
Fall einen Ausreißer über die Nachweisgrenze erkennen.<br />
Diese Studien dienen der Untersuchung des Zusammenhangs<br />
zwischen der HIV-spezifischen CD8-Immunantwort<br />
und der Unterdrückung der Viruslast. Frühere<br />
Studien haben belegt, dass die Zahl an HIV-spezifischen<br />
CD8-Gedächtniszellen steigt, wenn Patienten die<br />
HAART abgesetzt haben, und sinkt, wenn die Therapie<br />
wieder aufgenommen wird. Im Idealfall könnte mit Hilfe<br />
der SIT ein Anstieg der Zahl und Aktivität der HIVspezifischen<br />
CD8-Zellen erreicht werden, um so die<br />
HIV-Vermehrung zu unterdrücken.<br />
Bemerkenswert und in gewisser Weise verblüffend an<br />
Dr. Fauci's Vorschlag ist die minimale Datenbasis der<br />
Untersuchungen. Wir sind von NIAID-Studien eine Flut<br />
an fundierten Daten und charakteristische, genau auf<br />
vorhandene Fakten abgestimmte Protokolle gewöhnt.<br />
Die nun in diesen beiden innovativen Studien gezeigte<br />
Kreativität und Risikobereitschaft ist erfrischend. Die<br />
vielsagendste Kritik an seiner Präsentation drückte Dr.<br />
Fauci am besten mit seinen eigenen Worten aus: "Wir<br />
werden mit der Auswertung der Daten bis zum Abschluss<br />
der Studie warten". Über den Wert der Präsentation<br />
dieser wenigen, zwar viel versprechenden aber<br />
nichtsdestotrotz eindeutig vorläufigen Daten lässt sich<br />
streiten. Man darf auf die endgültigen Daten der Untersuchungen<br />
gespannt sein, schließlich besteht durch<br />
die Therapieunterbrechungen möglicherweise auch die<br />
7
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Gefahr einer Resistenzentwicklung.<br />
Infizierte und ihre Ärzte sollten deshalb keinesfalls<br />
auf eigene Faust außerhalb des Rahmens streng<br />
kontrollierter klinischer Studien mit Therapiepausen<br />
experimentieren!<br />
Quelle: Medscape. Übersetzt/bearbeitet von Karin Boss<br />
Einfluss einer HAART auf Tumoren<br />
Bestimmte Tumorarten treten besonders häufig bei HIV-<br />
Infizierten auf, so z.B. das Kaposi-Sarkom (KS) und<br />
Lymphome. Schon seit geraumer Zeit berichten Ärzte<br />
von Patienten, deren Tumore alleine durch eine hochaktive<br />
antiretrovirale Therapie (“HAART”) kleiner wurden<br />
oder sogar ganz verschwanden. Da man bei Krebs<br />
nie sicher sein kann, dass er endgültig besiegt ist, spricht<br />
man hier aber nicht von einer Heilung sondern lediglich<br />
von “Remission” (Rückgang).<br />
HAART zur Behandlung des Kaposi-Sarkoms<br />
Eine italienische Arbeitsgruppe untersuchte 53 Patienten<br />
mit Kaposi-Sarkom der Haut; Patienten mit dem<br />
schwerer wiegenden inneren Kaposi-Sarkom wurden<br />
nicht untersucht. Zu Studienbeginn hatten die Patienten<br />
eine mittlere CD4-Zellzahl von 174 Zellen/mm³<br />
(Bereich 1-882) und eine mittlere Viruslast von etwa<br />
180.000 Kopien/ml (1400 – mehr als 800.000). 22 Patienten<br />
hatten vor Beginn der HAART schon eine Therapie<br />
mit Nukleosidanaloga erhalten. In der Studie erhielten<br />
die Patienten zusätzlich zu den Nukleosidanaloga<br />
Indinavir (Crixivan ® , 25 Patienten), Saquinavir<br />
(Invirase ® , 19 Patienten) oder Ritonavir (Norvir ® , 7 Patienten).<br />
Nach einer Studiendauer von 48 Wochen waren<br />
die Daten von 45 Patienten auswertbar. 36% der<br />
Patienten wiesen eine totale Remission auf, weitere 36%<br />
eine Teilremission der Kaposi-Sarkome. Auffällig ist,<br />
dass das Kaposi-Sarkoms vor allem bei den Patienten<br />
zurück ging, deren CD4-Zellen anstiegen. Dagegen war<br />
die Viruslast bei den Patienten, deren Kaposi-Sarkom<br />
zurückging und bei den Patienten, deren KS nicht ansprach,<br />
nach 48 Wochen etwa gleich.<br />
HAART bei KS effektiver als Chemotherapie?<br />
Eine andere italienische Forschergruppe fand, dass eine<br />
HAART oft auch bei Patienten noch eine Besserung<br />
des KS bewirkte, bei denen eine Chemotherapie gegen<br />
das KS bereits versagt hatte. Wieder zeigten die Patienten<br />
die besten Ergebnisse, bei denen die CD4-Zellen<br />
am deutlichsten angestiegen waren.<br />
8<br />
Die Autoren der beiden Studien folgern, dass es Sinn<br />
macht, bei KS zunächst eine HAART zu beginnen, bevor<br />
man eine Chemotherapie einsetzt.<br />
Einfluss der HAART auf die Überlebensrate von<br />
Patienten mit Lymphomen<br />
Eine spanische Arbeitsgruppe berichtet über 58 Patienten,<br />
die in der Zeit von 1988-1996 wegen AIDS-assoziierter<br />
Lymphome mit einer Chemotherapie behandelt<br />
wurden. Zunächst wurde die volle Dosis einer Vierfach-<br />
Chemotherapie (“CHOP-Schema”) eingesetzt; die Dosis<br />
musste aber bei drei Viertel der Patienten reduziert<br />
werden. Patienten, die eine HAART bekamen, erreichten<br />
mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Remission und<br />
überlebten länger als Patienten, die keine HAART bekamen.<br />
Alles in allem zeigen diese Ergebnisse, dass das Immunsystem<br />
die wichtigste Waffe im Kampf gegen Tumoren<br />
ist. Wenn durch eine hochaktive antiretrovirale<br />
Therapie die Zahl der CD4-Zellen ansteigt, steigen auch<br />
die Chancen, den Krebs zu besiegen.<br />
Quelle: NATAP, übersetzt/bearbeitet von Helmut B.<br />
Ein bisschen Virus –<br />
harmlos oder bedeutsam?<br />
Die heutigen Tests zur Bestimmung der Viruslast können<br />
noch 50 Kopien viralen Erbmaterials pro Milliliter<br />
Blut zuverlässig nachweisen. Viele Patienten, die eine<br />
hochaktive antiretrovirale Therapie (“HAART”) erhalten,<br />
erreichen eine Viruslast unterhalb dieser Nachweisgrenze.<br />
Studienergebnisse der letzten Jahre legten den<br />
Schluss nahe, dass die Unterdrückung der Virusvermehrung<br />
umso länger klappt, je weiter man die Viruslast<br />
absenkt. Doch auch bei Patienten mit normalerweise<br />
nicht nachweisbarer Viruslast kommt es gelegentlich vor,<br />
dass plötzlich ein bisschen Virus messbar ist, meist<br />
zwischen 50 und 500 Kopien pro ml, oft als “Blips”<br />
bezeichnet. Bisher war nicht klar, ob dies ein harmloser<br />
Befund ist oder vielleicht der Bote einer drohenden<br />
Resistenzentwicklung und damit eines Therapieversagens.<br />
Um diese Frage zu untersuchen, hat ein niedergelassener<br />
Arzt aus Washington seine Patientenkartei<br />
auf solche Fälle hin durchforstet. Von 32 Personen, die<br />
nach zunächst nicht nachweisbarer Viruslast einen Messwert<br />
über 50 Kopien/ml aufwiesen, hatten 75% (24<br />
Patienten) bei der nächsten Untersuchung wieder eine<br />
nicht nachweisbare Viruslast. Bei den restlichen 8 Pati-
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
enten stieg die Viruslast weiter an und die Therapie<br />
musste schließlich umgestellt werden. Die Autoren der<br />
Studie schlussfolgern, dass bei einem Anstieg der Viruslast<br />
von “nicht nachweisbar” auf Werte zwischen 50<br />
und 400 Kopien/ml nicht unbedingt ein Therapieversagen<br />
vorliegen muss und dass es am sinnvollsten<br />
ist, die Viruslast des Patienten nach einem Monat<br />
nochmals zu bestimmen.<br />
Untersuchungen von Patienten aus der MSD-Studie 035<br />
lassen den Schluss zu, dass Patienten, deren Viruslast<br />
dauernd unter der Nachweisgrenze von 50 Kopien blieb,<br />
bei 52% der Blutproben eine Viruslast unter 2,5 Kopien<br />
hatten (mit einem noch empfindlicheren, experimentellen<br />
Test gemessen). Bei Patienten mit “Blips” waren<br />
nur 8% der Proben unter 2,5 Kopien/ml. Trotzdem<br />
unterschieden sich die beiden Gruppen über die Nachbeobachtungszeit<br />
von 84 Wochen nicht in der Rate der<br />
Therapieversager: Bei 13,8% der Patienten (20 von 145)<br />
ohne Blips versagte die Therapie schließlich im Vergleich<br />
zu 9,4% der Patienten (9 von 96) mit Blips.<br />
Vermutlich stammen diese Blips aus einer geringen Vermehrung<br />
von HIV aus Körperregionen, die durch die<br />
Medikamente nicht optimal erreicht werden, z.B. dem<br />
zentralen Nervensystem oder dem Genitaltrakt. Leider<br />
ist noch unklar, ob diese geringgradige Vermehrung zur<br />
Resistenzentwicklung führen kann, da bei so niedriger<br />
Viruslast kein Resistenztest durchführbar ist. Auch die<br />
immunologischen Auswirkungen sind derzeit nicht klar.<br />
So könnte es theoretisch durchaus sein, dass “ein<br />
bisschen Virus” das Immunsystem anregt und dazu<br />
beiträgt, dass die Viruslast langfristig unter Kontrolle<br />
bleibt. Dies muss jedoch in weiteren Studien untersucht<br />
werden. Beim heutigen Wissenstand empfiehlt es sich,<br />
nach einem “Blip” die Viruslast einen Monat später<br />
nochmals bestimmen zu lassen.<br />
Quelle: NATAP, übersetzt/bearbeitet von Helmut B.<br />
Aids wird politisch:<br />
Welt-Aids-Konferenz erzwingt<br />
Bewertungswandel<br />
Nach dem medizinischen Aufbruch von Vancouver war<br />
die Konferenz im südafrikanischen Durban ein weiterer,<br />
entscheidender Wendepunkt im Kampf gegen Aids.<br />
Die Zusammenkunft hat endlich ökonomische und politische<br />
Dimensionen der Krankheit dargelegt. Galten<br />
Aids und HIV lange Zeit als Problem weniger<br />
Bevölkerungsgruppen, als “Schwulenpest”, so werden<br />
sie nun als Lebens- und Existenzbedrohung ganzer Länder<br />
erkannt. Matthias Wienold, Berater der Deutschen<br />
Aids-Hilfe, brachte den inhaltlichen Wandel auf den<br />
Punkt: In Vancouver konnte man Infektionsabläufe und<br />
Therapiemöglichkeiten erstmals klar formulieren, Aids<br />
“bekam ein Gesicht”; in Durban war “das Gesicht<br />
schwarz”.<br />
Von den weltweit etwa 35 Millionen HIV-Infizierten<br />
leben weit über zwei Drittel im südlichen Afrika. In<br />
Sambia sank die durchschnittliche Lebenserwartung um<br />
19 auf 37 Jahre, in Botswana sogar um 32 auf 39 Jahre.<br />
Ähnlich stellt sich das Bild in Südafrika und Mosambik<br />
sowie außerhalb Afrikas in Asien, Lateinamerika und<br />
der Karibik dar. Das mühsam aufgebaute Gesundheitssystem<br />
bricht – vor allem in ländlichen Gebieten – zusammen,<br />
weil Ärzte und PflegerInnen sterben. Aufklärung<br />
durch Lehrer und Pfarreien wird unmöglich: Schulen<br />
und Kirchen müssen wegen Aids schließen. Sicherheit<br />
ist mancherorts nicht mehr zu garantieren: Aids betrifft<br />
auch weite Teile der Polizei und des Militärs. Fachkräfte<br />
und Universitäts-Abgänger sterben frühzeitig, oft<br />
nur kurz nach ihrer Ausbildung. Länder wie Botswana<br />
und Sambia werden zunehmend handlungsunfähig, weil<br />
die Menschen, die politische Entscheidungen umsetzen<br />
könnten, sterben. Gleichzeitig sind Therapien unbezahlbar:<br />
Eine einzelne Dreier-Kombination kostet das<br />
Vierzigfache des durchschnittlichen Einkommens. Die<br />
Wirklichkeit von Heute überholt jede fiktive Vorstellung<br />
früherer Tage. Die deutsche Bundesentwicklungsministerin<br />
sprach in diesem Zusammenhang von dreißig<br />
Jahren Entwicklungsarbeit, die Aids zunichte macht.<br />
Die unvorstellbare Situation rief nicht nur Teilnehmer<br />
der Welt-Aids-Konferenz auf den Plan – zirka 11.000<br />
aus 178 Staaten. Auch führende Vertreter der westlichen<br />
Länder und grenzübergreifender Institutionen wie<br />
der Vereinten Nationen und der Weltbank machten Aids<br />
zum “wichtigsten Thema des neuen Jahrhunderts”. Bill<br />
Clinton und Al Gore mahnten eine weltweite Aids-Politik<br />
an, private Stiftungen wie jene von Bill Gates spendeten<br />
große Summen. Frankreichs Staatspräsident<br />
Jacques Chirac setzte Aids auf die Tagesordnung des<br />
Weltwirtschaftsgipfels. Die Weltbank wird in Zukunft<br />
an Länder der dritten Welt Kredite zur Aids-Aufklärung<br />
vergeben. Die UNO und ihre Untergruppen WHO<br />
und UNICEF intervenieren vehement, ein millionenschwerer<br />
Hilfsfond ist in Planung.<br />
Die Reaktion kommt spät und ist verständlich, denn<br />
der westlichen Welt brechen Märkte weg. Märkte, auf<br />
die sich die Konjunktur der kommenden Jahrzehnte<br />
stützt. Außerdem besitzt mittlerweile jede global agierende<br />
Firma externe Produktionsstätten in Ländern der<br />
dritten Welt, ist also direkt betroffen vom zunehmen-<br />
9
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
den Facharbeitermangel und von einbrechenden Infrastrukturen.<br />
Der ökonomische Druck nimmt zu, und erst<br />
dieser konnte bewirken, was WHO und Betroffenen-<br />
Organisationen über Jahre hinweg nicht gelang: Aids ist<br />
ab sofort politisches Thema ersten Ranges!<br />
Das bekam auch die Pharma-Industrie zu spüren. In<br />
Durban traf sie der Vorwurf, an Aids außergewöhnlich<br />
gut zu verdienen, während Afrika stirbt. Das schlechte<br />
Image verdankt die Pharma-Industrie einer Preispolitik,<br />
die zu keiner Zeit transparent war und noch nie Gewinn<br />
und Verlust mit der Erforschung und Entwicklung<br />
eines Medikamentes verglich.<br />
Transparenz blieb der Pharma-Industrie auch in Durban<br />
fremd. Allerdings teilten erste Firmen wie<br />
Boehringer Ingelheim und Abbot mit, ihre Produkte in<br />
einigen Regionen der dritten Welt kostenfrei verteilen<br />
zu wollen. Die organisierte Pharma-Industrie schloss<br />
sich an und wird in ausgesuchten Ländern, aber nur<br />
dort, die Preise der Medikamente um sechzig Prozent<br />
senken, was nicht genügt, da stark eingeschränkte<br />
Gesundheitssysteme wie die in Botswana oder Sambia<br />
höchstens fünf Prozent der monatlich etwa 3000 Mark<br />
einer Dreier-Kombination begleichen können.<br />
Der Pharma-Industrie geht es bei ihren Aktionen nicht<br />
allein um das menschliche Leid, das sich außerhalb der<br />
westlichen Welt offenbart. Sie reagiert, wie zuvor schon<br />
Regierungen und Organisationen, auf ökonomischen<br />
Druck. Die Pharma-Industrie senkt die Preise bis gen<br />
Null, um nicht gezwungen zu werden, den Ländern der<br />
Dritten Welt preisgünstigere Patente zur Eigenproduktion<br />
zu überlassen. Das allein würde nämlich einen<br />
Therapie-Preis garantieren, der zu 95 Prozent unter<br />
dem jetzigen liegt, also bezahlbar wäre. Nicht ganz<br />
zu Unrecht fürchten die Pharma-Firmen eine weltweite<br />
Aufweichung der derzeit in westlichen Ländern geltenden<br />
Preise durch Reimporte und graue Märkte. Dann<br />
wäre die Hochpreispolitik, die nach Angaben der<br />
Pharma-Industrie hohe Entwicklungskosten deckt und<br />
der Forschung dient, nicht mehr zu halten.<br />
Den Ländern der dritten Welt ist darüber hinaus mit<br />
verbilligten Medikamenten nur bedingt gedient.<br />
Schließlich müssen Arzneien verabreicht und deren Wirkung<br />
im Nachhinein kontrolliert werden. Beides ist ohne<br />
funktionierendes Gesundheitssystem nicht möglich.<br />
Außerdem haben andere Länder andere Gebräuche. So<br />
gelten in Afrika “bunte Pillen” als vortreffliches Geschenk<br />
unter guten Freunden. Regelmäßige Einnahmezeiten<br />
sind zudem auf Grund zahlreicher Rituale nicht<br />
durchzusetzen. Medikamente können deshalb nur ge-<br />
10<br />
zielt, das heißt in Städten und vor der Geburt, eingesetzt<br />
werden. Flächendeckend garantiert letztlich nur eine<br />
Impfung Hilfe.<br />
So stellt sich die Lage aus westlicher Sicht ambivalent<br />
dar. Einerseits wird es von Vorteil sein, dass Aids<br />
leitpolitisches Thema geworden ist. Forschungsanstrengungen<br />
wird das beflügeln. Andererseits können<br />
Betroffene aller Länder nicht daran interessiert sein, dass<br />
die funktionierende Gesundheitsversorgung der westlichen<br />
Ländern leidet, weil Firmen der Pharma-Industrie<br />
sukzessive aus einem Markt aussteigen, der sich nicht<br />
mehr rentiert. Potenziert wird diese Ambivalenz durch<br />
das menschliche Leid, das Aids in Ländern der dritten<br />
Welt bedeutet. Gut versorgt lässt es sich leicht reden<br />
über Sterblichkeitsraten andernorts.<br />
Insofern ist die politische Entwicklung nach Durban<br />
für jeden HIV-Infizierten und an Aids Erkrankten hochbrisant.<br />
Moralisch und politisch! Die Augen vor der Situation<br />
in Entwicklungsländern zu verschließen hieße,<br />
das Gesamtbild der Krankheit nicht anzuerkennen.<br />
Daher gilt es - mehr denn je - darauf zu achten, dass<br />
Aids nicht wieder Thema einzelner Randgruppen, sondern<br />
eines der ganzen Gesellschaft, in diesem Fall der<br />
Welt-Gesellschaft wird. Aids ist Aufgabe aller!<br />
Regierungen und Organisationen sind zudem aufgerufen,<br />
nicht zu sparen, sondern zusätzliche Summen in<br />
Forschung und Aufklärung zu stecken sowie die<br />
Produktionskosten der Medikamente für Länder der<br />
dritten Welt zeitweise zu übernehmen, um sie dort gezielt<br />
einzusetzen, bis Impfmittel gefunden sind. In diesem<br />
Zusammenhang kann nicht sein, dass in Deutschland<br />
Forschungsetats des Bundes und der Länder zurückgefahren<br />
werden, während ein Mehr vonnöten wäre.<br />
Bedenklich ist ebenfalls, dass die funktionierende, wenn<br />
auch sensible und wenig transparente Liaison von<br />
Pharma-Industrie und Forschung unterminiert wird,<br />
indem Dritte-Welt-Patente den Markt gefährden. Patente<br />
helfen Botswana nur zum Teil, zerstören aber die ökonomische<br />
Infrastruktur der westlichen Länder. Den gordischen<br />
Knoten durchschlägt nur eine Impfung. Bis<br />
dahin können, so wenig das ist, Kondome Infektionen<br />
verhindern und Medikamente Leiden lindern. Es ist<br />
zuguterletzt unvertretbar, dass medizinische Leistungen<br />
in westlichen Ländern nicht angewandt beziehungsweise<br />
übernommen werden. Wie soll zum Beispiel Wissen<br />
über Resistenzen weitergegeben werden, wenn<br />
Resistenztests im eigenen Land nicht bezahlt werden?<br />
Ein Weniger besiegt Aids nicht,nur ein Alles. Das muss<br />
getan werden – ohne Einschränkung, hier wie dort!<br />
Stefan Boes
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
Wichtige Ergebnisse vom ”3 rd International<br />
Workshop on Salvage Therapy for HIV-<br />
Infection” (12.-14. April 2000, Chicago).<br />
Noch ist immer nicht genau definiert, was denn eigentlich<br />
eine ”Salvage Therapie” ist, normalerweise versteht<br />
man darunter aber die verbleibenden Therapiemöglichkeiten,<br />
wenn die erste und weitere Therapien<br />
versagt haben. Diese Therapien gestalten sich umso<br />
verzweifelter (und schwieriger für den Patienten), je mehr<br />
Vortherapien bereits versagt haben. Das Problem bei<br />
vielen Studien im Salvage-Bereich ist, dass sie erstens<br />
mit relativ kleinen Patientenzahlen gemacht wurden und<br />
zweitens rückblickend (retrospektiv) ausgewertet wurden.<br />
Beides verringert die Aussagekraft der Ergebnisse<br />
deutlich.<br />
Besser als Nichts<br />
Bei Patienten, bei denen schon die verschiedensten<br />
Therapiekombinationen ”verschlissen” wurden, gelingt<br />
es oftmals nicht mehr, die Viruslast dauerhaft unter die<br />
Nachweisgrenze zu senken. Bei diesen Patienten gibt es<br />
ein neues Therapieziel: Die Viruslast so weit wie möglich<br />
senken. Das klingt zwar banal, aber<br />
es konnte gezeigt werden, dass Patienten,<br />
die eine Viruslast über 5000/ml<br />
haben, ein zweieinhalbfach erhöhtes<br />
Risiko haben, innerhalb von einem Jahr<br />
das Vollbild AIDS zu erreichen oder<br />
zu sterben. Dem gegenüber hatten Patienten<br />
mit einer Viruslast über 500/<br />
ml aber unter 5000/ml praktisch kein<br />
erhöhtes Risiko im Vergleich zu den<br />
”Glücklichen”, die dauerhaft eine<br />
Viruslast unter 500/ml erzielten.<br />
Zumindest über den Zeitraum von einem<br />
Jahr lässt sich also auch mit einer<br />
mäßig erhöhten Viruslast ganz gut leben,<br />
wenn auch langfristig das Risiko<br />
einer Resistenzentwicklung und damit<br />
einem stärkeren Anstieg der Viruslast<br />
besteht.<br />
Neues zu Kombinationen aus<br />
Proteasehemmern<br />
cmin/korrigierte IC 95<br />
In Beschreibungen von neuen Substanzen findet man<br />
immer wieder zwei wichtige Kennzahlen: Die minimale<br />
Wirkstoffkonzentration im Blut (abgekürzt c min ) und die<br />
Konzentration des Wirkstoffs, bei der im Laborexperiment<br />
die Vermehrung von 50% bzw. 95% aller<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0,9<br />
Amprenavir<br />
1200 mg 2 x<br />
tgl.<br />
Viren verhindert werden kann (abgekürzt als IC 50 bzw.<br />
IC 95 vom Englischen ”Inhibitory Concentration”).<br />
Ein Problem besteht nun darin, dass im Körper des<br />
Menschen viele Arzneimittel nicht einfach so herumschwimmen,<br />
sondern an bestimmte Eiweißstoffe im Blut<br />
gebunden sind, man spricht hier von der ”Plasmaproteinbindung”.<br />
Diese kann unterschiedlich hoch sein.<br />
Wichtig ist, dass für eine medikamentöse Wirkung nur<br />
die ungebundene Menge des Wirkstoffs verfügbar ist.<br />
Beispiel: Eine Substanz hat eine Eiweißbindung von<br />
80%. Dann stehen effektiv für eine Wirkung nur 20%<br />
zur Verfügung! Bei den unterschiedlichen Proteasehemmern<br />
liegen nun die Werte für die Plasmaproteinbindung<br />
zwischen ca. 60% und über 98%. Das heißt,<br />
nur ein Bruchteil der aufgenommenen Substanz kann<br />
tatsächlich auch gegen das Virus wirken. Es macht also<br />
Sinn, die im Labor bestimmten IC 50 - oder IC 95 -Werte<br />
für die Plasmaproteinbindung zu korrigieren. Um nun<br />
die Vermehrung von HIV zuverlässig hemmen zu könne,<br />
sollte die Menge des Proteasehemmers im Blut immer<br />
größer sein als die um die Proteinbindung korrigierte<br />
IC 95 . Das Verhältnis von c min zu IC 95 sollte also immer<br />
größer 1 sein.<br />
Dies wurde nun für die einzelnen Proteasehemmer untersucht<br />
(siehe Grafik 1)<br />
3,7<br />
Indinavir 800<br />
mg alle 8 Std.<br />
Einzelsubstanzen<br />
1,8<br />
Nelfinavir<br />
750mg 3 x tgl.<br />
1,2<br />
Nelfinavir 1250<br />
mg 2 x tgl.<br />
Medikamente u. Dosierung<br />
Man kann schön erkennen, dass bei einigen Substanzen<br />
das Verhältnis kleiner als 1 ist. Das ist einer der Grün-<br />
2,4<br />
Ritonavir 600<br />
mg 2 x tgl.<br />
Grafik 1: Verhältnis von minimaler Konzentration<br />
von Proteasehemmern im Blut zu ihrer proteinkorrigierten<br />
minimalen Hemmkonzentration<br />
(Fortsetzung Seite 14)<br />
S<br />
11
12<br />
------<br />
------<br />
Gebrauchsinformation: NW=Nebenwirkungen,<br />
KI=Kontraindikationen, HW= Hinweis,<br />
DA= Dosisanpassung, WW=Wechselwirkungen<br />
NW: Anämie, Leuko-und Thrombopenie, Myopathie.<br />
Kopfschmerz. Anfangs GI(gastrointest.)-Symptome<br />
(Übelkeit, Erbrechen). DA: höhergrad. Niereninsuffizienz.<br />
KI: Anämie (Hb
13<br />
SQV<br />
DV<br />
NFV<br />
APV<br />
SQV<br />
RTV<br />
RTV<br />
RTV<br />
nd<br />
e)<br />
Gebrauchsinformation: NW=Nebenwirkungen,<br />
KI=Kontraindikationen, HW= Hinweis,<br />
DA= Dosisanpassung, WW=Wechselwirkungen<br />
NW: Initial verstärkt, dosisabhängig: 45% GI-Symptome,<br />
27% periorale Parästhesien. 23% Schwächegefühl,<br />
Hepatotoxizität. Lipodystrophie-Syndrom (gehäuft bei<br />
ART mit PI). ↑ Triglyzeride.<br />
WW: mit > 200 Medikamenten. Z.B. ↑ Plasmakonz. v.<br />
SQV, IDV, NFV (therap. genutzt, s. PI-Komb.). Cave z.B.<br />
Diazepam (Valium), Sildenafil (Viagra), Ecstasy!<br />
KI: Rifabutin, zahlr. weitere Med.! Schwere<br />
Leberinsuffizienz.<br />
NW: 20% Durchfall. Allergische Hautreaktionen.<br />
Lipodystrophie-Syndrom (gehäuft bei ART mit PI).<br />
KI: Komb.m.Terfenadin etc.(s.Saquinavir), siehe Fachinfo!<br />
WW: ↑ Plasmakonz. v. SQV, IDV, RTV. ↓ Plasmakonz. v.<br />
oralen Kontrazeptiva (andere Methoden empfohlen)<br />
DA: Komb. mit Rifabutin: Rifabutin-Dosis halbieren.<br />
NW: GI-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall),<br />
Kopfschmerzen, Exanthem (2. Behandlungswoche).<br />
KI:: Komb.m.Terfenadin etc.(s.Saquinavir), siehe Fachlit.<br />
WW: ↑ Plasmakonz.von Rifabutin (200%).↓ Plasmakonz.<br />
von APV durch Rifampicin (80%, deshalb KI) ,<br />
KI: Komb.m.Terfenadin,Astemizol,Cisaprid,Triazolam,<br />
Midazolam,Alprazolam, etc., siehe Fachinfo.<br />
NW: 17% allergische Hautreaktionen, in 8% schwer.<br />
Vorsicht bei Nieren- u. Leberinsuffizienz.<br />
WW: ↓ Plasmakonz. v. APV; SQV u. IDV: um ca. 30 %<br />
(DA erforderlich); orale Kontrazeptiva (andere Methoden<br />
empfohlen)<br />
NW: ca. 20 % Exanthem ab 10. Tag nach Behandlungsbeginn.<br />
Häufig ZNS-Symptome (Schwindel, Benommenheit<br />
Konzentrationsstörungen bewegte Träume) v a<br />
Einnahmehinweise<br />
Am besten zu einer<br />
Mahlzeit<br />
Ohne RTV: Zu einer Mahlzeit.<br />
Mit RTV: Nahrungsunabhängig<br />
Nüchtern oder zu einer<br />
Mahlzeit<br />
Nüchtern oder zu einer<br />
Mahlzeit<br />
Nüchtern oder zu einer<br />
nicht fettreichen Mahlzeit<br />
(Wg mögl ZNS NW<br />
DM-Kosten<br />
1OP / 30 Tg.<br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
1050 / 1125<br />
1042 / 1050<br />
1165 / 1165<br />
.... / 2024<br />
.... / 1527<br />
935 / 1870<br />
.... / 1123<br />
.... / 1310<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
716 / 716<br />
958 / 958
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
de, warum man heute zunehmend Proteasehemmer<br />
kombiniert, vor allem mit Ritonavir. Ritonavir verlangsamt<br />
den Abbau der anderen Proteasehemmer im Körper<br />
und man erreicht damit höhere Wirkstoffmengen<br />
im Blut. Die Ergebnisse für die untersuchten Kombinationen<br />
sind in Grafik 2 wiedergegeben.<br />
Grafik 2: Verhältnis von minimaler Konzentration<br />
von Proteasehemmerkombinationen im Blut zu<br />
ihrer proteinkorrigierten minimalen Hemmkonzentration<br />
Es ist unschwer zu erkennen, dass Ritonavir als ”Turbo”<br />
für die anderen Proteasehemmer wirkt. Aber Achtung!<br />
Je höher die Wirkstoffspiegel der Proteasehemmer<br />
sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit von<br />
Nebenwirkungen! Deshalb ist nicht unbedingt die Substanz<br />
oder Substanzkombination, die in dieser Untersuchung<br />
am besten abschneidet, auch wirklich die<br />
geeignetste. Was nützt eine fantastische Wirkung, wenn<br />
die Nebenwirkungen unerträglich werden. Einmal mehr<br />
sind die Ärzte gefordert, aus dem Arsenal, das die Wissenschaft<br />
ihnen heute bietet, für den einzelnen Patienten<br />
den individuell besten Kompromiss aus Wirksamkeit<br />
und Verträglichkeit herauszupicken!<br />
Aus den Ergebnissen lässt sich aber jetzt schon sagen,<br />
dass die heute verfügbaren Proteasehemmer in Zukunft<br />
immer weniger alleine sondern vermehrt in Kombinationen<br />
(vor allem mit Ritonavir) eingesetzt werden. Die<br />
Firma Abbott selbst wird ja ihren neuesten<br />
Proteasehemmer ABT-378 gleich mit Ritonavir in einer<br />
Kapsel anbieten.<br />
Kommentar: Aus unserer Sicht ist die Diskussion um<br />
die ”richtige” Kombination von Indinavir und<br />
14<br />
Cmin/korrigierte IC95<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
3,7<br />
Proteasehemmer-Kombinationen (mit Riton<br />
heller Balken = Ritonavir,<br />
dunkler Balken = anderer PI<br />
NT = nicht getestet<br />
1,7 1,1<br />
6,7<br />
NT<br />
24,2<br />
2,9<br />
28,6<br />
IDV SQV/RTV APV/RTV IDV/RTV IDV/RTV IDV<br />
800 q8h 400/400 1200/200 400/400 800/100 800/<br />
Kombination u. Dosierung (2 x tgl.)<br />
0,5<br />
Ritonavir eine Marketingschlacht der beiden Herstellerfirmen<br />
MSD und Abbott. Egal ob zweimal täglich<br />
”400/400” (400 mg Crixivan ® + 400 mg Norvir ® )<br />
oder ”800/100” (800 mg Crixivan ® + 100 mg Norvir ®<br />
), beide Kombinationen sind vermutlich deutlich stärker<br />
wirksam als Crixivan ® oder Norvir ® allein. Auch<br />
das Argument von Abbott, ”400/400” sei eine ”echte<br />
Doppelkombination” können wir nicht ganz nachvollziehen,<br />
da die HIV-Protease schließlich nur ein aktives<br />
Zentrum hat und beide Substanzen fast identische<br />
Resistenzmuster haben. Egal wieviele Proteasehemmer<br />
man gibt, es kann<br />
68,<br />
nur einer an die Protease<br />
binden! Der Unterschied der<br />
verschiedenen Dosierungskombinationen<br />
liegt vor allem<br />
in der Verträglichkeit.<br />
Für viele Patienten können<br />
400 mg Norvir ® schon recht<br />
massive Nebenwirkungen<br />
verursachen. Auf der anderen<br />
Seite besteht bei ”800/<br />
100” wahrscheinlich ein<br />
leicht erhöhtes Risiko für<br />
Nierennebenwirkungen, z.B.<br />
Nierensteine. Man muss also<br />
weiterhin sehr viel trinken!!!<br />
Vermutlich gibt es nicht die<br />
optimale Kombination für<br />
jeden Patienten. Der eine wird mit ”800/100” besser<br />
klarkommen, der andere mit ”400/400”. Eine Ausnahme<br />
sind Patienten, bei denen bereits mehrere Therapien<br />
versagt haben. Für diese könnte ”800/200”<br />
(800 mg Crixivan ® + 200 mg Norvir ® ) eine echte<br />
Chance bedeuten, allerdings wieder mit erhöhtem<br />
Nierensteinrisiko. Auch diese Dosierung wir zur Zeit<br />
in klinischen Studien untersucht.<br />
Und noch eins drauf: Proteasehemmer-<br />
Dreifachkombi<br />
Auf Grund von Labordaten schlagen Forscher von<br />
Glaxo vor, die drei Proteasehemmer Amprenavir<br />
(Agenerase ® ), Saquinavir (Fortovase ® )und Ritonavir<br />
(Norvir ® ) zu kombinieren. Die genaue Dosierung für<br />
eine mögliche Studie steht noch nicht fest, vorgeschlagen<br />
wurde aber die zweimal tägliche Gabe von 600 mg<br />
Amprenavir, 800 mg Saquinavir und 100 mg Ritonavir<br />
(immerhin 22 Kapseln pro Tag). Der Grund für diese<br />
ungewöhnliche Kombination ist zum einen, dass die<br />
Substanzen gegenseitig ihren Abbau verlangsamen und<br />
somit von den Einzelmedikamenten weniger eingenommen<br />
werden muss. Zum anderen sind HI-Viren, die die
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
typische Amprenavir-Resistenzmutation I50V haben,<br />
besonders empfindlich gegen Saquinavir. Nachteil des<br />
Verstärkereffekts: auch die Hauptnebenwirkung von<br />
Amprenavir und Saquinavir (Durchfall) wird verstärkt.<br />
Nun müssen Studien zeigen, ob diese Kombination in<br />
der Praxis hält, was man sich theoretisch davon verspricht.<br />
Viel hilft viel, oder?<br />
Bei Patienten, die bereits mehrere verschiedene Therapien<br />
hinter sich haben, die alle versagt haben, bleiben<br />
praktisch keine ”vernünftigen” Behandlungsoptionen.<br />
In ihrer Verzweiflung stellen die Ärzte dann eine sogenannte<br />
”Mega-HAART” oder ”MDRT” (Multi Drug<br />
Rescue Therapy) zusammen, die 5 oder mehr Medikamente<br />
umfasst. Doch trotz eigentlich hochwirksamer<br />
(und nebenwirksamer) Kombinationen kommt in den<br />
verschiedenen Studien bei nur etwa 30-40% der Patienten<br />
die Viruslast zumindest kurzfristig wieder unter die<br />
Nachweisgrenze. Rühmliche Ausnahmen: Eine Studie<br />
aus England (von Mike Youle), bei der nach 60 Wochen<br />
78% der Patienten eine Viruslast von weniger als 50<br />
Kopien/ml hatten! Youle selbst gibt einige Erklärungsversuche,<br />
warum seine Patienten besser abschneiden:<br />
- Viele Patienten erhielten zunächst so viele Medikamente,<br />
wie sie nur vertrugen. Nach ca. 12 Wochen<br />
wurde dann auf eine individuell reduziertes<br />
Therapieschema umgestellt.<br />
- Um die medikamentöse Einstellung zu erleichtern,<br />
erfolgte sie bei einigen Patienten im Krankenhaus.<br />
- Fast alle Patienten hatten eine Kombination aus<br />
Indinavir und Ritonavir (800/200 oder 800/400)<br />
als Bestandteil ihrer Therapie.<br />
- Patienten, bei denen diese Kombination versagte,<br />
erhielten ABT-378/r und Foscarnet.<br />
- Den Patienten wurde eindringlich klar gemacht, dass<br />
dies wahrscheinlich ihre letzte Chance ist. Sie hatten<br />
einen Arzt als Ansprechpartner, den sie jederzeit<br />
kontaktieren konnten.<br />
- Es gab eine Vielzahl von Therapieunterbrechungen,<br />
jedoch konnte in dieser Untersuchung kein Vorteil<br />
für die Patienten gefunden werden.<br />
Zusammenfassend sieht es so aus, dass vor einer Salvage-<br />
Therapie der Grund für das Versagen der vorhergegangenen<br />
Therapien gefunden werden sollte. Nur so ist es<br />
möglich, eine Erfolg versprechende Kombination für<br />
den Patienten zusammenzustellen. Ganz wichtig ist offensichtlich<br />
auch die Therapiebegleitung durch Ärzte,<br />
Krankenschwestern und das soziale Umfeld des Patienten.<br />
So kann er motiviert werden, trotz evtl. massiver<br />
Nebenwirkungen durchzuhalten.<br />
Neues von der Front<br />
Bei einem Salvage-Workshop dürfen natürlich auch<br />
Berichte zu neuen bzw. ”wiederentdeckten” Substanzen<br />
nicht fehlen:<br />
Foscarnet (Foscavir ® ): Diese Substanz wird als Infusion<br />
für die Behandlung der CMV-Infektion eingesetzt,<br />
die im Endstadium von AIDS zur Netzhautentzündung<br />
und schließlich zur Erblindung führen kann.<br />
Man weiß schon seit längerer Zeit, dass Foscarnet auch<br />
eine gewisse Wirkung gegen HIV hat, bisher wurde es<br />
aber wegen seiner massiven Nebenwirkungen nur zur<br />
Behandlung der CMV-Infektion eingesetzt. Einer<br />
amerikanischen Forschergruppe gelang es, chemische<br />
Abwandlungen dieser Substanz herzustellen, die im<br />
Reagenzglas eine deutlich stärkere Wirkung gegen HIV<br />
haben. Außerdem werden HI-Viren, die eine Resistenz<br />
gegen diese Foscarnet-Abkömmlinge entwickelt haben,<br />
wieder empfindlich gegen AZT. Im Tierversuch konnten<br />
die neuen Substanzen oral gegeben werden, es waren<br />
keine Infusionen erforderlich. Nun wird untersucht,<br />
welche der neuen Substanzen für weitergehende Untersuchungen<br />
am Menschen in Frage kommen.<br />
WF 10: Eine Substanz, die indirekt wirkt, indem sie die<br />
Funktion der Makrophagen (Fresszellen) und die Produktion<br />
entzündungsfördernder Botenstoffe reguliert.<br />
Da die Studie noch nicht abgeschlossen ist, kann man<br />
über die Wirksamkeit noch nichts aussagen, aber der<br />
Ansatzpunkt ist zumindest vielversprechend und könnte<br />
zu einer sinnvollen Ergänzung bisheriger Therapien<br />
führen.<br />
Interferon alpha: Eigentlich nicht mehr so ganz neu<br />
wurde Interferon wegen seiner Nebenwirkungen bisher<br />
nur bei speziellen Krankheiten eingesetzt. Nun konnte<br />
eine kleine Studie zeigen, dass bei den Patienten, die<br />
eine relativ niedrige Dosis Interferon zusätzlich zur<br />
antiretroviralen Kombitherapie erhielten, die Viruslast<br />
schneller unter die Nachweisgrenze sank. Auf der Basis<br />
dieser Ergebnisse werden evtl. weitere Studien gestartet.<br />
NNRTI-Doppelkombis: Kombinationen aus<br />
Nukleosidanaloga gehören zu fast jeder antiretroviralen<br />
Therapie. Proteasehemmerkombis setzen sich mehr und<br />
mehr durch. Nun fragen Forscher, ob man nicht auch<br />
NNRTI kombinieren könnte (NNRTI sind Sustiva ®<br />
, Viramune ® und Rescriptor ® ). Diese Kombinationen<br />
sind aber nicht unproblematisch, da sie sich gegenseitig<br />
und auch in Wechselwirkungen mit Proteashemmern in<br />
15
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
den Blutspiegeln beeinflussen. Außerdem gibt es eigentliche<br />
keinen theoretischen Grund für den Einsatz von<br />
zwei verschiedenen Medikamenten, die beide an die selbe<br />
Zielstruktur binden. Es wäre sogar denkbar, dass<br />
dadurch die antivirale Wirksamkeit abgeschwächt wird.<br />
– Insgesamt eine müßige Diskussion, solange alles Theorie<br />
ist und keine klinischen Daten existieren.<br />
Therapieunterbrechungen<br />
Seit einiger Zeit sorgt die Diskussion um die Möglichkeit<br />
von Therapieunterbrechungen für Aufregung. Zum<br />
einen, weil theoretisch tatsächlich die Möglichkeit besteht,<br />
dass das Immunsystem dadurch ”trainiert” wird,<br />
zum anderen, weil eine Pause von der mühsamen<br />
Medikamenteinnahme für viele HIV-Infizierte sehr attraktiv<br />
wäre.<br />
Bei der Interpretation von Studienergebnissen zu diesem<br />
Thema sollte man aber drei Patientengruppen ganz<br />
genau auseinander halten:<br />
1) Patienten, die unmittelbar nach ihrer HIV-Infektion<br />
mit einer Therapie begonnen haben und für längere Zeit<br />
eine Viruslast unter der Nachweisgrenze hatten.<br />
2) Patienten, die bereits längere Zeit infiziert waren,<br />
bevor sie mit einer medikamentösen Behandlung gegen<br />
HIV begonnen haben.<br />
3) Patienten, bei denen bereits mehrere verschiedene<br />
Therapien versagt haben. Sie haben meist eine niedrige<br />
CD4-Zellzahl und eine relative hohe Viruslast.<br />
Die besten Daten zu Therapiepausen gibt es momentan<br />
für die 3. Gruppe. Die Überlegung, die hinter den<br />
Behandlungsunterbrechungen steht, ist, dass resistente<br />
HI-Viren sich in aller Regel schlechter vermehren können<br />
als der Wildtyp. Nur in Gegenwart von Medikamenten<br />
haben resistente Viren bessere Chancen. Lässt<br />
man nun alle Medikamente weg – so die Überlegung –<br />
werden die resistenten Viren im Laufe der Zeit vom<br />
Wildtyp verdrängt und die Medikamente wirken wieder.<br />
Soweit die Theorie. Doch leider können sich die resistenten<br />
Virusvarianten über sehr lange Zeit im Körper<br />
verstecken. Werden die Medikamente dann wieder eingesetzt,<br />
kommen sie gewissermaßen aus ihrem Versteck<br />
und vermehren sich wieder. So zeigt auch eine Analyse<br />
des Studienzentrums an der Frankfurter Uniklinik, wo<br />
mit dieser Art von Therapieunterbrechungen wohl in<br />
Deutschland die meisten Erfahrungen gesammelt wurden,<br />
dass die Patienten durch die Unterbrechung einem<br />
erheblichen Risiko ausgesetzt sind: Zunächst fällt die<br />
CD4-Zellzahl deutlich ab und die Viruslast steigt an.<br />
Nehmen die Patienten dann wieder eine Therapie ein,<br />
16<br />
kommt es oft wieder zu einem kurzzeitigen Rückgang<br />
der Viruslast. Dieser hält aber bei den meisten Patienten<br />
nur kurze Zeit an. Wesentlich länger dauert es, den<br />
Verlust der CD4-Zellen auszugleichen, falls es überhaupt<br />
gelingt. Fällt die CD4-Zellzahl während der Therapiepause<br />
unter 200/mm³, haben die Patienten zusätzlich<br />
noch ein erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen.<br />
Über die anderen beiden Gruppen gibt es derzeit noch<br />
sehr wenig Daten, theoretisch wäre es zumindest denkbar,<br />
dass die erste Gruppe von Therapiepausen profitieren<br />
könnte. Für die zweite Gruppe (chronisch Infizierte)<br />
ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Behandlung<br />
so lange fortzusetzen, bis es einen Impstoff gibt, der<br />
ebenso ein Training des Immunsystems ermöglicht aber<br />
nicht die Risiken der wiederaufflammenden Virusvermehrung<br />
birgt.<br />
Falls man wegen unbeherrschbarer Nebenwirkungen zu<br />
einer Therapiepause gezwungen wird, wäre es sicher<br />
sinnvoll, dies nach Möglichkeit im Rahmen einer Studie<br />
zu tun oder zumindest alle relevanten Laborwerte engmaschig<br />
überwachen zu lassen.<br />
Komplikationen und Nebenwirkungen der<br />
Salvage-Therapie<br />
Laktatazidose<br />
Obwohl die Laktatazidose schon seit den frühen Tagen<br />
von AZT bekannt ist, widmet man ihr erst seit kurzem<br />
die gebührende Aufmerksamkeit. Um zu verstehen zu<br />
können, wie es zur Laktatazidose kommen kann, muss<br />
man sich den Wirkmechanismus der Nukleosidanaloga<br />
(wie Retrovir ® , Epivir ® , Combivir ® , Zerit ® , Videx ® ,<br />
Hivid ® und Ziagen ® ) noch einmal in Erinnerung rufen:<br />
Zur Vermehrung seines Erbmaterials braucht das HI-<br />
Virus bestimmte Bausteine, sogenannte Nukleoside.<br />
Diese werden aneinander gereiht wie Perlen auf einer<br />
Schnur. Nukleosidanaloga haben nun eine ähnliche chemische<br />
Struktur wie die natürlichen Nukleoside, verhindern<br />
aber, dass die Kette verlängert werden kann.<br />
Es kommt also zum Kettenabbruch und das Erbmaterial<br />
des Virus kann nicht vervielfältigt werden. Menschliche<br />
Zellen leiden unter diesen Nukleosidanaloga relativ<br />
wenig, da in den Zellen eine Art ”Korrekturleser” arbeitet,<br />
der die Nukleosidanaloge erkennen kann und<br />
wieder durch die natürlichen Nukleoside ersetzt. Somit<br />
wird die Vermehrung menschlicher Zellen durch die<br />
antiviral wirksame Konzentrationen von<br />
Nukleosidanaloga normalerweise kaum beeinträchtigt.<br />
Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme: Die ”Kraftwerke”<br />
der Körperzellen, die sogenannten Mitochond-
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
rien haben ihr eigenes Erbmaterial und vervielfältigen<br />
sich auch teilweise unabhängig vom Apparat der Köperzellen.<br />
Die Mitochondrien besitzen aber keine Korrekturfunktion.<br />
Damit können die Nukleosidanaloga langfristig<br />
die Vermehrung von Mitochondrien verlangsamen<br />
und die Körperzellen verarmen an Mitochondrien. Da<br />
diese aber für die Energiegewinnung zuständig sind,<br />
müssen die Körperzellen immer mehr auf weniger effektive<br />
Formen der Energiegewinnung ausweichen (auf<br />
den sogenannten anaeroben Stoffwechsel) und dabei<br />
entsteht Milchsäure (Laktat). Sammelt sich zuviel Milchsäure<br />
an, kommt es zu einer Übersäuerung des Bluts<br />
und des Gewebes (Azidose), eben der Laktatazidose.<br />
Die Beschwerden, die eine Laktatazidose verursachen<br />
kann, sind recht unterschiedlich. Im Vordergrund steht<br />
meistens eine verringerte Leistungsfähigkeit und schnelle<br />
Ermüdbarkeit. An den Laktatwerten im Blut kann der<br />
Arzt erkennen, ob eine Laktatazidose für diese Symptome<br />
verantwortlich ist. Glücklicherweise kommt es nur<br />
bei sehr wenigen Patienten, die Nukleosidanaloga einnehmen,<br />
zu einer so schweren Form der Laktatazidose,<br />
dass sie tatsächlich Beschwerden bekommen. Dann aber<br />
kann dies sogar zum Tode führen.<br />
Periphere Neuropathie<br />
Die Periphere Neuropathie, eine Schädigung der Nerven<br />
(vor allem in Armen und Beinen), führt zu verringerten<br />
Empfindungen oder sogar schweren Schmerzen<br />
in den betroffenen Gliedmaßen. Man nimmt an, dass<br />
vor allem Nervenzellen sehr empfindlich auf den Verlust<br />
ihrer ”Kraftwerke” (Mitochondrien, s.o.) reagieren<br />
und dass deshalb die Symptome auftreten. Eine englische<br />
Arbeitsgruppe kam zu den Schluss, dass die Substanz<br />
L-Acetyl-Carnitin die Symptome bessern kann.<br />
Noch unklar ist aber die Dosierung. Der Hersteller<br />
empfiehlt, zweimal täglich 4 ml zu injizieren, um eine<br />
signifikante Wirkung zu erzielen. Ob L-Acetyl-Carnitin<br />
auch in Tablettenform wirkt, ist noch nicht ausreichend<br />
untersucht. Entsprechende Versuche mit einer verwandten<br />
Substanz, dem Carnitin, verliefen leider negativ.<br />
Kommentar: Man wird den Verdacht nicht los, dass<br />
in vielen Salvage-Therapiestudien Medikamente wüst<br />
drauflos kombiniert werden. Sinnvoller scheint es da<br />
zu sein, zunächst einmal herauszufinden, warum denn<br />
die bisherigen Therapien versagt haben und, falls<br />
möglich, diese Hindernisse zu beseitigen.<br />
Klar ist mittlerweile auch, dass die vielbeschworenen<br />
Therapiepausen nicht den durchschlagenden Effekt<br />
bringen, den man sich gewünscht hatte. Im Gegenteil,<br />
für die Mehrzahl der Patienten bedeuten sie ein nicht<br />
zu unterschätzendes Risiko. Auch die Langzeit-<br />
nebenwirkungen vieler Salvage-Therapieregimes können<br />
die Lebensqualität der Patienten zusätzlich beeinträchtigen.<br />
Dennoch kann mit solchen Kombinationen<br />
noch ein bestimmter Anteil von Patienten eine<br />
Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze erreichen.<br />
Schwierig ist vorherzusagen, welche Patienten dies<br />
sein werden. Falls eine Senkung der Viruslast unter<br />
die Nachweisgrenze nicht mehr möglich ist, profitieren<br />
die Patienten zumindest kurz- und mittelfristig auch<br />
von einer teilweisen Unterdrückung der Virusvermehrung.<br />
Es wird zunehmend wichtiger, Therapiestrategien<br />
zu erstellen, d.h. nicht nur die eingesetzten<br />
Medikamente mit Bedacht auszuwählen, sondern auch<br />
alle Begleitumstände und die Lebensgewohnheiten der<br />
Patienten gebührend zu würdigen und bei der<br />
Therapieentscheidung zu berücksichtigen.<br />
Quellen: Bernd Vielhaber: FaxReport 8,9,10/2000;<br />
NATAP; Merck Manual (deutsch, 5. Auflage). Übersetzt/bearbeitet<br />
von Helmut B.<br />
Rauchen und HIV erhöht das Risiko eines<br />
Lungenemphysems<br />
Bei einem Lungenemphysem werden durch schädigende<br />
Einflüsse die feinsten Strukturen der Lunge, die Lungenbläschen,<br />
geschädigt und ”verschmelzen” zu größeren<br />
Strukturen, die aber eine viel kleinere Oberfläche<br />
haben. Deshalb steht dann weniger Oberfläche für den<br />
Gasaustausch zur Verfügung und die Betroffenen leiden<br />
unter Atemnot. Eine chronische Bronchitis, Asthma<br />
oder Rauchen können zur Entwicklung eines Lungenemphysems<br />
beitragen. Forscher fanden nun heraus,<br />
dass eine HIV-Infektion bei Rauchern das Risiko für<br />
ein Lungenemphysen deutlich erhöht: Bei 17 von 114<br />
HIV-Positiven wurde ein Lungenemphysem festgestellt,<br />
jedoch nur bei einem Probanden einer Kontrollgruppe<br />
von 44 HIV-Negativen. Dieser Unterschied ist statistisch<br />
signifikant (s.u.). Die beiden Gruppen waren hinsichtlich<br />
anderer Faktoren (Alter, Rauchgewohnheiten,<br />
etc.) vergleichbar. Allerdings nahmen nur wenige der<br />
HIV-Infizierten antiretrovirale Medikamente ein.<br />
Die Forscher nehmen an, dass die HIV-Infektion die<br />
durch das Rauchen verursachten Gewebeschäden verstärkt.<br />
Quelle: FaxReport 8/2000<br />
Was heißt eigentlich ”statistisch signifikant”?<br />
In Studienergebnissen wird immer wieder der Begriff<br />
”statistisch signifikant” gebraucht. Was kann man sich<br />
17
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
darunter vorstellen? Nun, man kann eine Studie natürlich<br />
immer nur mit einer begrenzten Anzahl von Patienten<br />
durchführen. Deshalb besteht immer ein gewisses<br />
Risiko, dass die Ergebnisse zufällig zu Stande gekommen<br />
sind. Nehmen wir das Beispiel aus der oben<br />
angegebenen Untersuchung: 17 von 144 HIV-Positiven<br />
hatten ein Lungenemphysem, aber nur einer von 44 HIV-<br />
Negativen. Dieses Ergebnis beruht mit einer Wahrscheinlichkeit<br />
von etwa 2,5% auf Zufall. Wie man dies<br />
errechnet, können mathematisch Interessierte in einschlägigen<br />
Statistiklehrbüchern nachlesen.<br />
In der medizinischen Forschung hat es sich eingebürgert,<br />
eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% zu akzeptieren.<br />
Im Allgemeinen werden allso Ergebnisse, bei<br />
denen der p-Wert unter 0,05 liegt, als ”statistisch signifikant”<br />
bezeichnet. Das heißt also nichts anderes, als<br />
dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis nur<br />
zufällig zu Stande gekommen ist, geringer ist als 5%! In<br />
wissenschaftlichen Publikationen findet sich statt der<br />
leicht verständlichen Prozentangabe meist nur ein lapidares<br />
”p
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
fetthaltigen Getränke (Milch!) zu sich genommen hat.<br />
Zwar werden die Cholesterinwerte durch Nahrung kurzfristig<br />
nur wenig beeinflusst, aber die Triglyzeridwerte<br />
können deutlich ansteigen.<br />
Da die Werte für das LDL-Cholesterin normalerweise<br />
nicht direkt bestimmt werden, sondern aus dem Gesamt-Cholesterin,<br />
dem HDL-Cholesterin und den<br />
Triglyzeriden berechnet werden, können auch diese errechneten<br />
Werte durch Nahrungsaufnahme verfälscht<br />
werden. Um einen Vergleichswert zu haben, sollte vor<br />
Therapiebeginn ein kompletter Status der Blutfette erhoben<br />
werden, dann das erste mal ein bis zwei Monate<br />
nach Beginn der antiretroviralen Therapie und anschließend<br />
alle drei bis sechs Monate.<br />
Liegen die Triglyzeridwerte über 400 mg/dl, liefern die<br />
Rechenformeln für die Bestimmung des LDL-Cholesterins<br />
keine verlässlichen Werte mehr. Dann muss das<br />
LDL separat bestimmt werden, was natürlich wieder<br />
extra kostet.Für die Beurteilung, ob ein erhöhtes Risiko<br />
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht, wird der Arzt<br />
neben den erwähnten Laborwerten noch andere Risikofaktoren<br />
berücksichtigen, z.B. Familiengeschichte (gab<br />
es Herzinfarkte in der Familie?), Rauchen, Bluthochdruck,<br />
Bewegungsarmut, Diabetes, Übergewicht. Auch<br />
bestimmte Medikamente (Hormone, Betablocker, Diuretika)<br />
können die Blutfette beeinflussen und damit das<br />
Risko erhöhen.<br />
Wann soll man handeln?<br />
Die Experten setzen bei HIV-Infizierten im Prinzip<br />
die gleichen Grenzwerte wie bei nicht Infizierten:<br />
Tabelle 1: Grenz- und Zielwerte für das LDL-<br />
Cholesterin<br />
Risiko<br />
Ohne koronare<br />
Herzkrankheit, und<br />
weniger als 2<br />
Risikofaktoren<br />
Ohne koronare<br />
Herzkrankheit,<br />
aber mehr als 2<br />
Risikofaktoren<br />
Mit koronarer<br />
Herzkrankheit<br />
Diätetische<br />
Maßnahmen<br />
Medikamentöse<br />
Maßnahmen<br />
LDL<br />
> 160 mg/dl > 190 mg/dl < 1<br />
> 130 mg/dl > 160 mg/dl < 1<br />
> 100 mg/dl > 130 mg/dl < 1<br />
Risikofaktoren sind Alter (Männer über 45, Frauen über<br />
55), koronare Herzkrankheit bei Vater oder Mutter,<br />
Rauchen, Bluthochdruck, niedriges HDL, Diabetes. Bei<br />
einem HDL über 60 mg/dl darf man einen Risikofaktor<br />
abziehen.<br />
Für die Triglyzeride ist das ganze etwas einfacher: Bei<br />
Werten über 200 mg/dl sollte die Ernährung verändert<br />
werden und mehr Ausdauersport betrieben werden.<br />
Spätestens bei Werten über 1000 mg/dl sollten medikamentöse<br />
Maßnahmen ergriffen werden. Patienten, die<br />
ein erhöhtes Risiko für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung<br />
haben, sollten schon bei Werten über 500<br />
mg/dl behandelt werden.<br />
Wie wird behandelt?<br />
Zunächst wird der Arzt allgemeine Maßnahmen empfehlen:<br />
Mehr (Ausdauer-)Sport, fett- und cholesterinarme<br />
Ernährung, Einschränkung des Alkoholkonsums und<br />
Aufhören mit dem Rauchen.<br />
Falls das alles nichts hilft, kommen wieder einmal Medikamente<br />
zum Einsatz.<br />
Für die Senkung des Cholesterins werden heute sog.<br />
”Statine” eingesetzt.. Beispiel für Statine sind: Sortis ® ,<br />
Zocor ® , Denan ® , Pravasin ® , Lipobay ® .<br />
Leider gibt es hier mögliche Interaktionen mit Proteasehemmern<br />
und NNRTI. Diese können zu Muskelempfindlichkeit<br />
und –schmerzen führen. Von den<br />
Statinen, die heute auf dem Markt sind, hat Pravastatin<br />
vermutlich das geringste Risiko für eine Interaktion mit<br />
HIV-Medikamenten. Dennoch sollte immer mit einer<br />
niedrigen Dosis begonnen werden.<br />
Erhöhte Triglyeride können mit sog. ”Fibraten” behandelt<br />
werden, z.B. mit Cedur ®.<br />
Problematisch wird es, wenn sowohl Cholesterin als auch<br />
Triglyceride gesenkt werden müssen. Die Kombination<br />
von Statinen und Fibraten erhöht nämlich wieder das<br />
Nebenwirkungsrisiko...<br />
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, die<br />
antiretrovirale Therapie zu ändern. Aber auch das ist<br />
eine heikle Angelegenheit, gerade wenn<br />
sie gut wirkt und man sie subjektiv gut<br />
verträgt. In Untersuchungen, die<br />
allerdings noch über recht kurze Zeiträume<br />
gingen, wurde ein Rückgang der<br />
Fettwerte beobachtet, wenn die Patienten<br />
von Proteasehemmern auf<br />
Nevirapin oder Abacavir umgestellt<br />
wurden. Es ist aber noch nicht klar, ob<br />
bei diesen Patienten die Hemmung der<br />
Virusvermehrung langfristig genauso<br />
gut gelingt wie mit Proteasehemmern.<br />
Es gibt mal wieder kein Patentrezept<br />
– Arzt und Patienten sind gefragt und müssen (wie<br />
immer) den Nutzen und mögliche Risiken gegeneinander<br />
abwägen.<br />
19
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Zwei Fliegen mit einer Klappe?<br />
Interessant im Zusammenhang mit einer Cholesterinsenkung<br />
durch Statine sind neuere Studienergebnisse<br />
bei (HIV-negativen) Frauen nach der Menopause, die<br />
zeigen, dass durch diese Medikamente gleichzeitig die<br />
Knochendichte erhöht werden kann. Verlust an<br />
Knochenmasse (Osteoporose) wird in letzter Zeit als<br />
neue Langzeitnebenwirkung der antiretroviralen<br />
Kombinationstherapien diskutiert. Knochen enthalten<br />
lebendes Gewebe, das die Knochenstruktur ständig den<br />
wechselnden Bedürfnissen anpasst. Das heißt,<br />
normalerweise befindet sich der Auf- und Abbau von<br />
Knochensubstanz in einem Gleichgewicht. Gewinnt der<br />
Knochenabbau die Überhand, kommt es zur Osteoporose.<br />
Einige der heute verfügbaren Medikamente gegen<br />
Osteoporose hemmen den Knochenabbau, während<br />
durch die Statine scheinbar der Knochenaufbau stimuliert<br />
wird. Wenn sich die Studienergebnisse bestätigen,<br />
könnten mit dieser Medikamentenklasse zwei wichtige<br />
Nebenwirkungen der antiviralen Kombitherapie bekämpft<br />
werden.<br />
Quelle: CID (in press), Edwards et al., Lancet 2000;<br />
355:2218-19. Übersetzt/bearbeitet von Helmut B.<br />
20<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V.<br />
gratuliert seiner<br />
Redaktionskollegin<br />
Dr. Heidemarie Kremer<br />
und ihrem Mann Gholam<br />
zu der Geburt<br />
der Zwillinge<br />
Kianosh und Arman!<br />
Herzlichen Glückwunsch!<br />
Insulinresistenz durch Proteasehemmer?<br />
Bei Patienten unter HAART wurden auch Veränderungen<br />
des Zuckerstoffwechsels – bis hin zum Diabetes –<br />
beobachtet. Amerikanische Forscher fanden nun bei<br />
Versuchen an tierischen Zellen, dass alle untersuchten<br />
Proteasehemmer (Ritonavir, Indinavir und Amprenavir)<br />
ein bestimmtes Transportmolekül hemmen, das<br />
normalerweise Zucker auf Anweisung des Botenstoffs<br />
Insulin in die Muskelzellen schleust. Damit werden die<br />
Zellen ”insulinresistent” und es kommt zu erhöhten<br />
Blutzuckerspiegeln. Allerdings betrifft diese Hemmwirkung<br />
nur ein ganz bestimmtes Transportprotein<br />
namens Glut4. Alle anderen untersuchten Transporter<br />
wurden nicht oder nur wenig beeinflusst. Nun kann man<br />
spekulieren, dass bei einigen Patienten die anderen Transporter<br />
zu wenig aktiv sind und sie deshalb auf Glut4<br />
angewiesen sind. Dies könnten die Patienten sein, die<br />
auf eine Hemmung von Glut4, z.B. durch<br />
Proteasehemmer, besonders empfindlich reagieren.<br />
Allerdings ist noch unklar, in wie weit sich diese Laborergebnisse<br />
tatsächlich auf den Menschen übertragen<br />
lassen.<br />
Quelle: JBC Papers (in press). Übersetzt/bearbeitet<br />
von Helmut B.<br />
Zu Risiken und Nebenwirkungen...<br />
Mögliche Risiken des Agenerase-Safts<br />
Der Agenerase-Saft enthält als Hilfsstoff Propylenglykol.<br />
Patienten mit eingeschränkter Leber- und/oder Nierenfunktion<br />
und Patienten, die Disulfiram (Antabus ®<br />
, ein<br />
Mittel zur Alkoholentwöhnung) oder Metronidazol (z.B.<br />
Clont ®<br />
, ein Mittel gegen best. Infektionen) einnehmen,<br />
sollten deshalb nach Möglichkeit nur die Agenerase-<br />
Kapseln einnehmen! Auch Kinder unter vier Jahren und<br />
schwangere Frauen sollten den Agenerase-Saft nicht einnehmen.<br />
Patienten, die den Agenerase-Saft benötigen, sollten<br />
engmaschig auf mögliche Symptome einer Glykol-Überdosierung<br />
überwacht werden. Dies sind z.B. Krampfanfälle,<br />
Stupor (Erstarrung), Herzrasen,<br />
Hyperosmolarität (Veränderung der Blutzusammensetzung),<br />
Laktatazidose, Nierenschädigung<br />
und Hämolyse (Zersetzung der roten Blutkörperchen).<br />
Proteasehemmer und Methamphetamin<br />
(”Crystal”)<br />
Über eine mögliche tödliche Wechselwirkung zwischen<br />
Norvir ® und Methamphetamin (auch als Crystal bekannt),<br />
berichten australische Ärzte. Crystal ist in den<br />
USA und Australien eine verbreitete Partydroge.<br />
In Melbourne wurde ein 49jähriger Mann tot aufgefunden,<br />
nachdem er am Vorabend Methamphetamin gespritzt<br />
und Amylnitrit (”Poppers”) inhaliert hatte. Der<br />
Mann hatte eine Kombinationstherapie aus 400 mg<br />
Norvir ® und 400 mg Fortovase ® und Zerit ® (alles
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
zweimal täglich) eingenommen. Untersuchungen zeigten,<br />
dass er einen stark erhöhten Methamphetaminspiegel<br />
im Blut hatte. Methamphetamin wird in der Leber über<br />
ein bestimmtes Enzymsystem, das sogenannte<br />
Cytochrom P450 2D6 abgebaut. Dieses wird von Norvir<br />
gehemmt. Deshalb ist es vorstellbar, dass der Proteasehemmer<br />
den Abbau des Methamphetamins verlangsamt<br />
und somit zu einer tödlichen Überdosis geführt hat.<br />
Eventuell könnte auch das Poppers noch dazu beigetragen<br />
haben, da Poppers im Körper zur Bildung von Stickoxid<br />
führt, das ebenfalls ein Hemmstoff des<br />
Cytochromsystems ist.<br />
Nierenschädigung nach Langzeiteinsatz von<br />
Crixivan ®<br />
Ein Fallbericht beschreibt eine Patientin, die unter<br />
Langzeitbehandlung mit Crixivan ® eine Nierenschädigung<br />
und in Folge dessen einen Bluthochdruck<br />
entwickelte. Indinavir (Crixivan ® ) ist dafür bekannt, dass<br />
es bei einer Minderheit der Patienten Nierensteine verursacht.<br />
Diese verschwinden nach reichlichem Trinken<br />
oder spätestens nach Absetzen von Crixivan ® sehr<br />
schnell. Möglicherweise treten sehr selten aber auch<br />
andere Nebenwirkungen an der Niere auf: Eine 39jährige<br />
Frau, die seit sieben Jahren HIV-infiziert war, begann<br />
eine Kombinationstherapie mit Crixivan ® . Eine<br />
Ultraschalluntersuchung der Niere bei Behandlungsbeginn<br />
zeigte eine völlig normales Bild. Neun Monate<br />
nach Beginn der Behandlung wurde bei der Patientin<br />
ein Bluthochdruck (RR 180/115 mmHg) und eine leichte<br />
Erhöhung des Kreatininwerts festgestellt. Ein steigender<br />
Kreatininwert kann ein Hinweis auf eine beginnende<br />
Nierenschädigung sein. Zur Senkung des Blutdruck<br />
erhielt die Patientin einen ACE-Hemmer (Enalapril).<br />
Nach weiteren neun Monaten wurde sowohl mit Ultraschall<br />
als auch mit spezielleren Untersuchungsmethoden<br />
eine Nierenschädigung (Atrophie) festgestellt. Daraufhin<br />
wurde Crixivan ® durch Viracept ® ersetzt. Dies führte<br />
zu einem Absinken des Blutdrucks, die Kreatininwerte<br />
blieben allerdings leicht erhöht. Die Autoren folgern,<br />
dass eine Nierenschädigung unter Langzeiteinsatz von<br />
Crixivan ® auch ohne Steinbildung auftreten kann. Der<br />
mögliche Zusammenhang zwischen der Gabe von<br />
Crixivan ® und dem Auftreten eines Bluthochdrucks muss<br />
noch weiter untersucht werden.<br />
Quelle: FaxReport 11/2000, bearbeitet von Helmut B.<br />
Neues in Kürze<br />
Also doch ”hit early”?<br />
Jede Zelle unseres Körpers führt genau Buch, wie oft<br />
sie sich schon geteilt hat. Ähnlich wie Wehrdienstleistende<br />
beim Bund jeden Tag einen Zentimeter von<br />
ihrem Maßband abschneiden, um zu wissen, wie lange<br />
sie noch durchhalten müssen, hat jede Körperzelle ein<br />
”Maßband”, bei dem mit jeder Teilung ein Stück abgeschnitten<br />
wird. Ist das Maßband zu Ende, ist dies das<br />
Signal für die Zelle, zu sterben. Beim Menschen erlaubt<br />
Podiumsveranstaltung<br />
zu den Ergebnissen der<br />
XIII. Welt-AIDS-Konferenz in Durban<br />
und der<br />
37th ICAAC in Toronto<br />
Es berichten bei einer Podiumsveranstaltung:<br />
P.D. Dr. med. Johannes Bogner<br />
Klinikum Innenstadt, LMU München<br />
Dr. med. Hans Jäger<br />
Schwerpunktarzt München<br />
P.D. Dr. med. Jürgen Rockstroh<br />
Universität Bonn<br />
Prof. Dr. med. Schlomo Staszewski<br />
HIV-Studienambulanz Universität Frankfurt<br />
Moderation:<br />
Dr. med. Werner Becker, München<br />
Freitag, 20. Oktober 2000, 19 Uhr<br />
Hörsaal der Poliklinik<br />
Pettenkoferstrasse 8 a<br />
München<br />
(nähe Sendlinger Tor)<br />
Eine Gemeinschaftsveranstaltung von<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V. und der<br />
Münchner AIDS-Hilfe e.V.<br />
Mit freundlicher Unterstützung durch<br />
GLAXO WELLCOME<br />
EINTRITT FREI!<br />
21
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
das Maßband, die sogenannten ”Telomere” an<br />
den Enden der Chromosomen, ca. 50 Teilungen.<br />
Dies ist wahrscheinlich ein recht vernünftiges<br />
Maß, denn nach 50 Teilungen haben sich in einer<br />
menschlichen Zelle soviel Müll und Fehler,<br />
die bei den Teilungsvorgängen gemacht werden,<br />
angesammelt, dass es im Interesse des<br />
Gesamtorganismus günstiger ist, wenn diese Zelle<br />
stirbt.<br />
Amerikanische Forscher haben nun festgestellt, dass<br />
Immunzellen von HIV-Infizierten deutlich verkürzte<br />
Telomere aufwiesen. So hatten Patienten im Alter von<br />
37 Jahren Telomerlängen wie nicht HIV-Infizierte 75jährige.<br />
Dies ist nicht nur ein Laborbefund; die Immunzellen<br />
von HIV-Infizierten können sich tatsächlich nicht<br />
mehr so häufig teilen und so stark reagieren wie die<br />
gesunder Kontrollpersonen. Diese Ergebnisse bestärken<br />
die Idee, die Behandlung der HIV-Infektion sofort<br />
nach der Diagnose zu beginnen. Allerdings wurde bisher<br />
nicht nachgewiesen, dass eine antiretrovirale Behandlung<br />
die Alterung des Immunsystems wieder auf eine<br />
normale Geschwindigkeit abbremsen kann.<br />
Quelle: FaxReport 11/2000,<br />
bearbeitet von Helmut B.<br />
Hepatitis C – leicht hat’s einen<br />
Eine Ansteckung mit Hepatitis C erfolgt nach heutigem<br />
Wissensstand vor allem durch infiziertes Blut. Doch<br />
kann Hepatitis C nicht nur über gemeinsam benutzte<br />
Spritzen und vermutlich auch Sexualkontakte übertragen<br />
werden, es reichen schon mikroskopische Mengen<br />
Blut, wie sie z.B. bei der gemeinsamen Benutzung von<br />
Rasierapparaten oder Zahnbürsten ausgetauscht werden<br />
können. Besonders problematisch ist dies, da es gegen<br />
die Hepatitis C bis heute keine Impfung gibt und bei<br />
relativ vielen Hepatitis-C-Infizierten als Spätkomplikation<br />
ein Leberkrebs droht.<br />
Quelle: FaxReport 11/2000<br />
22<br />
Lesen, lernen, diskutieren,<br />
informiert bleiben:<br />
Mitglied werden bei<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V.<br />
<strong>Projekt</strong> WORKSHOPS<br />
Veranstaltungsreihe von <strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
e.V., München und Münchner AIDS-Hilfe e.V.<br />
zur Vermittlung von medizinischem/therapeutischem<br />
Grundwissen an HIV-Infizierte<br />
und ihre Freunde<br />
Unsere Workshops 2000<br />
25.09.2000 Indische Naturheilkunde -<br />
Möglichkeiten zur Unterstützung<br />
des Immunsystems<br />
Referentin: Dr.med. Annette<br />
Müller-Leisgang, München<br />
30.10.2000 Metabolische Nebenwirkungen<br />
der ART - wie<br />
geht es weiter?<br />
Referent: P.D. Dr. Johannes<br />
Bogner, Klinikum Innenstadt,<br />
LMU München<br />
27.11.2000 "Drug Holidays" - Für und<br />
Wider<br />
Referent: Dr. med. Hans<br />
Jäger, Praxisgemeinschaft<br />
Dr. med. Hans Jäger, Dr.<br />
med. Eva Jägel-Guedes,<br />
München<br />
Alle Veranstaltungen finden jeweils um 19.00<br />
Uhr im Cafe Regenbogen der MÜAH,<br />
München, Lindwurmstraße 71 statt.<br />
(U-Bahn: U 3, U 6, Haltestelle Goetheplatz)<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V.<br />
Telefon: 089 / 21 94 96 20<br />
Fax-Nr.: 089/ 21 03 12 35<br />
E-mail: projektinfo@munich.netsurf.de<br />
HIV-Therapie-Hotline Münchner AIDS-Hilfe<br />
Telefon: 089/ 54 46 47 21<br />
E-mail: therapie.hotline@muenchner-aidshilfe.de
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Jahrgang 8, Nr.4 Juli/August 2000<br />
”AIDS-Sterbehaus Lagoinha”<br />
Liebe Mitglieder und Leser/Innen von <strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong>,<br />
wir unterstützen seit 1997 das AIDS-Sterbehaus in<br />
Lagoinha nähe Sao Paulo/Brasilien. Dieses wird von<br />
einer Niederlassung der Kongregation der Franziskanerinnen<br />
in Au/Inn betreut. Mitglieder und Freunde von<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> haben für das AIDS-Sterbehaus<br />
mittlerweile einen Betrag von über DM 82.000,— gespendet.<br />
Dieser Betrag wurde verwendet<br />
für den Umbau der Küche,<br />
für eine Rollstuhlrampe, für die<br />
Sanierung des Speisesaals, für<br />
einen Patientenheber, für pflegerische<br />
und medizinische Geräte<br />
u.a.<br />
Wir können auf diese Weise<br />
ein wenig dazu beitragen, den<br />
Betroffenen, die das AIDS-<br />
Haus in Lagoinha zum Sterben<br />
aufsuchen, zu helfen.<br />
Unser Spendenkonto für<br />
Lagoinha lautet:<br />
Konto-Nr. 884 550 2<br />
BLZ: 70020500<br />
Bank für Sozialwirtschaft<br />
Stichwort: ”Lagoinha”<br />
Unsere Vertrauensperson bei<br />
den Franziskanerinnen ist<br />
Schwester Dominica. Sie war<br />
vor kurzem in Lagoinha. Wir<br />
erhielten von Ihr einen Bericht, den wir nachstehend im<br />
Wesentlichen wiedergeben wollen:<br />
”Heute nun möchte ich einen längeren Brief an Sie beginnen<br />
und ein wenig von meinen Eindrücken der Reise<br />
nach Brasilien erzählen. Es liegt zwar schon einige<br />
Monate zurück, aber die Erlebnisse stehen mir noch<br />
immer sehr konkret vor Augen, vor allem aber im Herzen.<br />
Das Bild, das ich Ihnen beigelegt habe, drückt eigentlich<br />
alles aus, was ich in den viereinhalb Wochen dort<br />
erleben durfte. Ich bräuchte eigentlich keine Worte dafür.<br />
Wenn ich die Zeit in Brasilien auf einen Nenner zusammenfassen<br />
müsste, würde ich mit Saint-Exupery sagen:<br />
”Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist<br />
für die Augen unsichtbar”. Genau dies hat Sr. Annunciata<br />
im Bild versucht festzuhalten, als sie mich zusammen<br />
mit Claudio, einem Patienten in Lagoinha, fotografierte.<br />
(Jetzt vor kurzem habe ich erfahren, dass er vier<br />
Wochen nach dieser Aufnahme heimgehen durfte zu<br />
seinem Herrn und Schöpfer).<br />
Das Wesentliche dieser wunderschönen Reise hat sich<br />
in meinem Innersten ereignet. Das hatte ich mir eigentlich<br />
auch gewünscht, dass es eine Reise mit ”Tiefgang”<br />
werden sollte, nicht nur oberflächlich, von einer Sightseeing-Tour<br />
zur anderen. Um dieses Geschenk habe ich<br />
auch gebetet, und Gott hat mein Beten ernst genommen.<br />
Ich wurde überreich mit ganz wertvollen Erfahrungen<br />
beschenkt, vor allem<br />
in der Begegnung mit den<br />
Armen. Von unserem<br />
Provinzhaus aus (Nähe Sao<br />
Paulo) konnte ich insgesamt<br />
dreimal nach Lagoinha fahren,<br />
und dort mit den<br />
Schwestern ihren Alltag teilen:<br />
Sorge um die ihnen anvertrauten<br />
Patienten, aber<br />
auch die Sorge um arme<br />
Familien, die am Stadtrand<br />
von Lagoinha in Favelas<br />
wohnen. Es sind zum Teil<br />
Angehörige der Patienten.<br />
Für mich war es das erste<br />
Mal in meinem Leben, dass<br />
ich solch grosser Armut begegnet<br />
bin. Das hinterlässt<br />
schon Spuren in einem Herzen.<br />
Die erste Begegnung mit<br />
Lagoinha (wie oft hatte ich diesen Namen schon ausgesprochen<br />
oder geschrieben und an die Bewohner des<br />
AIDS-Hauses gedacht....) war sehr intensiv. Wenn man<br />
über Jahre einem Ort und seinen Menschen verbunden<br />
ist, vieles von Erzählungen und Fotos her kennt oder<br />
besser: meint zu kennen, und dann steht man tatsächlich<br />
vor diesem Haus und begegnet den Bewohnern,<br />
das hat mich wirklich gepackt. Es ist eine ganz besonders<br />
wohltuende Atmosphäre dort zu spüren, obwohl soviel<br />
Not und Elend hinter den Mauern lebt. Es ist schon so,<br />
wie eine Schwester einmal sagte: ”Hier (im AIDS-Haus)<br />
ist der Himmel offen. Die Armen ziehen den Himmel<br />
auf die Erde”. Ich finde gar nicht die Worte, wie man<br />
die Atmosphäre dort ausdrücken soll. Ist auch vielleicht<br />
nicht notwendig.<br />
23
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Juli/August 2000 Jahrgang 8, Nr.4<br />
Mit großer Freude zeigten sie mir natürlich die Anschaffungen<br />
der letzten Jahre, wozu <strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> ja<br />
den wesentlichen Anteil geleistet hat: Küchenumbau,<br />
Rollstuhlrampe, Sanierung des Speisesaals, Patientenheber,<br />
diverse pflegerische und medizinische Geräte.<br />
Lagoinha ist ein kleines Städtchen, ca. 3000 Einwohner,<br />
und liegt fast 1000 m hoch in den Bergen. Rundum<br />
nur grüne Matten und bewaldete Höhenzüge, fast wie<br />
irgendwo bei uns daheim. Und das mitten im heißen<br />
Brasilien. Wir waren ja zur Hochsommerzeit drüben,<br />
täglich brütete die Hitze bis zu 38 Grad. Am Ortsrand<br />
von Lagoinha gibt es viele elende Behausungen von<br />
ärmsten Familien, z.T. mit vielen vielen Kindern.<br />
Mehrmals konnte ich mit den Schwestern solche Familien<br />
besuchen, wir brachten Nahrungsmittel mit und sie<br />
erzählten uns von ihrem Leben. Manche sind wirklich<br />
vom Schicksal hart heimgesucht, andere wiederum sind<br />
mit diesen Lebensverhältnissen zufrieden, froh darüber,<br />
überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn es<br />
auch aus Blech oder Brettern ist.<br />
Noch viel krassere Wohnverhältnisse konnte ich in der<br />
Nähe von Rio de Janeiro erleben, wo ich mit einem deutschen<br />
Franziskanerpater ebenfalls einige arme Familien<br />
besuchen durfte. Mein Gott, wie man nur so leben kann.<br />
Ich würde wahrscheinlich nach wenigen Tagen todkrank<br />
werden wegen des Schmutzes, des Ungeziefers, der<br />
schlechten Luft usw. In Rio konnte ich sehr extrem die<br />
Gegensätze von arm und reich feststellen. Zum einen<br />
24<br />
Impressum<br />
die Hotel- und Finanzgiganten, blitzende Hochhäuser,<br />
Copacabana und Tourismus erster Klasse. Aber in den<br />
Vororten der Stadt und zum Teil sogar innerhalb der<br />
Stadt an Abhängen (Rio ist ja in eine ganz hügelige<br />
Gegend einzementiert) jede Menge Favelas, wo die Not<br />
und auch die Kriminalität aus allen Fugen schreit. Mein<br />
”Reiseführer” kannte sich gut dort aus, er lebt seit 17<br />
Jahren in der Nähe und wußte natürlich viel zu erzählen<br />
und mich an Plätze zu führen, die vielleicht sonst Touristen<br />
nicht so zugänglich sind. Diese Eindrücke von<br />
Brasilien waren die ”lauten”: viele Leute, Gewühl auf<br />
allen Strassen, Lärm und Gestank, aber natürlich auch<br />
eine herrliche Landschaft: Corcovado, Zuckerhut, die<br />
wunderschönen Buchten und das nahe Meer, üppigste<br />
Vegetation und Früchte wie im Schlaraffenland.<br />
Mehr eingeprägt von Brasilien haben sich jedoch inwendig<br />
bei mir die ”stillen” Momente, wie ich sie anfangs<br />
schon beschrieben habe. Herr O. Tex Weber hat<br />
uns damals bei unserem Besuch erzählt, dass er beruflich<br />
oft in Brasilien zu tun hatte und er sehr gerne dort<br />
war. Das kann ich jetzt gut verstehen. Schade, dass ich<br />
ihm von Brasilien, vor allem aber von Lagoinha nicht<br />
mehr berichten kann. Er war immer wieder in unserem<br />
Herzen und bei unseren Gesprächen dort in unserem<br />
Munde und wird von den Bewohnern dort nicht vergessen<br />
werden.”<br />
Klaus Streifinger<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong><br />
Herausgeber: <strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> e.V., Ickstattstraße 28, 80469 München, Telefon (089) 21 94 96 20,<br />
Fax: (089) 21 03 12 35, email: projektinfo@munich.netsurf.de. Vereinsregister: AG München Nr. 12575;<br />
Gemeinnützigkeit anerkannt: FA München, St.Nr.844/29143<br />
Redaktion: Peter Lechl, Dr. Heidemarie Kremer, Manfred Müller, Karl L., Karin Boss, Helmut B., Stefan<br />
Boes.<br />
Hinweis:<br />
<strong>Projekt</strong> <strong>Information</strong> versucht durch eine breite Auswahl von Themen, dem Leser einen gewissen Überblick<br />
zu den derzeitigen therapeutischen Möglichkeiten, Entwicklungen und dem Stand der Forschung<br />
zu geben. Zum größten Teil verwenden wir hierbei Übersetzungen aus ähnlichen Publikationen in den<br />
USA und Großbritannien.<br />
Sie geben nicht die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder. Ob die besprochenen<br />
Medikamente, Therapien oder Verfahren tatsächlich erfolgversprechend oder erfolglos sind, entzieht<br />
sich unserer Beurteilung. Sprechen Sie immer mit dem Arzt Ihres Vertrauens. Namentlich gezeichnete<br />
Artikel verantwortet der betreffende Autor. Soweit es um Zitate aus wissenschaftlichen Publikationen<br />
geht, werden die Leser gebeten die angegebenen Referenztexte zu konsultieren.<br />
Spendenkonto: Sozialbank München,<br />
Konto Nr. 8 845500 (BLZ 700 205 00)