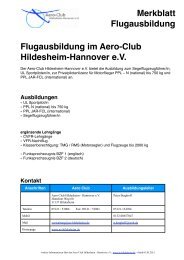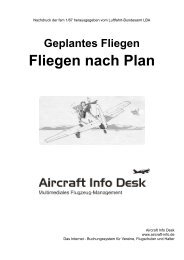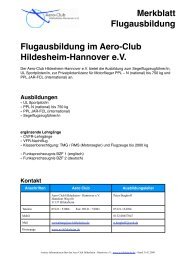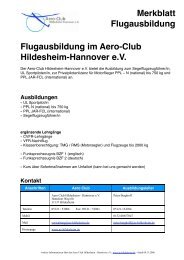Routenvorschlag und Hintergrundinformationen für einen Schlösser ...
Routenvorschlag und Hintergrundinformationen für einen Schlösser ...
Routenvorschlag und Hintergrundinformationen für einen Schlösser ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong><br />
<strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Liebe Fliegerkollegen,<br />
wie schön kann fliegen doch sein! Im Folgenden findet Ihr <strong>einen</strong> <strong>Routenvorschlag</strong> <strong>für</strong> <strong>einen</strong> Flug entlang<br />
der Strecke Hildesheim – Hameln – Höxter – Bad Gandersheim – Hildesheim. Die Tour führt Euch an<br />
12 örtlichen Sehenswürdigkeiten – vornehmlich Burgen <strong>und</strong> <strong>Schlösser</strong> – vorbei. Zu jeder der<br />
Sehenswürdigkeiten sind weiter unten im Dokument nähere Einzelheiten <strong>für</strong> diejenigen beschrieben, die<br />
ein besonderer Wissensdurst über die architektonische <strong>und</strong> geschichtliche Vielfalt dieser Gegend plagt.<br />
Die Betrachtung der Bauwerke lohnt sich unbedingt nämlich auch am Boden, vielleicht, wenn einmal<br />
schlechteres Wetter ist. Die Informationen über die Sehenswürdigkeiten sind allesamt aus dem Internet<br />
bezogen worden. Wen es interessiert, der kann z.B. unter http://www.burgen-<strong>und</strong>-schloesser.net/ oder<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite nähere Informationen über die Bauwerke oder weitere Links zu<br />
den Internetseiten der Betreiber oder Bewirtschafter der Einrichtungen erhalten.<br />
Die Sehenswürdigkeiten sind nur teilweise in der ICAO Karte Hannover eingetragen, insofern solltet ihr<br />
Euch vorher Gedanken <strong>und</strong> Eintragungen in der Flugkarte machen oder die GPS-Empfänger mit den<br />
folgenden Daten füttern:<br />
Wegpunkt Koordinaten<br />
EDVM 52° 10,8' N 09° 56,8' E<br />
Schloss Marienburg bei Nordstemmen 52° 10,3' N 09° 45,9' E<br />
Schloss Springe 52° 11,3' N 09° 34,5' E<br />
Burgruine Coppenbrügge 52° 07,0' N 09° 33,0' E<br />
Hameln 52° 06,5' N 09° 21,5' E<br />
Schloss Schwöbber 52° 04,2' N 09° 15,1' E<br />
Schloss Hämelschenburg 52° 01,9' N 09° 21,0' E<br />
Bad Pyrmont 51° 59,0’ N 09° 15,0’ E<br />
Burgruine Polle 51° 54,0' N 09° 24,0' E<br />
EDVI 51° 48,4' N 09° 22,7' E<br />
Fürstenberg 51° 44,0' N 09° 24,0' E<br />
Höxter 51° 46,5' N 09° 22,5' E<br />
Kloster Corvey 51° 46,7' N 09° 24,6' E<br />
Gut Allersheim (Holzminden) 51° 49,5' N 09° 28,5' E<br />
Schloss Bevern 51° 52,0' N 09° 30,0' E<br />
Kloster Amelungsborn 51° 53,9' N 09° 35,5' E<br />
Burg Greene 51° 51,3' N 09° 56,1' E<br />
EDVM 52° 10,8' N 09° 56,8' E
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Zunächst allerdings etwas zu den fliegerischen Aspekten: Die Spritztour dauert mit einer unserer Cessnas<br />
172 alles in allem r<strong>und</strong> 1:15 h (Reisefluggeschwindigkeit 105 kts IAS). Wird sie mit einer<br />
Zwischenlandung <strong>und</strong> Aufenthalt, z.B. in Höxter, kombiniert, beträgt die Flugzeit <strong>für</strong> Hin- <strong>und</strong> Rückflug<br />
r<strong>und</strong> jeweils 45 min.<br />
Viel Spaß beim Fliegen <strong>und</strong> achtet im Weserbergland auf die Einhaltung der richtigen<br />
Sicherheitsmindesthöhen, gerade wenn man den Überflug der Sehenswürdigkeiten etwas tiefer halten<br />
möchte. Bei Über- <strong>und</strong> Vorbeiflug an den Flugplätzen Bad Pyrmont <strong>und</strong> Höxter achtet bitte auf <strong>einen</strong><br />
sicheren Abstand zu den Platzr<strong>und</strong>en <strong>und</strong> die ggf. in der Nähe befindlichen Fallschirmspringer.<br />
1. SCHLOSS MARIENBURG (NORDSTEMMEN)<br />
Schloss Marienburg ist offizieller Wohnsitz der Prinzen von Hannover (Welfen). Das Schloss befindet<br />
sich auf einer Anhöhe links der Leine, südlich von Schulenburg, einem Ortsteil von Pattensen (Region<br />
Hannover) in Niedersachsen. Der Bahnhof Nordstemmen wurde als königlicher Bahnhof <strong>für</strong> das Schloss<br />
Marienburg gebaut <strong>und</strong> bildet mit dem Schloss Marienburg ein Ensemble.<br />
In den Jahren 1857 bis 1867 wurde es Ernst August von Hannover im neugotischen Stil durch den<br />
Architekten Conrad Wilhelm Hase auf einem Berg im Leinetal errichtet (ursprünglich war der Bau auf<br />
dem erheblich näher an Hannover gelegenen Stemmer Berg vorgesehen, der heute zur Barsinghäuser<br />
Ortschaft Stemmen gehört, aber die dortigen Bauern verkauften nicht). Die Inneneinrichtung erfolgte<br />
durch den Architekten Edwin Oppler. Das Schloss war ein Geschenk von König Georg V. an seine Frau<br />
Marie <strong>und</strong> sollte als Sommerresidenz dienen.<br />
Wegen der Niederlage des Königreichs Hannover 1866 im Krieg gegen Preußen wurde das Schloss nie<br />
von König Georg V. bewohnt, da dieser ins österreichische Exil gehen musste. Seine Frau Marie bewohnte<br />
das Schloss bis zu dessen Fertigstellung ein Jahr lang. Dann musste auch sie die nun preußische Provinz<br />
Hannover verlassen <strong>und</strong> folgte ihrem Mann ins Exil. Danach stand das Schloss 80 Jahre leer. Nach dem 2.<br />
Weltkrieg wurde das Schloss <strong>für</strong> 12 Jahre von einem Zweig der Welfen bewohnt, der aus der damaligen<br />
sowjetischen Besatzungszone von Schloss Blankenburg in den Westen geflüchtet war. Heute wird das<br />
Schloss nur noch von einem Verwalter bewohnt. Einige Räume werden vom Prinzen von Hannover bei<br />
offiziellen Empfängen genutzt. Neben der musealen Nutzung dienen weitere Schlossräume als Depot <strong>für</strong><br />
Kunstgegenstände.<br />
Die heutige Ausstattung stammt aus verschiedenen Welfenschlössern. Schloss Marienburg kann nur im<br />
Rahmen einer kostenpflichtigen Führung besichtigt werden.<br />
Vom 30. September bis 3. Oktober 2005 fand eine Ausstellung von Kunstgegenständen statt, die im<br />
Zeitraum vom 5. Oktober bis 15. Oktober durch das Auktionshaus Sotheby's auf dem Schloss zur<br />
Versteigerung angeboten wurden. Unter den angebotenen Gegenständen befinden sich auch Möbelstücke<br />
<strong>und</strong> eine größere Anzahl Gemälde. Während dieser Zeit war das Betreten des Schlosses zwar ohne<br />
Führung erlaubt, jedoch musste dazu der dreibändige Auktionskatalog erworben werden. Die Auktion<br />
ergab 37 Mio. €. Damit gründete Ernst August eine Stiftung die dem Erhalt des Schlosses <strong>und</strong> weiterer<br />
Besitztümer dienen soll.<br />
- 2 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
2. SCHLOSS SPRINGE<br />
Klassizistisches Jagdschloss<br />
Das Jagdschloss, von 1838 bis 1842 nach Plänen des Hofbaumeister Laves erbaut <strong>und</strong> von 1988 bis 1993<br />
sorgfältig restauriert, beherbergt die Weiterbildungsstätte Jägerlehrhof, zwei Festsäle mit prachtvoller<br />
klassizistischer Innenausstattung sowie freigelegten Wand- <strong>und</strong> Deckenmalereien, eine auch <strong>für</strong> Kinder<br />
sehr lehrreiche Jagd- <strong>und</strong> Tierschau sowie mehrfach wechselnde Sonderausstellungen. Regelmäßig stehen<br />
Konzerte <strong>und</strong> Vorträge auf dem Programm, die der Kulturkreis e. V. <strong>und</strong> das Niedersächsische Forstamt<br />
Saupark arrangieren. Die Jagdschlosskonzerte im Kaisersaal sind weit über die Landesgrenzen hinaus<br />
bekannt. Ein unvergessliches Erlebnis ist der alle zwei Jahre stattfindende Jagdbläser-Wettstreit.<br />
3. BURG COPPENBRÜGGE<br />
Burg Coppenbrügge, im Süden Niedersachsens, am Fuße des Ith, eingebettet zwischen Nesselberg <strong>und</strong><br />
Schecken liegt im Flecken Coppenbrügge. Der zentrale Ort Coppenbrügge kann auf eine tausendjährige<br />
Geschichte zurückblicken. Die erste urk<strong>und</strong>liche Erwähnung taucht um das Jahr 1000 in einer<br />
Grenzbeschreibung des Bistums Hildesheim als „Cobbanbrug“ auf.<br />
Im Tal zwischen Ith <strong>und</strong> Osterwald erbauten die Grafen von Spiegelberg zwischen 1280 <strong>und</strong> 1300 eine<br />
Burganlage als Zentrum ihrer Grafschaft. Von der Burg aus konnte die alte Heer- <strong>und</strong> Handelsstraße von<br />
Aachen nach Königsberg.<br />
Diese Straße führte unweit der Burg über <strong>einen</strong> Knüppeldamm durch ein Sumpfgebiet. Die Grafen von<br />
Spiegelberg, die im Jahr 1494 zu ihrem kl<strong>einen</strong> Coppenbrügger Gebiet noch die Grafschaft Pyrmont<br />
geerbt hatten, starben 1557 in männlicher Linie aus. Die Grafschaft Spiegelberg wurde in weiblicher Linie<br />
weitervererbt an die Grafen von Lippe, dann an die Grafen von Gleichen <strong>und</strong> 1631 an die Grafen von<br />
Nassau-Dietz. Über diese gelangte die Grafschaft später an die Fürsten von Nassau-Oranien, die<br />
Erbstatthalter der Niederlande.<br />
Erst 1819 verkauften die Niederländer ihre Grafschaft Spiegelberg an das Königreich Hannover, <strong>und</strong> mit<br />
diesem wurde sie 1866 preußisch. Die wechselvolle Geschichte der Grafen von Spiegelberg <strong>und</strong> die<br />
verkehrsgünstige Lage des Fleckens führten viele bedeutende Persönlichkeiten nach Coppenbrügge, z.B.<br />
den Großen Kur<strong>für</strong>sten, Friedrich den Großen, Königin Luise von Preußen <strong>und</strong> Bismarck.<br />
Am bekanntesten ist der Aufenthalt des Zaren Peter des Großen.<br />
Im Jahre 1618 erhielt der Flecken Coppenbrügge sogar die Stadtrechte durch die Grafen von Gleichen,<br />
doch der im selben Jahr ausbrechende 30jährige Krieg <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Kriegswirren,<br />
Verwüstungen <strong>und</strong> Verarmungen ließen diese Rechte in Vergessenheit geraten. Von zwei alten Rechten<br />
des Fleckens, den Markt- <strong>und</strong> Braurechten, machten die Coppenbrügger bis Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Gebrauch.<br />
Die im Mittelpunkt des Ortes historisch wertvolle Burg wurde in den letzten Jahren restauriert <strong>und</strong><br />
museal eingerichtet. Die mit Wall <strong>und</strong> Wassergraben versehene Anlage ist ein Schmuckstück des Fleckens,<br />
bestens geeignet <strong>und</strong> genutzt <strong>für</strong> mannigfaltige Zusammenkünfte, Konzerte <strong>und</strong> Theater. Der neu<br />
gestaltete Innenhof der alten Burg hat die reizvolle Atmosphäre der Stille <strong>und</strong> Romantik vergangener<br />
Zeiten geschickt erhalten. Mit dem seit 1986 eröffneten Museum, das über Burg, Ort <strong>und</strong> Umgebung<br />
informiert, hat Coppenbrügge aus seiner Burganlage eine kulturelle Attraktion besonderer Art gemacht.<br />
- 3 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
4. HAMELN<br />
Geschichte – Erste Siedlungsspuren im heutigen Stadtgebiet von Hameln gehen bis in die Steinzeit<br />
zurück. Ungeklärt ist, ab wann sich auf dem Boden der heutigen Altstadt erste dörfliche Strukturen<br />
herausbildeten.<br />
Im Jahre 802 oder 812 errichteten der sächsische Graf Bernhard <strong>und</strong> seine Frau Christina auf ihrem Gut<br />
in Hameln eine Eigenkirche. Im Jahre 826 starben beide kinderlos, die Besitzung geht an die Reichsabtei<br />
Fulda über. Diese gründete im Jahr 851 an dem günstig gelegenen Weserübergang ein<br />
Benediktinerkloster. Die ersten Nennungen nennen den Ort als "Hamela" oder "Hameloa".<br />
Klostergründung – Im Laufe der Zeit bildete sich vor dem in ein Kollegiatstift umgewandelten Kloster<br />
(urk<strong>und</strong>liche Nennungen 1054 <strong>und</strong> 1074) eine Marktsiedlung, die um 1200 erstmals als Stadt genannt<br />
wird. Damit gehört Hameln zu den allerersten Städten im ehemaligen Königreich Hannover. Im Jahr<br />
1209 wird erstmals eine (Stifts-)Mühle in Hameln erwähnt.<br />
Die Stadthoheit über Hameln liegt im 12. <strong>und</strong> 13.Jahrh<strong>und</strong>ert bei der Abtei Fulda bzw. ihren Stiftsvögten<br />
in Hameln, den Grafen von Everstein. Die geistliche Oberhoheit liegt beim Bischof von Minden. Im Jahr<br />
1259 verkauft der Abt von Fulda seine Rechte an Hameln an den Bischof von Minden. Das Hamelner<br />
Bürgerheer, welches dieses nicht hinnehmen will, unterliegt 1260 in der Schlacht von Sedemünder dem<br />
Bischof von Minden. Im Verlauf weiterer Auseinandersetzungen erwirbt Herzog Albrecht von<br />
Braunschweig 1268 die Vogtei über Hameln. Im Jahr 1277 bestätigt er der Stadt mit einem Privileg ihre<br />
bis dahin innegehabten Rechte.<br />
Weltweite Bekanntheit erlangt Hameln durch den bald darauf im Jahre 1284 erfolgten Auszug der<br />
"Hämelschen Kinder", aus welchem sich später die Rattenfängersage entwickelt. Die Datierung auf dieses<br />
Jahr geht auf das Spätmittelalter zurück, der älteste Bericht hierzu datiert aus der Zeit zwischen 1430 <strong>und</strong><br />
1450. Noch heute nennt sich die Stadt offiziell als Rattenfängerstadt Hameln.<br />
Hanse - 1426 wird Hameln Mitglied der Hanse, welcher es bis 1572 angehört. 1540 wird die Reformation<br />
eingeführt. Im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert erfolgte ein wirtschaftlicher Aufstieg, der bis zum Dreißigjährigen Krieg<br />
anhält. Im Wettstreit der reichen Kaufmannschaft mit dem Landadel entstehen in dieser Zeit die<br />
prächtigen Bauten der Weserrenaissance, die das Stadtbild noch heute schmücken.<br />
Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges besetzt 1625 König Christian IV. von Dänemark als Kriegsoberster<br />
des Niedersächsischen Reichskreises die Stadt. Ihm folgt der kaiserliche Feldherr Tilly. Die kaiserliche<br />
Besatzung währt bis 1633, als Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg <strong>und</strong> die schwedischen Truppen<br />
die kaiserlichen Besatzungstruppen belagern. Nach ihrer Niederlage bei Hessisch-Oldendorf kapituliert<br />
Hameln am 3. Juli 1633 vor dem Herzog Georg von Calenberg.<br />
Festung – Im Jahr 1664 beginnt der Ausbau der Stadt zur welfischen "Haupt- <strong>und</strong> Prinzipalfestung". Der<br />
erste Bauabschnitt der Festung gilt 1684 als abgeschlossen. 1664-1668 wird die Stadt mit sternförmigen<br />
Bastionen umgeben. Im Jahr 1690 werden durch herzogliches Privileg in Hameln Refugiés aus Frankreich<br />
(Hugenotten) angesiedelt. 1734 wird auf dem Werder bei Hameln die erste in staatlicher Regie errichtete<br />
Weserschleuse in Betrieb genommen, die den Schiffern bei der Überwindung des berüchtigten "Hamelner<br />
Loches" hilft.<br />
Nach dem Tod von König Georg II. von England-Hannover 1760 wird noch während des Siebenjährigen<br />
Krieges (1756-1763) unter seinem Nachfolger König Georg III. die Festung Hameln durch<br />
Festungsbauten auf dem Klüt verstärkt. Das Fort I (Fort George) wird von 1760 bis 1763 errichtet. 1774-<br />
1784 werden auf dem Klüt zwei weitere Forts angelegt: Fort II (Fort Wilhelm) <strong>und</strong> Fort III. Damit wird<br />
Hameln zum uneinnehmbaren Gibraltar des Nordens, der stärksten Festung des damaligen Fürstentums<br />
Hannover. Während der napoleonischen Zeit <strong>und</strong> unter wechselnden französischen <strong>und</strong> preußischen<br />
Besatzungen wird 1806 am Fuße des Klüts Fort IV (Fort Luise) errichtet.<br />
- 4 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Nach der Schlacht bei Jena kapitulierte Hameln 1806 kampflos vor Napoleon, auf s<strong>einen</strong> Befehl wurden<br />
bis auf zwei Stadttürme alle Befestigungen 1808 geschleift. So wurden die Voraussetzungen <strong>für</strong> eine<br />
weitere Ausweitung der Stadt geschaffen. Aus den St<strong>einen</strong> des ehemaligen Fort George wird 1843 ein<br />
zunächst "Georgsturm" genannter Aussichtsturm erbaut (1887 aufgestockt), der heute unter dem Namen<br />
"Klütturm" ein beliebtes Ausflugsziel ist.<br />
Kreisfreie Stadt / Kreisstadt - 1866 wurde Hameln nach 700-jähriger Oberhoheit der Welfen preußisch,<br />
1923 kreisfreie Stadt. Mit der Verwaltungs- <strong>und</strong> Gebietsreform in Niedersachsen 1972/1973 wurde der<br />
kreisfreie Status wieder beendet. Hameln ist seit 1885 Sitz der Kreisverwaltung des Landkreises Hameln-<br />
Pyrmont.<br />
Ende 1935 wird das Gefängnis Hameln von den Nationalsozialisten in ein Zuchthaus umgewandelt. Nach<br />
dem Krieg werden dort von der britischen Besatzung über 200 Kriegsverbrecher hingerichtet.<br />
In Hameln befindet sich ein großer Stützpunkt der britischen Rheinarmee. In der Linsingenkaserne<br />
(erbaut 1938) ist das 28. Pionierregiment mit 937 Soldaten <strong>und</strong> 500 Zivilangestellten stationiert, dazu<br />
leben noch 1376 Familienangehörige in der Stadt (Stand: Juni 2001) (Militärbasen im Ausland). Neben<br />
der Linsingenkaserne hatte die britische Garnison bis Anfang 2001 eine weitere Kaserne im Hamelner<br />
Stadtgebiet in Besitz (Scharnhorstkaserne; erbaut 1898). Im Zuge der Konvertierung von Militäranlagen<br />
in Wohnanlagen entsteht derzeit dort ein hervorragendes Wohngebiet in denkmal- <strong>und</strong><br />
ensemblegeschützten, ehemaligen Militärbauten.<br />
Bis zur Auflösung der Regierungsbezirke in Niedersachsen gehörte Hameln dem Regierungsbezirk<br />
Hannover an.<br />
5. SCHLOSS SCHWÖBBER<br />
Schlosshotel Münchhausen - Ab 1570 von Hilmar Baron von Münchhausen <strong>und</strong> seiner Familie erbautes<br />
Weserrenaissanceschloss. Bis 1920 war es 350 Jahre lang im Familienbesitz derer von Münchhausen. Seit<br />
1985 dient es als Clubhaus <strong>für</strong> Golfer der Golfanlage Schloss Schwöbber.<br />
1570 Hilmar von Münchhausen beginnt mit dem Bau des Anwesens, der Wassergräben <strong>und</strong> des Gartens.<br />
1668 Otto <strong>und</strong> sein Bruder Burchard von Münchhausen übernehmen das Schloss<br />
1715 Zar Peter der Große interessiert sich <strong>für</strong> die zu der Zeit größte Pflanzensammlung Europas <strong>und</strong> die<br />
Orangerie mit ihren Ananaspflanzungen<br />
1840 Eine eigene Schlosskapelle wird gebaut<br />
1850 Das Schloss ist kultureller Mittelpunkt der Region <strong>und</strong> ein gern besuchtes Ausflugsziel<br />
1992 Tragischer Brand des Mittelflügels<br />
2004 Eröffnung als 5-Sterne Schlosshotel<br />
6. SCHLOSS HÄMELSCHENBURG<br />
Das Schloss Hämelschenburg bei Emmerthal im Weserbergland zwischen Hameln <strong>und</strong> Bad Pyrmont gilt<br />
als das Hauptwerk der Weserrenaissance <strong>und</strong> bildet mit s<strong>einen</strong> Kunstsammlungen, Gartenanlagen,<br />
Wassermühle, Wirtschaftsgebäuden <strong>und</strong> der Kirche eine der schönsten Renaissanceanlagen Deutschlands.<br />
Es ist wesentlicher Bestandteil der Straße der Weserrenaissance.<br />
- 5 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Geschichte – Zwischen 1409 <strong>und</strong> 1414 erbauten die Grafen von Everstein auf dem Berg Woldau über<br />
dem Tal der Emmer die Burg Hemersen, die ab 1437 in den Besitz der Ritterfamilie Klencke überging,<br />
die aus Thedinghausen stammt <strong>und</strong> dort bis in das Jahr 1260 zurück verfolgt werden kann. 1487 geriet<br />
die Burg in die Große Stadtfehde <strong>und</strong> damit in die Gegenpartei der Welfen. Sie wurde unter Herzog<br />
Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg zerstört. Danach ließ die Ritterfamilie Klencke die Burg Hemersen<br />
wieder aufbauen. Der ab dann geführte Name Hämelschenburg entstand aus Dialektveränderungen des<br />
ursprünglichen Namens Hemersenburg, der wiederum aus dem Herrmann sin Burg nach Herrmann von<br />
Everstein entstanden war. 1544 brannte die gesamte Anlage, einschließlich der tiefer gelegenen<br />
Schlosskirche, vollständig nieder.<br />
Bau des Schlosses - Die wirtschaftliche Blüte zwischen 1520 <strong>und</strong> 1620 brachte dem Weserbergland eine<br />
rege Bautätigkeit. Beiderseits der Weser wurden vom Adel <strong>und</strong> den Landesherren viele <strong>Schlösser</strong> neu<br />
erbaut oder alte wesentlich umgestaltet. Der Wesersandstein (gelb <strong>und</strong> gut zu behauen von rechts der<br />
Weser, rot <strong>und</strong> deutlich härter von links der Weser) war ein begehrter Baustoff <strong>für</strong> Fassaden, Fußböden<br />
<strong>und</strong> Dacheindeckungen in ganz Nordwest- <strong>und</strong> Nordeuropa. 1588 ließen Jürgen Klencke (gedient am<br />
Grafenhof zu Nienburg/Weser <strong>und</strong> als Söldner zum Rittmeister empor gestiegen) <strong>und</strong> seine Frau Anna<br />
von Holle, hoch gebildete Nichte des Paderborner Bischofs Eberhard von Holle aus Verden, die<br />
Hämelschenburg als Wasserschloss im Stil der Weserrenaissance an neuem Standort unmittelbar am<br />
Flusslauf der Emmer neu erbauen. Die Mittel hierzu kamen einerseits durch die an der das Anwesen<br />
querenden Straße erhobenen Zölle <strong>und</strong> andererseits aus enormen Gewinnen eines regen Kornhandels<br />
zusammen.<br />
In dreißigjähriger Bauzeit diente der bereits vom Vater Jürgen Klenckes, Ludolf Klencke, errichtete<br />
umfriedete Wirtschaftshof unmittelbar an der Emmer dem Bauherren <strong>und</strong> seiner Frau als bescheidene<br />
Wohnstatt, bis der Nordflügel der als Dreiflügelbau durchgängig geplanten Anlage fertig gestellt war. Der<br />
Mittel- <strong>und</strong> der Südflügel mitsamt zweier im italienischen Renaissancestil erbauten achteckigen<br />
Treppentürme folgten nach <strong>und</strong> nach. Die Vollendung des Schlosses erlebte Jürgen Klencke nicht, er starb<br />
1609.<br />
Jürgen <strong>und</strong> Anna Klencke hatten 14 Kinder, von denen 12 erwachsen wurden, <strong>für</strong> die damalige Zeit mit<br />
hoher Kindersterblichkeit eine außergewöhnliche Zahl. Der älteste Sohn übernahm das Schloss nach dem<br />
Tod seines Vaters <strong>und</strong> ließ zusammen mit seiner Mutter den Bau fertig stellen.<br />
Allianzen – Im Dreißigjährigen Krieg gelang es Anna, das Schloss durch Allianzen zu schützen. Die<br />
couragierte Schlossherrin fuhr den anrückenden Truppen unter Tilly entgegen <strong>und</strong> handelte mit dem<br />
General <strong>einen</strong> Schutzvertrag aus, der es s<strong>einen</strong> Soldaten unter Androhung der Todesstrafe verbat,<br />
Hämelschenburg zu betreten. Sie rettete somit die gesamte Anlage vor Plünderung <strong>und</strong> Zerstörung. Im<br />
Siebenjährigen Krieg (1756-1763) wurde Hämelschenburg zwar besetzt <strong>und</strong> es verschwanden auch Teile<br />
der Inneneinrichtung, aber durch geschicktes Taktieren der Schlossherren konnte Schlimmeres<br />
abgewendet werden. So ist der Gesamtkomplex mit s<strong>einen</strong> vier aufwändig gestalteten Giebeln, 17<br />
Zwerchhäusern, den beiden hohen, Kupfer gedeckten Treppentürmen, zwei ebenerdigen,<br />
doppelgeschossigen Erkern (so genannten Ausluchten), mehreren Portalen <strong>und</strong> einer prächtigen<br />
Zugangsbrücke über den mit Karpfen besetzten Schlossteich bis heute vollständig erhalten.<br />
Zeit des Nationalsozialismus - In der Zeit des Nationalsozialismus stellten sich die Schlossherren<br />
ausdrücklich gegen das politische Regime, indem sie sich auf den in ihrer Ritterfamilie belegten Gr<strong>und</strong>satz<br />
der obersten Herrschaft Gottes über die weltlichen Mächte berief. Dieser Gr<strong>und</strong>satz ist bereits um 1600<br />
über dem Kamin des Speisezimmers im Erdgeschoss des Westflügels durch <strong>einen</strong> figürlich unter dem<br />
Kruzifix knienden Jürgen von Klencke <strong>und</strong> seiner Anna über den aufgereihten 14 Kindern (heute 13, eines<br />
wurde gestohlen) versinnbildlicht. Erstaunlicherweise wurde diese Einstellung von der NSDAP respektiert<br />
<strong>und</strong> auch der angrenzende Ort Hemersen blieb ohne Ortsgruppenleiter. Als einzigen Affront der<br />
herrschenden Macht kann man den um 1939 verbreiterten Ausbau der Staatsstraße durch das<br />
- 6 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Schlossensemble deuten, der dazu diente, die Anreise der NS-Anhänger zum Reichserntedankfest auf dem<br />
Bückeberg bei Hameln zu erleichtern.<br />
Dem entgegen öffnete man die Schlosskirche sonntags ausdrücklich <strong>für</strong> die in der umliegenden<br />
Landwirtschaft verdingten polnischen Fremdarbeiter zum Gottesdienst.<br />
Die Finanzierung des Schlosses gelang in dieser Zeit unter anderem durch zahlende adlige "Feriengäste",<br />
denen allerdings durch ein über der Speisetafel aufgehängtes vierseitiges Transparent unmissverständlich<br />
politische Äußerungen untersagt waren.<br />
Modernisierung – Natürlich wurde das Schloss Hämelschenburg im 19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert den<br />
Erfordernissen moderner Wohnkultur angepasst. So wurden 1845-1850 der hohe Wall an der West- <strong>und</strong><br />
Ostseite entfernt <strong>und</strong> der Graben an der Nordseite zugeschüttet. Die Rotsandstein-Eindeckung wurde bis<br />
1974 durch die leichtere Schieferdeckung ersetzt <strong>und</strong> zusätzliche Dachgauben wurden eingefügt. Der<br />
originäre Verputz wurde abgeschlagen <strong>und</strong> das Bruchsteinmauerwerk sichtbar gemacht. Die ehemals<br />
außenliegende Pilgerhalle wurde nach innen verlegt <strong>und</strong> schließlich das ganze Schloss mit einer modernen<br />
Zentralheizung versehen. Diese Umbauten beeinträchtigen aber nicht das historische Erscheinungsbild.<br />
Mutmaßliche Architekten – Die Architekten des Schlosses sind nicht namentlich beurk<strong>und</strong>et. Die<br />
Vielzahl der Bauhütten <strong>und</strong> Bauschulen der damaligen Zeit lassen nur eine verallgemeinernde<br />
Mutmaßung zu. Fast identische stilistische Einzelheiten des Cord Tönnis, dem nachgewiesenen<br />
Baumeister des Hauses Osterstraße 9 in Hameln, am Schloss von Detmold <strong>und</strong> am Archivhäuschen von<br />
Rinteln, lassen sich an den Fassaden der Hämelschenburg wieder erkennen. Details der Gestaltung der<br />
Giebel von Nord- <strong>und</strong> Westflügel sind identisch mit Werken der Baumeister Eberhard Wilkening <strong>und</strong><br />
Johann H<strong>und</strong>ertossen, letzterer aber neuerdings wieder umstritten.<br />
Baugeschichte – Eingebettet in das einzigartige Renaissanceensemble ist die 1563 erbaute Schlosskapelle,<br />
die 1652 zur Gemeindekirche von Hämelschenburg wurde. Sie wurde auf den Resten einer bereits 1409<br />
geweihten Kapelle errichtet, die auch dem Feuer von 1544 zum Opfer fiel. Die unter der Kirche gelegene<br />
Familiengruft der Klenckes blieb dabei unversehrt. Bereits von Ludolf Klencke wurde die Kirche 1563<br />
wieder auf den alten Gr<strong>und</strong>mauern errichtet, was den heutigen etwas schrägen Standort zur Gesamtanlage<br />
erklärt. Die Kirche gehört dadurch zu den frühesten evangelischen Kirchenbauten Norddeutschlands.<br />
Heutige Nutzung – An besonderen Feiertagen wird der 1604 von Anne <strong>und</strong> Georg Klencke gestiftete,<br />
reich mit Figuren aus der Glaubenslehre <strong>und</strong> Edelst<strong>einen</strong> besetzte Abendmahlkelch <strong>und</strong> die dazu<br />
gehörende schlichte Patene verwendet. Beide sind aus vergoldetem Silber.<br />
Die St. Marienkirche kann samstags <strong>und</strong> sonntags von 15-17 Uhr unter Aufsicht kostenfrei besichtigt<br />
werden. Diese zeitliche Einschränkung ist aus Diebstählen an der Innenausstattung in der Vergangenheit<br />
begründet.<br />
7. BAD PYRMONT<br />
Bad Pyrmont ist niedersächsisches Staatsbad <strong>und</strong> ein traditionsreiches Kurbad mit vielen entsprechenden<br />
Kureinrichtungen. Bekannt wurde der Ort 1556/57 als 10.000 Menschen aus ganz Europa herbeikamen<br />
("großes W<strong>und</strong>ergeläuf"), um Heilung zu finden <strong>und</strong> die w<strong>und</strong>ertätige Quelle zu erleben. Der Ort<br />
beherbergt <strong>einen</strong> der schönsten Kurparks Deutschlands mit einem berühmten Palmengarten, der größten<br />
Palmenfreianlage Nordeuropas. Einmalig ist auch die "Dunsthöhle", wo natürliche Kohlensäure an die<br />
Oberfläche steigt. Diese Kohlensäure wird auch als therapeutisches Mittel eingesetzt. Genutzt werden<br />
heute 6 Heilquellen, von denen auch die Hufelandtherme - ein öffentliches Wellness-Schwimmbad mit<br />
Saunalandschaft - versorgt wird. Bad Pyrmont ist außerdem das Zentrum der Quäker in Deutschland.<br />
- 7 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Im Mittelalter war Pyrmont Sitz einer kl<strong>einen</strong> Grafschaft, die 1625 durch Erbschaft an die Grafen von<br />
Waldeck fiel. Am 7. Mai 1625 übertrug Graf Hans Ludwig zu Gleichen s<strong>einen</strong> Vettern Christian <strong>und</strong><br />
Wolrad zu Waldeck die Herrschaft über Waldeck. Pyrmont bestand zu dieser Zeit aus dem alten<br />
Wasserschloss <strong>und</strong> einem kl<strong>einen</strong> Häuschen am so genannten „Heiligborn“.<br />
Die Grafschaft gehörte zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis. Der bekannteste Vertreter der<br />
Grafen zu Waldeck, Georg Friedrich zu Waldeck (1620-1692) ließ im Jahr 1668 den Quellbach zuwerfen<br />
<strong>und</strong> pflanzte die später berühmt gewordene vierreihige Lindenallee. Ihm folgten Christian Ludwig zu<br />
Waldeck (1692-1706) <strong>und</strong> Friedrich Anton Ulrich zu Waldeck (1706-1728). Mit dessen Tod war<br />
Pyrmont zu der Gesamtkonzeption gewachsen, die noch heute erkennbar ist: das Barockschloss, die<br />
Haupt- mit mehreren Nebenalleen sowie die Brunnenstraße. In dieser Zeit begann der Aufstieg Pyrmonts<br />
zu einem beliebten Bade- <strong>und</strong> Erholungsort der oberen Schichten, welches sogar dem berühmten Karlsbad<br />
s<strong>einen</strong> ersten Platz unter den europäischen Bädern streitig machte.<br />
1712 wurden die Grafen von Waldeck <strong>und</strong> Pyrmont durch Kaiser Karl VI. in den erblichen Fürstenstand<br />
erhoben. Nach einer Erbteilung 1805 war Pyrmont kurzfristig noch einmal bis 1812 selbständig, wurde<br />
dann aber wieder mit Waldeck vereinigt. Das Fürstentum Waldeck-Pyrmont behielt s<strong>einen</strong> Status nach<br />
dem Wiener Kongress 1815 <strong>und</strong> wurde Mitglied des Deutschen B<strong>und</strong>es. Von 1868 an wurde es von<br />
Preußen verwaltet, behielt aber seine nominelle Souveränität <strong>und</strong> wurde 1871 Mitgliedstaat in Bismarcks<br />
Deutschem Reich. Mit der Abdankung des letzten Fürsten nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde<br />
Waldeck-Pyrmont ein Freistaat in der Weimarer Republik. Am 30. November 1921 wurden die Stadt<br />
Pyrmont <strong>und</strong> der umliegende Bezirk auf Gr<strong>und</strong> eines Volksentscheides aus dem Freistaat aus- <strong>und</strong> der<br />
preußischen Provinz Hannover eingegliedert.<br />
Heute hat Bad Pyrmont etwa 21.000 Einwohner, <strong>einen</strong> Bahnhof, mehrere Schwimmbäder <strong>und</strong> <strong>einen</strong><br />
Flugplatz <strong>für</strong> Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Motorsegler <strong>und</strong> Motorflugzeuge.<br />
8. BURGRUINE POLLE<br />
Über der Weser erhebt sich auf einem Bergsporn die Reste der Burg Polle mit einem herrlichen Blick auf<br />
das Wesertal <strong>und</strong> das wahrscheinlich schon seit dem Jahre 1200. Die erste urk<strong>und</strong>liche Erwähnung erfolgt<br />
im Jahr 1285 bei der Übertragung von Gütern des Grafen Otto von Everstein an das Kloster Loccum.<br />
Um 1374 siegelt ein "Rat von dem Polle" <strong>einen</strong> eversteinschen Erbvertrag, doch mit dem Ende den<br />
Eversteinschen Erbfolgefehden kann Herzog Heinrich von Braunschweig die Burg 1407 einnehmen.<br />
Derer von Everstein gehen in die Verbannung. Im Jahr 1623 wird die Burg durch kaiserliche Truppen<br />
erobert, aber erst nach der Belagerung der Anlage durch die Schweden wird die Burg 1641 zerstört. 15<br />
Jahre später werden im unteren Burgbereich diverse Amtsbauten errichtet, welche aber zum Teil 1945<br />
wieder zerstört wurden. 1934 schenkt der Preußische Staat die Ruine dem Flecken Polle, 1956 werden<br />
Amtshaus <strong>und</strong> Burgpark dem Land Niedersachsen abgekauft.<br />
Erst im Jahr 1984 beginnen die umfangreichen Renovierungsarbeiten <strong>und</strong> später archäologische<br />
Ausgrabungen, welche 1988 abgeschlossen werden.<br />
Und wann hat Aschenputtel hier gelebt? Eine Frage, auf die es keine genaue Antwort gibt, aber seit 1930<br />
finden die Burgfestspiele statt <strong>und</strong> auch diesem Jahr gibt es wieder ein "Aschenputtelspiel" an jedem 3.<br />
Sonntag von Mai bis September.<br />
Von Juni bis August werden auf 3 Bühnen Märchen, Komödien <strong>und</strong> anderes Theater im Rahmen der<br />
Burgfestspiele dargeboten. Am 2. Septemberwochenende in jedem ungeraden Jahr findet ein<br />
märchenhaftes, historisches Burgfest statt.<br />
- 8 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
9. HÖXTER<br />
Kultur <strong>und</strong> Sehenswürdigkeiten<br />
Die weitgehend erhaltene mittelalterliche Stadtstruktur ist von Fachwerkbauten geprägt, unter denen sich<br />
einige Beispiele <strong>für</strong> den Stil der Weserrenaissance befinden. Besonders hervorzuheben sind das Adam-<strong>und</strong>-<br />
Eva-Haus in der Stummrige Straße <strong>und</strong> die alte Dechanei auf dem Marktplatz, dort sind über 60<br />
geschnitzte Halbrosetten zu bew<strong>und</strong>ern, die sich alle voneinander unterscheiden. Am Rande von Höxter<br />
liegt das Kloster Corvey unmittelbar an der Weser. Die Klosterkirche besitzt eine karolingische Krypta<br />
sowie ein imposantes Westwerk. Um Höxter bestehen Möglichkeiten zum Rudern, Fallschirmspringen,<br />
Wassersport <strong>und</strong> Wandern. Der 18 km R<strong>und</strong>wanderweg bietet schöne Aussichtspunkte wie z.B. den<br />
Köterberg.<br />
Im Rahmen der Erlebniswelt Renaissance gibt es in Höxter <strong>einen</strong> einzigartigen Stadtspaziergang zum<br />
Thema "Markt", auf dem der Besucher <strong>einen</strong> Mordfall klären kann, der sich 1617 ereignete.<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Infrastruktur – Höxter verfügt über <strong>einen</strong> Bahnhof. Der Bahnhof im Stadtzentrum heißt<br />
aus historischen Gründen Höxter Rathaus, der eigentliche Bahnhof Höxter liegt außerhalb des Stadtkerns<br />
<strong>und</strong> wird nur bei Bedarf <strong>für</strong> Zugkreuzungen benutzt. Auf der Strecke, die durch die Nord-West-Bahn<br />
befahren wird, fährt die Egge-Bahn (RB 84) in Richtung Paderborn <strong>und</strong> Holzminden. In Holzminden<br />
kann man in Richtung Kreiensen <strong>und</strong> Braunschweig umsteigen. Am Bahnhof in Höxter-Ottbergen<br />
besteht Anschluss an die Bahnstrecke Richtung Lauenförde, Bodenfelde, Göttingen <strong>und</strong> Northeim.<br />
Bildung – Höxter ist Standort der Hochschulabteilung FH Höxter (zugehörig zur Fachhochschule Lippe<br />
<strong>und</strong> Höxter). Als weiterbildende Schulen existieren direkt in Höxter das König-Wilhelm-Gymnasium, die<br />
Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule <strong>und</strong> die Hauptschule sowie eine kaufmännische Schule<br />
(Berufsschule <strong>und</strong> Wirtschaftsgymnasium).<br />
Söhne <strong>und</strong> Töchter der Stadt – Thomas von Heesen, Fußballtrainer von Arminia Bielefeld, Klaus Töpfer,<br />
B<strong>und</strong>esminister a.D. (geboren in Schlesien, kam im Kindesalter nach Höxter)<br />
10. SCHLOSS FÜRSTENBERG<br />
Porzellanmanufaktur Fürstenberg<br />
Eine geeignetere Stelle <strong>für</strong> die Anlage einer Burg ist im weiteren Umkreis nicht zu finden. Nirgendwo<br />
erhebt sich ein Berg in dieser Form am Ufer der Weser empor. Auf seine Form <strong>und</strong> Lage geht auch der<br />
Name Fürstenberg zurück. Damit ist kein Geschlecht oder gar Fürst im heutigen Sinne gemeint, sondern<br />
der Name Vorstenberg, wie er früher hieß, umschreibt einfach seine hervorragende - hervorstehende -<br />
topographische Lage.<br />
Für das Mittelalter sind nur spärliche Daten überliefert, aus denen wir jedenfalls annehmen können, dass<br />
kurz vor 1350 eine Burg an dieser Stelle entweder modernisiert oder ganz neu erbaut worden war. Einiges<br />
deutet darauf hin, dass es sich um die Modernisierung einer bereits bestehenden Anlage handelte.<br />
Ab dem Anfang des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts traten in diesem Raum adlige Familien auf, deren Machtkämpfe<br />
über die nächsten 200 Jahre diese Region beherrschten. Protagonisten sind hauptsächlich die Grafen von<br />
Eberstein <strong>und</strong> die Herren von Homburg. Die Grafen von Dassel <strong>und</strong> andere spielen - zumindest im<br />
Vergleich dazu - lediglich Nebenrollen.<br />
1130 kaufte Graf Otto von Eberstein den "Vorstenberch" vom Grafen Adolph II von Dassel. Die<br />
Überlieferung bzw. Benützung des Namens Fürstenberg deutet darauf hin, dass zu der Zeit eine feste Burg<br />
bereits bestanden hat.<br />
- 9 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Im 12. Jahrh<strong>und</strong>ert verkauften die Eversteiner Fürstenberg an die Herren von Hagen, die in Meinbrexen<br />
residierten. Als diese aber bald darauf ihre Besitzungen verkaufen mussten, ging der Fürstenberg wieder an<br />
die Grafen von Dassel.<br />
1268 verkaufte dann Graf Ludwig von Dassel das Gut Nienover zusammen mit der Hälfte des Sollings, in<br />
dem auch Fürstenberg lag, an König Richard Plantagenet, Graf von Cornwall. Dieser übertrug den Solling<br />
im Jahre 1272 an den Welfen Albrecht den Großen, womit der Fürstenberg nun auch in seinem Besitz<br />
gewesen wäre. Allerdings klappte das nicht so ohne weiteres mit der Übergabe der Immobilien, denn<br />
nachdem Richard gestorben war, weigerte sich sein Nachfolger, Rudolf von Habsburg, die Übertragung<br />
des Besitzes zu bestätigen. Also ging das Ganze zwischenzeitlich an den Grafen von Waldeck. Aber<br />
schließlich bekamen die Welfen doch noch Fürstenberg <strong>und</strong> den Solling, denn 1308 verkaufte Waldeck<br />
den Besitz endlich an den Herzog Albrecht den Feisten von Göttingen.<br />
Kurz vor 1350 müssen die Welfen auf dem Fürstenberg eine Burg entweder erbaut oder ,<br />
wahrscheinlicher, erneuert haben, denn in einem corveyischen Lehensverzeichnis wird unter diesem Jahre<br />
der Herzog von Göttingen als ein Vasall Corveys angeführt, der auch ein Teil des Sollings zum Lehen<br />
erhalten hatte, "in qua jam structum est de Vorstenberch".<br />
Bald darauf müssen die Herzöge von Göttingen Pleite gemacht haben, denn ab 1399 war der Forstinberg,<br />
wie er damals hieß, an Gottschalck von Plesse verpfändet.<br />
Erst im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert hören wir wieder von Fürstenberg. Im Jahre 1519 hatte Herzog Ulrich von<br />
Württemberg sein Land verlassen müssen, weil er dort von dem Schwäbischen B<strong>und</strong> vertrieben wurde.<br />
Während seines Exils residierte er abwechselnd bei s<strong>einen</strong> Schwägern Philip von Hessen <strong>und</strong> dem Herzog<br />
Heinrich den Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg. Mehrmals hielten sich die drei Herzöge auf der<br />
gerade fertiggestellten Sababurg im Reinhardswald, die Philip gehörte, der Residenz in Wolfenbittel, wo<br />
Heinrich normalerweise wohnte, oder auf dem Fürstenberg auf.<br />
Im Schmalkaldischen Krieg, als die welfischen Gebiete fast ganz in den Händen des B<strong>und</strong>es waren, wurde<br />
Fürstenberg 1545 unter Wolrad von Mansfeld <strong>und</strong> Otto von Malsburg von den Hessen genommen <strong>und</strong><br />
weitgehend zerstört.<br />
Jedenfalls fand die Burg Fürstenberg mit ihrer Zerstörung ein Ende, denn sie hatte als Schutz- <strong>und</strong><br />
Trutzburg ausgedient, aber weil man an der Stelle doch noch <strong>einen</strong> Verwaltungssitz brauchte <strong>und</strong> weil<br />
außerdem die weiten Forsten des Sollings <strong>für</strong> <strong>einen</strong> der wichtigsten Zeitvertreibe der Fürsten - nämlich der<br />
Jagd - wie geschaffen waren, wurde der Fürstenberg etwa ab 1590 als Jagdschloss von Herzog Heinrich<br />
Julius von Braunschweig wiederaufgebaut. Die vordere Fassade wurde im Stil der Weserrenaissance, das<br />
Torhaus mit hohem, reich geschmücktem Giebel, Voluten <strong>und</strong> Pyramiden gestaltet. Das vergoldete<br />
Monogramm HE weist auf den damals regierenden Herzog Heinrich Julius <strong>und</strong> dessen Gemahlin<br />
Elisabeth hin.<br />
Fürstenberg ist einer der wenigen Orte, die nicht nur eine Burg beziehungsweise Schloss besitzen, sondern<br />
derer gleich zwei. Denn es gibt noch die ehemalige Herzoglich-Braunschweigisch-Lüneburgische Domäne,<br />
wovon das dazugehörige Herrenhaus auch ein Schloss ist. Allerdings wird es immer nur als "die Domäne",<br />
bzw. gar nur als "Pächterwohnhaus" bezeichnet, weshalb das Gebäude als Schloss kaum Eingang in das<br />
Bewusstsein der Leute gef<strong>und</strong>en hat.<br />
Die Domänen rühren noch aus einer Zeit her, in der die Wirtschaft des gesamten Landes auf der<br />
Landwirtschaft beruhte. Auch wenn ausreichend Nahrungsmittel produziert wurden, so war Geld als<br />
Zahlungsmittel knapp. In diesen Zeiten besaßen die Landesherren so genannte "Eigenwirtschaften",<br />
riesige landwirtschaftliche Güter, deren Erträge in die Kasse des Landesherrn flossen.<br />
Über die nächsten 150 Jahre liegen z. Z. keine Aufzeichnungen vor. Es steht aber fest, dass den<br />
Gr<strong>und</strong>stock des späteren Dorfes die Arbeiter der Domäne bilden. Es entsteht eine Gaststätte, zur<br />
Versorgung der Einwohner, vor allem aber der Reisenden. Bier <strong>und</strong> Schnaps werden erzeugt. An<br />
Fürstenberg führte die Straße von Kassel über Lauenförde nach Holzminden vorbei, auch wurde das Amt<br />
- 10 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
ständig von Einwohnern aufgesucht, die während ihres Aufenthaltes verpflegt werden mussten. Bald<br />
siedelten sich auch ein Schmied <strong>und</strong> ein Müller an. Das Dorf war entstanden, auch wenn die Entstehung,<br />
im sozial-geographischen Sinn, nicht mit einem Datum zu belegen ist.<br />
Im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert werden dann von Fürstenberg aus durch den Oberjägermeister von Langen die<br />
Sollingwälder wirtschaftlich neu organisiert.<br />
Zahlreiche Versuche wurden unternommen, Wasser in den Ort zu leiten (Wassersammelanlage<br />
Stutzenborn/Luisenruh ?, heute noch sichtbar) <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen <strong>für</strong> eine wirtschaftliche Entwicklung zu<br />
legen.<br />
Ein großes Mühlenbauprojekt ab 1740, eine Mühle mit waagerechten Flügeln - also unabhängig von der<br />
Windrichtung - wird aber nie fertig gestellt. Ihr Konstrukteur, Orffyreus, stirbt 1745, ehe noch der<br />
Dachstuhl fertig gestellt ist.<br />
Am 11. Januar 1747 wird die Porzellanmanufaktur durch den Herzog Carl I. von Braunschweig gegründet<br />
<strong>und</strong> die Mühle, als erstes ihr zugewiesene Fabrikgebäude, zweckentfremdet fertig gestellt.<br />
11. KLOSTER CORVEY<br />
Corvey ist eine ehemalige Benediktinerabtei in Höxter im heutigen Nordrhein-Westfalen. Corvey war<br />
eines der bedeutendsten karolingischen Klöster, es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des<br />
Landes <strong>und</strong> zahlreiche Bischöfe gingen aus der Abtei hervor.<br />
Kaiser Ludwig der Fromme begründete im Jahre 815 auf Veranlassung seines Vaters Karls des Großen ein<br />
Kloster in Hethis, unweit von Corvey, das von Benediktinermönchen aus Corbie an der Somme bezogen<br />
wurde, <strong>und</strong> nannte es Corbeia nova, neues Corbie. Diese verlegten den Sitz im Jahre 822 an die Stelle des<br />
heutigen Corvey, wo es sich im 9. <strong>und</strong> 10. Jahrh<strong>und</strong>ert zu einem der bedeutendsten Kulturzentren<br />
Nordwesteuropas entwickelte. In dieser Zeit schrieb Widukind von Corvey hier seine Sachsengeschichte<br />
(nicht zu verwechseln mit dem Sachsenspiegel des Eike von Repgow aus dem 13. Jahrh<strong>und</strong>ert). Die<br />
dreischiffige Basilika wurde 830 begonnen <strong>und</strong> 844 geweiht. Aus dieser Zeit sind die unteren Stockwerke<br />
des Westwerks erhalten. Die dort vorhandenen Fresken aus dem 9. Jahrh<strong>und</strong>ert zeigen antike Motive der<br />
Odyssee.<br />
Unter Abt Wibald von Stablo (1146 – 1158) wurde das Westwerk in seiner heutigen Form ausgebaut <strong>und</strong><br />
das Kloster erlangte seine Reichsfreiheit. Es gelang ihm auch, ein kleines Territorium von 5 km² zu bilden,<br />
welches unmittelbar an das des Fürstbischofs von Paderborn angrenzte, in dessen Diözese es auch lag.<br />
1500 kam Corvey zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis.<br />
Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Kloster zerstört <strong>und</strong> danach barock in seiner heutigen Form wieder<br />
aufgebaut. Das etwa 12.000 Einwohner starke Hochstift, das im Jahr über etwa 100.000 Taler Einnahmen<br />
verfügte, versuchte sich stets aus der Abhängigkeit des Bischofs von Paderborn zu lösen. Einen enormen<br />
Motivationsantrieb erhielt es durch die Bedrohung seines Aussterbens, zählte der Konvent doch 1786<br />
lediglich noch 13 Mitglieder. Da es nur adligen Kandidaten Aufnahme gewährte <strong>und</strong> es von diesen kaum<br />
noch Bewerber gab, versuchte man dem Untergang durch die Erhebung in ein Bistum zu entgehen.<br />
Nach verschiedenen Vergleichen mit den umliegenden Herrschern <strong>und</strong> dem Bischof von Paderborn<br />
erlangte die Abtei 1779 die Erhebung in den Rang einer exemten Territorialabtei. In Gegenwart des Abtes<br />
beschloss der Konvent, dass der Gottesdienst, der stets sein benediktinisches Gepräge behalten hatte, auch<br />
nach einer Säkularisation der Abtei nicht verringert werden sollte, was <strong>für</strong> <strong>einen</strong> noch immer strengen<br />
klösterlichen Tagesablauf sprach. Für die Abhaltung der Gottesdienste wurden die Alumnen des 1786<br />
eröffneten Priesterseminars herangezogen, da die meisten Mönche zu alt waren, um den ganzen<br />
Gottesdienst abhalten zu können. Zugleich wurde die Zahl der künftigen Domherren auf zwölf <strong>und</strong> deren<br />
- 11 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Gehalt auf 500 Taler festgelegt. Auch wurde die Vita communis weitestgehend reformiert <strong>und</strong> die Klausur<br />
aufgehoben.<br />
1788 richtete die Abtei ihren Säkularisierungsantrag an den Papst. Hier<strong>für</strong> wurde besonders Ferdinand<br />
von Lüninck aktiv, der da<strong>für</strong> mit einem Domkanonikat entlohnt wurde. Der Papst hob das Kloster 1792<br />
auf <strong>und</strong> erhob sein Stiftsgebiet zum Bistum, welches lediglich 10 Pfarreien umfasste. Die Konventualen<br />
wurden nun zu Domherren erhoben, denen sich noch weitere Domizellare zugesellen sollten. Gleichzeitig<br />
erhielt die neue Kathedrale sechs Domvikare. Der Abt Theodor von Brabeck wurde nun Bischof <strong>und</strong> der<br />
Prior Domdechant. Die Kleidung <strong>und</strong> die Rechte wurden den übrigen deutschen Domkapiteln<br />
angeglichen. Im Jahr 1794 wurde die Urk<strong>und</strong>e durch den Kaiser ausgestellt <strong>und</strong> das neue Bistum, das<br />
lediglich das Gebiet des Hochstiftes umfasste, der Kirchenprovinz Mainz unterstellt. Auf Theodor von<br />
Brabeck folgte 1794 Ferdinand von Lüninck als Fürstbischof. Schon wenig später wurde 1803 das<br />
Fürstentum Corvey durch die Säkularisation aufgehoben. Das Bistum Corvey blieb bis zum Tode<br />
Ferdinand von Lünincks 1825 bestehen.<br />
In Corvey befindet sich das Grab des Dichters Hoffmann von Fallersleben, der als Bibliothekar die<br />
Fürstliche Bibliothek Corvey des Herzogs von Ratibor <strong>und</strong> Fürsten von Corvey mit etwa 74.000 Bänden<br />
betreute.<br />
Das Herzogliche Haus Ratibor <strong>und</strong> Corvey ist bis heute Eigentümer von Schloss Corvey.<br />
Beim Kloster befinden sich Reste der Stadt Corvey, die r<strong>und</strong> um das von Corvey abhängige Stift<br />
Niggenkerken von den Äbten als Konkurrenz <strong>für</strong> das nahe gelegene Höxter gegründet wurde. Die<br />
Siedlung verfiel nach einem Überfall des Bischofs von Paderborn <strong>und</strong> der Bürger Höxter 1267 allmählich<br />
<strong>und</strong> wurde im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert endgültig aufgegeben. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Klosters<br />
befindet sich die Ruine der abhängigen Probstei tom Roden.<br />
12. GUT ALLERSHEIM (HOLZMINDEN)<br />
Das im Ortsteil Allersheim der Stadt Holzminden an der alten B 64 gelegene Stiftungsgut war früher ein<br />
Außenhof des Klosters Amelungsborn <strong>und</strong> wurde diesem 1549 durch Herzog Heinrich den Jüngeren<br />
tauschweise gegen den Altendorfer Zehnten <strong>und</strong> verschiedene Zins- <strong>und</strong> Meiergüter entzogen. Von 1620<br />
bis 1639 befand sich das Gut im Eigentum der Familie von Mengersen.<br />
Herzog Ernst-August kaufte das Gut <strong>für</strong> 15.000 Taler zurück <strong>und</strong> vereinigte es 1649 mit verschiedenen,<br />
bis dahin zum <strong>für</strong>stlichen Amt Fürstenberg gehörenden Alt-Ebersteinschen Liegenschaften zu einem<br />
besonderen <strong>für</strong>stlichen Amte Allersheim.<br />
Seitdem als <strong>für</strong>stliches Kammergut verpachtet, wurde das Gut mit anderen landeseigenen Liegenschaften<br />
1934 in die Braunschweig-Stiftung eingebracht. Das gut arrondierte Wirtschaftsareal erstreckt sich<br />
zwischen Weserufer <strong>und</strong> Waldrand des Sollings.<br />
Es umfasst zur Zeit r<strong>und</strong> 370 Hektar, wovon 352 Hektar landwirtschaftlich nutzbar sind. Bei <strong>für</strong><br />
ackerbauliche Nutzung günstigem Klima werden auf den überwiegenden Lehmböden Weizen, Gerste,<br />
Zuckerrüben, Raps <strong>und</strong> Roggen angebaut. Die Wirtschaftsgebäude bilden zusammen mit dem<br />
Pächterwohnhaus <strong>einen</strong> großen übersichtlichen Gutshof, dessen Gebäudebesatz, aus dem 17.-19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert stammend <strong>und</strong> unter Denkmalschutz stehend, aber überdimensioniert ist.<br />
- 12 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
13. SCHLOSS BEVERN<br />
Bedeutendes Baudenkmal der Weserrenaissance<br />
Schloss Bevern gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern der Weserrenaissance. Es wurde in den<br />
Jahren 1603 - 1612 nach wesentlichen Vorgaben des Bauherrn, Statius von Münchhausen, als regelmäßige<br />
Vierflügelanlage um <strong>einen</strong> quadratischen Innenhof mit Wassergraben, zwei Brücken <strong>und</strong> einem<br />
Schlossgarten errichtet.<br />
Seitdem hat das Schloss ein wechselhaftes Schicksal erfahren. Trotz 20 Kindern aus zwei Ehen starb die<br />
Münchhausenlinie des Statius 1676 aus. Bereits 1652 hatte die Witwe den adeligen Besitz Bevern dem<br />
Herzog August d. J. zu Braunschweig <strong>und</strong> Lüneburg, dem Begründer der berühmten Bibliothek in<br />
Wolfenbüttel, überlassen, der ihn zum herzoglichen Jagdschloss umbaute.<br />
Eine Blütezeit erlebte das Schloss 1667 bis 1687 unter dem jüngsten Sohn des Herzogs, Ferdinand<br />
Albrecht I, dem es als Abfindung zugewiesen wurde. Die hierdurch entstandene herzogliche Nebenlinie<br />
Braunschweig-Bevern regierte ab 1734 das Herzogtum Braunschweig.<br />
Im weiteren Verlauf der Schlossgeschichte wird die Nutzung immer profaner. Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
diente das Schloss zunächst als Pensionärssitz. Später wurde eine Knopffabrik installiert. Im Jahre 1834<br />
richtete man eine „Correctionsanstalt“ mit Wohnungen <strong>und</strong> Werkstätten ein, die 1870 in eine<br />
Erziehungsanstalt <strong>für</strong> elternlose Kinder umgewandelt wurde.<br />
1933 befand sich sogar eine SA-Sportschule <strong>und</strong> Pionierkaserne in den historischen Mauern. In der Zeit<br />
von 1945 - 1949 wurde das Baudenkmal zur Flüchtlingsunterkunft <strong>und</strong> anschließend zum Möbellager.<br />
Im Jahr 1986 hat der Landkreis Holzminden das Schloss von der Gemeinde Bevern übernommen <strong>und</strong><br />
baut es seitdem kontinuierlich zu einem Kulturzentrum aus.<br />
14. KLOSTER AMELUNGSBORN (BEI NEGENBORN)<br />
Das Kloster Amelungsborn (auch Amelunxborn) am Südrande des Odfeldes bei Negenborn <strong>und</strong><br />
Stadtoldendorf im Landkreis Holzminden im Weserbergland ist nach Walkenried die älteste Gründung<br />
des Zisterzienser-Ordens in Niedersachsen.<br />
Gründung des Klosters – Es wurde um 1129 von Siegfried IV., dem letzten Grafen von Northeim-<br />
Boyneburg <strong>und</strong> Homburg gestiftet. Die "villa Amelungsborn", die ihren Namen nach der im Klosterareal<br />
noch heute nachweisbaren Quelle, dem "Born" (Brunnen) des Amelung trägt, gehörte zu den Erbgütern<br />
des Fürstengeschlechts. Am 5. Dezember 1129 wird das Kloster von Papst Honorius II. bestätigt, die<br />
Echtheit dieser Urk<strong>und</strong>e ist allerdings umstritten.<br />
Eine Stiftungsurk<strong>und</strong>e liegt nicht mehr vor. Als wahrscheinlichstes Jahr der Stiftung gilt 1129, da laut<br />
Zisterzienser-Verzeichnissen am 20. November 1135 Abt <strong>und</strong> Konvent in das Kloster einzogen <strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
zwischen der Stiftung <strong>und</strong> dem Einzug des Konvents üblicherweise sechs Jahre vergingen. 1135 erfolgt die<br />
Weihung durch Bischof Bernhard II. von Hildesheim.<br />
Die Besetzung erfolgte wie bei Walkenried <strong>und</strong> später auch bei Michaelstein bei Blankenburg von<br />
Altenkamp am Niederrhein aus, so dass Amelungsborn Enkelkloster von Morimond <strong>und</strong> Urenkelkloster<br />
von Cîteaux, dem 1098 gegründeten Stammkloster der Zisterzienser war.<br />
Erster Abt des Klosters wurde 1141 Abt Heinrich I., ein Halbbruder des Grafen Siegfried IV.<br />
Weitere Entwicklung <strong>und</strong> Tochtergründungen – Die positive wirtschaftliche Entwicklung des Klosters<br />
ermöglichte die Ausbreitung des Ordens. Bereits 1138 stellte Amelungsborn den Gründungsabt <strong>für</strong><br />
- 13 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Kloster Mariental bei Helmstedt. 1145 entsandte Amelungsborn <strong>einen</strong> vollständigen Konvent zur<br />
Gründung des Klosters Riddagshausen bei Braunschweig <strong>und</strong> wurde so zum Mutterkloster von<br />
Riddagshausen. Dort legten die Ordensbrüder eine Teichlandschaft <strong>für</strong> die Fischzucht an, die heute<br />
Naturschutzgebiet ist; von den ehemals 28 Teichen existieren heute noch elf.<br />
Amelungsborn wurde vor allem von dem reichen <strong>und</strong> mächtigen Doberan (heute Bad Doberan) bei<br />
Rostock, dessen Besetzung 1171 <strong>und</strong> nochmals 1176 durch den von Amelungsborn ausgehenden<br />
Wendenbekehrer Mönch Berno (1158 erster Bischof von Mecklenburg), veranlaßt wurde.<br />
Weitere Enkelklöster wurden Isenhagen-Marienrode bei Wittingen <strong>und</strong> Wahlshausen bei Fuldatal durch<br />
Riddagshausen sowie Dargun <strong>und</strong> Pelplin durch Doberan. Amelungsborn wurde das reichste <strong>und</strong> zugleich<br />
mit der ostdeutschen Kolonisationsbewegung am stärksten verb<strong>und</strong>ene Kloster des welfischen Bereiches.<br />
Auch nach der Entfremdung der hauptsächlich um Satow <strong>und</strong> Dranse gruppierten mecklenburgischen<br />
Güter im 14. Jahrh<strong>und</strong>ert sicherte sich das Kloster Amelungsborn reichlich Besitz, der außer durch die<br />
Edelherren von Homburg, als Rechtsnachfolger des Gründers, insbesondere durch die Grafen von<br />
Everstein zwischen Weser <strong>und</strong> Leine freigiebig vermehrt wurde. Darunter befanden sich die teils aus<br />
gelegten Dörfern oder Weilern gebildeten Wirtschaftshöfe (Grangien): Allersheim bei Holzminden,<br />
Schnetinghausen bei Moringen, Erzhausen <strong>und</strong> Bruchhof bei Greene, dazu Stadthöfe in Einbeck, Höxter<br />
<strong>und</strong> Hameln sowie Forstbesitz in der Nähe des Klosters.<br />
Nach der Reformation - Erst im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert geriet Amelungsborn fast widerstandslos in<br />
landes<strong>für</strong>stlicher welfischer Abhängigkeit. 1549 erfolgt die erzwungene Abtretung des reichen Außenhofes<br />
Allersheim bei Holzminden an Herzog Heinrich des Jüngeren von Braunschweig. 1568 nach dem<br />
Regierungsantritt von Herzog Julius von Braunschweig erfolgt die Einführung der Reformation <strong>und</strong> die<br />
Verbindung des Klosters mit einer theologischen Schule im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel.<br />
Amelungsborn wurde nicht aufgehoben, als Abt <strong>und</strong> Konvent das Augsburger Bekenntnis von 1530<br />
annahmen.<br />
Seit dem Dreißigjährigen Krieg, als in Amelungsborn unter dem Landdrostenregiment Herzogs Friedrich<br />
Ulrich zeitweilig eine "Kipper- <strong>und</strong> Wipper-Münze" (Art der Inflation) betrieben wurde, blieben die<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse zerrüttet.<br />
1655 erließ der Herzog eine neue Klosterordnung <strong>und</strong> bestellte den in Holzminden neu eingesetzten<br />
Generalsuperintendenten zum Abt des Klosters.<br />
1760 wurde die Klosterschule durch Herzog Carl I. nach Holzminden verlegt <strong>und</strong> mit der dortigen<br />
Stadtschule vereinigt, aus der später das heutige Campe-Gymnasium hervorgegangen ist.<br />
Um 1810 endet jeder korporative Zusammenhalt, obgleich das Amt des Abtes auch im 19. Jh. weiter<br />
bestehen blieb. Als 1875 die schulischen Aufgaben des Klosters durch die Verstaatlichung der Schule<br />
endet, bestand das Abtsamt noch als Ehrentitel <strong>für</strong> hohe braunschweigische Geistlichkeit fort.<br />
Neuere Zeit – Durch den Gebietsausgleich vom 1. August 1941 gelangte der Landkreis Holzminden vom<br />
Land Braunschweig zur preußischen Provinz Hannover. Gleichzeitig kam die Kirche zur Landeskirche<br />
Hannover. Der Kirchensenat trat in die Rechte des früheren Landesherrn ein <strong>und</strong> übernahm die<br />
Zuständigkeit <strong>für</strong> Kloster Amelungsborn.<br />
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Klosteranlage schwer beschädigt u.a. der äußere Mauerring.<br />
Neue Möglichkeiten brachte der "Loccumer Vertrag", ein Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen<br />
<strong>und</strong> den fünf Landeskirchen. Die zuständigen kirchlichen Behörden konnten nun die "Prälaturen"<br />
Amelungsborn, Königslutter, Mariental <strong>und</strong> Riddagshausen ohne staatliche Mitwirkung regeln.<br />
Die Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom 11. Februar 1965 sagt: „Das Kloster<br />
Amelungsborn ist eine geistliche Körperschaft in der Landeskirche, die landeskirchliche Aufgaben zu<br />
erfüllen hat. Es besteht aus dem Abt <strong>und</strong> den Konventualen. Die Oberaufsicht über das Kloster führt der<br />
- 14 -
<strong>Routenvorschlag</strong> <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>für</strong> <strong>einen</strong> <strong>Schlösser</strong>- <strong>und</strong> Burgenflug durch das Weserbergland<br />
Kirchensenat; er erlässt die Klosterverfassung <strong>und</strong> bestimmt im Einverständnis mit dem<br />
Landessynodalausschuss die landeskirchlichen Aufgaben des Klosters. Der Abt wird nach Anhörung des<br />
Konvents vom Kirchensenat ernannt.“<br />
15. BURG GREENE (BEI KREIENSEN)<br />
Die Burg Greene ist eine mittelalterliche Burganlage bei der Ortschaft Greene in Niedersachsen. Greene<br />
war schon vor über 1000 Jahren durch seine Fuhrt durch die Leine ein wichtiger Ort an der alten Ost-<br />
West-Straße, die die Nord-Süd-Strecke bei Mühlenbeck kreuzt. 980 wurde Greene erstmals urk<strong>und</strong>lich<br />
erwähnt, als Kaiser Otto II. den Stift Gandersheim den Herr- <strong>und</strong> Gerichtsbann von Greene schenkte.<br />
1308 war die Greener Burg durch die Edelherren von Homburg neu erbaut.<br />
1409 starb das Geschlecht der Homburger aus. Die Witwe des letzten Edelherren erhielt Witwenrechte<br />
auf Burg Greene, welche laut Vertrag vom 09.10.1409 dem Herzog Bernhard von Braunschweig vererbt<br />
war. Dieses führte zu einem Streit mit dem Bischof von Hildesheim. 1414 überlassen die Welfen dem<br />
Bischof die Burg <strong>für</strong> 12.000 rheinische Gulden, sie behalten sich aber das Wiederverkaufsrecht vor. 1436<br />
starb Schonett, die Witwe des letzten Homburgers in Hildesheim, wurde im Dom beigesetzt <strong>und</strong> Burg<br />
Greene wurde hildesheimerisch 1451 gestand der Bischof von Hildesheim dem braunschweigischen<br />
Herzog Wilhelm d.Ä. das Recht zu, Burg Greene gegen Zahlung der Pfandsumme von 12000 Gulden<br />
einzulösen 1499 war es den Welfen möglich, die 12.000 Gulden aufzubringen <strong>und</strong> machten die Burg zum<br />
Sitz des Herzoglichen Amtes Greene. 1553 verwüstete Graf von Mansfeld Burg Ort <strong>und</strong> Brücke, aber man<br />
baute alles bald wieder auf Im 30 jährigen Krieg von 1618 -1648 wurde die Burg stark beschädigt. 1694<br />
Im Dezember wird auf Anordnung der Herzöge Rudolf August <strong>und</strong> Anton Ulrich die Burg aufgegeben,<br />
"weil das alte Schloß <strong>und</strong> Amtshaus sowohl Alters als Gefahr halber nicht mehr bestehen, weniger der<br />
Amtshaushalt auf solchen alten Gebäude fernerhin geführet werden könne" Von 1696-1704 wurde das<br />
neue Amtshaus an der Heerstraße nach Wickensen errichtet. 1704 war die Burg verlassen <strong>und</strong> verfällt<br />
allmählich. 1732 verlieh Herzog Rudolf Greene das Marktrecht 1953 wurde die Burg zur<br />
B<strong>und</strong>esweihstätte <strong>für</strong> die deutschen Kriegsgefangenen <strong>und</strong> der Burgturm zum Ehrenturm erklärt.<br />
- 15 -