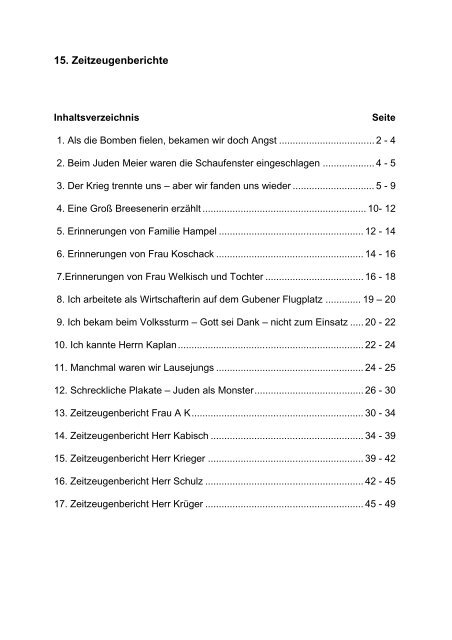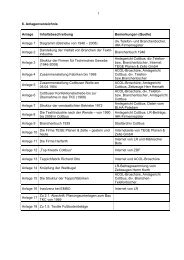15. Zeitzeugenberichte
15. Zeitzeugenberichte
15. Zeitzeugenberichte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>15.</strong> <strong>Zeitzeugenberichte</strong><br />
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Als die Bomben fielen, bekamen wir doch Angst ................................... 2 - 4<br />
2. Beim Juden Meier waren die Schaufenster eingeschlagen ................... 4 - 5<br />
3. Der Krieg trennte uns – aber wir fanden uns wieder .............................. 5 - 9<br />
4. Eine Groß Breesenerin erzählt ............................................................ 10- 12<br />
5. Erinnerungen von Familie Hampel ..................................................... 12 - 14<br />
6. Erinnerungen von Frau Koschack ...................................................... 14 - 16<br />
7.Erinnerungen von Frau Welkisch und Tochter .................................... 16 - 18<br />
8. Ich arbeitete als Wirtschafterin auf dem Gubener Flugplatz ............. 19 – 20<br />
9. Ich bekam beim Volkssturm – Gott sei Dank – nicht zum Einsatz ..... 20 - 22<br />
10. Ich kannte Herrn Kaplan.................................................................... 22 - 24<br />
11. Manchmal waren wir Lausejungs ...................................................... 24 - 25<br />
12. Schreckliche Plakate – Juden als Monster........................................ 26 - 30<br />
13. Zeitzeugenbericht Frau A K............................................................... 30 - 34<br />
14. Zeitzeugenbericht Herr Kabisch ........................................................ 34 - 39<br />
<strong>15.</strong> Zeitzeugenbericht Herr Krieger ......................................................... 39 - 42<br />
16. Zeitzeugenbericht Herr Schulz .......................................................... 42 - 45<br />
17. Zeitzeugenbericht Herr Krüger .......................................................... 45 - 49
1. Zeitzeugenbericht Frau Karge (anonym)<br />
Geboren wurde ich in Groß-Bösitz - das gehörte zu Guben. Später zogen wir nach Guben in<br />
die Bösitzer Straße in eine kleine Wohnung. Wir waren 8 Geschwister. Mein ältester Bruder<br />
wurde 1906, der zweite 1909 geboren. Am 28. April 1911 kam ich dann als ältestes Mädchen<br />
zur Welt. 1913 und 1914 bekam ich dann noch 2 Schwestern und 1922 einen Bruder. 1929<br />
wurden noch die Zwillinge, zwei Mädchen, geboren. Ich war als Kind sehr krank, durch Masern<br />
war ich damals schon fast erblindet.<br />
Mein Vater war bei der Hutfabrik Lißner als Presser beschäftigt. Meine Mutter ging der Kinder<br />
wegen nur zeitweise als Weberin in die Tuchfabrik Wolf arbeiten. Meine Einschulung fand<br />
1917 in der Sandschule statt. Später ging ich aber durch den Umzug in die Hindenburgschule.<br />
Da ich das älteste Mädchen war, mußte ich viel zu Hause helfen. Die Schule war für mich<br />
immer zweitrangig. Mein Vater kam eines Tages nach Hause und berichtete, daß die Firma in<br />
der Ostsiedlung Häuser baut und wer Interesse hat, sollte sich melden. Das tat er dann auch<br />
und nachdem mein jüngster Bruder 1922 geboren war, zogen wir in die Ostsiedlung in ein<br />
Häuschen mit Garten ein. Es war sehr schön dort. Wir hatten auch eine kleine Laube, in der<br />
wir öfter Frühstückten.<br />
1925 kam ich aus der Schule und da das Geld gebraucht wurde, fing ich gleich als Zwirnerin<br />
bei der Tuchfabrik Wolf zu arbeiten an, wo ich später meinen Ehemann kennenlernte. Er war<br />
dort Meister in der Walke. 1937 heirateten wir und 1939 wurde unser Sohn geboren. Am<br />
Anfang unserer Ehe bewohnten wir in der Ostsiedlung eine kleine Wohnung in einem<br />
Privathaus mit einer Stube und Küche. Als unser Sohn 2 oder 3 Jahre alt war, erhielten wir von<br />
der Firma Wolf eine schöne Werkswohnung in der Trommelgasse. Wir hatten zwei Zimmer,<br />
eine große Küche - alles schön und neu eingerichtet - und Toilette. Wir haben uns dort sehr<br />
wohlgefühlt. 1941 wurde mein Mann zur Wehrmacht eingezogen und 1942 ist er im Lazarett in<br />
Brandenburg gestorben.<br />
Als 1945 der Räumungsbefehl bekannt gegeben wurde, meinten die Leute aus dem Haus, es<br />
wird schon nicht so schlimm werden und wir versteckten uns gemeinsam auf dem Hof der<br />
Firma Wolf in einer Lagerhalle. Als dann die ersten Bomben fielen bekamen wir doch Angst<br />
und beschlossen, zu flüchten. Meine Schwägerin mit ihren beiden Jungen kam zu mir. Da wir<br />
wußten, daß die Firma Wolf die Tuche retten wollten und sie mit LKWs wegbrachten, fragten<br />
wir die Fahrer, ob sie uns - meine Schwägerin mit den zwei Jungen und mich mit meinem<br />
Jungen - mitnehmen würden. Kurz vor Senftenberg haben sie uns ausgeladen und wir sind zu<br />
Fuß weitergelaufen. Meine Schwägerin hatte in Senftenberg Verwandte, bei denen wir bleiben<br />
konnten. Die besaßen eine Gaststätte und uns ging es gut. Als eines Tages die Russen<br />
kamen, meinten die Wirtsleute, wir sollten uns auf dem Boden verstecken und leise sein. Der<br />
Wirt versorgte uns mit Essen und was sonst noch gebraucht wurde.<br />
Ein Russe kam zu uns auf den Boden und forderte meine Schwägerin und mich auf,<br />
mitzukommen in ein Gästezimmer. Wir nahmen jeder unser Kind mit. Der Sohn meiner<br />
Schwägerin schrie so sehr, daß er sie wieder gehen ließ. Ich saß auf dem Bettrand, meinen<br />
Sohn im Arm und der besoffene Russe neben mir. Immer wieder sagte ich zu meinem Sohn:<br />
Schrei doch! Aber er war so voller Angst, daß er keinen Ton herausbrachte. Irgendwann war<br />
es dem Russen zu viel und ich konnte gehen.<br />
Als der Krieg zu Ende war, machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Guben. Unterwegs<br />
übernachteten wir in einer Villa. Die Leute, denen das Haus gehörte, hatten sich in Sicherheit<br />
gebracht. Nur die Angestellten, eine Familie mit einer Tochter, bewachten das Haus und ließen<br />
uns bei sich schlafen. Nachts kamen auch hier wieder Russen und suchten nach Frauen. Sie<br />
hatten die Tochter unserer Wirtsleute im Visier, die sie aber nicht finden konnten, weil man sie<br />
weggebracht hatte. Dafür sollte ich mitgehen, aber ich weigerte mich. Die Anderen bettelten,<br />
2
ich soll doch mitgehen, sonst erschießen sie uns - und letzten Endes blieb mir nichts anderes<br />
übrig, als doch mitzugehen. Der große, kräftige Kerl führte mich die Treppe hinauf und kam mit<br />
einem Talglicht hinterher. Im Zimmer angekommen, fragte ich, was ich hier soll. Er sagte:<br />
Sauber machen! Ich meinte, es ist alles sauber und lief im Dunkeln wieder die Treppe hinunter.<br />
Ein Wunder, daß ich nicht gestürzt bin. Der Wachposten, der vor der Tür stand und die<br />
anderen Leute bewachte, stieß ich zur Seite und ging hinein zu den Anderen. Am nächsten<br />
Morgen sind wir frühzeitig aufgestanden, um weiterzugehen.<br />
Die Kinder machten sich auch über die Russen lustig, da die sich ihr Frühstück aus einem<br />
Nachttopf schmecken ließen.Wir sind bis nach Guben gekommen, dort haben die Polen<br />
Straßensperren auf der Chaussee eingerichtet. Nachbarn hatten uns für den Transport einen<br />
Handwagen gegeben.An der Straßensperre wurden wir durchsucht, ich konnte ungeschoren<br />
durchgehen. Anderen wurde vieles weggenommen.<br />
Zu Hause angekommen konnten wir nicht in unsere Wohnung, es war alles verwüstet. Wir<br />
bewohnten eine Doppelhaushälfte und zwischen den beiden Wohnungen hatte man im<br />
Wohnzimmer ein großes Loch geschlagen, um hin und her zu gehen. Wir schliefen also<br />
vorerst in der Waschküche, in die wir zunächst alle verfügbaren Chaiselongues und Betten<br />
räumten. Ein Mann aus dem Haus versuchte, einiges zu reparieren, wie zum Beispiel die<br />
Fenster.<br />
Am 20. Juni 1946 mußten wir ganz plötzlich wieder raus. Ich konnte nur mein Kind nehmen<br />
und dann ging es über die Lubststraße zum Spicherer Platz. Hier war alles voller Menschen.<br />
Ich sagte zu meiner Nachbarin, es geht ja nicht voran, wer weiß, wie lange wir hier noch<br />
zubringen müssen. Ich gehe noch mal zurück und hole noch den Sportwagen und ein Bett für<br />
den Jungen. Vor der Grenze hatten die Polen ein Haus eingerichtet, in welches alle zur<br />
Kontrolle hineingehen mußten. Sie durchsuchten uns und manchen wurde der Schmuck und<br />
die Uhren abgenommen. Über die Achenbachbrücke, die man notdürftig mit Balken belegt<br />
hatte, kamen wir auf die Westseite von Guben. Manch ein Leiterwagen ist in die Neiße<br />
gestürzt, da es sehr eng und eine ziemlich wackelige Angelegenheit war. In der Siedlung<br />
Thielestraße hatten wir gute Bekannte, bei denen wir bleiben konnten. Hier habe ich auch<br />
meine Eltern getroffen, die ebenfalls aus ihrem Haus raus mußten.<br />
Meine Mutter meinte, wir können den Bekannten nicht so lange zur Last fallen und bemühte<br />
sich, eine Behelfswohnung zu erhalten. Ich bekam in der Grochestraße ein Holzhäuschen mit<br />
einer Stube und Küche mit Herd. Ein Plumpsklo für mehrere Leute war etwas abseits. Im<br />
Sommer war es warm und im Winter sehr kalt. Um das Zimmer warm zu bekommen, mußte<br />
man ständig feuern. Das Wasser, das wir uns in Eimern holen mußten, war, wenn es richtig<br />
kalt war, ständig eingefroren. Wir sammelten im Wald Kusken (Kiefernzapfen) und Holz. Die<br />
Wälder waren damals sauber, wie ausgefegt. Eines Tages erzählten Nachbarn, daß sich die<br />
Leute nachts Bäume aus dem Wald klauten, um etwas mehr Brennholz zu haben und nicht<br />
frieren zu müssen. Wir beschlossen, das auch so zu machen. Meine Eltern, die in der Nähe<br />
auch in solch einem Holzhäuschen wohnten, und ich gingen mit Säge und Axt in den Wald in<br />
der Nähe der damaligen Lungenstation, heute die Gegend in der Nähe der Klaus-Hermann-<br />
Straße. Eines Tages, meine Nachbarin und ich waren wieder einen Baum umsägen. Wir<br />
haben wir das zersägte Holz auf einen Handwagen geladen und begaben uns auf den<br />
Heimweg. Uns erwischte die Polizei und wir mußten mit auf die Polizeiwache in die<br />
Kaltenborner Straße. Das Holz mußte ich dort abladen und die Säge meines Vaters wurde<br />
beschlagnahmt.<br />
In diesem Behelfsheim habe ich 27 Jahre!!! - bis 1973 - gewohnt. Erst dann führten meine<br />
Bemühungen zum Erfolg und ich bekam eine Neubauwohnung. In diesem Haus, aber in einer<br />
anderen Wohnung, wohne ich noch heute.<br />
3
Meine Mutter - sie war bei der Ärztin, Frau Dr. R. in Behandlung - erzählte mir, daß diese eine<br />
Hilfe für den Haushalt sucht. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich im Wald und dachte, das<br />
wäre etwas für mich, da ich dann nicht mehr bei Wind und Wetter draußen arbeiten mußte. Ich<br />
stellte mich bei ihr vor und wurde auch eingestellt. Ich verdiente monatlich 100 Mark, das war<br />
nicht viel. Fr. Dr. R. war eine sehr nette Frau und wir haben uns sehr gut verstanden. Sie lebte<br />
mit einer jüdischen Frau zusammen. Diese hatte sie die ganzen Jahre während der Nazizeit<br />
bei sich versteckt. Nur nachts sind sie gemeinsam an die frische Luft gegangen. Später zogen<br />
beide nach Dresden.<br />
Ich traf meinen früheren Meister und er bot mir an, wieder bei ihm zu arbeiten. Der Betrieb lief<br />
inzwischen wieder und sie brauchten dringend Leute. Nach dem Wegzug von Frau Dr. R., so<br />
ca. 1950, begann ich wieder mit der Arbeit als Zwirnerin bei der Gubener Wolle, bis ich dann<br />
als Rentnerin aus dem Betrieb ausschied.<br />
2. Zeitzeugenbericht Frau Müller (anonym)<br />
Am 8.8.1919 wurde ich in Merzwiese, Kreis Crossen, geboren. Wir hatten dort einen kleinen<br />
Bauernhof, den meine Mutter bewirtschaftete. Mein Vater arbeitete als Maurer in Guben.<br />
Ich wuchs mit zwei Schwestern, einer jüngeren und einer älteren auf.<br />
1926 wurde ich in Merzwiese eingeschult und ging dort 2 oder 3 Jahre zur Schule.<br />
1929 verkauften wir unser Grundstück und zogen nach Guben. In der Kohlstraße hatten wir<br />
eine Mietwohnung mit einer Stube und Küche. Hier besuchte ich dann die Hindenburgschule.<br />
Meine Mutter arbeitete in der Küche der Mückenberger Kaserne und verdiente gut.<br />
Mein Vater hatte eine Anstellung in Mückenberg bei Maurermeister Schmidt und so konnten<br />
wir uns später ein kleines Häuschen in einer Arbeiterwohnsiedlung, gleich bei den<br />
Mückenberger Kasernen, leisten.<br />
Diese Arbeiterwohnsiedlung nannte sich Arbeitereigentum. Wir zahlten am Anfang monatlich,<br />
ich glaube 30,- Mark ab. Durch den guten Verdienst meiner Eltern konnten wir später das<br />
Haus vollständig abzahlen. Wir bewohnten dann dort eine Doppelhaushälfte im Heimweg mit 3<br />
Zimmern und Küche. Toilette gab es allerdings nicht. Wir hatten draußen ein Plumpsklo.<br />
1933 kam ich aus der Schule und arbeitete bis 1945 im Stammhaus der Berlin-Gubener<br />
Hutfabrik. Ich hatte keine Ausbildung und wurde für verschiedene Arbeiten eingesetzt.<br />
Hauptarbeit war das Einkleben der Hutweite (Größe) in die fertigen Hüte. Erlebnisse mit Juden<br />
gab es bei mir nicht, aber als ich nach der Kristallnacht 1939 früh zur Arbeit ging, sah ich, daß<br />
beim Juden Maier am Markt die Schaufensterscheiben eingeschlagen waren. Mein Vater, er<br />
war zu der Zeit schon älter, wurde noch kurz vor Kriegsende eingezogen, aber nicht zum<br />
Volkssturm, sondern zur Truppe Todt.<br />
Am 12. Februar 1945 wurden wir über Lautsprecher zum Verlassen der Stadt aufgefordert.<br />
Meine jüngere Schwester mit ihrem 7 Monate alten Baby, meine ältere Schwester mit vier<br />
Kindern, das Älteste war 12 Jahre, meine Mutter und ich bereiteten uns gemeinsam auf die<br />
Flucht vor. Wir packten einen Handwagen voll mit Wäsche, Betten und was sonst noch<br />
gebraucht wurde und verließen unser Haus in Richtung Bahnhof. Dort stiegen wir in einen mit<br />
Stroh ausgelegten Güterzug, der voller Menschen war. Man brachte uns ohne Zwischenfälle<br />
nach Crinitz bei Luckau. Bei einem Töpfer, der in Crinitz ein großes Haus besaß, bekamen wir<br />
mit noch einer anderen Familie ein Quartier. Wir lebten dort ruhig. Es war zwar ab und zu<br />
Fliegeralarm, aber Bombenabwürfe gab es nicht. Verpflegt haben wir uns selbst mit den<br />
damals üblichen Lebensmittelkarten, die wir bei der Flucht mitnahmen.<br />
Anfang Mai 1945 marschierten auch dort russische Soldaten ein und es fanden<br />
Kampfhandlungen statt. Aus Angst vor Übergriffen versteckten wir uns im Keller des Hauses.<br />
Als die Russen am 8. Mai durch Crinitz durch waren, machten wir uns zu Fuß auf den<br />
4
Heimweg nach Guben. Unseren Handwagen hatte man uns geklaut und deshalb besorgten wir<br />
uns auf die gleiche Weise einen anderen Wagen. Den Kinderwagen wollten uns die Russen<br />
ebenfalls wegnehmen, aber das konnten wir verhindern. Zwei Tage waren wir unterwegs. In<br />
der ersten Nacht schliefen wir in Vetschau in einem Haus, in dem noch viele andere Familien<br />
übernachteten. Die zweite Nacht verbrachten wir in Peitz in der Gaststätte Teichschenke. Über<br />
eine Notbrücke im Königpark gelangten wir über die Neiße. Jedes zweite Haus in der Siedlung<br />
war zerstört. Unser Haus stand noch und war äußerlich unbeschädigt, aber drinnen befand<br />
sich nur noch ein Schrank, ein Tisch und die Betten. Alles andere war ausgeräumt. Wir<br />
versuchten uns wieder häuslich einzurichten, wohnten aber nur für kurze Zeit dort. Am 20. Juni<br />
kamen Polen in unser Haus und sagten, daß wir innerhalb einer Stunde raus sein müssen.<br />
Mitnehmen durften wir nichts, außer das, was wir am Körper trugen und was wir in der Eile an<br />
persönlichen Sachen greifen konnten. Meine Uhr versteckte ich am Körper und hatte Glück,<br />
daß sie nicht entdeckt wurde. Bei der Kontrolle an der Neiße nahmen uns die Polen alles weg,<br />
was ihnen gefiel, da verloren wir noch unser letztes Hab und Gut.<br />
In der Pestalozzistraße im Gemeindehaus (heute ein kirchlicher Kindergarten) mußten wir uns<br />
melden. Dort standen schon viele Menschen. Grüppchenweise wurden wir hineingelassen und<br />
bekamen eine Zuweisung für eine Unterkunft. Wir erhielten eine Wohnung mit zwei Zimmern,<br />
Küche und Toilette in einem Mietshaus in der Kupferhammerstraße. In diesem Haus befand<br />
sich eine Bäckerei und die Mühle. In diesen beiden Räumen lebte unsere Familie mit 9<br />
Personen - Mutter, Schwestern mit ihren Kindern und ich, später auch mein Vater - für zwei<br />
Jahre.<br />
Mein Vater geriet im Kriegseinsatz in tschechische Kriegsgefangenschaft und kehrte im<br />
September/Oktober nach Hause zurück.Mein Vater baute 1947/48 in der Gasstraße 14 das<br />
Dachgeschoß für uns aus und wir zogen dort ein. Ich selbst lebte bis zu meiner Hochzeit 1952<br />
mit in diese Wohnung.<br />
3. Der Krieg trennte uns, aber wir fanden uns wieder –<br />
Familie Schultz<br />
Herr Schultz - Der Weg eines Gubeners im 2. Weltkrieg<br />
Ich wurde am 1.11.1919 in Ratzdorf an der Warthe, Kreis Landsberg, geboren. Meine Eltern<br />
sind mit mir 1927 nach Groß Breesen in das damalige Russenlager, in dem 1914 18.000<br />
Russen interniert waren, gezogen. Dort bewohnten wir ein Haus, an dem sich die<br />
Waschanstalt für das Russenlager anschloß. Wir hatten kein Licht und auch keine Toilette.<br />
Von 1927 bis 1934 besuchte ich die Schule in Breesen und von 1934 bis 1938 habe ich<br />
Former bei der Maschinenfabrik und Gießerei Quade in der Straupitzsstraße, gelernt.<br />
Produziert haben wir Teile für Waschmaschinen und für die Hutindustrie.<br />
Nach der Lehre hatte man in dieser Firma keine Arbeit für mich und so erhielt ich den „Blauen<br />
Brief“. Ich fand eine neue Arbeit bei der Firma Alfred Donath in der Gießerei.<br />
Dort wurden zu dieser Zeit Gehäuse für Traktoren der Marke Loewe hergestellt. Die Firma hat<br />
die Fam. Donath von Fam. Köhler für billiges Geld übernommen. Die Tochter Eva hat sich den<br />
Männern verschrieben, der Sohn den Autos, sie gerieten beide auf die „Schiefe Bahn“ und<br />
irgendwann war die Firma pleite, eine günstige Gelegenheit für Fam. Donath.<br />
Im Oktober 1940 wurde ich als aktiver Soldat verpflichtet und wurde zur Ausbildung in Kystrien<br />
bei den Pionieren stationiert. Nach 8 Wochen ging es nach Polen, nach Cherworsk, an die<br />
russische Grenze zur Vorbereitung auf den Angriff im Juli 1941 auf die Russen.<br />
Am 19.7.1941 bin ich krank geworden. Es war sehr heiß, so 30 - 33 Grad Celsius, und mein<br />
Kreislauf machte schlapp. Der Arzt diagnostizierte Darmkatarr und ich wurde ins Lazarett in<br />
Reichenbach in Schlesien eingewiesen. Nach der Genesung, so ca. 6 Wochen später, kam ich<br />
5
zum Ersatztruppenteil nach Cottbus und nach 3 Wochen wurde ich wieder zur Front abgestellt.<br />
Im Januar 1942 traf ich dann an der Front in der Ukraine ein. Im Oktober 1942 wurde ich<br />
verwundet, ich war nicht transportfähig und lag 3 Wochen auf dem Hauptverbandsplatz.<br />
Nachdem ich operiert wurde und die Transportfähigkeit wieder hergestellt war, wurde ich nach<br />
Kursk verlegt. Dort teilte ich ein Krankenzimmer mit 21 schwer verwundeten Panzerfahrern.<br />
Von dort aus ging es mit einem Lazarettzug nach Bayreuth ins Lazarett. Nach 8 Monaten<br />
wurde ich zur Erholung nach Neuenmark Würzberg verlegt. Mein dortiger Arzt hat mich in den<br />
Heimaturlaub geschickt, da ich schon 6 Monate keinen Urlaub hatte.<br />
Endlich konnte ich meine Eltern besuchen. Meine Eltern wohnten in einer Dienstwohnung im<br />
Parkhotel in dem mein Vater als Hausmeister angestellt war. Am Tag meiner Ankunft hatte er<br />
etliche Zentner Kohlen bekommen und ich half ihm, diese reinzutragen. Mein Zeigefinger war<br />
durch einen Schuß verletzt und beim Kohlenschippen hat sich mein Finger derart entzündet,<br />
weil noch ein Splitter drin steckte, daß ich das Lazarett aufsuchen mußte. Als mein Urlaub zu<br />
Ende war, mußte ich wieder in Neuenmark Würzberg erscheinen. Der Arzt schickte mich<br />
wieder nach Bayreuth zur Behandlung meines Fingers. Dort wurde mir der rechte Zeigefinger<br />
abgenommen und zur Heilung blieb ich noch 8 Wochen.<br />
Dann ging es zurück nach Kystrien und ich wurde zunächst im Ersatztruppenteil eingesetzt<br />
und kam dann zur Ausbildungskompanie und mußte Rekruten ausbilden.<br />
Einmal hatte ich als Unteroffizier einen Fahrauftrag, dort sollte ich einen Arrestanten von<br />
Kystrien nach Frankfurt Oder bringen. Man hat ihn mir mit Handschellen übergeben, ich bekam<br />
eine Pistole und los ging es. Er bat mich, ihm die Handschellen abzunehmen, er würde nichts<br />
machen, das tat ich dann auch und wir kamen auch gut in Frankfurt/Oder an. Ich erinnerte<br />
mich, daß mein Vater, meine Eltern waren bereits geschieden, in Frankfurt wohnt. Ich habe<br />
auch seine Wohnung gefunden, bin aber nicht zu ihm gegangen.. Wieder zurück habe ich ihm<br />
einen Brief geschrieben und kurze Zeit später hat er mich in Kystrien aufgesucht, wollte mir<br />
120,- RM in die Hand drücken (den Unterhalt von 5,- RM pro Monat hatte er nie bezahlt), aber<br />
ich habe sie nicht angenommen.<br />
Dann ging der Kriegseinsatz los, aber nicht nach Polen, sondern nach Dänemark. Ich lieferte<br />
die Soldaten dort ab und kehrte nach Kystrien zurück.<br />
Bis 1943 habe ich dort als Ausbilder für Rekruten fungiert. Zwischendurch war ich für ein paar<br />
Monate in Deichow, dort haben wir nach Flusstreibminen gesucht.<br />
Mitte Februar 1944 hieß es, es geht innerhalb von 8 Tagen an die Front und ich wollte doch<br />
meine Verlobte, mit der ich bereits 5 Jahre zusammenlebte, absichern und so haben wir am<br />
26.2.1944 geheiratet.<br />
Im November/Dezember 1944 sind die Russen in Kystrien einmarschiert, die vorhandenen<br />
Brücken mußten zur Sprengung vorbereitet werden. Ich habe auch Sprengstoff dafür<br />
herangefahren.<br />
Die Festung Kystrien mußte aufgegeben werden, die Brücken wurden alle zerstört, die<br />
Eisenbahnschwellen wurden mit Phosphor übergossen und angebrannt. Nun ging nichts mehr<br />
raus. Wir haben uns nasse Säcke übergeworfen und konnten so doch noch hinaus.<br />
Eine Brücke Richtung Altstadt war noch begehbar, dort befand sich auch ein Bunker. Es waren<br />
dort deutsche Offiziere mit einem russischen Gefangenen, den ich auf die Festung bringen<br />
sollte. Da dies ja eigentlich unmöglich war, gingen wir erst einmal mit einem weißen Tuch los.<br />
Unterwegs habe ich ihm dann meine Waffe gegeben und ihm zu verstehen gegeben, er solle<br />
auf seine Leute warten. Ich bin dann allein weiter Richtung Fürstenwalde (Oderbruch) und bin<br />
bei Manschnow zufällig direkt in eine deutsche Stellung gerobbt.<br />
Wir sind dann mit dem Zug in Richtung Randgebiet von Berlin gefahren und haben in Zehdenik<br />
Stellung bezogen. Ich habe irgendwie den Anschluß verpaßt und wurde unterwegs von den<br />
„Kettenhunden“ aufgegriffen.<br />
6
Die „Kettenhunde“ waren die Militärpolizei und hatten diesen Namen wegen der Ketten mit<br />
einem ziemlich großen Schild, welche sie um den Hals trugen.<br />
Ich bekam von denen Auftrag, in einer Ziegelei russische Gefangene zu beaufsichtigen, bin<br />
aber abgehauen und habe mir ein Nachtquartier gesucht. Da las ich an einem Laden<br />
„Fleischer During“ und ging hinein. Der bot mir ein Quartier im Schweinestall an, der zwar leer<br />
war, aber das war wirklich unter aller Würde. Ich bin wieder zu ihm hin und fragte ihn, ob er<br />
denn in Guben Verwandte habe. Er bejahte meine Frage und ich sagte nur: „na denen werde<br />
ich erzählen, was Du mir für ein Quartier angeboten hast“ und ging wieder. Mir begegnete eine<br />
Frau, die mich fragte, in welcher Einheit ich denn diene und ich antwortete ihr, bei den<br />
Pionieren. Sie fragte „bei den 68.ern?“ Ich sagte ja und sie brachte mich in ein Haus, dort habe<br />
ich in einem Bett sehr gut die Nacht verbracht. Es stellte sich heraus, daß es die Frau eines<br />
Kameraden aus meiner Einheit war.<br />
Am nächsten Morgen haben mich die „Kettenhunde“ wieder geschnappt.<br />
Ich fand meine Einheit wieder. In Richtung Löwenberg, Ludwigslust marschierend gerieten wir<br />
in Hitzacker in englische Gefangenschaft.<br />
Mein Kamerad und ich gruben uns ein Loch, packten Moos rein und wir haben 3 Tage<br />
durchgeschlafen. Unterwegs hatten wir eine Kiste mit Brot organisiert, die wir auch in unserem<br />
Loch versteckten. Das war unser Glück, denn in den drei Wochen, die wir dort verbrachten,<br />
gab es zwar warmes Wasser zum waschen, aber nichts zu essen. Das Brot reichte gerade für<br />
die drei Wochen.<br />
Unterwegs fand ich ein Motorrad, welches ich mitnahm, fahren konnte ich nicht. Dieses<br />
Motorrad haben mir die Engländer bei der Gefangennahme gleich abgenommen, ich erhielt<br />
von ihnen aber eine Stange Zigaretten.<br />
Die Engländer verfrachteten uns in LKWs und brachten uns Richtung Euthin in ein<br />
Entlassungslager. Auf einem Bauernhof wurden wir im Kuhstall untergebracht. Die Kühe<br />
befanden sich auf der Weide. Mein Kumpel und ich hatten insofern Glück, daß im Stall kein<br />
Platz mehr war und wir beide auf dem Heuboden geschlafen konnten.<br />
Zur Beschäftigung haben wir dort sehr viel Fußball gespielt. Mit im Entlassungslager befanden<br />
sich ein Sportoffizier von Hertha BSC und Spieler von Schalke 04 und 1860 München.<br />
Dreimal in der Woche haben wir dann je ein Spiel absolviert und nannten uns „Die Chorgruppe<br />
von Stockhausen“. Für jedes Spiel gab es ½ Liter Milch und eine Tütensuppe für 4-6<br />
Personen. Wenn wir für die Springreiter in Warendorf (bei Euthin) die Ratten auf dem<br />
Dachboden totgeschlagen haben, erhielten wir pro Stück eine Packung Kekse - ich habe mich<br />
davor "gedrückt".<br />
Vom Entlassungslager Euthin ging es mit dem Zug ins Quarantänelager nach Bamberg. Aber<br />
dort wollte ich nicht hin. Das Quarantänelager lag auf der rechten Seite vom Zug. Ich stieg auf<br />
der linken Seite aus dem Zug und bin zu Fuß nach Bayreuth gelaufen. Da ich unterwegs<br />
großen Hunger bekam ging ich in ein Bauernhaus und bat um etwas zu essen, bekam aber<br />
nichts. Einem Kameraden, den ich unterwegs traf, erzählte ich davon. Der gab mir den Rat, im<br />
nächsten Laden ein Kreuz zu kaufen, dann würde mir man etwas geben. Ich folgte seinem<br />
Ratschlag und es war so, wie er sagte, ich bekam dann beim nächsten Bauern auch eine<br />
Stulle.<br />
In Bayreuth habe ich 2 Monate verbracht. Ich war auf der Suche nach einer Unterkunft und<br />
erinnerte mich an eine Frau Schulze, bei der schon meine Frau übernachtet hat, als sie mich<br />
im Lazarett besuchte. Sie bot mir einen Schlafplatz an, in Ihrem Haus konnte ich auf dem<br />
Fußboden der Küche schlafen. In den anderen Räumen waren Flüchtlinge untergebracht.<br />
Arbeit habe ich über einen Bauingenieur, den ich im Lazarett kennenlernte, vermittelt<br />
bekommen. Er fragte mich nach meinem Beruf und ich sagte, ich bin ein gelernter Former. Ich<br />
konnte in meinem Beruf bei der Fa. Kaiser arbeiten und wir haben Maschinenteile produziert.<br />
7
Im November1945 habe ich mich auf den Weg nach Guben gemacht, um nach meiner Frau zu<br />
schauen. In der Nähe von Lobenstein habe ich mich über die Grenze geschmuggelt. Es waren<br />
ja schon die Besatzungszonen festgelegt. Es ging aber alles gut und so konnte ich mit dem<br />
Zug nach Leipzig fahren. Der Bahnhof war überfüllt. Am 8. November 1945 bin ich in Guben<br />
angekommen und lief gleich zu dem Haus in der Kupferhammerstraße, in dem meine Frau<br />
wohnte. Vor dem Haus saß meine Schwägerin in schwarzen Sachen und weinte, meine<br />
Schwiegermutter ist zwei Tage vorher verstorben.<br />
Von ihr erfuhr ich, daß sich meine Frau in Schleswig Holstein aufhält, sie hatte auch eine<br />
Postkarte mit der Adresse, so konnte ich sie gezielt suchen. Zunächst trat den Rückweg nach<br />
Bayreuth an, denn ich mußte mir meine Lebensmittelkarten holen, damit ich mich auf meiner<br />
Reise nach Schleswig Holstein verpflegen konnte.Ich fand eine Mitfahrgelegenheit auf einem<br />
Güterzug, der in den Norden fuhr. Dieser war beladen mit gespritzter Saat. Die<br />
Mitfahrgelegenheit haben auch noch andere genutzt und weil sie hungrig waren, haben sie von<br />
der Saat gegessen. Sie hatten sich schlimm den Magen verdorben. Der Zug fuhr bis Hamburg-<br />
Harburg und mit der Adresse in der Hand konnte ich sehr schnell meine Frau finden. Ihr ging<br />
es gut und sie arbeitete in einer Schneiderei.<br />
Wir blieben beide dort, wir wohnten in einem Zimmer im Haus eines Wehrmachtsoffiziers a. D.,<br />
bis im Dezember 1945 Züge zusammengestellt wurden, die Flüchtlinge aus dem Osten in ihre<br />
Heimat zurückbringen sollten. Auch wir haben uns gemeldet und so sind wir mit einem<br />
Zwischenstop bei Verwandten in Berlin, im Januar 1946 wieder in Guben angekommen. Es<br />
war bei der Ankunft zwar Sperrstunde, aber wir sind trotzdem mit unserem Koffer nach Hause<br />
gelaufen. Unser Haus war voller Flüchtlinge.<br />
In der Nacht stand die Polizei vor der Tür und fragten, ob ich in der Nacht nach Hause<br />
gekommen bin. Ich bejahte dies und sie sagten mir, ich soll mich am nächsten Morgen in der<br />
Mittelstraße bei der GPU melden. Man verhörte mich dort und letztlich stellte sich heraus, daß<br />
ich mit einem anderen Mann, der den gleichen Namen wie ich trug und Bannführer bei der HJ<br />
war, verwechselt wurde. Ab Mitte Januar 1946 habe ich wieder bei der Firma Quade begonnen<br />
zu arbeiten. Wir produzierten u. a. Schöpfkellen, Untersetzer für Bügeleisen und Plinzsteine.<br />
Der Verdienst betrug damals 180,-RM und zum Vergleich – ein Pfund Margarine kostete 300,-<br />
RM, ein Zentner Kartoffeln so ca. 1000,00 RM.<br />
Foto: Lösch<br />
8
Frau Schultz – Der Weg einer Gubenerin im 2. Weltkrieg<br />
Am 30.8.1921 wurde ich in Guben, Kupferhammerstraße 18, geboren. Ich habe noch 3<br />
Geschwister – einen Bruder und 2 Schwestern – ich bin die Zweitgeborene. Wir wohnten in<br />
einem Mietshaus, mein Vater arbeitete als Rottenführer bei der Eisenbahn und meine Mutter<br />
versorgte uns Kinder als Hausfrau. Meine Schulzeit war vom 1.4.1928 bis 1936. Ich ging in die<br />
Klosterschule in der Kirchstraße. Ich war in der Schule sehr gut, konnte aber das Lyzeum nicht<br />
besuchen, weil es sich meine Eltern nicht leisten konnten.<br />
Nach der Schulzeit habe ich als Hilfsarbeiterin in der Tuchfabrik Werner Wolf für 7,50 RM /<br />
Woche gearbeitet. Ich nähte die Nummern in die Tuche ein und erledigte Botengänge und<br />
Handlanger- sowie Reinigungsarbeiten. Später konnte ich für etwas mehr Lohn als Ausnäherin<br />
arbeiten, d. h. ich habe die Fehler in den Tuchen ausgebessert.<br />
Die Ehefrau von Herrn Wolf leitete eine Gymnastikgruppe. Dort habe ich regelmäßig und gern<br />
Sport getrieben. Auch war sie Vorsitzende beim Roten Kreuz und mußte Hilfsschwestern für<br />
den Einsatz in den immer zahlreicher werdenden Lazaretten werben.<br />
Ich meldete mich und ab 1941 arbeitete ich für ca. 6 Monate als Schwester in der<br />
Hindenburgschule, die ebenfalls als Lazarett umfunktioniert war. Anschließend war mein<br />
Einsatzort im Lyzeum (Grüne Wiese), bis im Februar 1945 Guben geräumt werden mußte. Die<br />
Ärzte und wir Schwestern fuhren zum Einsatz in ein Lazarett nach Berlin Tegel. Dieses wurde<br />
von englischen Fliegerbomben zerstört und wir setzten unsere Arbeit in einem Lazarett in<br />
Spandau bis 1945 fort.<br />
Mein Mann schrieb mir, daß die Russen immer näher kommen und ich soll zusehen, daß ich in<br />
den Westen komme. Ich befolgte diesen Rat und ging gemeinsam mit einer Krankenschwester<br />
und 8 verletzten Soldaten - einer davon war im Rollstuhl - Ende April 1945 zu Fuß von<br />
Spandau los Richtung Westen. In Falkensee haben wir den Zug bestiegen und sind Richtung<br />
Kyritz gefahren. Der Zug wurde von russischen Fliegern beschossen, es war ein schrecklicher<br />
Anblick. Säuglinge, die in den Gepäcknetzen schliefen, wurden getroffen. Der Zug fuhr nicht<br />
mehr weiter, weil die Lok einen Treffer bekam. Auf dem Nebengleis stand ein Güterzug in den<br />
wir die Toten und Verletzten reingelegt haben. Unterkunft für die Übernachtung haben wir in<br />
Lazaretten gefunden. Unterwegs haben wir in der Zeitung gelesen, daß immer da, wo wir<br />
zuvor Halt gemacht hatten, die Russen einmarschiert sind. Die sind uns quasi gefolgt.<br />
Mit einer neuen Lok ging es weiter nach Kyritz, wo wir in einen anderen Zug umgestiegen sind,<br />
der uns nach Schleswig Holstein brachte. Dort sind nur wir zwei Schwestern angekommen.<br />
Wir meldeten uns beim Roten Kreuz und wurden in Märkisch Osterholz im Krankenhaus<br />
eingesetzt. Dort lagen viele Patienten mit Malaria, Ruhr usw. Verwundete wurden in<br />
umliegende Lazarette und kleine Krankenhäuser verteilt.Mir wurde vom Roten Kreuz<br />
angeboten, für 2 Jahre nach Kanada zu gehen und dort verwundete deutsche Soldaten zu<br />
pflegen. Da ich aber wissen wollte, was aus meinem Mann geworden ist, habe ich abgelehnt.<br />
Im August 1945 wurde ich vom Roten Kreuz entlassen und ich nahm eine Stelle als Näherin<br />
an. Ich habe vorrangig Oberhemden genäht.<br />
Ende November 1945, plötzlich stand mein Mann im Geschäft, die Wiedersehensfreude war<br />
groß und wie wir wieder nach Guben zurückgekommen sind, hat ja mein Mann bereits<br />
berichtet.<br />
9
4. Eine Groß Breesenerin erzählt:<br />
Zeitzeugenbericht Fam. Wachshaus - anonym -<br />
Am 8. Februar 1927 wurde ich in Groß Breesen geboren.Mein Vater befand sich für 1-2 Jahre<br />
bei der Wehrmacht, wurde dann, noch während des Krieges, zur Bahn geholt und arbeitete<br />
dort als Weichensteller.Meine Mutter war Hausfrau und hat bei ihrer Schwester in Sembten in<br />
der Landwirtschaft mitgeholfen.Mein Bruder und ich sind von unserem Elternhaus im<br />
sozialistischen Sinne erzogen worden - mein Vater war SPD-Anhänger - und wir durften nicht<br />
in die HJ bzw. BDM.<br />
1933 wurde ich in Groß Breesen in die Grundschule eingeschult, besuchte diese bis zur<br />
4. Klasse und beendete die 8. Klasse an der Volkschule Groß Breesen. Es war eine schlimme<br />
Zeit. In einem Klassenraum wurden zwei oder drei Klassen von einem Lehrer unterrichtet. In<br />
diese Schule gingen nur Groß Breesener und Bresinchener Kinder. Unser Lehrer bis zur 4.<br />
Klasse war Lehrer Sparmann. Der war nazistisch eingestellt und ließ es mich manchmal ganz<br />
schön merken, daß er etwas gegen unsere Familie hat. Offensichtlich hat er die "Rechten"<br />
bevorzugt. In der Volksschule unterrichtete uns Lehrer Plenz. Ein netter Lehrer und von<br />
Neutralität gekennzeichnet. Er sang mit meinem Vater im Gesangsverein und hat mich immer<br />
beschützt.<br />
Nach dem Schulabschluß leistete ich mein Pflichtjahr bei meiner Tante in Sembten ab. Ich<br />
konnte dies bei ihr machen, weil sie 5 Kinder hatte, davon waren 3 noch klein und bin täglich 4<br />
km mit dem Fahrrad morgens hin und abends wieder nach Hause gefahren. Dort wohnen<br />
durfte ich nicht, mein Vater hat es mir nicht erlaubt. Ich bekam keine Lehrstelle und mußte in<br />
der Rüstungsproduktion arbeiten. Ich arbeitete bei der Hutfabrik Wilke in der Gasstraße. Dort<br />
wurden in einem Raum, der für die Rüstung freigestellt war, Schutzhauben für die Bevölkerung<br />
gegen Gasangriffe aus Wachstuch genäht. Die Bezahlung waren nur wenige Mark pro Woche<br />
und die Arbeitszeit ging von Montags bis Samstags 6:00 Uhr bis 16:00 Uhr.<br />
Als wir Ende Januar 1945 beobachteten, daß viele große Trecks durch unser Dorf liefen und<br />
diese immer mehr wurden, beschlossen meine Cousine mit Tochter und ich nach Bayern zu<br />
fahren. Ich hatte damals einen Freund, der in der Nähe von Ulm zu Hause war, bei dessen<br />
Eltern sind wir untergekommen. Die Fahrt mit dem Zug dorthin war noch relativ normal.Meine<br />
Eltern und mein Bruder - so erfuhr ich später - sind nach Halbe geflüchtet, haben alles gut<br />
überstanden und sind nach Groß Breesen zurückgekehrt. Im Herbst 1945 hat mich mein Vater<br />
dort abgeholt und wir sind nach Groß Breesen zurückgekommen. Wir mußten "schwarz" über<br />
die bereits bestehende Grenze.<br />
Ich habe dann in der Bürgermeisterei angefangen zu Arbeiten.<br />
Der Ehemann berichtet:<br />
Ich wurde in Wuttschdorf im Kreis Züllichau-Schwiebus am 30.1.1926 geboren. Mein Vater<br />
arbeitete dort als Melkermeister. 1939 begann er mit der Arbeit als Melkermeister auf dem Gut<br />
Groß-Breesen. Wir zogen dorthin und ich besuchte von 1939 bis 1941 dort die Schule.<br />
Ich lernte bei Lehmann in der Cockerillstraße für 3 Jahre den Beruf des Friseurs. Nach der<br />
Prüfung bekam ich den Einberufungsbefehl zum Arbeitsdienst nach Finsterwalde. Dort erhielt<br />
ich die Armeeausbildung mit Spaten. Wir haben Straßen für Panzer gebaut, Rüstungsmaterial,<br />
welches aus den Kampfgebieten eingesammelt und zurückgebracht wurde, sortiert. Der<br />
Arbeitsdienst ging 1 Jahr und als ich ca. 2 Wochen zu Hause war, mußte ich als Soldat nach<br />
Schwerin an der Warthe. Von dort aus ging ich als 17jähriger zum Einsatz nach Frankreich in<br />
der Nähe von Brest. Ich erhielt die Infanterieausbildung und wurde dann Funker in der<br />
Nachrichteneinheit.<br />
10
Bei der Invasion der Engländer in der Normandie wurde ich durch den Einsatz von Phosphor<br />
an den Beinen leicht verwundet und kam in das Lazarett nach Paris. Nach 2 - 3 Wochen<br />
Aufenthalt mußte ich wieder an die Front zur Sicherungseinheit für schwere Flak bei Morleau.<br />
Dort marschierten dann die Amerikaner mit Panzern auf und ich bin mit anderen Kameraden<br />
bei Nacht und Nebel Richtung Deutschland geflüchtet. Auf dem Weg habe ich meine<br />
Kameraden verloren und bin allein weitergelaufen, teils gerobbt. Ich sah eine Einheit, dachte,<br />
es wären Deutsche, und bin zu ihnen hingegangen. Es war aber eine amerikanische<br />
Nachschubkolonne, die mich bei sich aufnahmen. Sie behandelten mich, als ob ich zu ihnen<br />
gehörte, konnten mich aber nach 2 Tagen nicht mehr weiter mitnehmen und übergaben mich<br />
den Franzosen. Dort kam ich ins Gefängnis. Einen Fotoapparat, den ich bei mir hatte, nahmen<br />
sie mir weg, alles war voller Flöhe und ich wurde traktiert und geschlagen.<br />
Weil Frankreich keine kriegführende Macht war, mußten die deutschen Gefangenen, wir waren<br />
ca. 30 Mann, auf Anordnung der Amerikaner in amerikanische Kriegsgefangenschaft<br />
übergeben werden. Die brachten mich in ein Gefangenencamp, ein großes Zeltlager<br />
außerhalb von Cherbourg. Ein Kamerad, Eberhard Dehl aus Mannheim, sprach gut englisch<br />
und setzte sich bei den Amerikanern für mich ein. So konnte ich im Zeltlazarett als Sanitäter<br />
und Friseur arbeiten, fiel somit unter die Genfer Konvention und wurde mit PP - für<br />
geschütztes Personal - gekennzeichnet.<br />
Zeltlazarett Cherbourg Foto: privat<br />
Dieses Zeltlazarett wurde aufgelöst und wir kamen in ein amerikanisches Lazarett direkt in<br />
Cherbourg. Das war ein Komplex mit mehreren Häusern und Werkstätten. Es gab riesige Säle.<br />
In einem dieser Säle lagen ca. 50 Verwundete, alles Amerikaner. Wir wurden dort nicht<br />
bewacht. Die ca. 30 deutschen Gefangenen haben verschiedene Arbeiten gemacht wie<br />
Autoreparatur, Müllabfuhr, Reinigungsarbeiten und alles was anfiel. Ich arbeitete unter<br />
anderem als Verwalter und habe an die Gefangenen Wäsche, Seife usw. verteilt.<br />
Bei der Weihnachtsfeier 1944 wurden wir unterbrochen. Vor Cherbourg wurden Schiffe, mit<br />
Nachschub für die amerikanischen Truppen, von einem deutschen U-Boot versengt, es gab<br />
viele Verwundete und wir sollten helfen, diese zu versorgen. Wir brachten viele Soldaten, naß<br />
bis auf die Knochen und oftmals ziemlich schwer verletzt, in die Säle. Das war Schwerstarbeit,<br />
für Körper und Seele, Fahrstühle gab es nicht. Im Frühjahr wurden wir nach Antwerpen,<br />
Belgien, verlegt. Dort bekam ich eine Blinddarmentzündung und wurde von den Amerikanern<br />
in Lüttich operiert. Nach der Genesung wurde ich in ein Entlassungslager nach Marburg an der<br />
Lahn verlegt.<br />
Nach und nach wurde einer nach dem anderen in die amerikanische, englische oder<br />
französische Besatzungszone entlassen. Da ich ja aus dem "Osten" kam, hätte ich lange auf<br />
meine Entlassung warten können, da in die sowjetische Besatzungszone niemand entlassen<br />
werden durfte. Als ich gefragt wurde, wohin ich denn entlassen werden wolle, sagte ich: nach<br />
Mannheim. Mein Sani-Kameraden hatte mir die Adresse seiner Eltern in Mannheim gegeben<br />
und gesagt, ich könne mich dorthin wenden.<br />
11
Am 11. Dezember 1945 war der Tag meiner Entlassung aus Marburg nach Mannheim. Dort<br />
suchte ich die Eltern meines Kameraden auf, ihn selbst habe ich aber aus den Augen verloren.<br />
Seine Eltern nahmen mich auf und ich wohnte dort für 1 bis 2 Jahre. Ich meldete mich beim<br />
Arbeitsamt und arbeitete in dieser Zeit als Friseur.Ich wollte zu gern wissen, wie es meiner<br />
Mutter ging und machte mich auf den Weg nach Groß Breesen. Ich bin "schwarz" über die<br />
Grenze und es ging alles gut. Ich bin dann noch mal zurück, um meine Sachen abzuholen und<br />
nach Hause zurückgekehrt.<br />
5. Zeitzeugenbericht Fam. Hampel<br />
Frau Hampel<br />
Am 2. November wurde ich in Guben, Kaltenborner Str. geboren. Wir wohnten in einem<br />
Mietshaus mit 9 Parteien. Wir hatten eine Stube und eine Küche.Vom 1.4.1935 bis zum<br />
31.3.1943 ging ich in die Pestalozzischule, damals Volksschule. Unsere Fächer waren neben<br />
Rechnen und Schreiben Gesang, Handarbeit und viel Sport.<br />
Täglich hatten wir ca. 6 Unterrichtsstunden. Gerne habe ich im Chor der Schule mitgesungen.<br />
Im Sommer begannen wir mit der Schule 7:00 Uhr und im Winter begann die Schule 8:00 Uhr.<br />
Ab dem 10. Lebensjahr sind wir Mädchen in den BDM aufgenommen worden. Wir bekamen<br />
jeder eine Uniform, die aus Rock, Bluse, Halstuch, welches mit einem Lederkonten<br />
zusammengehalten wurde, und einer Velourslederjacke bestand. An den Veranstaltungen des<br />
BDM habe ich wenig teilgenommen, weil mich das alles nicht interessiert hat. Ich habe<br />
deswegen auch Ärger bekommen. Einmal hat mich der Jugendführer Sonntag früh aus dem<br />
Bett geholt, da sollte eine Veranstaltung im "Tivoli", eine Gaststätte im heutigen Gubin in der<br />
Nähe der Himmelsleiter, sein. Ich wollte dort nicht hin, aber alle, die nicht von sich aus kamen,<br />
wurden abgeholt.<br />
Jeden Monat einmal trafen sich die Jungen im Rahmen der HJ und die Mädchen innerhalb des<br />
BDM getrennt voneinander. Bei uns wurde dann von extra geschulten BDM-Führern erzählt,<br />
vorgelesen und gesungen.Nach der Schule ging ich nach Hause, meine Großmutter hat für<br />
uns 2 Mädels gekocht, meine Schwester ist zwei Jahre älter.<br />
Dann haben wir Schularbeiten gemacht und sind dann in unseren Garten gegangen, den wir<br />
zur Eigenversorgung bewirtschaftet haben. Da war immer zu tun, Gießen, Unkraut jäten usw.<br />
Oftmals haben wir nachmittags mit unseren Lehrern Kräuter gesammelt, die auf dem Boden<br />
unserer Schule getrocknet wurden. Auch sammelten wir Altpapier.Mein Vater war von 1939 bis<br />
1945 eingezogen, er war in Stalingrad und überlebte nur, weil er im Stab war. Nur dieser<br />
wurde gerettet. 1940 wurde meine Mutter schwer krank und mußte für etwa ein halbes Jahr in<br />
die Heilstätte Berlin Grünau. In dieser Zeit kümmerte sich unsere Tante um uns Mädels. Meine<br />
Mutter dachte, sie wird die Heimat nicht mehr wiedersehen, weil so viele Bomben in Berlin<br />
fielen.<br />
Ab 1.4.1943 mußte ich ein Pflichtjahr absolvieren. Das erste halbe Jahr arbeitete ich bei der<br />
Schwester von Fell-Herrmann in der Frankfurter Straße als Haushaltshilfe und<br />
Kindermädchen. Das 2. Halbe Jahr arbeitete ich bei Fam. Seidel in der Zweigertstraße im<br />
heutigen Gubin. Dort habe ich die 3 kleinen Kinder der Familie betreut und den Haushalt<br />
geführt. Mal Einkaufen, mal putzen, mal Abwaschen - dies waren meine Aufgaben. Der Vater<br />
der Familie war im Krieg, da konnte die Frau eine Hilfe gebrauchen, weil sie auch selbst<br />
gesundheitliche Probleme hatte.<br />
Die Arbeitszeit war von 7:00 bis 19:00 Uhr, das nannte man den "totalen Kriegseinsatz". Der<br />
Monatslohn betrug 10,00 RM pro Monat. Gewohnt habe ich zu Hause. Ab 1.4.1944 begann<br />
meine Lehre als Schneiderin bei Frau Geike in der Pestalozzistraße.<br />
12
Die Lehrzeit betrug 3 1/2 Jahre mit einem Lehrlingsgeld von<br />
2,00 RM im 1. Lehrjahr,<br />
24,00 RM im 2. Lehrjahr und<br />
48,00 RM im 3. Lehrjahr.<br />
Wir nähten für Kundschaft aus allen Schichten, ab und zu auch Änderungsarbeiten.<br />
Die Besuche der Veranstaltungen des BDM waren auch während der Lehrzeit Pflicht.<br />
Meine Lehre mußte ich aber am 14.2.1945 unterbrechen.<br />
Seit Mitte Januar konnten wir schon Flüchtlingsströme zum Beispiel aus dem Warthe-Land<br />
beobachten und haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie es weitergehen wird. Wir<br />
bereiteten uns auf den Tag vor, an dem auch wir flüchten müssen und nähten uns Säcke, in<br />
denen wir einiges von unserem Hab und Gut, wie Bettwäsche, Leibwäsche, Schuhe, Schmuck,<br />
Papiere, unsere Lebensmittelkarten usw. verstauen konnten. Dann kam der Räumungsbefehl<br />
und auch wir flüchteten aus Guben. Wir fuhren am 14.2.1945 gemeinsam mit einer Nachbarin<br />
und deren 2 Kindern mit dem Zug nach Cottbus. Unser Ziel war Bitterfeld, dort hatten unsere<br />
Nachbarn Verwandte.<br />
Auf dem Bahnhof in Cottbus angekommen, ging es zunächst nicht weiter. Der Bahnhof war<br />
bombardiert worden und man hatte Angst um die Züge. Wir mußten alle aussteigen und der<br />
Zug wurde aus dem Bahnhof gefahren. Nach ca. 6 Stunden hat sich die Lage soweit beruhigt,<br />
daß der Zug wieder in den Bahnhof geholt wurde und wir einsteigen konnten. Zwischenzeitlich<br />
kamen immer mehr Züge in Cottbus an mit Flüchtlingen, die auch weiter wollten. Der Zug war<br />
überfüllt, Kinder lagen oben in den Gepäcknetzen. Dann ging es über Falkenberg nach<br />
Leipzig. Der Zug konnte in Leipzig nicht in den Bahnhof hineinfahren, weil dort durch eine<br />
Bombe die Bahnhofsdecke in der Bahnhofshalle und auf den Gleisen lag. Wir mußten daher<br />
vor dem Bahnhof auf freier Strecke aussteigen. Ohne Bahnsteig war es ganz schön schwierig,<br />
die Waggons waren ganz schön hoch. Wir fanden dann mit Hilfe der Eisenbahner einen<br />
Anschlußzug nach Bitterfeld.<br />
Unsere Flüchtlingswohnung hatte 3 Zimmer. Die Kinder bekamen 1 Zimmer, die Erwachsenen<br />
1 Zimmer und das Gepäck brachten wir im Wohnzimmer unter, dort haben wir auch gegessen.<br />
Gehungert haben wir nicht, wir hatten unsere Lebensmittelkarten mitgenommen, später haben<br />
wir entbehrliche Sachen, wie Schmuck und Bettwäsche, beim Bauern gegen Lebensmittel -<br />
hauptsächlich Kartoffeln - eingetauscht.In der Nähe von Bitterfeld war ein Vorratslager der<br />
Wehrmacht, welches durch einen Bombenangriff brannte. Dort haben wir uns die brauchbaren<br />
Büchsen mit Lebensmitteln geholt.<br />
Bis September 1945 mußten wir in Bitterfeld verbleiben. Die Eisenbahnbrücke über die Mulde<br />
war zerschossen, wurde dann repariert und im September fuhr wieder der erste Zug über<br />
diese Brücke. Sachsen Anhalt, somit auch Bitterfeld, gehörte zur amerikanischen<br />
Besatzungszone. Schon bei der Java-Konferenz und später beim Potsdamer Abkommen<br />
wurde beschlossen, Sachsen Anhalt an die russische Besatzung abzugeben.<br />
Wir erlebten die Amerikaner geschniegelt und gebügelt und nach 6 - 8 Wochen, als es dann<br />
russische Besatzungszone wurde, war das ein Bild wie Tag und Nacht. Die Russen kamen mit<br />
ihren Panjewagen und hatten selbst oft nur Lappen um die Füße. Meiner Ansicht nach waren<br />
das meist Mongolen, kleine Männer, die sich korrekt verhalten haben. Auf dem Weg nach<br />
Hause, wurde der Zug auf freier Strecke kurz vor Falkenberg gestoppt. Die Russen haben alle<br />
Waggons kontrolliert und haben alle Männer ab 16 Jahre zum Arbeiten mitgenommen. Wohin<br />
sie gekommen sind und was aus ihnen geworden ist, ist nicht bekannt. Bei unserer Ankunft in<br />
Cottbus, es war schon am Abend, fuhr kein Zug mehr, und wir übernachteten im Keller einer<br />
Ruine in der Nähe des Bahnhofs. Wir mußten auf unser Gepäck achten, denn dort waren<br />
schon die Polen, die unbeachtete Gepäckstücke geklaut haben.<br />
13
Am nächsten Tag ging es im überfüllten Zug nach Guben in unsere alte Wohnung. Sie war heil<br />
geblieben und die Möbel waren auch noch drin. Nur war sie bewohnt mit Flüchtlingen von der<br />
Ostsiedlung, einer Frau mit ihren zwei Kindern. Die haben aber ohne weiteres die Wohnung<br />
frei gemacht und sind in den Keller gezogen. Dort haben sie noch einige Jahre gewohnt.<br />
Herr Hampel<br />
Ich bin im Dezember 1928 in Guben geboren. Wir wohnten in einem Einfamilienhaus in der<br />
Damaschkestraße zur Miete. Später sind wir in die Flemmingstraße gezogen. Meine<br />
Großeltern haben dieses Haus als kinderreiche Familie preisgünstig von der Stadt gekauft und<br />
an meine Eltern vererbt.<br />
Mein Onkel wohnte in der Nähe der Mückenbergkaserne, den haben wir ab und an besucht,<br />
dort war das 29. Infanterieregiment. Zum Tag der Wehrmacht sind wir auch zu den<br />
Festlichkeiten an der Mückenbergkaserne gegangen und haben dort aus der Gulaschkanone<br />
Mittag gegessen. Ich kann mich erinnern, daß wir mit Juden nichts zu tun hatten. Ich weiß nur,<br />
daß es im Königspark. Die Insassen waren ausschließlich Frauen mit Kindern, die im Januar<br />
1945 zu Fuß über die Flemmingstraße nach Jamlitz verbracht wurden. Diesen Treck habe ich<br />
beobachtet.<br />
1942 fielen in Guben drei Bomben. Eine zerstörte ein Haus in der Lindenstraße in<br />
Reichenbach, eine riß einen Krater auf eine Wiese zwischen Bahnhof und Reichenbach und<br />
die dritte schlug in der Nähe des Königsparks ein. Wir haben dem Räumungsbefehl nicht<br />
befolgt und beschlossen in Guben zu bleiben. Als mein Cousin und ich mal unterwegs waren,<br />
hat uns ein SS-Wehrkommando geschnappt und uns gesagt, wir müssen uns in der Gaststätte<br />
in Lübbinchen melden. Dort sagte man uns, wir sollen nach Lübben gehen und uns dort beim<br />
Wehrkreiskommando melden.<br />
In Lübben auf einer Kreuzung begegneten wir einem bekannten Flakhelfer, der uns zurief:<br />
"Der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, macht euch nach Hause". Wir sind durch den Wald bis<br />
nach Hause gelaufen. Nach zwei Tagen haben wir beschlossen doch zu flüchten, damit man<br />
uns nicht erschießt und wir sind zu Zehnt aufgebrochen. Meine Eltern, mein zehn Jahre<br />
jüngerer Bruder, mein Cousin mit seiner Mutter, zwei Tanten, ein Onkel und eine Cousine sind<br />
mit dem Handwagen aufgebrochen. Diesen haben wir beladen mit allem was man<br />
gebrauchen könnte, Hühner - die versorgten uns mit Eiern -, Kaninchen, Verpflegung, Tee,<br />
Kocher, Fahrräder usw. Der Wagen hatte bestimmt ein Gewicht von ca. 15 Zentner. Bei<br />
Pausen im Wald haben wir die Hühner am Wagen festgebunden, damit sie etwas herumlaufen<br />
und scharren konnten.<br />
3 Tage haben wir uns im Wald versteckt und die Front ist während dessen über uns<br />
hinweggerollt. Wir flüchteten nach Lübben und meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich<br />
quartierten uns in ein Einfamilienhaus ein, deren Bewohner auch geflüchtet sind. Die anderen<br />
haben jeweils auch eine Bleibe gefunden und wir blieben untereinander in Kontakt. Als Ende<br />
April der Kessel von Halbe zugemacht wurde, ging nichts mehr und wir beschlossen nach<br />
Guben zurückzukehren. Als zwei Tage später Lübben gebrannt hat, das war dann im März<br />
oder April 1945 machten wir uns alle auf den Weg nach Guben. Wir waren 1 1/2 Tage<br />
unterwegs. Übernachtet haben wir in Goyatz beim Bäcker.<br />
Unser Haus war vom Krieg, der noch nicht ganz vorbei war, verschont geblieben und während<br />
wir weg waren, haben unsere Nachbarn, es waren alte Leute, die sich der Strapazen der<br />
Flucht nicht aussetzen wollten, auf unser Haus aufgepaßt und unser Vieh, wir hatten Schweine<br />
und Ziegen, gefüttert. Nach der Kapitulation ging es an die Aufräumarbeiten. Alle im Alter ab<br />
14 Jahre mußten arbeiten gehen, um Lebensmittelkarten zu erhalten. Die Arbeit wurde uns<br />
vom Amt, deren Sitz in dem jetzigen Gebäude der Volkssolidaritat ist, zugeteilt. Dort mußte<br />
man sich vorher registrieren lassen.<br />
14
6. Erinnerungen von Frau Koschack<br />
Ich wurde am 02.01.1930 als Einzelkind im heutigen Gubin geboren. Wir wohnten an der<br />
Roonstraße. Mein Vater baute 1933/34 ein Haus für unsere Familie, zu der noch meine Oma<br />
gehörte. Dieser Hausbau war für meinen Vater eine sinnvolle Beschäftigung, um seine<br />
Arbeitslosigkeit zu überbrücken. Die Steine hierfür fertigte er selbst an. 1934 konnten wir das<br />
Haus beziehen. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft zu Hause, die meine Mutter führte. So<br />
baute sie Gemüse, wie z. B. Salat, Möhren, Kohl u. a. an und züchtete Geflügel, wie Enten,<br />
Gänse, Hühner sowie auch Schweine und Ziegen. Was wir von den Erträgen selbst nicht<br />
verbrauchten, boten meine Eltern auf dem Markt zum Verkauf an. Mein Vater bekam später<br />
eine Anstellung in der Hutfabrik. 1940/41 ließ Hitler die Kasernen Mückenberg und Moltke<br />
bauen. Dort fand mein Vater dann längerfristig Arbeit als Kesselschmied. Bei uns zu Hause<br />
fanden regelmäßig geheime Treffen statt, worüber ich aber nicht sprechen durfte. Mein Vater<br />
war Mitglied der KPD und traf sich mit gleichgesinnten Genossen. Ich fand einmal auf dem<br />
Boden eine versteckte KPD-Fahne, die mir meine Mutter ängstlich wegnahm und in Sicherheit<br />
brachte.<br />
Ich wurde im Jahr 1936 eingeschult. Alle Schüler mußten dem Jungvolk beitreten. Mit 10<br />
Jahren wurden wir im BDM aufgenommen. Dort fanden einmal in der Woche Heimatabende<br />
und organisierte Sportfeste statt. Die Sportveranstaltungen bereiteten mir Spaß, die<br />
Heimatabende weniger. So kam es, daß ich manchmal schwänzte. Das hatte aber Folgen. Bei<br />
dreimaligem Fehlen kam die Polizei nach Hause. Mir erging es so, und meine Mutter drohte<br />
mir damit, daß ich bei weiteren Fehlstunden von der Polizei mitgenommen werden würde. Nun<br />
ging ich regelmäßig zu den Veranstaltungen. Eine weitere, von der Schule geforderte Aktivität<br />
der Schüler war „Altstoffe sammeln“. Daran gingen wir mit großem Eifer. Wir sangen dabei das<br />
Lied "Lumpen, Knochen, Eisen und Papier, ... ja das sammeln wir". So zogen wir von Haus zu<br />
Haus. Montags lieferten wir die Altstoffe in der Schule ab und bekamen dafür Punkte, die am<br />
Jahresende zusammengezählt und ausgewertet wurden. Die Fleißigsten bekamen dann<br />
Preise als Anerkennung. In der Regel waren es Bücher. Ich selbst besitze zwei Bücher aus<br />
dieser Zeit (Heidi-Heimatroman).<br />
1944 wurde ich aus der Schule entlassen. Jetzt begann ein Pflichtjahr für alle Schüler - die<br />
Jungen wurden zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen und die Mädchen absolvierten ein<br />
Hauswirtschaftsjahr. Mein Vater wollte für mich eine andere Ausbildung. Er sagte: „Für die<br />
Bonzen arbeitest du nicht“. Da ich schon immer Kindergärtnerin werden wollte, begann ich<br />
eine Lehre als Kinderpflegerin in Forst. Um nicht täglich hin und her fahren zu müssen, wohnte<br />
ich in einem Heim.<br />
Mit 16 Jahren wurden alle Mädchen zum Arbeitsdienst eingesetzt. Dieser war für ein Jahr<br />
befristet, aber für alle Pflicht. Die Arbeit dieser Organisation bestand darin, Gehorsam und<br />
Pflichtbewußtsein auszubilden. Es wurde die Versorgung der Menschen übernommen.<br />
Feiertage wurde zum Anlaß genommen, um Militäraufmärsche im Stadion abzuhalten. Der 1.<br />
Mai wurde groß gefeiert. Es fanden Aufmärsche am Hamdorffplatz statt und Reden wurden<br />
gehalten. Hitler versprach den Menschen Arbeit und diese glaubten daran, wußten aber nicht,<br />
daß sie für die Kriegsrüstung arbeiten sollten.<br />
Als der Krieg ausbrach, waren alle Menschen kopflos. Meine Mutter sagte immer wieder:<br />
„Was soll bloß aus uns werden?“ Mein Vater wurde Ende 1944 zum Volkssturm eingezogen.<br />
Der Ausbruch des Krieges wurde damit erklärt, daß man Deutschland zurückerobern wolle.<br />
Die Beschüsse der Stadt wechselten zwischen Russen und Deutschen. Mein Vater hatte, wie<br />
andere auch, auf unserem Acker einen Bunker gebaut, in dem wir uns verstecken konnten.<br />
Plünderungen und Vergewaltigungen von Deutschen und Russen waren an der<br />
Tagesordnung. Meine Tante gab sich freiwillig hin, um mich zu schonen. Anfang 1945 wurde<br />
die Zivilbevölkerung vertrieben. Die Deutschen rückten nach und die Russen wollten<br />
verhindern, daß Geheimnisse an sie preisgegeben werden.<br />
15
Die Russen forderten uns auf, hinter den Frontabschnitt zu gehen und so kamen wir nach<br />
Crossen-Thiemdorf und wurden auf einem Bauernhof aufgenommen. Dort waren polnische<br />
Zwangsarbeiter, die vom Gutsherren schlecht behandelt wurden. So kam es dazu, daß sie sich<br />
dafür an ihm rächten, indem sie einige Tiere töteten und so dem Bauern Schaden zufügten.<br />
Uns ging es dagegen gut. Als wir Ende April 1945 in die Heimat zurückkamen, fanden wir<br />
unser Haus einigermaßen unversehrt wieder. Die Fenster waren zerschlagen und einige Türen<br />
fehlten. Diese fanden wir dann aber in der näheren Umgebung wieder. Der Zusammenhalt mit<br />
den Nachbarn hatte sich vertieft, die Hilfsbereitschaft war gewachsen. Ende Mai wurden wir<br />
von den Polen in den westlichen Teil Gubens getrieben.<br />
Es galt eine Sperrstunde ab 22:00 Uhr, die wir aber nicht befolgten. Wir nutzten die Dunkelheit,<br />
um auf den Feldern Kartoffeln und Gemüse zu stehlen. Am Tage versuchten wir, durch<br />
Gelegenheitsarbeiten etwas Geld zu verdienen. So halfen wir auch, Tote von den Straßen<br />
wegzuräumen und zu beerdigen. Wer gearbeitet hat, bekam Marken, mit denen man ½ Brot<br />
erwerben konnte. Mein Vater war in tschechische Kriegsgefangenschaft geraten. Als er<br />
zurückkam sagte er, daß die Tschechen die Schlimmsten waren. Wir aber waren froh, daß er<br />
lebend nach Hause zurückgekommen ist. Ein Erlebnis werde ich nie vergessen. In der<br />
Nachbarschaft wurde ein Junge geboren, mit einem auffälligen Äußeren - er hatte weiß-blonde<br />
Haare und rote Augen. Eines Tages war dieses Kind verschwunden und keiner hatte eine<br />
Ahnung, wo es abgeblieben ist. Ich bin mir sicher, daß man dieses Kind ins KZ gebracht hat,<br />
wie so viele auch, die nicht dem Idealbild eines Deutschen entsprachen. Es tauchte auch nie<br />
wieder auf.<br />
7. Erinnerungen von Frau Welkisch und Tochter<br />
Am 17. Juni 1913 wurde ich in Guben in der Einbeckenstraße geboren. Hier hatten wir ein<br />
Haus, in dem ich mit meinen Eltern und meinem Bruder wohnte. Mein Vater arbeitete in der<br />
Tuchfabrik Lehmanns Wwe. & Sohn als Zwirnmeister, dort wurde das Garn für die Tuche<br />
produziert. Meine Mutter war Hausfrau, wir besaßen viel Ackerland und wir bewirtschafteten<br />
dieses mit Kartoffel- und Getreideanbau, auch Ziegen und Hühner haben wir gehalten.<br />
1919 wurde ich in der Osterbergschule eingeschult. Nach der Schule mußten wir Kinder viel im<br />
Haus und auf dem Acker helfen. Das habe ich immer gern gemacht. Vom 16. Lebensjahr an<br />
bis zu meiner Heirat arbeitete ich in der Hutfabrik Lißner in der Garnitur. Dort hat es mir sehr<br />
gut gefallen, es war ein sehr gutes Arbeitsklima. Mein Elternhaus wurde im Krieg 1945 leider<br />
zerstört.<br />
1934 / 1935 habe ich geheiratet und zog zu meinem Mann und den Schwiegereltern in die<br />
Triftstraße. Sie hatten dort ein eigenes Haus und ein großes Grundstück, das bis zum<br />
Bismarckturm verlief. Ein kinderloses, älteres Ehepaar aus Berlin, denen Guben nach einem<br />
Baumblütenfest sehr gefallen hat, wohnte noch mit in dem Haus. Im Laden vom Juden Hirsch<br />
sind wir immer einkaufen gegangen. Der war immer sehr nett und hat uns gut bedient. Auch im<br />
Kaufhaus Wolf und Grimmer, deren Geschäftsführer ein Jude war, haben wir gern eingekauft.<br />
1937 wurde meine Tochter geboren und ich gab meine Arbeit, der ich seit meinem 16.<br />
Lebensjahr nachging, auf.Mein Mann arbeitete vor dem Krieg als Schlosser bei der Firma<br />
Heinze in der Uferstraße. Später war er bei Borsig als Eisendreher beschäftigt, bis er noch<br />
kurz vor Kriegsende zum Volkssturm geholt wurde. Er kämpfte in Groß Gastrose und geriet<br />
dort in russische Gefangenschaft. Im Gefangenenlager in Sorau hat ihm ein Russe oft<br />
geholfen. Er nahm ihn mit in den Keller und sie unterhielten sich. So brachte er ihn auch mit<br />
seinem Freund, der ebenfalls in russischer Gefangenschaft war, zusammen. Er sagte ihnen,<br />
wie sie zusammen nach Guben und über die Neiße gehen können.<br />
16
Es ist auch alles gut gegangen. Eine Zeit lang war er noch im Quarantänelager, das in den<br />
Borsig-Baracken eingerichtet war. Wir gingen oft dorthin und schoben ihm etwas zu Essen<br />
durch den Zaun. Mein Sohn wurde im Januar 1945 geboren.<br />
Die Tochter erzählt weiter<br />
An die Schulzeit habe ich keine Erinnerungen. Die "kleinen Leute" haben sich nicht gegen<br />
irgendetwas aufgelehnt. Hitler hat Arbeit geschaffen und alle waren zufrieden - bis zum<br />
Kriegsausbruch. Radio hören war verboten. Da wir einen Volksempfänger besaßen, haben<br />
meine Eltern nachts heimlich Radio gehört, der Sender "Radio London" brachte immer die<br />
neuesten Kriegsberichte von der sich nähernden Front.<br />
Am 6. Februar 1945 kam der Aufruf, daß Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern Guben<br />
verlassen müssen. Auf dem Bahnhof wurde ein Zug zusammengestellt, der nach Finsterwalde<br />
fahren soll. Am 9. Februar 1945 brachte mein Vater uns - meine Mutter, mein Bruder, der<br />
gerade 3 Wochen alt war, und mich - zum Bahnhof.<br />
Wir hatten einen Kinderwagen und ein paar Sachen dabei. Mein Vater blieb in Guben. Der Zug<br />
war vollkommen überfüllt. Wir wurden nach Finsterwalde gebracht und bei der Firma Kellberg<br />
mit vielen anderen Leuten im Gemeinschaftsraum untergebracht. Ich erinnere mich an einen<br />
Mann, der an einem Tisch mit schwachem Licht saß und die Leute registrierte und<br />
beaufsichtige.<br />
Die Firma Kellberg war eine Schwedische Firma und befaßte sich mit Schweißtechnik. Auf<br />
dem Dach des Gebäudes war ein Kreuz und eine schwedische Fahne, was bedeutete, daß<br />
das Haus nicht bombardiert wurde. Die Mutter erinnert sich, daß ihr eine Schwester auf die<br />
Frage, ob sie etwas Milch für ihr Baby bekommen könnte, zur Antwort gab: Die hätten sie sich<br />
schon von zu Hause mitbringen müssen. Später wurden wir in einem großen<br />
Mehrfamilienhaus untergebracht. Unten war eine Eisenwarenhandlung. Wir wohnten in der 4.<br />
Etage unterm Dach. Es waren sehr nette Leute im Haus. Jemand gab uns eine Schwinge aus<br />
Korb, in die meine Mutter meinen kleinen Bruder legen konnte. Es war oft Fliegeralarm und wir<br />
mußten die 4 Treppen runter in den überfüllten Keller. Eine Familie aus dem Haus sorgte<br />
sogar dafür, daß mein Bruder die Nottaufe erhielt und lud uns hinterher zu Kaffee und Kuchen<br />
ein und hat uns so eine kleine Feier ermöglicht.<br />
Meine Großeltern wurden nach Kemmen, in der Nähe von Calau, evakuiert und erfuhren, daß<br />
wir uns in Finsterwalde befinden. Eines Tages kam dann mein Großvater, er hatte uns in<br />
Finsterwalde glücklicher Weise gefunden. Es war gerade wieder ein Bombenangriff und ich<br />
erinnere mich an Tiefflieger, höllischen Lärm und daß die Flügeltüren im Flur hin und her<br />
flogen. Wir hielten uns im Flur auf, in den Keller gingen wir nicht, weil er völlig überfüllt war.<br />
Ich habe schrecklich geheult und mich unter dem Jackett von meinem Großvater verkrochen.<br />
Der Großvater sagte: "hier bleibt ihr nicht" und nach ein paar Tagen konnte er uns mit nach<br />
Kemmen in ihre Unterkunft, einem Bauernhof holen. Der Bauernhof lag etwas abseits vom<br />
Dorf und wir hatten es dort ruhiger. Der Landwirt hielt täglich mit seinem Fernglas Ausschau.<br />
Eines Tages, etwa 3 Wochen vor Kriegsende, sah er am Horizont, daß die Russen im<br />
Anmarsch waren. Die meisten Dorfbewohner flüchteten aus Angst in den Wald. Meine Mutter<br />
wollte nicht flüchten und somit blieben wir dort. Die Russen besetzten das Dorf. Rings um das<br />
Bauerngehöft wurden Flakgeschütze in Stellung gebracht. Wir erlebten, wie die Russen ein<br />
deutsches Flugzeug abschossen. Der Opa von dem Bauerngehöft wurde mit der Situation<br />
nicht fertig und erschoß sich in der Scheune. Man gab uns noch ein Papier, auf dem bestätigt<br />
wurde, daß er Selbstmord beging. Die Russen gaben uns zu verstehen, daß es nicht gut wäre,<br />
wenn wir dort blieben und halfen uns noch, einen Handwagen zu beladen. So zogen wir ins<br />
Dorf. Dort warteten wir bis der Krieg zu Ende war. Nach Kriegsende verabredeten sich alle<br />
Gubener, die dort in der Nähe waren und stellten einen Treck zusammen. Zu Fuß machten wir<br />
uns auf den Weg nach Guben. Bei Cottbus übernachteten wir in irgend welchen Baracken und<br />
am nächsten Tag kamen wir ohne weitere Vorkommnisse in Guben an.<br />
17
Die Brücken waren zerstört, auch die Achenbachbrücke und wir mußten mit dem Kinderwagen<br />
über einen sehr wackeligen Brettersteg. Ich hatte große Angst und klammerte mich am<br />
Kinderwagen fest, denn rechts und links war alles vermint. Über die Grüne Wiese liefen wir zu<br />
unserem zu Hause in die Triftstraße und unterwegs kann ich mich an ein Haus erinnern, daß<br />
aussah wie eine Puppenstube, es fehlte die gesamte Vorderfront. Vor unserem Haus war ein<br />
Panzer gesprengt worden, ein großes Teil davon lag im Zimmer der Großeltern. Ansonsten<br />
war das Haus unversehrt. Auf dem Küchentisch stand Mutters bestes Geschirr. Auf den<br />
Tellern lagen noch ein paar Kuchenkrümel, die ich noch aufgesammelt habe. Große<br />
Plünderungen hatten wir nicht zu beklagen, nur eine Uhr und ein Teppich fehlten. Bei einem<br />
späteren Besuch im Ostteil Gubens bei früheren Nachbarn aus der Triftstraße hat meine<br />
Mutter ihre Uhr und ihren Teppich in deren Wohnung vorgefunden. Die Uhr hatte ein<br />
besonderes Merkmal und diese hat sie dann auch mitgenommen.<br />
Bei unserer Rückkehr war es bereits Anfang Mai und meine Mutter beeilte sich, den Garten<br />
umzugraben, um schnell noch etwas zu säen, denn wir brauchten ja etwas zu essen. Ein<br />
schreckliches Erlebnis war auch, als wir eines Tages sahen, wie nebenan Steine und ein Bein<br />
durch die Luft flogen. Es war jemand auf eine Mine getreten und wir denken heute, daß es<br />
großes Glück war, daß uns damals nichts passierte. Wir wohnten ja, wie schon gesagt, an den<br />
Gubener Bergen in der Nähe des Bismarckturms und diese waren vermint. Deshalb wurden<br />
sie von den Polen "Todesberge" genannt. Die Russen haben an uns Kinder Brot mit Zucker<br />
verteilt. Ich war sehr schüchtern und traute mich nicht meine Hand danach auszustrecken.<br />
Täglich bekamen wir für meinen kleinen Bruder 1/4 Liter Milch zugeteilt und ich stand gerade<br />
mit der Milchkanne am Laden an, als eine Frau angelaufen kam und schrie: Wir müssen raus,<br />
wir müssen raus!<br />
Ich lief weinend, ohne Milch zu meiner Mutter, die auf dem Berg in unserem Garten arbeitete.<br />
Sie dachte erst ich habe die Milch verschüttet, aber als wir auf den Hof kamen stand schon ein<br />
Pole dort mit dem Gewehr auf den Boden gerichtet. Er gab uns 10 Minuten Zeit, Haus und Hof<br />
zu verlassen. Wir packten schnell ein paar Habseligkeiten auf einen Handwagen zusammen<br />
und ich bekam, trotz großer Hitze, dicke Strümpfe, Wintermantel und alles, was ging,<br />
angezogen. Meine Mutter hängte noch einen Topf an den Handwagen um für uns etwas<br />
kochen zu können. Am Berg hatten wir die erste Kontrolle und alles, was den Polen gefiel<br />
nahmen sie uns weg. Aber den Kochtopf ließ sich meine Mutter nicht wegnehmen. Sie sagte,<br />
den brauche ich für die Kinder. Nun war der Wagen wesentlich leichter. Auf einer<br />
Behelfsbrücke überquerten wir die Neiße. Auf der anderen Seite angekommen, irrten wir bis<br />
zum Abend durch Guben. Es war ein sehr heißer Tag, wir wußten nicht wohin, Verwandte<br />
hatten wir hier nicht. Abends schickte man uns in Liehr’s Hotel in der Bahnhofsstraße (neben<br />
der Glaserei Dulitz). Irgendwann wurden wir in der Altsprucke in dem Tanzsaal einer<br />
Gaststätte untergebracht. Der Saal war ringsum mit Stroh ausgelegt. Eine Frau hat dort ihr<br />
Baby bekommen. Es waren schlimme Zustände. Zu Essen gab es Pellkartoffeln mit einer<br />
Soße, welche aus in Wasser aufgelöstem Käsepulver bestand. Beim Anstehen zum Essen sah<br />
ich bei dem Mädchen, das vor mir stand, daß der ganze Kopf voller Läuse war.<br />
Im September bekamen wir dann eine Einweisung in ein Borsig-Haus am Finkenhebbel. Dort<br />
wohnten viele Berliner, die bei Borsig gearbeitet haben. Diese wurden wohl wieder nach Berlin<br />
geschickt. Wir bewohnten zwei Stuben, eine Küche und eine Kammer mit 8 Personen. Meine<br />
Mutter, mein Bruder, ich, die Großeltern beiderseits und später kam mein Vater, der aus der<br />
Kriegsgefangenschaft heimkehrte und eine 3wöchige Quarantänezeit hinter sich gebracht<br />
hatte, noch dazu. Ein mir unbekannter alter Mann wohnte auch noch dort in der Kammer.<br />
18
8. Ich arbeite als Wirtschafterin auf dem<br />
Gubener Flugplatz<br />
Zeitzeugenbericht von Frau Erna Riemer<br />
Ich wurde als letztes von 9 Kindern am 25.06.1914 in Wiesenthal, in der Nähe von Sorau-<br />
Sommerfeld, geboren. Bereits im frühen Kindesalter verstarben 5 meiner Geschwister. Wir<br />
bewohnten in einem Mietshaus eine Wohnung mit 2 Zimmern. Wir 4 Kinder teilten uns ein<br />
Zimmer, unsere Eltern bewohnten das andere Zimmer, in diesem wurde auch gekocht. 1920<br />
oder 1921 wurde ich in Grünaue (Schere) eingeschult. Nach 8 Jahren Schulbesuch, so<br />
1928/1929 kam ich aus der Schule und machte danach 1 Jahr Zwangspause, da ich sehr<br />
zierlich und schlank und somit nicht arbeitsfähig war. Ich unterstützte in diesem Jahr tatkräftig<br />
meine Mutter im Haushalt, sie war auf einem Gut in Wiesenthal als Landarbeiterin tätig. Mein<br />
Vater arbeitete in der Kohlegrube in Teublitz als Bergbauarbeiter.<br />
Auf dem Dorf gab es keine Möglichkeit, eine Lehre zu beginnen, außerdem wurde das Geld<br />
gebraucht und so ging ich in Anstellung bei Dr. Bennewitz. Er hatte eine Ziegelei und ich<br />
arbeitete bei ihm als Hausmädchen und betreute die Kinder der Familie für ca. 3 1/2 Jahre. Die<br />
Ziegelei wurde geschlossen und ich bemühte mich um neue Arbeit. Ich fand eine neue<br />
Anstellung als Hausmädchen für ein halbes Jahr auf einem Gutshof in Lindo-Grode. Im April<br />
1933 ging ich nach Guben zu meiner älteren Schwester. Sie arbeitete bereits bei Lina Naschke<br />
als Gemüsebäuerin. Ich begann eine Anstellung bei Fritz Winkler, der mich als<br />
Gemüsegärtnerin beschäftigte. Mein Monatslohn betrug 20,00 RM. Kost und Logis waren aber<br />
frei. Das Zimmer teilte ich mir mit einer Mitbewohnerin. Dies war eine anstrengende Zeit,<br />
frühzeitig aufstehen und ein langer Arbeitstag waren an der Tagesordnung - so 12 bis 14<br />
Stunden. Nach 4 ½ Jahren habe ich meine Anstellung gekündigt, da ich bereits eine neue<br />
Stelle bei Dr. Kleemann als Hausmädchen sicher hatte. Herr Winkler wollte mich gar nicht<br />
gehen lassen, aber Dr. Kleemann hat besser bezahlt und so fing ich bei dem Arzt für Hautund<br />
Geschlechtskrankheiten an zu arbeiten.<br />
Ich versorgte den Haushalt in seiner Wohnung, Berliner Straße. Auch machte ich in seiner<br />
Praxis sauber, die ebenfalls in der Berliner Straße war, aber dort, wo jetzt die Apotheke ist. Bei<br />
Dr. Kleemann hatte ich ein Zimmer für mich allein. Der Lohn betrug 50,00 RM, Kost und Logis<br />
hatte ich auch frei und zu Weihnachten und zum Geburtstag erhielt ich von ihm Geschenke. 5<br />
Jahre arbeitete ich bei ihm und fing dann 1942/43 - ich war so 28 oder 29 Jahre alt - auf dem<br />
Gubener Flugplatz beim Fliegerhorst als Putzfrau an zu arbeiten. Dort hatte ich auch meine<br />
Unterkunft. Nach wenigen Wochen kam ich in die Gefolgschaftsküche und habe als<br />
Küchenhelferin Kartoffeln geschält und abgewaschen. Zu dieser Zeit habe ich dann bei meiner<br />
Schwester in der Triftstraße (heute Gubin) gewohnt.<br />
Wenig später wurde ich als Wirtschafterin im Fliegerlehrlingsheim eingesetzt. Dort machte ich<br />
sauber und bereitete das Frühstück und das Abendbrot für die Lehrlinge zu. Später wurde ich<br />
in der Truppenküche eingesetzt, habe dort auch wieder abgewaschen und Essen vorbereitet.<br />
Gekocht haben dort 2 angestellte Köche. Wie hoch mein Verdienst war, weiß ich nicht mehr,<br />
aber es war mehr als bei Dr. Kleemann und mehr Freizeit hatte ich auch. 1945 gab es<br />
zunehmend Fliegeralarm. Wir erhielten bereits unsere Papiere, arbeiteten aber weiter, wir<br />
hatten da wenigstens etwas zu Essen. Eines Sonntags, als wieder einmal Fliegeralarm war,<br />
ich arbeitete gerade mit den anderen Kollegen in der Küche, berieten wir uns und<br />
beschlossen, ab Montag nicht mehr arbeiten zu gehen. Als der Räumungsbefehl<br />
bekanntgegeben wurde, wollten wir nicht gehen. Meine Schwester und ich sind durch den<br />
Garten gegangen bis zum Gehöft von Maler Gersdorf und haben uns mit einigen anderen<br />
Leuten bei ihm im Keller versteckt. Als die Russen kamen und uns im Keller entdeckten,<br />
nahmen sie 2 Männer mit, die mit uns im Keller hockten. Während der Kämpfe gingen die<br />
Besitzansprüche unseres Gebietes dauernd hin und her. Als die Deutschen das Gebiet<br />
19
zurückerobert hatten, kamen die beiden Männer zurück und sagten zu uns: "Jetzt aber raus!“<br />
Ich packte ein paar Sachen auf mein Fahrrad und wir - Frau Pilz mit ihren 2 Töchtern, Herr und<br />
Frau Lehmann, Frau Gersdorf, Herr Pilz, meine Schwester und ich - verließen Guben in<br />
Richtung Schenkendöbern. Der Weg war sehr matschig und rechts und links neben der Straße<br />
hat es gebrannt. Es waren viele Menschen unterwegs. In einer Feldscheune haben wir auf<br />
Stroh mit vielen anderen Menschen übernachtet. Am nächsten Morgen ging es weiter in<br />
Richtung Cottbus. Immer wieder mußten wir uns vor Tieffliegern im Wald verstecken.<br />
Manchmal hatten wir Glück und wurden von Soldaten ein Stück mit einem LKW mitgenommen.<br />
Als wir in Cottbus angekommen sind, wurden wir mit einem Güterzug nach Calau gebracht.<br />
Wir wußten vorher nicht, wohin man uns bringen würde. In Calau wurden meine Schwester<br />
und ich von einem älteren Ehepaar in einem Einfamilienhaus aufgenommen. Wir gingen beide<br />
als Gemüsegärtnerinnen arbeiten, um uns versorgen zu können.<br />
Nach Kriegsende kehrten wir beide nach Guben in die Triftstraße zurück. Das Haus selbst hat<br />
in der 1. Etage einen Einschlag von einer "Stalinorgel" abbekommen, unsere Wohnung war<br />
soweit in Ordnung, wir konnten darin wohnen. Nebenan war eine Drogerie, ich kann mich<br />
erinnern, die war abgebrannt. Meine Schwester und ich arbeiteten in der Apotheke in der<br />
Kurmärkischen Straße (jetzt Berliner Straße), um Lebensmittelkarten zu bekommen. Dort<br />
haben wir Flaschen gewaschen und sauber gemacht. Als wir nicht mehr vom Ostteil der Stadt<br />
(heute Gubin) in den Westen der Stadt (heute Guben) gehen durften, sind wir in der<br />
Osterbergschule sauber machen gegangen. Dort sprach uns eines Tages ein Soldat, der sehr<br />
gut deutsch sprach, an; er sagte zu uns, wir sollten weggehen. Schon am darauffolgenden Tag<br />
kam ein polnischer Offizier und vertrieb uns aus unserer Wohnung. Wir konnten nichts<br />
mitnehmen, wir sind nur mit Handtasche losgegangen. Meine Armbanduhr band ich mir noch<br />
um den Mittelfuß und einen Reisekorb voller Wäsche versteckten wir noch im Heustall. Über<br />
die Schlachthofbrücke (Achenbachbrücke), die notdürftig mit Brettern belegt war, kamen wir<br />
über die Neiße in den Westteil von Guben.<br />
Natürlich wurden wir kontrolliert, aber meine Armbanduhr war an meinem Bein sicher. Auch<br />
Frau Pilz und ihre beiden Töchter sind wieder mit uns geflüchtet und wir konnten uns im<br />
Mietshaus von Familie Hildebrand in der Wohnung von Siegels in der Deulowitzer Straße<br />
einquartieren. Siegels waren von der ersten Flucht (noch) nicht zurückgekehrt. Wir hatten 2<br />
Zimmer und Küche für uns 5 Personen zur Verfügung. Geschlafen haben wir auf dem<br />
Fußboden, wir hatten keine Betten oder Matratzen. Wir begannen wieder mit der Arbeit,<br />
erledigten Aufräumarbeiten, meistens haben wir am Bahnhof Unkraut gejätet. Geld haben wir<br />
dafür nicht erhalten, aber die so wichtigen Lebensmittelkarten.<br />
In diesem Mietshaus wohnte ein junger Mann, mit dem ich mich gut verstanden habe. Wir<br />
lernten uns näher kennen und am 11.11.1945 haben wir geheiratet. Ich zog zu ihm in seine<br />
Wohnung, die aus einem Zimmer und einer Kammer bestand. Mein Mann war Invalide und<br />
somit von dem Dienst in der Wehrmacht befreit. Zum Volkssturm wurde er dann doch<br />
einberufen. Er ist auf dem Bahnhof in den Transportzug eingestiegen und meinte im letzten<br />
Moment, er müsse noch mal raus. Der Zug fuhr ohne ihn ab und so blieb ihm dieser Einsatz<br />
erspart. 1947 wurden wir stolze Eltern einer Tochter.<br />
9. Ich kam beim Volkssturm – Gott sei Dank – nicht<br />
zum Einsatz<br />
Erinnerungen eines Zeitzeugen (Lehmann)<br />
Ich wurde am 30.09.1929 im heutigen Gubin am Rande der Stadt geboren. Unsere Wohnung<br />
lag in einem Arbeiterviertel. Vorwiegend waren dort Gemüsebauern angesiedelt. Es wurden<br />
große Flächen mit Gemüse angebaut, deren Erträge verkauft wurden. Jede Nacht hielt ein Zug<br />
von der Strecke Berlin-Breslau in Guben, um fertig verpacktes Gemüse aufzuladen und<br />
20
mitzunehmen. Da mein Vater im Krieg war, mußte ich als 10jähriger die so genannte<br />
„Vaterrolle“ übernehmen. So ging es vielen Jungen. Infolgedessen, lernten wir frühzeitig<br />
Verantwortung für bestimmte Dinge zu tragen. Meine Mutter arbeitete als Weberin bei C.<br />
Lehmanns Wwe. & Sohn. Um die Kinder und den Haushalt kümmerte sich meine Oma.<br />
Mit dem 10. Lebensjahr war es Pflicht, bis zur Lehre der Hitler-Jugend beizutreten. Wir hatten<br />
mittwochs und samstags immer Dienst, wo Beschäftigungen, wie Kriegsspiele, Verkehrsspiele<br />
und Marschieren verrichtet wurden. Meine Jugendzeit verlief relativ problemlos, ich wuchs<br />
behütet auf. In Guben gab es viele Juden. Die meisten waren wohlhabende Geschäftsleute.<br />
Einigen gehörten sogar große Betriebe wie z. B. Wilke (Hutfabrik), Wolf (Tuchfabrik am Damm<br />
in Gubin), Kohn´s (Hutfabrik) u. a. Auch Pfarrer Schulz gehörte zu den Juden. Einzelnen<br />
gelang es, ins Ausland zu fliehen. Viele blieben aber auch hier und wurden enteignet und<br />
entrechtet.<br />
Im Herbst 1939 bis zum Januar 1940 wurden Zwangsarbeiter in Guben angesiedelt. Sie<br />
wurden in allen Wirtschaftsbereichen eingesetzt, um Löcher auszugleichen, die durch das<br />
Einziehen von Männern in den Krieg verursacht worden waren. Alle Zwangsarbeiter aus Polen<br />
mußten ein auf der Spitze stehendes gelbes Viereck mit einem schwarzen „P“, für Polen, als<br />
Kennzeichen tragen. Zwangsarbeiter, die in der Landwirtschaft tätig waren konnten sich frei<br />
bewegen, wogegen Beschäftigte in Rüstungsbetrieben und in den Arbeitslagern schlechtere<br />
Lebensbedingungen hatten. Es wurden Klassenunterschiede deutlich. So war es Gesetz, daß<br />
Arbeiter nicht mit den Herrschaften an einem Tisch sitzen durften. Andere wiederum vertraten<br />
die Ansicht: „Wir arbeiten zusammen, also essen wir auch zusammen.“ Ab Mitte1940 kamen<br />
vermehrt holländische, belgische, französische und mit Beginn des Rußlandfeldzuges 1941<br />
ukrainische Zwangsarbeiter hinzu.<br />
Alle mit dem Zug in Guben angekommenen Arbeiter wurden in verschiedene Bereiche der<br />
Wirtschaft (u. a. in Rüstungsindustrie und Landwirtschaft) verteilt. Dabei war die körperliche<br />
Verfassung eines jeden die Grundlage, für den entsprechenden Einsatz. Im März 1944 kam<br />
ich aus der Schule und begann am 1. April eine Lehre als Tischler. Bereits im Juni wurde ich in<br />
Meseritz zum Schippen von Laufgräben eingesetzt. Im Herbst bin ich wegen Krankheit<br />
vorzeitig entlassen worden. Im Dezember des gleichen Jahres wurde ich in den Volkssturm<br />
eingegliedert, kam aber - Gott sei Dank - nicht zum Einsatz. Die Überlebenschancen in diesen<br />
Einheiten waren sehr gering.<br />
Bis Anfang 1945 blieb Guben, bis auf ein paar kleine Bomben in Reichenbach, weitgehend<br />
unzerstört. Am Sonntag, 18. Februar 1945, begann der Artilleriebeschuss auf Guben, aber es<br />
betraf vorerst nur die Randgebiete. Die Deutschen hatten sich am Mittwoch, 21. Februar<br />
weitgehend zurückgezogen und die Sowjetverbände rückten gleich nach. Darauf erfolgte durch<br />
die Artillerie der Angriff auf die Innenstadt, wobei die ersten Toten in Guben zu beklagen<br />
waren.<br />
Am 24. Februar 1945 sind meine Großeltern, meine Mutter und ich geflüchtet. Alle die noch da<br />
geblieben sind, wurden von den Russen ostwärts getrieben. Wir befanden uns zwischen der<br />
sich bekämpfenden deutschen und russischen Front. Unsere Evakuierung endete in der Nähe<br />
von Calau. Wir wurden in Laasow auf einem Bauernhof aufgenommen und mit weiteren<br />
Flüchtlingen im Keller untergebracht. Die Frauen wurden versteckt, um sie vor den<br />
Vergewaltigungen durch die Sowjets zu schützen. Die sowjetischen Truppen hatten anläßlich<br />
des „Führergeburtstages“ versucht, Berlin zu erreichen und unter ihre Kontrolle zu bringen,<br />
was ihnen aber nicht gelang. Ein Russischer Politoffizier fragte uns, woher wir kommen. Als wir<br />
sagten, wir wären aus Guben, versicherte er uns, daß wir nach etwa fünf Tagen Wartezeit<br />
wieder zurück könnten. Er war sich sicher, daß Guben dann „befreit“ ist und letztlich war es<br />
auch so. Während unseres fünftägigen Aufenthaltes mußte ich mich beim Bau eines<br />
Feldflugplatzes beteiligen.<br />
21
Auf dem Rückweg nach Guben, der drei Tage dauerte, übernachteten wir in einer Schule in<br />
Peitz. Da die Schule völlig überfüllt war, mußten einige auch vor der Schule im Freien die<br />
Nacht verbringen. Als wir am 18. Mai 1945 wieder in Guben eintrafen, war unser Haus von<br />
Artillerie und Infanterie zerschossen worden und so ziemlich alles vermint. Obwohl die Türen<br />
fehlten und die Fenster zerschlagen waren, konnten wir das Haus noch bewohnen. Der<br />
Hinweis „Mine“ stand in russischer Schrift auf vielen Schildern. Dieses war mein erstes<br />
erlerntes russisches Wort. Alle Ortsschilder waren auch mit russischen Namen versehen.<br />
Auf den Straßen wurden junge und arbeitsfähige Bürger einfach von den Russen aufgegriffen<br />
und zum Viehtreiben herangezogen. Ich gehörte ebenfalls dazu. Wer die Möglichkeit fand, sich<br />
zu verstecken, um dieser schweren Arbeit zu entgehen, hatte Glück. Von Dezember 1944 bis<br />
Januar 1945 wurden alle verfügbaren Menschen, egal ob alt oder jung zum Schippen von<br />
Gräben eingesetzt.<br />
Mein Vater ist in Stalingrad geblieben und gilt als vermißt.<br />
10. Ich kannte Herrn Kaplan<br />
Zeitzeugenbericht von Frau Erika Haupt (anonym)<br />
Im Dezember 1922 erblickte ich im Ostteil von Guben (heute Gubin) das Licht der Welt. Mit<br />
meinen Eltern und meinem 2 Jahre älteren Bruder lebte ich in der Hoemannstraße in einem<br />
Doppelhaus. Das Haus war eins von ca. 8 Häusern in einer Siedlung, die für verdiente<br />
Arbeiter der Fabriken Lehmanns Wwe. & Sohn, Wilke u. a. errichtet wurden. Dort verlebte ich<br />
eine unbeschwerte Kindheit. Mein Vater arbeitete bei Lehmanns Wwe. & Sohn als<br />
Wollfachmann, er war dort für den Einkauf der Rohware im In- und Ausland zuständig und ein<br />
sehr angesehener Mitarbeiter. Meine Mutter war Hausfrau. Es gab in der Siedlung viele<br />
gleichaltrige Kinder, mit denen ich viel Zeit verbrachte. 1937 bauten meine Eltern in der<br />
Karrgasse ein neues Haus. Dieses steht noch gut erhalten im heutigen Gubin.<br />
1929 wurde ich in die Osterbergschule in eine reine Mädchenklasse eingeschult, die ich bis<br />
1937 besuchte. Ich war eine gute Schülerin und lag mit einer Klassenkameradin im ständigen<br />
Wetteifer um die besseren Noten. Unsere Lehrer waren älteren Jahrganges und gute<br />
Pädagogen. Wir wurden in der Schule in politischer Hinsicht kaum behelligt. Der politische<br />
Einfluss nahm erst gegen Ende meiner Schulzeit zu. Mädels, die freiwillig zu den Jung-Mädeln<br />
gingen, brauchten am Samstag nicht zur Schule zu gehen, sie leisteten bei der Organisation<br />
Dienst. Ich trat dem DJ erst bei, als es Pflicht wurde. Im BDM wurde ich nie Mitglied, da für<br />
mich keine Verpflichtung bestand. Wir unternahmen viele Fahrten. Dies gefiel meinem Vater<br />
nicht. Er war ein Familienmensch, der es lieber sah, wenn die Familie zusammen ist. Aber er<br />
wehrte sich nicht dagegen, wahrscheinlich kannte er die Konsequenzen. Die Fahrten waren<br />
immer toll, nur die Organisationsführerin war mir nicht sympathisch.<br />
Die Reichskristallnacht habe ich noch sehr deutlich in Erinnerung. Wir sind als Kinder in die<br />
Synagoge gegangen und haben die Zerstörung gesehen. Ich konnte die Zusammenhänge<br />
zwar noch nicht begreifen, aber ich war entsetzt, wie man so etwas schönes so zerstören<br />
kann. Die Judenverfolgung begriff ich damals noch nicht, ich sah zwar die zerschlagenen<br />
Fenster und hörte auch wie gesagt wurde, daß der Herr Kronheim, mit dem mein Vater oft<br />
spazieren ging und bei dem er seine Hüte kaufte, abgeholt wurde, konnte mir aber kein Reim<br />
drauf machen, was damit gemeint war. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Juden<br />
gemacht, ich kannte auch Herrn Kaplan, sie waren alle freundliche Leute. Später war ich<br />
erschüttert, als ich erfuhr was mit ihnen passiert ist.<br />
In unserem neuen Haus war alles schön, aber nun vom Krieg überschattet. Mit dem Krieg fing<br />
das entbehrliche Leben an. Lebensmittel wurden knapp und bestimmte Dinge gab es gar nicht<br />
22
mehr oder nur noch selten. Mit 14 Jahren ließ mich mein Vater nicht aufs Lyzeum gehen,<br />
worüber ich sehr traurig war, schließlich gingen alle meine Freundinnen aufs Lyzeum. Ich kam<br />
stattdessen für ein Jahr auf die Pestalozzi-Fröbel Schule, eine Hauswirtschaftsschule in Berlin.<br />
Anfangs hatte ich ziemliches Heimweh, trotzdem hat es mir dort sehr gut gefallen. Mein Vater<br />
wollte, daß aus mir eine gute Hausfrau wird. Mein Berufswunsch war Kinderkrankenschwester.<br />
Mein Bruder besuchte die Realschule. Da er aber nicht besonders gute Leistungen hatte,<br />
wurde er auf Initiative meines Vaters in die Hauptschule zurückgestuft.<br />
Nach dem Schulabschluß mußte ich zum Pflichtjahreinsatz. Da ich schon immer ein wenig<br />
Fernweh hatte, bemühte sich mein Vater um eine Pflichtjahrstelle in Ludwigshafen am Rhein.<br />
Dort betreute ich die beiden Kinder bei einer jungen Familie. Nach dem Pflichtjahr wurde ich<br />
zum Arbeitsdienst einberufen. Ich ging für ein ½ Jahr nach Bomst bei Posen an der<br />
ehemaligen polnischen Grenze und wurde dort in der Landwirtschaft eingesetzt. Die Uniform<br />
mit dem kratzigen Hut mußten wir bei der Arbeit immer tragen. Alle 8 Wochen durften wir<br />
Arbeitsmaiden nach Hause fahren. Den Hut abnehmen, war das Erste was wir taten. Während<br />
des Arbeitsdienstes wurde ich krank und wurde mit Scharlach ins Krankenhaus in Schwibus<br />
eingeliefert. 1942 kam ich zurück nach Guben und die meisten waren bereits zum Kriegsdienst<br />
verpflichtet worden. Mein Vater hat mir eine Stelle im Fernamt besorgt und so hatte ich Glück,<br />
daß ich nicht verpflichtet wurde und so zu Hause bleiben konnte. Ich arbeitete dort bis 1945,<br />
zum Ende des Krieges. Ich hatte dort nette - überwiegend gleichaltrige Kollegen und die Arbeit<br />
hat uns Spaß gemacht.<br />
Zwischenzeitlich, als der Krieg schon in Deutschland tobte, nahm ich an einem<br />
Austauschprogramm teil und tauschte meinen Arbeitsplatz mit einer Kollegin aus<br />
Recklinghausen. Sie kam nach Guben und wohnte bei meinen Eltern und ich ging nach<br />
Recklinghausen, wo ich das erste Mal mit dem Krieg richtig in Berührung gekommen bin. Bei<br />
Fliegeralarm beschäftigte ich die Kinder im Luftschutzbunker. Trotz der Bombenangriffe in<br />
Recklinghausen machte ich dort meine Arbeit und lernte neue moderne Technik kennen, die<br />
es zu Hause auf meiner Arbeitsstelle nicht gab. Ab 1943 bekamen wir Gasmasken<br />
ausgehändigt und wir wurden mit Übungen auf den direkten Kontakt mit dem Krieg vorbereitet.<br />
Während meiner Tätigkeit im Fernamt in Guben wohnte ich weiter bei meinen Eltern in<br />
unserem Haus. Ende 1944 konnten wir von unserem Haus aus die aus Osten kommenden<br />
Flüchtlingstrecks beobachten. Ich verteilte mit meiner Mutter warmen Tee an die Flüchtlinge.<br />
Der Kontakt mit dem Tod in Verbindung mit den Flüchtlingstrecks war ein einschneidendes<br />
Erlebnis.<br />
Als der Krieg näher kam, schickte ich meine Mutter nach Finsterwalde zu einer Verwandten,<br />
um sie in Sicherheit zu wissen. Um uns nach dem Krieg wiederzufinden, verabredeten wir<br />
einen Treffpunkt in Oschatz, ebenfalls bei Verwandten.Mein Vater war zum Kriegsdienst nach<br />
Frankfurt Oder eingezogen worden. Mein Bruder war ebenfalls noch im Krieg und wir hofften<br />
jeden Tag, daß keine schlechte Meldung kommt. Ich selbst blieb in Guben und ging so lange<br />
wie möglich arbeiten, zuletzt wurde im Keller ein Ausweichamt eingerichtet. Zu dieser Zeit<br />
durften wir nicht mehr nach Hause - unsere Wohnung war im Ostteil der Stadt - weil dieses<br />
Gebiet bereits wegen Kriegshandlungen gesperrt war. Ich wohnte bei einer Kollegin gegenüber<br />
der Arbeitsstelle.<br />
Ich wollte noch einmal zurück in unser Haus und fragte einen jungen Leutnant. Er begleitete<br />
mich zu meinem zu Hause. Als wir dort waren sagte er, ich würde das Haus nie wieder sehen.<br />
Im Keller hatten wir für meine Verlobung ein paar Flaschen roten Sekt gelagert, den nahmen<br />
wir mit. Im Februar 1945 nahm die Bombardierung Gubens zu und meine Kollegen und ich<br />
fuhren mit dem letzten Postauto aus Guben heraus. Über Lübbinchen fuhren wir nach Lübben<br />
und wir wurden in dem dortigen Postamt aufgenommen. Dort verbrachten wir die Nacht auf<br />
harten Holzstühlen. Meine Kollegin, wir nannten sie Strick-Liesel, weil sie ständig strickte,<br />
sagte mitten in der Nacht: hätte ich doch bloß nicht linksrum gestrickt! - und alle mußten<br />
lachen.<br />
23
An nächsten Tag wurden wir entlassen und waren auf uns selbst gestellt. Wir gingen<br />
zusammen auf den Lübbener Bahnhof. Ich wollte nach Oschatz in Sachsen, denn dort war ich<br />
mit meiner Familie verabredet. Meine Kolleginnen fuhren Richtung Berlin. Sie fuhren ab und<br />
ich war das erste Mal in diesem Krieg allein, hatte Angst und brach in Tränen aus. Mir wurde<br />
schlagartig bewußt, in welcher Situation ich mich befand.<br />
Irgendwann kam ich in Oschatz an. Dort wurde ich bereits von meinen Verwandten erwartet.<br />
Von Oschatz ging meine Reise weiter nach Weiden in die Oberpfalz. Ich suchte das junge<br />
Paar auf, bei denen ich mein Pflichtjahr ableistete, sie nahmen mich auch sofort auf. Das<br />
Kriegsende erlebte ich in der Oberpfalz. Ich habe mir im Traum immer ausgemalt, daß bei<br />
Kriegsende die 9. Symphonie von Beethoven erklingt. Zu meiner Enttäuschung spielte der<br />
Sender Beromünster im Radio die 7., die Schicksals Symphonie. Im Juli 1945 begab ich mich<br />
zu Fuß, ab und an per Anhalter, auf den Heimweg nach Guben. An der Zonengrenze der<br />
amerikanischen und russischen Sektoren bei Plauen wurde ich mit anderen Rückkehrern<br />
aufgegriffen und zur GPU gebracht. Die vermuteten, daß wir von der russischen in die<br />
amerikanische Zone flüchten wollen, wir wollten aber von der amerikanischen in die russische<br />
Zone. Die GPU schikanierte uns alle, nahm uns erstmal alles ab und ließ uns dann gehen. Ich<br />
hatte keine Angst und forderte beim Gehen mein Hab und Gut zurück - sie händigten es mir<br />
auch aus.<br />
Ich vermutete meine Mutter noch bei den Verwandten in Finsterwalde, mußte dort aber<br />
erfahren, daß sie bereits in Guben bei Bekannten sei. Sie wohnte bei Familie Pole in der Alten<br />
Poststraße. Ich suchte diese auf und erfuhr, sie sei auf dem Weg zum Geburtstag einer Tante<br />
nach Groß Gastrose. Ich bin sofort auf dem Neißedamm Richtung Groß Gastrose gelaufen<br />
und konnte auf halben Wege dorthin meine Mutter in die Arme schließen. Die<br />
Wiedersehensfreude war groß.<br />
Da meine Eltern ja bereits Ende Mai nach Guben zurückgekehrt waren (mein Vater hatte<br />
meine Mutter in Finsterwalde abgeholt), beseitigten sie die entstandenen Kriegsschäden am<br />
Haus. Ein handwerklich begabter Nachbar, dessen Haus in der Crossener Straße zerstört war,<br />
half ihnen und er konnte mit seiner Familie zum Dank dort wohnen. Die Wehrmacht hatte alle<br />
Türen für den Schützengraben benutzt und das Dach war kaputt. Am 20. Juni, bei der<br />
Räumung des Ostteils der Stadt, sind sie zur besagten Bekannten geflüchtet und haben dort<br />
zunächst gewohnt. 1946 kam mein Bruder aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurück.<br />
Mein Vater arbeitete bei der Gubener Wolle und half beim Wiederaufbau. Zunächst wohnten<br />
wir von 1945 bis 1954 im Bürohaus der Gubener Wolle. Dieses Haus bestand aus Büroräumen<br />
im Parterre und im 1. Stock befanden sich Wohnungen, eine davon bewohnten wir.<br />
1955 bekamen wir eine Wohnung auf der Halbinsel in der Villa (Richter & Lehmann), Nähe<br />
Kugelbrücke. Dort wohnten wir ca. 40 Jahre, bis wir 1995 wegen ungeklärter<br />
Besitzverhältnisse, die Villa räumen mußten. Ich arbeitete wieder bei der Post, besuchte eine<br />
Fachschule in Leipzig und arbeitete danach bis zuletzt als Dienststellenleiterin.<br />
11. Manchmal waren wir "Lausejungs"<br />
In der Anlage übersende ich Ihnen einen Bericht über die letzten Jahre der Gubener<br />
Oberschule für Jungen. Ich nehme an, daß er Ihnen ein wenig Nutzen, bringen kann.<br />
Vermissen werden Sie vermutlich Bemerkungen über einen von Schülern und Lehrern<br />
geleisteten "Widerstand". Einen solchen hat es aber keineswegs gegeben, und sollte es sein,<br />
daß dieser und jener, der von Ihnen Befragten, der die Schule ebenfalls besucht hat, Ihnen<br />
Gegenteiliges berichtet, dann entspricht das in keiner Weise den Tatsachen. Was wollte man<br />
auch von 10-18-jährigen Schülern, die ja gar nichts anderes kennengelernt hatten, als den<br />
Nationalsozialismus, eine gegenteilige Meinung, die schließlich sogar in einen "Widerstand"<br />
mündete, erwarten!<br />
24
In den 30er Jahren ist wohl einmal ein unangenehmer Vorfall geschehen, als man einem<br />
jüdischen Schüler - allerdings nicht von seiten seiner Klassenkameraden oder Lehrern,<br />
sondern "von oben" Schwierigkeiten machte. Wie die Sache ausgegangen ist, weiß ich nicht;<br />
fest steht allerdings, daß sich damals der Studiendirektor Wolf sehr für den Jungen eingesetzt<br />
hat.<br />
Daß etliche unserer Lehrer mit dem Nationalsozialismus und dem "Führer" nicht einverstanden<br />
waren, haben wir nicht bemerkt; erst im Nachhinein, also lange nach dem Kriege, ist mir in der<br />
Erinnerung einiges aufgefallen, das eigentlich (in der damaligen Zeit) recht unnormal war:<br />
Wenn Direktor Wolf unsere Klasse betrat, stürzte er eilends aufs Pult, riß die rechte Hand<br />
hoch, rief "Heil Hitler" und blätterte derweil - und das alles in Sekundenschnelle - im<br />
Lateinbuch die Vokabelseiten auf, die daraufhin abgefragt wurden. Verwundert war ich immer<br />
über Studienrat Erich Müller (der zur DDR-Zeit Direktor der Friedensschule wurde, obwohl er<br />
der Ost-CDU: angehörte). Bei ihm hatten wir Geschichte. Als wir die "Kampfzeit" der<br />
Nationalsozialisten durchnahmen, dem im Geschichtsbuch übermäßig viele Seiten gewidmet<br />
waren, hieß er uns Lineal und Bleistift hervornehmen und gab an, welche Sätze zu<br />
unterstreichen und somit zu lernen waren. Auch, daß sein Unterricht über dieses Kapitel<br />
unserer Geschichte voller Begeisterung war, kann nicht behauptet werden. Andererseits aber<br />
ließ er keinen Zweifel daran, daß er "ein alter Soldat" war - freilich im ersten Weltkrieg, und vor<br />
allem Friedrich der Große hatte es ihm (und auch uns) angetan.<br />
Was aber sehr auffällig war, von uns aber gar nicht so richtig wahrgenommen und eingeordnet<br />
wurde, war sein Gruß. Er stand dann auf dem Pult, winkelte den rechten Arm, erhoben und<br />
nach hinten abgewinkelt, empor und rief - nein, nicht "Heil Hitler", sondern "Heitla!!" Was mich<br />
seinerzeit immer wunderte, denn einen Sprachfehler hatte er nicht. Heute bin ich in der Lage,<br />
diese Art des Grußes zu deuten...Eine tragische Figur war Studienrat Neumann. Ich habe das<br />
in meiner "Alten Schule" anklingen lassen. Er wurde von allen Klassen gehänselt, wobei man<br />
sagen muß, daß er in seiner Art die Schüler auch provozierte. Als Spitznamen mußte er sich<br />
über den Namen "Moses" ärgern. Auch sein Gruß war glattwegs lächerlich. Er stand dann auf<br />
dem Katheder, hielt den Arm gestreckt nach vorn (wie es Vorschrift war) und intonierte ein<br />
feierliches "Heil Hitler!" Was wir, die wir uns köstlich amüsierten, mit einem in<br />
Sekundenschnelle dahingerufenen "Heil Hitler!!!" beantworteten, was er aber nicht akzeptierte,<br />
sondern uns ermahnte: Ihr müßt so grüßen, als ob der Führer hier vor euch stünde!" Dann<br />
wurde die ganze Prozedur noch einmal wiederholt und diesmal taten wir ihm den Gefallenen,<br />
langsam zu sprechen - allerdings nun doppelt so langsam, als er es verlangte. Ja, wir waren<br />
schon, wie er oft schimpfte, "Lausejungs"!<br />
Einmal, als wir es gar zu wild trieben, erklärte er (er war wohl, bevor er nach Guben kam, in<br />
Berlin Lehrer gewesen): "Damals, als in Berlin noch alles rot war, habe ich schon treu zur<br />
Fahne gestanden. Das nahmen wir zur Kenntnis, es erhöhte aber unsere Achtung vor ihm<br />
keineswegs. Viele Jahre später - der Sohn von Studienrat Roland war inzwischen der Leiter<br />
des Freundeskreises der Gubener Oberschulen geworden - und wir beide waren enge<br />
Freunde - erzählte ich ihm die Berliner Begebenheit. Er lachte und erwiderte: "Neumann? Der<br />
und ein alter Nationalsozialist? Der war alles andere als ein solcher!!<br />
Da Roland mit Sicherheit vieles von seinem Vater erfahren hatte, ist ihm zu glauben. Ganz<br />
offensichtlich ist dieses Gehabe von Studienrat Neumann lediglich ein, wenn auch tragischer,<br />
Versuch gewesen, wenigstens ein klein wenig Respekt von seinen Schülern zu erhalten, was<br />
sich aber als vergebens erwies. In den ersten Jahren nach dem Kriege hat er noch eine<br />
Zeitlang an der Oberschule Latein und Griechisch unterrichtet.<br />
Manfred Hausmann<br />
Wolfenbüttel, 8.9.2005<br />
25
12. Schreckliche Plakate – Juden als Monster –<br />
Erinnerungen einer Zeitzeugin - Frau Kuchling -<br />
Ich wurde 1939 als viertes Kind unserer Familie in Guben geboren. Unsere Wohnung - 1<br />
Zimmer mit Alkoven - in der Nähe der Stadt- und Hauptkirche war einfach zu klein geworden.<br />
Deshalb bemühten sich meine Eltern um eine größere Wohnung. In der Nähe des Friedhofs<br />
entstand die Stadtsiedlung. Leider war dort schon alles vergeben, aber in der Sprucke konnten<br />
sich Familien mit mindestens vier "lebend geborenen" Kindern bewerben. Wir erhielten ein<br />
Häuschen mit Garten Am Waldrand 1 und meine Eltern zogen mit uns in die sogenannte "Rote<br />
Sprucke". Hier war rundherum nur Wald.<br />
Wie wir zur Hausnummer 1 gelangten, dazu gibt es eine Geschichte, die wir nicht so wollten,<br />
aber die dennoch so gelaufen ist: Nachdem meine Eltern sich um das Grundstück beworben<br />
hatten, wurden die Hausnummern ausgelost. Mein Vater zog eine Nummer um die zwanzig<br />
herum. Weil er aber Bäckermeister und Konditor war und gern mal ein Café einrichten wollte,<br />
hat er mit den Leuten, die die Nummer 1 gezogen hatten, getauscht. Nur - unsere<br />
ursprüngliche Nummer wurde nie gebaut, es kam der Krieg dazwischen. In dieser Zeit wurden<br />
dann die Rotdornweg-Blocks, eigentlich für Arbeiter der Borsig-Werke, gebaut. Als Bauarbeiter<br />
waren nicht kriegstaugliche Männer verpflichtet worden.<br />
In unser neues Häuschen mit 70 m² Wohnfläche mußten meine Eltern, wie alle Leute ringsum<br />
2 Bauarbeiter aufnehmen. Einer von ihnen war Rentner und kam aus Templin und der andere,<br />
sehr viel jüngerer, war Invalide. Richtig fertig wurden die Häuser aber erst zu DDR-Zeit,<br />
nämlich erst dann wurden z. B. die geplanten Badewannen eingebaut. Aber fertig waren die<br />
Luftschutzbunker in den Blocks. Die Sprucke war damals ein ländlicher Vorort. In der Stadt war<br />
meine Mutter es gewöhnt, mit Stöckelschuhen aus dem Haus zu gehen, was jetzt nicht mehr<br />
möglich war - es waren überall nur Sandwege. Die Busverbindungen waren sehr spärlich und<br />
ein Fahrrad besaßen wir nicht. Sicherlich war auch der Garten für unsere Mutti ein Problem:<br />
Es war eine große Hecke zu pflegen und ohne Ahnung sollte sie plötzlich wissen, was<br />
Unkraut, Möhren oder Petersilie sind. Unser Vater wurde eingezogen, ursprünglich wollte er für<br />
den Garten zuständig sein. Ich war noch sehr klein und konnte mich kaum an ihn erinnern.<br />
Er war in Berlin bei einem, wie ich meine, Reservetrupp stationiert. Ich erinnere mich, daß<br />
unsere Mutti mit uns jeden Sonntag mit der Bahn nach Berlin gefahren ist, um ihn zu<br />
besuchen. Auch kann ich mich an schreckliche Plakate auf den Bahnhöfen und Straßen<br />
erinnern. Dort wurden Juden als Monster dargestellt. Wir hatten Angst. Einmal, wir waren<br />
wieder unterwegs nach Berlin, nahmen uns auf dem Gubener Bahnhof Soldaten in schwarzer<br />
Uniform unsere Mutter weg und gingen mit Ihr die Treppe vom Bahnsteig hinunter. Meine<br />
Mutter hatte dunkles Haar und braune Augen wie ich, meine Brüder waren blond, hatten auch<br />
braune Augen, ich denke, sie haben Juden gesucht - äußerlich hätte es man ja annehmen<br />
können, daß wir welche waren. Ich schrie wie am Spieß, nach einer Weile kam unsere Mutter<br />
wieder und ich bekam eine Ohrfeige von ihr.<br />
Einmal holte unsere Mutti auf der Rückreise eine kleine runde Metalldose, die obenauf ein<br />
Muster, ähnlich einer Sonne hatte, hervor, darin war herrliche Schokolade, die hatte der Vati<br />
ihr bei der Abfahrt noch in die Hand gedrückt. Das war Schokolade mit Koffein, SCHO-KA-<br />
KOLA - Fliegerschokolade und die gibt es übrigens noch heute. Ab und zu kam mein Vater auf<br />
Urlaub nach Hause. Bei diesen gelegentlichen Besuchen hat er uns Plätzchen gebacken. Die<br />
wurden in großen Werbebüchsen aus Blech oben auf dem Küchenschrank aufbewahrt und<br />
wenn wir Kinder Hunger hatten oder wenn Besuch kam, gab es Plätzchen. Sie mußten immer<br />
so eingeteilt werden, daß sie bis zum nächsten Besuch des Vaters reichten. Einmal kam der<br />
Vater in seiner Uniform durch den Hintereingang nach Hause, mein Bruder sah ihn und rief:<br />
"Mutti, hol die Backschüssel vor, Vati kommt!"<br />
26
Auch hat meine Mutter manchmal unseren Hunger nach Süßigkeiten gestillt, indem sie<br />
Bonbons aus Zucker, Mohn und roter Farbe hergestellt hat. Einkaufen waren wir im heutigen<br />
Café "Idyll". Dort war ein Milchladen und die Bäckerei Wolf, dort gab es auch andere<br />
Lebensmittel. Von Zeit zu Zeit kamen Vertreter zu uns nach Hause und verkauften Gasmasken<br />
und spezielle Brillen für unseren Schutz. Flugzeuge warfen Aluminiumstreifen ab, um Bomber<br />
und andere Kriegsflugzeuge zu irritieren. Dies sollte auch zum Schutz der Bevölkerung dienen.<br />
Wir Kinder sammelten diese ein und zu Weihnachten wurden sie zerschnitten und als Lametta<br />
an den Weihnachtsbaum gehängt, es gab ja keinen Baumschmuck.<br />
Andere Vertreter verkauften Rollos und Clips, um die Fenster zu verdunkeln. Es durfte kein<br />
Licht an den Seiten durchschimmern. Straßenlampen brannten schon lange nicht mehr.<br />
Beeindruckend waren für mich die vielen Flugzeuge am Himmel, die sahen für mich aus wie<br />
Metallsplitter und ich zeigte mit dem Finger auf sie. Meine Mutter hat mir das immer verboten,<br />
ich sollte noch nicht einmal den Kopf heben und nach ihnen schauen, solche Angst kursierte<br />
unter den Menschen. Autos gab es keine mehr, sie wurden beschlagnahmt. Unser Auto stand<br />
bei meinen Großeltern in der Scheune in Sommerfeld. Mein Opa hat sich zwar geweigert, das<br />
Auto rauszugeben, aber ihm wurde die Pistole auf die Brust gesetzt und es blieb ihm nichts<br />
anderes übrig, als es herauszugeben.<br />
Da die Einheit, bei der mein Vater stationiert war, als Reservetrupp in Bereitschaft stand und<br />
die Verpflegung den Hunger auch nicht restlos stillen konnte, hat die Truppe beschlossen,<br />
selbst Gemüse anzubauen und Hühner zu halten. Das Feld war "vor der Tür". Es wurde<br />
gefragt, wer Hühner besorgen kann und mein Vater meldete sich, da er nicht wußte, wie es<br />
weitergeht, dann würde er wenigstens seine Familie noch einmal sehen. Als er nach Hause<br />
kam und berichtete, was der Grund war, ist unsere Mutti fast in Ohnmacht gefallen. Wer hatte<br />
denn in dieser Zeit Hühner abzugeben? Schließlich hat sie ein Einziges aufgetrieben, mit dem<br />
er zu seiner Einheit zurückkehrte. Er mußte dafür in den "Bau".<br />
Unsere Nachbarin, Frau Schauersberger, eine große, hübsche Frau mit langen, zum Knoten<br />
gebundenen dunklen Haaren, bekam ein Baby und ich als kleines Mädchen war ziemlich<br />
neugierig und Mutti ist dann auch mit mir gucken gegangen. Frau Schauersberger hatte schon<br />
4 Jungs und dieses Baby war ein Mädchen. Unsere Mutti fragte diese Frau, "Haben sie denn<br />
keine Angst?" "Nein", sagte sie, "mein Mann bekleidet einen hohen Rang beim Militär". Eines<br />
Tages kam ein blonder, schöner, großer Mann, das war der Papa der Familie, für ein paar<br />
Tage nach Hause, um sich seine Tochter anzusehen. Kurze Zeit später erhielt die Frau die<br />
Nachricht, daß sich ihr Mann im nahegelegenen Wald erschossen hat. Im Nachhinein wurde<br />
bekannt, daß jüdische Militärangehörige nach Hause geschickt wurden, um ihre Familie zu<br />
töten. Er konnte dies offensichtlich nicht.<br />
Es war ein kalter Morgen, als ein Auto die Straße hinaufkam und es stiegen Männer mit<br />
schwarzen Stiefeln und schwarzer Uniform, ich denke das waren welche von der Gestapo,<br />
aus. Da es auf einmal ziemlich laut auf der Straße war, sind wir auch neugierig geworden. An<br />
der Hand meiner Mutter sah ich Frau Schauersberger im Morgenrock mit dem Baby auf dem<br />
Arm auf der Straße stehen. Am anderen Arm hatte sie einen Sohn, 2 Söhne versteckten sich<br />
hinter ihr. Der älteste Sohn stand etwas abseits und rief "Mutti, wo soll ich denn hin?, Zu<br />
Oma?, zur Tante?" Frau Schauersberger traute sich nicht zu antworten, da die Gestapo-Leute<br />
die Gewehre auf sie gerichtet hatten. Irgendwann antwortete sie "Lauf Junge, lauf!" Und schon<br />
zuckten diese Männer mit ihren Gewehren. Ich habe meine Mutti damals nicht verstanden,<br />
warum sie nicht zu dem Jungen gesagt hat, "komm doch zu uns". Frau Schauersberger wurde<br />
mit den 3 Jungs und dem Baby mitgenommen, wohin sie gebracht wurden und was aus ihnen<br />
geworden ist, ist unbekannt.<br />
Der älteste Sohn kehrte natürlich in der Nacht in oder an sein Elternhaus zurück. Die Gestapo-<br />
Leute waren am nächsten Tag wieder da und nahmen auch ihn mit. Unsere Mutti sagt mir, das<br />
waren Juden. Als das Haus von Schauersbergers leer war, haben wir Kinder gern dort<br />
herumgestöbert, obwohl Mutti uns das verboten hatte. Wir fanden in der Schublade des<br />
27
Küchenschranks Tabletten und mußten die natürlich kosten. Eine Sorte war bitter, die andere<br />
war süß. So teilten wir uns diese "Bonbons" ein. Heute gehe ich davon aus, die eine Sorte<br />
waren Schmerztabletten, die anderen Traubenzucker, aber genau wissen wir das bis heute<br />
nicht. Irgendwann wurde die Einheit meines Vaters in den Krieg beordert, wohin er gehen<br />
mußte, weiß ich nicht mehr, nur daß eines Tages mit der Post - die im Krieg immer<br />
funktionierte, aber lange gedauert hat - ein Brief eintraf mit der Mitteilung, daß mein Vater<br />
vermißt wird.<br />
Mein Vater lebte - Gott sei Dank -, er befand sich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Bei<br />
der Entlassung aus dieser hat man ihm gesagt, er brauche nicht nach Guben gehen, dort steht<br />
kein Stein mehr auf dem andren. Er erhielt eine Bescheinigung, mit der er nach Amerika hätte<br />
auswandern können. Da sich meine Eltern aber ausgemacht hatten, sich zu Hause<br />
wiederzutreffen, kam er dann 1946 doch nach Hause. Ich denke, im Herbst 1943 wurde bei<br />
uns eine Frau zwangseinquartiert. Fräulein Nebel war eine Gutsbesitzertochter aus Tilsit. Als<br />
sie nach ein paar Tagen anfing zu riechen, sagte meine Mutter zu ihr, sie solle sich doch bitte<br />
waschen, die Füße usw. Als Antwort bekam sie dann: "Es ist doch keiner da, der mich wäscht,<br />
waschen Sie mich?" Meine Mutter sagte ihr klipp und klar, sie würde kein einziges Körperteil<br />
von ihr waschen. Dies war also eine feine Dame, die es gewohnt war an- und ausgekleidet,<br />
gewaschen und bedient zu werden.<br />
Auch kann ich mich erinnern, daß so im Sommer 1944 Soldaten mit ihren Frauen oder<br />
Freundinnen bei uns Urlaub gemacht haben. Wahrscheinlich war auf Grund der<br />
Kriegsgeschehnisse Urlaub in anderen Gebieten nicht mehr möglich. Hier war es ideal, die<br />
Gegend lud dazu ein mit den Waldgebieten und dem Deulowitzer See.<br />
Öfter kamen Leute zu uns, um für die Kinderlandverschickung zu werben. Sie wollten meinen<br />
ältesten Bruder mitnehmen. Sie haben meiner Mutter erklärt, es würde ihm dort gut gehen, da<br />
gäbe es genug zu Essen, die Kinder würden nichts vom Krieg mitbekommen usw. Meine<br />
Mutter stimmte dem aber nicht zu, schließlich hatte sie versprochen, die Familie nicht<br />
auseinanderzureißen.<br />
Einen Freund hatte ich damals auch. Er hieß Peter und trug eine Brille, weil er so schrecklich<br />
schielte. 1945 ist er mit seiner hochschwangeren Mutti nach Hamburg zur Oma gefahren. Er<br />
bekam eine Schwester mit meinem Vornamen. Von Peter habe ich nie wieder etwas gehört.<br />
Im Februar 1945 mußten auch zwangsweise wir flüchten. Wir Kinder bekamen jeder<br />
mindestens 3fach Unterwäsche von unserer Mutti angezogen und sie packte Handtücher,<br />
Bettwäsche usw. ein. Ich bekam die kostbare große Puppe in den Arm gedrückt und die Jungs<br />
ihr Lieblingsspielzeug und los ging es bei Nacht und Nebel mit unseren Rucksäcken und<br />
Koffern zum Bahnhof. Wir bestiegen den Zug, wohin die Reise gehen würde, wußten wir nicht.<br />
Wir waren voller Angst und Sorge. Der Funkenflug der Kohle-Lok im Dunkel der Nacht hat uns<br />
zusätzlich Angst bereitet. Im Morgengrauen mußten wir alle aus dem Zug aussteigen, die<br />
Schienen waren zerstört und die Weiterfahrt nicht möglich.<br />
Wir waren in Lautawerk (heute Lauta) bei Senftenberg angekommen. Wir bekamen eine<br />
Unterkunft zugewiesen, in der wir nicht freundlich aufgenommen wurden, denn Kinder wollte<br />
niemand. Unzählige Bombenangriffe im Wald, im Luftschutzbunker oder im Keller haben wir<br />
miterlebt. Der Luftschutzbunker war ein kahler gemauerter Raum mit starken Pfeilern.<br />
Erreichbar war er durch eine Treppe mit einer auf Schienen laufenden Platte. Diese war zur<br />
Tarnung mit Rasen bedeckt und konnte auf- und zugeschoben werden. Dort lagen wir auf dem<br />
Boden mit einem Taschentuchknebel im Mund, der uns davor schützen sollte, daß uns im<br />
Körper durch den Druck der Bombeneinschläge etwas platzte. Auch waren wir von dem Druck<br />
vorübergehend taub. Es gab mit jedem Einschlag starke Erschütterungen und die Menschen<br />
schrien und weinten vor Angst. Bei Entwarnung verließen wir den Bunker und hofften, daß<br />
unsere Unterkunft nicht getroffen wurde. Unsere Mutter fiel aus Angst und Sorge und wegen<br />
der Unterernährung öfters in Ohnmacht, was uns Kinder jedesmal zusätzlich in Panik<br />
versetzte.Bekannte haben zwei Mal ihr Obdach und somit auch alle Habseligkeiten verloren.<br />
28
Fliegeralarm gab es Tag und Nacht und die Tiefflieger beschossen einzelne Objekte - auch<br />
Menschen. In unserer kleinen Straße waren Kettenbomben niedergegangen. 3, 4 oder mehr<br />
Bomben in akkurater Reihenfolge und genauem Abstand. Wir wollten zu gern auf dem Po in<br />
die Bombentrichter hineinrutschen, unsere Mutti hat uns dies aber verboten. Unsere Unterkunft<br />
bestand aus einem Zimmer mit Kochgelegenheit und einem Ehebett für uns alle. Beim<br />
gegenüberliegenden Haus war die Wand eingestürzt und man konnte von oben bis unten in<br />
die Wohnung hineinsehen. Ein Sofa stand dort "auf der Kippe" und mein 10jähriger Bruder<br />
machte sich einen Spaß daraus, darauf zu schaukeln. Jeden Augenblick konnte die Wand<br />
nachgeben oder das Sofa rutschen. Unsere Mutter hat fast einen Herzschlag erlitten, als sie<br />
das sah.<br />
Ich kann mich an sehr viele kaputte Dachziegel auf allen Straßen erinnern. Ich sammelte<br />
immer die - nach meiner Meinung - Schönsten. Im Kaufhaus saßen in der Babyabteilung<br />
Babypuppen in der Auslage, die mit den zu verkaufenden Sachen bekleidet waren. Gern hätte<br />
ich solch eine Puppe gehabt, aber die waren ja nicht verkäuflich. Einmal, nach so einem<br />
fürchterlichen Bombenangriff, das Kaufhaus war getroffen, lief ich dorthin, um mir so eine<br />
Puppe zu holen. Es war aber alles in Schutt und Asche gelegt. Unsere Mutti meldete uns für<br />
den Guben-Treck an, den wir aber verpaßten. So machten wir uns allein auf den Weg. Am<br />
Ortsausgang ging unser Leiterwagen kaputt und wir mußten zurück, um Hilfe zu holen. Mein<br />
6jähriger Bruder mußte bei dem kaputten Wagen bleiben. Er kam uns mit weinendem<br />
Geschrei entgegen - ein Russe hatte das am Wagen befestigte Trinktöpfchen abgeschnitten.<br />
Der Wagen mit unseren Habseligkeiten war dann weg und es ging zu Fuß mit Rucksack und<br />
einer Karre weiter Richtung Guben. In unserer ehemaligen Wohngegend in Gubin stand kein<br />
Stein mehr auf dem anderen. So war es Glück im Unglück, daß wir auf der anderen Seite der<br />
Neiße gewohnt haben, unser Haus blieb unversehrt.<br />
Seit unserer Flucht hatten wir nie genug zu Essen. Wasser und Strom gab es auch nicht. In<br />
der Nachbarschaft befand sich eine Pumpe. Dort haben wir Kinder uns abwechselnd<br />
angestellt, jeder eine Stunde. Als wir dann dran waren, haben unsere Mutti und meine Tante<br />
die Eimer, die mit einem Holzbrettchen abgedeckt wurden, damit nichts verschüttet wird, nach<br />
Hause getragen. Zu uns kamen nach und nach weitere Familienangehörige aus dem heutigen<br />
Gubin und wir waren schließlich 14 Personen in dem kleinen Häuschen. Wie alle satt kriegen,<br />
war das nächste Problem. Von einem Bauern aus der Nachbarschaft bekam meine Mutti 3<br />
Kornäpfel und 1 Ei geschenkt mit der ernsthaften Ermahnung, ein Mittagessen daraus zu<br />
machen!?!?<br />
In der Näher der Post in der Berliner Straße befand sich eine Molkerei. Dort konnten wir uns<br />
Molke holen. Auch dort haben wir uns abwechselnd angestellt, um Molke zu erhalten. Am<br />
Besten war es, wenn man die letzten Reste erhalten hat, denn da hat sich dann immer am<br />
Boden der Milchkanne etwas Quark abgesetzt. War man aber zu spät dran, war die Molke alle<br />
und wir gingen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Von der Molke wurde Suppe gekocht<br />
mit einer hineingeriebenen Kartoffel. Unser Vater, als Bäckermeister und Konditor, hatte so<br />
einige "Spezialrezepte. Wir haben auch "Schlagsahne" gemacht. Apfelsaft wurde mit Zucker<br />
vermischt und im Keller kalt gestellt. Mein ältester Bruder mußte dies dann mit dem<br />
Schneebesen mindestens eineinhalb Stunden aufschlagen.<br />
Um Kartoffeln anzubauen, hat mein Vater den Samen aus den Blüten der Pflanzen gewonnen,<br />
denn Steckkartoffeln gab es nicht zu kaufen. Durch den sandigen Boden wuchsen daraus<br />
Kartoffeln, die nur so groß wie Murmeln waren. Aber wir haben sie als Pellkartoffeln gegessen,<br />
einige wurden als Saatkartoffeln genommen. Nach der Entlassung meines Vaters, mußte er<br />
zunächst in das Quarantäne-Lager im Schlagsdorfer Weg. Dort haben wir unseren Vati<br />
besucht, die Trennung durch den Zaun habe ich als schrecklich empfunden. Er bekam später<br />
Arbeit bei der Bahn als Gleisbauer. Am 1. September 1945 wurde ich in der Pestalozzischule<br />
eingeschult. Meine Lehrerin war Fräulein Wuttke und in meiner Klasse waren 45 Schüler.<br />
29
Meine Mutti sagte, daß wir uns keine Zuckertüte leisten können, aber als ich am ersten<br />
Schultag nach Hause kam lag doch eine Zuckertüte mit Äpfeln und Birnen aus dem Garten auf<br />
meinem Bett.<br />
13. Erinnerungen einer Zeitzeugin - Frau Kuchling -<br />
Ich wurde 1939 als viertes Kind unserer Familie in Guben geboren. Unsere Wohnung - 1<br />
Zimmer mit Alkoven - in der Nähe der Stadt- und Hauptkirche war einfach zu klein geworden.<br />
Deshalb bemühten sich meine Eltern um eine größere Wohnung. In der Nähe des Friedhofs<br />
entstand die Stadtsiedlung. Leider war dort schon alles vergeben, aber in der Sprucke konnten<br />
sich Familien mit mindestens vier "lebend geborenen" Kindern bewerben. Wir erhielten ein<br />
Häuschen mit Garten Am Waldrand 1 und meine Eltern zogen mit uns in die sogenannte "Rote<br />
Sprucke". Hier war rundherum nur Wald.<br />
Wie wir zur Hausnummer 1 gelangten, dazu gibt es eine Geschichte, die wir nicht so wollten,<br />
aber die dennoch so gelaufen ist: Nachdem meine Eltern sich um das Grundstück beworben<br />
hatten, wurden die Hausnummern ausgelost. Mein Vater zog eine Nummer um die zwanzig<br />
herum. Weil er aber Bäckermeister und Konditor war und gern mal ein Café einrichten wollte,<br />
hat er mit den Leuten, die die Nummer 1 gezogen hatten, getauscht. Nur - unsere<br />
ursprüngliche Nummer wurde nie gebaut, es kam der Krieg dazwischen. In dieser Zeit wurden<br />
dann die Rotdornweg-Blocks, eigentlich für Arbeiter der Borsig-Werke, gebaut. Als Bauarbeiter<br />
waren nicht kriegstaugliche Männer verpflichtet worden.<br />
In unser neues Häuschen mit 70 m² Wohnfläche mußten meine Eltern, wie alle Leute ringsum<br />
2 Bauarbeiter aufnehmen. Einer von ihnen war Rentner und kam aus Templin und der andere,<br />
sehr viel jüngerer, war Invalide. Richtig fertig wurden die Häuser aber erst zu DDR-Zeit,<br />
nämlich erst dann wurden z. B. die geplanten Badewannen eingebaut. Aber fertig waren die<br />
Luftschutzbunker in den Blocks. Die Sprucke war damals ein ländlicher Vorort. In der Stadt war<br />
meine Mutter es gewöhnt, mit Stöckelschuhen aus dem Haus zu gehen, was jetzt nicht mehr<br />
möglich war - es waren überall nur Sandwege. Die Busverbindungen waren sehr spärlich und<br />
ein Fahrrad besaßen wir nicht. Sicherlich war auch der Garten für unsere Mutti ein Problem:<br />
Es war eine große Hecke zu pflegen und ohne Ahnung sollte sie plötzlich wissen, was<br />
Unkraut, Möhren oder Petersilie sind. Unser Vater wurde eingezogen, ursprünglich wollte er für<br />
den Garten zuständig sein. Ich war noch sehr klein und konnte mich kaum an ihn erinnern.<br />
Er war in Berlin bei einem, wie ich meine, Reservetrupp stationiert. Ich erinnere mich, daß<br />
unsere Mutti mit uns jeden Sonntag mit der Bahn nach Berlin gefahren ist, um ihn zu<br />
besuchen. Auch kann ich mich an schreckliche Plakate auf den Bahnhöfen und Straßen<br />
erinnern. Dort wurden Juden als Monster dargestellt. Wir hatten Angst. Einmal, wir waren<br />
wieder unterwegs nach Berlin, nahmen uns auf dem Gubener Bahnhof Soldaten in schwarzer<br />
Uniform unsere Mutter weg und gingen mit Ihr die Treppe vom Bahnsteig hinunter. Meine<br />
Mutter hatte dunkles Haar und braune Augen wie ich, meine Brüder waren blond, hatten auch<br />
braune Augen, ich denke, sie haben Juden gesucht - äußerlich hätte es man ja annehmen<br />
können, daß wir welche waren. Ich schrie wie am Spieß, nach einer Weile kam unsere Mutter<br />
wieder und ich bekam eine Ohrfeige von ihr.<br />
Einmal holte unsere Mutti auf der Rückreise eine kleine runde Metalldose, die obenauf ein<br />
Muster, ähnlich einer Sonne hatte, hervor, darin war herrliche Schokolade, die hatte der Vati<br />
ihr bei der Abfahrt noch in die Hand gedrückt. Das war Schokolade mit Koffein, SCHO-KA-<br />
KOLA - Fliegerschokolade und die gibt es übrigens noch heute. Ab und zu kam mein Vater auf<br />
Urlaub nach Hause. Bei diesen gelegentlichen Besuchen hat er uns Plätzchen gebacken. Die<br />
wurden in großen Werbebüchsen aus Blech oben auf dem Küchenschrank aufbewahrt und<br />
wenn wir Kinder Hunger hatten oder wenn Besuch kam, gab es Plätzchen. Sie mußten immer<br />
so eingeteilt werden, daß sie bis zum nächsten Besuch des Vaters reichten. Einmal kam der<br />
30
Vater in seiner Uniform durch den Hintereingang nach Hause, mein Bruder sah ihn und rief:<br />
"Mutti, hol die Backschüssel vor, Vati kommt!" Auch hat meine Mutter manchmal unseren<br />
Hunger nach Süßigkeiten gestillt, indem sie Bonbons aus Zucker, Mohn und roter Farbe<br />
hergestellt hat. Einkaufen waren wir im heutigen Café "Idyll". Dort war ein Milchladen und die<br />
Bäckerei Wolf, dort gab es auch andere Lebensmittel. Von Zeit zu Zeit kamen Vertreter zu uns<br />
nach Hause und verkauften Gasmasken und spezielle Brillen für unseren Schutz. Flugzeuge<br />
warfen Aluminiumstreifen ab, um Bomber und andere Kriegsflugzeuge zu irritieren. Dies sollte<br />
auch zum Schutz der Bevölkerung dienen. Wir Kinder sammelten diese ein und zu<br />
Weihnachten wurden sie zerschnitten und als Lametta an den Weihnachtsbaum gehängt, es<br />
gab ja keinen Baumschmuck.<br />
Andere Vertreter verkauften Rollos und Clips, um die Fenster zu verdunkeln. Es durfte kein<br />
Licht an den Seiten durchschimmern. Straßenlampen brannten schon lange nicht mehr.<br />
Beeindruckend waren für mich die vielen Flugzeuge am Himmel, die sahen für mich aus wie<br />
Metallsplitter und ich zeigte mit dem Finger auf sie. Meine Mutter hat mir das immer verboten,<br />
ich sollte noch nicht einmal den Kopf heben und nach ihnen schauen, solche Angst kursierte<br />
unter den Menschen. Autos gab es keine mehr, sie wurden beschlagnahmt. Unser Auto stand<br />
bei meinen Großeltern in der Scheune in Sommerfeld. Mein Opa hat sich zwar geweigert, das<br />
Auto rauszugeben, aber ihm wurde die Pistole auf die Brust gesetzt und es blieb ihm nichts<br />
anderes übrig, als es herauszugeben.<br />
Da die Einheit, bei der mein Vater stationiert war, als Reservetrupp in Bereitschaft stand und<br />
die Verpflegung den Hunger auch nicht restlos stillen konnte, hat die Truppe beschlossen,<br />
selbst Gemüse anzubauen und Hühner zu halten. Das Feld war "vor der Tür". Es wurde<br />
gefragt, wer Hühner besorgen kann und mein Vater meldete sich, da er nicht wußte, wie es<br />
weitergeht, dann würde er wenigstens seine Familie noch einmal sehen. Als er nach Hause<br />
kam und berichtete, was der Grund war, ist unsere Mutti fast in Ohnmacht gefallen. Wer hatte<br />
denn in dieser Zeit Hühner abzugeben? Schließlich hat sie ein Einziges aufgetrieben, mit dem<br />
er zu seiner Einheit zurückkehrte. Er mußte dafür in den "Bau".<br />
Unsere Nachbarin, Frau Schauersberger, eine große, hübsche Frau mit langen, zum Knoten<br />
gebundenen dunklen Haaren, bekam ein Baby und ich als kleines Mädchen war ziemlich<br />
neugierig und Mutti ist dann auch mit mir gucken gegangen. Frau Schauersberger hatte schon<br />
4 Jungs und dieses Baby war ein Mädchen. Unsere Mutti fragte diese Frau, "Haben sie denn<br />
keine Angst?" "Nein", sagte sie, "mein Mann bekleidet einen hohen Rang beim Militär". Eines<br />
Tages kam ein blonder, schöner, großer Mann, das war der Papa der Familie, für ein paar<br />
Tage nach Hause, um sich seine Tochter anzusehen. Kurze Zeit später erhielt die Frau die<br />
Nachricht, daß sich ihr Mann im nahegelegenen Wald erschossen hat. Im Nachhinein wurde<br />
bekannt, daß jüdische Militärangehörige nach Hause geschickt wurden, um ihre Familie zu<br />
töten. Er konnte dies offensichtlich nicht.<br />
Es war ein kalter Morgen, als ein Auto die Straße hinaufkam und es stiegen Männer mit<br />
schwarzen Stiefeln und schwarzer Uniform, ich denke das waren welche von der Gestapo,<br />
aus. Da es auf einmal ziemlich laut auf der Straße war, sind wir auch neugierig geworden. An<br />
der Hand meiner Mutter sah ich Frau Schauersberger im Morgenrock mit dem Baby auf dem<br />
Arm auf der Straße stehen. Am anderen Arm hatte sie einen Sohn, 2 Söhne versteckten sich<br />
hinter ihr. Der älteste Sohn stand etwas abseits und rief "Mutti, wo soll ich denn hin?, Zu<br />
Oma?, zur Tante?" Frau Schauersberger traute sich nicht zu antworten, da die Gestapo-Leute<br />
die Gewehre auf sie gerichtet hatten. Irgendwann antwortete sie "Lauf Junge, lauf!" Und schon<br />
zuckten diese Männer mit ihren Gewehren. Ich habe meine Mutti damals nicht verstanden,<br />
warum sie nicht zu dem Jungen gesagt hat, "komm doch zu uns". Frau Schauersberger wurde<br />
mit den 3 Jungs und dem Baby mitgenommen, wohin sie gebracht wurden und was aus ihnen<br />
geworden ist, ist unbekannt. Der älteste Sohn kehrte natürlich in der Nacht in oder an sein<br />
Elternhaus zurück. Die Gestapo-Leute waren am nächsten Tag wieder da und nahmen auch<br />
ihn mit. Unsere Mutti sagt mir, das waren Juden.<br />
31
Als das Haus von Schauersbergers leer war, haben wir Kinder gern dort herumgestöbert,<br />
obwohl Mutti uns das verboten hatte. Wir fanden in der Schublade des Küchenschranks<br />
Tabletten und mußten die natürlich kosten. Eine Sorte war bitter, die andere war süß. So<br />
teilten wir uns diese "Bonbons" ein. Heute gehe ich davon aus, die eine Sorte waren<br />
Schmerztabletten, die anderen Traubenzucker, aber genau wissen wir das bis heute nicht.<br />
Irgendwann wurde die Einheit meines Vaters in den Krieg beordert, wohin er gehen mußte,<br />
weiß ich nicht mehr, nur daß eines Tages mit der Post - die im Krieg immer funktionierte, aber<br />
lange gedauert hat - ein Brief eintraf mit der Mitteilung, daß mein Vater vermißt wird.<br />
Mein Vater lebte - Gott sei Dank -, er befand sich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Bei<br />
der Entlassung aus dieser hat man ihm gesagt, er brauche nicht nach Guben gehen, dort steht<br />
kein Stein mehr auf dem andren. Er erhielt eine Bescheinigung, mit der er nach Amerika hätte<br />
auswandern können.Da sich meine Eltern aber ausgemacht hatten, sich zu Hause<br />
wiederzutreffen, kam er dann 1946 doch nach Hause.Ich denke, im Herbst 1943 wurde bei uns<br />
eine Frau zwangseinquartiert. Fräulein Nebel war eine Gutsbesitzertochter aus Tilsit. Als sie<br />
nach ein paar Tagen anfing zu riechen, sagte meine Mutter zu ihr, sie solle sich doch bitte<br />
waschen, die Füße usw. Als Antwort bekam sie dann: "Es ist doch keiner da, der mich wäscht,<br />
waschen Sie mich?" Meine Mutter sagte ihr klipp und klar, sie würde kein einziges Körperteil<br />
von ihr waschen. Dies war also eine feine Dame, die es gewohnt war an- und ausgekleidet,<br />
gewaschen und bedient zu werden.<br />
Auch kann ich mich erinnern, daß so im Sommer 1944 Soldaten mit ihren Frauen oder<br />
Freundinnen bei uns Urlaub gemacht haben. Wahrscheinlich war auf Grund der<br />
Kriegsgeschehnisse Urlaub in anderen Gebieten nicht mehr möglich. Hier war es ideal, die<br />
Gegend lud dazu ein mit den Waldgebieten und dem Deulowitzer See. Öfter kamen Leute zu<br />
uns, um für die Kinderlandverschickung zu werben. Sie wollten meinen ältesten Bruder<br />
mitnehmen. Sie haben meiner Mutter erklärt, es würde ihm dort gut gehen, da gäbe es genug<br />
zu Essen, die Kinder würden nichts vom Krieg mitbekommen usw. Meine Mutter stimmte dem<br />
aber nicht zu, schließlich hatte sie versprochen, die Familie nicht auseinanderzureißen.<br />
Einen Freund hatte ich damals auch. Er hieß Peter und trug eine Brille, weil er so schrecklich<br />
schielte. 1945 ist er mit seiner hochschwangeren Mutti nach Hamburg zur Oma gefahren. Er<br />
bekam eine Schwester mit meinem Vornamen. Von Peter habe ich nie wieder etwas gehört.<br />
Im Februar 1945 mußten auch zwangsweise wir flüchten. Wir Kinder bekamen jeder<br />
mindestens 3fach Unterwäsche von unserer Mutti angezogen und sie packte Handtücher,<br />
Bettwäsche usw. ein. Ich bekam die kostbare große Puppe in den Arm gedrückt und die Jungs<br />
ihr Lieblingsspielzeug und los ging es bei Nacht und Nebel mit unseren Rucksäcken und<br />
Koffern zum Bahnhof. Wir bestiegen den Zug, wohin die Reise gehen würde, wußten wir nicht.<br />
Wir waren voller Angst und Sorge. Der Funkenflug der Kohle-Lok im Dunkel der Nacht hat uns<br />
zusätzlich Angst bereitet. Im Morgengrauen mußten wir alle aus dem Zug aussteigen, die<br />
Schienen waren zerstört und die Weiterfahrt nicht möglich.<br />
Wir waren in Lautawerk (heute Lauta) bei Senftenberg angekommen. Wir bekamen eine<br />
Unterkunft zugewiesen, in der wir nicht freundlich aufgenommen wurden, denn Kinder wollte<br />
niemand. Unzählige Bombenangriffe im Wald, im Luftschutzbunker oder im Keller haben wir<br />
miterlebt. Der Luftschutzbunker war ein kahler gemauerter Raum mit starken Pfeilern.<br />
Erreichbar war er durch eine Treppe mit einer auf Schienen laufenden Platte. Diese war zur<br />
Tarnung mit Rasen bedeckt und konnte auf- und zugeschoben werden. Dort lagen wir auf dem<br />
Boden mit einem Taschentuchknebel im Mund, der uns davor schützen sollte, daß uns im<br />
Körper durch den Druck der Bombeneinschläge etwas platzte. Auch waren wir von dem Druck<br />
vorübergehend taub. Es gab mit jedem Einschlag starke Erschütterungen und die Menschen<br />
schrien und weinten vor Angst. Bei Entwarnung verließen wir den Bunker und hofften, daß<br />
unsere Unterkunft nicht getroffen wurde. Unsere Mutter fiel aus Angst und Sorge und wegen<br />
der Unterernährung öfters in Ohnmacht, was uns Kinder jedesmal zusätzlich in Panik<br />
versetzte. Bekannte haben zwei Mal ihr Obdach und somit auch alle Habseligkeiten verloren.<br />
32
Fliegeralarm gab es Tag und Nacht und die Tiefflieger beschossen einzelne Objekte - auch<br />
Menschen. In unserer kleinen Straße waren Kettenbomben niedergegangen. 3, 4 oder mehr<br />
Bomben in akkurater Reihenfolge und genauem Abstand. Wir wollten zu gern auf dem Po in<br />
die Bombentrichter hineinrutschen, unsere Mutti hat uns dies aber verboten. Unsere Unterkunft<br />
bestand aus einem Zimmer mit Kochgelegenheit und einem Ehebett für uns alle. Beim<br />
gegenüberliegenden Haus war die Wand eingestürzt und man konnte von oben bis unten in<br />
die Wohnung hineinsehen. Ein Sofa stand dort "auf der Kippe" und mein 10jähriger Bruder<br />
machte sich einen Spaß daraus, darauf zu schaukeln. Jeden Augenblick konnte die Wand<br />
nachgeben oder das Sofa rutschen. Unsere Mutter hat fast einen Herzschlag erlitten, als sie<br />
das sah.<br />
Ich kann mich an sehr viele kaputte Dachziegel auf allen Straßen erinnern. Ich sammelte<br />
immer die - nach meiner Meinung - Schönsten. Im Kaufhaus saßen in der Babyabteilung<br />
Babypuppen in der Auslage, die mit den zu verkaufenden Sachen bekleidet waren. Gern hätte<br />
ich solch eine Puppe gehabt, aber die waren ja nicht verkäuflich. Einmal, nach so einem<br />
fürchterlichen Bombenangriff, das Kaufhaus war getroffen, lief ich dorthin, um mir so eine<br />
Puppe zu holen. Es war aber alles in Schutt und Asche gelegt.<br />
Unsere Mutti meldete uns für den Guben-Treck an, den wir aber verpaßten. So machten wir<br />
uns allein auf den Weg. Am Ortsausgang ging unser Leiterwagen kaputt und wir mußten<br />
zurück, um Hilfe zu holen. Mein 6jähriger Bruder mußte bei dem kaputten Wagen bleiben. Er<br />
kam uns mit weinendem Geschrei entgegen - ein Russe hatte das am Wagen befestigte<br />
Trinktöpfchen abgeschnitten. Der Wagen mit unseren Habseligkeiten war dann weg und es<br />
ging zu Fuß mit Rucksack und einer Karre weiter Richtung Guben.<br />
In unserer ehemaligen Wohngegend in Gubin stand kein Stein mehr auf dem anderen. So war<br />
es Glück im Unglück, daß wir auf der anderen Seite der Neiße gewohnt haben, unser Haus<br />
blieb unversehrt. Seit unserer Flucht hatten wir nie genug zu Essen. Wasser und Strom gab es<br />
auch nicht. In der Nachbarschaft befand sich eine Pumpe. Dort haben wir Kinder uns<br />
abwechselnd angestellt, jeder eine Stunde. Als wir dann dran waren, haben unsere Mutti und<br />
meine Tante die Eimer, die mit einem Holzbrettchen abgedeckt wurden, damit nichts<br />
verschüttet wird, nach Hause getragen. Zu uns kamen nach und nach weitere<br />
Familienangehörige aus dem heutigen Gubin und wir waren schließlich 14 Personen in dem<br />
kleinen Häuschen. Wie alle satt kriegen, war das nächste Problem. Von einem Bauern aus der<br />
Nachbarschaft bekam meine Mutti 3 Kornäpfel und 1 Ei geschenkt mit der ernsthaften<br />
Ermahnung, ein Mittagessen daraus zu machen!?!?<br />
In der Näher der Post in der Berliner Straße befand sich eine Molkerei. Dort konnten wir uns<br />
Molke holen. Auch dort haben wir uns abwechselnd angestellt, um Molke zu erhalten. Am<br />
Besten war es, wenn man die letzten Reste erhalten hat, denn da hat sich dann immer am<br />
Boden der Milchkanne etwas Quark abgesetzt. War man aber zu spät dran, war die Molke alle<br />
und wir gingen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Von der Molke wurde Suppe gekocht<br />
mit einer hineingeriebenen Kartoffel. Unser Vater, als Bäckermeister und Konditor, hatte so<br />
einige "Spezialrezepte. Wir haben auch "Schlagsahne" gemacht. Apfelsaft wurde mit Zucker<br />
vermischt und im Keller kalt gestellt. Mein ältester Bruder mußte dies dann mit dem<br />
Schneebesen mindestens eineinhalb Stunden aufschlagen.<br />
Um Kartoffeln anzubauen, hat mein Vater den Samen aus den Blüten der Pflanzen gewonnen,<br />
denn Steckkartoffeln gab es nicht zu kaufen. Durch den sandigen Boden wuchsen daraus<br />
Kartoffeln, die nur so groß wie Murmeln waren. Aber wir haben sie als Pellkartoffeln gegessen,<br />
einige wurden als Saatkartoffeln genommen. Nach der Entlassung meines Vaters, mußte er<br />
zunächst in das Quarantäne-Lager im Schlagsdorfer Weg. Dort haben wir unseren Vati<br />
besucht, die Trennung durch den Zaun habe ich als schrecklich empfunden. Er bekam später<br />
Arbeit bei der Bahn als Gleisbauer. Am 1. September 1945 wurde ich in der Pestalozzischule<br />
eingeschult. Meine Lehrerin war Fräulein Wuttke und in meiner Klasse waren 45 Schüler.<br />
33
Meine Mutti sagte, daß wir uns keine Zuckertüte leisten können, aber als ich am ersten<br />
Schultag nach Hause kam lag doch eine Zuckertüte mit Äpfeln und Birnen aus dem Garten auf<br />
meinem Bett.<br />
14. Zeitzeugenbericht Herr Kabisch<br />
Ich wurde am <strong>15.</strong>8.1931 in Guben, Grüne Wiese, geboren. Wir bewohnten bei Seifen-Knappe,<br />
einem Seifengroßhändler, eine kleine Stube. Mein Vater war Friseur in der Grünen Wiese,<br />
später in der Salzmarktstraße, meine Mutter arbeitete als Kostümschneiderin im Theater. Ich<br />
habe noch eine 3 Jahre ältere Schwester. Meine Eltern trennten sich und mein Vater heiratete<br />
1939 ein zweites Mal und wurde 1940 zur Wehrmacht einberufen. Aufgewachsen bin ich bei<br />
meiner Stiefmutter in der Germersdorfer Straße. Mein Stiefgroßvater arbeitete seit 1900 in der<br />
Hutfabrik Lißner (Standort des heutigen ALDI).<br />
Sie besaßen Ackerland. Es waren 3 Grundstücke, eines war verpachtet und zwei wurden<br />
selbst bewirtschaftet. Das Haus war so groß, daß stets ein Zimmer vermietet war. Zunächst<br />
bewohnte es der Stabsfeldwebel Rach aus Hoyerswerda, der nach ca. 1/2 Jahr versetzt<br />
wurde. Danach lebte dort für ca. ein Jahr ein Herr Kurth, er war Spieß auf dem Flugplatz<br />
Guben und bis Ende 1944 wohnte dort die Familie Reh aus Berlin. Sie flüchteten vor den<br />
Bombenangriffen auf Berlin. Durch den Herrn Kurth hatten wir Vorteile genossen. In einem<br />
strengen Winter sind unsere Pfirsichbäume erfroren und mußten ausgegraben werden. Da<br />
stellte uns Spieß Kurth einige Soldaten zur Verfügung, die diese Arbeit erledigten. Die haben<br />
es gern gemacht, - es hat 3 Tage gedauert, obwohl ein halber Tag gereicht hätte - weil sie bei<br />
uns eine gute Versorgung bekamen.<br />
Brot gab es nicht genug, aber mein Stiefgroßvater war Teilselbstversorger und schlachtete, ich<br />
weiß von 1940, ein Schwein und später Hammel. Dadurch hatten wir Fleisch und Wurst zur<br />
Verfügung. Auch Obst und Gemüse waren wegen der großen Ländereien ausreichend<br />
vorhanden. In die heute noch vorhandene Osterbergschule wurde ich 1938 eingeschult und<br />
besuchte ab 1942 dann die Oberschule für Jungen (Gymnasium Neustadt). Für den<br />
Schulwechsel, an der Oberschule für Jungen mußte Schulgeld gezahlt werden, dafür war die<br />
Zustimmung der Eltern notwendig, die Zustimmung meiner Mutter war keine Schwierigkeit,<br />
aber die Zustimmung meines Vaters, da er sich ja zu der Zeit im Krieg befand. Nachdem der<br />
Unterricht schon seit 14 Tagen lief, traf die Entscheidung von meinem Vater ein und ich konnte<br />
mit der Schule dort beginnen.<br />
Ein lustiges Erlebnis möchte ich hier schildern:<br />
Englisch wurde ja ebenso seit 14 Tagen unterrichtet, was ich ja verpaßt hatte. Unsere Lehrerin<br />
wollte mich nun testen und fragte mich etwas in englischer Sprache. Ich antwortete mit "ja",<br />
obwohl ich nichts verstanden hatte. Mein Banknachbar grinste und schob mir seine<br />
Federtasche in die Hosentasche. Ich begriff nichts. Die Lehrerin hatte mich gefragt, ob ich eine<br />
Federtasche in der Hosentasche habe und als sie merkte, daß meine Antwort stimmte, war sie<br />
sehr verblüfft - ich auch. Von Erziehung im nationalsozialistischen Sinne war meines<br />
Erachtens nichts zu merken. Wir haben unsere Lehrer verehrt. Unser Oberstudiendirektor<br />
Wolff hat in erster Linie auf gute Leistungen geachtet. Kein Lehrer hat in Uniform unterrichtet<br />
und der Hitler-Gruß wurde unverständlich dahergenuschelt.<br />
Zweimal im Jahr gab es Fahnenappell, da mußten wir in unserer Pimpf-Uniform erscheinen<br />
und es wurde die Deutschlandhymne gesungen. Bezüglich des Hausmeisters mußten wir<br />
Vorsicht walten lassen, der war ein strammer Parteigenosse, der auch täglich in Uniform zur<br />
Arbeit erschien.<br />
Unser Direktor hat auch auf die Ärmeren geachtet, da machte er keine Unterschiede zu besser<br />
betuchten. Er legte in der schulischen Erziehung Wert auf das Lernen, Hilfsbereitschaft und<br />
34
Sauberkeit. 1943 wurde das Lyzeum zum Reservelazarett umfunktioniert und die Mädchen<br />
wurden bei uns in der Oberschule für Jungen unterrichtet. Es wurde der Schichtunterricht<br />
eingeführt, immer im Wechsel für eine Woche die Jungen vormittags und die Mädchen<br />
nachmittags, dann umgekehrt. Nach 3 Wochen wurde diese Festlegung geändert, da in der<br />
Woche, wo die Mädchen nachmittags Schulunterricht hatten, einige Mädchen beim nach<br />
Hause gehen aus der Schule angepöbelt wurden. So wurde entschieden, daß die Mädchen<br />
generell vormittags unterrichtet werden und die Jungen am Nachmittag. Das war für mich<br />
ziemlich unangenehm, weil es meinen Tagesrhythmus völlig durcheinander gebracht hat. Nun<br />
hat man früh etwas länger geschlafen, Schularbeiten waren zu machen, nachmittags die<br />
Schule, da war keine Zeit mehr zum rumstromern in den Bergen - ich konnte meine Freiheiten<br />
nicht mehr ausleben. Dieser Zustand hielt bis zur Schließung der Schule Ende Januar 1945 so<br />
an.<br />
Trotzdem bin ich weiter gern zur Schule gegangen und habe ebenso gern gelernt. Sport war in<br />
dieser Zeit groß geschrieben, zur Schule gehörte ein großer Sportplatz und die städtische<br />
Turnhalle war auch in der Nähe (Hamdorffplatz). Mein Ding war das mit dem Sport nicht so<br />
richtig, ich habe immer zugesehen, daß ich Zeiten oder Weiten usw. aufschreiben konnte. Im<br />
Musikunterricht mußten wir auch mal ein nationalsozialistisches Lied singen, aber die Lehrer<br />
haben das auch mal ausfallen lassen. Ganz gegen den Strom zu schwimmen, ging natürlich<br />
nicht. Wir haben für die Schule Altstoffe - Lumpen, Knochen, Papier, Metall - gesammelt, diese<br />
wurden eingetragen und es wurden Punkte vergeben.<br />
Das Altstoffsammeln war überall gegenwärtig. Man mußte eine entsprechende Anzahl an<br />
Punkten nachweisen. Die SA hat gesammelt und wollte von jedem einen Anteil, für das<br />
Jungvolk, in dem ich seit 1942 Mitglied war, mußte ich sammeln und für mich privat wollte ich<br />
auch ein paar Pfennige verdienen. Das waren einschließlich der Schule dann 4 Mal sammeln.<br />
Obwohl ich gern Altstoffe sammelte, war das kaum zu schaffen und um die erforderlichen<br />
Punkte zu erhalten, habe ich frisches Obst und Gemüse in das Lazarett Lyzeum, Grüne<br />
Wiese, gebracht und bekam dort eine Bescheinigung, mit der ich meine Pflicht nachweisen<br />
konnte. Auch mußten wir mit der Sammelbüchse Geld sammeln, das war nicht mein Ding. Die<br />
meisten Leute hatten ja selbst nicht viel, ich opferte so manches Mal mein eigenes Geld.<br />
Wichtig war, zu den Zeiten, zu denen die Sammlungen angekündigt waren, immer kleine<br />
Münzen zur Verfügung zu haben. Es sammelten ja viele und auf einem Weg von 500 Metern<br />
konnte man viel Geld loswerden.<br />
Für die Altstoffsammlungen gab es ab und an Geschenke. Leider bin ich zu deren Verteilung<br />
nie anwesend gewesen. Gern hätte ich ein Quartettspiel über "Kohlenklau" gehabt. Die<br />
Erinnerungen an meine Kindheit sind recht angenehm. Ich habe viel in den Bergen gespielt,<br />
konnte mich auf Grund der Untermieter auch auf dem Flugplatz bewegen.<br />
In der Gaststätte Wilhelmshöhe waren Rekruten untergebracht, dort haben wir Kinder, ich war<br />
so 11 Jahre alt, uns öfters Essen geholt. Es gab meistens Eintopf aus der Feldküche.<br />
Höhepunkt war im März der Tag der Wehrmacht, der war natürlich für uns Kinder sehr<br />
interessant. Es gab Vorführungen der Technik, Informationen über die Ausbildung und vor<br />
allem Essen. Ich bin zuerst in die Mückenbergerkaserne I gegangen und habe dort<br />
Erbseneintopf mit Speck gegessen, danach ging es in die Mückenbergerkaserne II zum<br />
Kartoffelsuppe essen. Dies alles gab es ohne Marken von der Lebensmittelkarte für ca. 20<br />
Pfennig.<br />
Um Essen habe ich mich immer gekümmert, so habe ich ab 1942 in einem Kolonialwarenladen<br />
56 Zeitungen numeriert, dafür erhielt ich dann auch mal Bonbons.In meine Klasse ging<br />
auch ein Bäckerssohn, der täglich 2 Brötchen, die mit Zucker belegt waren, als Frühstück<br />
mitbekam. Oftmals habe ich mit ihm 1 Brötchen gegen Obst getauscht. In der Haagstraße gab<br />
es einen Bäcker Kieschke, dort habe ich mir manchmal für 5 Pfennig 1 Paket mit 500 Gramm<br />
Kuchenränder gekauft.<br />
35
Ich habe gern die Maße beim Maßnehmen aufgeschrieben, die Kunden benachrichtigt,<br />
Sachen ausgeliefert und das Geld kassiert sowie Nähmaterialien eingekauft. So kannte ich<br />
mich gut in Guben ausAuch kannte ich mich gut in den Bergen aus, was mir in meinem Dienst<br />
beim Jungvolk zugute kam.<br />
Ab dem 11. Lebensjahr (1941) mußte ich dem Jungvolk beitreten. Ich gehörte dem Fähnlein<br />
Nr. 8 an. Ich habe mich dort nie so richtig wohl gefühlt, einmal, weil ich in der Wohnung meiner<br />
Eltern gemeldet war, wir aber, nachdem mein Vater eingezogen wurde, zu den Eltern meiner<br />
Stiefmutter gezogen sind und dadurch in dem Umfeld die Kinder gar nicht kannte und<br />
weiterhin, weil ich kein Sporttyp war. Der Drill war nichts für mich und die Normen im Sport<br />
habe ich auch nicht geschafft. Ich habe mich lieber als Schreiber oder Nachrichtenüberbringer<br />
gemeldet.<br />
1 Mal pro Woche hatten wir für 2 Stunden Dienst und alle 4 Wochen am Wochenende Einsatz<br />
im Gelände mit Schießübungen und Geländespielen. Aufgabe war es, eine Fahne zu erobern.<br />
Daran als "Kämpfer" teilzunehmen war mir gar nichts und so habe ich mich rausgewunden,<br />
indem ich mich anbot, eine Stelle für die Fahne auszusuchen und sie zu bewachen. Ich kannte<br />
mich ja richtig gut in dem Gelände aus und letztlich wurde die Fahne nicht gefunden, ich stand<br />
gut da. Während der Ferien konnte man sich einmal aus wichtigem Grund vom Dienst befreien<br />
lassen. Ich hatte in Steinsdorf Verwandte, da habe ich angegeben, sie dort zu besuchen und<br />
bei ihnen Arbeiten zu verrichten. Da das ja nur ein Vorwand war, konnte ich mich natürlich<br />
nicht in der Stadt sehen lassen und verbrachte die Zeit in den Gubener Bergen.<br />
Wir führten einmal in Neuzelle ein Geländespiel durch. Dort übernachteten wir und an ein "U-<br />
Boot-Spiel" kann ich mich erinnern. Da kroch man aus einem Ärmel heraus, dieser wurde in<br />
die Höhe gehalten und jemand schüttete kaltes Wasser hinein. Das war ja nun wieder was für<br />
mich. Da ich mich sträubte, bekam ich zur Strafe Küchendienst. Ich habe mich darüber gefreut,<br />
daß ich Kartoffeln schälen mußte, da brauchte ich mich nicht bei dem Geländespiel raufen.<br />
Monatlich ein Mal war Pflichtappell im Centralkino mit über 1000 Sitzplätzen in der<br />
Salzmarktstraße. Für einen Eintrittspreis von 0,20 RM wurden uns dort militärische<br />
Propagandafilme gezeigt. Fehlen war nur mit Vorlage einer Krankenbescheinigung erlaubt.Aus<br />
meiner Erinnerung möchte ich sagen, war es so 1943, da hat man den Gubenern den Krieg<br />
schmackhaft gemacht, indem sie auf der Neißebrücke den Kampf gegen Flugzeuge<br />
demonstrierten.<br />
Der NSKK machte in Verbindung mit KdF mehrmals im Jahr Werbefahrten mit Autos. Da<br />
wurden die Kinder durch die Stadt kutschiert. Die Gubener haben im Krieg recht ruhig gelebt.<br />
Die Auswirkungen des Krieges in den Familien bestanden hauptsächlich darin, daß die Frauen<br />
Kopfschützer, Mützen, Socken und Strümpfe stricken mußten. Diese wurden dann beim WHW<br />
(Winterhilfswerk) abgeliefert. Alles wurde genau notiert, auch wurden Aufkleber an die<br />
Haustüren angebracht, und man hatte dann seine Ruhe, wenn man seine Schuldigkeit getan<br />
hatte.<br />
Es wurde höllisch aufgepaßt, ob man richtig verdunkelt, gleichzeitig wurde gelauscht, welcher<br />
Radiosender gehört wird. Wir hatten einen Hund, der sofort gebellt hat, wenn jemand in die<br />
Nähe unseres Hauses kam, da hatten wir durch ihn eine Vorwarnung. Die SA und die Partei in<br />
Uniform (NSDAP) hat auch regelmäßig kontrolliert, ob man sparsam mit Strom und Kohle<br />
umgeht. Sie sind in die Wohnung gekommen und wenn die Lampe mehrere Glühbirnen hatte,<br />
wurde angewiesen, nur eine davon zu benutzen oder sie auszutauschen, wenn sie zu viel Watt<br />
verbraucht. Dazu möchte ich ein Gedicht, veröffentlicht im Gubener Heimatkalender 2005,<br />
vortragen:<br />
Verderbt den Kohlenklau den Spaß<br />
und spart mit Kohle, Strom und Gas,<br />
mach Deine Stromentnahme klein,<br />
schränk Deine Deckenleuchte ein.<br />
36
Beim Rundfunkhören sei ganz Hörer,<br />
Wenn nicht, dann sei kein Stromverzehrer.<br />
Mit Koks und Kohle haltet haus,<br />
Das Ofenloch gibt nichts heraus.<br />
Schließt Feuer- und Bodenfenster dicht,<br />
vergeßt auch Haus- und Hoftür nicht.<br />
Macht Wasser warm in kleiner Kanne,<br />
nur halbvoll sei die Badewanne.<br />
Der spart an Gas, der sehr geschickt,<br />
zwei Töpfe aufeinanderrückt.<br />
Als Kohlensparer sehr geschätzt,<br />
sind Öfen, die instand gesetzt.<br />
Der Kontakt zu Gefangenen war uns untersagt, wir haben uns nicht daran gehalten. Auf einem<br />
der drei Grundstücke meines Stiefopas arbeitete ein polnischer Kriegsgefangener (ab 1940<br />
waren dann alle Polen Zivilarbeiter). Er wurde von uns gut behandelt und versorgt. An Juden<br />
kann ich mich nicht erinnern, aber zu dieser Zeit waren kaum noch Juden in Guben - und wenn<br />
ich welche gesehen haben sollte, dann hätte ich mich es sowieso nicht getraut, mit denen in<br />
Kontakt zu treten. Es waren ja überall Aufpasser.Mein Stiefgroßvater arbeitete ja, wie bereits<br />
erwähnt, in der Hutfabrik Lißner. In den Jahren 1942 bis 1944 kann ich mich an wunderschöne<br />
Weihnachtsfeiern, die er für die Kinder seiner Arbeiter veranstaltete, erinnern. Es gab ein<br />
buntes Programm, Plätzchen und Kakao, Äpfel und sogar eine Apfelsine. In Richtung<br />
Kriegsende erfolgte oft Fliegeralarm. Wenn er während der Schulzeit erfolgte, sind wir in den<br />
Luftschutzbunker am Hamdorffplatz gegangen.<br />
37
Quelle: Lausitzer Markt 19./ 20. Oktober 1994<br />
Fotos: privat<br />
Passierte es nachts zu Hause, mußten wir in einen Luftschutzkeller, der ca. 150 m vom Haus<br />
entfernt war, gehen. Es war kalt, dunkel und aus dem Schlaf gerissen, ist mir dies in<br />
unangenehmer Erinnerung gebliebenIm Januar 1945 kamen die ersten Trecks mit Flüchtlingen<br />
aus Ostpreußen und dem schlesischen Raum über das Wartheland durch Guben. Diese<br />
wurden vom Roten Kreuz, dem Luftschutz, der NSDAP, der SA und Privatpersonen versorgt<br />
und verpflegt. Auf der Schützenhausinsel befand sich auch solch eine Versorgungsstelle, dort<br />
habe ich gern mitgeholfen, die Suppe auszuschenken. In der Gubener Zeitung las ich dann<br />
eines Tages in dem Kolonialwarenladen, in dem ich die Zeitungen numerierte und austrug,<br />
daß die Russen bei Crossen sind.<br />
Dann kam die Evakuierung. Mit einem der letzten Züge, die Lok fuhr mein Onkel, Herbert<br />
Klinke, sind meine Stiefmutter und ich nach Potsdam Babelsberg gefahren. Zwei Tage waren<br />
wir unterwegs und wurden dort zunächst für 3 Tage im Keller einer Schule mit insgesamt<br />
ca. 40 Personen untergebracht. Danach erhielten wir Privatunterkünfte und wir bewohnten in<br />
der Blücher Straße 2 bei Familie Schulze, in dem Haus befand sich eine Fleischerei, ein<br />
möbliertes Zimmer mit einem Bett. Verpflegt haben wir uns mit unseren Lebensmittelkarten.<br />
Ich habe dort schlimme Bombenangriffe erlebt. Der Keller, in dem wir Schutz fanden, wackelte<br />
entsetzlich.<br />
Zur Schule mußte ich dort natürlich auch gehen. Die Kinder waren aus verschiedenen<br />
Regierungsbezirken zusammengewürfelt und die Klassen waren derart überfüllt, daß ich meist<br />
gestanden habe oder auf der Heizung gesessen habe. Einen Sitzplatz bekam man eventuell,<br />
wenn ein Schüler fehlte. Nach einer Woche, so von Ende Februar an, bin ich einfach nicht<br />
mehr in die Schule gegangen. Ende April wurde der Schulbetrieb dann allerorts eingestellt. Die<br />
Schule besuchte ich dann erst wieder ab September 1945 in Guben. ch hatte ja nun Zeit zum<br />
"Rumstöbern" und fand in unmittelbarer Nähe unserer Unterkunft in Potsdam Babelsberg ein<br />
Lebensmittellager. Da holte ich mir Knäckebrot. Ein anderes Mal wurde von der SS ein<br />
eigenes Verpflegungslager gesprengt, um es nicht in Feindhände gelangen zu lassen. Da<br />
kamen auf einmal auf der Nuthe Kisten angeschwommen, die ich natürlich rausfischte. Darin<br />
38
waren Schnapsflaschen, die ich gegen Zucker eintauschte. In der Sempatalis-Kaserne<br />
in Potsdam bin ich auch plündern gegangen. Dort waren Kartoffeln und Knäckebrot zu<br />
holen.Meine Stiefgroßeltern sind zu diesem Zeitpunkt in Guben geblieben, wurden<br />
dann aber zwangsevakuiert und landeten in Golßen.<br />
Im März 1945, einmal Mitte und einmal Ende des Monats, sind meine Stiefmutter und ich nach<br />
Guben gefahren. Zunächst mit der S-Bahn nach Berlin, dann mit dem Zug nach Cottbus - es<br />
gab noch eine regelmäßige Bahnverbindung zwischen Berlin und Cottbus - und mit dem LKW<br />
bis nach Peitz. Dort haben wir in den Reichshallen (heute Gymnasium) übernachtet und mit<br />
dem Panjewagen bis zum Reichenbacher Berg und zu Fuß weiter bis nach Hause. Unterwegs<br />
haben wir die Salzmarktstraße, den Marktplatz und die Königstraße zerstört und brennend<br />
vorgefunden. Nach Hause, in die Germersdorfer Straße, durften wir nicht, weil in der Nähe<br />
schon die Russen waren. Aus der Wohnung meiner Großmutter väterlicher Seite in der<br />
Pförtener Straße durften wir noch Kleinigkeiten holen. Ein Wachmann begleitete uns zu<br />
unserem Schutz. Der sagte zu meiner Stiefmutter noch: packt so viel ein, wie ihr könnt. Beim<br />
2. Mal sind wir mit dem Zug bis nach Grunow gefahren und dann zu Fuß weiter.<br />
Eine Woche nach Kriegsende, im Mai 1945 kamen wir zurück nach Guben. Unser kleiner<br />
Handwagen ging unterwegs kaputt, da hat eine andere Familie unsere Sachen auf ihren<br />
Wagen aufgeladen und so kamen wir am 20.5.1945 wieder in Guben an. Auch die<br />
Stiefgroßeltern waren aus Golßen bereits zurückgekehrt, ich freute mich riesig.<br />
Von meinem Vater haben wir lange nichts gehört. Er war beim Baubataillon und ist im<br />
Kriegseinsatz krank geworden. Eine Muskelverspannung wurde falsch behandelt. Er wurde in<br />
der Nähe von Baden-Baden operiert, dabei wurde sein Muskel zerschnitten.<br />
Ein Pfarrer hat ihn besucht und uns benachrichtigt. Meine Stiefmutter hat ihn dann dort<br />
besucht. Im September 1945 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft wieder nach Guben<br />
zurück.<br />
<strong>15.</strong> Zeitzeugenbericht Herr Krieger<br />
Im Jahr 1930 wurde ich geboren, wir wohnten in einem 2-Familienhaus, Hinter den Höfen 56,<br />
im heutigen Gubin zusammen mit meinen Großeltern. 1941 war ich 11 Jahre alt und ich kann<br />
mich an eine schöne Jugend erinnern. Wir haben in den Gubener Bergen, in der Nähe des<br />
Bismarckturms gespielt.<br />
1936 wurde ich in die Osterbergschule eingeschult. Die Erziehung war durch Staat und Schule<br />
im nationalsozialistischen Sinne geprägt. Organisationen, wie Jungvolk, Hitlerjugend usw.<br />
waren darauf ausgerichtet, künftige Soldaten heranzuziehen. In der Freizeit wurde Krieg<br />
gespielt, welche von den Organisationen gelenkt wurden. Es ging "Straße gegen Straße" oder<br />
"Stadt gegen Land". Ein Erlebnis bei solchen Kriegsspielen brachte mich dazu, darüber<br />
nachzudenken. Wir spielten mal wieder Krieg, Jungstamm 2 gegen Jungstamm 3, da flogen<br />
auf einmal die Fahrtenmesser. Alles sträubte sich in mir und ich beschloß für mich - bis dahin<br />
und nicht weiter.<br />
Ab 1941 besuchte ich die "Oberschule für Jungen" und war Mitglied des Schulchores.<br />
Durch die Mitwirkung im Schulchor bedingt, wechselte ich dann zur so genannten Spielschar,<br />
eine Organisation innerhalb der Hitlerjugend. Dort trafen sich Jugendliche, die sich künstlerisch<br />
betätigen wollten. Man konnte im Chor singen, im Orchester musizieren oder in der<br />
Volkstanzgruppe mitwirken. Ich lernte in dieser Zeit Geige spielen. Wir hatten diverse Auftritte<br />
vor Soldaten in der Mückenberger Kaserne. Auch fuhren wir im Frühjahr 1944 nach Borkum<br />
und traten vor Flaksoldaten auf, die dort stationiert waren. Auf der Fahrt dorthin mit dem Zug<br />
habe ich das erste Mal direkten Kontakt mit den Kriegsereignissen erfahren. In Berlin mußten<br />
wir das erste Mal aussteigen und mußten uns wegen der Bombenangriffe von Engländern und<br />
39
Amerikanern in einem Bunker in Sicherheit bringen. Das Gleiche widerfuhr uns noch mal in<br />
Emden. In den Bunkern konnte man die Wucht der Einschläge spüren, es wackelte alles.<br />
Auch in Borkum haben wir die Flugzeuge mit Luftangriffen erlebt. Während wir am Strand<br />
waren, schlugen die Bombensplitter neben uns ein. Der 2. Kontakt mit den unmittelbaren<br />
Auswirkungen des Krieges war dann 1944.Die ersten Flüchtlinge trafen aus dem Warthegau<br />
und Ostpreußen ein. Sie wurden in der Osterbergschule einquartiert. Ich kann mich noch<br />
erinnern, wie Massen von Menschen mit Pferdewagen, Handwagen usw. durch die Straßen<br />
zogen.<br />
In Guben selbst gab es nur einen Bombeneinschlag, das war ca. 1941, genau kann ich das<br />
nicht mehr sagen, aber ich weiß noch, daß dies für die Gubener eine "Sensation" war. Der<br />
Einschlag war am Reichenbacher Berg und alle sind gucken gegangen. Die Schule wurde oft<br />
wegen Luftalarm unterbrochen oder fiel deswegen ganz aus.<br />
Mein Vater arbeitete zunächst als Meister in der Hutfabrik und war dienstverpflichtet bei der<br />
Fa. Lorenz in Guben, Herstellungsbetrieb für Nachrichtentechnik, (Standort war in der heutigen<br />
Stadtverwaltung). Er arbeitete dann in Mittweida, wohin diese Produktion verlegt wurde. Er<br />
hatte eine Wehrdienstuntauglichkeitsbescheinigung, weil er 1939 im Polenfeldzug verwundet<br />
wurde.<br />
Die Lage wurde immer ernster, die Front rückte im Februar 1945 immer näher und wir<br />
flüchteten mit unserem Nachbar, einem Winzer, mit dem Pferdewagen nach Cahnsdorf, bei<br />
Luckau. Winzer wurden in Guben auch die Gemüsebauern genannt. In den Gubener Bergen<br />
wurde früher Wein angebaut. Da der Absatz wegen mangelnder Qualität immer weiter<br />
zurückging, wurde der Anbau auf Gemüse umgestellt, die Bauern haben aber den Namen<br />
Winzer behalten.<br />
Mit geflüchtet sind meine Großtante, meine Mutter und meine Schwester. Meine Oma war<br />
nicht aus dem Haus zu bewegen und blieb somit daheim. In Cahnsdorf bekamen wir ein<br />
Zimmer in einem Bauernhaus zugewiesen. Unsere Flucht war mein Glück, dadurch bin ich<br />
dem Volkssturm entkommen, wo ja kurz vor Kriegsende noch die Jugend einberufen und<br />
verheizt wurde.<br />
Mein vier Jahre älterer Bruder, bereits zur Wehrmacht einberufen, war in Frankfurt/Oder<br />
stationiert und geriet im April 1945 in dem Kessel von Halbe in russische Kriegsgefangenschaft<br />
und erst im Herbst 1949 wurde er aus der Gefangenschaft in die Heimat entlassen.<br />
Zweimal fuhr ich während dieser Zeit nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Zuerst<br />
sind wir mit der Großtante mit der Bahn, ich glaube mit der Spreewaldbahn, bis nach<br />
Lieberose gefahren und von dort aus zu Fuß oder mit diversen Mitfahrgelegenheiten bis nach<br />
Guben gekommen. Im Haus lagerte ein Zug von ca. 30 Soldaten der Wehrmacht und hinter<br />
dem Haus verliefen Laufgräben bis in die Gubener Berge. Groß war die Freude beim<br />
Wiedersehen mit der Oma.Beim 2. Mal, so im Februar/März 1945, fuhr ich mit dem Fahrrad,<br />
welches ich beim 1. Mal mitgenommen hatte, nach Guben. Auf der Crossener Brücke bin ich in<br />
einen Fliegerangriff geraten und mußte schnell in ein Haus flüchten.<br />
Zu Hause angekommen, kann ich mich an einen zerschossenen Panzer T 34 erinnern, der vor<br />
unserem Haus stand. Unser Haus selbst hatte nur einen kleinen Einschuß in dem Zimmer,<br />
welches mein Bruder und ich bewohnten, ansonsten war es unversehrt. Ich habe einige<br />
persönliche Dinge mitgenommen und bin in unseren Flüchtlingsort zurückgefahren. Kurz vor<br />
Kriegsende stieß auch unser Vater zu uns nach Cahnsdorf.<br />
Zu Hause, so berichtete meine Oma, waren ununterbrochen Kampfhandlungen zu hören.<br />
Eines Tages schaute sie aus dem Fenster und konnte den Bismarckturm nicht mehr sehen.<br />
Der befand sich so in 150 m bis 200 m Luftlinie von unserem Haus entfernt. Sie hatte die<br />
Sprengung nicht mitbekommen, weil die Kämpfe so laut tobten.<br />
40
Den Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 erlebten wir in Cahnsdorf. Am 20./21. 4.<br />
waren die Russen im Dorf. Wir versteckten uns im Keller, wurden dann entdeckt und von<br />
einem Kommissar verhört. Während der ersten 2 Tage wurden wir von den Kampfverbänden<br />
der Roten Armee nicht weiter belästigt. Erst als die Nachschubeinheiten das Dorf besetzten,<br />
kam es häufig zu Vergewaltigungen von jungen Mädchen und Frauen. Großtante, Mutter und<br />
Schwester (8 Jahre) blieben zum Glück davor verschont.<br />
Nach dem 8. Mai 1945 beschlossen wir, nach Hause zurückzukehren. Am ersten Tag<br />
schafften wir die Strecke von Cahnsdorf bis nach Jamlitz. Abends haben wir in Jamlitz pausiert<br />
und wurden in der Gaststätte einquartiert. Der Saal war überfüllt mit Flüchtlingen, Verwundeten<br />
und Kranken. Dort haben wir unsere kranke Großmutter auf dem Stroh liegend vorgefunden.<br />
Welch ein Glück!<br />
Am nächsten Tag sind wir mit einem Handwagen und der kranken Großmutter nach Hause<br />
gelaufen. Am Stadion haben die Russen eine Behelfsbrücke montiert, auf der wir die Neiße<br />
überqueren konnten. Wir haben im Stadion noch eine "Ehrenrunde" gedreht, dies war der von<br />
den Russen uns zugewiesene Weg. Über die Triftstraße und Winzerstraße sind wir dann an<br />
unserem Haus angekommen. Der Weg dorthin war komisch, alles sah anders aus, Gräben<br />
waren überall ausgehoben. In der Winzerstraße klaffte ein tiefes Loch, ein sogenannter<br />
Panzergraben, und nur ein schmaler Gehweg war begehbar.<br />
Zu Hause angekommen standen die Aufräumungsarbeiten an, wie z. B. an der Oberschule für<br />
Jungen (heutiger Lebensmittelmarkt in Gubin), die während der Kampfhandlungen als Lazarett<br />
diente. Man mußte sich an diesen Arbeiten beteiligen, um Lebensmittelmarken zu erhalten.<br />
Natürlich waren wir Jungs neugierig und erkundeten die Gegend, es sah ja alles ganz anders<br />
aus, als vor der Flucht. Wir liefen die Laufgräben hinter unserem Haus entlang bis zum<br />
Bismarckturm und Engelmanns Berg, früher eine beliebte Ausflugsgaststätte. Wir waren<br />
neugierig auf den Spiegelsaal und es waren tatsächlich noch einige Spiegel ganz geblieben.<br />
Als ich wieder draußen war und mich etwa 150 m entfernt hatte, krachte es hinter mir - eine<br />
Mine ging hoch.<br />
Wir sind zum Aussichtspunkt "Schnecke" gelaufen, einer der höchsten Punkte in Guben mit<br />
einer Aussichtsplattform. Diese hatte auch einen Treffer abbekommen und ein großes Stück<br />
war weggebrochen. Dort habe ich den grausamen Anblick eines zerteilten Körpers ertragen<br />
müssen.<br />
Einmal, ich war wieder in den Laufgräben unterwegs, habe ich in der Germersdorfer Anhöhe<br />
eine Kirschbaumplantage entdeckt, die Bäume hingen übervoll mit großen schwarzen<br />
Kirschen. Ich mußte natürlich unbedingt welche haben, wußte aber auch, daß dort Minen<br />
lagen. Vorsichtig mit einem Stock und mit den Händen untersuchte ich den Boden und sprang<br />
dann mit einem Satz auf den Baum. Dort aß ich mich erst einmal satt und pflückte noch welche<br />
für zu Hause. Meine Mutter schimpfte natürlich mit mir, "Junge, bist du denn verrückt!?"<br />
Täglich kamen Menschen durch Minen zu Schaden. Diese wurden in eine Villa in der<br />
Uferstraße, eines der Hilfskrankenhäuser, gebracht und behandelt. Auch ein Freund von mir<br />
mußte dieses Schicksal erleiden, er trat auf der Schützenhausinsel auf eine Mine und verlor<br />
dadurch ein Bein.<br />
Beim Arbeitseinsatz im westlichen Stadtteil von Guben, im Haus des Restaurants "Stadt<br />
Guben", wo wir das zerstörte Dach deckten, konnten wir täglich morgens einen Zug deutscher<br />
Kriegsgefangener beobachten, die im Marschschritt an uns vorbeizogen. Sie mußten im<br />
polnisch besetzten Teil von Guben, dem heutigen Gubin, Minen suchen.<br />
Wir waren ungefähr einen Monat zu Hause, dann sollte sich alles noch einmal ändern.<br />
Der 20.6.1945 war für uns ein schrecklicher Tag.<br />
Plötzlich standen polnische Soldaten in der Stube und befahlen uns, innerhalb von<br />
10 Minuten das Haus zu verlassen. Ja, was nun mitnehmen? Alle waren kopflos und<br />
schnappten sich die unmöglichsten Dinge, nur nicht das, was nötig war. Als wir auf die Straße<br />
kamen sahen wir die großen Menschenströme mit Handwagen. Wir dachten uns, da können<br />
41
wir ja auch unseren Handwagen holen und ein paar Dinge einladen und gingen noch mal<br />
zurück. Den Handwagen durften wir uns noch nehmen, aber ins Haus hat man uns nicht mehr<br />
gelassen. Wir mußten Richtung Westen über eine Pontonbrücke am Königpark. Vor der<br />
Brücke wurden wir "gefilzt", das wenige, was wir dabei hatten, wurde gründlich durchsucht. Ich<br />
beobachtete, wie eine Mutti ihr Baby aus dem Kinderwagen nehmen mußte, um eventuell<br />
wertvolle Dinge darin zu finden. Diese wurden den Ausgewiesenen weggenommen.<br />
Wir kamen dann bei einer Bekannten unter und wohnten bei ihr, bis sich die Lage<br />
einigermaßen normalisiert hat.<br />
Das Essen war knapp, die Bettelei auf den Bauernhöfen der Dörfer ging los sowie auch das<br />
Stoppeln auf den Feldern.<br />
Meine Großmutter ist kurz vor der Ausweisung verstorben. Zu Fuß, den roh gehobelten Sarg<br />
auf einen Tischlerwagen geladen, gingen wir zum Ostfriedhof und beerdigten sie.<br />
16. Zeitzeugenbericht des Herrn Kurt Schulz<br />
Ich wurde am 11.8.1928 in Groß Bösitz geboren. Meine Großmutter besaß dort ein Haus mit<br />
einem Garten. Auch hatten wir ein paar Ziegen. Ansonsten waren wir eine Arbeiterfamilie.<br />
Mein Vater arbeitete in der Kohlengrube am Nassen Fleck. Meine Mutter hat während der<br />
Erntezeit bei den Bauern im Ort geholfen. Ich hatte noch einen Bruder und eine Schwester.<br />
1935 wurde ich in Groß Bösitz eingeschult. In unserer Schule gab es zwei Klassenräume und<br />
in jedem wurden 4 Klassen unterrichtet. Unterricht hatten wir bei Lehrer Kahlo und Lehrer<br />
Puhlmann. Er war nicht auf Hitler eingestellt, deshalb wollte ihn der Bürgermeister nicht mehr<br />
in der Schule haben. So bekamen wir dann Lehrer Fettke. Ich nehme an, daß Herr Puhlmann<br />
pensioniert wurde. Lehrer Fettke organisierte des Öfteren Schulausflüge.<br />
So besuchten wir unter anderem den Bismarckturm, die Drenziger Schweiz und das Kloster<br />
Neuzelle.<br />
Im Stadtforst in Guben sammelten wir im Herbst Blaubeeren und brachten sie in die<br />
Hindenburgschule. Dort war zu dieser Zeit ein Lazarett eingerichtet.<br />
An Pfingsten fanden HJ- bzw. BDM-Treffen statt. Bei einem der Treffen übernachteten wir auf<br />
einem Gut hinter Stargart und übten tagsüber marschieren. Ich erinnere mich auch an ein<br />
Sportfest in Kanig.<br />
In meiner Freizeit ging ich einmal in der Woche zur Flieger-Hitler-Jugend. Unser Ausbilder war<br />
Herr Naumann und wir bauten dort Flugzeugmodelle. Das machte mir großen Spaß und ich<br />
bin sehr gerne dort hingegangen. Die hier erlernten handwerklichen Fähigkeiten konnte ich<br />
später gut anwenden.<br />
1943 kam ich aus der Schule und begann eine Lehre bei F. W. Schmidt (jetzt Berliner Straße)<br />
als Tuchausrüster.<br />
42
Ich arbeitete in der Appretur und in der Walke. Produziert wurden Feldstoffe für das Militär. Bei<br />
der Fa. F. W. Schmidt waren auch französische Kriegsgefangene eingesetzt. Die Franzosen<br />
waren schnittige Leute, mit denen ich mich gut unterhalten konnte. Sie wollten von mir einen<br />
fetten Kater – dessen Fleisch sie essen wollten -, wofür ich Schokolade bekommen sollte. Es<br />
kam auch tatsächlich zu diesem Tauschgeschäft.<br />
Später arbeitete ich auch noch bei der Firma Wolf am Damm. Dort wurden feine Tuche, wie z.<br />
B. für Jäger hergestellt.<br />
In der Lehrzeit war ich abkommandiert zur Firma BRABAG in Schwarzheide - dort wurde<br />
Benzin hergestellt. Für Bauarbeiten brauchte man Kies und so wurden wir mit dem Bus nach<br />
Prieschka in der Nähe von Liebenwerda gefahren, wo wir in der Kneipe untergebracht waren.<br />
Der Wirt hatte zwei Töchter. Eine hieß Wiesgard und sie gefiel mir gut. Eine Zeit lang haben<br />
wir uns noch geschrieben. Der Betrieb wurde bombardiert und ziemlich zerstört. Für die<br />
Reparatur mußten wir in der nahegelegenen Kiesgrube Zeischa Kies in die bereitgestellten<br />
Loren schippen. Wenn diese voll waren kam eine kleine Lok und transportierte die Loren zu<br />
den Eisenbahnwaggons und der Kies wurde umgekippt. Auch dort waren Kriegsgefangene -<br />
Franzosen und Engländer - eingesetzt.<br />
Im Herbst 1944, ich war gerade 16 Jahre alt, kam die Einberufung zum Arbeitsdienst nach<br />
Schwerin an der Warthe. Die Ausbildung umfaßte den Dienst an der Waffe. Beim Marschieren<br />
bin ich mit meinem linken Knie auf einen Stein gefallen. Danach konnte ich nicht mehr richtig<br />
laufen und humpelte hinterher. Der Ausbilder sah sich das Knie an, es wurde schon dick, und<br />
schickte mich ins Revier. Eine oder zwei Wochen habe ich dort verbracht. Hier war es<br />
wenigstens warm. In den Holzbaracken, in denen wir untergebracht waren, durfte kein Feuer<br />
gemacht werden und es war demzufolge sehr kalt. Unter die Nachtwäsche haben wir uns den<br />
Trainingsanzug gezogen, um nicht zu sehr zu frieren.<br />
Nach der Ausbildung, die ca. 8 Wochen dauerte, erfolgte die Verlegung nach Forst. Es lag<br />
schon der erste Schnee, als wir den Fußmarsch antraten. Da mein Knie mir immer noch<br />
Probleme machte, hieß es: „Schulz bekommt ein Fahrrad“. Zuerst ging es von<br />
Schwerin/Warthe über Crossen nach Bobersberg. In einem RAD-Lager übernachteten wir.<br />
Mein Vater erfuhr irgendwie, daß wir dort waren und wollte mir Wurst vom Schlachten bringen.<br />
Leider kam er einen Tag zu spät, wir waren schon wieder unterwegs über Pförten nach Forst.<br />
Der Vater eines Kameraden aus Kerkwitz kam und meinte: „Junge, der Krieg ist doch vorbei“,<br />
und er nahm seinen Sohn mit nach Hause. Auf dem Heimweg fielen sie den Kettenhunden in<br />
die Hände, diese haben meinen Kameraden im Wald als Deserteur erschossen.<br />
Von Forst ging es mit dem Zug nach Potsdam in die Kaserne Sempatalis, eine alte Kaserne<br />
aus dem ersten Weltkrieg. Ich kann mich noch an die erste Mahlzeit dort erinnern. Es gab<br />
Nudeln mit Gulasch auf Blechtellern und Quarkspeise. Von zu Hause kannte ich so was nicht.<br />
Es schmeckte mir sehr gut.<br />
Die Ausbildung fand auf dem Übungsplatz Bornstetter Feld statt. Wir übten das Schippen von<br />
Gräben, in die wir uns legten. Anschließend rollten die Panzer über uns hinweg. Nach ca. 8<br />
Wochen marschierten wir nachts von Potsdam nach Brandenburg. Viele hielten diesen Marsch<br />
in den neuen Schuhen und Socken, die wir zuvor erhalten hatten, nicht durch.<br />
Ein Oberleutnant, der Kompaniechef der Einheit, suchte sich aus unserer Gruppe einzelne<br />
Leute aus, zu denen auch ich gehörte. Zusammen mit Verwundeten, die nach einem<br />
Lazarettaufenthalt wieder wehrtauglich waren, stellte er einen Zug zusammen. Wir gehörten<br />
zur 4. Kompanie, wurden ausgerüstet mit SMG und Granatwerfern. In Eisenbahnwaggons, die<br />
mit Stroh ausgelegt waren, teilten wir uns den Platz mit Pferden und es ging über Dresden in<br />
Richtung Tschechei an die Front. Von Predigern wurden wir noch seelisch und moralisch auf<br />
den Kampf vorbereitet. Es hieß: „Für Führer, Volk und Vaterland“. Ganz in der Nähe hörten wir<br />
das Donnern der Kanonen von der nahen Front. In einer Ziegelei, in der wir gelegen haben,<br />
gab mir der Unteroffizier ein Fernglas in die Hand und ich sollte auf den Dachboden steigen<br />
und Ausschau halten.<br />
In der Toreinfahrt der gegenüberliegenden Scheune sah ich ein Geschütz stehen und in<br />
diesem Moment knallte es über mir. Wir wurden von Russen beschossen. Ich hatte Glück, mir<br />
war nichts passiert.<br />
43
Einmal kam ein PKW mit Russen, aus Richtung Front, auf uns zu. Meine Kameraden ließen es<br />
so nahe wie möglich an uns herankommen und schossen es ab. Aber keiner traute sich in<br />
dessen Nähe. Erst als es Dunkel war wurde nachgeschaut, ob jemand überlebt hatte.<br />
Bei einem Schußwechsel wurde unser Kompanieführer sehr schwer verletzt. Er konnte seine<br />
starken Schmerzen kaum ertragen und flehte mich an, ihn zu erschießen. Ich blieb bei ihm, die<br />
Zeit bis zum Eintreffen der Sanitäter erschien mir endlos. Ich habe nie erfahren, was aus ihm<br />
geworden ist. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse als Soldat.<br />
Im Mai 1945 geriet ich in Brünn in tschechische Gefangenschaft. Lange blieben wir nicht dort,<br />
dann wurden wir mit dem Zug über Ungarn, die Ukraine und Kiew nach Stalino, einem Ort<br />
nordwestlich von Odessa, gebracht. Dort mußten wir im Kohlebergbau, bei karger Kost (Kraut<br />
und Graupen) hart arbeiten. Ich war in der Glaserei beschäftigt, wo ich eines Tages mit meinen<br />
Holzschuhen, die wir von den Russen bekommen hatten, von einer Betonkante abrutschte,<br />
stürzte und eine Gehirnerschütterung erlitt. Deshalb wurde ich für einige Zeit OKD<br />
(dienstuntauglich) geschrieben, und konnte ein paar Tage auf der Stube bleiben.<br />
Meinem Freund war bei der Arbeit umgefallen und man brachte ihn in die Stadt ins<br />
Krankenhaus. Als ich später die Ruhr bekam wurde ich ins Lazarett gebracht.<br />
Nachdem ich wieder essen konnte, bekam ich Weißbrotstullen dick mit Butter bestrichen. Die<br />
Butter war in Dosen und kam aus Amerika.<br />
Eines Nachts, ca. 1.00 Uhr, wurden alle OKD geschriebenen und die Kranken in die<br />
Kommandantenbaracke außerhalb des Lagers gebracht.<br />
Wir erfuhren, daß eine Gruppe nach Hause entlassen werden sollte. Eine Liste wurde<br />
vorgelesen aber mein Name und der meines Freundes waren nicht darunter. Mein Freund<br />
Heinz wollte wieder zurück ins Lager gehen und sich hinlegen, aber ich sagte: Wir bleiben<br />
sitzen. Als der Kommandant am nächsten morgen kam, wunderte er sich, daß da noch zwei<br />
Jungen sitzen. Er fragte uns wie alt wir sind. Wir antworteten - auf Russisch - 17 Jahre und der<br />
Kommandant sagte darauf mit einer Handbewegung: „Ab nach Hause, zu Mutter“. Zuerst<br />
wurden wir entlaust und dann ging es mit 3 bereitgestellten Waggons Richtung Heimat. Nach<br />
einigen Wochen, die wir unterwegs waren und der anschließenden Quarantäne kamen wir im<br />
Oktober 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Für ein paar Tage blieb ich noch bei<br />
meinem Freund in Schönfließ. Hier gab es gutes Essen, aber bei mir ist nichts drin geblieben.<br />
Mein Magen hat das gute Essen nicht vertragen.<br />
Ich erfuhr, daß sich meine Eltern in Bresinchen befinden – und machte mich auf den Weg<br />
dorthin. Meine Großeltern väterlicherseits hatten in Bresinchen einen Bauernhof, den die ältere<br />
Schwester meines Vaters bewirtschaftete. Dorthin sind meine Eltern geflüchtet.<br />
Sie haben mich kaum wieder erkannt, so dünn war ich geworden. Mein Vater sagte: „Mensch<br />
Junge, du stolperst ja sogar noch über einen Strohhalm“.<br />
Nach meiner Heirat bewohnte ich mit meiner Frau ein Zimmer in einem Haus in Bresinchen.<br />
Später haben wir gegenüber ein eigenes Haus gebaut.<br />
44
17. Zeitzeugenbericht von Herrn Krüger<br />
Am 24.10.1933 wurde ich in Guben im Kastaniengraben 13 geboren. Meine Eltern lebten zur<br />
Miete bei Frau Utzig in einer Kellerwohnung mit Küche und Schlafraum. Mein Vater war als<br />
Schlosser bei der Tuchfabrik Schemel beschäftigt und meine Mutter arbeitete als Hutmacherin<br />
bei der Firma Wilke. Sie arbeitete dort viel mit Quecksilber und als ich geboren wurde hieß es,<br />
„der lebt nicht lange“. So erhielt ich schnell noch vom evangelischen Pfarrer Lehmann die<br />
Nottaufe. Meine Mutter suchte dann mit mir Herrn Schleising, einen Homöopathen in der<br />
Teichbornstraße, auf. Der meinte, „das kriegen wir schon wieder hin“ und ich wurde gesund.<br />
Im Alter von einem Jahr erhielt ich dann die offizielle Taufe in der Stadt- und Hauptkirche.<br />
45
Meine Kindheit verlief sorglos und ich mußte nichts entbehren. Wir hatten einen 700 m² großen<br />
Schrebergarten, in dem wir Gemüse und Obst angebauten, welches meine Mutter auch für<br />
den Winter einweckte. Kartoffeln brauchten wir keine kaufen und auch Hühner, Kaninchen und<br />
Enten hielten wir uns. Eingekauft wurde beim Kaufmann Strauß in der Königstraße. Weil man<br />
uns dort kannte, bekamen wir auch Dinge, die es nicht immer gab. Ab und zu bekam ich von<br />
ihm Schokolade.<br />
1940 wurde ich in die Sandschule eingeschult, die ich bis zur 3. Klasse besuchte. Ein Cousin<br />
meines Vaters hatte in der Pförtener Straße ein größeres Einfamilienhaus gebaut. Er bot uns<br />
an, bei ihnen zu wohnen und wir zogen dort ein und kurz darauf, im Januar 1942, wurde meine<br />
kleine Schwester geboren. Mein Vater arbeitete ab 1942 in den Borsig-Werken und wir zogen<br />
nochmals um - in die Sommerfelder Straße. Was er dort gearbeitet hat weiß ich nicht. Darüber<br />
durfte man nicht sprechen. Ab der 4. Klasse besuchte ich die Klosterschule. Als im Herbst<br />
1944 hier ein Lazarett eingerichtet wurde, mußte ich dann in die Osterbergschule.<br />
Unsere Lehrer in der Sandschule waren sehr streng. Es waren meist ausgemusterte<br />
Wehrmachtsangehörige, die als Lehrer eingesetzt wurden. Unser Geschichtslehrer war ein<br />
ehemaliger Flugzeugführer, der bei einem Flugzeugabsturz ein Bein verloren hatte. Unseren<br />
Klassenlehrer Müller werde ich nicht vergessen. Er hatte den „gelben Onkel“ (Rohrstock)<br />
immer dabei und ließ ihn uns auch oft spüren. Die Mädchen bekamen ihn über die Finger und<br />
die Jungen mußten die Hosen runter lassen. Unsere Musiklehrerin war Frl. Galaske. Sie<br />
spielte Geige und benutzte den Geigenstock auch schon mal anderweitig. Wer brummte oder<br />
falsch sang, den bestellte sie zu sich nach Hause in Schemels Weg zur Gesangsstunde. In<br />
den unteren Klassen sangen wir Volkslieder, Heimatlieder, Kirchenlieder und in der<br />
Vorweihnachtszeit Weihnachtslieder, während später, ab der 5. Klasse auch Nazilieder gelernt<br />
werden mußten.<br />
Herr Ringelhahn war unser Klassenlehrer und Religionslehrer in der Klosterschule. Der<br />
Religionsunterricht fand nach der Schule in dem kleinen Häuschen neben der Kirche statt. Wir<br />
versuchten uns immer davor zu drücken und verschwanden unterwegs heimlich, um in der<br />
Neiße ein Bad zu nehmen oder rumzustromern. Aber meistens erwischte uns Herr Ringelhahn<br />
und holte uns zum Unterricht.<br />
Freizeit hatte ich nicht viel zur Verfügung. Ich mußte im bereits erwähnten Garten und in dem<br />
meines Großvaters helfen. Als 1942 meine Schwester geboren wurde, habe ich sie oft<br />
spazieren fahren müssen. Da ich aber meine Freizeit mit den anderen spielend verbringen<br />
wollte, habe ich sie auch mal geärgert, damit sie weint. Meiner Mutter habe ich dann gesagt,<br />
sie hätte Hunger - und so war ich sie los. Einmal landete der Kinderwagen beim Rennen<br />
fahren im Chausseegraben, kippte um und meine Schwester fiel raus. Zu Hause gab es dafür<br />
mit dem Ausklopfer.<br />
Im Alter von 9 Jahren bin ich dem Deutschen Jungvolk beigetreten. Es wurde Werbung<br />
gemacht, daß sie junge Leute suchen, die besondere Interessen haben. Ich interessierte<br />
mich für den Flugmodellbau und konnte dies dort verwirklichen. Meine Eltern waren dagegen<br />
und schimpften mit mir aber ich setzte meinen Kopf durch. Ich gehörte dem Fähnlein 9 an,<br />
in dem Flugzeugmodelle gebastelt wurden - das fand in dem Gebäude statt, wo heute die<br />
Polizei ihren Sitz hat. Das hat mir großen Spaß gemacht, mopste ich doch bei meiner Mutter<br />
die Einweckgummis, damit die Flugzeuge auch durch die Luft sausen konnten.<br />
Ich bekam bei dem DJ ein schwarzes Halstuch mit einem braunen Lederknoten. Offiziell wurde<br />
man mit 10 Jahren in das DJ aufgenommen und dann mußten wir auch zu bestimmten<br />
Anlässen und Staatsfeiertagen, wie Hitlergeburtstag, Tag der Wehrmacht u. ä., Uniform<br />
tragen. Die schwarzen Hosen und das braune Hemd mußten die Eltern kaufen und vom<br />
46
Jungvolk erhielt jeder ein Fahrtenmesser. Der Kopf des Messergriffes war wie ein Adler<br />
geformt und in den Griff des Messers war das Zeichen der HJ eingraviert. Bei gutem Verhalten<br />
gab es ein Abzeichen. Es wurden Ausflüge von der DJ und HJ organisiert. Wir sind mal übers<br />
Wochenende, mal für 4 Tage nach Schiedlo gewandert und haben in der dortigen<br />
Jugendherberge übernachtet. Wir lernten dort in Kriegsspielen die Kriegsverhältnisse und das<br />
Soldatendasein kennen. Irgendwann dachte ich mir, irgend etwas stimmt hier nicht und habe<br />
die Uniform nicht mehr getragen. Das zog Repressalien mit sich, unser Sportlehrer an der<br />
Osterbergschule war ein bekennender Nazi und hat uns das mit Schlägen und Tritten spüren<br />
lassen. Bis 1945 war ich Mitglied im DJ. Die Schule wurde dann geschlossen.<br />
1942 wurde mein Vater zur Wehrmacht eingezogen und wurde in Rathenow kaserniert bei<br />
einer Kfz-Nachschubeinheit. Als seine Truppe nach Rußland abkommandiert wurde, erkrankte<br />
mein Vater und so hatte er Glück im Unglück und kam nach seiner Genesung als Kraftfahrer<br />
nach Norwegen. Während der Dienstzeit in Oslo war er bei einem Bauer, der selbst keine<br />
Kinder hatte, untergebracht. Mein Vater war ja gelernter Schlosser und er half auf dem<br />
Bauernhof oft mit. Er verstand sich mit dem Bauer sehr gut und dieser schlug meinem Vater<br />
vor, seine Familie herzuholen.<br />
Nach Kriegsende 1945 geriet er in englische Gefangenschaft, wurde dort gut behandelt und<br />
wurde im Frühjahr 1947 nach Deutschland entlassen. Über Kiel wurde er in ein<br />
Internierungslager nach Frankfurt/Oder in die russische Zone entlassen. Der norwegische<br />
Bauer hatte ihn zuvor noch mit vielen Dingen, wie Eßwaren, Bekleidung u. a. ausgestattet.<br />
Bei der Kontrolle in Frankfurt hatte er Glück und konnte alles behalten.<br />
Nach ca. 4 Wochen Internierungslager kam er dann nach Guben zurück, mußte für 2 bis 3<br />
Monate nach Küstrin Kietz gehen, um dort als Schlosser Panzer zu verschrotteten und begann<br />
dann bei der Firma C. Heinze - Hutmaschinenfabrik mit der Arbeit.<br />
1943 wurde in der Sommerfelder Straße ein Internierungslager angelegt. Es waren 8 oder 10<br />
Baracken. Auf der linken Seite waren Italiener und Franzosen untergebracht. Sie arbeiteten bei<br />
verschiedenen Firmen wie z. B. Wilke, Borsig, Reißner. Nach der Arbeit konnten sie sich<br />
relativ frei bewegen. Auf der rechten Seite waren Russen und Polen, sogar mit Kindern,<br />
eingesperrt und streng bewacht. Sie bekamen wenig zu Essen und täglich sah man<br />
Leichenwagen rausfahren. Wir haben als Kinder manchmal Kartoffeln, Brot oder Birnen aus<br />
Onkels Garten über den Zaun geworfen. Der Onkel schimpfte: Wenn die Wachposten euch<br />
erwischen! - Wurden wir aber nicht.<br />
Es war Mitte Februar 1945, meine Mutter und ihre Schwester waren einkaufen und draußen<br />
wurde es bereits dunkel. Meine Schwester und ich spielten in unserer Wohnung in der<br />
Sommerfelder Straße, sie mit ihrer Puppenstube und ich hatte eine Burg mit Lineolsoldaten,<br />
als die erste Stalinorgel über unser Haus hinweg schoß und in ein Haus in der Pförtener<br />
Straße einschlug. Meine Mutter kam ganz aufgeregt nach Hause gelaufen und war froh, daß<br />
uns nichts passiert war. Ich lief, neugierig wie ich war, das in Trümmer gelegte Haus<br />
angucken. Am nächsten Tag beschloß meine Mutter, unsere Sachen zu vergraben.<br />
Der Keller dieses Hauses sollte zum Luftschutzbunker ausgebaut werden, wozu es aber nicht<br />
mehr kam. So lag seit einiger Zeit ein großer Kieshaufen dort. In eine große Regentonne, die<br />
wir schon vorher aus unserem Garten geholt haben, packte meine Mutter eingewecktes<br />
Fleisch und Obst ein. Dafür hatten wir einige Tiere, die wir noch aus dem Garten holen<br />
konnten, geschlachtet. Die Tonne wurde dann unter dem Kieshaufen vergraben.<br />
Anfang März kamen SS-Leute zu uns nach Hause und meinten, es ist zu gefährlich, wir<br />
müssen hier raus und sollen mitnehmen, was wir können. In unser Schlafzimmer postierte sich<br />
ein Heckenschütze. Meine Mutter bepackte unseren großen Handwagen mit allem<br />
Notwendigen, was gebraucht wurde - Wäsche, Betten, Papiere usw. Damit zogen wir in die<br />
Dreikreuzstraße zur Tante und blieben dort bis Mitte April. Aber auch hier kam die SS und<br />
meinte: „Jetzt aber raus mit Euch, in zwei Tagen wird die Neißebrücke gesprengt“. Es wurde<br />
47
eilig ein Treck zusammengestellt. Dazu gehörten ca. 5 Pferdefuhrwerke und einige<br />
Handwagen. Der Einzige, der nicht zur Flucht zu bewegen war, war Herr Ribbisch. Er blieb mit<br />
seiner Frau und seiner Mutter da. Meine Tante, ihre Tochter, meine Mutter, meine Schwester<br />
und ich reihten uns in den Treck ein. Zum Glück mußten wir unseren großen Handwagen nicht<br />
ziehen, sondern konnten ihn an einen Pferdewagen anbinden. Wir fuhren über die<br />
Königstraße, Stadtschmiedstraße, über die Neißebrücke, die schon zur Sprengung vorbereitet<br />
war, Adolf-Hitler-Straße, Bahnhofstraße, Bahnhofsberg und den Reichenbacher Berg hinauf.<br />
Hier wurden wir noch von der russischen Artillerie beschossen und wir mußten in Deckung<br />
gehen. Getroffen wurde niemand.<br />
An der Kreuzung vor Lübbinchen stand deutsche Artillerie, die gerade anfing, das Gegen-feuer<br />
zu eröffnen. Es gingen uns fast die Pferde durch und die Kutscher hatten Mühe, sie zu halten.<br />
In Pinnow an der alten Schmiede befand sich eine Auffangstelle für Flüchtlinge, wo wir<br />
Verpflegung und Anweisungen, welchen Weg wir nehmen sollen, erhielten. Wir wurden nach<br />
Lieberose geschickt und im Schloß einquartiert. Nachdem wir dort die Nacht ver-brachten,<br />
wurden wir am nächsten Morgen aufgeteilt. Die eine Hälfte des Trecks sollte nach Halbe und<br />
die andere, wozu wir gehörten, sollte über Lübben nach Golßen weiterziehen. In Golßen<br />
angekommen wurden wir auf die Häuser im Ort aufgeteilt. Unsere Familie wurde in einem<br />
Haus untergebracht, in dem polnische Arbeiter wohnten, die in Golßen, in einem Betrieb, der<br />
Militärgeschirr herstellte, arbeiteten. Die Hauseigentümer waren Berliner, sie waren nicht da.<br />
Die Schwester meiner Mutter war bei einem Fleischer untergebracht. Als meine Mutter von<br />
einem Besuch bei ihrer Schwester zurückkehrte, stellte sie fest, daß unsere Geldkassette mit<br />
sämtlichen Papieren, Fotos und Unterlagen gestohlen worden war.<br />
Nach ca. 8 Tagen, als die Russen auch hierher kamen, zogen wir weiter über Sellendorf, in<br />
Richtung Luckenwalde, Jüterbog bis kurz vor Schlenzer. Eine Nacht verbrachten wir im Wald,<br />
weil uns jemand erzählte, daß in Schlenzer die Russen sind. Die weiße Bettwäsche wurde<br />
abgezogen, damit man uns nicht entdeckt. In der Nacht regnete es und alles wurde naß. In der<br />
Nähe hörten wir einen lauten Knall. Am Morgen sahen wir, daß ein russischer Panzer<br />
abgeschossen worden ist. In Schlenzer angekommen, hat uns der Ortsbauernführer in das<br />
Rittergut eingewiesen. Eine alte Frau, die schon über 70 Jahre alt war, bewirtschaftete ganz<br />
allein dieses Gut, denn alle Angehörigen waren im Krieg. Sie hat uns eine Wohnung<br />
zugewiesen. Nach 3 Tagen kamen die Russen. Meine Schwester lief auf dem Hof herum, als<br />
ein Auto vorfuhr und sie ein älterer Russe heranwinkte. Meine Mutter hatte Angst um sie, aber<br />
nach einer Weile kam sie mit einer großen Tüte braunem Zucker zurück. Bis zum Ende des<br />
Krieges blieben wir im Dorf Schlenzer. Weil im Ort die Vergewaltigungen nicht aufhörten ließ<br />
ein russischer Offizier einige seiner eigenen Leute an die Wand stellen.<br />
Um den 12. Mai machten wir uns auf den Heimweg. Die alte Frau gab uns zwei 10 l Tontöpfe,<br />
gefüllt mit Schmalz, mit. Wir waren etwa 3 Tage zu Fuß unterwegs und kamen am <strong>15.</strong> 5. in<br />
Guben an. Über eine Notbrücke zwischen der Eisenbahnbrücke Richtung Sommerfeld und der<br />
großen Neißebrücke, in Höhe der Brauerei Gröll, kamen wir in unserer Wohnung in der<br />
Sommerfelder Straße an. Dort war alles in Ordnung und auch unsere vergrabenen Vorräte im<br />
Keller waren noch da. Die Soldaten, die in unserer Wohnung lagen, haben sich gut<br />
benommen. Nur das Loch für die Schießscharte im Schlafzimmer, die sie für den<br />
Heckenschützen rausgeschlagen hatten, war noch vorhanden. Im Garten haben noch ein paar<br />
Hühner überlebt und sogar die Zigarren, die meine Mutter für die Rückkehr meines Vaters<br />
unter dem Bett versteckt hatte, waren noch da. Ich entdeckte sie und habe mit ein paar<br />
Kumpels auf dem Plumpsklo heimlich geraucht. Eine Nachbarin, Frau Erdmann, entdeckte den<br />
Qualm und petzte es meiner Mutter. Ich versteckte mich unter dem Bett, meine Mutter<br />
hinterher. Ich war aber schneller wieder hervorgekommen und lief auf Strümpfen bis zur<br />
Pförtener Straße, Höhe Gartenanlage Busch, vor meiner Mutter weg, die mich mit dem<br />
Ausklopfer verfolgte.<br />
48
Die Polen zogen uns Jungen zum Arbeiten heran. Unter Aufsicht mußten wir in der gesamten<br />
Sommerfelder Straße bis Schmachtenhain die Schützengräben zuschippen. Dabei haben wir<br />
oftmals auch Konservendosen mit Lebensmitteln gefunden.<br />
Auf der rechten Seite vor Schmachtenhain haben wir ein großes Massengrab ausgehoben.<br />
Dort sollten wir die gefallenen Soldaten, die wir in den Chausseegräben gefunden haben,<br />
begraben. Wir waren gerade dabei, die ersten beiden Toten aus den Schützengräben, in<br />
Tücher eingehüllt, in dem Massengrab zu beerdigen, als ein polnischer Offizier am 20. 6.<br />
um 9 Uhr zu uns sagte: „Alles stehen und liegen lassen. Ihr müßt hier raus und ihr kommt nie<br />
wieder, es wird polnisches Staatsgebiet.“ Er schickte uns nach Hause.<br />
Meine Mutter hat wieder den Handwagen, den wir schon bei der ersten Flucht benutzt hatten,<br />
zusammengepackt. Der polnische Offizier war human und sie konnte alles, was rein ging<br />
mitnehmen, auch die beiden Schmalztöpfe, die wir von der alten Frau vom Rittergut in<br />
Schlenzer erhielten. Obendrauf kam ein großer Teller mit Plinzen, die meine Mutter gerade<br />
gebacken hatte. Trotz großer Hitze mußte ich meinen Anzug mit den kurzen Hosen, darüber<br />
den Anzug mit den langen Hosen und noch einen Wintermantel anziehen. In der Tasche vom<br />
Wintermantel hatte ich die goldene Uhr meiner Mutter. Der Wintermantel war doppelt<br />
abgefüttert.<br />
Vor der Schützenhausinsel, beim Fotograf Simon, war eine Kontrollstelle eingerichtet. Ich<br />
mußte rein zur Kontrolle. Der Pole griff mir in die Tasche, die Uhr rutschte in das Mantelfutter<br />
und er wurde wütend und beförderte mich mit einem Fußtritt nach draußen. Ich suchte nach<br />
meiner Mutter, konnte sie aber nicht sehen. Sie hatte die Plinze an die Kinder verteilt und der<br />
polnische Posten fragten sie, ob das alles ihre Kinder seien. Sie bejahte dies und konnte ohne<br />
Kontrolle über die Brücke gehen. Wir sind dann beim Tischler Ploke in der Sprucker Straße<br />
gelandet.<br />
Ab 1. Oktober 1945 ging ich wieder zur Schule in das Pestalozzigymnasium und ab 1948<br />
erlernte ich den Beruf eines Modelltischlers bei der Firma Heinze (später Textima) in der<br />
Uferstraße.<br />
49