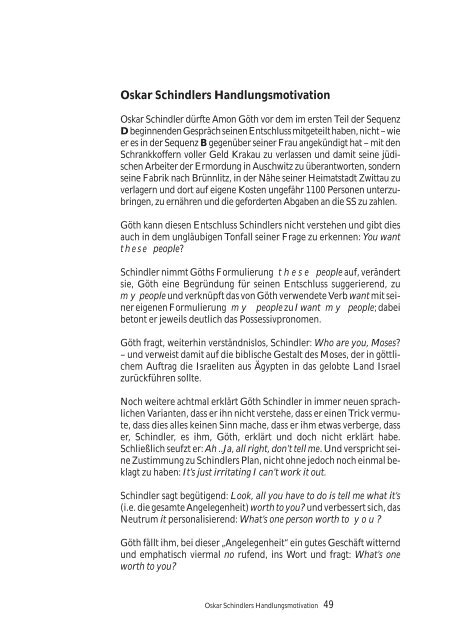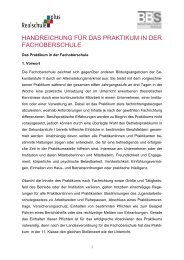Oskar Schindlers Handlungsmotivation
Oskar Schindlers Handlungsmotivation
Oskar Schindlers Handlungsmotivation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Oskar</strong> <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong><br />
<strong>Oskar</strong> Schindler dürfte Amon Göth vor dem im ersten Teil der Sequenz<br />
Dbeginnenden Gespräch seinen Entschluss mitgeteilt haben, nicht – wie<br />
er es in der Sequenz B gegenüber seiner Frau angekündigt hat – mit den<br />
Schrankkoffern voller Geld Krakau zu verlassen und damit seine jüdischen<br />
Arbeiter der Ermordung in Auschwitz zu überantworten, sondern<br />
seine Fabrik nach Brünnlitz, in der Nähe seiner Heimatstadt Zwittau zu<br />
verlagern und dort auf eigene Kosten ungefähr 1100 Personen unterzubringen,<br />
zu ernähren und die geforderten Abgaben an die SS zu zahlen.<br />
Göth kann diesen Entschluss <strong>Schindlers</strong> nicht verstehen und gibt dies<br />
auch in dem ungläubigen Tonfall seiner Frage zu erkennen: You want<br />
these people?<br />
Schindler nimmt Göths Formulierung these people auf, verändert<br />
sie, Göth eine Begründung für seinen Entschluss suggerierend, zu<br />
m y people und verknüpft das von Göth verwendete Verb want mit seiner<br />
eigenen Formulierung m y people zu I want m y people; dabei<br />
betont er jeweils deutlich das Possessivpronomen.<br />
Göth fragt, weiterhin verständnislos, Schindler: Who are you, Moses?<br />
– und verweist damit auf die biblische Gestalt des Moses, der in göttlichem<br />
Auftrag die Israeliten aus Ägypten in das gelobte Land Israel<br />
zurückführen sollte.<br />
Noch weitere achtmal erklärt Göth Schindler in immer neuen sprachlichen<br />
Varianten, dass er ihn nicht verstehe, dass er einen Trick vermute,<br />
dass dies alles keinen Sinn mache, dass er ihm etwas verberge, dass<br />
er, Schindler, es ihm, Göth, erklärt und doch nicht erklärt habe.<br />
Schließlich seufzt er: Ah ..Ja, all right, don’t tell me. Und verspricht seine<br />
Zustimmung zu <strong>Schindlers</strong> Plan, nicht ohne jedoch noch einmal beklagt<br />
zu haben: It’s just irritating I can’t work it out.<br />
Schindler sagt begütigend: Look, all you have to do is tell me what it’s<br />
(i.e. die gesamte Angelegenheit) worth to you? und verbessert sich, das<br />
Neutrum it personalisierend: What’s one person worth to y o u ?<br />
Göth fällt ihm, bei dieser „Angelegenheit“ ein gutes Geschäft witternd<br />
und emphatisch viermal no rufend, ins Wort und fragt: What’s one<br />
worth to you?<br />
<strong>Oskar</strong> <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong> 49
Why did Schindler<br />
do all this?<br />
Insgesamt zehnmal äußert Göth sein Unverständnis für <strong>Schindlers</strong><br />
Entschluss und bezeichnet ihn als sinnlos; genau so häufig versucht<br />
Schindler, Göth gegenüber seinen Entschluss zu begründen..<br />
Analog zu der in Sequenz A fünffach gestellten Frage nach der Identität<br />
des Protagonisten, die in einer ihrer Antworten auf Spielbergs Intention<br />
bei der Produktion des Films verwies, schließt sich auch in diesem<br />
Teil der Sequenz D ganz natürlich die Frage an, warum Spielberg<br />
Goeth zehnmal in vielfältiger Variation die Frage nach <strong>Schindlers</strong><br />
<strong>Handlungsmotivation</strong> stellen und Schindler ebenso häufig keine Göth<br />
überzeugende Antwort geben lässt.<br />
Es darf angenommen werden, dass Spielberg durch diese Form der<br />
Darstellung auf eine ihn ganz persönlich berührende Frage und<br />
gleichzeitig auf eine in der Öffentlichkeit immer wieder gestellte Frage<br />
verweisen wollte, auf die Frage nämlich nach <strong>Oskar</strong> <strong>Schindlers</strong><br />
<strong>Handlungsmotivation</strong>.<br />
In vielfacher Form und mit unterschiedlicher Intention ist die Frage<br />
nach den Beweggründen für <strong>Schindlers</strong> altruistisches Handeln gestellt<br />
worden: Warum hat er Juden vor den sogenannten Aktionen der SS in<br />
Krakau gewarnt? Warum hat er alte und kranke Menschen als „gelernte“<br />
Metallarbeiter in seiner DEF beschäftigt und für sie die entsprechenden<br />
„Überlassungsgebühren“ an die SS gezahlt? Warum schließlich<br />
hat er seinen gesamten Geschäftsgewinn in Höhe eines zweistelligen<br />
Millionenbetrages eingesetzt, um jüdische Arbeiter zu beschäftigen<br />
und gegen Ende des Krieges mehr als 1100 von ihnen vor der Ermordung<br />
in Auschwitz zu retten?<br />
Alle Versuche, ein einzelnes Ereignis oder eine lebensbedeutsame Erfahrung<br />
zu finden, die <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong> erklären<br />
könnten, sind bisher ohne Erfolg geblieben. Keneally gelingt dies in<br />
seinem „Roman“ ebensowenig wie den zahlreichen Biografen, die<br />
<strong>Schindlers</strong> Leben vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und in<br />
der Zeit des Krieges untersucht haben. Spielberg kennzeichnet in seinem<br />
Film durch den roten Mantel des in zwei Szenen auftretenden<br />
Kindes nur Zeitpunkte, an denen Schindler sich zum Handeln entschließt;<br />
er versucht aber nicht eine Erklärung hierfür zu geben. Dass<br />
er dies gern getan hätte, geht aus einer Episode während der Dreharbeiten<br />
in Krakau hervor: Als Spielberg Mietek Pemper bei dessen Eintreffen<br />
am Drehort erkannte, rief er ihm schon von weitem zu: Why<br />
did Schindler do all this? Aber auch Pemper konnte ihm keine ihn zufriedenstellende<br />
Antwort geben. Mietek Pemper hat dem Verfasser<br />
wiederholt berichtet, <strong>Oskar</strong> Schindler habe sich ihm und anderen<br />
Schindler-Juden gegenüber auch nach dem Krieg nicht zu Gründen<br />
50
für sein Handeln geäußert und die durch <strong>Schindlers</strong> „Liste“ Geretteten<br />
sagten immer wieder nur, es sei für sie primär wichtig, dass sie gerettet<br />
worden seien und dass sie für <strong>Schindlers</strong> Handeln keine singuläre<br />
Erklärung hätten.<br />
Spielberg erfindet in seinem Film kein Ereignis und keine Erklärung<br />
für <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong>; er lässt eine Leerstelle in seinem<br />
Film und verweist den Betrachter der Sequenz D durch die überhäufig<br />
geäußerte Verständnislosigkeit Göths für <strong>Schindlers</strong> Entschluss auf<br />
die Bedeutung der Frage nach dessen <strong>Handlungsmotivation</strong> und auf<br />
seinen eigenen Verzicht auf eine fiktive Antwort.<br />
Diese Leerstelle des Films erweist sich jedoch für den Unterricht als<br />
Glücksfall; sie ist geradezu die Voraussetzung für eine tiefergehende<br />
Reflexion der Schüler über den in Schindler vorgehenden Prozess des<br />
wertenden Abwägens und des Entscheidens und über die Motivation<br />
für sein Handeln.<br />
Nach der filmanalytischen Behandlung des ersten Teils der Sequenz D<br />
kann die unterrichtliche Reflexion der <strong>Handlungsmotivation</strong> <strong>Oskar</strong><br />
<strong>Schindlers</strong> durch den Verweis auf zwei Äußerungen <strong>Schindlers</strong> und auf<br />
eine Erklärung Yehuda Bauers zu dieser Problematik angereichert<br />
werden.<br />
Zu der Motivation seines Handelns hat Schindler selbst nur eine einzige<br />
öffentliche Äußerung abgegeben, die in allen gedruckten und elektronischen<br />
Biografien über ihn zitiert wird. Als in Frankfurt der Auschwitz-Prozess<br />
stattfand, wurde im Jahre 1965 ein Fernseh-Team des<br />
Hessischen Rundfunks auf den in Frankfurt lebenden <strong>Oskar</strong> Schindler<br />
aufmerksam gemacht und interviewte ihn zu der Verfolgung und Ermordung<br />
der europäischen Juden. Auf die Frage, warum er geholfen<br />
und nicht einfach weggesehen habe, antwortete er:<br />
„Die Verfolgungen der jüdischen Menschen im Generalgouvernement,<br />
im polnischen Raum, haben in ihren Grausamkeiten eine allmähliche<br />
Steigerung genommen; im Jahre 39 und dann 40, mit dem Judenstern;<br />
und die Zusammenpferchung der Menschen im Ghetto haben<br />
(sic) natürlich den Sadismus in Reinkultur erst im Jahre 41 und 42<br />
geoffenbart, und ein denkender Mensch, der mit dem inneren<br />
Schweinehund siegreich fertig wurde, musste einfach helfen. Es war<br />
keine andere Möglichkeit.“ 63<br />
63 Aus: Die Juden nannten ihn Vater Courage, Protokoll über <strong>Oskar</strong> Schindler, vorgelegt von Reinhard<br />
Albrecht, Südwestfunk, 1994<br />
<strong>Oskar</strong> <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong> 51
Diese Erklärung <strong>Schindlers</strong> zu seiner <strong>Handlungsmotivation</strong> nimmt<br />
Yehuda Bauer in seiner Rede auf, die er anläßlich des Gedenktages für<br />
die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag am 27. Januar<br />
1998 gehalten hat. Zunächst beschreibt er, wohl kaum aus Gründen<br />
der rhetorischen Wirkung bewusst übertreibend, sondern in<br />
tatsächlicher Überzeugung von der Richtigkeit seiner Charakterisierung<br />
<strong>Oskar</strong> Schindler 64 in äußerst negativer Weise und rühmt ihn danach<br />
als Beispiel der Menschlichkeit:<br />
„<strong>Oskar</strong> Schindler ist durch den bekannten Film eine umstrittene Figur<br />
geworden, aber sehen Sie, wenn man den Mythos wegtut, bleibt die historische<br />
Figur. Schindler war nicht nur ein Parteimitglied, sondern<br />
auch ein Agent der Abwehr, ein Schürzenjäger, ein Alkoholiker, ein<br />
rücksichtloser Ausnützer, ein Lügner. Sie würden kaum einen Menschen<br />
finden, dem Sie niedrigere Charakteristiken anhängen könnten.<br />
Und dann rettete er über tausend Menschenleben, unter Gefährdung<br />
seiner Person. Er schleppte persönlich schwerkranke und sterbende<br />
jüdische Arbeitssklaven aus einem frierenden Zug um zu versuchen,<br />
ihr Leben zu retten . Er musste es nicht tun, aber er tat es. Er fuhr nach<br />
Budapest, um die Juden dort vor dem Holocaust zu warnen; er musste<br />
es nicht, aber tat es. Warum? Weil er ein Mensch war; und so schlimm<br />
er war, so gut war er.“ 65<br />
Es scheint für Schindler wichtig gewesen zu sein darauf hinzuweisen,<br />
dass er bei seinem Entschluss, seine Arbeiter vor dem Transport nach<br />
Auschwitz zu retten, nicht unter irgendeinem Zwang gestanden, sondern<br />
als freier Mann gehandelt habe. Dies bringt er zum Abschluss eines<br />
Berichts über „Rettungsarbeiten“ zum Ausdruck, den er zu „Beginn<br />
der fünfziger Jahre“ 66 geschrieben hat:<br />
„Bei der Beurteilung meiner Handlungen bitte ich Sie sich vor Augen<br />
zu halten, dass ich all diese Aktionen nicht als Vabanquespieler oder<br />
Werkzeug irgendeiner Zwangslage, sondern als freier, reicher Mensch,<br />
der alles, was das Leben wertvoll macht, besaß, durchführte.“ 67<br />
In welcher Reihenfolge die Kernpunkte der Schülerreflexion über<br />
<strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong> (<strong>Schindlers</strong> Haltung; die Beschrei-<br />
64 Bei einem Vortrag vor Lehrern aus Nordrhein-Westfalen – an dem der Verfasser teilnehmen konnte – in<br />
der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem am 16.Oktober 1998 ging Yehuda Bauer ebenfalls auf<br />
<strong>Oskar</strong> Schindler ein; er charakterisierte ihn auch hier zunächst mit sehr drastischen Worten („Der Schindler<br />
war ein Schwein.“) und stellte ihn anschließend als beispielgebenden altruistischen Lebensretter dar.<br />
65 Yehuda Bauer, Rede im Deutschen Bundestag am 27.01.1998, In:.Deutscher Bundestag, Presseveröffentlichung,<br />
S. 9<br />
66 Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hrsg.), Widerstand in Deutschland 1933 – 1945. Ein historisches Lesebuch,<br />
München 1994, S. 189 – 197, hier: S. 189<br />
67 Steinbach/Tuchel, a.a.O., S. 197<br />
52
Tafelbild<br />
bung der Kriegssituation in Polen im Jahr 1944 mit ihren Auswirkungen<br />
auf die „Endlösung der Judenfrage“; <strong>Schindlers</strong> „Werten“; <strong>Schindlers</strong><br />
Werturteil und seine Normentscheidung; der Sinn seines Handelns)<br />
sich in einem Unterrichtsgespräch ergeben können, ist von untergeordneter<br />
Bedeutung und braucht daher nicht in Alternativen fiktiver<br />
Unterrichtsgespräche dargestellt zu werden.<br />
Vielmehr sollten die sich im Unterrichtsgespräch ergebenden Kernbegriffe<br />
in entsprechend großen Rechtecken als Tafelbild festgehalten<br />
werden, ohne dass dabei sogleich eine systematische Ordnung eingehalten<br />
werden müsste.<br />
Danach sollten die Schüler aufgefordert werden, diese Rechtecke einander<br />
sachlogisch zuzuordnen und diese Zuordnung zu begründen.<br />
In der folgenden Abbildung 1 werden die Kernbegriffe des Unterrichtsgesprächs<br />
in einer solchen denkbaren Zuordnung dargestellt.<br />
Plaszow to be closed.<br />
Schindler’s workers<br />
to be taken to<br />
Auschwitz.<br />
Abbildung 1: Vom Denken zum Handeln<br />
Vom Denken zum Handeln<br />
‘What is one<br />
person worth to<br />
you?’<br />
‘My people.’<br />
Transferring<br />
the factory<br />
to Brünlitz<br />
Composing<br />
the list;<br />
Saving 1100 lives<br />
The most<br />
meaningful,<br />
valuable<br />
alternative<br />
<strong>Oskar</strong> <strong>Schindlers</strong> <strong>Handlungsmotivation</strong> 53<br />
Göth: ‘Moses?’<br />
Schindler: ‘A rational<br />
human being,<br />
a free man.’<br />
Bauer: ‘A man.’