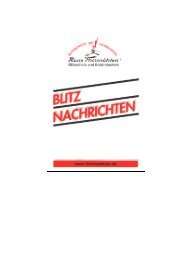Blitzschutz Reetdach
Blitzschutz Reetdach
Blitzschutz Reetdach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
1. Einleitung<br />
Reetdächer, die auch als Reith- oder Rieddächer<br />
bezeichnet werden, sind vorwiegend in Norddeutschland<br />
vorzufinden. Sie gehören zur Kategorie<br />
der Weichdächer.<br />
Bild 1:<br />
Typisches reetgedecktes Gebäude<br />
Weichgedeckte Dächer haben eine große Bedeutung<br />
im ortsgebundenen, landwirtschaftlichen Bauwesen,<br />
bei Einzelhäusern, die sich in die Landschaft<br />
einfügen sollen und in Gebieten, in denen<br />
man ausdrücklich auf das <strong>Reetdach</strong> als typisches<br />
Gestaltungsmerkmal setzt (z.B. auf Sylt). Zudem<br />
ist das Reet beliebt als Dachdeckungsmaterial für<br />
Schutzhütten, zur Überdachung von Hinweistafeln<br />
unter anderem in Erholungs- und Naturschutzgebieten.<br />
Das zur Dachdeckung verwendete Material bietet<br />
hervorragende Wärmedämmungseigenschaften,<br />
stellt jedoch durch seine Entzündlichkeit ein hohes<br />
Brandrisiko dar.<br />
Bei Blitzeinschlägen in Gebäude ohne Äußere<br />
<strong>Blitzschutz</strong>anlage entstehen fast immer Vollschäden,<br />
da das gesamte Gebäude innerhalb kurzer<br />
Zeit in Flammen steht. Die besonders hohe<br />
Packungsdichte der Reetbunde verhindert ein<br />
Eindringen des Löschwassers von außen, wodurch<br />
das Dach oftmals von innen her aufbrennt. Ein<br />
zusätzliches Risiko entsteht durch das Flugfeuer,<br />
das den Schaden auf umliegende Gebäude ausweiten<br />
kann.<br />
Zur Beherrschung dieser Risiken sind besondere<br />
Maßnahmen des <strong>Blitzschutz</strong>es zu beachten. Der<br />
Errichter des <strong>Blitzschutz</strong>systems sollte daher<br />
Kenntnis von den besonderen Eigenschaften dieser<br />
Dacheindeckung besitzen.<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Allgemeines -<br />
2. Grundsätzlicher Aufbau<br />
Die Dachunterkonstruktion besteht wie bei Ziegeldächern<br />
aus einem Tragwerk aus Holzbalken mit<br />
Sparren, auf denen die Lattung befestigt wird. Auf<br />
dieser Lattung werden dann einzelne Reetbunde<br />
befestigt. Der Fachmann bezeichnet dies als Bindung.<br />
Bild 2:<br />
Reetbunde vor der Verarbeitung<br />
14.9<br />
Seite 1 von 12<br />
In Deutschland ist das "gebundene" <strong>Reetdach</strong> weit<br />
verbreitet. Bei dieser Verlegeart werden die einzelnen<br />
Decklagen unter Verwendung eines Vorlegedrahtes,<br />
dem sogenannten Bandstock, mit Bindedraht<br />
an der Lattung befestigt. Geeignete Bandstöcke<br />
sind verzinkter Stahldraht oder Kupferdraht<br />
mit einem Durchmesser von ca. 5 mm. Aus<br />
Brandschutzgründen darf die Bindung nur mit<br />
einem nicht brennbarem Material (verzinkter Draht<br />
1 - 1,5 mm oder Kupferdraht) ausgeführt werden.<br />
Bild 3:<br />
Gebundes <strong>Reetdach</strong><br />
a - Bandstock - b - Bindedraht - c - Latte<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
Bei der Bindung der einzelnen Decklagen liegt der<br />
Bandstock etwa in der Mitte der Deckung. Bei einer<br />
typischen Gesamtdicke der Reetbunde von ca.<br />
30 cm liegen Bandstock und Bindedrähte somit ca.<br />
15 cm unterhalb der Oberfläche. Weiterführende<br />
Sekundärliteratur findet der interessierte Leser im<br />
Literaturverzeichnis.<br />
3. Firstarten von Reetdächern<br />
Als Abschluss des Daches ist der First den härtesten<br />
Witterungseinflüssen ausgesetzt. Seine Ausführung<br />
hat sehr sorgfältig zu erfolgen. Der Errichter<br />
des <strong>Blitzschutz</strong>systems muss vor der Eindeckung<br />
des Firstes die für die Fangeinrichtung<br />
erforderlichen Firstmaste setzen, so dass der verantwortliche<br />
Dachdecker diese Durchdringungen<br />
sorgfältig abdichten kann. Müssen Firstmaste z.B.<br />
bei einem bestehenden Gebäude nachträglich<br />
installiert werden, so ist der First behutsam zu öffnen<br />
und wieder abzudichten. Diese Arbeiten sollten<br />
aus Gewährleistungsgründen immer vom zuständigen<br />
Dachdecker-Fachbetrieb ausgeführt<br />
werden.<br />
Bei der Gestaltung des Firstes bedient man sich<br />
verschiedener Materialien und Methoden, die sich<br />
je nach Region und Geldbeutel deutlich unterscheiden.<br />
Gängige Methoden den First einzudecken<br />
sind der Heide- oder Sodenfirst.<br />
3.1 Heidefirst<br />
Bild 4: Gesteckter Heidefirst<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Allgemeines -<br />
Der Heidefirst wird aus geschnittenem, erdfeuchten<br />
Heidekraut geformt. Von der Firstspitze, an der<br />
der Heidefirst etwa 30 cm dick ist, verjüngt er sich<br />
zur unteren Kante auf etwa 10 cm. Zur Befestigung<br />
des Heidefirstes werden Holzpflöcke aus gespaltenem<br />
Weichholz, welche einseitig angespitzt werden,<br />
verwendet. Die Länge dieser Holzpflöcke sollte<br />
0,3 - 0,6 m, ihr Querschnitt etwa 15 - 20 mm<br />
betragen.<br />
14.9<br />
Seite 2 von 12<br />
Eine zusätzliche Bespannung des Firstes z.B. mit<br />
Kunststoffnetzen ist möglich. Je Meter Heidefirst<br />
sind etwa 100 Holzpflöcke zu verwenden. Der Errichter<br />
des <strong>Blitzschutz</strong>systems hat zu beachten,<br />
dass die Verwendung von Drahtgeflechten wie z.B.<br />
Maschendraht in Verbindung mit <strong>Blitzschutz</strong> an<br />
Gebäuden nicht zulässig ist.<br />
3.2 Sodenfirst<br />
Bild 5: Sodenfirst (Schnitt)<br />
Bild 6: Sodenfirst (Seitenansicht)<br />
Der Sodenfirst besteht aus gewachsenen Grassoden,<br />
die etwa 5 cm dick, zwischen 30 und 40 cm<br />
breit und etwa 1,30 bis 1,50 m lang sind. Auf 1 m<br />
First sollen etwa 7 bis 9 Soden verlegt werden. Der<br />
Anlegewinkel liegt zwischen 60° und 70°. Die Befestigung<br />
der einzelnen Soden erfolgt durch Hartholzpflöcke<br />
von etwa 20 bis 30 cm Länge. Jede<br />
Sode soll gepflockt sein; wenn eine zusätzliche<br />
Netzabdeckung am First vorhanden ist, ist jede<br />
zweite Sode zu pflocken. Die Verwendung von<br />
Drahtgeflechten wie z.B. Maschendraht ist in Verbindung<br />
mit <strong>Blitzschutz</strong> an Gebäuden nicht zulässig.<br />
Die Unterlage für den Sodenfirst besteht aus<br />
einer abgerundeten Reetlage. Darauf folgt eine Abdeckung<br />
aus z.B. einer besandeten Bitumenbahn<br />
oder einer Kunststoffbahn.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
3.3 Ziegelfirst<br />
In einigen Regionen Norddeutschlands wird der<br />
First mit einem gesonderten Firstdachstuhl ausgestattet,<br />
der über der letzten Reetlage angebracht<br />
ist. Dieser dient dazu den First mit Ziegeln oder<br />
einem geeigneten Wellplattenmaterial einzudecken.<br />
Bild 7:<br />
Firstdachstuhl mit Ziegeleindeckung<br />
3.4 Kupferfirst<br />
Eine Firsteindeckung, die der Vermoosung des<br />
<strong>Reetdach</strong>es entgegenwirken soll, ist die Eindeckung<br />
mit Kupferblech. Wie beim Ziegelfirst wird<br />
auch hier eine Holzkonstruktion auf der letzten<br />
Reetschicht am First benötigt, an der dann die<br />
Kupferbleche befestigt werden. Aus dekorativen<br />
Gründen, oder um der Vermoosung effektiver entgegenzuwirken,<br />
werden diese Kupferbleche oftmals<br />
auch an anderen Stellen des Daches verwendet,<br />
beispielsweise am Ortgang oder an der<br />
Kehle.<br />
Die These, dass durch das Auswaschen von Kupferionen<br />
die Vermoosung des Daches wirksam verlangsamt<br />
bzw. verhindert werden kann, ist unter<br />
den Fachleuten des Dachdeckerhandwerks umstritten.<br />
Bild 8:<br />
Vermoosung eines <strong>Reetdach</strong>es<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Allgemeines -<br />
4. <strong>Blitzschutz</strong> von Reetdächern<br />
4.1 Grundsätzlicher Aufbau<br />
14.9<br />
Seite 3 von 12<br />
Bild 9:<br />
Schemadarstellung<br />
1 Fangstange auf Holzpfahl<br />
2 Giebelstange<br />
Abstand vom Weichdach mindestens 0,4 m,<br />
Höhe über First mindestens 0,6 m<br />
3 Ableitung mit Leitungsstütze<br />
4 Traufenstütze. Entfernung<br />
vom Weichdach mindestens 0,15 m<br />
5 Spannkloben<br />
Die VDE V 0185 Teil 3 (11.02) fordert für Gebäude<br />
mit weicher Bedachung eine besondere Verlegung<br />
der Fangeinrichtung. Die Fangleitungen sind auf<br />
isolierenden Stützen frei gespannt zu verlegen. Die<br />
Abstandsmaße aus Bild 9 sind als Mindestmaße<br />
einzuhalten.<br />
Ein <strong>Blitzschutz</strong>system, das für Schutzklasse III ausgelegt<br />
ist, entspricht den normalen Anforderungen<br />
für reetgedeckte Gebäude. In besonderen Einzelfällen<br />
muss das Erfordernis zusätzlicher Maßnahmen<br />
nach VDE V 0185 Teil 2 geprüft werden.<br />
Der typische Abstand zwischen den einzelnen Ableitungen<br />
ergibt sich in Abhängigkeit von der<br />
Schutzklasse gemäß VDE V 0185 Teil 3 (11.02),<br />
Hauptabschnitt 1, Tabelle 5. Die Ausführung der<br />
Erdungsanlage ist in der VDE V 0185 Teil 3<br />
(11.02), Hauptabschnitt 1, Kapitel 4.4 festgelegt.<br />
Die Ausführung des Inneren <strong>Blitzschutz</strong>es ist in der<br />
VDE V 0185 Teil 3 (11.02), Hauptabschnitt 1, Kapitel<br />
5 festgelegt.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
14.9<br />
Seite 4 von 12<br />
Reetdächer - Normative und gesetztliche Vorgaben -<br />
4.2 Normative Verweise<br />
Gebäude mit Reetdächern gelten als besondere<br />
bauliche Anlagen. Die VDE V 0185 Teil 3 (11.02)<br />
legt im Hauptabschnitt 2, Kapitel 3.1.2 fest:<br />
"Ein <strong>Blitzschutz</strong>system, das für Schutzklasse III<br />
ausgelegt ist, entspricht den normalen Anforderungen<br />
für Gebäude mit weicher Bedachung. In<br />
besonderen Einzelfällen muss das Erfordernis<br />
zusätzlicher Maßnahmen nach VDE V 0185 Teil 2<br />
geprüft werden.<br />
3.1.2.1 Bei Dachdeckungen aus Reet, Stroh oder<br />
Schilf müssen die Fangleitungen auf isolierenden<br />
Stützen (Holzpfählen nach DIN 48812) gespannt<br />
verlegt werden. Der Abstand zwischen den Leitungen<br />
und dem First muss mindestens 0,6 m, zwischen<br />
den übrigen Leitungen auf dem Dach und<br />
der Dachhaut mindestens 0,4 m betragen. Diese<br />
Mindestabstände gelten für neuwertige Dächer. Bei<br />
der Montage eines <strong>Blitzschutz</strong>systems auf einem<br />
vorhandenen Dach sind die Abstände entsprechend<br />
größer zu wählen, so dass nach einer Neueindeckung<br />
oben angegebene Mindestabstände in<br />
jedem Fall eingehalten werden. Der Abstand von<br />
der Weichdachtraufe zur Traufenstütze darf 0,15 m<br />
nicht unterschreiten. Da die Stützen eine Schwachstelle<br />
darstellen, sind bei Firstleitungen Spannweiten<br />
bis etwa 15 m und bei Ableitungen Spannweiten<br />
bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen<br />
anzustreben.<br />
3.1.2.2 Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion<br />
(Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen<br />
und Unterlegscheiben fest verbunden<br />
werden.<br />
3.1.2.3 Oberhalb der Dachfläche befindliche metallene<br />
Teile (wie Windfahnen, Berieselungsanlagen,<br />
Leitern) müssen so befestigt werden, z. B. auf<br />
nicht leitenden Stützen, dass ein ausreichender<br />
Trennungsabstand s nach 5.3 in Hauptabschnitt 1<br />
eingehalten wird. Zuleitungen zu Berieselungsanlagen<br />
dürfen im Bereich der Durchführung durch<br />
die Dachhaut auf mindestens 0,6 m ober- und unterhalb<br />
nur aus Kunststoff bestehen.<br />
3.1.2.4 Bei Weichdächern, die mit einem metallenen<br />
Drahtnetz überzogen sind, ist ein wirksamer<br />
<strong>Blitzschutz</strong> nach 3.1.2.1 bis 3.1.2.3 nicht möglich.<br />
Das metallene Drahtgeflecht ist zu entfernen oder<br />
durch ein UV-beständiges Kunststoffnetz zu ersetzen.<br />
Ein wirksamer <strong>Blitzschutz</strong> ist ebenso wenig<br />
möglich, wenn Abdeckungen, Berieselungsanlagen,<br />
Entlüftungsrohre, Schornsteineinfassungen,<br />
Dachfenster, Oberlichter und dergleichen aus Metall<br />
vorhanden sind.<br />
In diesen Fällen ist ein wirksamer <strong>Blitzschutz</strong> nur<br />
durch einen getrennten Äußeren <strong>Blitzschutz</strong> mit<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Fangstangen neben den Gebäuden bzw. mit Fangleitungen<br />
oder Fangnetzen zwischen Masten<br />
neben den Gebäuden zu erreichen.<br />
3.1.2.5 Grenzt ein Weichdach an eine Dacheindeckung<br />
aus Metall und soll das Gebäude mit einem<br />
Äußeren <strong>Blitzschutz</strong> versehen werden, so<br />
muss zwischen dem Weichdach und dem übrigen<br />
Dach eine elektrisch nicht leitende Dacheindekkung<br />
von mindestens 1 m Breite, z. B. aus Kunststoff,<br />
eingefügt werden.<br />
3.1.2.6 Zweige von Bäumen sind in mindestens<br />
2 m Abstand vom Weichdach zu halten. Wenn<br />
Bäume dicht an einem Gebäude stehen und es<br />
überragen, muss an dem den Bäumen zugewandten<br />
Dachrand (Traufkante, Giebel) eine Fangleitung<br />
angebracht werden, die mit der <strong>Blitzschutz</strong>anlage<br />
zu verbinden ist. Die Abstände nach 3.1.2.1<br />
sind dabei einzuhalten.<br />
3.1.2.7 Antennen und Elektrosirenen sind auf<br />
weichgedeckten Dächern nicht zulässig. Antennen<br />
und elektrische Anlagen unter Dach müssen von<br />
dem Äußeren <strong>Blitzschutz</strong> den erforderlichen Trennungsabstand<br />
s einhalten.”<br />
5. Gesetzliche Vorgaben /<br />
Forderungen der Sachversicherer<br />
Ob ein <strong>Blitzschutz</strong>system zwingend vorgeschrieben<br />
ist, entscheidet die Baubehörde, die für die<br />
Genehmigung eines Bauvorhabens verantwortlich<br />
ist. Als Grundlage für diese Entscheidung dienen<br />
die Bauordnungen (BauO) der jeweiligen Bundesländer,<br />
die sich zum Thema <strong>Blitzschutz</strong> kaum voneinander<br />
unterscheiden.<br />
So führt z.B. die Niedersächsische Bauordnung<br />
(NBauO) zu diesem Thema aus:<br />
" § 20 Brandschutz<br />
(3) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart<br />
oder Benutzung Blitzschlag leicht eintreten<br />
oder zu schweren Folgen führen kann, müssen<br />
mit dauernd wirksamen <strong>Blitzschutz</strong>anlagen<br />
versehen sein.”<br />
Viele Sachversicherer fordern beim Abschluss<br />
neuer bzw. bei der Anpassung bestehender<br />
Versicherungsverträge Maßnahmen des Blitz-<br />
und Überspannungsschutzes. Grundlage hierfür<br />
ist die Richtlinie zur Schadenverhütung VDS 2010<br />
(07-02).<br />
Bestehen keine behördlichen Auflagen oder<br />
Forderungen der Sachversicherer, so liegt es im<br />
Ermessen des Bauherrn ein <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
installieren zu lassen.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
6. Besondere Gefahrenpunkte bei<br />
Reetdächern<br />
6.1. Maschendrahtüberzug<br />
Reetdächer - Gefahrenpunkte -<br />
Zum Schutz vor Vogelabtragungen werden Heide-<br />
und Sodenfirsten oftmals mit einem Maschendraht<br />
überzogen. Bei älteren Dächern ist dieser Draht<br />
leicht zu erkennen, da er dem natürlichen Verdichtungsprozeß<br />
des Materials und dem damit verbundenen<br />
Absacken des Firstes nicht folgt. Wenn der<br />
Maschendraht kunststoffumhüllt ausgeführt ist, ist<br />
er vor allem bei neueren Dächern aufgrund seiner<br />
Einfärbung oftmals schwer zu erkennen (Bild 10).<br />
Bild 10:<br />
Metallener Maschendraht am Heidefirst<br />
Gemäß VDE V 0185 Teil 3 (11.02), Hauptabschnitt<br />
2, Kapitel 3.1.2.4 ist ein wirksamer <strong>Blitzschutz</strong> nicht<br />
möglich, wenn das Dach mit einem metallenen<br />
Drahtnetz ganz oder teilweise überzogen ist. Die<br />
Fachregel für Dachdeckungen mit Reet, herausgegeben<br />
durch das Deutsche Dachdeckerhandwerk<br />
weist auf diese Problematik in Abs. 4.3.2. (4) ausdrücklich<br />
hin:<br />
"Eine zusätzliche Bespannung mit z.B. Kunststoffnetzen<br />
ist möglich. Die Verwendung von<br />
Drahtgeflechten ist in Verbindung mit <strong>Blitzschutz</strong><br />
an Gebäuden nicht zulässig.".<br />
Abschnitt 8 dieses Beitrags liefert Lösungsansätze<br />
zur Verminderung dieser Problematik.<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
14.9<br />
Seite 5 von 12<br />
6.2 Metallene Durchführungen u. Installationen<br />
Metallene Durchführungen sind nach VDE V 0185<br />
Teil 3 (11.02), Hauptabschnitt 2, Kapitel 3.1.2.3 und<br />
3.1.2.4 nicht zulässig. Neben dieser klaren Auslegung<br />
gibt es Grenzfälle, die z.B. bei einer Kaminsanierung<br />
eintreten. Wird ein gemauerter Kamin<br />
saniert, weil eine neue Heizungsanlage installiert<br />
wurde, so geschieht dies zunächst nach den Richtlinien<br />
der FEUVO (Feuerungsverordnung). Diese<br />
schreibt die Sanierung des Kamins mit einem geeigneten<br />
Werkstoff vor, der oftmals aus einem<br />
Edelstahlrohr besteht, das durch den bestehenden<br />
Kamin eingezogen wird. Hier wird eine metallene<br />
Durchführung erzeugt, die allerdings einen Abstand,<br />
entsprechend der Dicke des gemauerten<br />
Kamins, zum Weichdach aufweist.<br />
Bild 11:<br />
Sanierter Kamin mit Edelstahlrohren<br />
Abschnitt 8 dieses Beitrags liefert Lösungsansätze<br />
zur Verminderung dieser Problematik.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
6.3 Kupferbleche auf Reetdächern<br />
Die zunehmende Verwendung von Kupferblechen<br />
am First oder in der Dachfläche stellen für den Errichter<br />
eines <strong>Blitzschutz</strong>systems ein ernsthaftes<br />
Problem dar. Diese Problematik ist analog zu der<br />
des Maschendrahtüberzugs, der in der VDE V<br />
0185 Teil 3 im Hauptabschnitt 2, Kapitel 3.1.2.4<br />
einen wirksamen <strong>Blitzschutz</strong> nicht ermöglicht.<br />
Bei einem Blitzeinschlag in das <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
und dem damit entstehenden elektrischen Feld zwischen<br />
der Fangleitung und dem Erdpotential, das<br />
z.B. in Form von Niederspannungsleitungen direkt<br />
unter dem Dach liegt, wird der Kupferfirst, der zwischen<br />
dieser Anordnung liegt, dem elektrischen<br />
Feld voll ausgesetzt. Zwischen den Kupferblechen<br />
und den Niederspannungsleitungen können Teilentladungen<br />
und Überschläge erfolgen, die eine<br />
Funkenbildung zur Folge haben. Dies alles geschieht,<br />
ohne dass ein Durchschlag von der Fangleitung<br />
oder vom Ableitungsdraht auf den Kupferfirst<br />
stattgefunden hat.<br />
Bild 12:<br />
<strong>Reetdach</strong> mit Kupferfirst<br />
Reetdächer - Gefahrenpunkte -<br />
Abschnitt 8 dieses Beitrags liefert Lösungsansätze<br />
zur Verminderung dieser Problematik.<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
6.4 Binde- und Vorlegedrähte<br />
14.9<br />
Seite 6 von 12<br />
Die großflächig auf dem Dach verteilten Binde-<br />
und Vorlegedrähte weisen einen größeren Abstand<br />
zu den Fangeinrichtungen auf als die metallenen<br />
Komponenten aus den Abschnitten 6.1. und 6.3.<br />
Da die Bindedrähte vom Vorlegedraht bis unter die<br />
Lattung reichen, durchschneiden sie das bei einem<br />
Blitzeinschlag auftretende elektrische Feld senkrecht.<br />
Bei einer unmittelbar an der Lattung geführten<br />
Niederspannungsleitung sind Teilentladungen<br />
und Überschläge zwischen Bindedraht und Elektroinstallation<br />
nicht vollständig auszuschließen.<br />
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle<br />
erwähnt, dass die für den Dachstuhl verwendeten<br />
Schrauben und Nägel das gleiche Phänomen aufweisen.<br />
Bild 13:<br />
Bindedrähte an der Lattung<br />
Abschnitt 8 dieses Beitrags liefert Lösungsansätze<br />
zur Verminderung dieser Problematik.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
14.9<br />
Seite 7 von 12<br />
Reetdächer - Allgemeine Ausführungshinweise -<br />
7. Allgemeines<br />
Der wirksame <strong>Blitzschutz</strong> von reetgedeckten Gebäuden<br />
stellt sehr hohe Anforderungen an den Errichter.<br />
Aufgrund des erhöhten Brandrisikos eines<br />
Weichdaches sind besondere Maßnahmen für einen<br />
wirksamen <strong>Blitzschutz</strong> erforderlich.<br />
Ein Äußerer <strong>Blitzschutz</strong> für reetgedeckte Häuser<br />
muss nach VDE V 0185 Teil 3 (11.02) getrennt aufgebaut<br />
sein. Alle Fangleitungen und Ableitungen<br />
müssen auf Isolierstützen angebracht werden und<br />
zum Dach einen Mindestabstand von 60 cm für die<br />
Fangleitungen und 40 cm für die Ableitungen aufweisen.<br />
Die Mindestabstände von 60 bzw. 40 cm<br />
zum Dach gewährleisten einen Abstand zwischen<br />
den Dachdeckerdrähten und dem <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
von mindestens 55-60 cm. Diese Abstände<br />
müssen je nach Beschaffenheit des Daches (z.B.<br />
Kupferfirst) vergrößert werden, und zwar in dem<br />
Maße, dass stets Abstände vom <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
zu den Metallteilen von 60 cm gewährleistet sind.<br />
7.1 Erdungsanlage. Zusätzliche Hinweise<br />
Bei einem Neubau ist der Fundamenterder gemäß<br />
VDE V 0185 Teil 3 (11.02) Hauptabschnitt 1,<br />
Kapitel 4.4 und der DIN 18014 zu verlegen. Anschlussfahnen<br />
sind aus nichtrostendem Bandstahl<br />
30 x 3,5 mm (Werkstoff-Nr. 1.4571), Kabel NYY-<br />
I 50 mm² oder nichtrostendem Rundstahl Ø 10 mm<br />
(Werkstoff-Nr. 1.4571) auszuführen.<br />
Bei der Installation des <strong>Blitzschutz</strong>systems an<br />
einem bestehenden Gebäude ist eine Ringleitung<br />
aus verzinktem Bandstahl 30 x 3,5 mm, verzinktem<br />
Rundstahl Ø 10 mm oder vorzugsweise aus nichtrostendem<br />
Bandstahl 30 x 3,5 mm (Werkstoff-Nr.<br />
1.4571) in einem Erdgraben von 0,5 m Tiefe zu verlegen.<br />
Ist eine geschlossene Ringleitung aus baulichen<br />
Gründen nicht möglich, so sind Teilringleitungen<br />
zu verlegen und bei Bedarf durch Erderanordnung<br />
des Typs A (Tiefenerder) zu verbessern. Ein<br />
geschlossener Ring kann auch durch Verbindungsleitungen<br />
(z.B. durch den Keller) erfolgen.<br />
Es wird empfohlen eine einzige integrierte Erdungsanlage<br />
auszuführen, die für alle Zwecke<br />
(<strong>Blitzschutz</strong>-, Niederspannungs- und Fernmeldeanlagen)<br />
geeignet ist. Der Wert des Erdausbreitungswiderstandes<br />
sollte höchstens 10 Ohm betragen.<br />
Bei Moor-, Marsch- und Lehmböden sind<br />
Erdausbreitungswiderstände kleiner oder gleich<br />
2 Ohm möglich und daher anzustreben.<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
7.2 Fangeinrichtung. Zusätzliche Hinweise<br />
Bei Firstleitungen sind Spannweiten von 8 bis<br />
10 m, bei Ableitungen Spannweiten von 4-6 m<br />
ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Die<br />
Stützen stellen aus folgenden Gründen eine<br />
Schwachstelle dar:<br />
l ihr Isolierfaktor (km) ist geringer als der einer<br />
Luftstrecke<br />
l herablaufendes Regenwasser kann die<br />
Kriechstrecke verringern<br />
Die Fangleitung sollte in verzinktem Runddraht<br />
oder Rundkupfer (beide in Ø 8 mm) ausgeführt werden.<br />
Kupfer ist zu bevorzugen, da es in seiner<br />
Wertigkeit besser zu einem <strong>Reetdach</strong> passt. Von<br />
der Verwendung von Rundaluminium (Ø 8 mm)<br />
wird abgeraten, da dieser aufgrund seines höheren<br />
Ausdehnungskoeffizienten reißen und / oder bei<br />
Windeinwirkung Geräusche verursachen kann.<br />
Die Isolierstützen bestehen im allgemeinen aus<br />
einem witterungsfesten Hartholz (z.B. Bongossi,<br />
90x90 mm). Es ist auch möglich, andere Isolierstoffe<br />
(z.B. PVC) zu verwenden. Die Firststützen<br />
sind mit der Dachkonstruktion gemäß folgender<br />
Bilder fest mit Durchgangsbolzen zu verbinden.<br />
Bild 14: Befestigung an der Firstfette<br />
Bild 15: Detail Halteschutz zu Bild 14<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
14.9<br />
Seite 8 von 12<br />
Reetdächer - Allgemeine Ausführungshinweise -<br />
7.4 Ableitungen<br />
Die Anzahl der Ableitungen richtet sich nach der<br />
Schutzklasse des <strong>Blitzschutz</strong>systems. Wird die<br />
Schutzklasse III ausgeführt, so sind die Ableitungen<br />
im typischen Abstand von 15 m zu verlegen.<br />
Sie sind so anzuordnen, dass sie auf kürzestem<br />
Wege zur Erdungsanlage führen. Die Anordnung<br />
der Ableitungen ist so zu gestalten, dass sie ausgehend<br />
von den Ecken des Gebäudes möglichst<br />
gleichmäßig auf den Umfang verteilt sind. Je nach<br />
den baulichen Besonderheiten (Veranden, Gauben<br />
u.a.) dürfen die gegenseitigen Abstände unterschiedlich<br />
groß sein.<br />
Bild 16:<br />
Befestigung am Hahnebalken<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
7.5 Innerer <strong>Blitzschutz</strong><br />
Da es sich bei Reetdächern um besondere Anlagen<br />
mit hohem Brandrisiko handelt, ist dem Inneren<br />
<strong>Blitzschutz</strong> gemäß VDE V 0185 Teil 3, Hauptabschnitt<br />
1, Kapitel 5 besondere Beachtung zu<br />
schenken. Besonders im Hinblick auf die Einhaltung<br />
der Trennungsabstände ("Näherungen") ist<br />
der Innere <strong>Blitzschutz</strong> fester Bestandteil eines<br />
<strong>Blitzschutz</strong>systems von Reetdächern.<br />
Hierzu zählt u.a. der Einbau eines Blitzstromableiters<br />
(Überspannungsschutzgerät der Klasse I, ehemals<br />
Anforderungsklasse B). Weitere Ausführungsbestimmungen<br />
sind im Kapitel 9.1 dieses Handbuches<br />
enthalten.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
8. Fallbeispiele<br />
8.1 <strong>Reetdach</strong> mit Heide- oder Sodenfirst<br />
Bild 17:<br />
<strong>Reetdach</strong> mit Heidefirst<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Fallbeispiele -<br />
Bei der Installation des <strong>Blitzschutz</strong>systems dürfen<br />
die Mindestabstände der isolierten Fangleitung<br />
(60 cm Abstand zum First) und der Ableitungen<br />
(40 cm Abstand zur Dachfläche) nach VDE V 0185<br />
Teil 3 zu keinem Zeitpunkt unterschritten werden.<br />
Da das Firstmaterial einem natürlichen Verrottungsprozess<br />
unterliegt, muss bei der Nachrüstung<br />
einer <strong>Blitzschutz</strong>anlage beachtet werden, dass alle<br />
8 bis 10 Jahre der First "aufgefrischt" werden<br />
muss. Auch nach dieser Nachbessern des Firstes<br />
mit Heidekraut oder Grassoden dürfen die o.g. Abstände<br />
nicht unterschritten werden.<br />
Zum Schutz des Firstes vor Vogelabtragungen ist<br />
dieser oftmals mit einem metallenen Maschendraht<br />
abgedeckt. Der Errichter des <strong>Blitzschutz</strong>systems<br />
hat darauf hinzuweisen, dass dieses metallene<br />
Drahtgeflecht entfernt oder gegen ein Kunststoffnetz<br />
ausgetauscht wird. Neben der VDE V 0185<br />
Teil 3, Hauptabschnitt 2, Kapitel 3.1.2.4 ergibt sich<br />
diese Verpflichtung auch aus der Fachregel für<br />
Dachdeckungen mit Reet des Deutschen Dachdeckerhandwerkes<br />
gemäß Abschnitt 4.3.2.(4). Der<br />
Heide- oder Sodenfirst kann mit einem UV-beständigem<br />
Kunststoff- bzw. Nylonnetz geschützt werden.<br />
Ein Beispiel für ein solches Firstschutznetz ist<br />
das Netz SN 50/2 aus hochfestem Nylonnetzwerk,<br />
olivgrün, UV-stabilisierend imprägniert und mit<br />
Flammschutzfaktor ausgerüstet.<br />
14.9<br />
Seite 9 von 12<br />
Bild 18:<br />
UV-beständiges Kunststoffgeflecht als Ersatz des<br />
metallenen Maschendrahtes<br />
8.2. <strong>Reetdach</strong> mit Ziegelfirst<br />
In einigen Regionen Norddeutschlands ist es weit<br />
verbreitet, den First des <strong>Reetdach</strong>es mit 3 bis 4<br />
Reihen Ziegeln einzudecken, den sogenannten<br />
Ziegelfirst. Der Ziegelfirst darf blitzschutztechnisch<br />
nicht als Hartbedachung gedeutet werden. Würde<br />
er als eine solche gelten, wären die Mindestabstände<br />
nach VDE V 0185 Teil 3 nicht erforderlich,<br />
und auf dem First könnte die Fangleitung unmittelbar<br />
auf den Firstpfannen montiert werden.<br />
Da sich unmittelbar unter dem Ziegelfirst das Reet<br />
mit seinen Dachdeckerdrähten befindet, ist es<br />
auch aus Sicht des <strong>Blitzschutz</strong> als Weichdach bzw.<br />
Weichdachfirst anzusehen. Das bedeutet, dass die<br />
Mindestabstände nach VDE V 0185 Teil 3 (Fangleitungen<br />
60 cm Abstand zum First und Ableitung 40<br />
cm Abstand zur Dachfläche) einzuhalten sind.<br />
Bild 19:<br />
<strong>Reetdach</strong> mit Ziegelfirst<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
8.3. <strong>Reetdach</strong> mit Kupferblechen<br />
Zunehmend finden sich Reetdächer, bei denen<br />
Kupferbleche am First und auf der Dachfläche verlegt<br />
sind. Diese Bleche sollen neben ihrer dekorativen<br />
Wirkung der Vermoosung des <strong>Reetdach</strong>es entgegenwirken.<br />
Bild 20:<br />
<strong>Reetdach</strong> mit Kupferfirst<br />
Beim <strong>Blitzschutz</strong> für derartige Gebäude mit Kupferfirst<br />
ist folgendes zu beachten:<br />
l Näherungen zu geerdeten Teilen sind unter<br />
allen Umständen auszuschließen. Dies betrifft<br />
im besonderen die Näherungen zu innen verlegten<br />
geerdeten Installationen (Heizungsrohre,<br />
Niederspannungsleitungen). Diese sind unter<br />
keinen Umständen im Gebäude in Bereichen<br />
der Fangleitungen zu verlegen<br />
l Die einzelnen Kupferbleche sind elektrisch leitend<br />
miteinander zu verbinden. Hier genügt es<br />
die einzelnen Bleche durch Schrauben untereinander<br />
zu verbinden.<br />
l Der Kupferfirst darf auf keinen Fall direkt mit<br />
der Fangleitung des <strong>Blitzschutz</strong>systems verbunden<br />
werden.<br />
l Die Mindestabstände für die Fangleitungen<br />
und für die Ableitungen sind zu erhöhen. Für<br />
die Fangleitung wird mindestens 80 cm Abstand<br />
zum Kupferfirst und bei den Ableitungen wird<br />
mindestens 60 cm Abstand von Ableitung zum<br />
Kupferfirst empfohlen.<br />
l Der Einsatz von Isolierstützen wird empfohlen,<br />
siehe Abschnitt 9.<br />
8.4 Saniertes Wellblech-<strong>Reetdach</strong><br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Fallbeispiele -<br />
Reetdächer werden mit der Zeit undicht. Je nach<br />
Pflege des Daches und den Witterungsbedingungen<br />
soll ein <strong>Reetdach</strong> in Abständen von 40 bis 60<br />
Jahren erneuert werden. Da dies eine kostspielige<br />
Angelegenheit ist, werden diese Dächer nicht selten<br />
aus Kostengründen mit einem preiswerteren<br />
Material saniert. Auf das schon bestehende Weichdach,<br />
das wegen seiner hervorragenden wärme-<br />
14.9<br />
Seite 10 von 12<br />
dämmenden Eigenschaften bestehen bleibt, werden<br />
ca. 1 - 1,5 mm dicke kunststoffbeschichtete<br />
Wellblechplatten (Aluminium oder Stahlblech) befestigt.<br />
Bild 21:<br />
Wellblech-saniertes <strong>Reetdach</strong><br />
Beim <strong>Blitzschutz</strong> für derartige Gebäude mit Wellblech<br />
ist folgendes zu beachten:<br />
l Näherungen zu geerdeten Teilen sind unter<br />
allen Umständen auszuschließen. Dies betrifft<br />
im besonderen die Näherungen zu innen verlegten<br />
geerdeten Installationen (Heizungsrohre,<br />
Niederspannungsleitungen). Diese sind unter<br />
keinen Umständen im Gebäude in Bereichen<br />
der Fangleitungen zu verlegen<br />
l Die einzelnen Wellblechplatten sind elektrisch<br />
leitend miteinander zu verbinden. Es genügt die<br />
einzelnen Bleche durch Blechschrauben miteinander<br />
zu verbinden.<br />
l Das Wellblechdach ist mit einer Kupferleitung<br />
der Querschnittsfläche von 16 mm² am Tiefpunkt<br />
an den Potentialausgleich anzubinden.<br />
Bei großen Dächern ist es ratsam, das Blechdach<br />
von zwei Stellen aus an den Potentialausgleich<br />
anzubinden.<br />
l Das Wellblechdach darf auf keinen Fall direkt<br />
mit der Fangleitung oder der Ableitung des<br />
<strong>Blitzschutz</strong>systems verbunden werden.<br />
l Die Mindestabstände für die Fangleitung und<br />
für die Ableitung sollten erhöht werden. Für die<br />
Fangleitung sollte mindestens 80 cm Abstand<br />
zum Wellblech und bei den Ableitungen mindestens<br />
60 cm Abstand zwischen Ableitung und<br />
Wellblech eingehalten werden.<br />
Eine bessere Methode der kostengünstigen Sanierung<br />
ist es auf Wellblechplatten zu verzichten und<br />
stattdessen PVC oder andere nichtmetallische Materialien<br />
zu verwenden. Bei diesen Materialien tritt<br />
keine Näherungsproblematik auf. Bei der Verwendung<br />
von PVC-Wellplatten für die Installation des<br />
<strong>Blitzschutz</strong>systems sind die Abstände nach VDE V<br />
0185 Teil 3 (Fangleitung 60 cm, Ableitung 40 cm<br />
über dem Dach) ausreichend.<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
8.5 Der Kamin<br />
Der Kamin tritt bei Weichdächern immer am First<br />
aus dem Dach heraus und soll gemäß Feuerungsverordnung<br />
(FEUVO) mindestens 80 cm über dem<br />
First liegen. Dies bedeutet für den <strong>Blitzschutz</strong>,<br />
dass die Fangleitung an beiden Seiten um den<br />
Kamin herumgeführt werden muss. Solange am<br />
oder im Kamin keine Metallteile vorhanden sind, ist<br />
es auch problemlos möglich, die Fangleitung direkt<br />
am Kamin zu befestigen.<br />
Bild 22:<br />
Leitungsführung am Kamin<br />
Zum Schutz vor Direkteinschlägen ist es erforderlich,<br />
den Kamin mit einer Fangstange zu versehen.<br />
Diese Fangstange überragt den Kamin. Der<br />
Schutzwinkel nach VDE V 0185 Teil 3 ist einzuhalten.<br />
8.6 Kaminsanierung<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Fallbeispiele -<br />
Alte Kamine werden saniert, indem durch den bestehenden<br />
gemauerten Kamin ein Edelstahlrohr<br />
eingezogen wird. Dieses Rohr, das eine metallene<br />
Dachdurchführung darstellt, stellt an das <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
besondere Anforderungen. Wird<br />
eine Kaminsanierung durchgeführt, so ist zugleich<br />
ein bereits vorhandenes <strong>Blitzschutz</strong>system angemessen<br />
zu verändern.<br />
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:<br />
l Das Edelstahlrohr ist am Tiefpunkt (Erdgeschoss,<br />
Keller) an den Potentialausgleich anzuschließen.<br />
l Auf keinen Fall darf das Edelstahlrohr mit den<br />
Fangleitungen oder mit den Ableitungen des<br />
<strong>Blitzschutz</strong>systems direkt verbunden werden.<br />
l Die Fangleitung auf dem First ist in ausreichend<br />
großem Abstand (60 cm) an dem Edelstahlrohr<br />
vorbeizuführen. Wenn die Dicke der Kaminmauer<br />
nicht ausreicht, sind Isolierstützen zu<br />
14.9<br />
Seite 11 von 12<br />
verwenden, an denen die Fangleitung befestigt<br />
und auf Abstand gehalten wird. Als Isolierstützen<br />
sollten bevorzugt Kunststoff- oder GFK-<br />
Stützen (Glasfaser verstärkter Kunststoff) verwendet<br />
werden.<br />
l Ebenfalls in ausreichendem Sicherheitsabstand<br />
(60 cm) ist eine Fangstange zu montieren, die<br />
an die Fangleitung angeschlossen wird und den<br />
gesamten Kaminbereich schützt (vgl. Schutzbereich<br />
einer Fangstange).<br />
8.7 Näherungsprobleme durch nicht fachgerechte<br />
Installation der Niederspannungskabel<br />
Näherungen, die durch Kreuzungen der Ableitungen<br />
des <strong>Blitzschutz</strong>systems und der elektrischen<br />
Installation des Hauses hervorgerufen werden,<br />
sind ein nicht zu unterschätzendes Problem. Die<br />
Näherungen treten häufig an der Traufe auf. Die<br />
metallenen Traufenstützen, die die Ableitungsdrähte<br />
spannen, werden direkt an der Hauswand<br />
befestigt. Werden Niederspannungsleitungen z.B.<br />
für Außenbeleuchtungen, Alarmtechnik oder<br />
Brandmeldeanlagen so geführt, dass der Trennungsabstand<br />
unterschritten wird, so ist im Fall einer<br />
Blitzentladung mit direkten Überschlägen und<br />
Funkenbildung bzw. Einkopplungen in diese Leitungen<br />
zu rechnen. Um dies zu vermeiden, ist es<br />
dringend erforderlich, einen Trennungsabstand zwischen<br />
den Leitungen und dem Ableitungsdraht<br />
bzw. der Traufenstütze einzuhalten. Dieser Trennungsabstand<br />
kann nach VDE V 0185 Teil 3<br />
berechnet werden, in der Praxis gilt als Faustformel<br />
der Mindestabstand von 0,5 m. Da derartige<br />
Installationen häufig nachträglich durchgeführt werden,<br />
sind regelmäßige Sichtprüfungen erforderlich.<br />
Bei einer solchen Sichtprüfung können Fehler, die<br />
sich im Laufe der Zeit eingestellt haben, erkannt<br />
und behoben werden, was den einwandfreien<br />
Betrieb des <strong>Blitzschutz</strong>systems gewährleistet.<br />
Eine Entschärfung dieser Näherungsproblematik<br />
an der Traufe ist durch den Einsatz von Traufenstützen<br />
mit einer eingebauten Isolierstrecke möglich<br />
(siehe Abschnitt 9).<br />
Stand 04/03
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Genehmigung vom<br />
9. Entwicklung neuer Stützen und<br />
Abstandshalter<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Reyno Thormählen<br />
Reetdächer - Isolierstützen -<br />
Ein wesentlicher Aspekt eines isolierten <strong>Blitzschutz</strong>systems<br />
sind die Isolierstützen auf dem<br />
Dach. Das sind die <strong>Blitzschutz</strong>maste zur Befestigung<br />
der Fangleitung auf dem First, die Schrägstützen<br />
zur Befestigung der Ableitung auf dem<br />
Dach und die Traufenstützen zum Spannen der<br />
Ableitung unter der Traufe. Bei den Dach- und<br />
Firststützen handelt es sich ausschließlich um<br />
Holzstützen aus Hartholz (Eichen- oder Bongossiholz).<br />
Wenn das Holz durchnässt ist und das<br />
Wasser infolge starken Regens an den Seiten dieser<br />
Stützen herunterläuft, ist die Isolationswirkung<br />
dieser "Holzisolatoren" relativ schlecht.<br />
Die Traufenstützen, die aus einem verzinkten Stahl<br />
hergestellt sind, weisen überhaupt keine Isolationswirkung<br />
auf. Dies kann im Fall eines Blitzeinschlags<br />
zu Näherungen führen.<br />
Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Autor in<br />
Verbindung mit einem namhaften Hersteller an der<br />
Verbesserung der Wirksamkeit dieser <strong>Blitzschutz</strong>bauteile<br />
gearbeitet. Um die Gefahr von direkten<br />
Überschlägen zu reduzieren, wurden die Firststützen,<br />
Schrägstützen und die Traufenstützen mit<br />
Isolierstrecken versehen.<br />
Bild 23:<br />
Traufenstütze mit 1kV-Stützisolator<br />
Bild 24:<br />
Firststütze mit 20kV-Stützisolator<br />
14.9<br />
Seite 12 von 12<br />
Die Hersteller arbeiten an Stützen aus glasfaserverstärktem<br />
Kunststoffen (GFK), die folgende Eigenschaften<br />
aufweisen:<br />
l Verbesserung des Isolierfaktors k m<br />
l Hohe Zugbelastbarkeit<br />
l Geringeres Gewicht als bei den Holzstützen<br />
(Montageerleichterung)<br />
Bis zum Redaktionsschluss lagen seitens der<br />
Hersteller noch keine handelsüblichen Bauteile<br />
vor.<br />
Stand 04/03