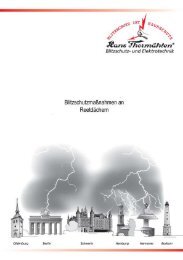2000-2005 - Hans Thormählen GmbH & Co
2000-2005 - Hans Thormählen GmbH & Co
2000-2005 - Hans Thormählen GmbH & Co
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1 Wie entsteht ein Gewitter? .......................................................................................... 5<br />
2 Welche Gefahren bestehen für Mensch und Tier? .................................................... 5<br />
2.1 Gefahren bei einem Direkteinschlag ......................................................................... 5<br />
2.2 Gefahren bei einem Naheinschlag............................................................................ 6<br />
2.3 Was bedeuten Spannungstrichter und Schrittspannung? ......................................... 6<br />
3 Was kostet Sicherheit? ................................................................................................ 6<br />
4 Ist eine Blitzschutzanlage notwendig?....................................................................... 7<br />
4.1 Wann wird eine Blitzschutzanlage gefordert? ........................................................... 8<br />
5 Wie ist eine Blitzschutzanlage aufgebaut? ................................................................ 8<br />
6 Fundamenterder ......................................................................................................... 10<br />
6.1 Zuständigkeiten für die Verlegung .......................................................................... 10<br />
6.2 Die Funktion des Fundamenterders........................................................................ 10<br />
7 Blitzschutz besonderer Anlagen ............................................................................... 11<br />
7.1 Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen ..................................................................... 11<br />
7.2 Blitzschutz von Solarkollektoren ............................................................................. 12<br />
7.3 Blitzschutz von Reithdächern.................................................................................. 13<br />
7.4 Blitzschutz von Kirchen........................................................................................... 14<br />
7.5 Blitzschutz von Dachaufbauten auf modernen Verwaltungsgebäuden.................... 15<br />
8 Der Schutz vor Schäden durch Überspannungen ................................................... 16<br />
8.1 Anwendungsbeispiel: ÜSS am Telekommunikationsanschluß................................ 18<br />
9 Das Schutz-Management ........................................................................................... 20<br />
9.1 Vorgehensweise...................................................................................................... 20<br />
10 Prüfungen von Blitzschutzsystemen..................................................................... 21<br />
10.1 Anwendungsbereich................................................................................................ 21<br />
10.2 Prüfintervalle ........................................................................................................... 21<br />
11 Weitere Fragen? ...................................................................................................... 22<br />
12 Auszug aus unserer Referenzliste......................................................................... 23<br />
13 Informationen über unsere Firma und ihre Geschäftsstellen ............................. 24<br />
13.1 Qualifikationen und Mitgliedschaften....................................................................... 24<br />
13.2 Anschriften und Kontakte........................................................................................ 24<br />
4
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
1 Wie entsteht ein Gewitter?<br />
Voraussetzung für ein Gewitter sind feuchte instabile Luftmassen. Steigen diese<br />
auf, so bilden sich Gewitterzellen mit einem Durchmesser von bis zu drei Kilometern.<br />
Ab einer Höhe von etwa fünf Kilometern, der Nullgradgrenze, entstehen in<br />
der Wolke Eiskristalle, die bis in Höhen von 10-12 Kilometern getragen werden.<br />
Bei der Entstehung der Eiskristalle erfolgt eine Ladungstrennung innerhalb der<br />
Gewitterwolke. Der obere Teil besteht aus positiver, der untere Teil aus negativer<br />
Ladung. Werden nun zwischen dem unteren Teil der Wolke und der positiv geladenen<br />
Erde Feldstärken von einigen 100.000 Volt pro Meter erreicht, erfolgt ein gewaltiger<br />
Kurzschluß, der Blitz.<br />
Aber nur etwa ein Drittel aller Blitze erreichen die Erde, der restliche Ladungsausgleich<br />
erfolgt innerhalb der Wolke. Diese als Wetterleuchten bezeichneten Wolke-<br />
Wolke-Blitze sind nur seitlich vom Gewitter zu sehen.<br />
Dem ruckartig zur Erde vorstoßenden Blitz wächst vom Erdboden (meist aus Spitzen<br />
und Kanten) eine Fangladung bis in ca. 40 m Höhe entgegen. Nach dem Zusammentreffen<br />
des ruckartig vorwachsenden Leitblitzes und der Fangladung<br />
erfolgt der Ladungsausgleich.<br />
Negative Wolke-Erde-Blitze (ca. 90% aller Blitze) bestehen aus mehreren Teilblitzen.<br />
Dabei fließen Ströme von ca. 20.000 bis 40.000 Ampere für die Zeit einiger<br />
Mikrosekunden pro Entladung. Vereinzelt wurden auch schon Stromstärken von<br />
500.000 Ampere gemessen. Die positiven Wolke-Erde-Blitze aus dem oberen Bereich<br />
der Wolke bergen die größeren Gefahren, da ein hoher Dauerstromfluß bis<br />
zu einigen 100 Millisekunden bestehen bleibt. Die selten vorkommenden Erde-<br />
Wolke-Blitze, die meist nur von hohen Gebäuden, wie Kirchen und Hochhäusern<br />
oder von Bergspitzen ausgehen, sind an den in Richtung Wolke gerichteten<br />
Verästelungen zu erkennen.<br />
Man unterscheidet im wesentlichen drei verschiedene Arten von Gewittern.<br />
Wärmegewitter entstehen bei starker Sonneneinstrahlung, die die feuchte Luft<br />
zum Aufsteigen zwingt.<br />
Frontgewitter kann man auch als Ganzjahresgewitter bezeichnen, sie können zu<br />
jeder Jahreszeit auftreten. Bei Frontgewittern schieben sich kalte Luftmassen unter<br />
die wärmeren bodennahen Luftschichten und zwingen sie aufzusteigen. Die<br />
Kaltluft kann aus einer tätigen Gewitterwolke stammen (mit dem Niederschlag wird<br />
Kaltluft nach unten befördert und tritt auch gegen den Bodenwind aus), oder sie<br />
stammt von einem Kaltlufteinbruch.<br />
Orographisches Gewitter. Bei dieser Gewitterart werden feuchtlabile Luftströme<br />
durch das Gelände (Berge oder Gebirgsketten) zum Aufsteigen gezwungen.<br />
2 Welche Gefahren bestehen für Mensch und Tier?<br />
2.1 Gefahren bei einem Direkteinschlag<br />
Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, so fließt der Blitzstrom - bedingt durch die<br />
Feuchtigkeit der Haut und der Kleidung- in den meisten Fällen über die Außenfläche<br />
des Körpers zur Erde ab. Dabei kommt es bei den Blitzopfern zu Verbren-<br />
5
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
nungen. Fließt ein Blitzstrom jedoch durch den menschlichen Körper, kann dieser<br />
Strom zu Bewußtlosigkeit, Atemstillstand, Lähmungen und zum Herzstillstand führen.<br />
Schon ein Stromfluß von 0,00001 Ampere über den Herzmuskel kann zum<br />
Tod durch Herzkammerflimmern führen.<br />
2.2 Gefahren bei einem Naheinschlag<br />
Auch ein in der Nähe einschlagender Blitz kann für den Menschen gefährlich sein.<br />
Beim Einschlag in einen Baum, Mast oder ein Gebäude kann der Blitz auf die Personen<br />
in unmittelbarer Nähe überspringen. Werden Gegenstände (Metall, Holz,<br />
Stein oder Mauerwerk) im Moment des Blitzeinschlags berührt, kann dies für Menschen<br />
oder Tiere eine tödliche Gefahr bedeuten. Ein Teilblitzstrom fließt dabei<br />
über den Körper zur Erde.<br />
2.3 Was bedeuten Spannungstrichter und Schrittspannung?<br />
Fließt ein Blitzstrom in das Erdreich ab oder trifft der Blitz den Erdboden, verteilt<br />
sich der Strom im Erdreich<br />
in alle Richtungen. Bei dieser<br />
Stromverteilung im Erdreich<br />
entsteht an der Erdoberfläche<br />
ein sogenannter<br />
Spannungstrichter.<br />
Befindet sich in diesem<br />
6<br />
1m<br />
1m<br />
US = Gefährdung durch Schrittspannung<br />
Spannungstrichter ein<br />
Mensch oder ein Tier, so<br />
können durch den Schritt<br />
des Menschen oder den<br />
Beinabstand des Tiers unterschiedliche<br />
Potentiale<br />
überbrückt werden. Diese<br />
sogenannte Schrittspannung<br />
führt dann zu einem<br />
Stromfluß durch den Kör-<br />
per des Lebewesens. Beim Menschen kann dieser Stromfluß zu Lähmungen oder<br />
unkontrollierten Reaktionen der Muskulatur führen (Personen können durch die<br />
plötzliche Verkrampfung der Muskeln mehrere Meter weit geschleudert werden).<br />
Dies bedeutet eine besonders große Gefahr im Gebirge. Für Tiere, die sich in einem<br />
Spannungstrichter befinden, ist dieser Stromstoß meist tödlich. Die Tiere<br />
überbrücken durch ihren größeren Beinabstand größere Spannungsunterschiede,<br />
was einen höheren Stromfluß über den Körper des Tiers zur Folge hat. Tiere sind<br />
ferner noch wesentlich empfindlicher gegen die Wirkungen des elektrischen<br />
Stroms.<br />
3 Was kostet Sicherheit?<br />
Wenn die Bauherren wüßten, wie preiswert eine Blitzschutzanlage bei einem Neubau<br />
ist, würden sicherlich heute die meisten Neubauten eine Blitzschutzanlage<br />
erhalten. Für die Elektroanlage muß ein sogenannter Fundamenterder in der<br />
US<br />
US<br />
Quelle: ABB
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Bodenplatte oder im Streifenfundament verlegt werden. Über eine Anschlußfahne<br />
ist der Fundamenterder mit dem Potentialausgleich des Hauses verbunden. Dieser<br />
Fundamenterder kann zugleich als Erdung für die Blitzschutzanlage verwendet<br />
werden. Für eine Blitzschutzanlage bei einem Neubau brauchen lediglich die erforderlichen<br />
Anschlußfahnen von diesem Fundamenterder in der Betonwand bis über<br />
das Erdniveau verlegt zu werden. Die Mehrkosten für diese Anschlußfahnen bewegen<br />
sich zwischen DM 100,- und DM 500,-. Je nach Größe des Hauses wird die<br />
Errichtung der äußeren Blitzschutzanlage durch eine Fachfirma dann nur noch ca.<br />
DM 1.500,- bis DM 4.000,- (für ein normales Einfamilienhaus) kosten. Eine ordnungsgemäß<br />
errichtete Blitzschutzanlage schützt nicht nur das Gebäude vor Beschädigung<br />
oder Zerstörung, die Blitzschutzanlage bedeutet vor allem für die Personen<br />
und die elektrischen Einrichtungen im Haus eine Sicherheit vor den Auswirkungen<br />
eines Blitzschlags. Keine Versicherung wird die Aufregung, die Ängste und<br />
den Ärger, die durch Blitzschlag bei einem Gebäude ohne Blitzschutzanlage entstehen,<br />
übernehmen oder ersetzen. Beim Aufziehen eines Gewitters sollte man,<br />
falls das Stromnetz und die elektronischen Verbraucher nicht durch sogenannte<br />
Überspannungsschutz-Geräte geschützt sind (innerer Blitzschutz ist nicht vorhanden),<br />
die Antennenleitung und die Netzstecker aller elektronischen Geräte<br />
(Fernseher, Videogerät, PC, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, usw.) aus<br />
der Steckdose ziehen. Nahezu alle diese Geräte sind sehr empfindlich gegen<br />
Überspannung, daher kann schon die Überspannung eines in 2 Kilometern im<br />
Umkreis einschlagenden Blitzes diese Geräte zerstören. Die Versicherungen<br />
ersetzen solche Schäden nur, wenn diese sogenannten Überspannungsschäden<br />
ausdrücklich mitversichert sind oder eine eigene Versicherung dafür<br />
abgeschlossen wurde.<br />
(Auszug aus: Reinhard Schüngel: „Blitze-Gefahren, Schutzmaßnahmen“, Branddirektion München,<br />
<strong>2000</strong>)<br />
4 Ist eine Blitzschutzanlage notwendig?<br />
Seit über 250 Jahren gibt es Blitzschutzanlagen auf Gebäuden. Sie sorgen dafür,<br />
daß im Falle eines Direkteinschlages der Blitzstrom gefahrlos zur Erde abgeleitet<br />
werden kann und somit keine Brände oder sonstigen Schäden entstehen.<br />
Unabhängig von behördlichen Auflagen sollten Gebäude auf jeden Fall eine Blitzschutzanlage<br />
erhalten,<br />
wenn sie ihre Umgebung deutlich überragen, wie Gebäude auf Bergkuppen,<br />
Hochhäuser, Türme, Schornsteine u.ä.<br />
wenn sie eine weiche Dacheindeckung aus Reet oder Holz besitzen oder<br />
leichtentflammbare Materialien im Dachbereich eingebaut sind<br />
wenn brand- und explosionsgefährliche Stoffe gelagert werden oder<br />
Gefahren von Industrieanlagen ausgehen<br />
wenn bei der Nutzung leicht Panikgefahr eintreten kann<br />
wenn Mensch und Kulturgüter in besonderer Weise zu schützen sind.<br />
Wenn keine besonderen Verordnungen vorliegen, ist die Errichtung einer Blitzschutzanlage<br />
eine freiwillige Entscheidung des Gebäudeeigentümers.<br />
7
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
In Deutschland sind in der Regel nur Schäden, die durch direkte Blitzschläge entstehen,<br />
z.B. Brände, Explosionen oder Schäden durch Krafteinwirkung, versicherbar.<br />
Indirekte Blitzschäden und daraus resultierende Kurzschluß- und Überspannungsschäden<br />
an elektrischen und elektronischen Einrichtungen werden dagegen<br />
häufig nicht versichert.<br />
4.1 Wann wird eine Blitzschutzanlage gefordert?<br />
Die Bauordnungen der Länder schreiben für Gebäude<br />
besonderer Bauart und Nutzung Blitzschutzanlagen<br />
vor. Dieses sind im wesentlichen Gebäude, in denen<br />
Panikgefahr besteht, wie z.B.<br />
8<br />
Hochhäuser<br />
Geschäftshäuser und Verkaufsstätten<br />
Versammlungsstätten und Gaststätten<br />
Büro- und Verwaltungsgebäude<br />
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime<br />
Schulen, Kindergärten und Sportstätten<br />
Auch bauliche Anlagen, von denen Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen, wie<br />
beispielsweise Anlagen mit Brand-, Explosionsgefahr oder kerntechnische Anlagen,<br />
müssen mit einem wirksamen Blitzschutz versehen werden.<br />
Weitere Anlagen und Gebäude, bei denen nach Bauart und Nutzung Blitzschlag<br />
leicht eintreten und zu schweren Folgen führen kann, sind:<br />
Brand- oder explosionsgefährdete Anlagen, z.B. Holzbearbeitungsbetriebe,<br />
Mühlen, Farbenfabriken, Munitions-, Feuerwerks und Zündholzfabriken,<br />
Lager brennbarer Flüssigkeiten und Gasbehälter<br />
größere oder einzeln stehende landwirtschaftliche Gebäude<br />
Gebäude mit weicher Bedachung<br />
Versammlungsstätten oder Gebäude für größere Menschenansammlungen<br />
(Kirchen, Theater, Flughäfen, Lichtspieltheater, Schulen, Konzert-, Sporthallen,<br />
Gefängnisse, Kasernen, sonstige Fabriken, Großgaragen, Krankenhäuser,<br />
Hotels, Bahnhöfe, Warenhäuser)<br />
Gebäude mit besonderem Wertinhalt (Gemäldesammlungen, Museen),<br />
denkmalgeschützte Gebäude, Gebäude mit umfangreicher elektronischer<br />
Ausstattung<br />
Fangeinrichtungen<br />
Die 5 wesentlichen Teile<br />
einer Blitzschutz-Anlage<br />
nach IEC 1024-1: 1990-03; ENV 61024-1: 1995-01;<br />
DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100): 1996-08<br />
Ableitungen<br />
Erdungsanlage<br />
eingehaltene<br />
Sicherheitsabstände<br />
Blitzschutz-<br />
Potentialausgleich<br />
Quelle: Dehn & Söhne<br />
5 Wie ist eine Blitzschutzanlage<br />
aufgebaut?<br />
Eine Blitzschutzanlage besteht aus<br />
fünf tragenden Säulen.<br />
Der Äußere Blitzschutz umfaßt<br />
alle Einrichtungen zum Auffangen<br />
und Ableiten des Blitzstromes in<br />
die Erdungsanlaqe. Mit der Fangeinrichtung,<br />
häufig aus Aluminium
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
oder Kupfer, wird sehr grobmaschig das äußere Profil des Gebäudes nachgeführt.<br />
Die Fangeinrichtung besteht im allgemeinen aus einer Firstleitung und/oder Leitungen<br />
auf der Dachfläche und ggf. aus Fangstangen. Alle metallenen Einrichtungen<br />
auf dem Gebäude (z.B. Dachrinnen) sind auf kürzestem Wege mit der Fangeinrichtung<br />
zu verbinden. Aus der Dachfläche herausragende Komponenten, wie z.B.<br />
Schornsteine, Lüftungsrohre, Lichtkuppeln u.a., werden mit Fangstangen versehen,<br />
die ihrerseits mit der Fangleitung verbunden werden.<br />
Ableitungen werden von der Fangeinrichtung an den Gebäudewänden auf direktem<br />
Wege nach unten zur Erdungsanlage geführt. Die Erdungsanlage verteilt den<br />
Blitzstrom möglichst großflächig im Erdboden.<br />
Während der Äußere Blitzschutz vorrangig die Brandgefahr beseitigt, werden durch<br />
Maßnahmen des Inneren Blitzschutzes die Auswirkungen des Blitzstromes und<br />
seiner elektrischen und magnetischen Felder auf Personen, metallene Installationen,<br />
elektrische Verbrauchersysteme und elektronische Geräte begrenzt. Der<br />
wichtigste Bestandteil des Inneren Blitzschutzes ist der Blitzschutz-Potentialausgleich,<br />
ohne den ein wirkungsvoller Überspannungsschutz nicht möglich ist. Durch<br />
spezielle Schutzgeräte können Überspannungen auf so niedrige Werte herabgesetzt<br />
werden, daß sie selbst für empfindliche elektronische Geräte ungefährlich<br />
sind.<br />
Blitzschutz besteht also immer aus Äußerem und Innerem Blitzschutz.<br />
Blitzschutz-<br />
Potentialausgleich<br />
Hausanschlußkasten<br />
Blitzschutzanlage nach DIN VDE V0185 Teil 100<br />
Fanganordnung<br />
Blitzstrom-<br />
Ableiter für<br />
230/400 V,<br />
50 Hz<br />
PAS<br />
Fundamenterder<br />
Blitzstrom-<br />
Ableiter für<br />
Telefonleitung<br />
Potentialausgleich<br />
für Heizung, Klima,<br />
Sanitär<br />
Sicherheitsabstand<br />
Ableitungsanordnung<br />
Erdungsanlage<br />
Blitzschutz umfaßt den Äußeren und Inneren Blitzschutz. Quelle: Dehn & Söhne<br />
9
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
6 Fundamenterder<br />
Der Fundamenterder ist ein Leiter, der –allseits von Beton umschlossen- großflächig<br />
mit der Erde in Verbindung steht.<br />
Der Fundamenterder muß nach DIN 18014 ausgeführt werden. Auf der Grundlage<br />
der DIN 18014 und der „Technischen Anschlußbedingungen“ (TAB), herausgegeben<br />
von der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V., ist der Fundamenterder<br />
in Neubauten einzubauen. Er ist Bestandteil der elektrischen Anlage, da er<br />
u.a. die Grundlage der folgenden Schutzmaßnahmen bildet:<br />
10<br />
elektrotechnische Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100<br />
Hochspannungsschutzmaßnahmen nach DIN VDE 0141<br />
Blitzschutzmaßnahmen nach DIN VDE 0185<br />
Funktionssicherheit für fernmelde- und informationstechnische Einrichtun-<br />
gen nach DIN VDE 0800<br />
6.1 Zuständigkeiten für die Verlegung<br />
Das Verlegen des Fundamenterders ist vom Bauherrn oder Architekten zu veranlassen.<br />
Bei vielen Bauvorhaben wird mit der Planung und Ausführung des Fundamenterders<br />
die Hochbaufirma beauftragt. Die Verlegung des Fundamenterders erfolgt<br />
dann häufig von Bauhilfskräften, die Überwachung der Ausführung wird vom Bauleiter<br />
oder Polier übernommen. Bauleiter und Polier müssen die erforderliche Qualifikation<br />
nach DIN VDE 1000 Teil 10 nachweisen, um die Funktion der verantwortlichen<br />
Elektrofachkraft nicht unzulässig einzunehmen. Andernfalls tragen<br />
sie die Verantwortung, daß der Fundamenterder in vollem Umfang dem DIN-Vorschriftenwerk<br />
entspricht.<br />
Fazit: Die Ausführung des Fundamenterders darf nur von qualifizierten Blitzschutzoder<br />
Elektrofachkräften mit entsprechender Berufsausbildung erfolgen.<br />
6.2 Die Funktion des Fundamenterders<br />
Nach der VDE 0100 Teil 410 und 540 wird ein Hauptpotentialausgleich gefordert.<br />
Dieser Hauptpotentialausgleich kann durch Anschluß aller metallenen Systeme im<br />
Gebäude an den Fundamenterder äußerst effektiv ausgeführt werden. Der Fundamenterder<br />
ist darüber hinaus auch als Erder für eine Blitzschutzanlage zu verwenden.<br />
Aus technischer Sicht ist unumgänglich, daß alle aus dem Beton herausgeführten<br />
Anschlußfahnen aus korrosionsbeständigem Material bestehen (z.B. kunststoffumhüllter<br />
Draht, nichtrostender Stahl, Kabel NYY).<br />
Die Blitzschutzfachfirma stellt die gem. VDE 0100 Teil 410 und 540 geforderte Verbindung<br />
zwischen der Blitzschutzanlage und dem Fundamenterder her.
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
7 Blitzschutz besonderer Anlagen<br />
7.1 Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen<br />
Forciert durch staatliche Förderprogramme (z.B. 100.000-Dächer-Programm) gewinnt<br />
die Energieerzeugung durch Photovoltaik- (PV-) Anlagen zunehmend an<br />
Bedeutung. Photovoltaik-Anlagen wandeln die Energie des Sonnenlichts direkt in<br />
elektrische Energie um. Diese Energie wird am Erzeugungsort genutzt oder bei<br />
netzparallelen Anlagen in das Versorgungsnetz des Energieversorgers eingespeist.<br />
Die Photovoltaik-Anlage wird in der Regel auf dem Dach oder an der Fassade<br />
montiert. Um wirtschaftliche Leistungen zu erzielen, werden einzelne PV-Module<br />
zu einem weiträumigen Verbund zusammengeschaltet. Wegen der exponierten<br />
Lage und der großflächigen Ausdehnung des Photovoltaik-Systems entsteht eine<br />
enorme Überspannungsgefährdung durch direkte und indirekte Blitzeinwirkungen.<br />
Besitzt das Gebäude eine<br />
Blitzschutzanlage, so muß<br />
die Fangeinrichtung dahingehend<br />
erweitert werden,<br />
daß ein direkter Blitzeinschlag<br />
in die PV-Module<br />
ausgeschlossen ist. Bei der<br />
Anordnung der Fangeinrichtung<br />
sind zwei wichtige<br />
Forderungen zu beachten:<br />
Möglichst keine Abschattung<br />
der PV-Module, da sonst eine Leistungsreduktion eintritt<br />
Einhaltung des Sicherheitsabstandes s zum PV-Modul (typ. ≥0.5m). Exakt<br />
läßt sich der Abstand errechnen aus der Näherungsformel gemäß VDE V<br />
0185 Teil 100.<br />
Das Prinzip des Überspannungsschutzes ist dem folgenden Bild zu entnehmen.<br />
L+<br />
L-<br />
zum PV-Modul-<br />
Gestell<br />
Überspannungsableiter<br />
Fangstange zum Schutz vor direktem Blitzeinschlag<br />
DC<br />
AC<br />
L<br />
N<br />
PE<br />
Überspannungsableiter<br />
Überspannungsschutz für ein Photovoltaik-System, Quelle: Dehn & Söhne<br />
11
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Kann aus montagetechnischer Sicht der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen<br />
PV-Modul und Fangeinrichtung nicht eingehalten werden, so ist eine direkte, leitende<br />
Verbindung zwischen der Fangeinrichtung und der Rahmenkonstruktion des<br />
PV-Moduls herzustellen. Da hier im Einschlagfall mit erheblichen Blitzströmen auf<br />
den Gleichspannungs- und Potentialausgleichsleitungen zu rechnen ist, müssen<br />
zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden:<br />
12<br />
Verlegung einer zusätzlichen Potentialausgleichsleitung parallel zu den<br />
Gleichstromleitungen und / oder<br />
Verwendung geschirmter Gleichstromleitungen. Der Schirm muß hierbei<br />
blitzstromtragfähig sein und geringe Kopplungsimpedanzen aufweisen. Zur<br />
Kompensation induzierter Spannungen sollten die Adern der Gleichstromleitungen<br />
verdrillt werden.<br />
7.2 Blitzschutz von Solarkollektoren<br />
Bei Solarkollektoren, die<br />
ausschließlich der Brauchwassererwärmung<br />
dienen,<br />
ist das Schutzprinzip ähnlich.<br />
Zur Vermeidung direkter<br />
Blitzeinschläge ist<br />
die Kollektorfläche z.B.<br />
durch Fangstangen in<br />
einen Schutzraum zu bringen.<br />
Der Potentialausgleich ist<br />
durch Einbeziehung der<br />
metallenen Rohre für den<br />
Solarkreislauf unbedingt<br />
herzustellen. Die elektrischen<br />
Leitungen (Meß-<br />
und Regelkreis) sind durch<br />
entsprechende Bauelemente<br />
gegen Überspannungen<br />
zu schützen.<br />
Näherungen zu anderen<br />
metallenen oder elektrischen<br />
Installationen sind<br />
Anordnung der Fangeinrichtung zum Schutz vor direktem<br />
Blitzeinschlag in den Solarkollektor, Quelle: Dehn & Söhne<br />
unter allen Umständen zu vermeiden. Als Faustformel gilt ein Mindestabstand von<br />
0.5 m. Exakt läßt sich dieser Sicherheitsabstand errechnen aus der Näherungsformel<br />
gemäß VDE V 0185 Teil 100.
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
7.3 Blitzschutz von Reithdächern<br />
Reithdächer, in weiten<br />
Teilen Norddeutschlands<br />
auch Reet- bzw. Weichdach<br />
genannt, verlangen<br />
eine besondere Beachtung.<br />
In der DIN VDE<br />
0185 Teil 2 ist detailliert<br />
beschrieben, wie der<br />
Blitzschutz für derartige<br />
Gebäude auszusehen<br />
hat. Ein wirksamer Blitzschutz<br />
für Reithdächer ist<br />
kaum möglich, wenn dieses<br />
mit einem metallenen<br />
Maschendraht überzogen<br />
ist. Hier empfiehlt sich<br />
der Einsatz von -elektrisch<br />
nicht leitfähigem-<br />
Kunststoffgeflecht aus<br />
UV-beständigem Material.<br />
Holzmast aus Bongossi 90x90mm<br />
mit Auffangspitze Rd / 16mm Alu<br />
Holzschrägenstütze aus<br />
Bongossi mit Isolator<br />
Traufenstütze verz. Stahl<br />
mit Isolator<br />
Äußerer Blitzschutz mit Isolatoren an einem Reitdach<br />
Der zunehmende Einsatz von Kupferfirsten stellt sehr hohe Anforderungen an den<br />
Blitzschutzerrichter. Die elektrisch hervorragend leitfähigen Kupferbleche, die eine<br />
Vermoosung der Dachfläche vermindern sollen, können einen gefährlichen, unkontrollierten<br />
Stromfluß verursachen. Ein wirksamer Blitzschutz ist hier nur durch<br />
drastische Erhöhung der Sicherheitsabstände möglich.<br />
Bei sehr hohen Stromstärken und bei feuchten Holzmasten und Holzschrägenstützen<br />
besteht die Gefahr, daß bei einem Blitzeinschlag eine Teilentladung über die<br />
feuchten Holzstützen auf das Reithdach fließt. Dabei kommt es zu einem Überschlag<br />
auf den metallenen Maschendraht oder auf den 4 mm starken Bindedraht.<br />
Die metallenen Traufenstützen werden unmittelbar an der Gebäudewand befestigt.<br />
Werden Leitungen und Kabel, z.B. für die Rundumbeleuchtung oder Alarmtechnik,<br />
an diesen Traufenstützen befestigt oder so geführt, daß der Sicherheitsabstand<br />
unterschritten wird, so ist im Fall einer Blitzentladung mit direkten Überschlägen<br />
bzw. Einkopplungen in diese Leitungen zu rechnen. Daher ist es ratsam, elektrische<br />
Leitungen außerhalb des Näherungsbereiches zu allen Komponenten des<br />
Blitzschutzsystems zu verlegen (Faustformel: mindestens 50 cm Abstand). Sollte<br />
dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können, so sind alle in das<br />
Gebäude eingehenden elektrischen Leitungen an der Eintrittstelle mit Blitzstrom-<br />
bzw. Überspannungsableitern zu beschalten. Ein wirkungsvoller Überspannungsschutz<br />
setzt einen richtig ausgeführten Blitzschutz-Potentialausgleich voraus.<br />
Wir haben aufgrund dieser Erkenntnisse die Blitzschutzmaste und die Traufenstützen<br />
weiterentwickelt und mit Isolatoren versehen. Die Gefahr eines Überschlages<br />
auf die metallenen Teile des Daches oder in die energietechnischen<br />
Leitungen wird hiermit erheblich reduziert.<br />
13
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
7.4 Blitzschutz von Kirchen<br />
Kirchtürme überragen in der Regel ihre Umgebung erheblich und stellen damit<br />
einen bevorzugten Blitzeinschlagpunkt dar. Aufgrund des hohen, schwer ersetzbaren<br />
Kulturwertes und der erheblichen Menschenansammlungen ist die Notwendigkeit<br />
von Blitzschutzanlagen auf Kirchen eindeutig gegeben.<br />
Nach VDE 0185 Teil 2 Abs. 4.2 gelten folgende Bestimmungen<br />
14<br />
Kirchtürme bis 20 m Höhe erhalten eine außenliegende Ableitung<br />
Kirchtürme über 20 m Höhe erhalten mind. zwei außenliegende Ableitungen<br />
Im Inneren des Turmes sind keine Ableitungen erlaubt<br />
Das Kirchenschiff erhält eine eigene Blitzschutzanlage, welche bei einem an-<br />
gebauten Turm auf dem kürzesten Wege mit diesem zu verbinden ist<br />
Der Einbau von Blitzstromableitern in die Niederspannungs-Hauptverteilung ist vor<br />
geschrieben. Eine weitere wichtige Maßnahme ist der Überspannungsschutz der elektrischen<br />
Anlage innerhalb des Kirchenschiffes und des Kirchturmes<br />
Näherungen zu den äußeren Ableitungen im Bereich des Glockenstuhles sind<br />
durch zusätzliche Maßnahmen zu beseitigen<br />
Für den Inneren Blitzschutz<br />
stellt der sorgfältig ausgeführte<br />
Blitzschutzpotentialausgleich die<br />
wichtigste Grundlage dar. Alle<br />
metallenen Teile werden direkt,<br />
alle Niederspannungskabel indirekt<br />
durch Überspannungsableiter<br />
der Anforderungsklasse B<br />
in den Potentialausgleich einbezogen.<br />
Der Blitzschutz – Potentialausgleich<br />
sollte so nahe wie<br />
möglich an der Eintrittsstelle aller<br />
elektrischen Leitungen erfolgen.<br />
Aus technischer Sicht ist<br />
der Einsatz der Überspannungsableiter<br />
im ungezählten<br />
Bereich häufig vorteilhafter. Eine<br />
Abstimmung mit dem zuständigenEnergieversorgungsunternehmen<br />
ist allerdings erforderlich.<br />
Prinzip des Äußeren und Inneren Blitzschutzes<br />
einer Kirche mit angebautem Kirchturm
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
7.5 Blitzschutz von Dachaufbauten auf modernen Verwaltungsgebäuden<br />
Die Dächer von Verwaltungs- und Industriegebäuden werden zunehmend zu komplexen<br />
technischen Nutzflächen. Der Anteil an elektrisch betriebenen und gesteuerten<br />
Einrichtungen, wie z.B. Klimageräten oder Rauch-Wärme-Abzugsanlagen<br />
(RWAs), nimmt gegenüber den klassischen Dachaufbauten wie Kaminen und<br />
Dachfenstern erheblich zu. Diese Systeme haben i.d.R. leitende Verbindungen in<br />
das Gebäudeinnere und bedürfen daher einer besonderen Beachtung.<br />
Den Schutz von Dachaufbauten mit leitender Fortführung in das Gebäudeinnere<br />
kann man nur realisieren, indem das Objekt in einen Schutzraum gebracht wird.<br />
Dies läßt sich z.B. mit Fangstangen erreichen, die in einem Mindestabstand vom<br />
zu schützenden Objekt aufzustellen sind. Wird dieser Mindestabstand unterschritten,<br />
so kommt es durch Näherungen zu unerwünschten Teilblitzströmen innerhalb<br />
des zu schützenden Systems. Bei ausreichendem Abstand werden Direkteinschläge<br />
in das Objekt und damit in die elektrische Leitung wirksam vermieden.<br />
Überspannungen, die z.B. durch induktive Einkopplungen entstehen, sind durch<br />
Ableiter der Anforderungsklasse C relativ preiswert zu unterbinden.<br />
Können Näherungsabstände nicht oder nur unter schwierigsten Bedingungen eingehalten<br />
werden, so bietet sich der Aufbau einer isolierten Fangeinrichtung an.<br />
Hierbei wird die gesamte Fangeinrichtung auf isolierenden Stützmasten verlegt.<br />
Bei mehrerer überspannten Dachaufbauten stellt dies oftmals die kostengünstigste<br />
und technisch beste Lösung dar.<br />
Isoliertes Blitzschutzsystem<br />
15
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
8 Der Schutz vor Schäden durch Überspannungen<br />
Mit dem Blitzableiter ist es getan, dann brauche ich doch keinen Überspannungsschutz!<br />
Weit gefehlt, denn durch Überspannungen entstehen jährlich Schäden in dreistelliger<br />
Millionenhöhe. Geht es beim Äußeren Blitzschutz im wesentlichen um den<br />
Brandschutz, so ist der Innere Blitzschutz eine Maßnahme zum Schutz der elektrischen<br />
und elektronischen Geräte vor Fehlfunktionen bzw. Zerstörung.<br />
Der Blitzstrom wird durch eine funktionsfähige Äußere Blitzschutzanlage zuverlässig<br />
in das Erdreich<br />
abgeleitet, erzeugt aber<br />
durch seine unvorstellbar<br />
hohe Energie<br />
in elektrischen<br />
Leitungen und Geräten<br />
eine Induktionsspannung<br />
von mehreren<br />
tausend Volt. Kaum ein<br />
Gerät hält solche hohen<br />
Spannungen aus. Selbst<br />
im Umkreis des Blitzeinschlages<br />
von etwa<br />
16<br />
Beeinflussung empfindlicher Elektronik<br />
einem Kilometer drohen<br />
erhebliche Schäden an<br />
elektrischen Geräten, da<br />
die Überspannungen auch über die Netzeinspeisung in das Gebäude gelangen<br />
können.<br />
Schäden an elektrischen Verbrauchern führen oftmals zu erheblichen Reparatur-<br />
oder Wiederbeschaffungskosten, doch wer ersetzt die Folgeschäden, z.B. den Verlust<br />
unersetzlicher Daten, den Ausfall oder die Fehlfunktionen von EDV-Systemen<br />
im gewerblichen Bereich oder medizinischen Geräten in Arztpraxen?<br />
Man kann Vorsorge gegen diese Schäden treffen, indem man den Inneren Blitzschutz<br />
ausführt. Der „Innere Blitzschutz“ umfaßt alle Maßnahmen, die getroffen<br />
werden, um die Auswirkungen des Blitzstromes mit seinen elektrischen und magnetischen<br />
Feldern möglichst gering zu halten.<br />
Der wichtigste Bestandteil des Inneren Blitzschutzes ist der Blitzschutz-Potentialausgleich,<br />
ohne den ein wirkungsvoller Überspannungsschutz nicht möglich ist. Zu<br />
beachten ist, daß der Blitzschutz-Potentialausgleich auf einen fachtechnisch richtig<br />
ausgeführten Hauptpotentialausgleich und einen ggf. erforderlichen örtlichen Potentialausgleich<br />
aufsetzt.<br />
Bei der Planung von Überspannungsschutzmaßnahmen ist darauf zu achten, daß<br />
entsprechend der Anforderungen und Belastungen, die ein Überspannungs-<br />
Schutzgerät beherrschen muß, eine zuverlässige Ableiterkoordination herzustellen<br />
ist.
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Fazit:<br />
Die Zusammenhänge zwischen dem „Äußeren“ und dem „Inneren“ Blitzschutz sind<br />
von erheblicher Bedeutung. Nur ein Fachmann, der beide Gebiete beherrscht,<br />
kann eine wirksames Schutzkonzept erarbeiten. Lassen Sie sich –für Sie unverbindlich-<br />
durch unsere Spezialisten für Blitz- und Überspannungsschutz beraten.<br />
Sie werden Ihnen verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten, die Ihre Sach-<br />
und Vermögensgegenstände optimal unter Kosten-Nutzen-Gesichtpunkten schüt-<br />
EVU Hauptverteilung Unterverteilung Endgerät<br />
zen.<br />
6<br />
Stehstoßspannungsfestigkeit der Isolation in kV<br />
Wh<br />
4<br />
Auf der Einspeiseseite muß der Haupt-Energieanteil, der Strom, beherrscht<br />
werden. Dies gelingt mit leistungsfähigen Blitzstromableitern der Anforderungsklasse<br />
B. Nur diese Geräte sind in der Lage die extrem steile Stromflanke wirksam<br />
von der folgenden Elektroinstallation fernzuhalten.<br />
Die Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C, die an den nachgeschalteten<br />
Stromkreisverteilern installiert werden, setzen die Störspannung erheblich<br />
herab. Dieses Schutzniveau kann für viele elektrische Verbraucher als<br />
ausreichend betrachtet werden. Für elektronische Geräte oder elektrische Geräte<br />
mit elektronischer Steuerung reicht dieser Schutz oftmals nicht mehr aus. Hier<br />
muß die Störspannung weiter bis zur Eingangs-Spannungsfestigkeit des Geräts<br />
gesenkt werden. Dies erreicht man mit Überspannungsableitern der Anforderungsklasse<br />
D, die auch als Geräteschutz bezeichnet werden.<br />
2,5<br />
Geräteschutz<br />
Körper<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
PEN<br />
Schutzkonzept für die Stromversorgung, hier bei „Klassischer Nullung“ (Netzform: TN-C-System)<br />
1,5<br />
17
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
8.1 Anwendungsbeispiel: ÜSS am Telekommunikationsanschluß<br />
Telekommunikationsleitungen sind neben den energietechnischen Leitungen die<br />
wichtigste Leitungsverbindung nach außen. Für den hochtechnisierten Ablauf in<br />
Industrieanlagen und im Büro ist eine kontinuierlich verfügbare Schnittstelle zur<br />
Außenwelt überlebenswichtig. Bei einem Ausfall drohen neben dem<br />
Imageschaden hohe Kosten, da z.B. Kundenaufträge nicht abgewickelt werden<br />
können oder Firmendaten nur lokal aktualisiert, aber nicht mehr überregional zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Nach den Statistiken der Elektronik-Schadenversicherer ist die Überspannung die<br />
häufigste Schadenursache.<br />
Die vorwiegende Art der Entstehung ist die durch direkte oder ferne<br />
Blitzeinwirkung verursachte Überspannung, wobei die Überspannung durch direkte<br />
Einschläge in eine bauliche Anlage die härteste Beanspruchung, aber den<br />
selteneren Fall darstellt. Das Leitungsnetz der Telekommunikationsleitung<br />
überdeckt oftmals eine Fläche von mehreren Quadratkilometern. Bei einer<br />
Blitzeinschlaghäufigkeit von ca. 1 bis 5 Blitzeinschlägen pro Jahr und km² in<br />
Deutschland ist hierdurch mit Überspannungseinkopplungen zu rechnen.<br />
Die sicherste Art eine bauliche Anlage gegen die Auswirkungen der Blitzbeeinflussung<br />
zu schützen ist eine vollständige Blitzschutzanlage aus den Maßnahmen<br />
des Äußeren und Inneren Blitzschutzes. Diese Gesamtmaßnahme ist Aufgabe<br />
des Gebäudeeigentümers und beinhaltet dann im Rahmen des Inneren Blitzschutzes<br />
den vollständigen Blitzschutzpotentialausgleich, also auch die<br />
schutztechnische Einbeziehung der Telekommunikationsleitungen. (vgl. Kapitel 9)<br />
Soll lediglich der Teilbereich der Telekommunikation geschützt werden, so ist der<br />
prinzipielle Aufbau der folgenden Abbildung zu entnehmen.<br />
18<br />
S1527a<br />
APL<br />
Schutzmaßnahme am ISDN Basisanschluß<br />
TELEKOM TEILNEHMER<br />
U k 0<br />
NTBA<br />
BLITZDUCTOR ® BLITZDUCTOR CT BD 110<br />
NT-Protector<br />
® CT BD 110<br />
NT-Protector<br />
Energieversorgung<br />
z.B. SF-Protector<br />
S0<br />
DEHNlink ISDN/ I<br />
TK-Anlage<br />
DSM-2-RJ45 ISDN SS0 0<br />
ISDN-Card<br />
1527.ppt / 19.04.<strong>2000</strong> / KK<br />
Quelle: Dehn + Söhne
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Im einfachsten Anwendungsfall (Einzelplatzanwendung) stellen sich die Schutzmaßnahmen<br />
wie folgt dar.<br />
Quelle: Dehn + Söhne<br />
Der NT-Protector wird an eine 230 V Schutzkontaksteckdose angeschlossen und<br />
ist somit über den Schutzleiter mit dem örtlichen Potentialausgleich verbunden. Er<br />
versorgt das Netzabschlußgerät (z.B. NTBA) über die integrierte Steckdose mit der<br />
geschützten 230 V Netzspannung. Durch Anschalten einer 230 V Verteilerleiste<br />
läßt sich die „saubere“ 230 V Netzspannung auch für weitere Kommunikationsgeräte,<br />
wie z.B. Faxgerät, TK-Anlage oder entsprechende Telefone nutzen. Die<br />
Datenleitung der UK0-Schnittstelle wird über das Schutzgerät mit dem Übergabepunkt<br />
des Telekommunikationsanbieters (z.B. TAE-Anschlußdose) verbunden.<br />
Für aufwendigere Mehrplatzanwendungen stellt sich die Schutzmaßnahme prinzipiell<br />
vergleichbar dar, deren Komplexität verlangt jedoch eine Schutzbeschaltung<br />
der einzelnen Adern sowie der energietechnischen Zuleitungen. Für die Beherrschung<br />
energiereicher Überspannungen oder den Schutz räumlich weit getrennter<br />
Installationen ist ein Potentialausgleich zwischen Überspannungschutzgeräten<br />
und TK-Anlage unbedingt erforderlich.<br />
(Auszug aus: W. Trommer / Klaus-Peter Müller: Beitrag aus Fachzeitschrift de, Ausgabe 11/<strong>2000</strong>)<br />
19
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
9 Das Schutz-Management<br />
Elektronische Systeme werden mittlerweile in allen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt.<br />
Die Globalisierung hat den Bedarf an Kommunikations- und Informationstechnik<br />
rapide beschleunigt. So erfolgt beispielsweise im Bankensektor die Abwicklung<br />
von Zahlungsströmen i.a. beleglos. Dem Endkunden werden Transaktionen<br />
durch Online Banking rund um die Uhr ermöglicht. Die Rechnersysteme der<br />
Bankfilialen sind dabei landesweit mit dem Rechenzentrum ihres Stammhauses<br />
verbunden.<br />
Diese vernetzte Welt mit ihrem stetig wachsenden Informationsfluß wird bei Beeinträchtigungen<br />
empfindlich gestört. Die Achillesferse ist das Versagen der elektronischen<br />
Datenverarbeitung, das sich schnell zur wirtschaftlichen Katastrophe ausweiten<br />
kann. Ausfälle oder Störungen, die z.B. durch Blitzeinwirkungen verursacht<br />
werden, können mit Hilfe von Maßnahmen der elektromagnetischen Verträglichkeit<br />
(EMV) wirksam eingegrenzt werden.<br />
Das „Gesetz über die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG)" fordert eine<br />
ausreichende Störfestigkeit der Störsenke. Hierzu zählt auch der Schutz gegen die<br />
Auswirkungen des Blitzes. Für komplexe elektrische und elektronische Anlagen ist<br />
die Aneinanderreihung klassischer Blitzschutzmaßnahmen nicht mehr ausreichend.<br />
Hierzu liegt im nationalen Bereich liegt seit dem 1. September 1997 die<br />
DIN VDE 0185 Teil 103<br />
„Schutz gegen elektromagnetischen Blitzimpuls“<br />
Teil 1: Allgemeine Grundsätze<br />
(IEC 1312-1:1995 modifiziert)<br />
vor. Die Norm fordert zu Beginn der Planung eine Antwort auf die Frage, in welcher<br />
Form ein Schutz gegen den elektromagnetischen Impuls des Blitzes (LEMP)<br />
notwendig ist. Der Entwurf des LEMP-Schutzes sollte unbedingt in Verbindung mit<br />
dem Entwurf des Blitzschutzsystems durchgeführt werden. Die DIN VDE 0185 Teil<br />
103 legt im Anhang E dabei die Verantwortlichkeiten fest.<br />
9.1 Vorgehensweise<br />
20<br />
LEMP<br />
BSZ 0 B<br />
energietechnisches<br />
Netz<br />
Fangeinrichtung<br />
Lüftung<br />
Raumschirm<br />
BSZ 2<br />
SEMP<br />
ü ü<br />
BSZ 0 A<br />
BSZ 1<br />
Geräteschirm<br />
BSZ 1<br />
BSZ 3<br />
ü ü<br />
ü ü<br />
LEMP<br />
Zwischenboden<br />
Stahlarmierung Blitzschutz-Potentialausgleich<br />
Fundamenterder<br />
Blitzstrom-Ableiter<br />
Ring-Potentialausgleichsschiene<br />
ü<br />
LEMP<br />
energietechn. Netz<br />
informationstechnisches<br />
Netz<br />
S659/3 659-3-c.ppt / 17.07.96<br />
ü<br />
M<br />
ü<br />
Kamera<br />
ü<br />
Lampe<br />
ü<br />
Steckdose<br />
BSZ 0 B<br />
"Blitzkugel"<br />
Radius 20 m<br />
BSZ 0 B<br />
örtlicher Potentialausgleich<br />
Überspannungs-Ableiter<br />
Blitz-Schutzzonen-Konzept (Quelle: Dehn & Söhne)<br />
Das zu schützende<br />
Volumen wird in<br />
Blitz-Schutzzonen<br />
eingeteilt. Durchdringen<br />
metallene<br />
Rohr- oder Kabelsysteme<br />
mehrere<br />
Zonen, so sind diese<br />
Schnittstellen<br />
sorgfältig zu behandeln.<br />
Für passive<br />
Elemente, z.B.<br />
Rohrleitungen, ist<br />
eine Verbindung zum<br />
Zonenschirm herzu-
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
stellen (Blitzschutz-Potentialausgleich), aktive Elemente, z.B. elektrische Leitungen,<br />
sind mit Blitzstromableitern der Anforderungsklasse B bzw. mit Überspannungsableitern<br />
der Anforderungsklassen C und D zu schützen.<br />
Der Planer hat dafür zu sorgen, daß diese Ableiter so aufeinander abgestimmt<br />
werden, daß sie die Bedrohungsgröße stufenweise bis zur Eingangs-Spannungsfestigkeit<br />
des Endgeräts abbauen können. Dies setzt voraus, daß der Planer über<br />
detaillierte Kenntnisse der energie- und informationstechnischen Netzkonfiguration,<br />
der Endgeräte und des physikalischen Verhaltens der Ableiter verfügt.<br />
10 Prüfungen von Blitzschutzsystemen<br />
Ein Blitzschutzsystem ist eine Sicherheitseinrichtung. Um<br />
die einwandfreie Funktionsfähigkeit über die gesamte<br />
Lebensdauer zu gewährleisten, sind Blitzschutzsysteme<br />
wiederkehrend zu prüfen. Die Richtlinien zur Prüfung von<br />
Blitzschutzsystemen sind festgelegt in der<br />
VDE V 0185 Teil 110<br />
Blitzschutzsysteme<br />
Leitfaden zur Prüfung von Blitzschutzsystemen.<br />
10.1 Anwendungsbereich<br />
Die Vorschrift gilt für neue Blitzschutzsysteme nach VDE 0185 Teil 1 und 2 sowie<br />
der VDE V 0185 Teil 100. Bestehende Anlagen genießen Bestandsschutz, sind jedoch<br />
sinngemäß einer Blitzschutzklasse zuzuordnen.<br />
Die Prüfung des Blitzschutzsystems ist durch eine Blitzschutzfachkraft auszuführen.<br />
Dieser darf folgende Arten von Prüfungen durchführen:<br />
Prüfung der Planung<br />
Baubegleitende Prüfung<br />
Abnahmeprüfung<br />
Wiederholungsprüfung<br />
Zusatzprüfung (nur in Ausnahmefällen)<br />
Sichtprüfung (nur in Ausnahmefällen)<br />
10.2 Prüfintervalle<br />
Der Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung ist von der Blitzschutzklasse abzuleiten.<br />
Die folgende Tabelle nennt zeitliche Abstände der Wiederholungsprüfungen.<br />
Blitz-<br />
schutz-<br />
klasse<br />
Intervall<br />
zwischen<br />
den vollständigen<br />
Prüfungen<br />
Intervall zwischen den Sichtprüfungen von Gebäuden der Schutzklassen<br />
I und II bzw. von kritischen Anlagen*<br />
* z.B. Teile des Blitzschutzsystems, die starken mechanischen Beanspruchungen<br />
ausgesetzt sind, sowie Blitzstrom- und Überspannungsableiter,<br />
Potentialausgleichsverbindungen von Kabeln und Rohrleitungen usw.<br />
I 2 Jahre 1 Jahr<br />
II 4 Jahre 2 Jahre<br />
III, IV 6 Jahre 3 Jahre<br />
21
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Die genannten Prüffristen können abweichen, wenn<br />
22<br />
Forderungen der Sachversicherer,<br />
Auflagen von Behörden und Verordnungen oder<br />
ungewöhnliche örtliche Umgebungsbedingungen (z.B. Bereiche mit erhöhter<br />
oberirdischer und / oder unterirdischer Korrosionsgefahr) vorliegen.<br />
Bei Reparaturen, Erweiterungen oder wesentlichen Nutzungsänderungen an der<br />
baulichen Anlage sind Zusatzprüfungen durchzuführen.<br />
Die Beschaffenheit von Erdungsanlagen, die älter als 10 Jahre sind, kann nur durch eine<br />
Freilegung beurteilt werden.<br />
Mit elektrischen Messungen ist zu kontrollieren, ob alle Verbindungen und Anschlüsse<br />
von Fangeinrichtungen, Ableitungen, Potentialausgleichsleitungen, Schirmungsmaßnahmen<br />
usw. einen niederohmigen Durchgang aufweisen. Es sind zusätzlich<br />
die Übergangswiderstände zur Erdungsanlage an allen Meßstellen sowie<br />
die Erdungswiderstände an Einzel- bzw. Teilringerden o.ä. zu prüfen.<br />
Für jede Prüfung ist ein Prüfbericht anzufertigen, der zusammen<br />
mit den technischen Unterlagen in einem Prüfbuch<br />
beim Eigentümer verbleibt. Der Prüfbericht stellt<br />
einen Nachweis über die Funktionsfähigkeit der Anlage<br />
dar.<br />
11 Weitere Fragen?<br />
Zu jedem der angeführten Themenbereiche erhalten Sie ausführliche Informationen<br />
von unseren Fachleuten, die Ihnen auch gerne ein für Sie unverbindliches<br />
Angebot erstellen. Die Anschriften und Telefonnummern finden Sie auf der letzten<br />
Seite.<br />
Besuchen Sie auch unsere Websites im Internet. Hier finden Sie aktuelle Informationen<br />
rund um das Thema Blitzschutz.
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
12 Auszug aus unserer Referenzliste<br />
ABB Gebäudetechnik AG ADAC Aldi Nord Allianz Versicherung AG Amt<br />
für Bau- und Kunstpflege Ämter der Freien und <strong>Hans</strong>estadt Hamburg Arbeiterwohlfahrt<br />
Oldenburg AVA Bielefeld BEB Erdgas und Erdöl <strong>GmbH</strong> <br />
Beiersdorf AG Bertelsmann / Mohndruck Bilfinger & Berger Bau AG Bischöfliches<br />
Generalvikariat Botterbloom e.G. Bremer Baubetrieb, Betrieb der<br />
Stadtgemeinde Bremen Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH <br />
Bremer Lagerhaus Gesellschaft Brötje-Werk, Rastede DaimlerChrysler AG <br />
DaimlerChrysler Aerospace Airbus <strong>GmbH</strong> Deutsche Bundesbahn AG Deutsche<br />
Messe AG, Hannover Deutsche BP AG Deutsche Telekom Elf Minol<br />
Erdgas-Verkaufs-Gesellschaft mbH Münster EWE Aktiengesellschaft Oldenburg<br />
EWE TEL <strong>GmbH</strong> Friesisches Brauhaus zu Jever Felten & Guileaume<br />
Genossenschafts-Rechenzentrale Norddeutschland <strong>GmbH</strong> Hamburg Mannheimer<br />
Henkel Genthin <strong>GmbH</strong> HEW Hamburgische Elektrizitätswerke AG <br />
Howaldtwerke Deutsche Werft AG (HDW) hüppeform, Sonnenschutz- u. Raumsysteme<br />
<strong>GmbH</strong> KBB Kavernen Bau- und Betriebs <strong>GmbH</strong> Landeszentralbank<br />
Hannover Landesbauämter Flensburg, Kiel, Lübeck, Itzehoe Magistrat der<br />
Städte Leipzig, Magdeburg, Bremerhaven Mannesmann Hoesch <strong>GmbH</strong> <br />
Metaleurop <strong>GmbH</strong> Jos. L. Meyer <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. Mobil Erdgas-Erdöl <strong>GmbH</strong> <br />
Neynaber Chemie <strong>GmbH</strong> Norddeutsche Erdgas-Aufbereitungs-<strong>GmbH</strong> Norddeutsche<br />
Seekabelwerke <strong>GmbH</strong> Nord/GkA, Hannover Nord-West Kavernengesellschaft<br />
mbH NDR Norddeutscher Rundfunk Nordwest-Zeitung <br />
Oevermann <strong>GmbH</strong> Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Peguform-<br />
Werke <strong>GmbH</strong> Preußag Energie <strong>GmbH</strong> Preussen Elektra AG RCG<br />
Münster-Oldenburg Rehau Brake Relius <strong>Co</strong>atings Oldenburg R + S Esterwegen<br />
Rügenwalder Wurstfabrik Siemens AG SKL Motoren- und Systemtechnik<br />
AG Staatshochbauamt Bückeburg Staatshochbauamt Munster <br />
Staatshochbauämter Lingen, Oldenburg, Osnabrück, Magdeburg, Schönebeck <br />
Stadtbauämter Hannover, Kiel, Oldenburg, Osnabrück Stöver's Pommes-frites<br />
VEW Münster Volkswagenwerke AG Waskönig + Walter Wasser- u.<br />
Schifffahrtsämter Bremerhaven, Tönning, Kiel, Wilhelmshaven, Magdeburg Wintershall<br />
AG Württembergische Versicherungs AG Wund Objektbau <br />
Im Rahmen der Weltausstellung (EXPO) in Hannover haben wir an folgenden<br />
Projekten mitgewirkt: Deutscher Pavillon Französischer Pavillon <br />
Norwegischer Pavillon Chinesischer Pavillon Thailändischer Pavillon <br />
Kolumbianischer Pavillon Post Pavillon Stadtbahnlinie Skywalk Heliport<br />
D2-Linie SAS Radisson-Hotel Neubau Verwaltung Deutsche Messe AG <br />
Messehallen 19-23 und 25 EXPO Plaza-Bühne Kampfmittelbeseitigungsanlage<br />
(Munster)<br />
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Referenzliste mit Objektangaben zu.<br />
23
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
13 Informationen über unsere Firma und ihre Geschäftsstellen<br />
13.1 Qualifikationen und Mitgliedschaften<br />
Staatlich anerkannter Blitzableitersetzer und Prüfer<br />
VDS anerkannter EMV-Sachkundiger<br />
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001<br />
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagement nach SCC**<br />
Mitglied des TÜV Nord e.V.<br />
Mitglied des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.)<br />
Mitglied des VDB (Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.V.)<br />
Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft e.V.<br />
Mitglied des ABB (Ständiger Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung im VDE)<br />
13.2 Anschriften und Kontakte<br />
ZENTRALE<br />
GESCHÄFTSSTELLEN<br />
Herr H.-J. Zeh<br />
19061 Schwerin<br />
Werkstraße 711<br />
Telefon: (03 85) 61 34-50<br />
Telefax: (03 85) 61 34-46<br />
schwerin@thormaehlen.de<br />
Herr Bernd Plachetka<br />
30419 Hannover<br />
Im Spitzen Ort 37<br />
Telefon: (05 11) 79 29 36<br />
Telefax: (05 11) 75 19 63<br />
hannover@thormaehlen.de<br />
KOOPERATIONSPARTNER<br />
24<br />
<strong>Hans</strong> <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>.<br />
26939 Großenmeer<br />
Meerkircher Straße 40<br />
Telefon: (0 44 83) 92 89-0<br />
Telefax: (0 44 83) 92 89-50<br />
e-mail: info@thormaehlen.de<br />
Herr Thorsten Buss<br />
24223 Raisdorf<br />
Preetzer Straße 29<br />
Telefon: (0 43 07) 65 30<br />
Telefax: (0 43 07) 70 48<br />
raisdorf@thormaehlen.de<br />
Herr Jens Eschen<br />
26607 Aurich<br />
Esenser Straße 255<br />
Telefon: (0 49 41) 9 94 55-33<br />
Telefax: (0 49 43) 9 94 55-34 54<br />
grossefehn@thormaehlen.de<br />
Herr Frank Metting<br />
33729 Bielefeld<br />
Brönninghauser Straße 35c<br />
Telefon: (05 21) 39 06-210<br />
Telefax: (05 21) 39 06-311<br />
bielefeld@thormaehlen.de<br />
Wagener & <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Agrarstraße 1<br />
39130 Magdeburg<br />
Telefon: (03 91) 7 27 05 31<br />
Telefax: (03 91) 7 21 96 39<br />
www.wagener-thormaehlen.de<br />
Wagener & <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Börnecker Straße 17<br />
38889 Blankenburg<br />
Telefon: (0 39 44) 6 30 63<br />
Telefax: (0 39 44) 6 30 63<br />
www.wagener-thormaehlen.de<br />
Besuchen Sie uns im Internet unter www.thormaehlen.de<br />
Außendienstmitarbeiter:<br />
G. Hagemann: (0 47 31) 49 95<br />
A. Brunnert: (04 41) 88 47 44<br />
Herr Lutz Brocksiek<br />
22547 Hamburg<br />
Luruper Hauptstraße 68<br />
Telefon: (0 40) 83 29 44-0<br />
Telefax: (0 40) 83 29 44-50<br />
hamburg@thormaehlen.de<br />
Herr Frank Scharfenberg<br />
28207 Bremen<br />
Hermine-Seelhoff-Straße 4<br />
Telefon: (04 21) 4 30 00-0<br />
Telefax: (04 21) 4 30 00-44<br />
bremen@thormaehlen.de<br />
Herr <strong>Hans</strong>-Ulrich Putty<br />
49084 Osnabrück<br />
Kiebitzheide 39 (Fledder)<br />
Telefon: (05 41) 58 61 43<br />
Telefax: (05 41) 57 31 77<br />
osnabrueck@thormaehlen.de<br />
Wagener & <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Franz-Flemming-Straße 23<br />
04179 Leipzig<br />
Telefon: (03 41) 4 41-20 88<br />
Telefax: (03 41) 4 41 69 87<br />
www.wagener-thormaehlen.de<br />
Wagener & <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Birkholzer Straße 31a<br />
16341 Berlin / Schwanebeck<br />
Telefon: (0 30) 9 44 62 31<br />
Telefax: (0 30) 9 44 62 89<br />
www.wagener-thormaehlen.de
Blitznachrichten Ausgabe <strong>2000</strong>/2001<br />
Verantwortlich: Dipl.-Ing. Reyno <strong>Thormählen</strong>, © <strong>Hans</strong> <strong>Thormählen</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>.<br />
17. Ausgabe, September <strong>2000</strong>, Erstauflage 1972<br />
25