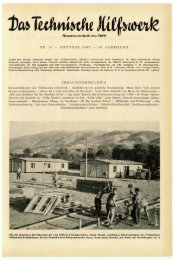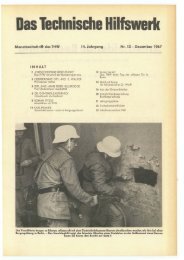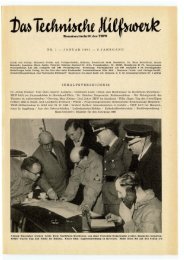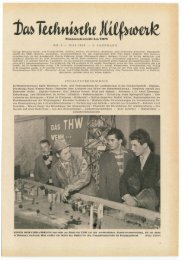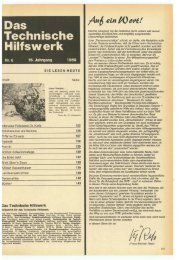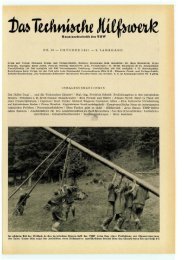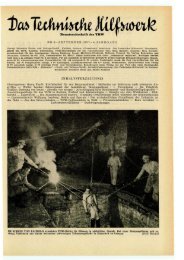Das Technische
Das Technische
Das Technische
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
, <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> N 6643 E<br />
HiHswerk .""Ou01 70<br />
im August '70<br />
Erlaß über die Errichtung des<br />
<strong>Technische</strong>n Hilfswerks (THW) als<br />
nichtrechtsfähige Bundesanstalt 170<br />
Katastrophenschutz im Blickwinkel<br />
der Energie- und Wasserversorgung<br />
172<br />
THW intern 177<br />
Test: <strong>Das</strong> Tornisterfiltergerät<br />
TOF 200 B 178<br />
Aus den Landesverbänden 181<br />
Personalia/Presseecho 184<br />
THW-Schule Hoya ... 185<br />
... und Ahrweiler 187<br />
Aus dem Weißbuch '70 189<br />
Technik 190<br />
Uranspaltung bis heute 191<br />
Bücher/Zeitschriften 192<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk<br />
Herausgegeben von der Bundesanstalt Tech -<br />
nisches Hilfswerk, Bonn-Bad Godesberg,<br />
Deutschherrenstraße 93<br />
Chefredakteur:<br />
Hans-Chrlstoph Toelle<br />
Redaktion:<br />
Manfred Sadlowski (Chef vom Dienst)<br />
Erlch Bartocha<br />
Wolfgang Wilczek (Layout)<br />
53 Bonn, Bennauer Straße 31, Telefon 22 07 44<br />
Verlag , Anzeigenverwaltung und Vertrieb:<br />
Mönch-Verlag Koblenz - Bonner Büro,<br />
Bonn, Bennauer Straße 31, Telefon 22 07 44<br />
Druck :<br />
Görres-Druckerel GmbH, 54 Koblenz,<br />
Industriegebiet, Carl-Spaeter-Straße 1<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk erscheint monatlich<br />
zum Einzelpreis von 70 Pfennig. Postbezug:<br />
Viertelj ährlich 2,- DM einschließlich ,Zustellgebühr.<br />
In den Preisen sind 5,5'10 Mehrwertsteuer<br />
enthalten. Bestellungen beim Verlag,<br />
bel der Post oder Im Buchhandel.<br />
Zur Zelt Ist die AnzeigenpreislIste 5 gültig.<br />
Die mit vollem Namen oder mit gekürzten<br />
Zeichen versehenen Artikel stellen nicht unbedingt<br />
die Meinung der Redaktion dar. Unverlangt<br />
eingesandte Beiträge sind erbeten, Redaktion<br />
und Verlag können jedoch keine Haftung<br />
dafür übernehmen. NIchtbenötIgte Unterlagen<br />
werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto<br />
beiliegt.<br />
BIldnachweis:<br />
Mönch-Archiv, Piaska, Kriseher, Breitenbach,<br />
Armin, Weiler, Werkfoto Krupp, Deutsche Tafelglas<br />
AG, Pantenburg, Conti-Press.<br />
Titellayout: Wolfgang Wilczek<br />
LIEBE FREUNDE'<br />
Es scheint ein besonderes Merkmal unserer Tage zu sein,<br />
daß die Probleme, die seit aUen Zeiten uns in Atem halten,<br />
in wohlformulierten Reden und anspruchsvollen Kommentaren<br />
immer wieder in das Blickfeld der Menschen gezogen<br />
werden.<br />
Beim näheren Zuschauen stellen wir oft fest, daß es in der<br />
Regel beim Reden bleibt: ein philosophisches Geschwätz<br />
als Alibi einer ansonsten inhumanen Einstellung zur geseIlschaftspolitischen<br />
Verantwortung, ein Feigenblatt, das<br />
den Egoismus eines dekadenten Bürgertums kaum noch<br />
verbergen kann.<br />
Wir alle wissen, daß diese Aussage kein gedrechselter<br />
Pessimismus ist, denn wir sind als THW-Helfer seit 20<br />
Jahren mit der Schattenseite menschlichen Zusammenlebens<br />
konfrontiert.<br />
Wir sind immer dann aufgerufen, wenn die Not über Dörfer<br />
und Städte hereinbricht, wenn Naturkatastrophen oder<br />
menschliches Versagen die Existenz - die ganz einfache<br />
menschliche Existenz - in Frage stellt.<br />
Wir haben nicht zu fragen, ob unsere Hilfeleistung vom<br />
einzelnen verdient ist, ob unserem persönlichen Einsatz<br />
ein politisches Wohlverhalten der anderen Seite vorausging.<br />
Wir helfen, und das seit 20 Jahren, trotzdem uns dieses<br />
Helfen nicht immer leicht gemacht wurde. Es gab und gibt<br />
in unserer Gesellschaft viele, die an den Sonnentagen<br />
nicht an übermorgen denken wollen und jeden Pfennig<br />
für sinnlos ausgegeben betrachten, der nicht vordergründig<br />
den Erfolg von Morgen gewährleistet.<br />
So betrachtet könnten die hinter uns liegenden 20 Jahre<br />
kaum Ansporn für die nächsten Jahrzehnte sein.<br />
Aber dem ist nicht so: THW-Helfer haben sich der Notsituation<br />
verschrieben. Sie wissen, daß "ihre Stunde"<br />
immer wieder kommt und sie hineinzwingt in die Bewährung.<br />
Eine Bewährung, von der menschliches Leben und<br />
die Erhaltung schwer verdienter Sachgüter abhängt.<br />
Wenn wir so die 20 Jahre zurückschauen, dann brauchen<br />
wir uns nicht zu verstecken. <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk hat<br />
gute Arbeit geleistet, ob bei uns in der Heimat oder<br />
irgendwo draußen in der Welt. An diesem Tage dürfen<br />
wir wohl einmal von uns selbst behaupten: Die THW-Helfer<br />
haben sich um unser Land und die Menschen in aller<br />
Welt, denen sie helfen durften, verdient gemacht.<br />
Verdient gemacht hat sich ganz besonders der bisherige<br />
Direktor des THW, DipL-lng. Hans Zielinski, der seit dem<br />
1. Juli 1970 eine neue verantwortungsvolle Tätigkeit im<br />
Bundesamt übernommen hat. Die Redaktion unserer Zeitschrift<br />
verabschiedet sich von einem fairen und verständnisvollen<br />
Direktor, der die Bedeutung der journalistischen<br />
Arbeit für das THW nie übersah.<br />
Gleichzeitig darf auch ich mich von Ihnen verabschieden,<br />
da ich am 1. September 1970 einen neuen Aufgabenbereich<br />
beim Bundesminister des Innern übernehme.<br />
Dem <strong>Technische</strong>n Hilfswerk ein herzliches Glück auf für<br />
die nächsten Jahrzehnte.<br />
Ihr Hans Christoph Toelle
170<br />
I. Name, Rechtsform, Sitz<br />
(1) <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk wird als nichtrechtsfähige<br />
Bundesanstalt errichtet. Die Anstalt untersteht<br />
dem Bundesminister des Innern.<br />
(2) Der Sitz der Anstalt wird vom Bundesminister des<br />
Innern bestimmt.<br />
11. Aufgaben<br />
(1) <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk hat folgende Aufgaben:<br />
a) Leistung technischer Hilfe bei Katastrophen<br />
und Unglücksfällen größeren Ausmaßes,<br />
b) Leistung technischer Dienste im zivilen Luftschutz,<br />
c) Leistung technischer Hilfe bei der Beseitigung<br />
von öffentlichen Notständen, durch welche die<br />
lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung,<br />
der öffentliche Gesundheitsdienst oder der<br />
lebensnotwendige Verkehr gefährdet werden,<br />
sofern alle anderen hierfür vorgesehenen Maßnahmen<br />
nicht ausreichen (vgl. hierzu auch den<br />
Grundsatz der Subsidiarität, Abschnitt IX) .<br />
(2) Hoheitliche Aufgaben werden vom <strong>Technische</strong>n<br />
Hilfswerk nicht wahrgenommen.<br />
(3) <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk wird an den Anlagen<br />
und in den Betrieben der öffentlichen Versorgung nur<br />
im Einvernehmen mit den nach dem Energienotgesetz<br />
zuständigen Hauptlast- oder Hauptgasverteilern tätig.<br />
111. Aufbau<br />
(1) <strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk wird von dem Direktor<br />
geleitet.<br />
(2). Beim <strong>Technische</strong>n Hilfswerk wird ein Verwaltungsbeirat<br />
gebildet.<br />
(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben des <strong>Technische</strong>n<br />
Hilfswerks, das sich über das gesamte Bundesgebiet<br />
und das Land Berlin erstreckt, werden in den Ländern<br />
Landesbeauftragte, in den Landkreisen Kreisbeauftragte<br />
und in den Gemeinden Ortsbeauftragte bestellt.<br />
IV. Berufung und Aufgaben des Direktors<br />
(1) Der Direktor wird vom Bundesminister des Innern<br />
bestellt und entlassen.<br />
(2) Der Direktor bestellt und entläßt die Landesbeauftragten,<br />
die Kreisbeauftragten und die Ortsbeauftrag-<br />
ten. Vor der Bestellung der Landesbeauftragten sind<br />
die obersten Landesbehörden, vor der Bestellung der<br />
Kreis- und Ortsbeauftragten die Kreis- und Gemeindeverwaltungen<br />
zu hören.<br />
(3) Die Anstellung und Entlassung der Angestellten<br />
erfolgt durch den Direktor, soweit diese Befugnisse<br />
nicht auf die Landes-, Kreis- oder Ortsbeauftragten<br />
übertragen werden.<br />
(4) Der Direktor ist dem Bundesminister des Innern<br />
für den Aufbau des <strong>Technische</strong>n Hilfswerks und die<br />
Durchführung der Aufgaben sowie für die ordnungsmäßige<br />
Verwendung der Haushaltsmittel verantwortlich.<br />
V. Verwaltungsbeirat<br />
(1) Der Bundesminister des Innern beruft den Verwaltungsbeirat,<br />
der aus Vertretern der beteiligten<br />
Bundesministerien, der Deutschen Bundesbahn, der<br />
Länder, der Bundesvereinigung, der kommunalen<br />
Spitzenverbände und der Spitzenorganisationen, der<br />
Unternehmer und der Arbeitnehmer bestehen soll.<br />
(2) Der Verwaltungsbeirat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit<br />
aller am <strong>Technische</strong>n Hilfswerk beteiligten<br />
Behörden und Verbände zu fördern, das Tech-
Erlaß über die Errichtung<br />
des <strong>Technische</strong>n Hilfswerks (THW) als<br />
nichtrechtsfähige Bundesanstalt<br />
Vom 25. August 1953<br />
nische Hilfswerk in allen wichtigen Fragen zu beraten<br />
und bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen.<br />
Er ist vor der Bestellung des Direktors, der<br />
Landesbeauftragten sowie der Anstellung aller hauptamtlichen<br />
Angestellten von der Gruppe TO.A 11 an aufwärts.<br />
zu hören. Der Verwaltungsbeirat nimmt zu dem<br />
vom Direktor des <strong>Technische</strong>n Hilfswerks aufgestellten<br />
Haushaltsvoranschlag des <strong>Technische</strong>n Hilfswerks<br />
sowie zu dem Jahresbericht Stellung.<br />
(3) Den Vorsitz im Verwaltungsbeirat führt der Vertreter<br />
des Bundesministers des Innern. Der Direktor des<br />
<strong>Technische</strong>n Hilfswerks nimmt an den Sitzungen des<br />
Verwaltungsbeirats mit beratender Stimme teil.<br />
(4) Der Verwaltungsbeirat beschließt mit einfacher<br />
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet<br />
die Stimme des Vorsitzenden.<br />
VI. Helfer<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk bedient sich bei der Durchführung<br />
seiner Aufgaben freiwilliger, ehrenamtlich tätiger<br />
Helfer, vornehmlich aus technischen Berufen, die<br />
sich hierzu verpflichtet haben. Nur Personen, die für<br />
eine demokratischen Einstellung Gewähr bieten, können<br />
ihm angehören.<br />
VII. Katastrophenschutz und Luftschutz<br />
(1) Bei Katastrophen sowie bei Unglücksfällen größeren<br />
Ausmaßes kann jede für die Hilfeleistung zuständige<br />
Verwaltungsbehörde die Unterstützung des <strong>Technische</strong>n<br />
Hilfswerks in Anspruch nehmen. Um die<br />
rechtzeitige Hilfeleistung sicherzustellen, hat das<br />
<strong>Technische</strong> Hilfswerk mit den zuständigen Behörden<br />
ständig Fühlung zu halten. Bei Gefahr im Verzuge<br />
kann das <strong>Technische</strong> Hilfswerk auch ohne behördliche<br />
Anordnung tätig werden. Es unterrichtet die örtlich<br />
zuständige Behörde unverzüglich über die von ihm<br />
getrOffenen Maßnahmen. Die zuständige Behörde<br />
entscheidet über die weitere Hilfeleistung.<br />
(2) Bei der Leistung technischer Dienste im zivilen<br />
Luftschutz ist das <strong>Technische</strong> Hilfswerk an die hier<br />
geltenden besonderen Bestimmungen gebunden.<br />
VIII. Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen<br />
(1) Bei öffentlichen Notständen, die den Bereich nur<br />
eines Landes berühren, steht das <strong>Technische</strong> Hilfswerk<br />
den Ländern, den Landkreisen und Gemeinden<br />
auf Anforderung der obersten Landesbehörde zur<br />
Verfügung. Über die Hilfeleistung entscheidet die<br />
oberste Landesbehörde im Benehmen mit dem Bundesminister<br />
des Innern.<br />
(2) Bei öffentlichen Notständen, die über den Bereich<br />
eines Landes hinausgehen oder hinauszugehen drohen,<br />
ordnet die Bundesregierung, bei Gefahr im Verzuge<br />
der Bundesminister des Innern im Einvernehmen<br />
mit den beteiligten Bundesministern und nach<br />
Anhörung der obersten Landesbehörden die Hilfeleistung<br />
an.<br />
(3) Bei öffentlichen Notständen im Bereich von bundeseigenen<br />
Verwaltungen ordnet die Bundesregierung,<br />
bei Gefahr im Verzuge der Bundesminister des<br />
Innern im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachminister<br />
des Bundes die Hilfeleistung an.<br />
IX. Subsidiarität der Hilfeleistung bel öffentlichen<br />
Notständen<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk leistet erst dann Hilfe, wenn<br />
die Sozialpartner, die Gemeinden, die Landkreise oder<br />
das Land nicht in der Lage sind, die lebenswichtige<br />
Versorgung aufrecht zu erhalten.<br />
171
In unserer Zeit, die von<br />
Katastrophen aller Art<br />
erschüttert wird und in der<br />
zudem Vorsorge getroffen<br />
wird, um den Schrecken eines<br />
Krieges zu begegnen, ist es<br />
allzu berechtigt, nach dem<br />
vorhandenen Katastrophenschutz<br />
zu fragen. Sie meine<br />
Herren, werden sicher mit der<br />
Erwartung hierhin gekommen<br />
sein, zu erfahren, ob und in<br />
welcher Weise sich die<br />
Bundesregierung an der<br />
Bekämpfung von Katastrophen,<br />
soweit sie verheerende<br />
Folgen für die Energie- und<br />
Wasserversorgung nach sich<br />
ziehen kann, beteiligt.<br />
Zunächst - das darf hier<br />
vorausgesetzt sein - wird es<br />
aus vielfachen Gründen im<br />
Interesse eines jeden Unternehmens<br />
liegen, sich selbst<br />
zu schützen. Es geht doch<br />
zunächst um den Schutz der<br />
Werksangehörigen, dann der<br />
Maschinen, Anlagen und<br />
Gebäude, schließlich um den<br />
Ausfall von Leistungen oder<br />
Erzeugung. Auch die<br />
erweiterte Verbundwirtschaft<br />
ist schon allein aus<br />
wirtschaftlichen Erwägungen<br />
kein Allheilmittel gegen<br />
Katastrophen, zumal im<br />
Kriegsfall das Verbundsystem<br />
sehr schnell durchbrochen<br />
würde. Eine Ummantelung<br />
aller Energie- und<br />
Versorgungsanlagen mit<br />
bomben- oder gar atombombensicherem<br />
Eisenbeton<br />
scheidet aus wirtschaftlichen<br />
und praktischen Gründen<br />
aus.<br />
Auf Aufrechterhaltung der<br />
Funktionsfähigkeit der<br />
Versorgungsbetriebe nach<br />
schweren Zerstörungen im<br />
V-Fall sind nach dem<br />
Wirtschafts-Sicherstellungsgesetz<br />
Verordnungen in<br />
Bearbeitung, nach denen der<br />
Regierungspräsident in<br />
seinem Verwaltungsbezirk<br />
Firmen der Bau-, Maschinen-<br />
172<br />
bau- oder Elektro-Industrie<br />
durch Zwangsvertrag<br />
verpflichten kann, die<br />
Wiederinstandsetzung durchzuführen.<br />
Rettung von Personen<br />
Für die Rettung von<br />
Personen und zur Verminderung<br />
von Sachschäden<br />
hat jedes Werk auch heute<br />
schon gewisse Maßnahmen<br />
getroffen. Teilweise bestehen<br />
Werksfeuerwehren, fast in<br />
allen Versorgungsbetrieben<br />
sind Unfall-, Rettungs- oder<br />
Sanitätsstationen eingerichtet,<br />
darüber hinaus wird es<br />
ausnahmslos Instandsetzungskolonnen<br />
geben, die<br />
bei betrieblichen Störungen<br />
sofort eingesetzt werden.<br />
Dieser Selbstschutz wird für<br />
schwerste Zerstörungen,<br />
wie sie im V-Fall zu erwarten<br />
sind, in jeder Hinsicht<br />
unzureichend sein. Die<br />
Förderung dieses Selbstschutzes<br />
in den Betrieben<br />
obliegt auch den Gemeinden<br />
bzw. den zuständigen<br />
Hauptverwaltungsbeamten,<br />
mit denen beim Ausbau<br />
des Werkschutzes Verbindung<br />
aufgenommen werden sollte.<br />
Auch der Bundesverband<br />
für den Selbstschutz kann<br />
bei der Unterrichtung,<br />
in der Ausbildung sowie in<br />
fachlichen Fragen des<br />
Sach- und Personenschutzes<br />
fördernd mitwirken.<br />
Für den V-Fall müssen<br />
Schutzraumbauten für die<br />
Werksangehörigen vorhanden<br />
sein. Durch die damit<br />
verbundenen erheblichen<br />
Kosten sind Maßnahmen auf<br />
diesem Gebiet immer wieder<br />
zurückgestellt worden. Es<br />
KATASTROPHENSCHUTZ<br />
sind aber Gesetze in<br />
Vorbereitung, welche die<br />
Förderung des Schutzraumbaues<br />
mit staatlichen Mitteln<br />
vorsehen.<br />
Bei allen Vorsorgemaßnahmen<br />
verdient der<br />
Fall eine besondere<br />
Beachtung bei der ein durch<br />
eine Katastrophe betroffenes<br />
Versorgungsunternehmen<br />
auf Grund seines Personalmangels<br />
nicht mehr in der<br />
Lage ist, die Energie- oder<br />
Wasserversorgung im<br />
notwendigen Umfang<br />
durchzuführen.<br />
Um schwerwiegende Folgen<br />
bei auftretenden Versorgungsschwierigkeiten<br />
abzuwenden,<br />
steht eine Hilfsorganisation<br />
zur Verfügung, die sich<br />
<strong>Technische</strong>s Hilfswerk nennt<br />
und die vom Bund<br />
unterhalten, unterstützt und<br />
getragen wird. Auf diese<br />
Einrichtung möchte ich im<br />
Folgenden näher eingehen:<br />
Technik<br />
und Organisation<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk<br />
ist eine Organisation, die<br />
seit 20 Jahren besteht.<br />
Zum Unterschied zu vielen<br />
anderen Hilfswerken, die<br />
sich karitativen und sozialen<br />
Aufgaben widmen oder die<br />
zur Abwehr bestimmter<br />
Gefahren - zum Beispiel<br />
des Feuers - eingesetzt<br />
werden, wird das THW<br />
bei besonderen Notständen<br />
tätig, zu deren Abwehr<br />
technische Hilfsmittel und<br />
technisch geschultes Personal<br />
erforderlich ist. I<br />
Die Hauptaufgaben des THW<br />
liegen auf fol genden<br />
Gebieten :<br />
Leistung technischer Hilfe<br />
bei größeren Unglücksfällen<br />
und Katastrophen,<br />
Leistung technischer<br />
Dienste im zivilen<br />
Bevölkerungsschutz für<br />
Bergungs- und Instandsetzungsaufgaben,<br />
Leistung technischer Hilfe<br />
bei besonderen Notständen,<br />
wie si e für die<br />
Bevölkerung bei Ausfall<br />
von Strom, Wasser, Gas<br />
oder bei Zerstörungen im<br />
Abwassernetz auftreten.<br />
Mit fortschreitender<br />
Gefährdung des Menschen<br />
auf der Straße und mit<br />
zunehmender Verseuchung<br />
des Grundwassers sind in<br />
den letzten Jahren folgende<br />
Aufgaben dazugekommen:<br />
Hilfe bei größeren<br />
Unglücksfällen auf<br />
Hauptstraßen und<br />
- Bekämpfung von<br />
Ölschäden.<br />
Eine Organisation, die diesen<br />
Aufgabenkatalog zu<br />
bewältigen hat, kann nur<br />
sinnvoll bei Katastrophen<br />
eingesetzt werden, wenn<br />
folgende Voraussetzungen<br />
gegeben sind :<br />
Es müssen ausreichende und<br />
gut ausgebildete Kräfte<br />
vorhanden sein.<br />
Diese Kräfte müssen in<br />
kürzester Zeit in<br />
ausreichender Anzahl an<br />
Gefahrenpunkten zusammengezogen<br />
werden können.<br />
<strong>Das</strong> notwendige Gerät und<br />
die erforderliche Ausrüstung<br />
müssen in kurzer Zeit
im Blickwinkel der Energieund<br />
Wasserversorgung<br />
Rede des früheren Direktors des <strong>Technische</strong>n Hilfswerks, Hans Zielinski, vor Industrievertretern<br />
dem Einsatzort zugeführt<br />
werden können.<br />
Eine ausreichende finanzielle<br />
Unterstützung muß gewährleistet<br />
sein.<br />
73000 Helfer<br />
die ihm gestellte Aufgabe<br />
zu erfüllen.<br />
Alle Ortsverbände innerhalb<br />
der Grenzen einer<br />
Landesregierung sind zu<br />
einem Landesverband<br />
zusammengefaßt, davon gibt<br />
es einschließlich des<br />
Bundeslandes Berlin elf an<br />
der Zahl. Die Leitung des<br />
THW hat ihren Sitz in Bonn-<br />
Bad Godesberg. Auf dem<br />
Gebiet der Verwaltung ist<br />
<strong>Das</strong> THW verfügt über 73 000<br />
Helfer, die sich auf insgesamt I fur zIvilen<br />
mit Bundesamt<br />
560 Ortsverbände verteilen. (BzB) organisatorisch<br />
Diese weitgehende Aufteilung verbunden. Es hat so auf<br />
; gewährleistet, daß das THW<br />
, nicht nur in jedem Bezirk<br />
der einen Seite den Status<br />
einer nicht rechtsfähigen<br />
I<br />
der Bundesrepublik Bundesanstalt; auf der<br />
, eingesetzt werden kann, anderen Seite ist die Leitung<br />
sondern daß auch überall des THW eine Abteilung<br />
Helfer mit guter Ortskenntnis des BzB.<br />
zur SchadensteIle gerufen<br />
werden können.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk<br />
ist eine Organisation, die<br />
sich vornehmlich aus<br />
Freiwilligen, daneben aus<br />
einem sehr kleinen Stab<br />
hauptamtlicher Kräfte<br />
zusammensetzt. <strong>Das</strong><br />
Stärkeverhältnis beträgt etwa<br />
100 : 1. Es könnte vermutet<br />
werden, daß bei der fast<br />
ausschließlichen ehrenamtlichen<br />
Tätigkeit eine<br />
Unsicherheit in bezug auf<br />
die für einen Einsatz<br />
verfügbaren Kräfte in Kauf<br />
genommen werden müßte.<br />
Die bisherigen Einsätze<br />
haben jedoch bewiesen, daß<br />
die berufliche Einspannung<br />
nicht zum Hindernis<br />
geworden ist. Von ganz<br />
wenigen Ausnahmefällen<br />
abgesehen, haben sich die<br />
A rbeitgeber nicht gegen den<br />
A bzug ihrer Arbeitskräfte<br />
ausgesprochen, wenn es<br />
um die Bekämpfung von<br />
Katastrophen ging.<br />
Andererseits setzt der<br />
, freiwillige THW-Helfer alles<br />
! daran - auch unter lnkauf-<br />
! nahme von Entbehrungen -,<br />
Strom und Wasser<br />
Unter allen Aufgaben des<br />
THW ist die Instandsetzung<br />
von Versorgungsleitungen<br />
als wichtigste anzusehen.<br />
In unserer hochzivilisierten<br />
Welt ist ein Leben ohne<br />
Stromversorgung undenkbar;<br />
als Beispiel hierfür soll an<br />
die Panik erinnert werden,<br />
die entstand, als in New York<br />
nur für Stunden der Strom<br />
ausfiel. Noch mehr aber ist<br />
alles menschliche und<br />
tierische Leben vom<br />
Vorhandensein des Trinkwassers<br />
abhängig.<br />
Unterbrechungen führen<br />
nach kurzer Zeit zu gesundheitlichen<br />
Schädigungen,<br />
bei längerem Ausbleiben<br />
ist ein Chaos unvermeidbar.<br />
Wenn es auch durch die<br />
Verbundwirtschaft Unterbrechungen<br />
und Ausfällen<br />
I in der Strom- und Wasser-<br />
I<br />
versorgung entgegengewirkt<br />
wird, so ist damit die<br />
einwandfreie Versorgung<br />
noch nicht garantiert. Im<br />
Gegenteil: Der aus<br />
Rationalisierungsgründen<br />
fortschreitende Personalabbau<br />
steigert die Gefahr<br />
längerer Ausfälle, denn sehr<br />
bald ist bei größeren Schäden<br />
die Grenze erreicht, wo das<br />
vorhandene Personal für die<br />
Wiederingangsetzung von<br />
Versorgungsbetrieben nicht<br />
mehr ausreicht.<br />
Für solche Katastrophenfälle<br />
bietet sich das THW als<br />
Nothelfer an. In den<br />
Instandsetzungs-Einheiten<br />
für die Strom-, Wasser- und<br />
Gas-Versorgungsanlagen<br />
sind im THW handwerklich<br />
geschulte Kräfte vorhanden,<br />
die vielfach durch ihren<br />
Beruf große Erfahrungen<br />
mitbringen. Diese<br />
sogenannten Fachhelfer<br />
werden sowohl in ihrem<br />
Ortsverband als auch zum<br />
Teil an der THW-Schule<br />
Ahrweiler so auf ihr<br />
Spezialgebiet eingeübt, daß<br />
sie auch unter erschwerten<br />
Bedingungen - wie bei<br />
unzureichender Beleuchtung,<br />
bei einem Unwetter -<br />
fachgerecht Instandsetzungsarbeiten<br />
durchzuführen<br />
vermögen. Von den 73 000<br />
Helfern stehen heute schon<br />
10000 für Spezialarbeiten<br />
an Versorgungsnetzen zur<br />
Verfügung. Diese Kräfte<br />
können durch eine mehrfache<br />
Anzahl von Helfern aus den<br />
Sparten der Bergung, des<br />
allgemeinen Katastrophenschutzes,<br />
des Wasserdienstes<br />
und des Brückenbaues<br />
verstärkt werden, wenn es<br />
sich nicht um Arbeiten<br />
I handelt, die ein spezielles<br />
Fachwissen erfordern.<br />
Soll noch nicht erreicht<br />
Die Ausrüstung für die<br />
10000 Helfer des<br />
Instandsetzungsdienstes<br />
bedarf noch einer<br />
wesentlichen Ergänzung.<br />
Starke Einschränkungen<br />
auf dem Ausgabesektor des<br />
Bundeshaushaltes haben das<br />
geplante Ausrüstungssoll<br />
bisher nur zu 60 Prozent<br />
erreichen lassen.<br />
<strong>Das</strong> Gerät ist in tragbaren<br />
und genau bezeichneten<br />
Gerätekisten untergebracht.<br />
Für den Transport des<br />
Gerätes und der Helfer<br />
stehen Gerätekraftwagen,<br />
Lastkraftwagen und<br />
VW-Busse in einer dem<br />
Gerätepark zugeordneten<br />
Zah l zur Verfügung. Der<br />
endgültige Sollbestand kann<br />
nicht auf weite Sicht im<br />
Voraus festgelegt werden,<br />
weil verbesserte Verfahren<br />
und Fortschritte in der<br />
Technik immer wieder neues<br />
Gerät erforderlich machen.<br />
Bei der Ausrüstung des THW<br />
handelt es sich hauptsächlich<br />
um handelsübliches<br />
Werkzeug, um Vorrichtungen<br />
und um Beleuchtungsgerät.<br />
Spezialeinrichtungen, Kabelmuffen,<br />
Rohrleitungen mit<br />
den Absperrorganen fehlen.<br />
Dieses Material muß aus<br />
dem Lagerbestand der<br />
Versorgungsunternehmen zur<br />
Verfügung gestellt werden.<br />
Dem THW ist die Aufgabe<br />
erteilt, bei der Behebung<br />
von Schäden in den Strom-,<br />
Wasser- und Gasnetzen auf<br />
Anforderung mitzuwirken.<br />
Wenn die Versorgungsunternehmen<br />
gewillt sind,<br />
die sich ihnen bietenden<br />
Möglichkeiten zu ergreifen,<br />
um Ausfälle abzukürzen<br />
oder gar zu verhindern, dann<br />
ist ein Zusammengehen<br />
der Versorgungsunternehmen<br />
mit dem THWeigentlich<br />
unausbleiblich.<br />
173
Katastrophenschutz im Blickwinkel der Energie- und Wasserversorgung<br />
Unbegrenzte Hilfe<br />
Die Hilfe und Unterstützung,<br />
die das THW geben kann,<br />
ist - soweit es sich um<br />
eine Personalverstärkung<br />
handelt -, fast unbegrenzt.<br />
<strong>Das</strong> Alarmsystem und die<br />
Motorisierung erlauben, daß<br />
die erforderlichen Kräfte<br />
innerhalb kurzer Zeit zur<br />
Verfügung gestellt werden<br />
können. Die große Anzahl<br />
an geschulten Fachkräften<br />
auf den verschiedensten<br />
Gebieten ermöglicht es, daß<br />
mit Hilfe vorhandener<br />
Karteien bei Bekanntgabe<br />
der Gefahrenlage nur<br />
Helfer ausgesucht werden,<br />
deren Einsatz mit Sicherheit<br />
zum Erfolg führt.<br />
Trotzdem sollte es nie an<br />
einer genügenden<br />
Vorbereitung für den Einsatz<br />
fehlen. Größere Ausfälle<br />
lassen sich bei Katastrophen<br />
nur dann vermeiden, wenn<br />
ein Plan zur Abwehr der<br />
Katastrophe · besteht. Da<br />
hinein gehören alle<br />
Gefahrenquellen mit genauen<br />
Anmerkungen, wie sie<br />
anzugehen sind, dazu gehört<br />
ein Lageplan mit allen<br />
Zugangswegen und mit<br />
eingezeichneten Leitungen.<br />
Es müssen außerdem<br />
eingetragen sein: die THW-<br />
Ortsverbände (mit Tel.-Nr.),<br />
die Ortsbeauftragten, die<br />
Geschäftsführer, wichtige<br />
Lieferfirmen, Transportunternehmen,<br />
Polizei,<br />
behördliche KatastrophenschutzsteIlen<br />
usw.<br />
Diese Planung sollte<br />
gemeinsam mit einer<br />
Führungskraft des THW<br />
erarbeitet werden.<br />
Daneben müßte eine<br />
Einweisung an die Helfer<br />
des zuständigen OV<br />
durchgeführt werden. Für<br />
eine gute Zusammenarbeit<br />
ist es auch wichtig, daß Helfer<br />
des THW an Sonnabenden<br />
oder Sonntagen den<br />
174<br />
Montagetrupps der<br />
Versorgungswerke beigesteilt<br />
werden. Dabei lernt das<br />
Betriebspersonal die<br />
einzelnen Helfer, ihre<br />
Fähigkeiten und<br />
Verwendungsmöglichkeiten<br />
kennen.<br />
Freiwillige Fachkräfte<br />
Neben der Abstimmung<br />
in allen vorzunehmenden<br />
Arbeiten ist es auch<br />
notwendig, eine solche in<br />
dem benötigten Werkzeug zu<br />
suchen. Ein Zuviel erschwert<br />
die Übersichtlichkeit, ein<br />
Zuwenig macht die<br />
Durchführung der Arbeiten<br />
unmöglich.<br />
Eine Beratung durch das<br />
Fachpersonal der<br />
Versorgungsbetriebe für die<br />
Ergänzung oder<br />
Auswechslung des beim THW<br />
verwendeten Gerätes wäre<br />
dringend erforderlich.<br />
Vom THW kann jedes<br />
Fachpersonal gestellt werden,<br />
soweit nicht Spezialerfahrungen<br />
in Versorgungsbetrieben<br />
notwendig sind.<br />
Selbstverständlich wird vom<br />
THW aus nie Fachpersonal<br />
von Versorgungsbetrieben<br />
eingesetzt werden, selbst<br />
wenn es sich um noch so<br />
bedeutsame Führungskräfte<br />
im THW handelt.<br />
Andererseits gibt es im THW<br />
viele Fachleute, die nicht in<br />
irgendeinem Beschäftigungsverhältnis<br />
zu einem<br />
Versorgungsbetrieb stehen.<br />
Da sind in Berufsgruppen<br />
vertreten: Ingenieure und<br />
Techniker auf den Gebieten<br />
Elektrotechnik, Maschinenbau<br />
und Bauwesen; Handwerksmeister<br />
und Handwerker,<br />
die als Starkstrom- oder<br />
SChwachstromelektriker,<br />
Installateure, Rohrverleger,<br />
Stahlbauer, Heizungsfachleute<br />
eingesetzt sind.<br />
Diese Fachkräfte haben sich<br />
freiwillig dazu entschieden,<br />
in Notsituationen ihre ganze<br />
Kraft einzusetzen. Sie haben<br />
den Wunsch, sich zudem für<br />
den Katastrophenschutz<br />
weiter ausbilden zu lassen.<br />
Hier liegt an freiwilliger<br />
Hilfsdarbietung ein Angebot<br />
vor, das nicht unbeachtet<br />
bleiben sollte.<br />
öl-Verschmutzung<br />
Als wertvollstes Gut des<br />
Menschen kann das Wasser<br />
angesehen werden. Dabei<br />
bestehen viele Gefahren, es<br />
zu verderben und<br />
unbrauchbar zu machen.<br />
An den Seen der Bundesrepublik<br />
bzw. durch die Seen<br />
hindurch verlaufen immer<br />
mehr Öl-Fernleitungen und<br />
bedrohen damit in<br />
zunehmendem Maße die<br />
Reservoire für unsere<br />
Wasserversorgung.<br />
An diesen Seen werden<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
in der Weise getrOffen, daß<br />
Vorrichtungen eingesetzt<br />
werden, um bereits<br />
eingelaufenes Öl auf dem<br />
schnellsten Wege zu<br />
entfernen. <strong>Das</strong> geschieht<br />
zum Beispiel auf dem<br />
Chiemsee, in dem zunächst<br />
das eingelaufene Öl durch<br />
schwimmende 'Sperrkörper<br />
eingekreist wird, um es dann<br />
über ÖI-Absauggeräte<br />
schwimmenden Tankgefäßen<br />
zuzuführen. Eine dauernde<br />
Gefahrenquelle für den<br />
Chiemsee ist die kürzlich<br />
fertiggestellte Öl-Fernleitung,<br />
die von Triest über die<br />
Alpen nach Ingolstadt führt.<br />
<strong>Das</strong> THW ist hier am<br />
Chiemsee wie auch an<br />
anderen Stellen, wie z. B. auf<br />
den Havelseen in Westberlin,<br />
damit beauftragt, die Sperren<br />
im Gefahrenfall einzufahren<br />
und das an der Oberfläche<br />
schwimmende Öl zu<br />
entfernen.<br />
Ist das Wasser nicht mehr<br />
genießbar, müssen Trinkwasseraufbereitungsanlagen<br />
eingesetzt werden.<br />
Bei dem letzten THW-Einsatz<br />
in der Türkei ging es in der<br />
Hauptsache darum, das in<br />
den Bachläufen durch<br />
Tierkadaver verseuchte<br />
Wasser für Trinkzwecke<br />
brauchbar zu machen.<br />
<strong>Das</strong> THW besitzt z. Z. noch<br />
keine Trinkwasser-<br />
Aufbereitungsanlage; jedoch<br />
haben einige Landesregierungen,<br />
wie z. B.<br />
Nordrhein-Westfalen, Hessen<br />
und Niedersachsen für den<br />
von ihnen wahrzunehmenden<br />
Katastrophenschutz Trinkwasseranlagen<br />
beschafft, die<br />
sie der Obhut verschiedener<br />
Organisationen: - der<br />
Freiwilligen Feuerwehr - und<br />
dem THW - zur Betreuung,<br />
Wartung, Pflege, Bedienung<br />
und damit zum Einsatz<br />
übergeben haben. Es handelt<br />
sich dabei um fahrbare<br />
Anlagen, teilweise sind es<br />
Berkefeld-Aggregate, deren<br />
Leistungsvermögen zwischen<br />
3 -10 m 3 /h liegt. Schon eine<br />
Anlage mit einer Leistung<br />
von 3 m 3 /h reicht aus, um<br />
eine Notversorgung für 3600<br />
Menschen sicherzustellen,<br />
wenn das Trinkwasser auf<br />
10 I/Tag je Person<br />
beschränkt wird.<br />
Jeder Einsatz von<br />
Wasser-Aufbereitungsanlagen
in der BRD kann nur in<br />
Abstimmung mit den<br />
zuständigen Wasserversorgungsunternehmen<br />
durchgeführt werden. Alle<br />
im Zusammenhang mit der<br />
Aufbereitung durchzuführenden<br />
chemischen und<br />
biologischen Untersuchungen<br />
müssen ebenfalls den<br />
Wasserversorgungsunternehmen<br />
überlassen bleiben.<br />
<strong>Das</strong> schließt nicht aus,<br />
daß unter Aufsicht und<br />
Verantwortung der öffentlichen<br />
Unternehmungen auch<br />
dafür ausgebildete THW-<br />
Helfer Wasseruntersuchungen<br />
durchführen können, ja<br />
sogar müssen, um die<br />
laufende Kontrolle bei der<br />
Wasseraufbereitung ausüben<br />
zu können.<br />
Falls keine<br />
Wasseraufbereitungsanlage<br />
vorhanden ist, läßt sich eine<br />
von der Trinkwasserleitung<br />
abgeschnittene Bevölkerung<br />
mit fahrbaren Tankbehältern<br />
versorgen.<br />
Bei der Flutkatastrophe 1962<br />
in Hamburg und auch bei<br />
der überschwemmung in<br />
Bad Godesberg Anfang<br />
dieses Jahres konnte die<br />
Bevölkerung tagelang aus<br />
Tankwagen mit Trinkwasser<br />
beliefert werden. Auch<br />
zusammenfaltbare Kunststoffbehälter,<br />
deren Fassungsvermögen<br />
etwa 1 m 3<br />
betragen, und die gut auf<br />
Lkw unterzubringen sind,<br />
lassen sich für den Wassertransport<br />
verwenden. Unter<br />
den vielen Möglichkeiten,<br />
eine gestörte Wasserversorgung<br />
wieder<br />
ingangzusetzen, sei die<br />
Vorsorgemaßnahme der<br />
Städtischen Wasserwerke<br />
Saarlouis erwähnt. Dort<br />
wurde dem THW ein<br />
100-KVA-Notstrom-Aggregat<br />
überlassen, damit Helfer<br />
daran laufend üben können.<br />
Dieses Gerät ist gerade so<br />
groß daß bei Stromausfall<br />
die durch Elektromotore<br />
angetriebenen Pumpen<br />
betrieben werden können.<br />
Auch das THW besitzt<br />
Notstromaggregate, jedoch<br />
sind sie mit Leistungen<br />
zwischen 3,5 und 10 KVA<br />
wesentlich kleiner. Trotzdem<br />
können die Aggregate für die<br />
Wasserversorgung sehr<br />
nützlich sein, wenn z. B.<br />
Kunststoffrohrleitungen<br />
verlegt werden und dazu<br />
eine Ausleuchtung notwendig<br />
wird.<br />
Erfahrungen<br />
bei Hochwasser<br />
Erfahrungen bei der letzten<br />
Hochwasserkatastrophe, die<br />
weite Gebiete des Rheins<br />
und des Mains erfaßte,<br />
hatten gerade bei den<br />
THW-Einsätzen für den Raum<br />
Bonn neue Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse gebracht.<br />
In einem vorher nie<br />
gekannten Ausmaße wurden<br />
die Keller der Häuser, die<br />
unmittelbar am Rheif! lagen,<br />
überschwemmt.<br />
<strong>Das</strong> hatte zur Folge, daß<br />
sich durch den Auftrieb<br />
einzelne Tankbehälter<br />
losrissen und ihren Ölinhalt<br />
ausfließen ließen. Da<br />
gleichzeitig Wasserleitungen<br />
unterspült wurden und<br />
brachen, war die<br />
Trinkwasserzufuhr für<br />
einzelne Straßenzüge<br />
unterbrochen. Hier wurden<br />
dann Tankwagen eingesetzt.<br />
Der Schaden konnte dadurch<br />
gemindert werden, daß durch<br />
das Eingreifen von THW-<br />
Helfern in letzter Minute<br />
für eine ausreichende<br />
Beschwerung der Tankbehälter<br />
gesorgt werden<br />
konnte. Die Abbindung des<br />
im Keller befindlichen Öles<br />
durch EKOPERL wurde<br />
vielfach mit mehr oder<br />
weniger Erfolg versucht. Es<br />
blieb an den Wänden ein<br />
kaum zu entfernender<br />
Schmutz- und Schlammüberzug<br />
zurück. Von einigen<br />
Bewohnern wurde versucht,<br />
die Keller auszupumpen, um<br />
ihre ÖI-Feuerungsanlagen<br />
vor Schaden zu bewahren.<br />
Sie erzielten damit nur, daß<br />
durch den Druck des noch<br />
außenstehenden Wassers der<br />
Kellerboden aufgerissen<br />
wurde.<br />
Soweit sich in den<br />
Kellerräumen Steckdosen<br />
befanden, wurden die<br />
entsprechenden Zuleitungen<br />
an den SCha,ltstationen von<br />
dem Stromversorgungsunternehmen<br />
unterbrochen.<br />
<strong>Das</strong> bedeutete, daß die<br />
Bewohner in den Tagen des<br />
Hochwassers auf Strom und<br />
damit auch auf Wärme<br />
verzichten mußten. Um die<br />
Steckdosen und die<br />
empfindlichen Regelgeräte<br />
der Heizungsanlagen zu<br />
schützen, wurden sie<br />
abgebaut oder unmittelbar<br />
unter die Decke gehängt.<br />
Ein besonderes Problem<br />
bestand bei den Ölbrennern.<br />
Um sie zu schützen, mußten<br />
sie rechtzeitig abgebaut,<br />
die unterbrochenen<br />
Ölzuführungsleitungen<br />
abgedichtet und die<br />
elektrischen Anschlüsse<br />
isoliert werden. Unmittelbar<br />
nach Zurückgehen des<br />
Hochwassers waren die ÖIbrenner<br />
wieder anzuschließen.<br />
Die Heizungsfirmen in der<br />
Umgebung von Bonn<br />
konnten diese Arbeiten mit<br />
ihren Kräften nicht<br />
bewältigen. Hier konnte das<br />
THW unterstützend eingreifen,<br />
indem Fachkräfte aus dem<br />
Ruhrgebiet für etwa eine<br />
Woche eingesetzt wurden.<br />
So konnte der Ausfall der<br />
Heizungsanlagen auf ein<br />
Minimum reduziert werden.<br />
Es gab bei dem Hochwasser<br />
auch einen Straßenzug in<br />
Remagen, in welchem<br />
sämtliche Gasfeuerungsanlagen<br />
bis zum 1. Stock<br />
der Wohnungen vollkommen<br />
überspült wurden. Auch hier<br />
konnten THW-Helfer<br />
eingreifen, indem sie die<br />
Heizeinrichtungen und<br />
Warmwasserbereiter<br />
gründlich säuberten und<br />
austrockneten, um sie dann<br />
in Betrieb zu setzen.<br />
Daneben soll der<br />
Katastrophenschutz, wie er<br />
organisations- und personalmäßig<br />
für den Frieden<br />
aufgebaut ist, nach dem<br />
neuen Gesetz über die<br />
Erweiterung des<br />
Katastrophenschutzes<br />
ausgebaut werden.<br />
In diesem Gesetz ist das<br />
THW dazu bestimmt,<br />
Instandsetzungsaufgaben -<br />
und damit ist das vorhin<br />
geSChilderte Tätigwerden<br />
in den Verteilernetzen der<br />
Versorgungsunternehmen<br />
gemeint -<br />
Dazu wird die Ausrustung<br />
des THW noch besonders<br />
ergänzt. Der Bund stellt<br />
Ihnen insofern seine Hilfe<br />
zur Verfügung.<br />
Der Weg zu einem engen<br />
Zusammenschluß von den<br />
Versorgungsunternehmen<br />
und dem THW Ist damit<br />
aufgezeichnet. Diesem ersten<br />
maßgeblichen Gespräch<br />
werden noch viele folgen.<br />
Es geht um eine gemeinsame<br />
Arbeit, die nicht nur einen<br />
guten Kontakt schaffen,<br />
sondern die sich wirklich<br />
lohnen wird.<br />
175
176<br />
Liebe Helfer!<br />
An diesem Tag des zwanzigjährigen<br />
Bestehens des <strong>Technische</strong>n<br />
Hilfswerks wird jeder,<br />
der es kennt, mit Stolz<br />
und Freude auf die mit Einsätzen<br />
und Hilfeleistungen<br />
ausgefüllten Jahre zurückblicken.<br />
Für mich ist es schmerzlich, Ihnen<br />
gerade an diesem Tage<br />
mitteilen zu müssen, daß<br />
ich im Zuge einer Umorganisation<br />
des Bundesamtes<br />
für zivilen Bevölkerungsschutz<br />
von meinen bisherigen<br />
Aufgaben entbunden<br />
wurde, um die Leitung der<br />
Abteilung Warn- und Alarmdienst<br />
zu übernehmen.<br />
So muß ich mich an diesem denkwürdigen<br />
Tage des THW<br />
von Ihnen verabschieden.<br />
Ich möchte mich dabei aufrichtig<br />
bedanken für Ihre<br />
Mühe undfürdievielen Entbehrungen,<br />
die Sie auf sich<br />
genommen haben; für Ihre<br />
stete Ei nsatzbereitschaft.<br />
Vielen Dank für die vielen<br />
frohen Stunden, die ich mit<br />
Ihnen im kameradschaftlichen<br />
Kreise verlebte.<br />
Wenn ich auch hauptamtlich nicht<br />
mehr für das THW tätig bin,<br />
so fühle ich mich - schon<br />
auf Grund vieler gemeinsamer<br />
Erlebnisse - mit Ihnen<br />
für immer aufs engste verbunden.<br />
Ich wünsche Ihnen allen, daß es<br />
mit dem Aufbau des THW<br />
weiter vorangeht, daß das<br />
THW noch an Ansehen gewinnt<br />
und daß Ihre künftigen<br />
Einsätze stets erfolgreich<br />
zum Abschluß gebracht<br />
werden kön(len.<br />
Glück auf! Ihr<br />
Direktor der Bundesanstalt <strong>Technische</strong>s Hilfswerk
DER<br />
TRICK<br />
DES MONATS<br />
Maßnahmen<br />
zur Trinkwassernotversorgung<br />
Einer geordneten Wasserversorgung,<br />
dabei natürlich<br />
der Deckung des lebensnotwendigen<br />
Bedarfs<br />
an Trinkwasser, kommt<br />
bei Katastrophen und erst<br />
recht im Verteidigungsfall,<br />
eine ganz besondere Bedeutung<br />
zu .<br />
Mit dem Schwerpunktprogramm"Trinkwassernotversorgung<br />
aus Brunnen<br />
und Quellfassungen" ,<br />
das seit Anfang 1968 stufenweise<br />
realisiert wird,<br />
wurde der Vollzug des<br />
§ 1 Nr. 1 des Wassersicherstellungsgesetzes<br />
vom 24. August 1965 (Bundesgesetzblatt<br />
I, S. 1225)<br />
in Angriff genommen.<br />
In Normalzeiten ist die<br />
Versorgung mit Trinkwas-<br />
ser in ausreichender<br />
Menge und einwandfreier<br />
Güte sichergestellt. Die<br />
Betriebsanlagen und Netze<br />
der Wasserversorgungsunternehmen<br />
können aber<br />
durch die verschiedensten<br />
Ereignisse begrenzt<br />
oder ganz ausfallen. Allein<br />
auf Grund eines ÖIunfalls<br />
kann es nötig werden,<br />
augenblicklich ein<br />
Wasserwerk abzuschalten.<br />
Die Flutkatastrophe im<br />
Jahre 1962 bewirkte u. a.<br />
in Hamburg gebietsweise<br />
Störungen in der rei.<br />
bungslosen Wasserversorgung.<br />
Auch ist zu bedenken,<br />
daß bei der Wasserversorgung<br />
noch nicht ein<br />
Großverbundbetrieb be.<br />
steht wie bei der engvermaschten<br />
elektrischen<br />
Ein Gruppenführer ist mit<br />
seiner Gruppe allein irgendwo<br />
eingesetzt, weitab<br />
vom Ortsverband. Mehrere<br />
Helfer sind total durchnäßt.<br />
Der Gruppenführer<br />
will den OB anrufen, findet<br />
aber im Telefonbuch<br />
nicht "THW", sondern nur<br />
den Namen, und da der<br />
OB zufällig " Schmidt"<br />
heißt, und das in einer<br />
Stadt, in der es viele<br />
" Schmidt" gibt, ist er<br />
ziemlich ratlos die<br />
Straße, wo er privat wohnt,<br />
weiß er nämlich auch<br />
ebensowenig wie den Vornamen<br />
des OB. Natürlich<br />
hat er ihn schließlich doch<br />
erreicht - und auch neue<br />
Kleidung kam an, aber<br />
beim nächsten THW-<br />
Energieverteilung. Im Verteidigungsfall<br />
kann Betriebsausfall<br />
durch Sabotage<br />
sowie konventionelle<br />
oder ABC-Waffeneinwirkung<br />
hervorgerufen werden.<br />
Mit diesem Notbrunnenprogramm<br />
soll erreicht<br />
werden, daß speziell im<br />
Verteidigungsfall eine den<br />
Umständen entsprechend<br />
ausreichende Trinkwassernotversorgung<br />
der Bevölkerung<br />
gewährleistet ist.<br />
Die zentrale Wasserversorgung<br />
bei Ausfall durch<br />
Brunnen und ähnliche<br />
Maßnahmen v 0 I I zu ersetzen<br />
ist unmöglich.<br />
Durch die Haushaltslage<br />
des Bundes bedingt, ist<br />
in erster Lin ie eine Konzentrierung<br />
auf die Großstädte<br />
und Ballungsräume<br />
vorgesehen, auch erstreckt<br />
sich daher das Programm<br />
über eine größere Zeitspanne.<br />
Für das Notbrunnenprogramm<br />
sind im<br />
Rahmen der Zivilverteidigung<br />
Aufwendungen von<br />
etwa 240 Millionen DM<br />
nötig. Die aus Bundesmitteln<br />
für die Trinkwassernotversorgung<br />
im Verteidigungsfall<br />
erbauten<br />
Abend ließ er von einem<br />
Helfer - einem Techn ischen<br />
Zeichner - schön<br />
säuberlich einen kleinen<br />
Zettel schreiben : "Anschrift<br />
und Rufnummer<br />
des OB : .... . . "<br />
Und weil er gerade so<br />
schön dabei war, schrieb<br />
er auch noch die Anschriften<br />
und Rufnummern sei·<br />
nes Zugführers, der Ausschußleiter,<br />
des Ausbildungsleiters,<br />
des Krankenhauses,<br />
der Ortspolizei<br />
, der örtlichen DRK-,<br />
ASB- und MHD-Dienststellen<br />
sowie der Feuerwehr<br />
und auch der umliegenden<br />
Krankenhäuser.<br />
Dazu kam auf Vorschlag<br />
der Helfer noch die Rufnummer<br />
des E-Umspann-<br />
Brunnen dürfen im Hinblick<br />
auf die ständige Betriebsbereitschaft<br />
meist<br />
schon jetzt unter Beachtung<br />
bestimmter Auflagen<br />
benutzt werden.<br />
Nun eine kurze Beschreibung<br />
des entwickelten<br />
" Regelbrunnen " , detai-<br />
Iierte Angaben sind in<br />
den entsprechenden Vorschriften<br />
niedergelegt.<br />
Dieser vereinfachte Rohrbrunnentyp<br />
wird je nach<br />
den örtlichen Gegebenheiten<br />
(Bodenverhältnisse,<br />
Grundwassertiefen, notwendige<br />
Fördermengen)<br />
mit einer Handpumpe oder<br />
elektrischen Unterwasserpumpe<br />
ausgestattet. Der<br />
" Regelbrunnen " ist konstruktiv<br />
so durchgebildet,<br />
daß Druckwel len mögl ichst<br />
elastisch aufgenommen<br />
werden. Die Kapazität der<br />
Brunnen ist so zu bemessen,<br />
daß der Gesamtbedarf<br />
des jeweiligen zugeordnetenVersorgungsgebietes<br />
bei angemessener<br />
Betriebszeit gedeckt wird .<br />
Welche Trinkwassermengen<br />
bei der Bedarfsermittlung<br />
in Ansatz zu bringen<br />
sind, ist jetzt in der erstenWassersicherstel-<br />
werkes und des Wasserund<br />
Klärwerkes für<br />
eventuelle Ölalarme! Und<br />
sogar die Abschleppdienste<br />
wurden nicht vergessen<br />
- und eine große<br />
Baufirma, von der man<br />
schon einmal ein Fahrzeug<br />
und Pumpen geliehen hat.<br />
Und dieses kleine "Spezial-THW-Telefon<br />
buch "<br />
wurde nun in eine Plastikfolie<br />
gesteckt - damit<br />
es nicht "versaut" wird -<br />
und im Führerhaus an die<br />
Rückwand gehängt!<br />
Und was glaubt Ihr? Die<br />
anderen Gruppen haben<br />
es sich abgeschrieben -<br />
und noch weiter ergänzt,<br />
ganz nach ihrem Gebrauch<br />
für den Katastrophenfall!<br />
Es hat sich bewährt.<br />
lungsverordnung vom 31 .<br />
März 1970 (Bundesgesetzblatt<br />
I, Seite 257) , endgültig<br />
festgelegt worden.<br />
Nach § 2, Abs. 1, vorgenannter<br />
Verordnung, sind<br />
z. B. in der Regel 15 I<br />
Trinkwasser je Person<br />
und Tag zugrunde zu legen.<br />
Für Krankenhäuser,<br />
Betriebe deren Weiterarbeit<br />
nach der Zivilverteidigungsplanungunerläßlich<br />
ist, die Nutztierhaltung<br />
usw., sind größere<br />
Bedarfsmengen ausgewiesen.<br />
Soweit in den<br />
bereits Notbrunnen errichtet<br />
sind, sollten nach<br />
Absprache mit den zuständigenVerwaltungssteIlen<br />
(Amt für Zivilschutz,Katastrophenabwehrbehörde<br />
oder Wasserve<br />
rso rg u ngsu nte rnehmen)<br />
die Einsatzkräfte des<br />
THW-I nstandsetzungsdienstes<br />
über die Funktionsweise<br />
orientiert werden.<br />
Die nötigen Angaben<br />
über Standorte und Förderleistungen<br />
sind in der<br />
Ortsverbands-Organisationsmappe,<br />
Blatt C 10 :<br />
"Wasserversorgung" zu<br />
erfassen. GERD KRÜGER<br />
177
In der Ausrüstung der Sanitätsbereitschaft<br />
des LSHD befindet<br />
sich - ausgewiesen unter Schutzgerät<br />
- ein Tornisterfiltergerät<br />
mit 8 Satz Reservefilterschichten.<br />
Dieses Tornisterfiltergerät entspricht<br />
dem Trinkwasserfiltergerät<br />
TOF 200 B der Seitz-Werke,<br />
Bad Kreuznach, und dient zur<br />
Reinigung und E n t k e i m u n g<br />
von leicht verschmutztem und<br />
verseuchtem Wasser durch Filterung<br />
und Adsorption. Diese Filterung<br />
und Adsorption erfolgt<br />
ähnlich wie bei den in der Industrie<br />
in sehr großer Menge<br />
vorhandenen Filtergeräten der<br />
Seitz-Werke durch auswechselbareAsbest-Zellulose-Filterschichten.<br />
Diese Filterschichten<br />
tragen auf der glatten Seite die<br />
Bezeichnung .. EK", wenn sie der<br />
Entkeimung von verseuchtem<br />
Wasser dienen sollen (alle Ober-<br />
178<br />
flächenwässer im Einsatzfalle).<br />
Sch ichten ähnlicher Form, die<br />
industriell gebraucht werden und<br />
die Bezeichnung .. K" mit einer<br />
arabischen Zahl dahinter haben,<br />
sind für Entkeimungszwecke<br />
nicht geeignet. Es sind sog.<br />
Klärschichten.<br />
Durch die Bezeichnung .. 200 B"<br />
ist ausgedrückt, daß bei einwandfreiem<br />
unfiltriertem Wasser<br />
(klares, durchsichtiges Wasser)<br />
die Stundenleistung einer Filterbeschickung<br />
200 I/h beträgt. <strong>Das</strong><br />
.. B" gibt an, daß es sich um<br />
.. biologische Filtration" handelt.<br />
Hier sei darauf hingewiesen,<br />
daß schon bei geringfügiger<br />
Trübung des unfiltrierten Wassers<br />
die Stunden leistung des<br />
Gerätes sehr schnell auf 100 I/h<br />
abfällt und bei deutlich trübem<br />
gefärbtem Wasser (nach Regengüssen<br />
und Hochwasser) die<br />
Stundenleistung noch geringer<br />
ist. Diese Erscheinungen haben<br />
sich in den letzten Jahren wiederholt<br />
beim Einsatz dieser Geräte<br />
gezeigt, weil man sich nicht<br />
darüber im klaren war, daß dieses<br />
Filter ein Grundgerät darstellt,<br />
zu welchem eigentlich bei<br />
einer kompletten Ausrüstung das<br />
Trinkwasserfiltergerät TOF 100 AC<br />
(Zusatzgerät) gehört. Dieses Zusatzgerät<br />
dient sowohl zur Vorentsalzung(Vordemineralisierung),<br />
Geruchsbeseitigung, Entchlorung<br />
und Entfärbung als<br />
auch zur Reinigung von radioaktiv<br />
oder chemisch bzw. radioaktiv<br />
und chemisch verseuchtem<br />
Wasser.<br />
Die Abb. zeigt den Gesamtaufbau<br />
der Gerätekombination<br />
TOF 200 Bund TOF 100 AC.<br />
Zwischen den beiden Filtergeräten,<br />
die auf den Transport-<br />
kisten aufgestellt werden, sind<br />
zwei zusammenfaltbare gummierte<br />
Becken (Abb. 2) aufgehängt,<br />
in denen im Ausflockungsverfahren<br />
die Vorklärung des zu<br />
filtrierenden Wassers vor der<br />
Aufnahme in das Filter TOF 200 B<br />
vorgenommen wird. Da sich die<br />
Filterschichten des Tornisterfiltergerätes<br />
durch lehmige und<br />
schlammige Bestandteile des<br />
Wassers sehr schnell (bei verschmutztem<br />
Wasser oftmals<br />
schon in wenigen Minuten) zusetzen<br />
und die Leistungen des<br />
Filters auf wenige Liter sinkt,<br />
läßt sich mit Hilfe des Zubehörs<br />
zur Wasservorbehandlung, das<br />
im sog. Chemikalienvorrat des<br />
Trinkwasserfiltergerätes 100 AC<br />
vorhanden ist, die Verwendungsdauer<br />
einer Filterschichtenbeschickung<br />
des Grundgerätes wesentlich<br />
verlängern und die Fil-
<strong>Das</strong> Tornisterfiltergerät TOF 200 B<br />
trationsleistung über einen größeren<br />
Zeitraum sicherstellen.<br />
Bei dieser Gelegenheit sei aber<br />
darauf hingewiesen, daß aus<br />
Meerwasser oder anderen Wässern<br />
mit hohen Salzgehalten<br />
auch unter Verwendung des Filters<br />
100 AC kein Trinkwasser<br />
gewonnen werden kann. Es sei<br />
noch erwähnt, daß durch die<br />
Verwendung industrieller Filtertypen<br />
trotz der durch die größere<br />
Anzahl der Filterschichten<br />
bedingten größeren Filterfläche<br />
keine Verbesserung erzielt wird<br />
(Abb. 3). <strong>Das</strong> hat sich besonders<br />
bei einer der Hilfsorganisationen<br />
im Einsatz in Florenz gezeigt.<br />
Die größere Pumpen leistung unter<br />
Umständen elektrisch angetriebener<br />
Pumpen bringt auf jedem<br />
cm 2 der Filterschicht eine<br />
spezifische Wassermenge. Es ist<br />
gleichgültig, ob kleine oder<br />
große Filterflächen zur Verfügung<br />
stehen; in jedem Fall verschmutzt<br />
die vor allem bei Hochwasser<br />
vorhandene lehmige Beimengung<br />
jeden einzelnen cm 2 • so<br />
daß auch bei Verwendung größerer<br />
Filter ohne Vorklärung die<br />
Verwendung von EK-Schichten<br />
direkt als falsch zu bezeichnen<br />
ist.<br />
Ein oft beobachteter Irrtum der<br />
Helfer ist auch der, daß angenommen<br />
wird, die Filterschichten<br />
seien hintereinandergeschaltet.<br />
Dies ist nicht der Fall. Durch<br />
Unterteilung in Trubrahmen und<br />
Glanzrahmen, die an zwei verschiedene<br />
Kanäle - nämlich den<br />
Trubkanal und den Glanzkanal -<br />
angeschlossen sind, ergeben die<br />
acht im TOF 200 B verwendeten<br />
EK-Schichten nur eine achtmal<br />
so große Fläche. Die Schichten<br />
sind also parallel geschaltet,<br />
und über den Siebkorb und<br />
Saugschlauch wird mit der Handflügelpumpe<br />
das zu filternde<br />
Wasser angesaugt und durch den<br />
vorderen Deckel, den unteren<br />
Augenkanal und die Trubrahmen<br />
schließlich durch die Filterschichten<br />
gedrückt.<br />
Um ein Durchdrücken der<br />
Schichten zu verhindern, bestehen<br />
die Glanzplatten aus beidseitig<br />
mit Riffeln und oben mit<br />
Abflußöffnungen versehenen<br />
massiven Platten. Zwischen den<br />
Riffeln läuft das aus den Filtersch<br />
ichten heraustretende ent-<br />
keimte Wasser über den oberen<br />
Augenkanal zum Reinwasserauslauf<br />
am vorderen Deckel. Die<br />
Abdichtung der einzelnen so<br />
entstehenden Filterkammern erfolgt<br />
durch die Schichten selbst<br />
bzw. durch die Gummidichtungen<br />
in den Augenkanälen.<br />
,<br />
Ein derartiges Gerät, das beim<br />
Zusammenbau mit den oftmals<br />
auch schmutzigen bzw. verseuchten<br />
Händen berührt wird, kann<br />
natürlich nicht keimfrei sein. Es<br />
wäre sinnlos, eine Entkeimung<br />
durchführen zu wollen, wenn das<br />
Gerät vor Inbetriebnahme nicht<br />
keimfrei gemacht wird. Diese Erkenntnis,<br />
die an sich schon uralt<br />
ist (die Industrie-Filter werden<br />
durch strömenden Dampf<br />
15 Minuten sterilisiert) wurde bei<br />
der Bundeswehr gewonnen. Seitdem<br />
wird für die Bundeswehrgeräte<br />
zusätzlich eine Flasche<br />
mit Formalin-Desinfektionsmittel<br />
mit Meßbecher und eine grün<br />
markierte Kupplung für den<br />
Reinwasserauslaufschlauch mitgeliefert.<br />
Diese Teile fehlen bei<br />
den vom BzB ausgelieferten Geräten.<br />
Sie sind aber unerläßlich.<br />
In jeder Apotheke kann man jedoch<br />
Formalin DAB 6, 38 Vol. %<br />
= 35 Gew. %, käuflich erwerben.<br />
Am besten eignet sich eine Plastikflasche<br />
mit Trinkbecher von<br />
etwa 0,5 I Inhalt, in deren Trinkbecher<br />
man mit einem erhitzten<br />
Schraubenzieher bei 60 cm 3 einen<br />
Füllstrich anbringt.<br />
Die Desinfektion des Filters<br />
200 B geht wie folgt vor sich:<br />
<strong>Das</strong> Filtergerät wird mit Wasser<br />
gefüllt. 60 cm 3 Formalin werden<br />
in dem Becher mit Strichmarkierung<br />
abgemessen und durch<br />
den grün markierten Reinwasserauslaufschlaucheingefüllt(Abb.4).<br />
Die grün markierte Kupplung<br />
des Reinwasserauslaufschlauches<br />
wird an Stelle des Saugschlauches<br />
angekuppelt (Abb. 5) und<br />
zur Desinfektion mit 50 Pumpenschwengelschlägen<br />
umgepumpt.<br />
Danach läßt man den Filter 10<br />
Minuten stehen. Anschließend<br />
kuppelt man den Reinwasserauslaufschlauch<br />
vom Rohwasserstutzen<br />
ab und pumpt das Gerät<br />
leer. Der Saugschlauch wird<br />
angekuppelt und mindestens 20 I<br />
Wasser werden zum Auswaschen<br />
179
<strong>Das</strong> Tornisterfiltergerät TOF 200 B<br />
180<br />
der Desinfektionslösung<br />
gepumpt.<br />
<strong>Das</strong> Waschwasser sollte in einem<br />
Eimer gesammelt werden. Es<br />
kann zur desinfizierenden Reinigung,<br />
z. B . zum Händewaschen,<br />
Spülen von Feldküchenkesseln,<br />
Essensträgern, Kochgeschirren<br />
usw., Verwendung<br />
finden, jedoch nicht zum Trinken<br />
oder Kochen.<br />
Es taucht nun die Frage auf,<br />
wann desinfiziert werden muß.<br />
1. Nach Einlegen neuer Filterschichten<br />
(Ansetzen des Filters);<br />
2. nach mehr als zweistündiger<br />
Betriebsunterbrechung ;<br />
3. nach der Entwässerung, z. B.<br />
zum Transport.<br />
Da die Filter 100 AC nicht in<br />
der Ausrüstung vorhanden sind,<br />
erscheint es notwendig, zwei<br />
etwa 100 I Wasser fassende Behälter<br />
zu beschaffen, in denen<br />
die Vorklärung schmutzigen<br />
Wassers durch Fäll-(Ausflok.<br />
kungs-)verfahren durchgeführt<br />
werden. In jeweils einem wird<br />
geklärt (Dauer etwa 30 Minuten),<br />
aus dem anderen wird das bereits<br />
geklärte Wasser abgepumpt<br />
und dem Filterapparat zugeführt.<br />
Die entsprechenden Fällsalze<br />
können bei den Seitz-Werken,<br />
Bad Kreuznach, bezogen werden<br />
(Ersatzmaterial für die Filter<br />
100 AC). Unter Umständen ist es<br />
ratsam, auch gleich das Tragegestell<br />
mit 8 Plastikflaschen und<br />
einem Plastikmeßzylinder komplett<br />
zu bestellen, das wir in<br />
Abb. 6 auf dem Stuhle im Hintergrund<br />
sehen. Es enthält als<br />
sog. "Chemikalienvorrat für die<br />
Wasservorbehandlung" :<br />
1 Flasche mit Entgiftungspulver<br />
(blaue Verschlußkappe)<br />
Flasche zum Ansetzen der Entgiftungsmilch,<br />
leer (blaue Verschlußkappe)<br />
2 Flaschen mit Fällsalz (gelbe<br />
Verschlußkappe)<br />
Flasche zum Ansetzen der<br />
Fällösung, leer (gelbe Verschlußkappe)<br />
3 Flaschen mit Fällpulver (grüne<br />
Verschlußkappe).<br />
Diese Kunststofflaschen befinden<br />
sich zusammen mit einem Meßgefäß<br />
in einem Blecheinsatz.<br />
(Fortsetzung folgt)
Aus den Landesverbänden<br />
Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
Köln<br />
Im Beisein eines Kamerateams<br />
des ZDF führten die<br />
Bergungstaucher des Ortsverbandes<br />
eine Übung<br />
durch. Die Tauchergruppe,<br />
aus sieben Mann bestehend,<br />
ist für den Katastropheneinsatz<br />
vorgesehen,<br />
steht jedoch auch für technische<br />
Hilfeleistungen unter<br />
Wasser der Allgemeinheit<br />
zur Verfügung.<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Bad Kreuznach<br />
Fünfzig Helfer hatten sich<br />
den Stausee in Niederhausen<br />
für eine Großübung<br />
ausgesucht. Die<br />
Männer wurden im Fahren<br />
mit schwimmenden Brükken<br />
, dem Bau von Fähren<br />
und dem Pendelverkehr<br />
mit Schlauchbooten geschult.<br />
Worms<br />
Fünf Helfer des Ortsverbandes<br />
unterstützten die<br />
Krim inalpolizei bei der Aufklärung<br />
eines Mordfalles.<br />
Der Einsatzort mußte so<br />
ausgeleuchtet werden, daß<br />
eine einwandfreie Spurensicherung<br />
durchgeführt<br />
werden konnte.<br />
Kaiserslautern<br />
Im alten Sendehaus des<br />
Südwestfunks ist seit geraumer<br />
Zeit der Verein<br />
Gelsen ki rchen<br />
Am 20. Juni baute der Ortsverband<br />
auf dem Berger<br />
See in Gelsenkirchen-<br />
Buer eine Großraumfähre<br />
für verschiedene Veranstaltungen<br />
im Rahmen des<br />
Sommerfestes der Stadt<br />
und für die Ausbildung<br />
der Helfer im . Wasserdienst.<br />
Sechs Helfer löschten<br />
am 16. Juli einen<br />
Schwelbrand an einer<br />
Wasch berg halde.<br />
Lebenshilfe für geistig Behinderte<br />
untergebracht.<br />
<strong>Das</strong> halbverfallene Haus<br />
wurde nun vom Ortsverband<br />
des THW soweit wie-<br />
Siegburg<br />
Den am 8. Juli im Köln-<br />
Bonner Raum niedergegangenen<br />
Wassermassen<br />
rückten 20 THW-Helfer aus<br />
Siegburg "zu Leibe". In<br />
der besonders stark betroffenen<br />
Gemeinde Eitorf<br />
arbeiteten die Helfer mit<br />
acht Pumpen in 24stündigem<br />
Einsatz.<br />
Dortmund<br />
Zum Abschluß des 1. Ausbildungshalbjahres<br />
führte<br />
der Ortsverband am 20.<br />
Juni im Wannbachtal eine<br />
Großübung durch. Die<br />
Übungsleitung zeigte sich<br />
mit dem Ergebnis zufrieden.<br />
Die Ortspresse berichtete<br />
anschließend ausführlich<br />
über das Ereignis.<br />
Rheydt<br />
Die Ortsteile Giesenkirchen<br />
und Odenkirchen wurden<br />
während eines Gewitters<br />
am 9. Juni von einer Regenflut<br />
kaum dagewesenen<br />
Ausmaßes heimgesucht.<br />
der repariert, daß 56 Kinder<br />
praktisch eine neue<br />
Heimstatt gefunden haben.<br />
Zwei Firmen beteiligtensich<br />
miterheblichenGeldmitteln.<br />
Zusammen mit der Polizei<br />
und der Feuerwehr waren<br />
THW-Helfer mit der Sicherung<br />
eines Baukrans und<br />
dem Auspumpen der überfluteten<br />
Keller befaßt.<br />
Arnsberg<br />
Im Rahmen der Ausbildungsübung<br />
einer Bergungs-<br />
und Instandsetzungsgruppe<br />
des Ortsverbandes<br />
wurde der Schacht<br />
des alten Schloßbergbrunnens<br />
untersucht, vermessen,<br />
die Wassertiefe<br />
gelotet und die Verschmutzung<br />
des Wasserspiegels<br />
beseitigt.<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Heidelberg<br />
Drei Fässer mit je 200 LItern<br />
Sulfuryl-Chlorid und<br />
Chlorsulfonsäure, die vergraben<br />
und bereits ankorrodiert<br />
waren, konnten mit<br />
Hilfe des THW zu einem<br />
von der Polizei bestimmten<br />
Platz transportiert werden;<br />
eine gefährliche Unternehmung,<br />
die, wäre sie<br />
nicht geglückt, erheblichen<br />
Schaden angerichtet hätte.<br />
Stockach<br />
Der Ortsbeauftragte des<br />
OV Stockach ordnete eine<br />
technische Hilfeleistung<br />
an, da Gefahr im Verzuge<br />
war in Selfingen, Kreis<br />
Stockach. Der kleine Bach<br />
des Ortes hatte sich durch<br />
ein heftiges Hagelgewitter<br />
zu einem reißenden Strom<br />
entwickelt und die KanaIdurchlässe<br />
verstopft. Bäume,<br />
Bretter, Unrat, Schlamm<br />
und Geröllmassen mußten<br />
aus dem ehemals harmlosen<br />
Bach entfernt werden.<br />
Große Schäden, die unvermeidbar<br />
schienen, konnten<br />
durch den Selbsteinsatz<br />
des THW verhindert werden.<br />
181
Hessen<br />
Darmstadt<br />
"Im Dienste der Bürgerschaft"<br />
fand in der Innenstadt<br />
eine technische Ausstellung<br />
verschiedener<br />
Hilfsorganisationen statt.<br />
<strong>Das</strong> THW führte Passanten<br />
Fahrzeuge und Geräte<br />
verschiedener Art vor.<br />
Darmstadt wurde durch das<br />
Katastrophenschutzamt der<br />
Stadt Darmstadtzur Schließung<br />
eines Dammbruches<br />
bei Leeheim, Kreis Groß-<br />
Gerau, alarmiert. Die Versuche<br />
der Helfer, die Schadensstelle,<br />
5 m breit, mit<br />
einem Verbau von Baumstämmen<br />
und Sandsäcken<br />
zu schließen, mißlang. Die<br />
starke Strömung spülte<br />
Sandsäcke und Baumstämme<br />
weg. Lediglich kleine<br />
Schadensstellen des Dam-<br />
Niedersachsen<br />
Lüneburg<br />
Im Auftrag der Kreisverwaltung<br />
von Lüneburg<br />
übernahm der Ortsverband<br />
Lüneburg in Neetzendorf<br />
den Bau einer Ersatzbrücke.<br />
Die alte Brücke<br />
auf der Zugangsstraße<br />
nach Neetzendorf war<br />
durch Hochwasser zer-<br />
mes konnten mit Sand- stört worden.<br />
Der Betreuungsbereich des säcken geschlossen wer-<br />
<strong>Technische</strong>n Hilfswerks den. Verden a. d. Aller<br />
Korbach<br />
Die "Korbach 11" als Einsatzboot des Ortsverbandes<br />
ist vom Stapel gelaufen. Über ein Jahr hatten 20 Helfer<br />
an dem Boot gearbeitet, das mit einem 42-PS-Motor<br />
15 Knoten "macht".<br />
Limburg<br />
Unter der Schirmherrschaft von Verkehrsminister Leber<br />
fand eine große Wirtschaftsausstellung und Informationsschau<br />
statt, an der das THW mit einem Ausstellungsstand<br />
beteiligt war. 150000 Besuchern konnten<br />
dabei die wichtigsten Geräte des Ortsverbandes vorgeführt<br />
werden.<br />
182<br />
Der Ortsverband Verden<br />
(Aller), durch die Polizei<br />
des Landkreises Verden<br />
nach Eitze bei Verden gerufen,<br />
sollte einen Bundeswehrhubschrauber,<br />
der<br />
in die Aller gestürzt war,<br />
suchen und bergen. Nach<br />
längerem Suchen entdeckten<br />
die Helfer Öllachen<br />
und bargen kleine Teile<br />
des Hubschraubers. <strong>Das</strong><br />
zwischenzeitlich eingetroffene<br />
Rettungskommando<br />
der Bundeswehr und die<br />
eingesetzten Hubschrauber<br />
konnten die abgestürzten<br />
Piloten und den<br />
Rumpf der Maschine ebenfalls<br />
nicht orten. In den<br />
Nachtstunden wurde der<br />
Einsatz abgebrochen.<br />
Freden-Alfeld<br />
Bei einem Eisenbahnunglück<br />
am 8. Juni im Abschnitt<br />
Freden-Alfeld wurden<br />
90 Helfer alarmiert.<br />
Aufgabe des THW war das<br />
Zerschneiden der Unfallgleise<br />
mit Brennschneidgeräten,<br />
das Bereinigen<br />
und Aufschütten des Gleiskörpers<br />
sowie das Ausleuchten<br />
der SchadenssteIle.<br />
Hannover<br />
Auf Anforderung der Kriminalpolizei<br />
durchsuchten<br />
THW-Helfer eine abgebrannte<br />
Behausung, die<br />
zwei Obdachlose bewohnt<br />
hatten, nach einer Leiche.<br />
Die Suche wurde erfolglos<br />
eingestellt.<br />
Salzgitter<br />
Die Schachtanlage "Anna" in der Nähe der UnglückssteIle<br />
Lengede diente mehreren Ortsverbänden (Salzgitter,<br />
Goslar, Clausthal, Göttingen, Lehrte und Peine)<br />
zu Sprengübungen. Anschließend wurde auf Anregung<br />
der Helfer an der Gedenkstätte des Grubenunglücks<br />
vor sieben Jahren ein Kranz niedergelegt.<br />
Delmenhorst<br />
Rege Tätigkeit des Ortsverbandes:<br />
Bau der Fuß-<br />
Gilde; Auffüllen von 500<br />
Luftballons für eine Großschau;<br />
Aufstelle.n und stängängerbrücke<br />
zwischen ei- dige Beseitigung von Stö-<br />
nem Industriebetrieb und rungen einer E-Versor-<br />
einem großen Neubauprojekt;<br />
Aufstellen eines Baumes<br />
für die St.-Polykaspus-<br />
Schleswig-<br />
Holstein<br />
Elmshorn<br />
Eine Gasexplosion im<br />
Obergeschoß eines Wohngebäudes<br />
war der Anlaß<br />
zur Alarmierung des Ortsverbandes<br />
Elmshorn.<br />
Die Einsatzgruppen sperrten<br />
wegen der Gefahr von<br />
Ziegelfall den Unfallort ab,<br />
beseitigten überhängende<br />
Dachteile und eine beschädigte<br />
Trennmauer der<br />
Wohnung und stützten<br />
die herabhängende Wohnungsdecke<br />
ab.<br />
Flensburg<br />
Die Kreisverwaltung von<br />
Flensburg/Land alarmierte<br />
den Ortsverband Flensburg<br />
zur Suche und Bergung<br />
eines in Klein/Solt in den<br />
Fluß Kielstau versunkenen<br />
Kleinkindes.<br />
gungsanlage für und während<br />
eines Reit- und<br />
Springturniers.<br />
Bad Segeberg<br />
Bei einem Verkehrsunfall<br />
in Bad Segeberg war ein<br />
Personenkraftwagen auf<br />
ein Wehr des Flusses<br />
Trave gestürzt und hatte<br />
das Wehr beschädigt. <strong>Das</strong><br />
Wehr staute die Trave.<br />
Der Ortsverband des <strong>Technische</strong>n<br />
Hilfswerks, zu<br />
Hilfe gerufen, beseitigte<br />
mit zwei Greifzügen das<br />
Hindernis.<br />
Auf der Rückfahrt wurde<br />
der Einsatztrupp Augenzeuge,<br />
als ein Personenkraftwagen<br />
mit Wohnanhänger<br />
von einer Windboe<br />
erfaßt, von der Kreisstraße<br />
eine 10 m tiefe Böschung<br />
hinuntergeschleudert wurde.<br />
Durch Blaulicht und<br />
Posten sicherte der Einsatztrupp<br />
des Ortsverbandes<br />
Bad Segeberg die<br />
UnfallsteIle, barg die Insassen<br />
des Personenkraftwagens<br />
und überführte sie<br />
in das Krankenhaus.
Aus den Landesverbänden<br />
Preetz<br />
Nach eineinhalbjähriger<br />
Bauzeit präsentiert der<br />
Ortsverband ein neues<br />
I<br />
Saarland<br />
Nonnweiler<br />
Anläßlich des Kreisfeuerwehrtages<br />
hatte der Ortsverband<br />
des THW den Ausrichtern<br />
in den Tagen vor<br />
dem Fest durch den Bau<br />
einer Brücke über die<br />
Prims zum Festplatz, die<br />
Aufstellung von Beleuchtungsanlagen<br />
und die In-<br />
Heim mit Garage und<br />
Schuppen für Bauholz.<br />
Über 2000 Arbeitsstunden<br />
hatten 20 Helfer an den<br />
Wochenenden investiert.<br />
stallation einer Waschanlage<br />
geholfen. Im Festzug<br />
war das THW daher stark<br />
vertreten.<br />
Saarlouis/ Merzig<br />
Eine große Werbe- und<br />
Leistungsschau fand am<br />
27. und 28. Juni auf dem<br />
Gelände der Katastrophensch<br />
utzschule des Saarlandes<br />
auf dem Litermont bei<br />
Düppenweiler statt. 180<br />
freiwillige Helfer nahmen<br />
an der Veranstaltung teil.<br />
Bayern<br />
Marktheidenfeld<br />
Der Landesverband hatte<br />
mehrere Ortsverbände zu<br />
einer "Übung Ersatzübergang"<br />
aufgerufen. Aufbauend<br />
auf den Erfahrungen<br />
des letzten Hochwassers<br />
sollten die Helfer weitere<br />
Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit,<br />
auch des<br />
LH-Gerätes, gewinnen.<br />
Gunzenhausen<br />
Die Kreisverkehrswacht<br />
schenkte dem THW-Ortsverband<br />
eine Magnettafel<br />
für den Verkehrsunterricht.<br />
Bei der Übergabe wurden<br />
die Helfer aufgefordert, an<br />
der Verbesserung der<br />
Kraftfahrer-Disziplin mitzuwirken.<br />
München<br />
Zur Katastrophenhilfe auf<br />
den Autobahnen stand der<br />
Landpolizei an den "verlängerten<br />
Wochenenden"<br />
der Monate Mai und Juni<br />
auch das THW in Bayern<br />
zur Verfügung.<br />
Einsatzgruppen der THW-<br />
Ortsverbände Freising,<br />
Lauf, Kitzingen, Ochsenfurt,<br />
Würzburg, Schweinfurt,<br />
Bad Kissingen und<br />
Mellrichstadt wurden an<br />
den Autobahnstrecken mit<br />
besonderer Unfallfrequenz<br />
- München - Ingolstadt,<br />
Autobahndreieck Nürnberg,<br />
Nürnberg - Würzburg,<br />
Würzburg - Fulda -<br />
postiert, um bei Unglücksfällen<br />
zur Rettung verunglückter<br />
Personen und zum<br />
Freimachen der Fahrbahnen<br />
beizutragen.<br />
Für die Autobahn München<br />
- Salzburg wurde außerdem<br />
vom THW-Ortsverband<br />
München eine bewegliche<br />
Bereitschaft eingesetzt,<br />
die die besonders<br />
anfällige Strecke München<br />
- Irschenberg im Gefolge<br />
der Landpolizei-Fahrzeuge<br />
abfuhr.<br />
Forchheim<br />
Bei einem Flugzeugabsturz<br />
kamen drei Menschen ums<br />
Leben. Die verkohlten Leichen<br />
wurden von Helfern<br />
des Ortsverbandes unter<br />
Lebensgefahr geborgen,<br />
weil einer der Tanks noch<br />
halb voll Treibstoff war.<br />
Unser Bild oben zeigt die<br />
Unglücksstelle.<br />
Nach einem Hauseinsturz<br />
auf der Hauptstraße stützten<br />
THW-Männer das Restmauerwerk<br />
und suchten<br />
nach einer angeblich Verschütteten.<br />
Es konnte festgestellt<br />
werden, daß niemand<br />
unter den Trümmern<br />
begraben war.<br />
183
Peru-Hilfe<br />
Zahlreiche Tageszeitungen<br />
erwähnten in ihrer<br />
Berichterstattung über die<br />
Erdbebenkatastrophe in<br />
Peru auch ausführlich die<br />
vom <strong>Technische</strong>n Hilfswerk<br />
geleisteten Dienste.<br />
Der "Bonner Generalanzeiger"<br />
brachte am 8. Juli<br />
den Bericht eines Studenten,<br />
der mit weiteren 17<br />
Helfern in den Anden eingesetzt<br />
war.<br />
Werbung<br />
Mehrere Zeitungen Nordrhein-Westfalensberichteten<br />
in den letzten Wochen<br />
über Werbe-Veranstaltungen<br />
des THW. Eine ganzseitige<br />
Bildreportage be.<br />
184<br />
faßt sich mit dem Jubiläumstag<br />
in Gronau, der zur<br />
Werbung genutzt wurde.<br />
"Um der Öffentlichkeit ein<br />
besseres Bild von ihrer<br />
Arbeit zu geben", so die<br />
"Westdeutsche Allgemeine<br />
Zeitung" vom 13. Juli, opferten<br />
Mitglieder des THW.<br />
zwölf Stunden auf den<br />
Marktplätzen Boy, Fuhlenbrock<br />
und Eigen.<br />
Über ein Sommertest, das<br />
das Altenaer THW veranstaltete,<br />
schrieb das Kreisblatt<br />
: Man hatte außer<br />
einem großen Mannschaftszelt,<br />
in dem zwei<br />
Beatbands zum Tanz aufspielten,<br />
eine Schießbude<br />
und mehrere andere Vergnügungsständeaufgestellt.<br />
Interessierten<br />
GERD HEMPEL trat mit<br />
seinen vier Söhnen dem<br />
Ortsverband Siegen bei.<br />
Dem Vernehmen nach sol l<br />
versucht werden, auch<br />
Frau Hempel für den<br />
Dienst am Feldkochherd<br />
zu begeistern.<br />
HANS-ULRICH PERLBACH<br />
wurde neuer Bezirksbeauftragter<br />
für Hamburg-Eimsbüttel.<br />
Während eines gut<br />
besuchten Kameradschaftsabends<br />
führte der<br />
Hamburger Landesbeauftragte<br />
Kneppenberg ihn in<br />
sein Amt ein.<br />
JÜRGEN NIETMANN, Helfer<br />
beim THW aus Elmshorn,<br />
wurde von seinen<br />
Kameraden erst in die<br />
Ehe mit Frau Antje "entlassen",<br />
nachdem er den<br />
Tampen der Spalierstehenden<br />
durchschnitten<br />
hatte.<br />
Bürgern wurde ein Teil<br />
der Ausrüstung vorgestellt<br />
und vorgeführt.<br />
Ausbildung und<br />
Einsatz<br />
Die "Kölnische Rundschau<br />
" war dabei, als sieben<br />
Taucher des Kölner<br />
Ortsverbandes bei der<br />
Tauchsportgemeinschaft<br />
Porz ihre Ausbildung absolvierten.<br />
Naß ging es auch zu bei<br />
einer Großübung des OV<br />
Bad Kreuznach. Dort<br />
probte man den Einsatz<br />
bei Wassernot, worüber<br />
die "Allgemeine Zeitung"<br />
Mainz dreispaltig in Wort<br />
und Bild berichtete.<br />
CHRISTIAN MÜLLER, Fernseh-Redakteur<br />
der " Schaubude"<br />
beim Norddeutschen<br />
Rundfunk, stattete<br />
anläßlich des Hafenkon.;<br />
zerts während der Kieler<br />
Woche, an dem auch das<br />
THW beteiligt war, dessen<br />
Informationsstand einen<br />
Besuch ab. Gruppenführer<br />
Roth erläuterte " Schaubuden-Müller"<br />
die ausgestellten<br />
Geräte und deren<br />
Verwendungsmögl ichkeit.<br />
Ein Sparkassenbuch über<br />
16500 Mark und 42 Silbertaler<br />
fanden THW-Helfer<br />
in der Bettmatratze<br />
einer verstorbenen Bäuerin,<br />
deren Hof von den<br />
THW-Männern aus Men ..<br />
den im Rahmen einer<br />
Übung abgerissen wurde.<br />
<strong>Das</strong> Gehöft in Sümmern<br />
war baufäl lig. Mehrere<br />
Zeitungen schrieben über<br />
die "THW-Schatzgräber".<br />
Ein Presseausschnitt ging<br />
der Redaktion zu, der von<br />
der Bergung eines im<br />
Lüttinger Baggerloch versunkenen<br />
Lkw handelte.<br />
" Bei den Bergungsarbeiten<br />
zeigte sich das harmonischeZusammenarbeiten<br />
zwischen der Schwimmtauchgruppe<br />
des THW<br />
<strong>Das</strong> <strong>Technische</strong> Hilfswerk<br />
trauert um ALWIN<br />
INTER, Ortsverband<br />
Mettlach. Er war seit<br />
vergangenem Jahr mit<br />
der Wahrnehmung der<br />
Geschäfte des Ortsbeauftragten<br />
befaßt. ER-<br />
HARD PATZEL T, Helfer<br />
des Ortsverbandes<br />
Donauesch i ngen.<br />
Kleve, dem Deichverband<br />
Grieth-Griethausen und<br />
den Bediensteten der<br />
Baggerei. Obwohl nur ein<br />
einziger Ölfleck den mutmaßlichen<br />
Standort des<br />
Fahrzeuges anzeigte, hatten<br />
es die Männer der<br />
Bergungsgruppe schnell<br />
geortet."<br />
Mehrere Zeitungen waren<br />
während einer Katastrophenübung<br />
durch ihre Redakteure<br />
vertreten, die das<br />
THW Aßweiler mit der<br />
Feuerwehr und dem Roten<br />
Kreuz Oberwürzbach<br />
veranstaltete. Die Übung,<br />
bei der ein Flugzeugabsturz<br />
angenommen wurde,<br />
war interessant genug für<br />
mehrspaltige Reportagen.
<strong>Das</strong> Innere des Hofes Niederboyen.<br />
Als im Jahre 1957 das Bundesministerium<br />
des Innern Generalmajor<br />
a. D. Lorenz beauftragte,<br />
für den Schutz der Bevölkerung<br />
vor Katastrophen an und auf<br />
dem Wasser mit Helfern des<br />
<strong>Technische</strong>n Hilfswerks den<br />
Schwimmbrückendienst aufzubauen,<br />
war dieser sich klar, daß<br />
nicht nur geeignetes Gerät beschafft<br />
werden, sondern das<br />
Hauptaugenmerk auf die Ausbildung<br />
gelegt werden müsse<br />
und zu diesem Zweck eine besondere<br />
Ausbildungsstätte erforderl<br />
ich sei.<br />
Auf Grund eingehender Erkundungen<br />
fiel schließlich die Wahl<br />
auf die alte Grafenstadt Hoya an<br />
der Weser, weil hier ein im Bundes<br />
besitz befindlicher ehemaliger<br />
Fliegerhorst und der Weserstrom<br />
gleichermaßen günstige<br />
Voraussetzungen für Unterbringu<br />
ng und Ausbildung boten.<br />
Dank der Tatkraft und der reichen<br />
Erfahrungen, die der aus<br />
der Pionierwaffe hervorgegangene<br />
Generalmajor a. D. Lorenz<br />
bes aß, und unterstützt von einem<br />
zu n ächst noch kleinen Kreis von<br />
THW-Schule Hoya . • •<br />
Mitarbeitern, konnte am 12. Juli<br />
1959 der 1. Lehrgang mit 30 Helfern<br />
durchgeführt werden.<br />
Als Übungsgerät stand dafür das<br />
von der Wehrmacht verwendete<br />
Brückengerät und ein leichtes<br />
Gerät aus Beständen der US-<br />
Armee zur Verfügung. Bald konnten<br />
jedoch diese Geräte durch<br />
modernere ergänzt werden.<br />
"Geburtswehen"<br />
Trotz aller Unzulänglichkeiten<br />
der ersten Zeit waren jedoch die<br />
Helfer mit einem solchen Eifer<br />
bei der Sache, daß bereits im<br />
Spätsommer 1959 der erste<br />
Brückenschlag des THW über<br />
die Weser bei Dörverden durchgeführt<br />
werden konnte, ein Bild,<br />
das inzwischen zu einem auch<br />
in der Öffentlichkeit gewohnten,<br />
aber immer wieder stark beachteten<br />
Ereignis geworden ist.<br />
Als im Juni 1964 die Schule aus<br />
Anlaß ihres 5jährigen Bestehens<br />
im Rahmen eines "Tages der offenen<br />
Tür" sich einer breiten Öffentlichkeit<br />
vorstellte, war sie bereits<br />
zu einem festen Begriff bei<br />
den Helfern des THW im ge-<br />
samten Bundesgebiet geworden.<br />
So konnte Schulleiter Baron die<br />
zahlreichen Besucher durch Lehrsäle,<br />
die mit vielen in mühevoller<br />
Kleinarbeit vom Schulpersonal<br />
hergestellten Modellen ausgestattet<br />
waren, Unterkünfte für<br />
120 Lehrgangsteilnehmer und<br />
eine modern eingerichtete Küche<br />
führen.<br />
Auch der Geräte- und Fahrzeugpark<br />
hatte sich in den zurückliegenden<br />
fünf Jahren erheblich<br />
vergrößert und gab einen umfassenden<br />
Einblick in die hohen<br />
technischen Anforderungen de"<br />
Ausbildung, die ein leistungsfähiger<br />
Wasserdienst erfordert.<br />
Für die Erhaltung und Instandsetzung<br />
waren auch die Anfänge<br />
von schuleigenen Werkstätten<br />
geschaffen, die inzwischen stetig<br />
weiter ausgebaut worden<br />
sind und daher einer Reihe von<br />
Fachkräften aus dem hiesigen<br />
Raum einen sicheren und interessanten<br />
Arbeitsplatz bieten.<br />
Auch für die am Anfang bestehende<br />
behelfsmäßige Lösung<br />
einer Ausbildungsstätte am Wasser<br />
unterhalb der Staustufe Dör-<br />
verden war 1961 ein Ersatz gefunden<br />
worden. <strong>Das</strong> Bundesamt<br />
für zivilen Bevölkerungsschutz<br />
konnte nämlich einen Bauernhof<br />
in der 8 km von Hoya entfernt<br />
liegenden Gemeinde Wien bergen<br />
als Wasserübungsplatz langfristig<br />
an pachten, der durch seine unmittelbare<br />
Lage an einem von<br />
der Schiffahrt nicht benutzten<br />
Weserarm ideale<br />
möglichkeiten an und auf dem<br />
Wasser bietet und gleichzeitig in<br />
den zur Verfügung stehenden<br />
Gebäuden die Lagerung des<br />
Übungsgerätes ermöglicht. Darüber<br />
hinaus steht ein unmittelbar<br />
an die Unterkunft grenzendes<br />
im Bundesbesitz befindliches<br />
Gelände als Landübungsplatz<br />
in einer Größe von 20 ha<br />
zur Verfügung, so daß die Ausbildung<br />
aller mit dem Wasserdienst<br />
zusammenhängenden<br />
Fachdienste hier an der Schule<br />
betrieben werden kann.<br />
10000 Helfer geschult<br />
Die Vielseitigkeit und der Umfang<br />
dieser Ausbildung zeigt die<br />
nachstehende Übersicht der lau-<br />
185
THW-Schule Hoys<br />
fenden Lehrgänge, wobei die am<br />
Ende des Ausbildungsjahres 1969<br />
erreichte Lehrgangsnummer 743<br />
und die stattliche Zahl von 9962<br />
geschulten Helfern auch dem<br />
Außenstehenden etwas über den<br />
Umfang der in diesen 12 Jahren<br />
geleisteten Arbeit sagen dürfte.<br />
Eine zusätzliche Aufgabe erwuchs<br />
der Schule daraus, daß<br />
ihr die vom Bundesamt für zivilen<br />
Bevölkerungsschutz eingerichtetenSchwimmbrückengeräteläger<br />
in Hemsloh, Kreis Grafschaft<br />
Diepholz und in Hochdonn<br />
am Nord-Ostsee-Kanal unterstellt<br />
wurden.<br />
Die Bereitstellung des dort befindlichen<br />
Gerätes erfolgte insbesondere<br />
für die Erstellung von<br />
Ersatzübergängen im Verteidigungsfall.<br />
Die für diese Aufgabe erforderlichen<br />
Einheiten werden aus den<br />
im Wasserdienst ausgebildeten<br />
Helfern des THW aufgestellt. Für<br />
bereits im Frieden notwendige<br />
Vorkehrungen mußten Kader<br />
aus hauptamtlichem Personal<br />
gebildet werden, die die Aufstellung<br />
und Mobilmachung dieser<br />
Einheiten durchführen und<br />
die Sch lüsselstellungen in diesen<br />
besetzen sollen.<br />
Obersicht über die Zahl der LehrgangsteIlnehmer<br />
In den Ausbildungsjahren<br />
Helferzahl<br />
bei Lehrgängen nach<br />
Jahr<br />
Lehrgang-Zeitplan<br />
1957/1960<br />
1961<br />
1962<br />
1963<br />
1964<br />
1965<br />
1966<br />
1967<br />
1968<br />
1969<br />
760<br />
962<br />
846<br />
816<br />
1 216<br />
855<br />
605<br />
92 *)<br />
448<br />
783<br />
Auf Grund mancherlei überlegungen<br />
wurde das für den norddeutschen<br />
Raum hierfür vorgesehene<br />
Personal an der Schule<br />
zusammengezogen und dieser<br />
unterstellt.<br />
Sie ist somit für die Aus- und<br />
Weiterbildung verantwortlich,<br />
wobei die seit dem Jahre 1964<br />
in regelmäßiger Folge durchgeführten<br />
übungen Höhepunkte<br />
bilden und der Schulung für den<br />
Einsatz des hauptamtlichen Personals<br />
und der Helfer in den<br />
vorgesehenen Einheiten dienen.<br />
Dabei werden auch Gerät, Fahrzeuge<br />
und sonstige Ausrüstung<br />
auf ihre ·Zweckmäßigkeit erprobt,<br />
soweit nicht schon während des<br />
laufenden Dienstbetriebes neue<br />
Erkenntnisse gesammelt und<br />
ausgewertet werden.<br />
Die Erarbeitung von Lehrhilfen,<br />
Merkblättern und Dienstvorschriften<br />
nehmen einen breiten<br />
Raum in dem umfangreichen<br />
Aufgabenkreis der Schule ein.<br />
Bewährte Einrichtung<br />
<strong>Das</strong> Kader-Personal, das sich<br />
bei den Lagergruppen Rhein I<br />
und Rhein II in Mehlem und<br />
Germersheim befindet, hat seine<br />
erste Schulung ebenfalls in Hoya<br />
7383<br />
2579<br />
Somit ergibt sich ein Gesamt-Ist von 9962 Helfern.<br />
bei Wochenend-<br />
Kurzlehrgängen<br />
875<br />
881<br />
823<br />
') Ab 22. Juli 1967 keine Lehrgänge auf Grund der Haushaltslage (5. Verfügungen<br />
vom 10. März 1967 und 22. Mai 1967 - 1I1 4 - 46 - 62 - 05 -)<br />
Namen und Amtszeit der Leiter der THW-Schule Hoya<br />
Name<br />
Albert Beierlein<br />
Max Hoffmann<br />
Volkmar Zahn<br />
Erich Baron<br />
Amtszeit<br />
') Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt.<br />
186<br />
Juli 1959 bis Oktober 1959<br />
November 1959 bis März 1960 *)<br />
April 1960 bis Dezember 1962<br />
seit Januar 1963<br />
Lehrgangsteilnehmer an der THW-Bundesschule<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
-<br />
-<br />
500 - ---<br />
o-==- I---<br />
erhalten. Es wird in gewissen<br />
Zeitabständen zur Fortbildung<br />
und Wahrung der Einheitlichkeit<br />
der Ausbildung hier zusammengezogen,<br />
um bei übungen der<br />
Landesverbände in den vorgesehenen<br />
Einsatzräumen eingesetzt<br />
zu werden.<br />
Inzwischen haben die jährlich<br />
wiederkehrenden Hochwasserkatastrophen<br />
des In- und Auslandes<br />
und die sich mehrenden<br />
Unfälle auf dem Wasser den an<br />
der Schule ausgebildeten Helfern<br />
oft genug Gelegenheit gegeben,<br />
ihr Können unter Beweis<br />
zu stellen. Die bisher gesammelten<br />
Erfahrungen haben gezeigt,<br />
daß der Fachdienst "Wasserdienst"<br />
ein unverzichtbarer<br />
fff-If-If-<br />
f-f--<br />
I<br />
I---<br />
I-<br />
I-<br />
I-<br />
II-<br />
I-<br />
I-<br />
I-<br />
I-<br />
I-<br />
Il-<br />
I-<br />
'-<br />
Bestandteil des Katastrophenschutzes<br />
ist und bleiben muß.<br />
Außerdem beweisen die Erfolge<br />
bei diesen Einsätzen, daß sich<br />
die Einrichtung einer Zentralen<br />
Ausbildungsstätte bewährt hat.<br />
Sie allein vermag die Helfer des<br />
THW und darüber hinaus auch<br />
die Angehörigen anderer Katastrophenschutz-Organisationen<br />
einheitlich auszubilden, damit sie<br />
fachgerecht und schnell anderen<br />
und sich selbst an und auf dem<br />
Wasser helfen können.<br />
So bildet die THW-Schule Hoya<br />
einen festen Bestandteil der für<br />
die gesamte Bevölkerung in der<br />
Bundesrepublik erforderlichen<br />
Katastrophenschutzeinrichtungen.<br />
Blick auf die Wiesen des Obungsplatzes während einer Obung.
<strong>Das</strong> Lehrgangsprogramm war im<br />
ersten Jahr noch nicht allzu um -<br />
fangreich. Es wurden ausgebildet:<br />
Gruppenführer für den allgemeinen<br />
Katastrophenschutz<br />
und für den Behelfsbrückenbau<br />
sowie Gruppenführer für Starkstromkabelnetze,Hochspannungsfreileitungsnetze<br />
und Rohrnetz<br />
Gas - Wasser. Nach Erlaß<br />
über die Gründung der Bundesanstalt<br />
THW nahm der Umfang<br />
der Lehrgänge jedoch sehr<br />
schnell zu, so daß vom 9. März<br />
1953 bis zum 31. März 1954 bereits<br />
27 Lehrgänge mit insgesamt<br />
856 Teilnehmern durchgeführt<br />
wurden. Die Zahl der Lehrgänge<br />
steigerte sich von Jahr<br />
zu Jahr und 1969 ist sie - wie<br />
die Abb. 1 zeigt - bei 119 Lehrgängen<br />
in diesem Jahre mi1<br />
2169 Lehrgangsteilnehmern angelangt.<br />
Der geringe Rückgan g<br />
im Jahre 1960 ist darauf zurückzuführen,<br />
daß die Zentrale Ausbildungsstätte<br />
des Bundes fü r<br />
den Luftschutzhilfsdienst ihre<br />
Tätigkeit aufnahm und ebenfalls<br />
Einrichtungen in Marienthai in<br />
Anspruch genommen hat, so daß<br />
eine vorübergehende Einschränkung<br />
der Lehrgänge des THW<br />
notwendig wurde.<br />
Bis zum 31. Dezember 1969<br />
wurde die THW-Bundesschule<br />
von 19255 Helfern besucht und<br />
es wurden 811 Lehrgänge insgesamt<br />
für Zwecke des THW<br />
durchgeführt.<br />
Vielseitige Ausbildung<br />
Im Laufe der Jahre sind die<br />
Leh rgangsarten außerordentlich<br />
vielseitig geworden. Die Aufstellung<br />
Nr. 2 zeigt für die Zeit vom<br />
9. März 1953 bis zum 31. Dezember<br />
1969, welche Lehrgangsarten<br />
in welcher Anzahl und mi t<br />
wieviel Teilnehmern durchgeführt<br />
wurden. Auch nach Vereinigung<br />
mit der Zentralen Ausbildungsstätte<br />
des Bundes (ZAB) für den<br />
LSHD lag der Schwerpunkt der<br />
Ausbildungstätigkeit bei de r<br />
THW-Bundesschule.<br />
Die ZAB für den LSHD hat von<br />
1959 bis 1969 insgesamt 305<br />
Lehrgänge abgehalten, die von<br />
4227 Lehrgangsteilnehmern besucht<br />
wurden. Auch die Teilnehmerzahlen<br />
der ZAB für den<br />
LSHD sind aus der Kurve Nr. 3<br />
zu entnehmen. Hier ist der Rückgang<br />
der Lehrgangsteilnehmer<br />
· . . und Ahrweiler<br />
In der Zeit vom 9. März 1953 bis zum 31. Dezember 1969 sind an Lehrgängen durchgeführt worden:<br />
Art der Lehrgänge<br />
1. <strong>Technische</strong>r Dienst NE<br />
1.1 Starkstrom-Freileitung<br />
1.2 Starkstrom-Kabel.<br />
1.3 Maststeiger<br />
1.4 NE-GF<br />
1.5 Schaltanlagen - Einführung<br />
1.6 Schaltanlagen 1 Woche .<br />
1.7 Schaltanlagen 2 Wochen<br />
1.8 Alu-Kabel-Schweißen .<br />
2. <strong>Technische</strong>r Dienst RK<br />
2.1 Rohrleitungsbau<br />
2.2 Rohrnetz-Wasser GF<br />
2.3 Kanalbau . . . . . . . . . . . .<br />
2.4 GF Abwasser-Ölschadenbeseitigung<br />
2.5 Rohrnetz "Gas"<br />
2.6 GF Rohrnetz-Gas .<br />
2.7 Schweißen.<br />
2.8 Brunnenbau<br />
2.9 Eternit-Rohrleitungsbau<br />
3. TD-Führungskräfte<br />
3.1 NE-RK<br />
3.2 NE<br />
3.3 RK<br />
3.4 ZF TD<br />
4. B-Dlenst des THW<br />
4.1 Behelfsstegebau<br />
4.2 Behelfsbrückenbau .<br />
4.3 Behelfsbrückenbau - Ergänzung<br />
4.4 Behelfsbrückenbau - Leiter<br />
4.5 Sprengdienst<br />
4.6 Sprengdienst - Wiederholung<br />
4.7 Atemschutz - Ausbilder<br />
4.8 Atemschutz - Grundlehrgang .<br />
4.9 B-Grundlehrgang.<br />
4.10 B-Gruppenführer .<br />
4.11 B-GF-Ausbilder<br />
4.12 B-ZF für Ausbilder.<br />
4.13 B-Führungskräfte - Einführung<br />
4.14 B-Führungskräfte - Ergänzung<br />
5. Katastrophen-Sonderlehrgänge<br />
5.1 Katastrophen-Brennschneiden.<br />
5.2 Katastrophenschutzhelfer bzw. allgemein .<br />
5.3 GF im Katastrophenschutz<br />
5.4 ZF im Katastrophenschutz<br />
5.5 Führer im Katastrophenschutz<br />
5.6 Waldlagerbau<br />
5.7 Schirrmeister und Gerätewarte .<br />
5.8 Kfz-Sachbearbeiter .<br />
5.9 Behelfsvermessung im Gelände - Grundlehrg.<br />
6. Lehrgang für Ausbildungsleiter<br />
6.1 Führungsgrundlagen<br />
7. Allgemeine Sonderlehrgänge<br />
8. THW-Fernmeldelehrgänge<br />
8.1 Wartung Funkgeräte<br />
9. ha. Geschäftsführer .<br />
9.1 Ortsbeauftragte<br />
9.2 <strong>Technische</strong> Mitarbeiter<br />
9.3 Einsatzleiter Kreisebene<br />
16<br />
13<br />
5<br />
15<br />
6<br />
9<br />
4<br />
7<br />
30<br />
2<br />
10<br />
3<br />
3<br />
2<br />
26<br />
8<br />
1<br />
6<br />
3<br />
2<br />
6<br />
40<br />
69<br />
19<br />
10<br />
46<br />
22<br />
15<br />
17<br />
21<br />
33<br />
1<br />
1<br />
33<br />
3<br />
66<br />
10<br />
40<br />
20<br />
14<br />
23<br />
35<br />
1<br />
15<br />
17<br />
12<br />
11<br />
15<br />
2<br />
11<br />
9<br />
1<br />
2<br />
i:<br />
a> "<br />
-na><br />
I/)E<br />
.- E<br />
NI/)<br />
75<br />
85<br />
17<br />
330<br />
224<br />
29<br />
11<br />
17<br />
23<br />
a><br />
E<br />
E<br />
THW-Schule Ahrweiler<br />
seit 1967 auf die Unsicherheit<br />
der Helfer über das weitere<br />
Fortbestehen des LSHD und die<br />
Neuorganisation im Rahmen<br />
des Erweiterten Katastrophenschutzes<br />
zurückzuführen.<br />
Die Ausrüstung der THW-Bundesschule<br />
hinsichtlich der<br />
übungsanlagen und technischen<br />
übungsstationen ist vorbildlich.<br />
<strong>Das</strong> gilt besonders auch für die<br />
Ausb ildung im Bergungsdienst.<br />
Dabe i soll darauf hingewiesen<br />
werden, daß vom Aufbau der<br />
Trümmerstraße an bis zu der<br />
Gestaltung von Modellanlagen<br />
und übungsräumen diese Arbeiten<br />
zum überwiegenden Teil<br />
durch das Personal der THW-<br />
Bundesschule nach eigenen Entwürfen<br />
durchgeführt wurden.<br />
Viele der Einrichtungen wie z. B.<br />
das Trümmerhausmodell 1: 10<br />
sind heute international anerkan<br />
nt und werden von Model lbauf<br />
irmen für das Ausland hergestellt.<br />
Die technischen Einrichtungen<br />
für d ie Ausbildung des Instandsetzungsdienstes<br />
waren schon in<br />
Marienthai vorbildlich und haben<br />
Ind ustriefirmen Anregungen für<br />
die Ausgestaltung neuer Lehrmittel<br />
gegeben. Bei der Planung<br />
der technischen Schulen der<br />
Bundeswehr wurden<br />
dene Lehrmittelarten übernommen<br />
. Dabei ist allerdings zu erwäh<br />
nen, daß die Anlagen der<br />
Bundeswehr durch Industriefirmen<br />
erstellt wurden.<br />
1968 wurde die fachtechnisch e<br />
Schule der Bundesanstalt THW<br />
in Moers aufgelöst, die nach Zusammen<br />
legung der THW-Schule<br />
Ahrw eiler mit der ZAB für den<br />
LSH D aus Marienthai abgezogen<br />
worden war. Ab 1969 laufen an<br />
der THW-Bundesschule auch<br />
alle Lehrgänge für die fachtechnische<br />
Ausbildung auf dem Gebi<br />
et der Schaltanlagen, der Kabelverlegung<br />
und Montage, des<br />
Freil eitungsbaues, für Abwasse rund<br />
Olschadenbekämpfung, fü r<br />
Bru nnenbau, Autogenschweißen<br />
und für Alukabelschweißen.<br />
Die Ausbi ldung der Helfer fü r<br />
das im Instandsetzungsdienst<br />
benötigte Ergänzungspersona l<br />
für d ie Fachtrupps der Versorgungsbetriebe<br />
erfolgt in enger<br />
Zusammenarbeit mit den Versorgungsbetrieben,<br />
von denen<br />
188<br />
auch teilweise die Lehrkräfte zur<br />
Verfügung gestellt werden.<br />
Ursprünglich bestand der Lehrkörper<br />
der THW-Bundesschule<br />
lediglich . aus dem Schulleiter,<br />
vier Lehrkräften, ein Sprengmeister<br />
und sechs Ausbildern. Heute<br />
ist der Lehrkörper etwas umfangreicher.<br />
Er ist in Anlehnung<br />
an die Gliederung der<br />
ZAB für den LSHD in zwei Lehrgruppen<br />
unterteilt, die Lehrgruppe<br />
Katastrophenschutz und<br />
die Lehrgruppe Instandsetzungsdienst.<br />
Die THW-Bundesschu le<br />
verfügt zur Zeit über folgendes<br />
Lehrpersonal: ein Schu lleiter,<br />
zwei Lehrgruppenleiter, zwei<br />
Lehrkräfte I-D ienst, zwe i Lehrkräfte<br />
Kat.-Dienst, acht Ausbilder.<br />
Gerätewarte, Kraftfahrer<br />
usw. sind bei den Schulen gemeinsam<br />
im Stellen plan.<br />
Zusammenfassend kann festgestellt<br />
werden, daß die Bundesanstalt<br />
THW mit ihrer Bundesschule<br />
Ahrweiler über eine zentrale<br />
Ausbildungsstätte verfügt,<br />
die sich wegen ihrer Einrichtungen<br />
und der Qualität ihrer Lehrgänge<br />
sowie der angewandten<br />
Lehrmethoden im In- und Ausland<br />
des besten Rufes erfreut.<br />
T.;/nJ,mer<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
qOO<br />
goo<br />
700<br />
600<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Lehrgangsteilnehmer<br />
an derZAB<br />
für den LSHD<br />
1'152 1'1S3 1'15* 1'155 1'156 1'151 1'158 1'159 1'160 1'161 1962 1'163 1r61f 1'165 1'166 1'16T 1'168 1'16'1<br />
R"chnung.jahr
Zivile Verteidigung (Zlff. 73 + 74)<br />
Die Bundesrepublik muß für einen Verteidigungsfall,<br />
der weite Landstriche unseres<br />
Staatsgebietes
Technik<br />
Wissenschaft<br />
Forschung<br />
Transportables<br />
Kunststoffhaus -<br />
Behausung<br />
desmobilen<br />
Arbeitnehmers<br />
von morgen?<br />
Wer hat nicht schon in Presse,<br />
Film und Fernsehen gelegentlich<br />
Berichte gefunden, wonach<br />
irgend ein spleeniger Amerikaner<br />
sein komplettes Wohnhaus<br />
auf Räder oder ein Floß verladen<br />
hat und damit umzog? Eine<br />
weit größere ' Rolle spielen<br />
gegen in Nordamerika die Wohnwagenstädte<br />
der Arbeiter und<br />
Industrieangestellten. Die häufige<br />
Arbeitslosigkeit, die oft<br />
schlagartig durch Schließung<br />
großer Fabriken entsteht, zwingt<br />
dort die Arbeitnehmer zunehmend<br />
zur Beweglichkeit. Ein erheblicher<br />
Teil der Betroffenen<br />
hilft sich dann mit einem Wohnwagen<br />
und zieht so lange durchs<br />
Land, bis er an anderer Stelle<br />
wieder Arbeit findet. Auch wird<br />
drüben überm großen Teich die<br />
Wohnungsfürsorge nicht so groß<br />
geschrieben wie bei uns. Wenn<br />
irgendwo ein neues Industriewerk<br />
aus dem Boden wächst,<br />
bilden sich fast immer Wohnwagensiedlungen<br />
als einzige<br />
Unterkunftsmöglichkeit der<br />
neuen Belegschaft. Kommt diese<br />
Entwicklung auch in Europa auf<br />
uns zu? Die Anzeichen verdichten<br />
sich.<br />
Aus ganz anderen Gesichtspunkten<br />
allerdings ist nun durch Initiative<br />
eines großen deutschen<br />
Chemiekonzerns ein komfortables<br />
Kunststoffhaus konstruiert worden,<br />
daß eine vollwertige Wohnung<br />
mit modernstem Komfort<br />
bietet. Da es aber in der Fabrik<br />
komplett gefertigt und dann an<br />
seinen Standort transportiert<br />
wird, dürfte es besonders für<br />
solche Leute interessant sein, die<br />
beruflich beweglich bleiben wollen<br />
oder müssen und gerne mitsamt<br />
ihrem Haus umziehen wol-<br />
190<br />
<strong>Das</strong> Haus besteht aus einer 15 m langen Kunststoffröhre.<br />
f. i!<br />
len. <strong>Das</strong> Röhrenhaus auf Stützen,<br />
vom schweizerischen Architekten<br />
Franz A. Dutler, St. Gallen, entworfen,<br />
ist in jeder Hinsicht ein<br />
Kind und zugleich Repräsentant<br />
unserer Zeit.<br />
<strong>Das</strong> Haus besteht aus einer<br />
Röhre von 15 m Länge und 4,92<br />
m Durchmesser. Die Röhre wird<br />
nach dem Wickelverfahren hergestellt<br />
und besteht aus Außenund<br />
Innenschalen aus glasfaser-<br />
•<br />
verstärktem Palatal mit einer<br />
hoch isolierenden Zwischenschicht<br />
aus Hartschaumstoff. Es ist wetterfest,<br />
sogar an der See, und<br />
wartungsfrei. Die 70 qm Innenfläche<br />
sind geschickt in Wohn-,<br />
Sch laf- und Arbeitsbereich aufgeteilt.<br />
Die Räume des Musterhauses<br />
wirken hell, geräumig,<br />
großzügig und sehr modern, dennoch<br />
sehr wohnlich. Die Möbel<br />
sind aus Kunststoff gefertigt. Die<br />
gesamte Einrichtung einschließ-<br />
lieh Geschi rrspülmaschine, Microwellengrill,<br />
Fernseher und<br />
Stereoanlage wird mitgeliefert.<br />
Ein besonderer Clou ist die Heizung.<br />
Sie kann durch das Telefon<br />
ferngesteuert werden. Falls<br />
das Haus z. B. als luxuriöses<br />
Wochenendhaus dient, kann man<br />
sie durch Anruf einschalten oder<br />
bei Umdisposition auch wieder<br />
abschalten. Bis zu vier Personen<br />
können in der Kunststoffröhre<br />
bequem wohnen. H. C. Weiler
Uranspaltung bis heute<br />
Atome sind die kleinsten Bausteine<br />
eines chemischen Grundstoffes.<br />
<strong>Das</strong> Wort Atom stammt<br />
von dem griechischen Philosophen<br />
Demokrit (400 v. Chr.) und<br />
besagt, daß die Atome als die<br />
kleinsten, nicht mehr weiter<br />
teilbaren Bestandteile der natürlichen,<br />
auf der Erde vorkommenden<br />
Elemente gelten. Erst<br />
viel später führte die Entdekkung<br />
der Radioaktivität durch<br />
den französischen Physiker<br />
Becquerel (1896) und des Radiums<br />
durch das Ehepaar Marie<br />
und Pierre Curie (1898) zu der<br />
Ansicht, daß gewisse Elemente<br />
sich in andere Elemente umzuwandeln<br />
vermögen. So führen<br />
z. B. Uran-Atome ohne äußeren<br />
Einfluß über Radium-Atome in<br />
Form der Zerfallsreihen schließlich<br />
zu stabilen Blei-Atomen.<br />
Solche Elemente, die zu Umwandlungen<br />
in andere Atomarten<br />
neigen, nennt man radioaktiv.<br />
Damit war schließlich die alte<br />
Definition für den Begriff Atom<br />
verlorengegangen und man erkannte,<br />
daß die Atome sich aus<br />
Elementarteilchen aufbauen und<br />
durchaus weiter teilbar sind. Der<br />
Bau aller Atome folgt einem<br />
einheitlichen Schema: im Mittelpunkt<br />
des Atoms sitzt der Atomkern,<br />
bestehend aus Protonen<br />
und Neutronen, der von der<br />
Atomhülle (Elektronenhülle) umgeben<br />
wird.<br />
Die technische Nutzbarmachung<br />
der in den Atomkernen enthaltenen<br />
Energie hat mit der Uranspaltung<br />
begonnen. Am 6. Januar<br />
1939 erschien in der deutschen<br />
Fachzeitschrift "Die Naturwissenschaften"<br />
ein Bericht VOI'<br />
Otto Hahn und Fritz Straßmann<br />
vom Kaiser-Wilhelm-Institut für<br />
Chemie in Berlin-Dahlem unter<br />
dem Titel "über das Zerplatzen<br />
des Uran kernes durch langsame<br />
Neutronen". Die Entdeckung war<br />
den beiden Forschern am 17.<br />
Dezember 1938 gelungen.<br />
Dr. Olto Hahn, am 8. März 1879<br />
in Frankfurt/Main geboren, war<br />
seit 1912 Mitglied und leitete<br />
von 1928 bis 1945 das Kaiser-<br />
Wilhelm-Institut für Chemie in<br />
Berlin, gleichzeitig war er Professor<br />
an der Universität Berlin<br />
und seit 1945 Professor in Götlingen.<br />
Von 1946 bis 1960 stand<br />
er als Präsident der Max-Planck-<br />
Gesellschaft zur Förderung der<br />
Wissenschaft vor und erhielt 1944<br />
den Nobelpreis für Chemie. Prof.<br />
Hahn starb am 28. 7. 1968.<br />
Dr. Fritz Straßmann, am 22 . Februar<br />
1902 in Boppard geboren,<br />
war nach seiner Berliner Tätigkeit<br />
Professor und Direktor des<br />
Instituts für Anorganische und<br />
Kern-Chemie der Universität<br />
Mainz und ist seit April dieses<br />
Jahres emeritiert.<br />
Wenn ein Neutron in einen Urankern<br />
(U 235) eindringt, kommt<br />
dieser zum Platzen und zerfällt<br />
in zwei Kerne von ähnlicher<br />
Größe. Es werden neue Neutronen<br />
gleichzeitig frei, die zu weiteren<br />
Uran-Kernspaltungen führen<br />
. Die Nachricht dieser Entdeckung<br />
wurde einem zu gleicher<br />
Zeit in Amerika tagenden<br />
Kernphysiker-Kongreß, an dem<br />
auch der bekannte Forscher Nils<br />
Bohr teilnahm, bekannt. Es soll<br />
damals eine ganze Zahl von<br />
Kongreßteilnehmern daraufhin<br />
die Sitzung unverzüglich verlassen<br />
haben, um die Ergebnisse<br />
des Prof. Hahn zu prüfen. Nach<br />
wenigen Tagen hatte man bereits<br />
den Nachweis erbracht, daß<br />
Hahn und Straßmann recht hat·<br />
ten . Zahlreiche Veröffentlichungen<br />
zum Thema Kernspaltung<br />
erschienen nun, allein 1939 über<br />
100 Artikel. Auch die Frage der<br />
Nutzung der Kernenergie wurde<br />
aufgeworfen und durch den italienischen<br />
Physiker Fermi (1938<br />
Nobelpreis für Physik) beantwortet,<br />
der 1942 in Chicago den<br />
ersten Kernreaktor der Welt in<br />
Betrieb setzte.<br />
Schon im Frühjahr 1939 war den<br />
Fachleuten ebenfalls klar geworden,<br />
daß auch eine militärische<br />
Anwendung der Kernspaltung<br />
möglich ist. Im Gegensatz zum<br />
,Kernreaktor muß hier die Freisetzung<br />
der bei der Kernspaltung<br />
erhaltenen Energie<br />
schlagartig in kleinsten Bruchteilen<br />
einer Sekunde erfolgen<br />
und zu Schäden unvorstellbarer<br />
Stärke führen. So begann man<br />
in Amerika mit dem Bau von<br />
Atombomben; bis 1945 waren<br />
drei Bomben fertiggestellt. Die<br />
erste Bombe wurde versuchsweise<br />
am 16. Juli 1945 in Alamogordo<br />
(Neu-Mexiko) zur Detonation<br />
gebracht, die zweite Bombe<br />
kam am 6. August 1945, um 8.15<br />
Professor Hahn<br />
Uhr Ortszeit, in Hiroshima zum<br />
Einsatz, und die dritte Bombe<br />
schließlich fiel drei Tage danach<br />
auf Nagasaki. Fünf Tage später<br />
kapitulierte Japan.<br />
Im Jahre 1949 erfolgte die erste<br />
Versuchsdetonation einer russischen<br />
Atombombe. Bei beiden<br />
Mächten wird nun der Bau neuer<br />
Atombomben betrieben, es folgen<br />
ebenso auf beiden Seiten<br />
in den folgenden Jahren zahlreiche<br />
Versuchsdetonationen, unter<br />
anderem im Juli 1946 auch<br />
eine Unterwasserdetonation im<br />
Bikini-Archipel im Pazifik. Um<br />
größere Energien freizumachen,<br />
beginnt ein Kampf um den Bau<br />
der Wasserstoffbombe, und im<br />
Mai findet auf der Insel Eniwetok<br />
die er,ste Erprobung der Amerikaner<br />
einer thermonuklearen Reaktion<br />
statt. Schon im August<br />
1953 lassen die Russen ihre<br />
erste Wasserstoffbombe detonieren.<br />
Während die Amerikaner<br />
flüssiges Deuterium und Tritium<br />
benutzten, fand man bei der Untersuchung<br />
von Luftproben nach<br />
dem russischen Versuch geringe<br />
Spuren von Lithium. Lithium, mit<br />
Deuterium durch eine chemische<br />
Reaktion vereinigt, bedeutete einen<br />
weiteren technischen Fortschritt<br />
bei der Herstellung der<br />
Wasserstoffbomben. Bei der Versuchsdetonation<br />
der Amerikaner<br />
am 1. März 1954 kam erstmals<br />
eine Drei-Phasen-Bombe zum<br />
Einsatz. Diese Bombe, der Name<br />
zeigt es an, enthält Uran 235 zur<br />
Zündung, Lithiumdeuderid für die<br />
Kernverschmelzung und Uran<br />
238. Der größte Teil der freiwerdenden<br />
Detonationsenergie ist<br />
dabei dem Uran 238 zuzuschreiben.<br />
Die zahlreichen Testversuche<br />
führten nach langen Verhandlungen<br />
im Herbst 1958 zu<br />
einer Vereinbarung zwischen den<br />
USA, der Sowjetunion und England,<br />
keine weiteren Detonationen<br />
in der Luft oder an der Erdoberfläche<br />
vorzunehmen. Unterirdische<br />
Detonationen, die nicht<br />
bis zur Oberfläche durchbrechen,<br />
blieben dagegen erlaubt. Es soll<br />
noch erwähnt werden, daß 1952<br />
die Englän,der ihren ersten Testversuch<br />
durchführten. Am 13.<br />
Ferbuar 1960 war dann Frankreich<br />
soweit und löste in der<br />
Sahara die Detonation aus,<br />
der noch eine Heihe weiterer<br />
Detonationen folgten, darunter<br />
auch solche im Stillen Ozean.<br />
Drei Jahre später, am 16. Oktober<br />
1964, überraschte auch<br />
China die anderen Mächte mit<br />
seiner ersten Testung.<br />
Neben dieser Waffenentwicklung<br />
lief von Anfang an eine Weiterführung<br />
der gesteuerten Energiegewinnung<br />
aus dem Atomkern,<br />
der Konstruktion und des<br />
Baues zahlreicher Kernreaktoren<br />
verschiedenster Typen. Ende<br />
1968 wurden in .der ganzen Welt<br />
64 Kernkraftwerke mit einer<br />
Netto-Kapazität von 12807 MWe<br />
betrieben. Bis Ende 1975 Ist mit<br />
weiteren 138 Werken zu rechnen,<br />
die gesamte Nettoleistung wird<br />
bei 202 Kernkraftwerken 105264<br />
MWe betragen. Es werden sich<br />
dann 164 Kraftwerke mit 89995<br />
MWe in der westlichen Welt, 38<br />
Werke mit 15269 MWe in den<br />
Ostblockstaaten und in Asien<br />
befinden. Die größte nuklear<br />
installierte elektrische Leistung<br />
werden die USA mit 88 Anlagen<br />
und 60149 MWe aufweisen, gefolgt<br />
von Großbritannien mit 19<br />
Anlagen und 10643 MWe.<br />
Während bis 1968 der Gas-Graphit-Reaktor<br />
der meistgebaute<br />
Typ der Kernkraftwerke (42,2 Ofo)<br />
war, wird 1975 der Druckwassertyp<br />
(49,2 Ofo) an erster Stelle<br />
stehen.<br />
Abschließend soll noch ein Beispiel<br />
der friedlichen Nutzung der<br />
Atomenergie .in Form einer unterirdischen<br />
Kerndetonation erwähnt<br />
werden. Die USA haben<br />
am 10. September vergangenen<br />
Jahres in den Bergen Colorados<br />
ein im Sandstein eingeschlosseneserschlossen,<br />
indem sie einen 40-<br />
KT -Atomsprengkörper am Ende<br />
eines 2542 m tiefen Schachtes<br />
auslösten. Nach Schätzung der<br />
amerikanischen Atomenergiekommission<br />
(AEC) wurden dabei<br />
bis zu 9 Billionen m 3 im Fels<br />
eingeschlossenes Naturgas zugänglich<br />
gemacht. In der näheren<br />
Umgebung des Detonationsortes<br />
war ein mehrfaches Beben<br />
der Erde ohne Entweichen von<br />
Radioaktivität festzustellen. Nach<br />
Ansicht der AEC hat dieser Versuch<br />
erneut die Möglichkeit einer<br />
Nutzung der Kernenergie für<br />
geologische Zwecke bestätigt.<br />
GMS.<br />
191
Taschenbuch fü r Truppentechnik<br />
und Instandsetzungswesen.<br />
1970 - 13. Auflage.<br />
Herausgegeben von<br />
Brigadegeneral a. D. Kurt<br />
Voge l. 350 Seiten, mit zahlreichen<br />
Abbildungen, Übersichten<br />
und Tabellen. Format<br />
DIN A 6, Plastikeinband<br />
. 10,80 DM . Wehr<br />
und Wissen-Verlags-GmbH,<br />
Darmstadt.<br />
<strong>Das</strong> o. a. Taschenbuch liegt in<br />
der 13. Folge überarbeitet und<br />
erweit ert vor. Für Zwecke des<br />
THW und des erweiterten Katastrophenschutzes<br />
sind besonders<br />
die Kapitel über den Umgang<br />
mit Explosivstoffen und<br />
die Kapitel über Kraftfahrwesen<br />
und hydraulische Anlagen interessant.<br />
<strong>Das</strong> Buch enthält wichtige<br />
Umrechnungstafeln für alle<br />
techn ischen Maßsysteme sowie<br />
über Spezialmaßeinheiten der<br />
USA.<br />
Der Anhang "Allgemeinmilitärisches<br />
Wissen " bringt unter<br />
Pionie rausbildung aller Truppen<br />
Hinweise zum feldmäßigen Straßenbau,<br />
Bau von Behelfsübersetzmitteln<br />
und zum Behelfsbrücken-<br />
und Stegebau sowie<br />
über Spreng- und Zündmittel und<br />
ihre Anwendung. Ebenso sind<br />
viele Einzelheiten aus dem Fernmeldedienst<br />
aller Truppen und<br />
über ABC-Kampfmittel direkt für<br />
den erweiterten Katastrophenschutz<br />
verwendbar, ebenso die<br />
Kapitel über Zurechtfinden im<br />
Gelände, Kartenkunde und den<br />
motorisierten Marsch.<br />
Strahlenschutz in Forschung<br />
und Praxis. Jahrbuch<br />
der Vereinigung Deutsch<br />
er Strahlenschutzärzte<br />
e. V. 251 Seiten, mit vielen<br />
Tabellen und Abbildungen,<br />
in Leinen gebunden, Format<br />
DlN A 5. Verlag Rombach,<br />
Freiburg i. Br.<br />
Der Strahlenschutz hat auf Grund<br />
der Entwicklung auf atomarem<br />
Gebiet und infolge der steigenden<br />
Anwendung energie reicher<br />
ionisierender Strahlen in Medizin,<br />
Forschung und Technik eine<br />
Ausweitung erfahren, die es notwend<br />
ig macht, eine allgemeine<br />
Information zu geben.<br />
192<br />
<strong>Das</strong> Buch ist untergliedert in die<br />
Hauptabschnitte Radiologie und<br />
Strahlenschutz; Berufliche Strahlenschäden<br />
und ihre Diagnose;<br />
Die Strahlenschutzgesetzgebung<br />
und ihre praktische Durchführung<br />
; Strahlenschutz in Industrie<br />
und Technik; Dosimetrie unter<br />
besonderer Berücksichtigung der<br />
Individualdosimetrie; Probleme<br />
der Beseitigung radioaktiver Abfälle.<br />
Für die im ABC-Dienst tätigen<br />
Angehörigen des erweiterten<br />
Katastrophenschutzes enthält es<br />
eine große Anzahl außerordentlich<br />
interessanter Veröffentlichungen<br />
aus der Feder führender<br />
Fachleute.<br />
Galvanometer. Von Dr.<br />
Schlosser und Dr.-Ing. Winterling.<br />
261 Seiten, mit 61<br />
Bildern und 12 Tafeln, For"<br />
mat DIN A 5, in Leinen gebunden.<br />
Verlag G. Braun,<br />
Karlsruhe.<br />
<strong>Das</strong> Galvanometer nimmt unter<br />
den elektrischen Meßgeräten<br />
eine besondere Stellung ein. Seit<br />
seiner Erfindung begleitet es als<br />
wichtigstes Meßgerät für die<br />
Messung kleiner Gleichströme<br />
und Gleichspannungen die Entwicklung<br />
der Elektrotechnik. Dia<br />
Entwicklung der Galvanometer<br />
gilt im wesentlichen als abgeschlossen.<br />
Die Verfasser haben<br />
alle Erkenntnisse in ihrem Buch<br />
zusammengefaßt, um den Ingenieuren<br />
und Technikern eine<br />
Übersicht des Erreichten zu geben.<br />
<strong>Das</strong> Buch hat den Charakter<br />
eines Nachschlagewerkes, das<br />
den Benutzer des Galvanometers<br />
schnell und sicher informiert.<br />
Für die Dimensionierung<br />
und einzelne Bauteile enthält es<br />
wichtige Empfehlungen für den<br />
Instrumentenbauer. Vom einfach·<br />
sten bis zu den modernsten<br />
Lichtmarkengalvanometern, Mikroprojektoren<br />
und unmittelbar<br />
in Meßeinrichtungen eingebautenSpannband-Zeigergalvanometern<br />
sind auch die neuesten<br />
Konstruktionsformen besonders<br />
berücksichtigt. Ebenso finden<br />
moderne Registriergalvanometer<br />
ihre Beachtung.<br />
<strong>Das</strong> Buch kann allen elektrotechnisch<br />
interessierten Personen<br />
sehr empfohlen werden.<br />
Erweiterter Katastrophenschutz<br />
ZB - Ziviler Bevölkerungsschutz,<br />
Heft 5/70<br />
"Der lebt, der leben will", Pauly.<br />
- "Die nächsten Schritte. <strong>Das</strong><br />
Katastrophenschutzgesetz und<br />
seine Verwirklichung". - "DLRG-<br />
Erfolgsbericht 1969. 730 Menschen<br />
wurden gerettet". - "A + B<br />
= X? Stimmt diese Formel? Ist<br />
die Gesamtverteidigung (X) die<br />
Summe aus militärischer Verteidigung<br />
(A) plus ziviler Verteidigung<br />
(B)?" , Freutel. - "Wasser<br />
über alles - Alles über Wasser",<br />
4. Teil, Such .<br />
Zivilschutz. Informationsdienst<br />
des Österreichischen<br />
Zivilschutzverbandes,<br />
Heft 9170<br />
"Bilden Atomreaktoren eine Gefahr<br />
für die Bevölkerung?". -<br />
.. Der unheimliche Tod in winzigen<br />
Silberbüchsen" .<br />
Zivilschutz. Informationsdienst<br />
des Österreich ischen<br />
Zivilschutzverbandes,<br />
Heft 10170<br />
"Was in der Sowjetunion jeder<br />
wissen muß ". - "Geistige Landesverteidigung<br />
und Zivilschutz".<br />
- .. Die schwersten Erdbeben dieses<br />
Jahrhunderts".<br />
Zivilschutz. Zeitschrift des<br />
Schweizerisch en Bundes<br />
für Zivilschutz, Heft 5170<br />
" Gerüstet für die Megatonne?".<br />
- .. <strong>Das</strong> Luftverteidigungssystem<br />
,Florida' ". - .. Zivilschutz an der<br />
MUBA". - .. Zivilschutzvorlage im<br />
Kanton Bern".<br />
NATO-Brief, Heft 5170<br />
"Sachverständigentagung in Rom<br />
über Katastrophenhilfe " .<br />
Dräger-Hefte, Nr. 279<br />
Entwicklung des neuen<br />
Preßluftatmers Modell PA 54/<br />
1800 S", Warncke. - "Die praktische<br />
Anwendung des mechanischen<br />
Prüfröhrchenverfahrens<br />
bei der Beurteilung von Arbeitsplätzen",<br />
Dr. Manz. - .. Hinweis:<br />
Ein neues Dräger-Prüfröhrchen-<br />
Taschenbuch" .<br />
Bohren - Sprengen - Räumen,<br />
Heft 5170<br />
"Probleme der Gebäudesprengungen<br />
in bebauten Gebieten ".-<br />
"Churchill-Falls Projekt. In Labrador<br />
entste ht das größte unterirdische<br />
Wasserkraftwerk der<br />
Welt", Dinse.<br />
Militärwesen<br />
loyal, Heft 7/70<br />
" Moskau greift nach den Weltmeeren<br />
" . - .. Gefahr aus dem<br />
Norden". "Blauer Himmel,<br />
blaues Meer und rote Schatten".<br />
- .. Bundeswehr und Gesell -<br />
schaft ".<br />
Flotte, Heft 2/70<br />
.. Marine-Konzeption ". - "Wettrüsten<br />
unter Wasser". - "Hafenportrait<br />
Wilhe lmshaven ". - .. Marinearsenal"<br />
. - .. Schwedens Marine,<br />
klein aber modern ".<br />
,,50000 Mann tür Lenin ".<br />
I-Dienst: Elektrotechnik<br />
ETZ - Ausgabe A, Heft 5170<br />
Sicherheitsprobleme bei ge kapselten<br />
Hochspannungsanlagen<br />
des Mittelspannungsbereiches" ,<br />
Hamberger. - .. Die Betriebssicherheit<br />
elektrischer Anlagen<br />
und ihre Bedeutung für die Beeinflussungstechnik",<br />
Kuhnert.<br />
I-Dienst: Gas-Wasser-<br />
Abwasser<br />
gwf - Wasser, Abwasser,<br />
Heft 5/70<br />
.. Die öffentliche Wasserversorgung<br />
in Baden-Württemberg<br />
(11.)" . - "Der Bau des Rohrstollens<br />
Geislingen (Steige)", Schmid,<br />
Wurster. - "Wasser 70 - Lebenselement<br />
Wasser", Vater.<br />
gwt - Gas, Erdgas, Heft 5170<br />
.. Gefahren um die Olversorgung",<br />
Genzsch.