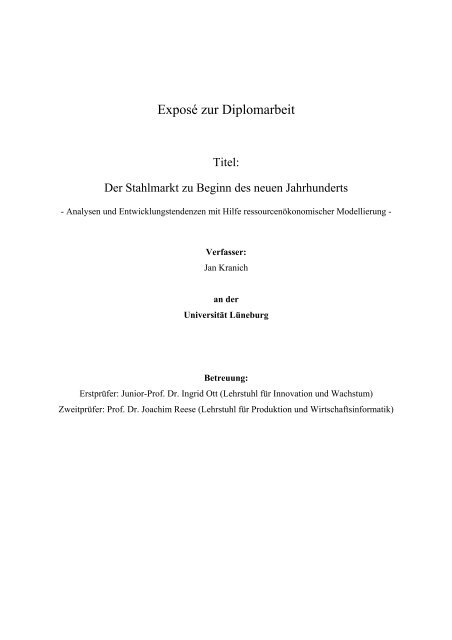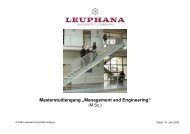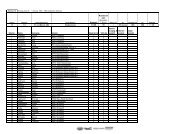Exposé zur Diplomarbeit - Leuphana Universität Lüneburg
Exposé zur Diplomarbeit - Leuphana Universität Lüneburg
Exposé zur Diplomarbeit - Leuphana Universität Lüneburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Exposé</strong> <strong>zur</strong> <strong>Diplomarbeit</strong><br />
Titel:<br />
Der Stahlmarkt zu Beginn des neuen Jahrhunderts<br />
- Analysen und Entwicklungstendenzen mit Hilfe ressourcenökonomischer Modellierung -<br />
Verfasser:<br />
Jan Kranich<br />
an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong><br />
Betreuung:<br />
Erstprüfer: Junior-Prof. Dr. Ingrid Ott (Lehrstuhl für Innovation und Wachstum)<br />
Zweitprüfer: Prof. Dr. Joachim Reese (Lehrstuhl für Produktion und Wirtschaftsinformatik)
1. Motivation für das gewählte Thema<br />
Wahl und Gestaltung des Themas der <strong>Diplomarbeit</strong> sind im Wesentlichen durch meine mehrjährige<br />
Berufserfahrung in verschiedenen Zweigen der metallverarbeitenden Industrie motiviert.<br />
Meine derzeitige Tätigkeit bei dem Hamburger Handelsunternehmen für Verbindungstechnik<br />
F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, das als Praxispartner das Projekt begleitet, ließ<br />
mich direkt an den derzeitigen Entwicklungen des Stahlmarktes teilhaben. Eine Situation<br />
drastisch gestiegener Rohstoffpreise und spürbarer Angebotsverknappung eines Werkstoffs,<br />
der bisher als unbegrenzt verfügbar galt, weckte in mir wissenschaftliches Interesse.<br />
Aufgrund meiner Studienschwerpunkte Ökonometrie und Volkswirtschaftslehre und dem dort<br />
erworbenen Methodenwissen möchte ich mich der praktischen Problemsstellung von Seiten<br />
der Ressourcenökonomie nähern. Dies liegt nicht nur im Untersuchungsgegenstand begründet,<br />
sondern auch in meinen bisherigen Erfahrungen im Rahmen ressourcenökonomischer<br />
Modellierung.<br />
2. Untersuchungsgegenstand<br />
Im Zentrum der Untersuchungen steht der Stahlmarkt zu Beginn des neuen Jahrhunderts.<br />
Stahl ist eine Legierung des Eisens mit anderen Elementen, wobei der Masseanteil des Eisens<br />
größer als der jedes anderen Elements ist, und der Kohlenstoffgehalt im Allgemeinen weniger<br />
als zwei Masseprozent beträgt. Stahl ist im Vergleich zu anderen Werkstoffen kostengünstig<br />
in der Herstellung und hat hervorragende Eigenschaften in Beständigkeit und Verarbeitung.<br />
Hinsichtlich chemischer Zusammensetzung wird in drei Stahlklassen unterschieden:<br />
Unlegierte Stähle<br />
- Legierungsanteil bleibt unter einem bestimmten Grenzwert.<br />
Andere legierte Stähle<br />
- Legierungsanteil ist größer als der Grenzwert der unlegierten Stähle.<br />
Nichtrostende Stähle<br />
- Masseanteil Kohlenstoff ist unter 1,2% und mehr als 10,5% Chrom. 1<br />
Stahl wird aus Eisen gewonnen, das wiederum aus Eisenerz und i.d.R. mit Kohlenstoff reduziert<br />
wird. Der Produktionsprozess gliedert sich in folgende Phasen:<br />
1. Eisenerzgewinnung (Tagebau oder Untertagebau)<br />
2. Rohstoffvorbehandlung (Aufbereiten, Homogenisieren, Agglomerieren)<br />
3. Transport (per Schiene zum Hafen, Massengutfrachter)<br />
1 Vgl. DIN EN 10020<br />
Seite 2 von 10
4. Roheisenerzeugung (Hochofen, alternativ Direkt- oder Schmelzreduktion)<br />
5. Stahlerzeugung (durch Frischen des flüssigen Roheisens)<br />
6. Nachbehandlung (Sekundärmetallurgie)<br />
7. Urformen (i.d.R. Stranggießen, alternativ: Kokillenguss)<br />
8. Warmformgebung<br />
9. Kaltformgebung<br />
10. Nachbehandlung<br />
Im Wesentlichen wird die Wertschöpfungskette des Stahlherstellung durch zwei Industrien<br />
dominiert: die Eisenerzförderung sowie die Roheisen- und Stahlproduktion. Die Erzeugnisse<br />
der Stahlproduktion sind hauptsächlich warm- und kaltgewalzte Lang- und Flachstähle, Rohre<br />
sowie Ringe, Radreifen und Vollräder. Die Abb. 2.1 zeigt die Stahlerzeugnisse für die Europäische<br />
Union (2002). Wichtigste Klasse bilden mit 43,73% der Gesamterzeugung die Warmbreitstähle<br />
(Breite >600 mm), gefolgt von Walzdrähten (Durchmesser >5mm), Beton- und<br />
Stabstählen.<br />
Walzdraht<br />
17,05%<br />
Warmbreitband<br />
43,73%<br />
Betonstahl<br />
12,28%<br />
Stabstahl<br />
8,21%<br />
andere Träger<br />
4,06%<br />
Weitere<br />
18,73%<br />
Seite 3 von 10<br />
H-Träger<br />
3,40%<br />
Quartoblech<br />
5,23%<br />
Profile<br />
2,73%<br />
Oberbau<br />
1,57%<br />
Bandstahl<br />
0,70%<br />
Spund-wand<br />
0,70%<br />
Breitflachstahl<br />
0,25%<br />
Warmblech<br />
0,09%<br />
Abb. 2.1: Anteile verschiedener Stahlerzeugnisse an warmgewalzter Gesamtproduktion (EU, 2002) 2<br />
Die Stahlverwendung konzentriert sich in der metallverarbeitenden Industrie. Die Abb. 2.2<br />
gibt den Verbrauch von Stahl in den wichtigsten Branchen wieder. Neben der Metallwarenherstellung,<br />
gefolgt von Ziehereien und Kaltwalzwerken, sind der Fahrzeug- und Maschinenbau<br />
die wichtigsten Abnehmergruppen.<br />
2 Daten entnommen aus Eurostat (2002)
Stahlverwendung in Mio. t<br />
9,00<br />
8,00<br />
7,00<br />
6,00<br />
5,00<br />
4,00<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
Metallwaren<br />
8,10<br />
Ziehereien und Kaltwalzwerke<br />
6,00<br />
Fahrzeugbau<br />
5,60<br />
4,10<br />
Maschinenbau<br />
3,40<br />
Stahlbau<br />
Abb. 2.2: Stahlverwendung in Deutschland (2002) sortiert nach Branchen 3<br />
3,00<br />
Seite 4 von 10<br />
2,80<br />
Bau<br />
Schiffbau<br />
0,80<br />
Elektrotechnik<br />
Während die stahlverbrauchenden Branchen i.d.R. von einer großen Anzahl von Anbietern,<br />
einer Vielzahl von unterschiedlichen Verarbeitungstechnologien und Fertigprodukten sowie<br />
einer hauptsächlich kleinen oder mittelständischen Betriebsgröße geprägt sind, treten in der<br />
Erzförderung und Stahlproduktion teilweise beträchtliche Konzentrationstendenzen in Erscheinung.<br />
Bei den Stahlproduzenten gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen, die durch<br />
unterschiedliche Fertigungstechnologien begründet sind. Die klassische Route der Roheisenerzeugung<br />
im Hochofen und dem Sauerstoffkonverterverfahren zum Frischen des Roheisens<br />
zum Rohstahl wird durch die sogenannte Direktreduktion in Verbindung mit dem Elektrolichtbogenverfahren<br />
ergänzt. Neben der Verwendung von festem Eisenschwamm, dem Output<br />
der Direktreduktion, findet auch Stahlschrott als wichtiger Eisenträger Verwendung im Elektrolichtbogenofen,<br />
der <strong>zur</strong> Stahlerzeugung dient. Die Hochofenroute ist hochgradig kapitalintensiv,<br />
erfordert eine kontinuierliche Versorgung mit Eisenerz und Reduktionsmitteln in konstanter<br />
Qualität sowie eine bestimmte minimale Ausbringungsmenge, um wirtschaftlich betrieben<br />
werden zu können. Die alternative Route über den Elektrolichtbogen verfügt zwar<br />
über eine geringere Produktivität, benötigt jedoch ein deutlich geringeres Investitionsvolumen,<br />
kann mit unterschiedlichen Eisenträgern betrieben werden und erreicht durch kleinere<br />
Losgrößen eine höhere Flexibilität, die ein kontinuierlich arbeitender Hochofen nicht bieten<br />
3 Daten entnommen aus: http://www.stahl-online.de/wirtschafts_und_Politik/stahl_in_zahlen/2005/Stahlver-<br />
wendung_in_D_2010k.jpg (24.03.2005)<br />
0,30<br />
2,90
kann. Aus diesen Gründen ist der Anteil des Elektrostahlverfahrens an der gesamten Weltstahlproduktion<br />
auf rund 40% gestiegen. 4 Durch den hohen Kapitalbedarf in der Hochofenroute<br />
ist bei entsprechenden Stahlproduzenten eine zunehmende Konzentration durch Fusionen<br />
und Übernahmen zu beobachten, die bedeutendsten waren 2001 der Zusammenschluss<br />
der luxemburgischen Arbed S.A., der spanischen Aceralia Corporacion Siderurgica S.A. und<br />
der französischen Usinor S.A. zum derzeitig größten Stahlproduzenten der Welt, der Arcelor<br />
S.A., sowie 2004 der niederländischen Unternehmen LNM Group und ISPAT International<br />
N.V. mit der amerikanischen International Steel zu Mittal Steel.<br />
Auf der anderen Seite ermöglicht der Einsatz von Elektrostahlwerken (auch als Ministahlwerke<br />
bezeichnet), Ländern mit hinreichender Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur den Einstieg<br />
in die Stahlproduktion durch Unabhängigkeit von flüssigem Roheisen, geringerem Kapitalbedarf<br />
und kleinere bis mittlere Fertigungskapazitäten. Aufgrund dieser gegenläufigen<br />
Tendenzen werden weitere Übernahmen in der Stahlerzeugung erwartet, doch in Anbetracht<br />
der Tatsache, dass gegenwärtig die 30 größten Stahlhersteller nicht einmal die Hälfte des<br />
weltweiten Outputs produzieren, wird die Marktkonzentration wahrscheinlich moderat bleiben.<br />
Anders gestaltet sich die Situation bei den eisenerzfördernden Anbietern. So stellen die<br />
drei größte Minengesellschaften (die brasilianische CVRD, und die australische Rio Tinto und<br />
BHP) rund 70% des weltweiten Eisenerzangebots. Wesentliche Ursachen bilden hier das enorme<br />
Investitionsvolumen und Zeiträume von der Exploration bis Förderbeginn von bis zu<br />
zehn Jahren. Unter diesen Bedingungen stehen den Minengesellschaften unter großem wirtschaftlichen<br />
Druck, ihre Förderkapazitäten weitgehend auszunutzen, um die getätigten Investitionen<br />
wieder einzufahren. Durch den Bedarf der Stahlhersteller nach einer kontinuierlichen<br />
Rohstoffversorgung für den Betrieb ihrer Hochöfen besteht zwischen Erz- und Stahlproduzenten<br />
ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, was z.B. durch Langzeitlieferkontrakte geregelt<br />
wird.<br />
Gegenwärtig ist die Situation auf dem Stahlmarkt durch ein historisch hohes Preisniveau angespannt.<br />
Als Ursachen dieser Entwicklung werden u.a. folgende Aspekte benannt: 5<br />
Nachfrageanstieg durch den enormen Verbrauch im wachsenden Markt Chinas<br />
4<br />
vgl. Stahlfibel (2002), S.53<br />
5<br />
vgl. z.B. „China hält die Rohstoffmärkte auf Trab“, Handelsblatt vom 02.03.04, „Luxusgut Stahl“, Die Zeit<br />
vom 02.12.2004, „Gier nach Erz und Öl“, Die Zeit vom 19.05.2004, „Rohstoffmärkte erleben eine Renaissance“,<br />
Handelsblatt vom 03.12.2004, Bericht <strong>zur</strong> Lage auf dem Stahlmarkt, IV. Quartal 2004, Wirtschaftsverband für<br />
Stahl- und Metallverarbeitung e.V., 10.11.2004, „Stahlindustrie erwartet neues Rekordjahr“, Handelsblatt vom<br />
28.12.2004, „Rohstoffe bieten gute Perspektiven“, Handelsblatt vom 19.01.2005<br />
Seite 5 von 10
Vollständig ausgelastete Produktions- und Fertigungskapazitäten<br />
Verknappung von Eisenerz, Koks und Legierungselementen durch un<strong>zur</strong>eichende<br />
Förderkapazitäten<br />
Aber auch: oligopolistisch-strategisches Verhalten der Eisenerz- und Stahlproduzenten.<br />
3. Kurze Literaturübersicht<br />
Der Stahlmarkt aus Perspektive der Ressourcenökonomie wurde bisher noch nicht betrachtet.<br />
Stattdessen gibt es einige Studien über den Eisenerzmarkt aus Sicht der Spieltheorie. Die letzte<br />
Veröffentlichung durch Tamvakis (1999) untersucht die Handelsströme zwischen erzimportierenden<br />
und –exportierenden Ländern in oligopolistischen Marktstrukturen und testet ein<br />
entsprechendes ökonometrisches Modell. Zwei Jahre zuvor legte Hellmer (1997) im Rahmen<br />
seiner Dissertation zwei Papiere vor, von denen das erste Cournot-Verhalten testet und das<br />
zweite die Wettbewerbsposition des schwedischen Produzenten LKAB analysiert. Im Rahmen<br />
ressourcenökonomischer Betrachtung wurden häufiger Rohstoffe wie Erdöl, Kupfer und Aluminium<br />
untersucht. 6 Wesentliche Grundlagen für diese Arbeit sind neben verschiedenen<br />
Werken der Industrieökonomie die Arbeiten von Pindyck (1978) und Hartwick (1989). 7<br />
4. Warum Ressourcenökonomie?<br />
Obwohl Eisen mit 5,6% das vierthäufigste Element der Erdkruste ist, sind die Reserven nicht<br />
unbegrenzt verfügbar. Zum einen wird die Förderung durch begrenzte Kapazitäten begrenzt,<br />
zum anderen müssen die bekannten und erschlossenen Lagerstätten durch weitere Exploration<br />
ausgedehnt und nutzbar gemacht werden. Eisengehalt des Erzes, Lagerstättengröße, Anbindung<br />
an den internationalen Markt und standortgebundene Faktorkosten, wie bspw. Löhne,<br />
sind wettbewerbsrelevante Einflussgrößen.<br />
Eisenerz wird nahezu exklusiv für die Eisen- und Stahlgewinnung verwendet und ist zudem<br />
für die Weltwirtschaft ein essentieller Rohstoff. Eine Verknappung im Angebot durch begrenzte<br />
Förderkapazitäten und Exploration bilden einen interessanten Anhaltspunkt für eine<br />
ressourcenökonomische Analyse.<br />
6 vgl. z.B. Adelmann, M.A.: Mineral depletion, with spezial reference to petroleum, Review of Economics and<br />
Statistics 72, 1990, S.1-10; Svedberg, P., Tilton, J.E.: The real real price of nonrenewable resources: copper<br />
1870-2000, Seminar Paper 723, Institute of International Economic Studies, Stockholm University, 2003<br />
7 vgl. auch Literaturliste (aktueller Stand)<br />
Seite 6 von 10
5. Zielsetzung und Aufbau der <strong>Diplomarbeit</strong><br />
Im Rahmen der <strong>Diplomarbeit</strong> sollen folgende Zielsetzungen verfolgt werden:<br />
Ausführliche Beschreibung der Eisenerz- und stahlerzeugenden Industrie mit den<br />
notwendigen Rohstoffen und Fertigungsverfahren, der Kostenstruktur und technologischen<br />
Entwicklungen<br />
Erklärungsansätze für bestehende Marktstrukturen, insbesondere der Konzentration,<br />
auf Basis der Mikro- und Industrieökonomie<br />
Entwicklung eines ressourcenökonomischen Modells für die Erklärung der Marktdynamik,<br />
insbesondere der Preisentwicklung<br />
Zusammenfassung und Ableitung möglicher Entwicklungsszenarien<br />
Um der Komplexität des Themas als auch alternativer Erklärungsansätze gerecht zu werden,<br />
bemühe ich mich um eine breite industrie- und mikroökonomische Fundierung, da Charakteristika<br />
von Kosten- und Technologiestrukturen i.d.R. auf künftige Entwicklungspfade einen<br />
wesentlichen Einfluss haben und somit die ressourcenökonomisch-theoretischen Erkenntnisse<br />
einen umfassendere Erklärungskraft erreichen.<br />
Modellvariante<br />
Zusammenfassung<br />
Ergebnisse<br />
Optimierung<br />
Modellstruktur<br />
Prämissen<br />
Marktstruktur<br />
Kostenstruktur<br />
Rohstoffe Technologie<br />
Abb. 5.1: Gliederung und Aufbau<br />
Seite 7 von 10<br />
Ressourcenökonomie<br />
Industrieökonomie<br />
Ökonometrie
Die Abb. 2.1 stellt den Aufbau der <strong>Diplomarbeit</strong> schematisch dar. Zunächst sollen Rohstoffe<br />
und Produktionsprozesse betrachtet werden, auf dieser Basis sollen dann Schlussfolgerungen<br />
für die resultierenden Kostenstrukturen gezogen, die die Basis für die Marktstrukturen innerhalb<br />
der Wertschöpfungskette legen. Die einzelnen Abschnitte werden jeweils zusammengefasst<br />
und in wesentlichen Tatbeständen formuliert. Die Analysen werden industrieökonomisch<br />
fundiert, sämtliche Erkenntnisse und Schlussfolgerungen werden sowohl durch deskriptive<br />
Statistik als auch mittels Regressionsverfahren abgesichert. Auf Grundlage der praktischen<br />
Bestandsaufnahmen soll dann ein ressourcenökonomisches Modell aufgebaut werden, wobei<br />
die Tatbestände des vorangegangenen Abschnitts die Modellprämissen bestimmen, auf denen<br />
die Modellstruktur aufbaut. Aus der Modelloptimierung bzw. Modellvariationen sollen dann<br />
Schlussfolgerungen gezogen werden, die in einer Zusammenfassung aller Ergebnisse münden.<br />
Abschließend wird ein konkreter Bezug zum Praxisfall genommen und mögliche Entwicklungsszenarien<br />
entwickelt.<br />
Seite 8 von 10
6. Literaturverzeichnis<br />
AME Mineral economics, Rmeeting the challenges, Report on Iron & Steel, 1994<br />
Ameling, D.: Technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit (report on the cooperative<br />
technical and scientific work), in: Stahl und Eisen, Ausgabe 12, 2002, S.72-92<br />
Barsch, H., Bürger, K.: Naturressourcen der Erde und ihre Nutzung, Justus Perthes Verlag,<br />
Gotha, 1996<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel (BDS) (Hrsg.): Stahl-Lexikon, 20. Auflage, Vertriebsgesellschaft<br />
des BDS mbH, Bochum, 1978<br />
Clarke, R.: Industrial Economics, Basil Blackwell, Oxford und New York, 1985<br />
Daniëls, B.: Transition paths towards CO2 emission reduction in the steel industry,<br />
Universal Press, Veenendaal, 2002, S.58<br />
Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 2001 <strong>zur</strong> Erklärung der Vereinbarkeit mit<br />
dem Gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen (Sache COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi),<br />
Aktenzeichen K(2001) 3363, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen<br />
Union, L92/50 vom 30.03.2004<br />
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2001 <strong>zur</strong> Genehmigung des Zusammenschlusses<br />
von Arbed S.A., Aceralia Corporacion Siderurgica S.A. und Usinor S.A. zu<br />
Newco Steel (Sache EGKS.1351– Usinor/Arbed/Aceralia), Aktenzeichen K(2001) 3696,<br />
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, L88/1 vom 04.04.2003<br />
Eurostat (Hrsg.): 50 Jahre EGKS-Vertrag, Kohle und Stahlstatistiken, Ausgabe 2002, Europäische<br />
Gemeinschaften, 2002<br />
Fritsch, M., Wein, T., Eewers, H. J.: Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 5. überarbeitete<br />
und ergänzte Auflage, Vahlen-Verlag München, 2003<br />
Hartwick, J.M.: Non-renewable Resources Extraction Programs and Markets, harwood<br />
academic publishers, chur et al., 1989<br />
Hellmer, S.: Competitive Strength in Iron Ore Production, Doctoral thesis, Luleå<br />
University of Technology, 1997<br />
Hoel, M.: Resource extraction under some Alternative Market Structures, Verlag Anton<br />
Hain, Meisenheim am Glan, 1978<br />
International Iron and Steel Institute (IISI): Steel Statistical Yearbook 2004, Brüssel, 2004<br />
Lüngen, B., Schmöle, P.: Hochofenbetrieb ohne Koks und Kohlenstoff, in: Stahl und Eisen,<br />
Ausgabe 11, 2004<br />
Perman R. et al.: Natural Resource and Environmental Economics, Pearson Education<br />
Limited, Essex, 2003<br />
Seite 9 von 10
Schumann, J., Meyer, U., Ströbele, :W.: Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, 7.<br />
Auflage, Springer Verlag, Berlin, 1999<br />
Shy, O.: Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, 1999<br />
Tamvakis, M. N.: An Economic Model of the Iron Ore Trade, British Thesis Service,<br />
West Yorkshire, 1999<br />
Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) (Hrsg.): Stahlfibel, Verlag Stahleisen GmbH,<br />
Düsseldorf, 2002<br />
Wied-Nebbeling, S.: Markt- und Preistheorie, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin et al.,<br />
1997<br />
Wied-Nebbeling, S.: Das Preisverhalten in der Industrie. Ergebnisse einer erneuten Befragung,<br />
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen, Schriftenreihe: Band 43,<br />
Tübingen 1985<br />
Internetquellen:<br />
U.S. Department of Transportation, Maritime Administration,<br />
<br />
http://www.marad.dot.gov/MARAD_statistics, 22.03.2005<br />
U.S. Geological Survey (USGS), Onlineversion des Mineral Yearbook von 1932-2003,<br />
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/, 10.03.2005<br />
Wirtschaftsvereinigung Stahl, Stahlinstitut VDEh: www.stahl-online.de, 14.03.2005<br />
Seite 10 von 10