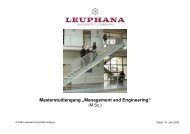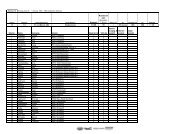Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg
Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg
Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
College<br />
<strong>Leuphana</strong> Bachelor<br />
<strong>Modulhandbuch</strong><br />
Minor Industrietechnik (<strong>ITEC</strong>)<br />
<strong>Lüneburg</strong>, Januar 2009
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
<strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> – College<br />
Studiengangsleiter<br />
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami (adami@uni.leuphana.de)<br />
Prof. Dr. Hans-Heinrich Schleich (schleich@uni.leuphana.de)<br />
Department Automatisierungs- und Produktionstechnik<br />
<strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong><br />
Scharnhorststrasse 1, D-21335 <strong>Lüneburg</strong><br />
Tel. : 04131 677 5315<br />
Fax : 04131 677 5300<br />
2
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Minor Industrietechnik: Technik für Nichttechniker<br />
Der Minor Industrietechnik bietet einen Überblick über die wichtigsten Techno-logien und technikorientierten Prozesse<br />
in der produzierenden Industrie. Mit diesem Angebot richtet er sich besonders an Studierende, die nicht technikerfahren<br />
sind und keinen technischen Major belegt haben.<br />
Ziel: Technik verstehen, beurteilen und bewerten<br />
Hauptziel des Minors Industrietechnik an der <strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> ist die Vermittlung des technischen<br />
Grundverständnisses für nichttechnische Berufe, die in unserer hoch technisierten Gesellschaft mit zunehmender<br />
Häufigkeit technische Aspekte in die Reflexion von Wirkzusammenhängen und die Ableitung von Handlungsoptionen<br />
einbeziehen müssen. Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, in den wichtigsten technischen Disziplinen im<br />
Kontext industrieller Systeme zu arbeiten.<br />
Profil: Relevante Technik in Industrieunternehmen<br />
In Ihrem Studium machen Sie sich mit den technologischen Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und<br />
Automatisierungstechnik vertraut und erwer-ben fundierte Kenntnisse im Bereich der Informations- und<br />
Kommunikations-technologie. Darüber hinaus arbeiten Sie sich in die industriellen Kernprozesse Supply Chain<br />
Management, Entwicklung/Technologiemanagement und indust-rielle Produktion ein.<br />
So bietet der Minor einen umfassenden Überblick über technologische Prozesse und einen Querschnitt durch die<br />
einschlägigen Ingenieurdisziplinen. Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den wichtigen ingenieur- und unternehmensrelevanten<br />
Themenfeldern. Sie erarbeiten sich die Grundlagen praxis-orientierter Kompetenz in einem<br />
technischen Umfeld.<br />
Die erforderlichen fachlichen Grundlagen werden in den Modulen des Minors gelehrt. Voraussetzung für das Studium<br />
des Minors Industrietechnik ist neben den durch das <strong>Leuphana</strong>-Semester gelegten Grundlagen in Mathematik vor<br />
allem ein offenes und vorbehaltfreies Grundinteresse an technischen Frages-tellungen<br />
Empfohlene Studienkombinationen: Der Major empfiehlt und genehmigt<br />
Der Minor Industrietechnik ist für die Kombination mit nichttechnischen Majors aus den Bereichen Wirtschaftsrecht,<br />
Wirtschaftspsychologie, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik/Wirtschaftsinformatik,<br />
angewandte Kulturwissenschaft, Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Umweltwissenschaften vorgesehen und ergänzt in<br />
dieser Kombination das fachspezifische Studium um technische Aspekte.<br />
Warum soll ich <strong>ITEC</strong> studieren?<br />
Deutschland ist ein Hochtechnologieland. Technik ist überall und prägt in unterschiedlicher<br />
Intensität nahezu alle Lebensbereiche.<br />
Ein Grundverständnis für Technik und der durch sie bestimmten Prozesse erleichtert die<br />
gesamthafte Reflexion und Ableitung von Handlungsoptionen auch bei geistes-, sozial- oder<br />
wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen.<br />
Deutschland ist eine Industrienation, die sich im offenen, globalen Wettbewerb behaupten muss.<br />
Neben Politik und Ökonomie sind Technik und Logistik entscheidende Gestaltungsparameter.<br />
Diskussionen über Klimaschutz und Nachhaltigkeit führt man kompetenter, wenn man auch<br />
technische Zusammenhänge beurteilen kann.<br />
Der Arbeitsmarkt für technische Berufe bietet erstklassige Chancen. Nutzen Sie das Major/Minor-<br />
Konzept des <strong>Leuphana</strong> Bachelors zum Aufbau einer attraktiven Position für Ihren Berufseinstieg.<br />
Technologie Campus Volgershall: Department Automatisierungs- und Produktionstechnik<br />
Der Minor Industrietechnik wird vom Department Automatisierungs- und Produktionstechnik angeboten. Das<br />
Department befindet sich auf dem Technologie-Campus Volgershall in <strong>Lüneburg</strong>. In dem großzügigen Neubau sind<br />
alle Seminarräume und Labore sowie die Büros der Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
3
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
untergebracht. Außerdem gibt es dort eine Bibliothek mit umfangreicher technischer Literatur sowie eine Mensa und<br />
eine Cafeteria.<br />
Im Kern des Gebäudes befindet sich die Maschinenhalle mit zahlreichen modernen Produktionsmaschinen und<br />
Automatisierungsanlagen. Weitere Labore mit hochwertiger technischer Ausstattung befinden sich im Umfeld der<br />
Maschinenhalle.<br />
Das Department umfasst derzeit 10 Professoren, die mit ihren Denominationen die Hauptbereiche der<br />
Automatisierungs- und Produktionstechnik abdecken.<br />
Übergänge: Masterstudium auf Wunsch auch mit Engineering Fokus<br />
Der erfolgreiche Abschluss eines Studiengangs mit dem Minor Industrietechnik schafft die Zugangsvoraussetzung für<br />
einen Masterstudiengang. Die <strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> bietet passende weiterführende Masterstudiengänge<br />
an, z.B. das interdisziplinäre Masterstudium „Management and Engineering“. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach<br />
einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit berufsbegleitend den weiterbildenden Studiengang „Manufacturing<br />
Management“ (Master of Business Administration, MBA) zu belegen.<br />
Weitere Informationen: Wir stehen Rede und Antwort<br />
Detaillierte Informationen zum Minor Industrietechnik erhalten Sie im Internet unter www.leuphana-ing.de. Dort<br />
finden Sie Informationsdokumente mit ausführlichen Darstellungen der Studieninhalte, Studienbedingungen,<br />
Berufschancen für Ingenieure und Wirtschaftsingenieure und vieles mehr.<br />
Fachspezifische Fragen zu Studieninhalten und Kombinationsmöglichkeiten und Studienfachberatung über die<br />
Minorverantwortlichen<br />
Prof. Dr. Wilfried Adami (adami@uni.leuphana.de)<br />
Prof. Dr. Hans-Heinrich Schleich (schleich@uni.leuphana.de)<br />
4
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulübersicht Minor Industrietechnik (<strong>ITEC</strong>)<br />
Semester<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Supply Chain<br />
Management<br />
Entwicklung und<br />
Technologiemanagement<br />
Industrieproduktion<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien<br />
Elektro- und<br />
Automatisierungstechnik<br />
Maschinenbau<br />
Industrielle Prozesse<br />
Technologiegruppen<br />
Minor <strong>ITEC</strong>: 6 Module, in denen die wichtigsten Technologiebereiche und industriellen Prozesse erörtert werden.<br />
5
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbeschreibungen<br />
Modulbezeichnung Maschinenbau<br />
Nummer<br />
Modulschlüssel Mi-Ind-1<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr.-Ing. Marco Linß<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Marco Linß<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Maschinenbau (MB) (Vorlesung, Übungen, Praktikum), 4 SWS<br />
Das Modul vermittelt Grundlagenkenntnisse zu folgende Gebieten des Maschinenbaus:<br />
Werkstoffkunde,<br />
Technische Mechanik,<br />
Konstruktion,<br />
Fertigungstechnik,<br />
Fertigungsmesstechnik,<br />
Werkzeugmaschinen,<br />
Qualitätsmanagement.<br />
Qualifikationsziele Ziele des Moduls ist die Erlangung von grundlegenden Kenntnisse des Maschinenbaus, seiner wesentlichen<br />
Teilgebiete und deren Verknüpfungen bzw. Abhängigkeiten<br />
Fachkompetenz - Kenntnisse über die Grundlagen im Maschinenbau<br />
- Erkennen der Zusammenhänge zwischen Konstruktion und Fertigung bzw. Kontrolle von Bauteilen<br />
Methodenkompetenz<br />
- Erarbeitung fachfremder Themengebiete<br />
- Darstellung von Untersuchungsergebnissen<br />
Sozial- und Selbstkompetenz - Arbeiten in Gruppen, Teamfähigkeit.<br />
- Erstellung von Versuchsberichten (Auswertung, Beurteilung, Dokumentation)<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
- Vorlesung (Sprache: Deutsch, englische Fachbegriffe),<br />
- Übungsaufgaben (Deutsch),<br />
- Praktikum (Sprache: Deutsch, englische Fachbegriffe),<br />
- Selbststudium.<br />
Klausur (90 Minuten), mündliche Prüfung<br />
Laborleistung / Übungsteilnahme<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
(Projektarbeit)<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />
keine<br />
Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />
für interne Zwecke erforderlich)<br />
Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />
Vorlesung keine keine<br />
Übung/Seminar keine keine<br />
Übung/Labor/Praktikum keine keine<br />
Sonstiges Literatur:<br />
- Grote / Feldhusen: DUBBEL-Taschenbuch für den Maschinenbau, Springer Verlag, 2007<br />
- Czichos / Hennecke: HÜTTE - Das Ingenieurwissen, Springer Verlag, 2008<br />
- Klein, M.: Einführung in die DIN - Normen, B. G. Teubner Verlag + Beuth Verlag<br />
6
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbezeichnung Elektro- und Automatisierungstechnik<br />
Nummer<br />
Modulschlüssel Mi-Ind_2<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr. Hans-Dieter Sträter<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr. K. Fiedler, Prof. Dr. A. P. Georgiadis, Prof. Dr. K.-D. Hübner, Prof. Dr. Hans-Dieter Sträter, Dipl.-Ing. B.-M.<br />
Block, Dipl.-Ing. A. Zedler , M.Sc.<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Qualifikationsziele<br />
Elektro- und Automatisierungstechnik<br />
In dem Modul wird ein Überblick über die Automatisierungstechnik aus elektrotechnischer Sicht vermittelt. Dazu<br />
gehören neben Grundlagen der Elektrotechnik die Messtechnik, die Steuerungs- und Regelungstechnik, die<br />
elektrische Antriebstechnik, Pneumatik/Hydraulik und die Robotertechnik. Bei einem Besuch eines fertigenden<br />
Unternehmens mit hohem Automatisierungsgrad (bevorzugt ein VW-Werk) wird der Einsatz dieser Disziplinen in der<br />
Praxis betrachtet.<br />
Fachkompetenz Die Studierenden sollen die Grundlagen der Elektrotechnik in begrenzter Tiefe kennen. Dabei erfolgt eine<br />
Beschränkung auf die für Automatisierungsprozesse bedeutendsten Teilgebiete. Das fachliche Ziel ist erreicht,<br />
wenn die Studierenden (evtl. nach Hinzuziehen weiterer Quellen) einen Artikel der VDI-Nachrichten lesen und<br />
verstehen können.<br />
Methodenkompetenz<br />
Die Studierenden sollen die Methoden kennen lernen, nach denen im Rahmen der Elektrotechnik Information<br />
(analog) transportiert und zu Kontrolle von Prozessen eingesetzt wird. Ferner soll erfahren werden, wie diese<br />
Methoden in der Praxis eingesetzt werden.<br />
Sozial- und Selbstkompetenz Arbeiten im Team, Erarbeitung fachfremder Kompetenz in Eigenverantwortung<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
Vorlesung, integrierte Übungen, Diskussionen und Aufgaben im Rahmen des Selbststudiums<br />
Abschlussgespräch/Mündliche Prüfung<br />
Keine<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
(Projektarbeit)<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />
Interesse an technischen Zusammenhängen, Interesse an interdisziplinären Kompetenzen<br />
Max. Gruppengröße Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />
Vorlesung 18<br />
Übungen 18<br />
Sonstiges Literatur:<br />
1. VDI-Nachrichten, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf , wöchentliche Erscheinung<br />
7
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbezeichnung Information- und Kommunikationstechnologien<br />
Nummer 4710 4000<br />
Modulschlüssel Mi-Ind_3<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr. Helmut Faasch<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr. Helmut Faasch<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Qualifikationsziele<br />
Vorlesung mit Übungen Information- und Kommunikationstechnologien, 4 SWS<br />
Grundlagen in den Bereichen Digitale Kodierung von Zeichen, Zahlen, Bildern und kontinuierlichen Signalen;<br />
Hardware und Software; Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme; Netzwerke und Internet; Datenstrukturen und<br />
Datenbank; Programmierung:<br />
Strukturierte Speicherung von Information<br />
Einführung<br />
Komponenten moderner Rechenanlagen<br />
Theorie und Grenzen der Berechenbarkeit – nicht alles ist möglich<br />
Speicherung von Daten und Informationen – computergerechte Kodierung<br />
Digital vs. Analog, Bit, Byte, Zeichen- und Zahlensysteme<br />
Dateiformate: Wie stellen Computer Zeichen, Bilder und Musik dar ?<br />
Woraus besteht eine "Web-Page" im World Wide Web ?<br />
Hardware und Software, wie spielen sie zusammen ?<br />
Was leistet ein Betriebssystem ?<br />
Programmiersprachen und Computerprogramme<br />
Übungen: "Erforschen" der Anatomie von digitalen Daten, Erstellen von kleinen Programmen in einer gängigen<br />
Programmiersprache, Erstellen einer kleinen Web-Page<br />
Verarbeitung von Daten und Information<br />
Grundlagen der Datenverarbeitung<br />
Was ist eine Datenbank ?<br />
Excel, Access und große relationale Datenbanken<br />
Analyse von Datenstrukturen<br />
Strukturierung Speicherung in einer relationalen Datenbank<br />
Anfragen an eine Datenbank<br />
Übungen: Anlegen einer Datenbank mit MySql, Eintragen von Daten und Beziehungen, Selektion von Daten<br />
Netze und Kommunikationssysteme<br />
Einführung in die Funktionsweise und die Anwendungen von Rechnernetzen<br />
"Denken in und Konstruieren in Schichten" – das OSI-Modell<br />
Begriffswelt: WAN, MAN, LAN, WLAN<br />
Komponenten und Verbindungen: Host, Server, Router, Hub, Switch<br />
Charakteristische Eigenschaften und Kennzahlen: Bandbreite, Durchsatz, Latenz<br />
Grenzen der Übertragung<br />
Grundlegende Protokolle: Ethernet, TCP/IP, Vermittlung von Nachrichten, DNS<br />
Anwendungen und ihre Protokolle: WWW (http), FTP, EMAIL<br />
Sicherheit und Unsicherheit: Verschlüsselung, Passwörter und Hashcodes, PGP,<br />
Firewall, Viren und Trojaner<br />
Übungen: Einrichten eines einfachen, lokalen FTP und http-Servers (Apache), Ablegen der früher erstellten Web-<br />
Page auf dem eigenen Server, Abrufen und darstellen der Daten<br />
Ziel des Moduls ist die Erlangung von Grundlagenkenntnissen der digitalen Informationsverarbeitung<br />
Fachkompetenz Beherrschung der grundlegenden Terminologien und Techniken in der Informationsverarbeitung.<br />
Grenzen der Berechenbarkeit, Zusammenspiel von Hardware und Software, Darstellung von Informationen in<br />
computergerechter Kodierung, Basistechnologien von Netzwerken und Funktionsweise des Internets, Aufgaben von<br />
8
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Methodenkompetenz<br />
Datenbanken<br />
Formalisierung von einfachen Algorithmen in einer Programmiersprache<br />
Einschätzung der von typischen Leistungskenngrößen in der Informatik<br />
Strukturierung von Daten als Voraussetzung für eine automatisierte Verarbeitung<br />
.<br />
Sozial- und Selbstkompetenz Arbeiten im Team,<br />
Prinzipien der verteilten Entwicklung von großen Systemen in der Informatik<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
Einführungsvorlesung<br />
Vorlesung mit praktische Übungen<br />
Kurzreferate zu ausgewählten Aufgabenstellungen<br />
Klausur (90 min.) oder Mündliche Prüfung<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
(Projektarbeit)<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />
keine<br />
Max. Gruppengröße (Angabe ist Höchstgrenze<br />
für interne Zwecke erforderlich) 20<br />
Vorlesung 20<br />
Übung 20<br />
Sonstiges<br />
Ggf. Begründung<br />
9
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbezeichnung Entwicklung und Technologiemanagement<br />
Development and Technology Management<br />
Nummer<br />
Modulschlüssel Mi-Ind_4<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />
Dipl.-Ing. Michael Schubert<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Qualifikationsziele<br />
Entwicklung und Technologiemanagement, 4 SWS<br />
Ziele: Erwerb grundlegender Kenntnisse über Prozesse und Technologien bei der Entwicklung von<br />
Industrieprodukten sowie beim Computer unterstützten Konstruieren<br />
Inhalte: Folgende Inhalte werden systematisch erarbeitet<br />
Grundlagen der Produktentwicklung<br />
• Bedeutung von Innovation<br />
• Einordnung der Produktentwicklung in die Wertschöpfungskette<br />
• Produktlebenszyklus (PLM)<br />
• Nachhaltige Produktentwicklung<br />
• Gesetzliche Regelungen, Produkthaftung<br />
Grundlagen der Konstruktion<br />
• Anfertigen technischer Zeichnungen<br />
• Durchführen einfacher Festigkeitsberechnungen<br />
Konstruktionsmanagement 1: Prozesse<br />
• Gliederung des Konstruktionsprozesses<br />
• Vorgehensweise in den Konstruktionsphasen<br />
• Input und Output der Phasen<br />
• Branchenspezifische Unterschiede<br />
• Fertigungsgerechtes Konstruieren, Design to Cost<br />
Konstruktionsmanagement 2: Methoden<br />
• Ideenfindung (intuitiv, systematisch, Brainstorming, Morphologischer Kasten)<br />
• Netzplantechnik<br />
• Wertanalyse<br />
• Simultaneous Engineering<br />
Digitale Methoden (Einführung)<br />
• Einführung in Grundlagen CAD (Begriffe, Modelle etc.)<br />
• FEM, Simulation bei der Produktentwicklung<br />
• Product Data Management (PDM)<br />
Entwicklung und Management variantenreicher Produkte<br />
• Teilefamilienbildung, Modularisierung, Baukasten,Typisierung<br />
• Mass Customization<br />
• Variantenmanagement<br />
Innovationsmanagement und Technologiefolgenabschätzung<br />
• Überblick<br />
• Projektmanagement in der Produktentwicklung<br />
• Standortgerechte Konstruktion (Hoch-/Niedriglohnländer)<br />
CAD Kurs<br />
• Erlernen des praktischen Umgangs mit dem CAD-System Inventor<br />
Fachkompetenz Kenntnisse über grundlegende Prozesse und Technologien bei der Entwicklung von Industrieprodukten,<br />
grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem CAD-System<br />
Methodenkompetenz<br />
Konzeption von Entwicklungsprozessen unter Einbindung virtueller Methoden.<br />
10
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Sozial- und Selbstkompetenz Bereitschaft, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und vertieftes Interesse für das Studium zu<br />
entwickeln, Fähigkeit autonom zu arbeiten, Leistungsbereitschaft<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
Vorlesungen mit begleitenden Übungen, Praktikum (CAD-Einführungskurs), Exkursion<br />
Klausur und CAD-Entwurf oder Portfolioprüfung<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
(Projektarbeit)<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />
Keine<br />
Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />
für interne Zwecke erforderlich)<br />
Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />
Vorlesung<br />
Übung<br />
keine<br />
Praktikum 17 Zahl der Arbeitsplätze im CAD-Labor<br />
Sonstiges Literatur:<br />
2. Hoischen - Hesser, Technisches Zeichnen – Verlag Cornelsen 30. Auflage<br />
3. Roloff / Matek, Maschinenelemente – Verlag Vieweg, 17. Auflage<br />
4. Roloff / Matek, Maschinenelemente Tabellen – Verlag Vieweg, 17. Auflage<br />
5. Richard Lang, Inventor 2009 Das Anwenderbuch – CAD Fachbuchversand<br />
6. Wördenweber, B.; Wickord, W.: Technologie- und Innovationsmanagement im Unternehmen, VDI-Buch,<br />
Springer-Verlag 2008<br />
7. Grieves, M.: Product Lifecycle Management, Mcgraw-Hill, 2005<br />
11
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbezeichnung Industrieproduktion<br />
Industrial Production<br />
Nummer Die Nummerierung des Moduls wird zentral eingegeben und ist mit der Prüfungsverwaltung abgestimmt.<br />
Modulschlüssel Ma-Ind_6<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Qualifikationsziele<br />
Industrieproduktion, 4 SWS<br />
Ziele: Erwerb grundlegender Kenntnisse über Prozesse, Technologien und Gestaltungsparameter in der<br />
industriellen Produktion von Stückgütern<br />
Inhalte: Folgende Inhalte werden systematisch erarbeitet<br />
• Einführung in die Grundlagen der industriellen Produktion<br />
• Funktionale Strukturen in produzierenden Unternehmen<br />
• Fertigungsprozesse<br />
• Fertigungskonzepte<br />
• Wertschöpfungsstrukturen<br />
• Fertigungskomplexität<br />
• Standortwahl<br />
• Globale Produktionsnetzwerke<br />
• Digitale Fabrik<br />
Fachkompetenz Kenntnisse über grundlegende Prozesse und Technologien der industriellen Produktion, grundlegende Kenntnisse<br />
über Planung und Optimierung industrieller Produktionssysteme<br />
Methodenkompetenz<br />
Konzeption von Produktionssystemen unter Einbindung virtueller Methoden.<br />
Sozial- und Selbstkompetenz Bereitschaft, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und vertieftes Interesse für das Studium zu<br />
entwickeln, Fähigkeit autonom zu arbeiten, Leistungsbereitschaft<br />
Kennen des Zusammenwirkens unterschiedlicher hierarchischer und sozialer Ebenen in einem produzierenden<br />
Unternehmen und grundsätzlicher Regeln beim Umgang mit Systembeteiligten, geplante und strukturierte<br />
Vorgehensweisen, Beherrschung technischer, sozialer und wirtschaftlicher Zielkonflikte<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Vorlesungen mit begleitenden Übungen und Case Studies<br />
Klausur oder Hausarbeit oder Mündliche Prüfung<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
(Projektarbeit)<br />
12
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />
Keine<br />
Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />
für interne Zwecke erforderlich)<br />
Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />
Vorlesung keine<br />
Übung keine<br />
Praktikum keine<br />
Sonstiges Literatur:<br />
1. Eversheim, W; Organisation in der Produktionstechnik, Band 1-4, Springer Verlag, 2004<br />
2. Westkämper, E; Bullinger, H.-J; Horvath, P; Zahn, E; Montageplanung – effizient und marktgerecht, VDI-<br />
Verlag, 2005<br />
3. Schellberg, O; Effiziente Gestaltung von globalen Produktionsnetzwerken, Shaker-Verlag, 2005<br />
4. Zheng, L., Possel-Dölken, F.: Strategic Production Networks, Springer-Verlag, 2002<br />
5. Abele, E., Kluge,J., Näher, U.: Handbuch Globale Produktion, Hanser-Verlag, 2006<br />
6. Schellberg, O.: Effiziente Gestaltung von globalen Produktionsnetzwerken, Shaker-Verlag, 2002<br />
7. Laudicina, P. A.: Trendbuch Internationalisierung, Campus-Verlag, 2005<br />
8. Schuh, G.: Produktionsplanung und -steuerung, Springer-Verlag, 2006<br />
13
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Modulbezeichnung Supply Chain Management<br />
Nummer<br />
Modulschlüssel Mi-Ind-5<br />
Modulverantwortliche/r<br />
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami<br />
Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami<br />
Zum Modul gehörende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Inhalte/<br />
Standards<br />
Supply Chain Management, 4 SWS<br />
Inhalte:<br />
Vermittlung der theoretischen und anwendungsorientierten Grundlagen zu Management und Steuerung der<br />
Versorgungskette mit strategischer .Ausrichtung auf den Kundennutzen<br />
Vorlesung mit integrierter Übung:<br />
• Materialwirtschaft<br />
• Materialflusssteuerung im Unternehmen<br />
• Einkauf<br />
• Lagerung<br />
• Transport<br />
• Vertrieb, Kundendienst<br />
• Integration des Internets in die betrieblichen Prozesse<br />
Qualifikationsziele Die Studierenden sollen Aufgaben aus den genannten Themengebieten selbstständig verstehen und lösen können.<br />
Die erlernten Fähigkeiten sollen in anwendungsorientierten Gebieten selbstständig angewendet werden können.<br />
Fachkompetenz • Beherrschung grundlegender Verfahren und Methoden zum Management der Versorgungskette<br />
• Kenntnis über deren Einsatz im operationalen und strategischen Rahmen.<br />
Methodenkompetenz<br />
• Kenntnis von Methoden zur Materialbedarfsplanung/-steuerung sowie zur Organisation betrieblicher<br />
Abläufe<br />
Sozial- und Selbstkompetenz • Systematisch/ methodische Vorgehensweisen<br />
• Integration von Fach-, Methoden-, Sozialkompetenz zur Handlungskompetenz<br />
Lehrarrangements und<br />
Studierendenaktivitäten<br />
(Lehr- und Lernformen)<br />
Voraussetzungen für die<br />
Vergabe von Credit Points<br />
a) Prüfungsleistungen<br />
b) Studienleistungen<br />
Lehr-/Lernmengen<br />
(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />
darunter Präsenzzeit und<br />
Selbststudium)<br />
Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen<br />
Selbststudium: Gruppenarbeit, Selbstlernen,<br />
Klausur (90 min) oder Projektarbeit oder Mündliche Prüfung<br />
keine<br />
5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />
14
Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />
Dauer und Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Voraussetzung(en) für die<br />
Teilnahme<br />
Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />
Keine<br />
Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />
für interne Zwecke erforderlich)<br />
Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />
Vorlesung keine<br />
Übung keine<br />
Tutorium keine<br />
Sonstiges Literatur:<br />
1. Arndt, H: Supply Chain Management. Gabler 2005<br />
2. Becker, T.: Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren, Springer 2005<br />
3. Berning, R.: Prozessmanagement und Logistik. Cornelsen 2002<br />
4. Chopra, S. & P. Meindl: Supply Chain Management. Pearson Prentice Hall 2004<br />
5. Cohen, S. & J. Roussel: Strategic Supply Chain Management. McGraw-Hill 2004<br />
6. Goldratt, E. M.: Das Ziel. Campus 2001<br />
7. Imai, M.: Kaizen. Der Schlüssel zum Erfolg. Econ 2005<br />
8. Senge, P. M.: Die fünfte Disziplin. Klett-Cotta 1996<br />
9. Womack, Jones, Roos: Die zweite Revolution in der Autoindustrie. Campus1991<br />
15