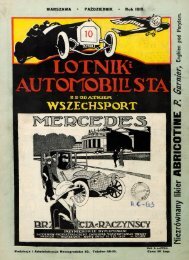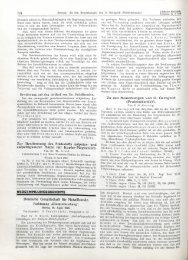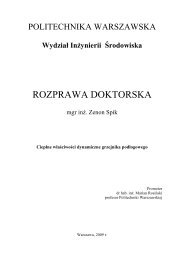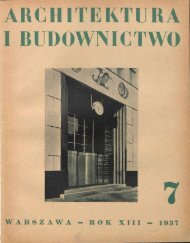Technologische Schlüsse aus der Kristallographie der Metalle.1)
Technologische Schlüsse aus der Kristallographie der Metalle.1)
Technologische Schlüsse aus der Kristallographie der Metalle.1)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Band 57. Nr. 24.<br />
14 Juni 191Ł<br />
duen abzugrenzen, teils indem sie nur die Korngrenzen bloßlegen,<br />
teils indem sie die Schliffflächc gemäß ihrer Neigung<br />
zu den Kristallachsen jeden Kornes verschieden faszitieren.<br />
Unser« Aeußerungen (in Abschnitt C und D) über die Natur<br />
<strong>der</strong> Kornhäute haben wir hier nur noch hinzuzufügen, daß<br />
gerade deien voreilende Aetzbarkeit in <strong>der</strong> Literatur schon<br />
als Konnzeichen voreilen<strong>der</strong> Verfestigung gegenüber dem<br />
Korninnern gedeutet wurde. Auf Textblatt !) war ferner<br />
wie in vielen älteren Abbildungen metallographischer Veröffentlichungen<br />
zu erkennen, daß die Facettenätzung den Boreich<br />
jedes Kristalliten durch Lichtreflex klar anzeigt, sofern<br />
sich das Gefüge im ungestörten natürlichen kristallischen<br />
Gleichgewicht befindet, Abb. 21 und 23, daß dagegen das<br />
Phänomen auf Schliffen kaltgestreckter Metalle verwaschen<br />
wird, Abb. 24, und schließlich im Endzustande höchster Verfestigung,<br />
Abb. 22, völlig verschwindet. Wir haben in unserem<br />
Arbeitsgebiet keinen Anlaß gehabt, dieses Verfahren<br />
weiter <strong>aus</strong>zubauen, glauben jedoch, daß die neueren Hinweise<br />
(Rosenhain und Gürtler) auf die eigentümlichen<br />
Abarten <strong>der</strong> Lichtreflexe von elektischem und dystektisohem<br />
Gefüge gute Dienste tun könnten, wenn sie insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
<strong>der</strong> Stahlprüfung (vergl. Benedicks), vielleicht auch bei<br />
Son<strong>der</strong>iragcn wie nach <strong>der</strong> Natur des ff-Messings berücksichtigt<br />
würden.<br />
Gelegentlich sind von mehreren Forschern (Heyn u. a.)<br />
beim Aetzen Erscheinungen beobachtet worden, die den<br />
in <strong>der</strong> Mineralogie planmäßig durchforschten Aetzfiguren<br />
ähneln (vergl. hierzu u. a. Baumhauer und Liebisch).<br />
Zum Studium <strong>der</strong> Kristallsysteme von Metallen erschien es<br />
wünschenswert, ein in dieser Hinsicht zuverlässiges Aetzverfahren<br />
<strong>aus</strong>zuarbeiten. Abb. 27 bis 37 zeigen, daß in <strong>der</strong><br />
zehnprozentigen Ammoniumpersulfatlösung ein vorzügliches<br />
Hülfsmittel zur Erzeugung deutlicher Aetzfiguren auf Eisen1 ),<br />
') Die Ammoniumpersulfatlösung dürfte auch außerhalb des Themas<br />
dieser Arbelt für die Mikrographie des Eisens von einigein Wert sein.<br />
Trefler und Nettel: Zeichnerische Diagiammeruiittlung für För<strong>der</strong>maBohlnen. 93. r )<br />
Kupfer, Messing und Bronze gefunden wurde; alle diese<br />
Stoffe erwiesen sich als regulär. Beson<strong>der</strong>e Beachtung verdient<br />
Abb. 31 mit dem systematischen Aetzabbau eines Kupferkristalliten.<br />
Das hexagonale Zink war in konzentrierter<br />
Chromsäurelösung am ehesten zugänglich, Abb. 38 bis 41.<br />
Unsere Erfahrungen sind zu jungen Datums, um etwa heute<br />
schon Rückschlüsse <strong>aus</strong> dem Kristallsystem auf gewisse physikalische<br />
Eigenschaften zu erlauben; wir erinnern aber daran,<br />
daß für Mineralien u. a. von Pöschl Beziehungen zwischen<br />
Kristallsystem, Härte und Zähigkeit bereits behauptet wurden,<br />
und in diesem Zusammenhang gibt die Zugehörigkeit des<br />
spröden Zinkes zum hexagonalen System einiges zu denken.<br />
Für die Technologie erscheint die Kristallfigurenätznng<br />
insofern als ein bequemes Prüfverfahren, als sie unmittelbar<br />
das Kristallsystem und mittelbar unter Umständen auch<br />
die absolute Lage <strong>der</strong> Kristallachsen im Raum aufdeckt.<br />
Wir haben an definierten Kristallen (vergl. Abschnitt A) <strong>aus</strong><br />
Kupfer festgestellt, daß die Ammoniumpersulfatlösung auf<br />
je<strong>der</strong> beliebigen Schnittfläche eines Kupferoktae<strong>der</strong>s konkave<br />
o<strong>der</strong> konvexe Körper bloßlegt, <strong>der</strong>en Begrenzungsebenen den<br />
Hauptsymmetrieebenen des regulären Systems (d. h. auch den<br />
Würfelflächen) parallel laufen. In jedem Einzelfall, für den<br />
die Angriffsweise des Aetzmittels ebenso genau ermittelt ist,<br />
kann man nunmehr mit Hülfe <strong>der</strong> Aetzfiguren den Zusammenhang<br />
zwischen Orientierung <strong>der</strong> Kristalliten und technologischem<br />
Verhalten erforschen.<br />
Noch deutlicher als die Facettenätzung zeigt die Kristallfigurenätzung<br />
den Grad <strong>der</strong> Kaltgereektheit an: die Figurenätzbarkeit<br />
verschwindet entsprechend den in den nächsten<br />
Abschnitten erörterten Verän<strong>der</strong>ungen des Korninnern,<br />
indem sich unter wachsen<strong>der</strong> Kaltreckung die Orientiertheit<br />
mehr o<strong>der</strong> min<strong>der</strong> schnell in ununterbrochen ineinan<strong>der</strong> übergreifenden<br />
Zonen verwirrt. (Schluß folgt.)<br />
Zum Aetzen von Stahl wird die Lösung zweckmäßig mit dem gleichen<br />
Volumen Alkohol verdünnt.<br />
Zeichnerische Diagrammermittlung für För<strong>der</strong>maschinen<br />
mit Antrieb durch Reihenschlußmotoren.<br />
(För<strong>der</strong>maschinen mit Treibscheibe, zylindrischen und kegeligen Trommeln und Bobinen.)»)<br />
Nachdem <strong>der</strong> Drehstrom als die für die elektrische Kraftübertragung<br />
am besten geeignete Stromart allgemein in elektrischen<br />
Betrieben Eingang gefunden hat, gehen neuerdings<br />
die Bestrebungen dahin, in allen Fällen, wo die Umlaufzahl<br />
<strong>der</strong> Antriebmaschinen geregelt werden muß, den Betrieb<br />
durch Verwendung verlustlos regelbarer Kollektormotoren<br />
wirtschaftlicher zu gestalten. Der normale Asynchronmotor<br />
genügt diesen Anfor<strong>der</strong>ungen nicht, da seine Umlaufzahl nur<br />
durch Einschalten von Wi<strong>der</strong>ständen in den Läuferstromkreis<br />
geän<strong>der</strong>t werden kann, wobei ein großer Teil <strong>der</strong> zugeführten<br />
elektrischen Energie in diesen Wi<strong>der</strong>ständen nutzlos verbraucht<br />
wird.<br />
Dieser Umstand hat dazu geführt, daß die Anwendung<br />
von Drehstrommotoren insbeson<strong>der</strong>e für größere Leistungen<br />
im För<strong>der</strong>betriebe zunächst als ungünstig erscheint, um so<br />
mehr, als in <strong>der</strong> Leonard-Schaltung ein Mittel gefunden war,<br />
das fast unabhängig von <strong>der</strong> Belastung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>maschine<br />
eine genaue, nahezu verlustlose Regelung <strong>der</strong> Umlaufzahl<br />
ermöglichte. Auf Grund <strong>der</strong> Leonard-Schaltung entwickelten<br />
sieh dann die Ilgner-Antriebe, die heute, insbeson<strong>der</strong>e für<br />
ganz große För<strong>der</strong>anlagen, eine beherrschende<br />
nehmen.<br />
Stellung ein<br />
Als Nachteile <strong>der</strong> Leonard-Schaltung wurden für kleinere<br />
Anlagen stets <strong>der</strong> notwendige Umformer und die mit <strong>der</strong><br />
') Son<strong>der</strong>abdrücke dieses Aufsatzes (Fachgebiete: Bergbau und Mechanik)<br />
werden abgegeben. Der Preis wird mit <strong>der</strong> Veröffentlichung<br />
des Schlusses bekannt gemacht werden.<br />
Von Dipl.-Ing. Gregor Trefler und Fritz Nettel.<br />
Energieumformung verbundenen Verluste empfunden. Dieser<br />
Umstand veranlaßte denn auch den Antrieb <strong>der</strong> För<strong>der</strong>maschine<br />
durch verlustlos<br />
strommotoren.<br />
regelbare Wechselstrom- o<strong>der</strong> Dreh<br />
Die heute <strong>aus</strong>gebildeten Bauarten von verlustlos regelbaren<br />
Kollektormotoren zum Anschluß an Drehstromnetze<br />
sind folgende:<br />
a) Winter-Eichberg-Motor (Nebenschluß-Charakteristik),<br />
b) Drehstrom-Reihenschlußmotor<br />
teristik),<br />
(Reihenschluß Charak<br />
c) Doppel-Repulsionsmotor (zwei Einphascn-Kollektormotoren<br />
in Scott-Schaltung, Reihenschluß-Charakteristik).<br />
Der Winter-Eichberg-Motor wird entwe<strong>der</strong> durch einen<br />
Drehtransformator o<strong>der</strong> durch einen Windungsschalter, <strong>der</strong><br />
die Stän<strong>der</strong>wicklungen selbst in Sparschaltung als Regeltransformator<br />
schaltet, geregelt. Infolge dieser verwickelten<br />
Hülfseinrichtungen und <strong>der</strong> Unmöglichkeit, mit ihnen die<br />
Umlauf zahl bis auf null herunter zu regeln, erscheint <strong>der</strong><br />
Nebenschlußmotor für den För<strong>der</strong>betrieb wenig geeignet. Bis<br />
heute ist er auch auf diesem<br />
worden.<br />
Gebiete noch nicht angewandt<br />
Bei den Drehstrom-Reihenschluß- und Doppel-Repulsionsmotoren<br />
wird die Umlaufzahl in einfacher Weise durch<br />
Bürstenverschiebung, und zwar in beliebiger Feinheit geregelt.<br />
Infolgedessen sind diese Motoren für den För<strong>der</strong>betrieb beson<strong>der</strong>s<br />
geeignet, was auch eine größere Anzahl von Ausführungen<br />
bewiesen hat.