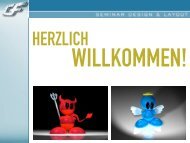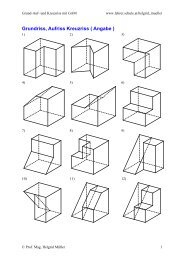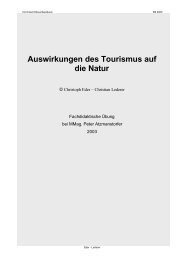SA-Ökosystem Alm - Lehrer
SA-Ökosystem Alm - Lehrer
SA-Ökosystem Alm - Lehrer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VU Projektunterricht SS 2003 / SS 2005<br />
<strong>Ökosystem</strong> <strong>Alm</strong><br />
© Christoph Eder, Sabine Brandstätter<br />
Fachdidaktische Übung<br />
bei MMag. Peter Atzmanstorfer<br />
2003 / 2004
VU Projektunterricht SS 2003 / SS 2005<br />
Projektunterricht Sameralm – Bedeutung der <strong>Alm</strong>wirtschaft<br />
<strong>Ökosystem</strong> <strong>Alm</strong><br />
Inhalt:<br />
1. Geplanter Ablauf<br />
• Praxis- und problemorientiert mit den Schülerinnen arbeiten<br />
• genauer Ablauf erst nach Besichtigung der Sameralm planbar<br />
• Schäden zeigen, evtl. Bodenprofil, usw.<br />
2. Thematischer Input<br />
• Ökologische Einflüsse in der Geschichte der <strong>Alm</strong>wirtschaft<br />
• Aktueller Stand<br />
• Zukunftsperspektiven – Wie wird sich der „Standort“ <strong>Alm</strong> in Zukunft<br />
• entwickeln?<br />
1. Geplanter Ablauf vor Ort:<br />
Die Schülerinnen sollen die Möglichkeit haben, selbst die verschiedenen<br />
Parameter des <strong>Ökosystem</strong>s <strong>Alm</strong> zu erkennen. Sie sollen die Möglichkeit<br />
bekommen, die verschiedenen Landschaftsstrukturen und Nutzungsformen zu<br />
beobachten und zu analysieren. (Was ist wo und warum?)<br />
Diese Einheit genau festzulegen ist noch schwierig, da wir nicht wissen wie die<br />
aktuelle Situation auf der <strong>Alm</strong> ist und wie viel Zeit wir mit den Schülerinnen<br />
haben.<br />
2. Thematischer Input:<br />
Ökologische Einflüsse in der Geschichte der <strong>Alm</strong>wirtschaft:<br />
Seit Anfang des letzten Jahrhunderts erfolgte eine intensive Nutzung der <strong>Alm</strong>en.<br />
Diese Nutzung nahm jedoch gegen Ende der 60er und in den 70er Jahren ab.<br />
Durch die relativ geringe Ertragsfähigkeit, verbunden mit hohem Arbeitsaufwand,<br />
schien der <strong>Alm</strong>wirtschaft das Ende bevorzustehen – sie passte nicht zum<br />
damaligen Fortschrittsdenken.<br />
Es war jedoch auch schon damals bekannt, dass die <strong>Alm</strong> auch eine enorme<br />
außerlandwirtschaftliche Bedeutung hat. Aus diesem Grund beschloss man die<br />
Unterstützung der erschwerten Arbeits- und Bewirtschaftungsbedingungen durch<br />
die öffentliche Hand, um diesen Rückgang zu stoppen. In manchen Fällen gab<br />
es wieder eine Aufwärtsentwicklung. Der Stellen wert der <strong>Alm</strong>wirtschaft hat in der<br />
Bevölkerung wieder zugenommen. Die <strong>Alm</strong>bewirtschaftung ist jedoch durch den<br />
allgemeinen Rückgang der Viehhaltung gefährdet und kann dadurch in manchen<br />
Bereichen nicht mehr flächendeckend erhalten werden.<br />
Um das <strong>Ökosystem</strong> <strong>Alm</strong> aufrecht zu erhalten, benötigt es ein reiches<br />
Futterangebot, Tierbesatz und eine Weideführung. Würde man die Beweidung<br />
einstellen, hätte das fatale Folgen auf das <strong>Ökosystem</strong>. Es würde zu einer<br />
allmählichen Sukzession in Richtung der natürlichen Vegetation kommen. Es<br />
würden z.B. Gras- und Seggenbestände entstehen, welche im Winter für den<br />
Schnee als Rutschbahn fungieren würden. Auch die Biodiversität, die<br />
Strukturvielfalt dieser Landschaften würde dadruch verloren gehen. Aus diesem<br />
Grund sollte man versuchen die <strong>Alm</strong>en auch weiterhin zu erhalten und dem<br />
ganzen eine „landschaftslpflegende“ Rolle zukommen lassen, damit die<br />
Artenvielfalt und die Ästhetik dieser Landschaft erhalten bleibt.<br />
Aktueller Stand
VU Projektunterricht SS 2003 / SS 2005<br />
Zur Bodenmorphologie:<br />
Kleinstrukturen der Bodenmorphologie haben aufgrund der Abholzung einen<br />
Einfluss auf die Vegetation. Im offenen Weideland kommt es durch Mulden- oder<br />
Hanglagen zu „klimatischen“ Unterschieden für die Flora. Dabei spielen<br />
Temperaturunterschiede, Lichteinfall und auch die Windverhältnisse eine große<br />
Rolle und durch diese Faktoren steigt die Biodiversität. Weiters spielen auch die<br />
unterschiedlichen Nährstoffverhältnisse und die verschiedenen<br />
Nutzungseinflüsse eine Rolle. Es ergibt sich daraus ein Wechsel in der<br />
Landschaft – Weiden, Sträucher, Baumgruppen. So entstehen verschiedene<br />
Biotope (= Lebensräume) und es kommt zu einer Erhöhung der ARtenvielfalt.<br />
Verschiedene Einflussfaktoren auf das <strong>Ökosystem</strong> <strong>Alm</strong>:<br />
Viehtritt:<br />
• Die Beweidung der <strong>Alm</strong>en beeinträchtigt die Böden und den Wasserabfluss der mit Vieh<br />
beweideten Flächen. Durch kontinuierlichen Betritt wird der Boden verdichtet und die<br />
Aufnahmekapazität des Bodens für Niederschläge (Regen, Schnee, Schmelzwasser)<br />
verringert.<br />
• Das Porenvolumen des Bodens wird durch den Auflagedruck der Hufe an diesen Stellen<br />
vermindert und durch die Verdichtung werden die Porenzerstört oder verstopft. Als Folge<br />
davon sinkt die Wasseraufnahmefähigkeit und die Belüftung des Bodens, was zu einer<br />
schnelleren Austrocknung und geringeren Sauerstoffversorgung der Wurzeln führt. Im<br />
weiteren Verlauf geht das Wurzel- und Pflanzenwachstum zurück. Bei anhaltender<br />
Überweidung können Pflanzenarten absterben, die, was ihre Bodenbedeckung betrifft, durch<br />
minderwertigere Arten ersetzt werden.<br />
• Durch den Tritt der Weidetiere kann es auch passieren, dass Pflanzen aus dem Boden<br />
gedrückt oder umgetreten werden. Es kann dadurch zum Absterben der Pflanze kommen.<br />
• Wird die schützende Pflanzendecke des Bodens degradiert, setzen Erosionsvorgänge ein,<br />
dadurch werden auch noch wichtige Pflanzennährstoffe ausgewaschen.<br />
• Um diese Erosionsvorgänge zu vermeiden, muss also die Pflanzendecke intakt erhalten<br />
werden. Sie beeinflusst durch ihre mechanischen Schutzfunktion auch Evapotranspiration und<br />
als Wasserkonsument das Abflussgeschehen.<br />
• Sichtbar wird das ganze in Form von Viehgangeln, Buckelwiesen und Terrassierungen in den<br />
Hängen. Dies kann man meist sehr früh sehr gut erkennen.<br />
• Buckelwiesenbildung: Es kommt zur Entstehung kleiner Erdbuckel, wenn die schweren Tiere<br />
über den feuchten oder wassergesättigten Boden wandern.<br />
• Terrassierungen (Viehgangeln): Sie entstehen durch das ständig quer zum Hang hin- und<br />
herwandernden Vieh. Es ist aufgrund der Verdichtung auf den Trittpfaden fast keine<br />
Vegeation mehr vorhanden. Bei fortgesetzter Benutzung der Trittpfade werden diese bei der<br />
Schneeschmelze im Frühjahr zu Sammelrinnen für das Wasser. In Folge dessen setzt eine<br />
beschleunigte Bodenerosion ein<br />
Beweidung und Verbiss:<br />
In vielen Teilen der Alpen fallen die überdurchschnittlich hohen Jahresniederschläge oft in Form<br />
sommerlicher Platz- und Dauerregen. Die Vegetation wirkt dabei wie eine Schutzschicht für den<br />
Boden. Die oberirdischen Pflanzenteile absorbieren einen Teil der Energie der Regentropfen, des<br />
fließenden Wassers und des Windes, so dass weniger davon auf den Boden trifft. Das Wurzelsystem<br />
trägt zur mechanischen Bodenfestigkeit bei.<br />
Zu früher und zu starker Verbiss führt folglich zum Eingehen und Vertrocknen der<br />
Pflanzen und gefährdet die standortgemäße Wiederbegrünung. Die Ursachen hierfür liegen in zu<br />
frühem <strong>Alm</strong>auftrieb und zu hohen Weideviehzahlen.<br />
Besatz:<br />
Seit Erlass eines Großteils der Weiderechte Mitte des 19. Jahrhunderts ist das<br />
Lebendgewicht der Rinder deutlich gestiegen. Eine adulte Kuh wird zur damaligen Zeit mit 300 kg<br />
angegeben. Heutige ausgewachsene Kühe wiegen 600 bis 700 kg, was zu einem erhöhten<br />
Nahrungsbedarf führt. Viele Landwirte haben dieser Tatsache damit Rechnung getragen, dass sie<br />
Waldflächen zugunsten neuer Weideflächen reduziert haben. Dadurch hat sich die Waldgrenze in
VU Projektunterricht SS 2003 / SS 2005<br />
vielen Bereichen um bis zu 300 Meter nach unten verlagert. Außerdem werden Kälber oft nicht den<br />
zulässigen Auftriebsquoten zugerechnet. Da diese jedoch während ihres Wachstums eine nicht zu<br />
vernachlässigende Pflanzenmenge fressen, erhöht sich die Gefahr zu starker Beweidung. Wenn der<br />
Viehbestand zu groß ist, kommt es zu Engpässen in der Nahrungsversorgung – das Weidevieh weicht<br />
daher auf holzige Pflanzen,<br />
insbesonders Zweige von Büschen und Bäumen aus, was auf längere Sicht zu einem verfrühten Tod<br />
der Bäume führen kann. Aber auch ein Unterbesatz an Weidvieh kann Probleme aufwerfen. Rinder<br />
und Schafe fressen bei einem zu großen Weideangebot systematisch nur die besten Futterpflanzen<br />
ab, sodass sich nur wenige robuste Arten durchsetzen. Eine wenig artenreiche und schüttere<br />
Vegetationsdecke ist die Folge.<br />
Zukunftsperspektiven – Wie sieht die Zukunft der <strong>Alm</strong>en aus?<br />
Aufgelassene <strong>Alm</strong>en:<br />
Unter dem Auflassen von <strong>Alm</strong>en versteht man die Einstellung der Beweidung –<br />
weitgehende Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind die Folge. Auf vielen Weideflächen kommt es<br />
nach der Auflassung zu Vernässungen, wenn die seit Generationen offengehaltenen<br />
Entwässerungsgräben nicht mehr gepflegt werden und verfallen. Der steigende Wassergehalt in den<br />
Böden kann den hydrostatischen und hydrodynamischen Druck auf den Hang und damit die Gefahr<br />
von Rutschungen erhöhen. Bei einer nicht mehr genutzten <strong>Alm</strong> entfällt die Kontrolle des <strong>Alm</strong>personals<br />
auf Schwachstellen in der Vegetationsdecke. Als Folge können sich durch die vorherige Nutzung<br />
entstandene Erosionsherde ausbreiten, da eine notwendige<br />
Sanierung des Bodens nicht stattfindet. Nach Einstellung der Nutzung wachsen die vorhandenen<br />
Gräser lang auf, sterben im Herbst ab und legen sich hangabwärts flach auf den Boden. Sie bieten<br />
damit ideale Gleitbahnen für den Winterschnee. An steilen Hängen verklebt der Schnee mit dem<br />
langgewachsenen Altgras, Stauden und<br />
aufkommenden Gehölzen und kann als Gleitschnee die Vegetationsdecke aufreißen. Diese offenen<br />
Bodenstellen verfügen nicht mehr über die der Erosion entgegenwirkende geschlossene<br />
Pflanzendecke. Die aufgezeigten ökologischen Probleme Erosion und Bodenbelastung sind das<br />
Resultat eines Zusammenspiels von <strong>Alm</strong>wirtschaft und Wintertourismus. Festzustellen ist, dass<br />
Wintersport und <strong>Alm</strong>wirtschaft in jedem Fall eine zusätzliche Belastung des <strong>Ökosystem</strong>s darstellen.<br />
Die aufgezeigten Lösungsvorschläge sind in keinster Weise Lösungen im eigentlichen Sinn, sondern<br />
stellen nur Maßnahmen dar, die die entstehenden Beeinträchtigungen auf Natur und Umwelt mildern,<br />
jedoch niemals ausschalten können. Diese Beeinträchtigungen können bis zur irreversiblen<br />
Schädigung<br />
führen, falls die momentane Nutzung weitergeführt bzw. verstärkt wird. Allerdings soll auch angemerkt<br />
werden, dass die Bergregionen mittlerweile eine traditionelle, vom Menschen geschaffene<br />
Kulturlandschaft darstellen, die u. A. auch für den Tourismus relevant sind. Dieses künstlich<br />
geschaffene <strong>Ökosystem</strong> wird mittels genau angepasster Bewirtschaftungsformen aufrechterhalten. Mit<br />
eventuellen Veränderungen würde diese traditionelle Kulturlandschaft weitgehend<br />
zusammenbrechen. Egal, ob die Nutzung fortgesetzt oder aufgegeben wird – es wird zu Problemen<br />
kommen, die bewältigt werden müssen. Eine Agrarpolitik mit Einbezug von ökonomischen, kulturellen<br />
und umweltschutztechnischen Aspekten ist deshalb<br />
notwendig.