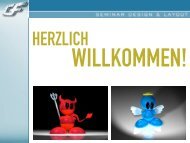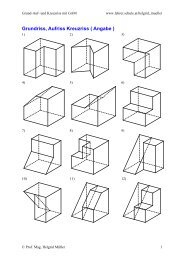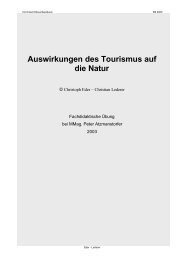Staudämme - lehrer
Staudämme - lehrer
Staudämme - lehrer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
<strong>Staudämme</strong><br />
©<br />
Fachdidaktische Übung<br />
bei MMag. Peter Atzmanstorfer<br />
2003
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
Kapitel 1<br />
Aus der Geschichte des Staudammes:<br />
Information zum Thema „<strong>Staudämme</strong>“<br />
Bereits 8000 vor Christus gab es die ersten Bewässerungsanlagen. Zu den ersten Staudammbauerin<br />
in der Geschichte der Menschheit gehören wahrscheinlich die Bewohner der Zagros Kette im<br />
heutigen Iran. Sie bauten schmale Wehre (aus Reisig und Erde), welche dazu dienten, Wasser in<br />
schmale Kanäle abzuleiten.<br />
Die Sumerer haben bereits 6000 vor Christus ihr Land – Mesopotamien – mit einem<br />
Bewässerungsnetz überzogen.<br />
Die ersten echten Reste von <strong>Staudämme</strong>n der Antike, welche im Nahen Osten (genauer gesagt in<br />
Jordanien) gefunden wurden, wurden auf etwa 3000 vor Christus datiert. Es gab dort damals bereits<br />
ein Wassertransportsystem, welches Wasser durch einen Kanal in andere Speicherbecken ableitete.<br />
Auch die Ägypter planten bereits einen Megastaudamm (10 m Hoch und über 100 m lang), welcher<br />
jedoch durch ein Hochwasser zum Teil weggeschwemmt wurde, aus diesem Grund wurde dieses<br />
Projekt nicht beendet und man findet heute keine Überreste mehr davon. (Ca. 2600 v. Chr.)<br />
Ab ca. 1000 vor Christus entstanden weltweit zahlreiche kleinere und größere Dämme, deren Reste<br />
man unter vielen Bauten im Mittelmeerraum und in China gefunden hat. Besonders die Römer waren<br />
führ ihre <strong>Staudämme</strong> und Aquädukte bekannt.<br />
Um 400 v. Chr. gab es in Sri Lanka bereits einen Damm, der mehr als 30 Meter hoch war. Diese<br />
Größe blieb lange Zeit unübertroffen bis weit ins 12. Jahrhundert hinein. Erst dann wurden bauten<br />
Errichtet, welche sogar eine Ausdehnung von 14 km erreichten.<br />
Das 19. Jahrhundert – die Blütezeit der Dämme Europas!<br />
In einem Zeitraum von 100 Jahren entstanden in Europa mehr als 250 solcher Bauwerke mit einer<br />
Höhe von mehr als 10 Metern. Vor allem England war ein Vorreiter in diesem Gebiet. Zu Beginn des<br />
20. Jahrhunderts gab es dort so viele so viele Dämme wie in allen anderen Ländern der Erde<br />
zusammen.<br />
Jedoch hatte man zu dieser Zeit auch noch mit gewaltigen Problemen zu kämpfen, da es damals nur<br />
sehr wenige Informationen über Abflussmengen und Regenfallmengen gab. Es kam dadurch immer<br />
wieder (sehr häufig) zu Dammbrüchen, da die Bauwerke den Wassermassen nicht standhalten<br />
konnten. In 30er Jahren das 20. Jahrhunderts gelang es erstmals den Wissenschaftlern mehr über die<br />
Gesteine und deren Verhalten unter hohem Druck herauszufinden. Dadurch konnte man die Statik der<br />
<strong>Staudämme</strong>r verbessern.<br />
Eine Erfindung des Franzosen Benoit Fourneyron 1832 war es dann, die auch den Dammbau zum<br />
Zwecke der Energiegewinnung revolutionierte. Die Konstruktion der ersten Wasserturbine der Welt<br />
ermöglichte es, die bis dahin verwendeten Wassermühlen schnell um ein Vielfaches an Leistung zu<br />
übertreffen. Die wirkliche Bedeutung dieser Erfindung zeigte sich aber erst gegen Ende des 19.<br />
Jahrhunderts, als die Fortschritte in der Elektrotechnik dazu führten, dass Kraftwerke und<br />
Übertragungsleitungen wie Pilze aus dem Boden schossen.<br />
Das erste Wasserkraftwerk, ein Laufwasserkraftwerk in Wisconsin, ging schließlich 1882 in Betrieb. In<br />
den nächsten Jahrzehnten entwickelten sich an vielen schnell fließenden Flüssen und Strömen<br />
Europas vor allem in den Alpen und Norwegen Wasserkraftwerke. Aber erst nach der<br />
Jahrhundertwende stieg die Größe der Dämme und Energiestationen schnell an. Fortschritte im<br />
Turbinen- und Staudammbau waren dafür verantwortlich.<br />
Bedeuteten zunächst noch 30 Meter Höhe das Maß aller Dinge, gab es 1930 bereits Konstruktionen,<br />
die über 200 Meter erreichten. Die heutigen Talsperren und <strong>Staudämme</strong> ragen manchmal noch weiter<br />
in den Himmel und sind oft regelrechte Monster aus Beton und Stahl.<br />
Heute gibt es mehr als 45 000 Großdämme weltweit und jedes Jahr kommen noch weitere dazu. Die<br />
meisten sind erst nach 1950 erbaut worden und das „Mekka“ der Staudammbauten liegt derzeit in<br />
China.<br />
Staudammtypen:<br />
Geländebeschaffenheit, Talform und Baustoffe, welche vor Ort verfügbar sind bestimmen den Typ der<br />
<strong>Staudämme</strong>. Staumauern bestehen entweder aus Natursteinmauerwerk oder Beton, Dämme aus<br />
Steinen und Erde.
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
Gewichtsstaumauer: Dies sind stabile Betonstrukturen, welche im Querschnitt eine dreieckige<br />
Form besitzen. Sie haben ein so hohes Eigengewicht, dass allein dieses ausreicht, den<br />
Wassermassen stand zu halten. Sie haben die größte Beständigkeit und müssen am wenigsten<br />
oft gewartet werden.<br />
Die höchste europäische Talsperre findet man in der Schweiz: die Staumauer von Grande<br />
Dixence ist 284 m hoch und besteht aus einer 700 m langen Betonkonstruktion, die auf einem<br />
stabilen Felsfundament erbaut wurde.<br />
Bogenstaumauer: Sie wird auch als Kuppel- oder Gewölbestauwand<br />
bezeichnet. Diese <strong>Staudämme</strong> haben eine geschwungene Form, welche sich<br />
vor allem der Landschaft sehr gut anpasst. Aber nicht nur dass, sondern auch<br />
allen physikalischen Anforderungen entspricht sie. Sie wölbt sich gegen das<br />
Wasser, welches durch sowohl vertikaler als auch horizontaler Krümmung der<br />
Mauer auf die Talflanken übertragen wird. Solche Konstruktionen sind jedoch<br />
nur bei stabilen Talflanken und bei engen Talquerschnitten sinnvoll.<br />
Eine Kombination aus Gewichtsstaumauer (im Mittelteil) und Bogenstaumauer(im<br />
Randbereich) nennt man Bogengewichtsstaumauer. Sie stellt eine Zwischenlösung<br />
dar. Sie erreicht die nötige Standfestigkeit teils durch ihr Eigengewicht und teils durch Abstützen auf<br />
die Talflanken.<br />
Pfeilstaumauer: Hierbei unterscheidet man zwischen Pfeilergewölbestaumauern und<br />
Pfeilerplattenstaumauern. Je nach Stärke des Wasserdrucks und Beschaffenheit des Untergrunds<br />
werden als Zwischenräume gewölbte oder flache Betonsegmente eingesetzt. Die Pfeiler leiten<br />
den Wasserdruck weiter in den Boden. Hierbei wird nicht so viel Beton gebraucht,<br />
jedoch sind die Kosten durch den komplizierten Bau gleich hoch, wie die bei<br />
anderen Konstruktionen.<br />
Nutzungsarten:<br />
Aufschüttungen: Oft kann man, wenn die natürlichen Ressourcen vorhanden<br />
sind, einen Erd- oder Steinschüttdamm errichten, bei denen die Kosten<br />
niedriger sind als bei den anderen Typen von <strong>Staudämme</strong>n. Ein Beispiel hierfür ist z.B. der<br />
Assuanstaudamm. Diese <strong>Staudämme</strong> sind im Allgemeinen im Querschnitt breiter als hoch<br />
und haben meistens einen dichten Kern. An der Seite, auf der das Wasser ist, werden<br />
Abdichtungen aus Asphalt und Beton angelegt.<br />
<strong>Staudämme</strong> haben verschiedene Aufgaben:<br />
Sie dienen zur<br />
• Trink- und Brauchwasserversorgung<br />
• Hochwasserschutz<br />
• Stromerzeugung<br />
• Erhöhung der Schiffbarkeit bestimmter Flüsse<br />
Eine positive Nebenerscheinung ist noch dazu die Schaffung neuer Arbeitsplätze. (Dies ist vor allem<br />
in den 3. Welt-Ländern ein wichtiger Punkt.)
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
Kapitel 2<br />
Folgen und Probleme von <strong>Staudämme</strong>n für die Umwelt<br />
So groß der Nutzen von <strong>Staudämme</strong>n ist, so groß sind auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt.<br />
Logischerweise stellt ein so massives Bauwerk wie ein Staudamm einen markanten Einschnitt in der<br />
Landschaft dar, und dass dies niemals ganz ohne Folgen und Auswirkungen auf die Umwelt, die<br />
Ökologie des Flusses und der Umgebung bleiben kann ist wohl offensichtlich.<br />
Es sind Kernprobleme zu erkennen, die in ihrer spezifischen Ausprägung bei fast jedem Damm zu<br />
finden sind, dazu kommen noch Folgen, die besonders bei einzelnen Dämmen zum Tragen kommen,<br />
bei anderen Dämmen aber keine Rolle spielen.<br />
Staut man ein fließendes Gewässer auf, so bewirkt das auf alle Fälle eine Veränderung im Längsprofil<br />
des Flusses, da das Gleichgewicht zwischen Erosion und Akkumulation im Fluss verändert wird. Der<br />
Stausee wird eine lokale Erosionsbasis. Gravierende Änderungen beim Materialtransport des<br />
Flusses, seiner Erosionstätigkeit, sowie seiner Sedimentation sind die Folge.<br />
Das Material, das der Fluss in seinem Oberlauf aufgenommen hat wird beim Eintritt in den<br />
Staubereich durch das hier vorherrschende flachere Gefälle, und die Abnahme der<br />
Fließgeschwindigkeit des Wassers abgelagert. Die Folge ist eine Verlandung des Staubereiches.<br />
Die zweite Seite ist die, dass der Fluss seine ganzen Sedimente im Staubecken zurückgelassen hat,<br />
was zur Folge hat, dass die Erosionstätigkeit im Unterlauf stark zunimmt. Es kommt zu einer<br />
verstärkten Seitenerosion aber genaus o auch zu Tiefenschürfung.<br />
Die Folge ist, dass sich der Fluss zum einen immer tiefer in sein Flussbett eingräbt. Zum anderen<br />
kommt es durch die Seitenerosion zu Uferabbrüchen. Dies bedeutet einen totalen Bodenverlust, der<br />
nicht sanierbar ist, sondern nur eingeschränkt oder zum Stillstand gebracht werden kann. (deutlich zu<br />
beobachten beim Assuanstaudamm und Oberrhein)<br />
Um diese Ausräumung der Flüsse unterhalb eines Staudammes verhindern zu können gibt es<br />
mehrere Möglichkeiten.<br />
Man könnte die Flusssohle mit groben Steine auslegen, „pflastern“, dies ist aber sehr teuer, und die<br />
Erosion würde eben am Ende der Pflasterung einsetzen.<br />
Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Geschiebezugabe von außen, man reichert den Fluss nach dem<br />
Kraftwerk wieder mit Sedimenten an. Dies würde beim Assuandamm durch die großen Mengen an<br />
benötigtem Material niemals sinnvoll sein.<br />
Dritte und im Endeffekt wirksamste Maßnahme ist der Bau von weiteren Wehranlagen. Eine so<br />
entstehende Staustufenkette löst das Problem bis zu letzten Kraftwerk sehr gut. – Wurde in dieser<br />
Form am Oberrhein angewandt.<br />
Der Bau eines Staudammes kann auch zu Veränderungen im Grundwasserhaushalt, der an den<br />
Fluss angrenzenden Gebiete führen. Direkte Auswirkungen durch den See oder den normal<br />
wasserärmeren Unterlauf sind durch eine in der Regel vorhandene Abdichtung der Ufer nicht zu<br />
erwarten. Durch den Bau des Assuandammes kam es aber zu Änderungen im Wasserhaushalt, denn<br />
durch die nun mögliche ganzjährige Bewässerung ist nun Grundwasser an Stellen zu finden, die<br />
früher trocken waren, ebenso wie als Folge der Bewässerung ein Grundwasserabflusssystem<br />
Richtung Fluss entstand. In den Staustufen entlang des Flusses ist es genau umgekehrt. Hier findet<br />
eine Grundwassererneuerung durch den Fluss statt. Allgemein kann man sagen, dass durch den<br />
Assuandamm der Grundwasserspiegel gestiegen ist.<br />
Eine Folge des höheren Grundwasserniveaus durch die Bewässerung ist ein steigendes<br />
Vernässungs- und Versalzungsproblem des Bodens.<br />
Eine nicht zu vernachlässigende Folge von <strong>Staudämme</strong>n ist, dass durch das Aufstauen von Wasser<br />
immer ein Becken überflutet wird. Dies stellt einen bedeutenden Eingriff in ein Ökosystem dar. Es<br />
geht hier immer ein Stück Landschaft verloren, bei dem es sich oftmals auch um Aulandschaften<br />
handelt, die einen wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen darstellen, der so verloren geht.<br />
Heute oftmals ein führender Kritikpunkt von Staudammgegnern.<br />
Es gehen zwar oftmals mit der Flutung von Ufergebieten groß angelegte Renaturierungsmaßnahmen<br />
an den neuen Ufern des Stausees einher, ob diese aber die verlorenen Lebensräume ersetzen<br />
können, wird besonders von Staudammkritikern bezweifelt.<br />
Auf der anderen Seite kommt es unterhalb des Dammes bei vorhandenen Augebieten durch die<br />
geänderten Wasserverhältnisse zu einer Austrocknung und zu einer Veränderung der Pflanzen- und<br />
Tierwelt.<br />
Bei vielen Dämmen lässt sich im Bereich des Staubeckens eine Veränderung der Wassergüte<br />
messen. Durch einen langen Aufenthalt des Wassers, und durch das so entstehende stehende
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
Gewässer kommt es zu einer Steigerung des Planktonwachstums und zu einer erhöhten<br />
Algenkonzentration im Wasser, wofür in fließendem Gewässer die Aufenthaltszeit nicht reichen<br />
würde. Dies ist für die Verwendung des Wassers zur Bewässerung kein Problem, hingegen<br />
problematisch bei Verwendung als Trinkwasser. Diese Erscheinung ist beispielsweise beim<br />
Assuandamm zu finden.<br />
Eine Auswirkung, die speziell beim Assuandamm zu finden ist, betrifft die Güte des Flusswassers, in<br />
welchem die Menge der gelösten Stoffe als Folge der möglich gewordenen dauerhaften Bewässerung<br />
zunahm. Das Grundwasser steigt, dadurch kommt zu einer Zunahme des Salzgehaltes im Boden.<br />
Um hier eine Versalzung des Bodens zu verhindern ist eine Entwässerung des Landes notwendig.<br />
Als Folge dieser Entwässerung nimmt der Salzgehalt im Flusswasser zu.<br />
Eine der größten Auswirkungen des Assuandammes für das ganze Niltal ist das Ausbleiben der<br />
großen Überschwemmungen. Diese brachten jährlich eine Menge Schlamm auf die Felder von bis zu<br />
1mm im Jahr. Von seiner chemischen Zusammensetzung ist der Nilschlamm ein gutes<br />
Ausgangssubstrat für Bodenbildung, und wesentlich verantwortlich für die Fruchtbarkeit der Felder.<br />
Dieser Schlamm kann nun nicht mehr auf die Felder gelangen. Inwieweit dies Folgen für die<br />
Landwirtschaft hat ist nicht restlos geklärt, denn zum einen hat im Laufe der Zeit die Schlammdecke<br />
eine Mächtigkeit von durchschnittlich 9m erreicht, davon ist nur 1m bewurzelt, andererseits sind<br />
durch die intensive Bewässerung jetzt bis zu drei Ernten im Jahr möglich, und wahrscheinlich würde<br />
der Nilschlamm als Dünger ohnehin nicht mehr ausreichen, und sowieso Mineraldünger eingesetzt<br />
werden müssen.<br />
Als eine weitere Folge des Ausbleibens der Überschwemmungen kommt es auf den Feldern zu immer<br />
größerer Versandung. Der über das Jahr auf die Felder gewehte Sand wurde früher vom Hochwasser<br />
wieder ausgewaschen, und an anderer Stelle abgelagert.<br />
Kapitel 3<br />
Maltastaudamm (Kölnbreinsperre)<br />
Das Kraftwerk Malta mit seinem Speichersee Kölnbrein ist das größte seiner Art in Österreich, sowohl<br />
im Bereich der Größe der Staumauer und des Stausees und in der Leistung.<br />
Erste Pläne zum Bau gab es bereits in den dreißiger Jahren. Durch die Kriegsereignisse wurden<br />
diese Planungen jedoch erst in den Fünfzigern wieder aufgegriffen. Die Region im hinteren Maltatal<br />
zählt zu den niederschlagsreichsten Österreichs, da hier Wettereinflusse sowohl von Süden (Kärnten)<br />
als auch von Norden (Salzburg) des Alpenhauptkammes spürbar sind. Des Weiteren stellen die<br />
zahlreichen Gletscher durch Abfluß im Sommer eine nicht zu unterschätzende Wasserquelle dar.<br />
Das Kraftwerk wurde nach jahrelangen Planungen in den Jahren 1971 bis 78 gebaut. Der Vollstau<br />
wurde erstmals Ende der 70er Probleme erreicht. Man bemerkte, dass die Staumauer Probleme<br />
hatte, die 5,4 Mio. Tonnen an Druck auszuhalten, weil sich Risse im Beton auftaten. Aus diesem<br />
Grund mußte die Mauer in den Jahren 1989 bis 94 aufwendig saniert werden. Man verwendete dazu<br />
ein 70 m breites und 65 m hohes Stützgewölbe auf der Talseite. Die wasserseitig gelegenen Risse<br />
wurden mit Zement - und Kunstharzinjektionen verdichtet. Seitdem gibt es keine Sicherheitsprobleme<br />
mehr.<br />
Der Sinn des Kraftwerkes liegt darin, sogenannten Spitzenstrom zu erzeugen, d.h. Strom zu Jahres-<br />
und Tageszeiten, wo er Mangelware ist.<br />
Das direkt in den Speichersee fließende Wasser allein reicht nicht aus, um ihn vollständig zu füllen.<br />
Aus diesem Grund werden Bäche aus benachbarten Tälern hingeleitet. Am Beispiel Lieser sieht man<br />
die Aufwendigkeit dieses Projekts: Dieser Bach wird im Quellbereich durch einen über 10 km langen<br />
unterirdischen Stollen in den sog. Vorspeicher Galgenbichl umgeleitet. Von dort aus wird das Wasser<br />
in den höher gelegenen Kölnbreinspeicher gepumpt, von wo er dann verwertet werden kann. Dieser<br />
Vorgang klingt nach einem Nullsummenspiel, macht aber durchaus Sinn: Man pumpt zu Zeiten, in<br />
denen die Energie dafür günstig ist, um die Speicherkapazität zu teuren Zeiten wieder auszunutzen.<br />
Nach Nutzung des Wassers durchläuft es nocheinmal den Vorspeicher, danach nach Möllbrücke im<br />
Mölltal, wo es ein drittes Mal zur Stromproduktion herangezogen wird. Danach läuft das Wasser in die<br />
Drau, wo es schließlich durch ca. 10 Laufkraftwerke fließt, eh es Kärnten und somit Österreich verläßt.<br />
Auswirkungen auf die Natur:<br />
Kraftwerksprojekt inklusive Panoramastraße wurde mitten in den heutigen Nationalpark Hohe Tauern<br />
gebaut. Die Umleitung der Gewässer durch unterirdische Stollen ist sicherlich nicht ohne Folgen.<br />
Daten:<br />
Höhe: 200 Meter<br />
Länge: 626 m
VU Nutzungskonflikte SS 2003<br />
Dicke: bis zu 41 m<br />
Baubedarf: 1,6 Mio. m³ Beton<br />
Speicherkapazität: 200 Mio. m³ Wasser bzw. 911 GWh<br />
Assuan-Staudamm/Ägypten<br />
Grund des Baues:<br />
Nach dem weiten Weltkrieg stieg die Bevölkerungszahl in Ägypten schlagartig an. Die<br />
Nahrungsmittelproduktion konnte aber nicht gesteigert werden, nicht zuletzt deswegen, weil ein<br />
Großteil des Landes in der Wüste liegt, und damit eine ständige Wasserknappheit gegeben ist.<br />
Abhilfe versprach man sich vom Bau eines Staudammes. Dieser wurde mit sowjetischer Hilfe<br />
finanziert und gebaut und nach elf Jahren Bautätigkeit im Jahre 1971 in Betrieb genommen.<br />
Daten:<br />
3.600 Meter lang<br />
111 Meter hoch<br />
Breite: 980 Meter (Basis), 40 Meter (Krone)<br />
Der Stausee hat eine Länge von 540 km.<br />
Die 12 Turbinen haben eine Leistung von 170 MW.<br />
Erfolg oder nicht Erfolg?<br />
Ziel Realität<br />
Gewinnung von Nutz- und<br />
Bewässerungswasser<br />
Erreicht<br />
Ausdehnung der kultivierbaren Fläche Schrumpfung des nutzbaren Landes<br />
Schutz vor Überflutungen erreicht<br />
Steigerung der Tragfähigkeit des Bodens durch Grundwasserspiegel stieg an – Versalzung und<br />
Absenkung des Grundwassers<br />
Verschlammung des Bodens<br />
Stromproduktion erreicht, jedoch unter den Erwartungen<br />
Probleme:<br />
• Umsiedelung von ca. 100.000 Menschen, vorwiegend Bauern in Städte – des Weiteren<br />
versanken wichtige Kulturgüter im Wasser (einige Tempel wurden mit internationaler Hilfe<br />
„umgesiedelt“)<br />
• Ausbleiben des Schlammes, der eine wichtige Düngewirkung hatte<br />
• Überschwemmungen blieben aus – deshalb mußten Bewässerungsanlagen gebaut werden<br />
• Erosion: es wird nicht mehr, wie früher, Schlamm am Ufer und Nildelta abgelagert, sondern<br />
das Gegenteil passiert – es wird Landmasse abgetragen, womit die rare nutzbare Landfläche<br />
dezimiert wird.