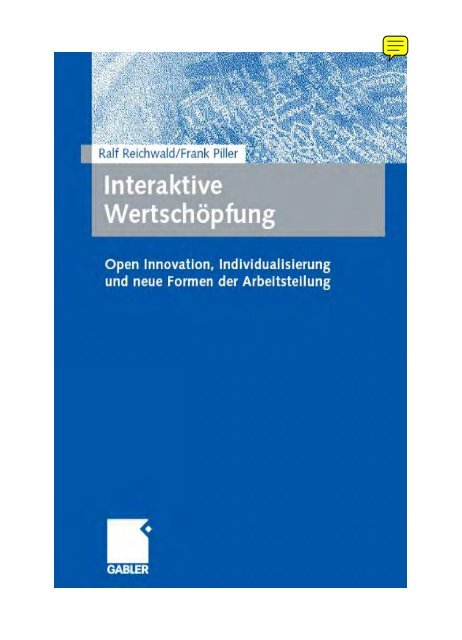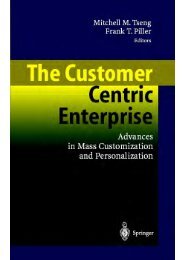Reichwald, Ralf / Piller, Frank
Reichwald, Ralf / Piller, Frank
Reichwald, Ralf / Piller, Frank
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Auflage erschienen<br />
Liebe Leser,<br />
im April 2009 ist endlich die<br />
zweite und deutlich überarbeitete<br />
Auflage unseres Buchs erschienen.<br />
Die Kapitelstruktur und<br />
wesentliche Definitionen wurden<br />
ebenso überarbeitet wie die<br />
Fallstudien aktualisiert.<br />
Auszüge der überarbeiteten 2.<br />
Auflage können Sie wiederum auf<br />
der Website zum Buch,<br />
www.open-innovation.de,<br />
downloaden.
Nutzungsbedingungen dieses Dokuments<br />
Dieser File wird von den Autoren des Buchs unter einer Creative Commons Lizenz<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Die vollständigen Bedingungen dieser Lizenz lesen Sie hier:<br />
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/<br />
Die aktuelle Version dieses Buchs erhalten Sie unter<br />
www.open-innovation.com/iws
<strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong>/<strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong><br />
Interaktive Wertschöpfung
Dieses Buch wird von der Peter-Pribilla-Stiftung gefördert.<br />
Ziel der Stiftung ist die Förderung von Forschung und Wissenstransfer<br />
auf den Gebieten „Innovation und Leadership“.<br />
Professor Peter Pribilla (*1941, †2003) war Mitglied des<br />
Zentralvorstands der Siemens AG und Honorarprofessor an<br />
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der TU München.
<strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong>/<strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong><br />
Interaktive<br />
Wertschöpfung<br />
Open Innovation, Individualisierung<br />
und neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Konzepte – Methoden – Praxis<br />
unter Mitarbeit von Christoph Ihl und Sascha Seifert
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.<br />
Die diesem Buch zugrunde liegenden Forschungsarbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG) im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 582 an der TU<br />
München sowie das BMBF im Rahmen der Projekte WinServ (FKZ 01HW0182) und EwoMacs<br />
(FKZ 02PD1120) unterstützt.<br />
Autorenkontakt:<br />
Prof. Dr. Prof. h. c. Dr. h. c. <strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong> Dr. <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong><br />
Technische Universität München, MIT Sloan School of Management<br />
Lst. für Information, Organisation u. Mgt. 50 Memorial Drive, E52-513<br />
Leopoldstr. 139 Cambridge, MA 02139<br />
80804 München USA<br />
reichwald@wi.tum.de piller@open-innovation.com<br />
Web-Seiten zum Buch im Internet:<br />
www.prof-reichwald.org/iws<br />
www.open-innovation.com/iws<br />
1. Auflage Mai 2006<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006<br />
Lektorat: Barbara Roscher / Jutta Hinrichsen<br />
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.<br />
www.gabler.de<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für<br />
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk<br />
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im<br />
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher<br />
von jedermann benutzt werden dürften.<br />
Konzeption und Layout des Umschlags: Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de<br />
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Wilhelm & Adam, Heusenstamm<br />
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier<br />
Printed in Germany<br />
ISBN-10 3-8349-0106-7<br />
ISBN-13 978-3-8349-0106-4
2. Auflage erschienen<br />
Liebe Leser,<br />
im April 2009 ist endlich die<br />
zweite und deutlich überarbeitete<br />
Auflage unseres Buchs erschienen.<br />
Die Kapitelstruktur und<br />
wesentliche Definitionen wurden<br />
ebenso überarbeitet wie die<br />
Fallstudien aktualisiert.<br />
Auszüge der überarbeiteten 2.<br />
Auflage können Sie wiederum auf<br />
der Website zum Buch,<br />
www.open-innovation.de,<br />
downloaden.
Vorwort<br />
Ideen, Beispiele und Herausforderungen zur<br />
Interaktiven Wertschöpfung – geschrieben von<br />
unseren Kunden: unseren Lesern<br />
Dieses Buch ist eine Innovation, und wir praktizieren „Open Innovation“ mit diesem<br />
Vorwort. Unsere wichtigsten Kunden, unsere Master- und Executive-MBA-Studenten<br />
sowie Forschungspartner, haben wir in die Buchproduktion einbezogen. In den<br />
Vorlesungen und Seminaren der letzten Semester haben wir intensiv Cases und<br />
Literaturbeiträge zu Open Innovation und Mass Customization thematisiert und<br />
diskutiert. So entstand eine Vorabversion zu diesem Buch, und wir konnten unsere<br />
Kunden einladen, mit uns das Vorwort zu schreiben. Die folgende Einführung ist<br />
nach den Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung entstanden und wurde ausnahmslos<br />
von unseren Lesern geschrieben. Als Autoren verblieb uns lediglich die<br />
Integration und Zusammenstellung der Einzelbeiträge. Dabei sind wir nach dem<br />
Innovationskonzept des Unternehmens Zagat vorgegangen, das in den USA hoch<br />
erfolgreich Restaurant- und Reiseführer rein auf Basis von Kundenbeiträgen erstellt.<br />
Was unsere Kunden hier zustande gebracht haben, hat uns ebenso erstaunt wie<br />
erfreut.<br />
Der Einstieg<br />
Den Einstieg bildet die Frage „interaktive Wertschöpfung und Open Innovation –<br />
sind das nicht einfach weitere Buzzwords irgendwelcher Berater?“ Die Antwort<br />
unserer Kunden heißt Nein: „Ein hervorragendes Beispiel für Open Innovation ist<br />
das Open-Logo-Projekt von Spreadshirt.com [ein Anbieter individueller Kleidung].<br />
Das Unternehmen lässt nicht nur sein Corporate Design von der eigenen Kunden-<br />
Community entwickeln, sondern gibt sein Schicksal und seine Zukunft mehr und<br />
mehr in die Hände seiner Kunden ... Dabei geht es nicht mehr rein um T-Shirt-<br />
Entwürfe. Zusammen mit der TRND-Agentur werden neue Projektideen und<br />
Unternehmensstandbeine aus der Community heraus entwickelt.” “Spreadshirt-<br />
Geschäftsführer Lukasz Gadowski hat seine Strategie kürzlich gegenüber dem<br />
SPIEGEL auf den Punkt gebracht: ‘Wir befähigen die User, ihr eigenes Ding zu<br />
machen.’ “<br />
Aber es geht auch viel einfacher: “Letzte Woche habe ich meiner Schwiegermutter ein<br />
bei ‘personalnovel.de’ individuell gestaltetes Buch geschenkt. Sie spielt die Mutter des<br />
Helden, und auch ihr Hund bekam eine Rolle. Das Buch war ein Volltreffer und wurde<br />
bei der Geburtstagsfeier eifrig herumgereicht. Das finde ich im Moment das beste<br />
Mass-Customization-Beispiel, weil es mir (zumindest für dieses Jahr) die Qual [einer<br />
passenden Geschenkwahl] erspart hat.”<br />
V
Vorwort<br />
„Es sind die kleinen Dinge, die den Fortschritt ausmachen“<br />
Diese Beispiele haben gemeinsam, “dass sie den Kunden in den Mittelpunkt der<br />
Wertschöpfung stellen.” Anstelle einer “rein unternehmensintern dominierten<br />
Produktion und Innovation werden die Kunden zu aktiven Wertschöpfungspartnern.”<br />
“Die Vorstufen dieses Ansatzes waren immer Meinungsbefragungen, Markttests etc.”<br />
So laden wir [ein Hersteller von Finanzsoftware] “als Banksoftware-Outsourcing-<br />
Partner unsere Kunden ein, unsere Software zu testen. Dies beginnt bei den Basistests,<br />
die bereits der Kunde wahrnimmt. Durch die Einladung in die Testphase gewinnt der<br />
Kunde Einblick in die neuen Funktionen des Produkts und kann diese gleich prüfen.<br />
Im Weiteren gibt dies uns die Gelegenheit, den Kunden mit seinen Bedürfnissen kennenzulernen.<br />
Diese Bedürfnisse geben wiederum die Basis für die Fortentwicklung<br />
außerhalb von Management-Schranken wie Kosten/Nutzen – denn oft sind es die kleinen<br />
Dinge, die den Fortschritt ausmachen.”<br />
“Seit es Amateurfunk gibt, wird dort Open Innovation praktiziert.”<br />
Doch interaktive Wertschöpfung “geht weiter als Selbstbedienung oder Marktforschung.”<br />
Im Mittelpunkt steht die “partnerschaftliche Organisation der Leistungserstellung”<br />
in einer “Community aus Kunden, Nutzern, Herstellern, Lieferanten,<br />
Händlern und anderen Quellen innovativen Wissens.” Diese Art der Mitwirkung von<br />
Kunden und Nutzern an der Wertschöpfung ist dabei nicht unbedingt neu: “Seit es<br />
Amateurfunk gibt, wird dort Open Innovation praktiziert.” Alle wesentlichen<br />
Entwicklungen kommen von den Nutzern. “Die Vereine bauen gar Satelliten (Oskar-<br />
Satelliten-Programm), die sie weitgehend selbst finanzieren und mit Erstflügen im All<br />
platzieren. Amateurfunk ist wegweisend im Hochfrequenzbereich …. Der Idealismus<br />
der Personen und das hohe Engagement der in der Wirtschaft engagierten Forscher<br />
und die Tüftler, die Hochfrequenz betrieben haben – denen verdanken wir heute<br />
wesentliche Teile unserer Mobilfunktechnologie.”<br />
“Ich war jahrelang ein eifriger Gestalter von Community-Medien“<br />
Auch im Bereich der Medienproduktion sind Kunden seit vielen Jahren aktiv. “Ich war<br />
jahrelang ein eifriger Nutzer/Gestalter von Community-Medien – ob bei einem<br />
Bürgerradio als Reporter von der Landtagswahl oder als Moderator von<br />
Radiosendungen. Wie sich nun herausstellt, sind Community-Medien, Vereine, etc.<br />
Vorreiter in Sachen Open Innovation, denn diese mussten schon immer auf motivierte<br />
Kunden/Mitglieder und deren Ideen-Reichtum, Innovationsfreude und (Eigen)<br />
Initiative bauen. Also all das, was “professionelle” Unternehmen nun gerade lernen.”<br />
Für diese aber “ist die Vorstellung, dass auch die Kunden einen wertvollen Beitrag zur<br />
Leistungserstellung beitragen und manche Aufgaben besser lösen können als die<br />
Hersteller, eine Kulturrevolution.”<br />
“Die Chancen für die Unternehmen liegen auf der Hand: enge Kundenbindung,<br />
Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls: ‘Das Unternehmen sind wir.’ “ “Gerade unter<br />
dem Stichwort ‘Social Commerce’ wird es eine Fülle von neuen Verkaufskonzepten<br />
geben, in denen es mehr um Kaufempfehlungen von Fan zu Fan (bzw. von<br />
Freundin zu Freundin) geht als um den klassischen Kauf im Laden. Empfehlungssysteme<br />
werden eine Rolle spielen; die Kommunikation wird offener und<br />
VI
direkter ablaufen und auch der Wunsch, nach individuelleren (= exklusiveren)<br />
Produktangeboten wird steigen.” Wichtigster Treiber aber ist, dass die Anbieter<br />
“Zugang zur Kundeninformation bekommen, die in dieser Qualität zu diesen<br />
[geringen] Kosten” bislang nicht verfügbar waren. Damit sollen die “Kosten der<br />
Produktentwicklung gesenkt und der Spagat zwischen Individualität und Preis<br />
geschlossen” werden.<br />
„Die Gefahr ist groß, dass Unternehmen es übertreiben“<br />
Vorwort<br />
Doch “je aktiver die Kunden werden sollen, desto aktiver muss man sich aus<br />
Unternehmenssicht auch um sie kümmern.” “Kunden werden es begrüßen, eingebunden<br />
zu werden. Die große Gefahr ist (heute noch), dass Unternehmen es übertreiben.”<br />
Eine große Herausforderung ist deshalb “die Beherrschung der Komplexität aus<br />
Kundensicht. Kunden trauen sich oft nicht zu, größere Wertschöpfung wie bspw. das<br />
Design zu betreiben.” Ein Beispiel: “Bei 121Time [ein Anbieter individueller Uhren im<br />
Internet] habe ich den Job des Designers übernommen. Was mich sehr nachdenklich<br />
gemacht hat, ist die Tatsache, dass ich es … sehr anstrengend empfand, bis ich das<br />
Design für die Uhr meiner Frau zusammengestellt hatte.” Die “strategische<br />
Grundfrage [ist deshalb], was der Kunde als Partner aktiv mitgestalten soll und vor<br />
allem in welcher Umfang”. “Im ‘Café Brotraum’ in München können Kunden massiv<br />
in die Wertschöpfung von Backwaren eingreifen – müssen dann jedoch auch das kulinarische<br />
Risiko von Senf-Schafskäse Pralinen tragen.” “Die Herausforderung für die<br />
Unternehmen liegt so in einer adäquaten Gestaltung von Schnittstellen zwischen<br />
Unternehmen und Kunden, [in der] Reduktion von Komplexität der Produkte und<br />
Prozesse sowie in einer Verkürzung der Durchlaufzeiten vom Angebot bis zum fertigen<br />
Produkt.” Denn “die Chance, dem Kunden eine Fülle von (Wahl- und<br />
Beteiligungs-)Möglichkeiten bieten zu können, heißt nicht, dass man seinen Kunden<br />
nicht gleichzeitig auch einfache Lösungen und direkte Wege zum Produkt bieten muss.<br />
Unternehmen müssen lernen, beide Möglichkeiten zu bieten.”<br />
“Falls diese Herausforderungen gepackt werden, kann das Unternehmen auf eine<br />
riesige Ressource an Ideen und Innovationen zugreifen.”<br />
Eine der größten Herausforderungen ist die soziale Komponente.” “Der Kunde<br />
darf sein Mitwirken nicht als mitwirken, sondern als mitgestalten erleben. Der<br />
Kunde ist ernst zu nehmen und seine Inputs sind stets zu beantworten. Ansonsten<br />
fehlt auf Dauer die Glaubwürdigkeit.” “Künftig geht es darum, eine unbekannte<br />
Masse von Menschen sozial kompetent zu führen. Hier wird ein enormes Geschick<br />
im Umgang mit Menschen gefordert sein. Denn jegliche Ausfälligkeit und<br />
Ungeschicklichkeit schlägt in weitaus höherem Maße als heute auf das<br />
Unternehmen zurück.”<br />
Im Herstellerunternehmen aber ist “vor allem ein Kulturwandel notwendig.” “Alle<br />
Mitarbeiter müssen den Nutzen” von interaktiver Wertschöpfung verstehen. “Vor<br />
allem die Produktentwicklung darf die Mitwirkung der Kunden nicht als Konkurrenz<br />
sehen, sondern als Ideen-Lieferant. Falls diese Herausforderungen gepackt<br />
werden, kann das Unternehmen auf eine riesige Ressource an Ideen und Innovationen<br />
zugreifen.”<br />
VII
Vorwort<br />
“Deshalb wünsche ich diesem Buch viele Leser”<br />
“Bei mir [als Kunde] überwiegt jedoch die Freude darüber, endlich vom Unternehmen<br />
ernst genommen zu werden und selbst einen Beitrag leisten zu können.” “Die Chancen<br />
sehe ich vor allen Dingen in einer bedarfsorientierten, nachhaltigen Produktionswelt,<br />
die unserer Zeit mehr als gut zu Gesicht stehen würde.” “Deshalb wünsche ich diesem<br />
Buch viele Leser”, denn es ist aufgrund “seiner hohen markt- und gesellschaftspolitischen<br />
Bedeutung” ein “wichtiger” Beitrag, “um der interaktiven Wertschöpfung, entsprechend<br />
ihres enormen Potentials, auf breiter Ebene zeitnah zu mehr Popularität und<br />
Verbreitung zu verhelfen.”<br />
Basierend auf Beiträgen von Peter Arnold, Wolfgang Bauhaus, Paul Blazek,<br />
Stefanie Breuer, Martin Dietram, Alexander Dorn, Gaby Egelwiße, Elha<br />
Elezovic, Patrick Eichhorn, Silvia Fenz, Robert Freund, Johannes Hache,<br />
Andreas Helms, Steffi Jansen, Timo Jäger, Joachim Kant, Tanja Kempf,<br />
Jochen Krisch, Ulrike Kustermann, Thomas Lippert, Bastian Merfels,<br />
Melanie Müller, Sabine Pabst, Miriam D. Pattberg, Peter Raabe, Christoph<br />
Schmidt, Dorothee Schmitt, Christian Schönherr, Anja Seidler, Johannes<br />
Steuerwald, Christoph Stotko, Alexander Ullrich, Jörg Vogt, Stefan<br />
Walchberg, Christian Waller, Claudia Wiesmann, Stefanie Wolf, Andrea M.<br />
Zehetner und Günther Zonner.<br />
Danksagung<br />
Allen oben aufgeführten Personen sagen wir Dank für ihre Beiträge zum Gemeinschaftswerk.<br />
Doch nicht nur das Vorwort, sondern auch weite Teile des Buches wären<br />
ohne unsere Partner in Forschung und Praxis nicht entstanden. Wir danken dabei an<br />
erster Stelle dem Team des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre: Information,<br />
Organisation und Management (IOM) der Technischen Universität München (TUM)<br />
für die vielfältige Unterstützung und die kreativen Inputs aus zahlreichen empirischen<br />
Forschungsprojekten des Lehrstuhls, insbesondere Angelika Bullinger, Melanie<br />
Müller, Dominik Walcher, Hagen Habicht, Klaus Moser, Daniel Rackensperger,<br />
Michael Ney und Jutta Hensel. Unsere Mitautoren Christoph Ihl und Sascha Seifert<br />
haben in den Kapiteln 2 und 3 mit wesentlichen Ideen dieses Buch geprägt und waren<br />
uns stets exzellente Sparingpartner bei der Diskussion unserer Entwürfe.<br />
Wesentliche Teile dieses Buches basieren auf Konzepten und Inhalten, die im Rahmen<br />
des Sonderforschungsbereichs „Marktnahe Produktion individualisierter Produkte“<br />
(vgl. Lindemann/ <strong>Reichwald</strong> / Zäh 2000) entwickelt wurden. Wir danken allen Kollegen<br />
und Kolleginnen des Forschungsverbundes, vertreten durch den Sprecher des SFB 582,<br />
Herrn Prof. Dr. Udo Lindemann, und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die<br />
Förderung. Ebenso haben wir aus den Forschungsprojekten des Förderprogramms<br />
„Innovative Dienstleistungen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung<br />
(BMBF) profitiert, besonders aus den Projekten WINSERV (<strong>Reichwald</strong> / Mayer /<br />
VIII
Vorwort<br />
Engelmann / Walcher 2006) , MACS und COSMOS (Krcmar / <strong>Reichwald</strong> / Schlichter /<br />
Baumgarten 2005) sowie aus den Projekten EUROSHOE und CEC der<br />
Förderprogramme der Europäischen Union. Wir danken den Förderinstitutionen für<br />
ihre wertvolle Unterstützung und unseren Projektpartnern aus Wissenschaft und<br />
Praxis für die ausgezeichnete Kooperation.<br />
Das Buch hat nicht zuletzt von unserer Verankerung in mehrere internationale<br />
Forschernetzwerke profitiert. Hier ist neben der Mass-Customization-Community vor<br />
allem die Forschergruppe um Eric von Hippel am Massachusetts Institute of<br />
Technology (MIT), Boston, USA, zu nennen. Viele der grundlegenden Konzepte und<br />
Ideen dieses Buches sind von dieser Kooperation geprägt – ebenfalls ein ausgezeichnetes<br />
Beispiel für Open Innovation in der Wissenschaft.<br />
Eine Vielzahl innovativer Manager und Entrepreneure in Europa und in den USA haben für<br />
die empirische Fundierung unserer Gedanken gesorgt. Ohne ihre Offenheit und Auskunftsbereitschaft<br />
hätten viele der Fallstudien und Beispiele in diesem Buch nicht entstehen<br />
können. Auf Interviews, bei Firmenbesuchen und in Arbeitskreisen und Veranstaltungen<br />
des Lehrstuhls haben sie mit uns diskutiert und unsere Gedanken auf die Probe gestellt –<br />
und oft durch neue Ideen aus der Praxis nachhaltig erweitert. Gleiches gilt auch für unsere<br />
Studenten in München und Cambridge sowie in MBA-Kursen an anderen Institutionen, die<br />
ebenfalls durch ihre Beiträge die Konzeption dieses Buchs wesentlich mitgeprägt haben.<br />
Der Gabler Verlag war wieder einmal ein kompetenter und flexibler Partner, der sich von<br />
unseren innovativen Ideen mitreißen ließ. Wir stellen eine Kurzfassung dieses Buches<br />
unter einer Creative-Commons-Lizenz auf der Web-Site zu diesem Buch ins Netz, die<br />
sich jeder Interessent kostenlos beschaffen kann. Auch der Verlag betritt mit diesem<br />
Produktionskonzept Neuland, und wir danken Frau Barbara Roscher und Frau Jutta<br />
Hinrichsen für ihre große Unterstützung bei diesem Buchprojekt. Frau Gabriele Singer<br />
vom Verlag danken wir für die sorgfältige Umsetzung der Gestaltung dieses Buches.<br />
Unsere Leser ermuntern wir zur Mitwirkung bei der interaktiven Weiterentwicklung<br />
dieses Buches. Senden Sie uns Ihre Beispiele, Kommentare und Verbesserungsvorschläge<br />
und wirken Sie somit an der nächsten Auflage dieses Lehrbuchs interaktiv mit.<br />
Wir freuen uns über jeden Beitrag von Ihnen!<br />
München und Cambridge / Boston<br />
<strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong> und <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong><br />
(reichwald@wi.tum.de | piller@open-innovation.com)<br />
Das Buch im Netz:<br />
Im Internet finden Sie einen umfangreichen Begleitdienst zu diesem Buch mit vielen<br />
weiteren Informationen:<br />
www.prof-reichwald.org/iws oder www.open-innovation.com/iws<br />
IX
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung und Überblick:<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1<br />
2 Organisation der arbeitsteiligen Wertschöpfung: Entwicklungen und<br />
Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />
2.1 Eine Übersicht der Evolution von Wert und Wertschöpfung . . . . . . . . . . . .11<br />
2.2 Die tayloristische Industrieproduktion: hierarchische<br />
Organisation der Arbeitsteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
2.2.1 Tayloristische Prinzipien der wissenschaftlichen<br />
Betriebsführung: Produktivitätsoptimierung unter stabilen<br />
Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
2.2.2 Gesetze der Produktivität und Kostenwirtschaftlichkeit . . . . . . . .18<br />
2.2.3 Grenzen des Taylorismus: Heterogenisierung der<br />
Nachfrage und Empowerment aktiver Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
2.3 Auflösung der Unternehmensgrenzen: Von der internen<br />
Abwicklung zu Netzwerken und Märkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
2.3.1 Marktorientierung und Flexibilität als Leitziele in<br />
Unternehmensnetzwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />
2.3.2 Ökonomie der Netzwerkorganisationen und<br />
Move-to-the-Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
2.3.3 Grenzen der grenzenlosen Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />
2.4 Interaktive Wertschöpfung – neue Formen der Arbeitsteilung und<br />
des Wissenstransfers zwischen Anbietern und Kunden . . . . . . . . . . . . . . . .41<br />
2.4.1 Prinzipien und Eigenschaften der interaktiven Wertschöpfung . . .42<br />
2.4.2 Kundenintegration und Lösungsraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47<br />
2.4.3 Arbeitsteilung und Organisation in der interaktiven<br />
Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />
2.4.3.1 Arbeitsteilung und Nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />
2.4.3.2 Logik der Arbeitsteilung nach dem Konzept der<br />
“wissensökonomischen Reife” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />
2.4.3.3 Logik der Arbeitsteilung nach dem Konzept der<br />
“sticky information” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57<br />
2.4.3.4 “Commons-based Peer Production” als<br />
Organisationsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58<br />
2.4.3.5 Organisation der Informations- und<br />
Wissensproduktion: Offenheit vs. proprietärer<br />
Schutz von Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />
2.4.4 Interaktive Wertschöpfung aus Kundenperspektive:<br />
Free Revealing und Nutzen der Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
XI
Inhaltsverzeichnis<br />
2.4.5 Interaktive Wertschöpfung aus Unternehmensperspektive:<br />
Effiziente Differenzierung und Zugriff auf knappe Ressourcen . . .75<br />
2.4.6 Interaktionskompetenz und interaktionsförderliche<br />
Organisations- und Kommunikationsstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
2.4.7 Grenzen der interaktiven Wertschöpfung:<br />
Aufgabenteilung und Transaktionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91<br />
3 Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation . . . . . . . . . . . . .95<br />
3.1 Der interaktive Innovationsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />
3.2 Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im<br />
Innovationsprozess:der Weg zu Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105<br />
3.2.1 Ansätze der Kundenorientierung: “Voice of the Customer” . . . . .106<br />
3.2.2 Innovationsprozesse in interorganisationalen Netzwerken . . . . . .114<br />
3.2.3 Kunden als Quelle von Innovationen:<br />
Vom Manufacturer-Active zum Customer-Active Paradigm . . . . .120<br />
3.2.4 Open Innovation: Ein Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128<br />
3.3 Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation . . . . . . . . . . . . .135<br />
3.3.1 Eigenschaften von Kundeninnovatoren (Lead Usern) . . . . . . . . . .137<br />
3.3.2 Unzufriedenheit mit bestehenden Lösungen und<br />
Erwartung eines besseren Fit zwischenProdukteigenschaften<br />
und Kundenbedürfnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142<br />
3.3.3 Erfolgreiche Absolvierung einer lohnenswerten Aufgabe<br />
und Stolz auf das Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144<br />
3.3.4 Reduktion von Unsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146<br />
3.3.5 Soziale Bestätigung und externe Anerkennung . . . . . . . . . . . . . . . .146<br />
3.3.6 Kosten der Beteiligung am Innovationsprozess aus Sicht<br />
der Nutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147<br />
3.4 Die Unternehmensperspektive – Wettbewerbsvorteile durch<br />
Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149<br />
3.4.1 Reduzierung der Time-to-Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150<br />
3.4.2 Reduzierung der Cost-to-Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151<br />
3.4.3 Steigerung des Fit-to-Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152<br />
3.4.4 Erhöhung des New-to-Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153<br />
3.4.5. Kosten aus Sicht des Herstellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154<br />
3.5 Instrumente von Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155<br />
3.5.1 Die Lead-User-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156<br />
3.5.2 Toolkits für Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163<br />
3.5.3 Innovationswettbewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172<br />
3.5.4 Communities für Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176<br />
4 Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Individualisierung und<br />
Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191<br />
XII<br />
4.1 Produktindividualisierung und Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . .193<br />
4.1.1 Der Begriff Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Inhaltsverzeichnis<br />
4.1.2 Mass Customization als Ausprägung einer<br />
Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198<br />
4.1.3 Prinzipien und Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199<br />
4.1.4 Einordnung der Produktindividualisierung in das Konzept<br />
der interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207<br />
4.1.5 Effizienzkriterien interaktiver Wertschöpfung bei<br />
Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214<br />
4.2 Kosteneffizienz von Individualproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215<br />
4.2.1 Zusätzliche Kosten durch Produktindividualisierung . . . . . . . . . .216<br />
4.2.2 Neue Kostensenkungspotenziale durch<br />
Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223<br />
4.3 Markteffizienz von Individualproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230<br />
4.3.1 Einfluss auf die Produktqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231<br />
4.3.2 Einfluss auf die Prozessqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232<br />
4.3.3 Preispolitische Potenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232<br />
4.3.4 Zusammenfassende Betrachtung der Effizienzwirkung<br />
interaktiver Wertschöpfung durch<br />
Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234<br />
4.4 Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei<br />
Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237<br />
4.4.1 Übersicht und Phasenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238<br />
4.4.2 Kommunikationsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241<br />
4.4.3 Exploring-Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244<br />
4.4.4 Konfigurationsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245<br />
4.4.5 Wartezeit und Lieferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251<br />
4.4.6 Feedback und After-sales-Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252<br />
4.4.7 Wiederholungskauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253<br />
5 Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257<br />
5.1 Von Mass Customization zu Open Innovation bei der<br />
Adidas-Salomon AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257<br />
5.2 Wikipedia als Beispiel einer interaktiven Wertschöpfung in<br />
Nutzer-Communities von Informationsgütern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270<br />
5.3 Mass Customization in der Reisebranche – kundenindividuelles<br />
Reisen mit Dynamic Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279<br />
5.4 Linel GmbH: Entwurf eines Mass-Customization-Konzepts für<br />
die Wasser- und Abwasserfiltrationsbranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294<br />
5.5 Effizienz der interaktiven Wertschöpfung – eine Kalkulation am<br />
Beispiel von Maßkonfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303<br />
6 Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313<br />
Quellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319<br />
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355<br />
XIII
Verzeichnis der Kästen<br />
Kasten 1–1 Threadless: Interactive Value Creation With and By Consumers . . . . . .2<br />
Kasten 2–1: Henry Ford und das “Modell T” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Kasten 2–2: Wichtige Funktionen und Gesetzmäßigkeiten der klassischen<br />
Produktionstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Kasten 2–3: Literaturempfehlungen zum Wandel der Märkte und zum<br />
Empowerment der Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Kasten 2–4: Das Beispiel Dell: Netzwerke als Antwort auf den marktlichen<br />
und technologischen Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />
Kasten 2–5: Organisationsgrenzen: Begriff und Ebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />
Kasten 2–6: Ansätze zur Erklärung organisationaler Grenzen:<br />
Transaktionskosten und Property-Rights-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />
Kasten 2–7: User Innovation in Kite-Surfing: Dominierung der<br />
Wertschöpfung durch die Anbieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41<br />
Kasten 2–8: Spreadshirt: Rasantes Wachstum durch Interaktive<br />
Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Kasten 2–9: Literaturempfehlungen zu grundlegenden Schriften zur<br />
Kundenintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />
Kasten 2–10: Could The Culture of Participation Threaten The Existence<br />
of The Firm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64<br />
Kasten 2–11: Skaleneffekte der Informationsproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Kasten 2–12: Literaturempfehlungen zu den Prinzipien der Arbeitsteilung<br />
und Organisation der interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . .71<br />
Kasten 2–13: Literaturempfehlungen zu den Wettbewerbsvorteilen durch<br />
Interaktive Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Kasten 2-14: Literaturempfehlungen zur Interaktionskompetenz und zu interaktionsförderlichen<br />
Organisations- und Kommunikationsstrukturen . . . .91<br />
Kasten 3–1: Innocentive: Ideenbörse für Tüftler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96<br />
Kasten 3–2: Quality Function Deployment (QFD) als umfassende Methode<br />
eines kundenorientierten Innovationsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111<br />
Kasten 3–3: Procter & Gamble’s Strategy to Harness Outside Talent to<br />
Boost Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114<br />
Kasten 3–4: Portrait of a User Innovator: How Bette Nesmith Graham<br />
(1922-1980) invented Liquid Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124<br />
Kasten 3–5: Ein Interview mit Eric von Hippel, MIT, über die<br />
Demokratisierung von Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127<br />
Kasten 3–6: What’s Really Up with Web 2.0: Customer Innovation and<br />
Design It Yourself . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132<br />
Kasten 3–7: Literaturempfehlungen zu Grundidee und Hintergrund von<br />
Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135<br />
XV
Verzeichnis der Kästen<br />
Kasten 3–8: Motives and Tools of Do-It-Yourself Inventors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141<br />
Kasten 3–9: Literaturempfehlungen zur Kundenperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . .149<br />
Kasten 3–10: Literaturempfehlungen zur Herstellerperspektive . . . . . . . . . . . . . . . .155<br />
Kasten 3–11: Literaturempfehlungen zur Lead-User-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . .163<br />
Kasten 3–12: Prototyping und Experiment als grundlegende Idee von Toolkits . . .165<br />
Kasten 3–13: Ein Toolkit in der Nahrungsmittelindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168<br />
Kasten 3–14: Literaturempfehlungen zu Toolkits für Open Innovation . . . . . . . . . .172<br />
Kasten 3–15: Ideenwettbewerb bei Swarovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177<br />
Kasten 3–16: Beispiel zur Interaktiven Wertschöpfung in<br />
Innovation-Communities: Die Entstehung von Linux . . . . . . . . . . . . .181<br />
Kasten 3–17: Open Invention Network Formed to Promote Linux and Spur<br />
Innovation Globally Through Access to Key Patents . . . . . . . . . . . . . .182<br />
Kasten 3–18: Beispiele der Übertragung des Gedankens der<br />
Open-Source-Software-Entwicklung auf andere Bereiche . . . . . . . . . .183<br />
Kasten 3–19: Nutzung von Input aus Kunden-Communities bei MUJI . . . . . . . . . .188<br />
Kasten 3–20: Literaturempfehlungen zu Open Innovation Communities . . . . . . . . .189<br />
Kasten 4–1: mi adidas: Das Mass-Customization-Programm von Adidas . . . . . . .192<br />
Kasten 4–2: Eigenschaften von Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204<br />
Kasten 4–3: Literaturempfehlungen zu den Grundlagen der<br />
Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215<br />
Kasten 4–4: Mass-Customization-Produktionstechnologie Rapid<br />
Manufacturing: Die Brille aus dem Drucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218<br />
Kasten 4–5: Loewe Individual-Fernseher als Alternative für eine<br />
Produktion am Standort Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234<br />
Kasten 4–6: Literaturempfehlungen zur Markt- und Kosteneffizienz von<br />
Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237<br />
Kasten 4–7: Kundenintegration in das Produktdesign am Beispiel des<br />
Internet-Toolkits von Factory 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239<br />
Kasten 4–8: Web Sites Offering Personalized Products Catch Fire<br />
Among Vcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243<br />
Kasten 4–9: LEGO Factory: Von Mass Customization zu User Innovation . . . . . . .254<br />
Kasten 4–10: Literaturempfehlungen zur Gestaltung der<br />
Kundeninteraktion bei Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255<br />
Kasten 5–1: Die Konkurrenz: Mass Customization bei Nike . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259<br />
Kasten 5–2: Beispiele für Maßkonfektion im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304<br />
XVI
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 2–1: Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven<br />
Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />
Abbildung 2–2: Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung nach<br />
Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Abbildung 2–3: “Principles of Common Wisdom” - Rahmenbedingungen und<br />
Prinzipien der tayloristischen Industrieorganisation . . . . . . . . . . . .17<br />
Abbildung 2–4: Alternative Wertschöpfungsarrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />
Abbildung 2–5: Einfluss der neuen Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien (IKT) auf die<br />
Vorteilhaftigkeit von Organisationsstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
Abbildung 2–6: Das Modell der interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />
Abbildung 2–7: Kundenintegration zur Produktion von Dienstleistungen<br />
und individuellen Produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
Abbildung 2–8: Ebenen der interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
Abbildung 2–9: Logik der Arbeitsteilung zwischen Unternehmen<br />
und Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58<br />
Abbildung 2–10: Einsparungen von externen Transaktionskosten in der<br />
interaktive Wertschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61<br />
Abbildung 2–11: Gütertypologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />
Abbildung 2–12: Das Kontinuum zwischen implizitem und explizitem Wissen . . . .70<br />
Abbildung 2–13: Interaktive Wertschöpfung und Unternehmenserfolg . . . . . . . . . . .80<br />
Abbildung 2–14: Unterscheidung von technisch-naturwissenschaftlichem<br />
Wissen und Anwendungswissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83<br />
Abbildung 2–15: Bausteine der Interaktionskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86<br />
Abbildung 2–16: Trade-Off zwischen Produktionskosten und<br />
Transaktionskosten in der interaktiven Wertschöpfung . . . . . . . . . .92<br />
Abbildung 3–1: Ziele von Prozessinnovationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99<br />
Abbildung 3–2: Arten von Innovationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101<br />
Abbildung 3–3: Phasen eines idealtypischen Innovationsprozesses . . . . . . . . . . . . .102<br />
Abbildung 3–4: Faktoren von Kundenorientierung im Innovationsprozess . . . . . .107<br />
Abbildung 3–5: Typische konventionelle Methoden der Datengewinnung<br />
zum Zugang zu Bedürfnisinformation<br />
(“voice of the customer”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110<br />
Abbildung 3–6: Closed versus Open Innovation nach Chesbrough . . . . . . . . . . . . .119<br />
Abbildung 3–7: Ausgewählte Studien zum Anteil innovativer<br />
Nutzer an allen Nutzern der Produkte einer Branche . . . . . . . . . .121<br />
Abbildung 3–8: Vom MAP zum CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123<br />
Abbildung 3–9: Gegenüberstellung des Lead-User-Gedankens und des<br />
klassischen “Voice of the Customer”-Konzepts . . . . . . . . . . . . . . .130<br />
XVII
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 3–10: Determinanten der Kundenbeteiligung an Open Innovation . . . .136<br />
Abbildung 3–11: Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . .150<br />
Abbildung 3–12: Phasen der Lead-User-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157<br />
Abbildung 3–13: Die Suchtechniken Pyramiding und Screening . . . . . . . . . . . . . . . .160<br />
Abbildung 3–14: Kreativitätstechniken im Innovationsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . .162<br />
Abbildung 3–15: Ablauf des iterativen Problemlösungsprozesses im<br />
klassischen Innovationsprozess und bei Einbezug der<br />
Nutzer mittels Toolkits für Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . .164<br />
Abbildung 3–16: Arten von Toolkits für Open Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167<br />
Abbildung 3–17: Beispiele für Toolkits für User Co-Design in der<br />
Schuhindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170<br />
Abbildung 3–18: Merkmale virtueller Communities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178<br />
Abbildung 3–19: Beispiele für Meinungsplattformen und Marken-Communities<br />
im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185<br />
Abbildung 4–1: Idealpunkte eines Produkts aus Kundensicht (Nr. 1-4) im<br />
Vergleich zu den realen Produkteigenschaften (P*) als<br />
Kaufentscheidungskriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194<br />
Abbildung 4–2: Möglichkeiten der Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . .196<br />
Abbildung 4–3: Merkmale der Individualisierung und Standardisierung<br />
auf Produktebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197<br />
Abbildung 4–4: Prinzipien von Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200<br />
Abbildung 4–5: Zeitpunkte der Integration des Kunden in die<br />
Leistungserstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209<br />
Abbildung 4–6: Auftragsneutrale und kundenbasierte Vorfertigung . . . . . . . . . . . .212<br />
Abbildung 4–7: Übersicht der Treiber der Effizienz interaktiver<br />
Wertschöpfung bei Produktindividualisierung . . . . . . . . . . . . . . . .215<br />
Abbildung 4–8: Aufbau von “Learning Relationships” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228<br />
Abbildung 4–9: Qualitativer Vergleich der Wertschöpfungsmodelle in<br />
Bezug auf wesentliche Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229<br />
Abbildung 4–10: Kosten und Nutzen einer Mass-Customization-Strategie<br />
aus Sicht des Anbieters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235<br />
Abbildung 4–11: Phasen der Kundeninteraktion bei Mass Customization . . . . . . . .239<br />
Abbildung 4–12: Der Konfigurationsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246<br />
Abbildung 4–13: Einsatzumgebungen von Toolkits für User Co-Design . . . . . . . . . .247<br />
Abbildung 4–14: Aufgabenumfang eines Produktkonfigurationssystems für<br />
Mass Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248<br />
Abbildung 5–1: Der ‘mi adidas’-Konfigurationsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261<br />
Abbildung 5–2: Aufbau der Gestalte-Seite des Ideenwettbewerbs . . . . . . . . . . . . . .264<br />
Abbildung 5–3: Verteilung der Ideen auf die unterschiedlichen Phasen . . . . . . . . .267<br />
Abbildung 5–4: Verteilung des Kreativscores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268<br />
Abbildung 5–5: Der Ideenwettbewerb als Methode zur Identifikation von<br />
Lead Usern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269<br />
Abbildung 5–6: Ausschnitt aus der Hauptseite der deutschsprachigen<br />
Wikipedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271<br />
Abbildung 5–7: Diagramm der Wikimedia-Server-Architektur vom<br />
12. April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278<br />
XVIII
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 5–8: Gesamtumsatz und Umsatzentwicklung der deutschen<br />
Reisebranche on- und offline 1999 bis 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282<br />
Abbildung 5-9: Wichtige Angebote großer Online-Reiseagenturen im Internet . . . . .283<br />
Abbildung 5-10: Wichtige Angebote großer, "klassischer"<br />
Reiseveranstalter im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284<br />
Abbildung 5–11: Funktionaler Vergleich wichtiger<br />
Dynamic-Packaging-Angebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286<br />
Abbildung 5–12: Funktionalschema der Reisevermittlung durch Online-<br />
Reiseagenturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287<br />
Abbildung 5–13: “Click&Mix“-Angebot auf expedia.de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288<br />
Abbildung 5–14: Individualisierung des Fluges, der Zimmerausstattung,<br />
des Mietwagens sowie Auswahl einer Reiseversicherung . . . . . . .289<br />
Abbildung 5–15: Tourdesigner der Jacana Tours GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290<br />
Abbildung 5–16: Prozess aus Sicht des Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291<br />
Abbildung 5–17: Mögliche Module einer Filtrationsanlage und ihre<br />
Ausprägungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297<br />
Abbildung 5–18: Darstellung eines Konfigurators für<br />
Membranfiltrationsanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298<br />
Abbildung 5–19: Beispielmodul Wartung & Reparatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299<br />
Abbildung 5–20: Wertschöpfungskette bei Maßkonfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304<br />
Abbildung 5–21: Kostenstruktur Maßkonfektionsware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305<br />
Abbildung 5–22: Vergleich Abschriften bei Massenkonfektion und Mass<br />
Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306<br />
Abbildung 5–23: Kostenerhöhung bei individueller Fertigung von<br />
Konfektionsware in Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309<br />
Abbildung 5–24: Durchlaufzeiten der kundenindividuellen<br />
Massenfertigung einer Damenhose in Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310<br />
XIX
2. Auflage erschienen<br />
Liebe Leser,<br />
im April 2009 ist endlich die<br />
zweite und deutlich überarbeitete<br />
Auflage unseres Buchs erschienen.<br />
Die Kapitelstruktur und<br />
wesentliche Definitionen wurden<br />
ebenso überarbeitet wie die<br />
Fallstudien aktualisiert.<br />
Auszüge der überarbeiteten 2.<br />
Auflage können Sie wiederum auf<br />
der Website zum Buch,<br />
www.open-innovation.de,<br />
downloaden.
1 Einleitung und Überblick:<br />
Die aktive Rolle von Kunden in<br />
der Wertschöpfung<br />
Wenn wir in diesem Buch vom Konzept der interaktiven Wertschöpfung sprechen, so<br />
steht für uns als Besonderheit die aktive Rolle des Kunden in der Wertschöpfung im<br />
Mittelpunkt. Der Kunde ist in unserem Konzept nicht mehr nur passiver Empfänger<br />
und Konsument einer von Herstellern autonom geleisteten Wertschöpfung. Vielmehr<br />
treten Kunden als Wertschöpfungspartner von Unternehmen auf, indem sie Produkte<br />
oder Dienstleistungen mitgestalten und teilweise sogar deren Entwicklung und<br />
Herstellung bestimmen oder übernehmen. Aus der von Unternehmen dominierten<br />
Wertschöpfung wird durch die aktive Rolle der Kunden eine interaktive Wertschöpfung.<br />
1<br />
Was ist interaktive Wertschöpfung?<br />
Interaktive Wertschöpfung heißt Kooperation und sozialer Austausch. Das Konzept<br />
der interaktiven Wertschöpfung geht von einem stark kooperativen Prozess aus, in<br />
dem der Kunde nur im Extremfall dominiert. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass<br />
Kunden in der Regel nicht allein die finanziellen und materiellen Ressourcen aufbringen<br />
können und wollen, um einen komplexen und langwierigen Wertschöpfungsprozess<br />
ohne Unterstützung eines Herstellers zu gestalten. In der Regel signalisiert der<br />
Hersteller seine Empfangsbereitschaft für Kundenbeiträge zur Wertschöpfung, indem<br />
er spezielle Infrastruktur und Ressourcen bereitstellt. Die Rolle der Kunden geht dabei<br />
aber weit über den Aufbau eines Regals von Ikea oder eine Selbstbedienung am<br />
Bankautomaten hinaus. Dies sind zwar auch Formen einer Arbeitsteilung zwischen<br />
Anbieter und Abnehmern, jedoch finden sie rein auf einer operativen Ebene innerhalb<br />
eines engen Lösungsrahmens statt. Wir wollen dagegen auf Wertschöpfungsprozesse<br />
fokussieren, die durch einen weiten Lösungsraum gekennzeichnet sind. So können<br />
sich Kunden als Lieferanten von in Markttests und Pilotierungen erworbener<br />
Anwendungserfahrung oder aber als Mitgestalter der Produktentwicklung erweisen,<br />
die Ideen für neue Produkte beisteuern, an der Konzeptentwicklung mitarbeiten oder<br />
Produkte designen und konfigurieren (Dahan / Srinivasan 2000; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2003;<br />
Brockhoff 2005).<br />
1 Hinweis: Unter einem Kunden verstehen wir den Abnehmer und vor allem Nutzer einer<br />
Leistung und unter einem Unternehmen den Anbieter und vor allem den Hersteller einer<br />
Leistung. Ein Kunde bzw. Nutzer kann dabei auch ein Unternehmen sein (im B-to-B-<br />
Geschäft). Bei der Leistung kann es sich sowohl um materielle Produkte als auch<br />
Dienstleistungen handeln, oft ist das Leistungsobjekt bei interaktiver Wertschöpfung auch ein<br />
Produkt-Service-Bündel.<br />
1
1<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Das Beispiel von Threadless<br />
Ein konkretes Beispiel, wie wir interaktive Wertschöpfung verstehen, liefert das Unternehmen<br />
Threadless. Das im Jahre 2000 in Chicago gegründete Unternehmen verkauft<br />
mit großem Erfolg ein eigentlich einfaches Produkt: bedruckte T-Shirts. Die beiden<br />
Gründer und ihre knapp 20 Mitarbeiter erwirtschaften aber mit diesem Produkt inzwischen<br />
pro Monat Gewinne in Höhe von mehreren Einhunderttausend Dollar und verkaufen<br />
mehr als 50.000 T-Shirts pro Monat (Ogawa / <strong>Piller</strong> 2006). Sie schaffen dies, da<br />
alle wesentlichen wertschöpfenden Aufgaben an die Kunden ausgelagert sind, die diesen<br />
mit großer Begeisterung nachkommen (siehe Kasten 1–1 für eine ausführliche<br />
Darstellung). Die Kunden designen die T-Shirts und machen Verbesserungsvorschläge<br />
zu den Entwürfen anderer. Sie screenen und bewerten alle Entwürfe und wählen diejenigen<br />
aus, die aus der Konzeption in die Produktion gehen sollen. Sie übernehmen<br />
dabei das Marktrisiko, da sie sich zum Kauf eines Wunsch-T-Shirt (moralisch) verpflichten,<br />
bevor dieses in Produktion geht. Die Kunden übernehmen die Werbung, stellen<br />
die Models und Photographen für die Katalogphotos und werben neue Kunden.<br />
Die Kunden fühlen sich dabei aber nicht etwa ausgenutzt, sondern zeigen im Gegensatz<br />
große Begeisterung für das Unternehmen, das ihnen diese Mitwirkung ermöglicht.<br />
Sie beschützen Threadless vor Nachahmern (deren Web-Sites sie hacken) und<br />
übermitteln unzählige Ideen, wie das Unternehmen noch besser und produktiver werden<br />
kann. Threadless selbst fokussiert sich auf die Bereitstellung und Weiternetwicklung<br />
einer Interaktionsplattform, auf der die Interaktion mit und zwischen ihren<br />
Kunden abläuft. Das Unternehmen definiert zudem die Spielregeln, honoriert die<br />
Kunden-Designer, deren Entwürfe für eine Produktion ausgewählt wurden und steuert<br />
den eigentlichen materiellen Leistungserstellungsprozess (Herstellung und<br />
Distribution).<br />
Kasten 1–1 Threadless: Interactive Value Creation With and By Consumers<br />
(Quelle: Auszug aus dem Arbeitspapier “Collective Customer Commitment” von Susumu Ogawa<br />
und <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>, MIT User Innovation Working Paper Series, Cambridge, MA 2005)<br />
Threadless, a young Chicago-based fashion company, follows an innovative business model that<br />
takes some ideas from postponement and customization, but mixes them with new ways of customer<br />
interaction to create high variety products without risks, and without heavy investments in market<br />
research. In fact, it follows a strategy that turns market research expenditures into quick sales.<br />
Started in 2000 by designers Jake Nickell and Jacob DeHart, Threadless focuses on a hot fashion<br />
item, t-shirts with colorful graphics. This is a typically hit-or-miss product. Its success is defined by<br />
fast changing trends, peer recognition, and finding the right distribution outlets for specific designs.<br />
Despite these challenges, none of the company’s products ever flopped. But Threadless has neither<br />
a sophisticated market research or forecasting capabilities nor a complicated flexible manufacturing<br />
system. Rather, all products sold by Threadless are inspected and approved by user consensus<br />
before any larger investment is made into a new product. Only after a sufficient number of<br />
customers have expressed their willingness to buy a new design, the garment is produced. If this<br />
commitment is missing, a potential design concept is dismissed. But if enough customers pledge<br />
to purchase the product, the design will be finalized and go into production. In this way, market<br />
2
Eine neue Form der Arbeitsteilung entsteht<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
research expenditures are turned into early sales. New designs regularly sell out fast, but are<br />
reproduced only if a large enough number of additional customers express interest in a reprint.<br />
Also the designs are submitted entirely by the community, which includes hobbyists, but also professional<br />
graphic designers. The company exploits a large pool of talent and ideas to get new<br />
designs (much larger than it could afford if the design process would have been internalized).<br />
Creators of submissions which are selected by other users get a $1000 reward, and their name is<br />
printed on the particular t-shirt’s label. Since Threadless’ launch, over 300 winning designs have<br />
been chosen for print from more than 32,000 submissions. The Threadless community is thriving<br />
with over 150,000 users signed up to submit, evaluate, score, and purchase new designs.<br />
This method eliminates the risk of new product developments. The commitment of the users to<br />
screen, evaluate and score new designs provides a powerful mechanism to reduce flops of new<br />
products. The method breaks with the known practices of new product development. It utilizes the<br />
capabilities of customers and users for the innovation process. The process starts when either a<br />
consumer or the development team of a manufacturer posts an idea for a desired product on a<br />
dedicated web site. Second, reactions and evaluations of other consumers towards the posted<br />
idea are encouraged in form of internet forums and opinion polls. Based on the results of this process,<br />
the company investigates the possibility of commercialization of the most popular designs.<br />
Is this evaluation positive, the company decides about a minimum amount of purchasers necessary<br />
to produce the item for a given sales price, covering its initial development and manufacturing<br />
costs (and the desired margin). The new product idea is then presented to the customer community,<br />
and interested customers are invited to express their commitment to this idea by voting for the<br />
design or even placing an order. Accordingly, if the number of interested purchasers exceeds the<br />
minimum necessary lot size, merchandising is settled and sales are commenced.<br />
Instead of investing in highly flexible manufacturing systems and dealing with individual custom<br />
designs, the company focuses its energy to motivate creative designers to submit new designs and<br />
facilitates the evaluation and voting process in its customer community. Contrarily to postponement,<br />
it only starts the full manufacturing cycle after customers have shown their real commitment<br />
to purchase a particular item, eliminating the risk of product flops while allowing still for economies<br />
of scale. Compared to mass customization, Threadless has not to interact with individual customers<br />
with regard to their specific order and to run manufacturing lots of one. The costly elicitation<br />
process is substituted by an early involvement of some (expert) customers in development, and<br />
the refinement of their ideas and pre-order taking by a larger group of customers. Motivated by its<br />
success in the fashion market, the founders of the company have recently extended their categories<br />
to formal wear like ties or polo shirts (NakedandAngry.com) or music (15Megsof Fame.com).<br />
Was sich in diesem Beispiel als kreative Spielerei Einzelner anhört, ist kein Einzelfall.<br />
Eine Vielzahl an Beispielen aus verschiedensten Branchen zeigt, dass die aktive Rolle<br />
von Kunden und Anwendern in der Wertschöpfung weder ein rein akademisches noch<br />
ein für die Praxis neues Phänomen ist. In jüngster Zeit ist auch zu beobachten, dass<br />
immer mehr etablierte Unternehmen (z. B. Audi, Adidas, BMW, Huber Group, Eli Lilly<br />
oder Procter&Gamble) mit der Einführung dezidierter Infra- und Organisationsstrukturen<br />
für die interaktive Wertschöpfung mit Abnehmern begonnen haben.<br />
Auch andere Neugründungen wie MySQL, Threadless.com oder Zagat haben wie<br />
Threadless ihr Geschäftsmodell ganz auf die Entwicklung ihrer Produkte durch<br />
Kunden ausgerichtet. Nicht zuletzt begünstigt durch neue Möglichkeiten der<br />
3<br />
1
1<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und des Internets gewinnt<br />
die interaktive Wertschöpfung auch in vielen Konsumgütermärkten an Bedeutung.<br />
Unternehmen reagieren damit verstärkt auf aktuelle Trends und tragen so bewährte<br />
Konzepte und Modelle für die Organisation der arbeitsteiligen Wertschöpfung als<br />
(vorläufiges) Ergebnis eines Entwicklungsprozesses auf eine neue Stufe. Das<br />
Spannende an diesen Modellen ist dabei eine neue Vorstellung und Organisation der<br />
Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Abnehmern. Eine hierarchische Aufgabenverteilung<br />
und Kontrolle wird durch Selbstmotivation und Selbstselektion der Akteure<br />
ersetzt. Der internen Koordination durch Regeln und Organisationsformen stehen<br />
neue Koordinationsformen in Netzwerken gegenüber. Standardisierte Massenartikel<br />
oder vorproduzierte Varianten werden durch individuelle Leistungen ersetzt, ohne<br />
dass dadurch die Preise aber wesentlich steigen.<br />
Die Entwicklungsgeschichte der interaktiven Wertschöpfung<br />
Das hier dargestellte Modell der interaktiven Wertschöpfung stellt eine Synthese und<br />
Weiterentwicklung von generalisierbaren Prinzipien dar, die in der Vergangenheit<br />
sowohl in Ansätzen der Organisationsforschung sowie in Ansätzen des Innovations-,<br />
Technologie- und Produktionsmanagements erarbeitet worden sind. Unser Konzept<br />
der interaktiven Wertschöpfung erhebt deshalb nicht den Anspruch, etwas grundsätzlich<br />
Neues zu sein, es handelt sich vielmehr um eine Ergänzung und Weiterentwicklung<br />
bewährter theoriegeleiteter Ansätze und Konzepte zur instrumentellen und organisatorischen<br />
Gestaltung des Innovations- und Produktionsmanagements. Wir beziehen<br />
uns auf eine traditionsreiche Reihe großer Autoren und knüpfen an deren gedanklichen<br />
Konstrukten an.<br />
Chester Barnard ist einer der Urväter der modernen Organisationstheorie. In seinem<br />
Buch “Organization and Management” (1948) diskutiert er detailliert und lange vor<br />
modernen Strömungen eines “Beziehungsmarketings” die symbiotische Beziehung<br />
zwischen Käufern und Verkäufern. Kunden gelten für Barnard nicht als externe<br />
Akteure, sondern sie sind Teil der Organisation. Er bemerkt, dass sowohl Kunden als<br />
auch die Angestellten eines Herstellerunternehmens gleichermaßen Inputfaktoren<br />
zum Leistungserstellungsprozess beitragen.<br />
Diesen Gedanken greift viele Jahre später Alvin Toffler (1970, 1980) auf. Er prägte den<br />
berühmten Ausdruck des “Prosumers”, der in einer Rolle Konsument und Produzent<br />
ist. Allerdings ist der Tofflersche Prosument ein autonomer Akteur, der ohne<br />
Kooperation mit einem Unternehmen produktive und konsumptive Aufgaben vollzieht.<br />
Eine wesentliche Quelle unserer Ideen in diesem Buch ist die Konzeption einer “interactive<br />
strategy” von Richard Normann und Rafael Ramirez (1993, 1998[1994]) sowie<br />
Solveig Wikström (1996a, 1996b). Diese Autoren können als Urheber einer modernen<br />
Debatte interaktiver Wertschöpfung zwischen Unternehmen und Kunden gesehen<br />
werden (siehe auch Mannervik 1997; Parolini 1999; Ramirez 1999; Schön 1994;<br />
Wikström / Normann 1994 für verwandte Schriften). Sie erklären, dass sich als Folge<br />
des Einsatzes neuer Informations- und Fertigungstechnologien sowie geänderter<br />
Lebensstile zwei wesentliche Änderungen ergeben werden:<br />
4
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Die Trennung zwischen (materiellen) Produkten und Dienstleistungen wird hinfällig,<br />
da alle Leistungen durch einen Kern oder eine Peripherie von Diensten geprägt<br />
werden, die ihren eigentlichen Wert darstellen. Prägendes Merkmal von<br />
Dienstleistungen ist aber der Einbezug des Kunden als externer Faktor in die<br />
Leistungserstellung.<br />
Damit wird auch das von Michael Porter (1985) geprägte Bild der “Wertschöpfungskette”<br />
in Frage gestellt: Erfolg im Wettbewerb leitet sich nicht daraus ab,<br />
bestimmte festgelegte Aktivitäten entlang einer sequentiellen Abfolge zu positionieren,<br />
sondern ist vielmehr Resultat der Fähigkeit eines Unternehmens, mit allen<br />
an der Wertschöpfung beteiligten Akteuren ein geschlossenes und abgestimmtes<br />
Wertsystem zu schaffen (Normann und Ramirez nennen dieses ‘value constellation’).<br />
Wertschöpfung ist in dieser Vorstellung immer ‘co-creation’ zwischen verschiedenen<br />
Akteuren einschließlich der Kunden.<br />
Prahalad und Ramaswamy (2000, 2002, 2003, 2004) bauen auf dieser Vorstellung auf<br />
und geben eine moderne Interpretation der Gedanken von Normann und Ramirez vor<br />
dem Hintergrund der Möglichkeiten des Internets. Sie betonen vor allem das kontinuierliche<br />
Feedback, das heute Kunden Herstellern geben und das zur kontinuierlichen<br />
Weiterentwicklung und Konkretisierung von Leistungsbündeln beiträgt. Zur wichtigsten<br />
Aufgabe von Herstellerunternehmen wird es deshalb, Interaktionsplattformen zu<br />
schaffen, die den Inputprozess für den Kunden zum Erlebnis werden lässt. Auch<br />
Ursula Hansen und Thorsten Hennig (1995) entwickeln die Ideen von Normann und<br />
Ramirez weiter und liefern eine marketingfokussierte Betrachtung dieser Thematik<br />
(siehe auch Hansen 1993; Hansen / Raabe 1991; Hansen / Schoenheit 1985; Hennig-<br />
Thurau 1998).<br />
In der deutschen Managementforschung haben vor allem Werner Engelhardt und<br />
Michael Kleinaltenkamp und ihre Schüler eine deutsche Schule der Kundenintegration<br />
(auch im Deutschen von ihnen ‘Customer Integration’ genannt) begründet<br />
(siehe z. B. Engelhardt / Freiling 1995; Engelhardt / Kleinaltenkamp / Reckenfelderbäumer<br />
1993; Fließ 2001; Jacob 1995, 2003; Kleinaltenkamp 1996, 1997a, 1997b, 2002;<br />
Kleinaltenkamp / Fließ / Jacob 1996; Kleinaltenkamp / Haase 2000; Trommen 2002;<br />
Weiber / Jacob 2000). Die Autoren argumentieren aus der Perspektive industrieller<br />
Märkte, wo eine Leistungserstellung in vielen Fällen durch individuelle und auf das<br />
Produktionssystem des Abnehmers ausgerichtete Prozesse geprägt ist. Die Erstellung<br />
einer individuellen Leistung bedarf jedoch zunächst einer intensiven Interaktion zwischen<br />
Anbieter und Abnehmer zur Konkretisierung dieser Leistung. Ein solches<br />
Leistungssystem ist vor allem durch zwei Eigenschaften geprägt: In einem ersten<br />
Schritt, einer autonomen Vorproduktion, stellt der Hersteller zunächst die Potenziale<br />
und Produktionsplattformen bereit. In einem zweiten Schritt werden unter Mitwirkung<br />
des individuellen Abnehmers in einem integrierten Prozess die<br />
Produktekonkretisiert und genutzt. In aktuelleren Arbeiten ist dieses Verständnis von<br />
den Autoren zu einer eigenen Leistungslehre ausgebaut worden. Auch diese Gruppe<br />
von Autoren betont die Irrelevanz einer Trennung von Sach- und Dienstleistungen, da<br />
beide Leistungsarten stets durch materielle und immaterielle Bestandteile geprägt<br />
sind.<br />
5<br />
1
1<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Die These, dass auch in Konsumgütermärkten immer mehr Kunden entweder freiwillig<br />
oder unfreiwillig zum aktiven Mitakteur der Leistungserstellung werden (“Von der<br />
Selbstbedienung zur Co-Produkion”) ist der Ausgangspunkt der Untersuchungen von<br />
Oskar Grün und Jean-Claude Brunner (2002, 2003) sowie Günter Voß und Kerstin<br />
Rieder (2005). In ihren Modellen sind es vor allem Bestrebungen zur Effizienz- und<br />
Effektivitätssteigerung, die Unternehmen veranlassen, immer mehr Arbeit an die<br />
Kunden auszulagern. Zwar sind die heutigen Konsumenten selbstbestimmter, informierter,<br />
aktiver und besser mit Produktionstechnik ausgestattet, jedoch haben sie häufig<br />
keine andere Wahl, als hier mitzuwirken. Während Voß und Rieder dieses<br />
Phänomen aus Sicht der Komsumsoziologie darstellen und kritisch hinterfragen, entwickeln<br />
Grün und Brunner ein Organisationsmodell, wie Unternehmen eine weit<br />
gehende Form der Selbstbedienung steuern und gestalten können.<br />
Vor allem aber liegen unserem Modell der interaktiven Wertschöpfung Beobachtungen<br />
der Forschergruppe um Eric von Hippel zugrunde (siehe zum Beispiel von Hippel<br />
1978a, 1986, 1988, 1998; 2005; siehe auch <strong>Frank</strong>e / Schreier 2002; <strong>Frank</strong>e / Shah 2003;<br />
Füller 2005; Harhoff / Henkel / von Hippel 2003; Henkel / von Hippel 2005; Herstatt<br />
1991; Jeppesen 2005; Lüthje 2000; Lakhani / Wolf 2005; Ogawa 1998; Ogawa / <strong>Piller</strong><br />
2006; Urban / von Hippel 1988; Thomke 2003; Thomke / von Hippel 2002). Von Hippel<br />
betont, dass Kunden bzw. Nutzer in verschiedensten Produktdomänen zunehmend<br />
selbständig in der Lage sind, Produkte für den Eigenbedarf zu modifizieren oder gar<br />
vollständig (zumindest als Prototypen) zu entwickeln, d. h. ohne die Mitwirkung<br />
eines herstellenden Unternehmens. Diese Kunden fortschrittlichen Kunden werden als<br />
“Lead User” bezeichnet. Das so genannte “customer-active paradigm” (CAP) von von<br />
Hippel geht im Gegensatz zum traditionellen “manufacturing-active paradigm”<br />
(MAP) von einer extremen Form der Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und<br />
Kunden aus, wobei der Aufwand vom Kunden zunächst autonom geleistet wird.<br />
Umso erstaunlicher ist die Beobachtung, dass eine Vielzahl dieser Kunden ihre<br />
Produktentwicklungen oder Produktmodifikationen freiwillig und ohne erkennbare<br />
Gegenleistung der Öffentlichkeit preisgeben oder einem herstellenden Unternehmen<br />
überlassen. In bestimmten Situationen kann sich auch noch nach dieser<br />
Entwicklerleistung eine Zusammenarbeit mit einem Hersteller für den Kunden als vorteilhaft<br />
erweisen, so dass Kunden die interaktive Wertschöpfung sogar initiieren<br />
(Harhoff / Henkel / von Hippel 2003). Das Modell der “Commons-based Peer<br />
Production”, das der Yale-Professor Yochai Benkler (2002) zur Beschreibung der<br />
Produktionsprinzipien der Open-Source-Software-Entwicklung (auch eine<br />
Kundeninnovation) gebildet hat, ist eine wichtige Grundlage zur Bildung von<br />
Organisationsregeln, wie sich die daraus folgende Arbeitsteilung zwischen<br />
Herstellerunternehmen und Kunden koordinieren lässt.<br />
Ziel und Aufbau dieses Buchs<br />
Unsere Vorstellung der interaktiven Wertschöpfung, die wir im folgenden Kapitel<br />
noch ausführlich konkretisieren, betont dagegen die aktive Kooperation und<br />
Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Kunden bzw. Nutzern. Wir bleiben aber in<br />
der Gedankenwelt von von Hippels, wenn wir im Gegensatz zu den zuvor genannten<br />
klassischen Autoren einer Kundenintegration vor allem auf Innovation und die<br />
6
Entwicklung neuer Leistungen fokussieren. Uns geht es um die Einbeziehung der<br />
Kunden in die Wertschöpfung im Rahmen der Schaffung neuer Lösungsräume oder<br />
zumindest der kreativen Nutzung offener vorhandener Potenziale.<br />
Das vorliegende Buch soll aufzeigen,<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
welche Entwicklungen und Trends zu einer zunehmenden Relevanz und<br />
Verbreitung der interaktiven Wertschöpfung geführt haben,<br />
welche Vorteile sich aus der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden<br />
gegenüber der unternehmenszentrierten Wertschöpfung ergeben und<br />
welche neuen Konzepte, Methoden und Instrumente geeignet sind, um die mit der<br />
Interaktion verbundenen wechselseitigen Kommunikations-, Abhängigkeits- und<br />
Austauschbeziehungen zu organisieren und zu gestalten.<br />
Im Teil 2 des Buches werden Modelle der arbeitsteiligen Wertschöpfungsorganisation<br />
in ihrer Entwicklung hin zur interaktiven Wertschöpfung dargestellt. Wir wollen zeigen,<br />
wie sich aus der klassischen industriellen Vorstellung der Wertschöpfung (die<br />
aber immer noch das Denken vieler Manager und Wissenschaftler prägt) in einem evolutionären<br />
Prozess ein neues Wertschöpfungsmodell bildet. Dabei nehmen wir Bezug<br />
auf die zugrunde liegenden Leitziele, Trends und Theorien. Ausgangspunkt der<br />
Darstellung ist die klassische industrielle Massenproduktion auf Basis tayloristischer<br />
Prinzipien der Arbeitsgestaltung und hierarchischer Organisationsstrukturen<br />
(Abschnitt 2.2). Dieses konventionelle Wertschöpfungsmodell orientiert sich streng an<br />
den Zielen der “Produktivität” und der “Kostenwirtschaftlichkeit” in der Produktion.<br />
Dieses Ziel wird primär durch eine maximale Ausnutzung von Skaleneffekten und<br />
eine Zerlegung des Wertschöpfungsprozesses in kleinste Einheiten zu realisieren versucht.<br />
Dabei ist man auf stabile Rahmenbedingungen und langfristig prognostizierbare<br />
Absatzmärkte angewiesen.<br />
Diese Vorstellung ist aber heute überholt, wie Abschnitt 2.3 zeigt. Heute sind oft die<br />
Abflachung und die Auflösung hierarchischer Unternehmensstrukturen zugunsten<br />
von Netzwerkorganisationen und einer Abwicklung auf Märkten zu beobachten. Diese<br />
Entwicklung trägt den gewandelten Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte<br />
Rechnung. Neben der Verfügbarkeit immer besserer Informations- und<br />
Produktionstechnologien sorgt der Wertewandel in Arbeitswelt und Gesellschaft für<br />
einen steigenden Wettbewerbsdruck auf Unternehmen. Immer häufiger ist der Wandel<br />
von Verkäufer- zu Käufermärkten zu beobachten, in denen Kundenwünsche<br />
anspruchsvoller und Produktlebenszyklen kürzer werden. Unter diesen Bedingungen<br />
wird die industrielle Wertschöpfung einer auf Skaleneffekten basierenden<br />
Massenproduktion zunehmend durch eine marktgetriebene Entwicklung und<br />
Produktion auf Kundenbestellung abgelöst. Die betriebswirtschaftlichen Ziele<br />
“Qualität”, “Zeit” und vor allem “Flexibilität” erhalten aus wettbewerbsstrategischer<br />
Sicht eine grundsätzliche Neubewertung und treten als gleichwertige Ziele neben<br />
“Produktivität” und “Kostenwirtschaftlichkeit”.<br />
Jedoch ist auch dieses Leitbild einer vernetzten Wirtschaft nur eine Zwischenstufe zur<br />
interaktiven Wertschöpfung, die wir in Abschnitt 2.4 mit ihren grundlegenden<br />
7<br />
1
1<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Prinzipien und Eigenschaften vorstellen. Die Relevanz dieses Modells ist nicht zuletzt<br />
auf die Verbreitung des Internets und die gestiegene Markttransparenz zurückzuführen,<br />
wodurch die Notwendigkeit der Wettbewerbsdifferenzierung für Unternehmen<br />
und die Marktmacht der Kunden weiter gestiegen ist. Dies treibt die<br />
Individualisierung der Kundenbedürfnisse weiter voran. Hersteller sind nun gezwungen,<br />
zum einen sehr heterogene Kundenbedürfnisse auf Segment- oder sogar auf<br />
Einzelkundenebene zu berücksichtigen. Zum anderen müssen Hersteller im<br />
Wettbewerb kontinuierlich Produkte mit hohem Neuigkeitsgrad entwickeln, die aber<br />
wiederum mit einem hohen Marktakzeptanz- bzw. Floprisiko verbunden sind. In der<br />
Konsequenz treten “Innovativität” und der “Wissenstransfer” mit Marktpartnern als<br />
Leitziele der Unternehmensführung in den Vordergrund.<br />
Klassische Marktforschung reicht in diesem Wettbewerbsumfeld meist nicht aus, um<br />
ausreichend Information über die vielfältigen und neuartigen Kundenwünsche zu<br />
sammeln und mithin das Marktakzeptanzrisiko neuer Produkte zu senken. Klassische<br />
Marktforschung ist häufig auf “durchschnittliche” Kundenpräferenzen oder die<br />
Zufriedenheit mit einem Standardprodukt gerichtet und trägt deshalb der<br />
Heterogenität der Kundenwünsche nicht Rechnung. Mit dem Bild des Kunden als passivem<br />
Rezipienten neuer Produkte setzt sie oft erst kurz vor oder gar nach der<br />
Kaufentscheidung an und dehnt die Informationsgenerierung nicht auf frühere Phasen<br />
der Produktentwicklung aus.<br />
Auch neuere Organisationsformen wie Unternehmensnetzwerke implizieren zwar<br />
häufig eine gewisse Öffnung des einzelnen Unternehmens gegenüber externen<br />
Informationsquellen. So sind in zahlreichen Branchen der Investitionsgüterindustrie<br />
vertraglich geregelte Kooperationen zwischen Partnern, die komplexe Produkte<br />
gemeinsam entwickeln, weit verbreitet. Diese stärker institutionalisierten<br />
Netzwerkformen lassen aber das stark verteilte Potenzial individueller Wissensträger,<br />
insbesondere von Anwendern und Endabnehmern der jeweiligen Produkte, als aktive<br />
Teilhaber an der Wertschöpfung meist unberücksichtigt.<br />
Zwei grundlegende Formen der interaktiven Wertschöpfung: Open Innovation und<br />
Mass Customization<br />
Abschnitt 2.4 zeigt, dass die interaktive Wertschöpfung den Transfer von implizitem<br />
Wissen der Kunden zu Unternehmen durch das Prinzip der Kundenintegration realisiert.<br />
Das bedeutet, dass Kunden sich in die vormals autonomen Wertschöpfungsaktivitäten<br />
des Unternehmens einbringen und diese teilweise selbst ausführen, um so<br />
ihr Wissen zu artikulieren und zu explizieren. Diese Interaktion resultiert in einer<br />
neuen Form der Austausch- und Abhängigkeitsbeziehung zwischen Kunden und<br />
Unternehmen. Mit dem Internet bestehen für Unternehmen neue Möglichkeiten des<br />
kostengünstigen und informelleren Wissensaustauschs mit Individuen und der aktiven<br />
Beteiligung vormals anonymer Kunden an der Wertschöpfung. Im Hinblick auf<br />
eine funktionsfähige Gestaltung dieser Beziehung gehen wir dabei auch auf die notwendigen<br />
organisatorischen und strategischen Rahmenbedingungen ein, die für beide<br />
Interaktionspartner gleichermaßen Nutzen stiften.<br />
In den weiteren Hauptteilen dieses Buches werden wir dann zwei grundlegende<br />
Formen der interaktiven Wertschöpfung unterscheiden und näher diskutieren, die<br />
8
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Unternehmen als unterschiedliche strategische Stoßrichtungen verfolgen können. Je<br />
nach Ausmaß und Phase des Wertschöpfungsprozesses, in der die Kundenintegration<br />
stattfindet, sprechen wir von<br />
Open Innovation: die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden, die<br />
sich auf Wertschöpfungsaktivitäten im Innovationsprozess bezieht und auf die<br />
Entwicklung neuer Produkte für einen größeren Abnehmerkreis abzielt.<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization: die Zusammenarbeit zwischen<br />
Unternehmen und Kunden, die sich auf Wertschöpfungsaktivitäten im operativen<br />
Produktionsprozess bezieht und auf die Entwicklung eines individualisierten<br />
Produktes für einen Abnehmer abzielt.<br />
Während die praktische Umsetzung von Open Innovation in vielen Unternehmen<br />
erst ganz am Anfang steht und deshalb hier nur eine recht geringe empirische Basis<br />
zur Ableitung von “promising practices” und Strukturen einer erfolgreichen<br />
Umsetzung besteht, ist die Umsetzung von Mass Customization deutlich weiter fortgeschritten.<br />
Die Analyse von Mass Customization kann deshalb auch wichtige<br />
Anhaltspunkte für eine Gestaltung der Interaktionsprozesse und Instrumente für<br />
Open Innovation geben.<br />
Die detaillierte Darstellung von Open Innovation erfolgt in Teil 3 des Buches, die der<br />
Produktindividualisierung bzw. Mass Customization in Teil 4. Hier werden die beiden<br />
Formen der interaktiven Wertschöpfung mit ihren vielseitigen Facetten auf instrumenteller<br />
und operativer Ebene im Hinblick auf eine Umsetzung in Unternehmen weiter<br />
konkretisiert. In beiden Teilen geht es vor allem auch um eine ausführliche Diskussion<br />
des Nutzens und der Kosten interaktiver Wertschöpfung für den Kunden und für den<br />
Hersteller. Das Verständnis der Treiber und Hürden der interaktiven Wertschöpfung<br />
ist zum einen Ausgangspunkt einer Beurteilung, ob und wann das Modell der interaktiven<br />
Wertschöpfung klassischen Wertschöpfungsmodellen überlegen ist. Zum anderen<br />
bildet es den Ansatzpunkt für eine “Ökonomie der interaktiven Wertschöpfung”<br />
mit neuen Formen der Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Kunden als<br />
Wertschöpfungspartnern.<br />
Interaktive Wertschöpfung als neues Prinzip zur Organisation der Arbeitsteilung<br />
Ist das neu? Kunden wurden im Rahmen von Selbstbedienungsaktivitäten immer<br />
schon in die Wertschöpfung eines Herstellers integriert. Jedoch geht die Integration des<br />
Kunden heute viel weiter und ist nicht nur ein weiteres Mittel zur Steigerung der internen<br />
operationalen Effizienz des Herstellers, sondern wird vielmehr zentrales Mittel<br />
zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen. Dies verlangt einen radikalen Wechsel der<br />
Sichtweise und ein Überdenken der konventionellen Prinzipien erfolgreicher<br />
Wertschöpfung: Ein Unternehmen wechselt von einem intern fokussierten zu einem<br />
offenen Modus von Wertschöpfung, der alle Aktivitäten umfasst (Bendapudi / Leone<br />
2003: 14; Grün / Brunner 2002: 148). Auch wenn die Entwicklung von einfachen Selbstbedienungsformaten<br />
zu weit gehenden Formen der Kundenintegration ein gradueller<br />
und evolutionärer Prozess ist, so bedeutet er doch von Unternehmern ein radikales<br />
Umdenken. Die “neue” Kundenintegration, um die es in diesem Buch gehen soll, ist<br />
gekennzeichnet durch den Einbezug von Kunden und Nutzern in Bereiche und<br />
9<br />
1
1<br />
Die aktive Rolle von Kunden in der Wertschöpfung<br />
Aktivitäten, die zuvor als interne und zentrale Domäne des Herstellers angesehen wurden<br />
(<strong>Piller</strong> 2004; Wikström 1996a).<br />
Dieser Ausdruck soll Kundenintegration als dynamischen Prozess definieren, sowohl<br />
aus Sicht des Kunden als auch des Herstellers. Durch die Integration der Kunden in die<br />
Wertschöpfung resultieren innovative Prozessstrukturen, die die konventionelle<br />
Vorstellung von Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Abnehmern aufheben. Dies<br />
verlangt in der Folge aber auch eine Redefinition der Kernkompetenzen des<br />
Unternehmens und neue Formen der Organisation und Koordination. Die Neuigkeit<br />
der interaktiven Wertschöpfung wird damit vor allem durch die subjektive Neuigkeit<br />
für das Unternehmen definiert (Rogers 1995: 11): Auch wenn einzelne Prinzipien der<br />
interaktiven Wertschöpfung aus Sicht der ökonomischen Literatur nicht neu sind, so ist<br />
doch ihre Erkenntnis und ganzheitliche Umsetzung für die meisten Unternehmen<br />
heute noch sehr neu. Für diese Firmen erfährt das Wissen um die optimale Lösung des<br />
Koordinations- und Wirtschaftlichkeitsproblems einen radikalen Wandel.<br />
10
2 Organisation der arbeitsteiligen<br />
Wertschöpfung: Entwicklungen<br />
und Trends auf dem Weg zur<br />
interaktiven Wertschöpfung<br />
2.1 Eine Übersicht der Evolution von Wert und<br />
Wertschöpfung<br />
‘Wert’ und ‘Wertschöpfung’ sind einige der am meisten verwendeten Begriffe in der<br />
Managementliteratur (siehe Ramirez 1999 zur Denotation des Wertbegriffs). Das primäre<br />
Ziel ökonomischer Aktivität ist, Wert zu schaffen. Wert wird produziert, indem<br />
Menschen mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Wissen und weiteren Ressourcen<br />
handeln (Normann / Ramirez 1998: 49). Wertschöpfung kann als die Nutzung dieses<br />
Wissens in einer arbeitsteiligen Organisation angesehen werden, als die Gesamtheit<br />
der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen und Organisationen zur Lösung des<br />
Wirtschaftlichkeitsproblems einsetzen: das Wissen über den Markt, über die<br />
Organisation von Wertschöpfungsprozessen und über die Führung von Menschen in<br />
einer von Güterknappheit gekennzeichneten Wirtschaft. Einen Indikator für den<br />
“Wert” dieser Aktivitäten bildet der Preis einer Leistung. Dieser Preis drückt die<br />
Differenz zwischen den Aktivitäten der herstellenden Akteure und den Aktivitäten<br />
(bzw. der Zahlungsbereitschaft) der Abnehmer aus. Über den Kauf gewinnt Letzterer<br />
Zugang (oder Eigentum) zu dem Ergebnis der Aktivitäten der Herstellerorganisation.<br />
Ökonomische Transaktionen können also generell als Austausch von Aktivitäten oder<br />
Ressourcen gesehen werden, die einen Preis haben.<br />
Taylor und die wissenschaftliche Betriebsführung<br />
Die heute dominierende Vorstellung, wie Unternehmen Werte schaffen, kann auf Prinzipien<br />
zurückgeführt werden, die vor 100 Jahren in der aufkommenden Industriegesellschaft<br />
entwickelt wurden. Vor allem Frederick Taylors Ansatz des “Scientific<br />
Management” legte mit seinem Fokus auf die Senkung von Produktionskosten die<br />
Basis für alle folgenden Debatten (Wolf 2003). Rationalprinzip, Güterknappheit und<br />
das Allokationsproblem kennzeichnen die betriebswirtschaftliche Problemstellung von<br />
Organisation, Arbeitsteilung und Koordination der Wertschöpfung in Taylors Modell<br />
(Gutenberg 1951; Kosiol 1959). Im deutschsprachigen Raum entwickelte sich auf Basis<br />
dieser Prinzipien die betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, die das Fach bis in<br />
die 1980er Jahre maßgeblich geprägt hat (Heinen 1968, 1982). In deren Modell setzen<br />
Entscheidungen über die zielorientierte Durchführung von Wertschöpfungsprozessen<br />
auf den Gegebenheiten der betrieblichen Produktionsfaktoren an: Betriebsmittel,<br />
11
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Werkstoffe und Arbeit. Da die betrieblichen Produktionsfaktoren knappe Güter sind<br />
und einen Marktpreis haben, zielt die betriebliche Entscheidungsfindung nach dem<br />
Rationalprinzip darauf ab, die knappen Güter in ihre optimale Verwendungsrichtung<br />
zu lenken, dies wird als das betriebliche Allokationsproblem bezeichnet (Heinen 1959,<br />
1983). Wir werden diese Prinzipien in Abschnitt 2.2 dieses Kapitels näher betrachten.<br />
Wertkettendenken und interorganisationale Netzwerke<br />
Porters (1985) Modell einer Wertschöpfungskette präsentierte der Managementlehre<br />
einen integrierten Ansatz, wie sie den Wertschöpfungsprozess von der Entwicklung<br />
über Produktion und Vertrieb bis hin zur Auslieferung von Gütern und Leistungen mit<br />
Hilfe des Produktionsfaktors Information organisieren und steuern können. Anfang<br />
der 1990er Jahre wurde durch Hammer und Champy (1993) mit der Idee des Business<br />
Process Reengineering ein vertiefender und in der Wirtschaft begeistert aufgenommener<br />
Ansatz vorgestellt, wie durch Kostenreduktion und eine Fokussierung auf die<br />
interne Effizienz in einem Unternehmen Wert geschaffen werden kann (d. h. die<br />
Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft und den gesamten Herstellungskosten<br />
ausgeweitet wird). Diese interne Sichtweise wurde später um das Bild eines grenzenlosen<br />
(oder gar virtuellen) Unternehmens erweitert, in dem ein eng verbundenes Netzwerk<br />
professioneller Akteure eine abgestimmte und friktionslose Wertschöpfungskette<br />
schafft, die viele Organisationen umfasst (Picot / <strong>Reichwald</strong> 1994; Sydow 1992,<br />
<strong>Reichwald</strong> et. al 2000).<br />
Die Zulieferer (und Zulieferer der Zulieferer) wurden in die Suche nach neuen Wertschöpfungsarrangements<br />
einbezogen, wie wir in Abschnitt 2.3 noch vertiefend sehen<br />
werden. Mit dem Aufkommen des Internets und den daraus folgenden Potenzialen<br />
zur Senkung von Transaktionskosten wurde eine neue Dimension der organisatorischen<br />
Effizienz eingeläutet (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003), indem nun auch die<br />
Aktivitäten an der Schnittstelle zwischen einem Hersteller(netzwerk) und den<br />
Abnehmern in den Fokus der Effizienzbetrachtung einbezogen werden. Entlang aller<br />
Stufen dieser Evolution steht dennoch stets die Annahme, dass das Streben nach<br />
interner Kosteneffizienz (d. h. die Steigerung der Differenz zwischen dem möglichen<br />
Preis und den Kosten der Erstellung einer Leistung) die Quelle betrieblicher Wertschöpfung<br />
ist. Diese Prämisse wird nicht in Frage gestellt (Prahalad / Ramaswamy<br />
2002: 52).<br />
Interaktive Wertschöpfung<br />
Doch Kunden und Nutzer honorieren in der Regel nicht die interne operative Effizienz<br />
eines Anbieters. Sie mögen zwar günstige Preise als Resultat dieser Effizienz,<br />
doch hat sich stets gezeigt, dass das Streben nach immer weiterer operativer Effizienz<br />
innerhalb eines Netzwerks keine Quelle nachhaltiger Wettbewerbsvorteile ist (Porter<br />
1996). Operative Effizienz ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für<br />
dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Vielmehr zeigt sich heute, dass vor allem die Gestaltung<br />
der Schnittstellen und der Aktivitäten an der Peripherie eines Unternehmens zu<br />
Marktpartnern wesentliche Ansatzpunkte für die Schaffung von Wert bildet. Damit<br />
tritt der Akteur in den Mittelpunkt der Betrachtung, der bislang in der Debatte um die<br />
Gestaltung der Wertschöpfung weitgehend ausgeblendet war: der Kunde.<br />
12
Evolution von Wert und Wertschöpfung<br />
Wir sehen heute, dass Kunden das Ergebnis betrieblicher Wertschöpfung nicht nur<br />
konsumieren, sondern selbst einen wesentlichen Beitrag bei der Schaffung von Wert<br />
leisten (Ramirez 1999). Dies geschieht dabei nicht nur autonom in der Kundendomäne<br />
(ein Bereich, der in der Mikroökonomie schon lange im Zusammenhang mit<br />
Konsumentenproduktion untersucht wurde, siehe z. B. Becker 1965; Haverty 1987;<br />
Lancaster 1966; Ratchford 2001; Stigler / Becker 1977), sondern auch in einem interaktiven<br />
und kooperativen Prozess mit Herstellern und anderen Nutzern einer Leistung.<br />
Kunden und Nutzer tragen dazu bei, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen<br />
eines Herstellers zu erweitern (Gibbert / Leibold / Probst 2002). Die Kunden werden als<br />
strategischer und wichtiger Faktor in die Aktivitäten integriert, die in einem erweiterten<br />
Wertschöpfungsnetzwerk Wert schaffen. Die Wahrnehmung dieses Wertes umfasst<br />
dabei weit mehr als die Erhöhung der Differenz zwischen Zahlungsbereitschaft und<br />
interner Effizienz. Haupttreiber dieses Wandels sind die neuen Technologien, insbesondere<br />
die Informations- und Kommunikationstechnologien, die die betrieblichen<br />
und überbetrieblichen Wertschöpfungsprozesse vollständig verändert haben<br />
(Abbildung 2–1).<br />
Abbildung 2–1: Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Internationalisierung des<br />
Wettbewerbs<br />
Steigende<br />
Innovationsdynamik und<br />
Marktsunsicherheit<br />
Wertewandel und Trend<br />
zur Individualisierung und<br />
des Kunden<br />
Entwicklung neuer Informations- & Kommunikationstechnologien als Enabler<br />
Hierarchische Organisation<br />
Taylorismus<br />
Herausforderungen für Unternehmen<br />
Produktivität Flexibilität Innovativität<br />
Netzwerkorganisation<br />
Marktorientierung<br />
Interaktive<br />
Wertschöpfung<br />
Kundenintegration<br />
Entwicklung unternehmerischer Wertschöpfungskonzepte und Leitbilder<br />
Von Hierarchie und Markt zur “Commons-based Peer-Production”<br />
Entlang dieser Evolution der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung ändert sich<br />
aber nicht nur die Sichtweise, welche Akteure am Wertschöpfungsprozess aktiv betei-<br />
13<br />
2.1
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
ligt sind (vom internen Fokus bei Taylor über Netzwerke mit festen Partnern bis zur<br />
Interaktion mit den Kunden bzw. Nutzern), sondern auch die Vorstellung, wie das<br />
Organisationsproblem, d. h. die Koordination und Motivation der einzelnen Akteure,<br />
die die Gesamtaufgabe arbeitsteilig vollziehen, am besten gelöst werden kann. Taylors<br />
Modell setzt vor allem auf die hierarchische Koordination und Motivation durch finanzielle<br />
Anreize in einem geschlossenen Wertschöpfungssystem. Die Netzwerkansätze<br />
erweitern diese Vorstellung um eine Kombination marktlicher und hierarchischer<br />
Koordinationsformen und betonen darüber hinaus auch eine Motivation durch nichtmonetäre<br />
Anreize. Die interaktive Wertschöpfung ergänzt diese beiden klassischen<br />
Koordinationsformen (Hierarchie und Markt) durch einen dritten Weg: die<br />
Selbstselektion und Selbstorganisation von Aufgaben durch (hoch) spezialisierte<br />
Akteure, deren Motivation vor allem die (eigene) Nutzung der kooperativ geschaffenen<br />
Leistungen ist, die jedoch durch eine Vielzahl weiterer sozialer, intrinsischer und<br />
extrinsischer Motive ergänzt werden kann. Dieses Organisationsprinzip einer<br />
“Commons-based Peer-Production” verlangt eigene Kompetenzen und Prinzipien der<br />
Organisation der Wertschöpfung.<br />
Die Entwicklung der sich ändernden Vorstellung der optimalen Organisation der<br />
betrieblichen Wertschöpfung kann so zusammenfassend in drei Leitmodellen aufgezeigt<br />
werden, die jeweils Folge verschiedener technischer und gesellschaftlicher Trends<br />
sind. Sie werden im Folgenden in ihren unterschiedlichen Ausrichtungen und<br />
Organisationsformen der Arbeitsteilung sowie in ihren unterschiedlichen Beziehungen<br />
zu Märkten und Marktpartnern vorgestellt:<br />
Wertschöpfung in der hierarchischen Industrieorganisation mit tayloristischer<br />
Arbeitsteilung (Abschnitt 2.2);<br />
Auflösung der Unternehmensgrenzen und Wertschöpfung in überbetrieblichen<br />
Netzwerkorganisationen aus Basis einer marktlichen Koordination (Abschnitt 2.3),<br />
Interaktive Wertschöpfung unter Integration der Kunden in einen kooperativen<br />
Wertschöpfungsprozess (Abschnitt 2.4).<br />
2.2 Die tayloristische Industrieproduktion:<br />
hierarchische Organisation der Arbeitsteilung<br />
2.2.1 Tayloristische Prinzipien der wissenschaftlichen<br />
Betriebsführung: Produktivitätsoptimierung unter<br />
stabilen Bedingungen<br />
Das Handeln vieler Unternehmen ist häufig noch durch traditionelles Erfahrungswissen<br />
der industriellen Organisation geprägt. Das Erfahrungswissen der industriellen<br />
Arbeitsorganisation basiert primär auf den Leitsätzen des “Scientific Management”,<br />
also der “wissenschaftlichen Betriebsführung”, die insbesondere auf das Werk von<br />
F.W. Taylor (1913) zurückgehen. Ihre Anwendung führten nicht nur vor knapp 100<br />
14
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
Jahren zum Aufstieg des Unternehmers Ford zu einem der weltgrößten Industriellen<br />
(siehe Kasten 2–1), sondern diese Leitsätze beeinflussen auch heute noch Struktur und<br />
Prozess von Unternehmen, Produktivität und Wertschöpfung der Leistungserstellung,<br />
aber auch die Entwicklung des klassischen betriebswirtschaftlichen Instrumentariums<br />
der Führungs-, Anreiz- und Kontrollsysteme.<br />
Kasten 2–1: Henry Ford und das “Modell T”<br />
(Quellen: Barnet / Cavanagh 1984; Ford 1923; Lacey 1987)<br />
Frederick Winslow Taylor hatte seinen ersten Artikel zur Verbesserung der Arbeitsabläufe für die<br />
American Society of Mechanical Engineers schon acht Jahre zuvor geschrieben, als Henry Ford<br />
1903 mit der Produktion von Automobilen begann. Zu diesem Zeitpunkt war ein einziger<br />
Montagearbeiter für das gesamte Fahrzeug zuständig und benötigte durchschnittlich 12,5 Stunden<br />
(ca. 750 min.). Obwohl der Mechanisierungsgrad und die Produktivität in der Autoindustrie in den<br />
USA höher waren als bei den europäischen Firmen, reichte dies bald nicht mehr aus, um die steigende<br />
Nachfrage zu befriedigen. Dies galt vor allem für das von Henry Ford 1908 eingeführte<br />
“Modell T”. Nach fünf weiteren Jahren des ständigen Probierens und Suchens nach<br />
Verbesserungen fand Ford bis 1913 endlich den Schlüssel zur Steigerung der Produktivität.<br />
Indem er vergleichbare Ansätze des Scientific Management nach Taylor weiterentwickelte und<br />
umsetzte, konnte er die Produktivität massiv erhöhen. Ford standardisierte die Arbeitsprozesse<br />
und, bis dahin undenkbar, die Arbeitswerkzeuge. Bis zu diesem Zeitpunkt brachten die Arbeiter<br />
noch ihre eigenen Werkzeuge mit in die Montage und bestimmten weitgehend selbst die<br />
Arbeitsabläufe in der Fertigung. Von nun an war jeder Arbeiter für nur einen Arbeitsprozess zuständig<br />
und nutzte dazu standardisierte Werkzeuge, Vorteile der Spezialisierung und Arbeitsteilung, die<br />
Adam Smith bereits 1776 ausführlich beschrieben hatte. Dadurch fiel der durchschnittliche<br />
Arbeitszyklus eines Arbeiters an einem Fahrzeug, für das er nun nicht mehr gesamthaft verantwortlich<br />
war, von 514 Minuten auf 2,3 Minuten! Angesichts der sich zum Beispiel in der<br />
Endmontage wechselseitig behindernden Montagegruppen musste Ford nahezu zwangsläufig zur<br />
Fließbandfertigung übergehen. Mit der Einführung der Fließbandproduktion, dem so genannten<br />
“Fordismus”, reduzierte Ford den durchschnittlichen Zeitbedarf für einen Arbeitszyklus um weitere<br />
44 Sekunden, ein Produktivitätsfortschritt, der aber deutlich geringer ausfiel, als die Möglichkeiten<br />
infolge der Standardisierung und Entkoppelung der Arbeitsschritte. “Anfang 1914 ... legten wir die<br />
Sammelbahn höher. Wir hatten inzwischen das Prinzip der aufrechten Arbeitsstellung eingeführt ...<br />
Das Heraufrücken der Arbeitsebene in Armhöhe und eine weitere Aufteilung der<br />
Arbeitsvorrichtungen ... reduzierte die Arbeitszeit auf eine Stunde 33 Minuten pro Chassis” (Ford<br />
1923: 95).<br />
1914, also im ersten Jahr nach der Einführung der Fließbandfertigung wurde die Fertigung von<br />
Ford-T-Modellen um 152 % auf 308.162 Wagen gesteigert. In den 20er Jahren wurden mehr als<br />
eine Million Wagen im Jahr gefertigt. Als die Produktion des T-Modells im Mai 1927 nach 19 Jahren<br />
eingestellt wurde, hatte Ford 15.007.033 Wagen dieses Typs produziert. Erst der VW-Käfer sollte<br />
1972 diesen Rekord übertreffen.<br />
Wesentliche Merkmale einer tayloristischen Industrieorganisation sind die funktionale<br />
Arbeitsteilung in der Aufbauorganisation und der mit den Methoden der Arbeitsanalyse<br />
systematisch entwickelte “One best way” der Ablauforganisation (Abbildung<br />
15<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
2–2). In der Denkwelt des tayloristischen Ansatzes kann das komplexe Problem der<br />
Koordination der betrieblichen Leistungserstellung für eine gegebene Ausstattung und<br />
Anordnung von Produktionsfaktoren durch folgende Gestaltungsprinzipien “optimal”<br />
gelöst werden (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003):<br />
Konzentration der Arbeitsmethodik auf eine weitestgehende Arbeitszerlegung;<br />
personelle Trennung von dispositiver und ausführender Arbeit;<br />
räumliche Ausgliederung aller planenden, steuernden und kontrollierenden<br />
Aufgaben aus dem Bereich der Fertigung.<br />
Auf diese Weise konnte das komplexe Koordinationsproblem zwar “optimal” über die<br />
Ausstattung und Anordnung der Produktionsfaktoren gelöst werden, jedoch wurde<br />
der Mensch lediglich als ein funktionsfähiger Produktionsfaktor betrachtet, der als<br />
Befehlsempfänger und -umsetzer in den Fertigungsprozess integriert wurde. Die<br />
Kommunikationsbeziehungen folgten den hierarchischen Strukturen. Es entstand eine<br />
streng formalisierte, durch feste Regeln vorgeschriebene Kommunikation über die<br />
Hierarchiestufen, der so genannte Dienstweg. Das Kommunikationsverhalten zwischen<br />
Vorgesetzten und Untergebenen war vom Rollenverständnis des Vorgesetzten<br />
als Befehlsgeber und des Untergebenen als Befehlsempfänger geprägt.<br />
Abbildung 2–2: Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung nach Taylor (entnommen<br />
aus Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003)<br />
Produktion als<br />
Kombinationsprozess:<br />
Arbeit<br />
Betriebsmittel<br />
Werkstoffe<br />
Drehen Fräsen Bohren<br />
16<br />
Ausgliederung<br />
von:<br />
Planung<br />
Steuerung<br />
Kontrolle<br />
dispositive Arbeit<br />
objektbezogene Arbeit<br />
verrichtungsorientierte<br />
Arbeitszerlegung<br />
Hohnen<br />
Ziel:<br />
Produktivitätsoptimierung<br />
geprüft<br />
Qualitätskontrolle<br />
Prinzipien wissenschaftlicher<br />
Betriebsführung:<br />
• Trennung von Handund<br />
Kopfarbeit<br />
• Methoden der<br />
Arbeitszerlegung und<br />
Ablaufoptimierung<br />
(Arbeitsstudium)<br />
• Leistungsgerechte<br />
Entlohnung -> Stückund<br />
Akkordlohn<br />
• Fließprinzip zur Lösung d.<br />
Koordinationsproblems<br />
• Methoden der Planung,<br />
Steuerung und Kontrolle
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betriebsführung steht nicht der Mensch, sondern<br />
Strategien zur Rationalisierung der Güterproduktion. Industrielle Rationalisierungsstrategien<br />
konzentrierten sich vor allem auf die Produktion von Massengütern in<br />
Großunternehmen, die durch eine konsequente vertikale Integration der Wertschöpfungskette<br />
und eine zunehmende horizontale Divisionalisierung verschiedener<br />
Produktbereiche entstanden. Die Entwicklung leistungsfähiger Produktions- und<br />
Distributionssysteme sowie Investitionen in Managementfunktionen ermöglichten<br />
eine stetige Ausweitung der Massenproduktion bei hochgradiger Arbeitsteilung.<br />
Dadurch konnten umfangreiche kostenmäßige Größenvorteile ausgenutzt werden;<br />
nämlich Skaleneffekte (“economies of scale”) und Verbundeffekte (“economies of<br />
scope”), die vielfach zur Begründung der Vorteilhaftigkeit einer internen “administrativen”<br />
Koordination von Großunternehmen durch hierarchische Strukturen herangezogen<br />
werden (Chandler 1977, 1980, 1990; siehe auch Kasten 2–2 unten). Diese<br />
Managementprinzipien führten zu beachtlichen Erfolgen durch die systematische<br />
Gewinnung, Perfektionierung und Anwendung von Methoden zur Optimierung von<br />
Fertigungsprozessen. Große Erfolge wurden in der Vergangenheit aber nur dadurch<br />
erzielt, dass die langfristig stabilen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens adäquat<br />
abgebildet und in klare Prinzipien unternehmerischen Handelns übersetzt wurden<br />
(siehe die in Abbildung 2–3 genannten Prämissen). Solange diese Prämissen den tatsächlichen<br />
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entsprachen,<br />
sicherten die klassischen Prinzipien – Burkart Lutz nennt sie die “Principles of<br />
Common Wisdom” der industriellen Innovationsstrategie – Unternehmen zuverlässig<br />
auf ihrem Erfolgspfad ab. Heute aber haben sich viele dieser Rahmenbedingungen<br />
Abbildung 2–3: “Principles of Common Wisdom” - Rahmenbedingungen und Prinzipien der<br />
tayloristischen Industrieorganisation (entnommen aus Picot / <strong>Reichwald</strong> /<br />
Wigand 2003)<br />
Rahmenbedingungen:<br />
Absatzmärkte mit<br />
langfristig klar<br />
vorhersehbarer Dynamik<br />
Begrenzte Zahl von Wettbewerbern<br />
mit bekannten<br />
Stärken und Schwächen<br />
Niedrige Kosten<br />
natürlicher Ressourcen<br />
und geringe Umweltlasten<br />
für die Unter-nehmen<br />
Reichliche Verfügbarkeit<br />
von hochmotivierten,<br />
qualifizierten<br />
Arbeitskräften<br />
Prinzipien erfolgreicher<br />
Unternehmensführung:<br />
Maximale Durchplanung und Effektivierung aller<br />
betrieblichen Abläufe, vor allem in der<br />
Produktion<br />
klare arbeitsteilige Abgrenzung von Ressorts,<br />
fachlichen Zuständigkeiten und hierarchischen<br />
Verantwortlichkeiten<br />
eindeutige Präferenz für unternehmensinterne<br />
Lösungen<br />
maximale Nutzung des Serieneffekts (economies<br />
of scale)<br />
Marktbehauptung vor allem durch inkrementelle<br />
Produktinnovationen (schrittweise Verbesserung<br />
existierender Produkte)<br />
Primat von arbeitssparenden Investitionen und<br />
Innovationen<br />
17<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
gewandelt (siehe Abschnitt 2.2.3). Damit sind neue Prinzipien erforderlich. Doch fällt<br />
vielen Managern die Loslösung von den klassischen Prinzipien schwer, denn diese<br />
Grundsätze sind über Jahrzehnte gefestigt und liegen heute gewissermaßen “fest verdrahtet”<br />
vor, z. B. in der Aufgabendefinition und Zuständigkeitsabgrenzung von<br />
Managementressorts, in der Definition von Ausbildungsinhalten, Qualifikationen und<br />
Mitarbeiterkompetenzen, in Auswahl und Aufbau betrieblicher Informationssysteme<br />
sowie im Zuschnitt der Außenbeziehungen von Unternehmen. Wir wollen im folgenden<br />
Abschnitt die wichtigsten Grundlagen dieser klassischen Prinzipien kurz betrachten<br />
(siehe dazu ausführlicher z. B. Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003; Wayland / Cole<br />
1997; Wolf 2003).<br />
2.2.2 Gesetze der Produktivität und<br />
Kostenwirtschaftlichkeit<br />
Die Prinzipien der klassischen Industrieorganisation basieren auf den Erkenntnissen<br />
der Produktionswirtschaft, fokussiert auf die Produktion homogener Güter in großen<br />
Stückzahlen. Fragen der Produktivität und der Kostenwirtschaftlichkeit stehen im<br />
Zentrum der Betrachtung. In der Betriebswirtschaftslehre dominiert das Produktionsmodell,<br />
das Erich Gutenberg (1951) in seinem Buch “Die Produktion” beschrieben<br />
hat. Dieses Produktionsmodell bildet das betriebswirtschaftliche Geschehen als<br />
Kombinationsprozess der betrieblichen Faktoren Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe<br />
ab. Die zentrale Aufgabe der Unternehmensleitung (des “dispositiven Faktors”)<br />
besteht darin, durch Organisation und Planung die Produktivität zu optimieren. Der<br />
eher technische Begriff der Produktivität, d. h. das Verhältnis von Ausbringung zum<br />
Faktoreinsatz, entspricht aus betriebswirtschaftlicher Sicht der Bewertung von<br />
Ausbringung und Faktoreinsatz mit Marktpreisen. In der klassischen Theorie der<br />
Unternehmung bilden Produktivität und Kostenwirtschaftlichkeit zentrale Betrachtungsgrößen.<br />
Dabei stehen Produktions- und Kostenbeziehungen im Zentrum der<br />
betriebswirtschaftlichen Analyse von Wertschöpfungsprozessen. Wissensbasis bildet<br />
die Produktions- und Kostentheorie (Heinen 1959; Busse von Colbe 1975; Wöhe<br />
1960).<br />
Die betriebswirtschaftliche Produktionstheorie erklärt die funktionalen Zusammenhänge<br />
zwischen der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren und der Menge<br />
der damit hergestellten Produkte (Beispiele bilden der Maschinenbau, Werkzeuge oder<br />
Automobile). Zur Lösung des Allokationsproblems in der Wertschöpfung benötigen<br />
Entscheidungsträger Kosteninformationen. In Kostenfunktionen werden die Verbrauchsmengen<br />
der betrieblichen Produktionsfaktoren bewertet, das Betrachtungsfeld<br />
der Kostentheorie. Die Kostentheorie erklärt die Zusammenhänge zwischen der<br />
betrieblichen Wertschöpfung (Ausbringungsmengen) und den Produktionskosten. Die<br />
Kostenanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil der Kostentheorie. Sie unterscheidet<br />
Gesamtkosten, Stückkosten, Grenzkosten und umfasst das Wissen über Kostenstrukturen<br />
und Kostenverläufe bei unterschiedlichen Ausbringungsmengen und<br />
Betriebsgrößenvariationen. Ausgewählte Produktions- und Kostenfunktionen nach<br />
18
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
dem Ertragsgesetz sind in Kasten 2–2 knapp erläutert. Auf Basis dieses Wissens sind<br />
im letzten Jahrhundert die Systeme der industriellen Produktionsplanung und -steuerung<br />
sowie die Systeme der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung entstanden,<br />
deren Prinzipien in der industriellen Praxis bis heute Anwendung finden. Hier sei auf<br />
die umfassende betriebswirtschaftliche Literatur der industriellen Produktionswirtschaft<br />
verwiesen (z. B. Corsten 2003; Heinen 1976, 1991; Schweitzer 1994;<br />
Schweitzer / Küpper 1997; Zahn / Schmid 1996; Zäpfel 1982). Die Ausrichtung an<br />
Produktivität und Kostenwirtschaftlichkeit als leitende Zielsetzungen orientiert sich an<br />
der Unternehmensstrategie der Kostenführerschaft und den Produktivitätseffekten<br />
von Betriebsgrößenvariationen, den so genannten “Economies of Scale” und<br />
“Economies of Scope” (siehe Kasten 2–2).<br />
Kasten 2–2: Wichtige Funktionen und Gesetzmäßigkeiten der klassischen<br />
Produktionstheorie<br />
(1) Produktions- und Kostenfunktionen nach dem Ertragsgesetz<br />
m<br />
0<br />
A<br />
Abbildung: Partielle Gesamtertragsfunktion<br />
Die in der ersten Abbildung dargestellte, typische partielle Gesamtertragsfunktion zeigt die<br />
Abhängigkeit der Menge produzierter Güter (m) vom Einsatz eines Produktionsfaktors (r ). Dabei<br />
1<br />
sei der Einsatz aller weiteren Produktionsfaktoren (r , …, r ), die zur Herstellung von m benötigt<br />
2 n<br />
werden, konstant. Die Ertragsfunktion steigt bei geringem Einsatz von r1 bis zum Punkt A überproportional<br />
an. Danach flacht die Funktion ab, bis sie im Punkt B ihr Maximum erreicht. Bei weiterem<br />
Einsatz von r beginnt die Ertragsfunktion schließlich zu fallen. Bei sehr geringem<br />
1<br />
Arbeitseinsatz herrscht, verglichen mit den anderen Produktionsfaktoren, relativer Mangel an<br />
Arbeit. Daher erhöht zusätzliche Arbeit die Effizienz der gesamten Produktion, die Funktion steigt<br />
überproportional an, die Grenzerträge steigen ebenfalls. Die höchste Effizienz des Faktoreinsatzes<br />
Arbeit ist am Punkt A, dem Wendepunkt der Ertragskurve, erreicht. Zwischen den Punkten A und<br />
B nimmt die Effizienz des Einsatzes von Arbeit ab, die Grenzerträge fallen. Daher flacht die<br />
Ertragskurve ab, bis sie in Punkt B ihr Maximum erreicht, an diesem Punkt ist der Grenzertrag des<br />
Einsatzes von Arbeit gleich Null. Jeder zusätzliche Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit führt zu<br />
einem sinkenden Gesamtertrag, der Grenzertrag ist dann negativ.<br />
B<br />
r 1<br />
19<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung: Klassische Kostenfunktionen<br />
Die zweite Abbildung stellt verschiedene Kostenfunktionen in Abhängigkeit von der erzeugten<br />
Güter- bzw. Dienstleistungsmenge m dar. Dabei sind Kf die Fixkosten der Produktion; sie sind im<br />
dargestellten Beispiel konstant. Die Gesamtkostenfunktion (K) ergibt sich als Summe der<br />
Fixkosten und der gesamten variablen Kosten der Produktion einer bestimmten Leistungsmenge<br />
m. Ihre Ableitung (K’) hat ein globales Minimum am Punkt A’. Der Anstieg der Gesamtkosten ist<br />
dort am niedrigsten. Weiterhin zeigt die Grafik die Funktion der variablen Stückkosten (kv ). Das<br />
globale Minimum dieser Funktion ist am Punkt C’; bei der entsprechenden Produktionsmenge<br />
sind die variablen Kosten pro Stück am geringsten. Im Punkt C’ schneiden sich außerdem die<br />
Funktionen kv und K’. Im Punkt C befände sich der kostenoptimale Produktionspunkt, wenn keine<br />
Fixkosten anfallen würden. Grafisch findet man diesen Punkt, indem man vom Schnittpunkt der<br />
Funktionen K und K aus eine Tangente an die Funktion K legt. Da in unserem Beispiel jedoch kon-<br />
f<br />
stante positive Fixkosten anfallen, verschiebt sich die kostenoptimale Produktion zum Punkt B;<br />
hier wird die Menge m* produziert. Bei dieser Produktionsmenge hat die Stückkostenfunktion (k)<br />
ihr Minimum und schneidet sich gleichzeitig mit K’ im Punkt B’. Den Punkt B findet man grafisch,<br />
indem man vom Ursprung des Koordinatensystems aus eine Tangente an K legt.<br />
(2) Skalen und Verbundeffekte<br />
Skaleneffekte bzw. “economies of scale” beruhen auf der Annahme, dass eine langfristige<br />
Ausdehnung der Produktionsmenge auch zu einer Ausweitung der Betriebsgröße führen wird. Die<br />
hieraus resultierenden Kostenvorteile beruhen auf (a) Kostendegressionseffekten, die sinkende<br />
Stückkosten in Abhängigkeit von einer (langfristigen) Änderung der Produktionsmenge aufgrund<br />
steigender Kapazitätsauslastung bzw. steigenden Kapazitätsgrößen beschreiben. Ersparnisse<br />
ergeben sich durch die Fertigung größerer Fertigungslose, da der Anteil der losfixen Kosten pro<br />
Outputeinheit abnimmt. Flexible Fertigungstechnologien lassen jedoch die Bedeutung dieses<br />
Punktes immer mehr abnehmen. (b) Spezialisierungsvorteile durch Arbeitsteilung, die sowohl beim<br />
Personal als auch bei Maschinen zu verwirklichen sind. Eine Erhöhung des Spezialisierungsgrads<br />
setzt aber meist eine höhere Produktionsmenge voraus. (c) Weiterhin können sich für größere<br />
Betriebe Kostenvorteile entsprechend der sog. “2/3-Regel der Anlageninvestition” ergeben: Investitions-,<br />
Betriebs- und Arbeitskosten steigen meist unterproportional mit steigender Anlagengröße.<br />
20<br />
K<br />
K f<br />
K‘<br />
k<br />
k v<br />
K f<br />
I II III IV<br />
A<br />
A‘<br />
0 m*<br />
m<br />
C<br />
C‘<br />
B<br />
B‘<br />
k v<br />
K<br />
K‘<br />
k<br />
K f
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
(d) Mit einer langfristig größeren Produktionsmenge können auch Beschaffungsvorteile verwirklicht<br />
werden. So sind die Zinsen für die Beschaffung größerer Kapitalmengen niedriger, auch stehen<br />
effizientere Formen des Kapitalmarktes nur für Großunternehmen offen. Ebenso können<br />
Mengenrabatte beim Materialeinkauf genutzt und effizientere Logistiksysteme aufgebaut werden.<br />
(e) In allen Bereichen beruhen auch Kostenvorteile durch Lern- und Erfahrungsvorsprünge auf<br />
einer langfristigen Ausdehnung des Outputs.<br />
Verbundeffekte bzw. “economies of scope” sind diejenigen Kostenvorteile, die sich für eine<br />
Unternehmung aus der Produktion und Distribution von mehr als einem Produkt ergeben. Sie<br />
basieren auf der gemeinsamen, jedoch nicht konkurrierenden Nutzung von Produktionsfaktoren<br />
jeder Art im Rahmen einer Mehrprodukt-Produktion, wenn bei einer Einprodukt-Produktion Anteile<br />
der Produktionsfaktoren ungenutzt bleiben würden. Sie beschreiben so die Vorteilhaftigkeit vertikaler<br />
oder horizontaler Diversifikation in einem Mehrproduktunternehmen. Eine derartig verbundene<br />
Produktion innerhalb eines Unternehmens ist immer dann vorteilhafter als die Produktion der<br />
gleichen Güter in zwei verschiedenen Unternehmen, wenn mit der gemeinsamen Nutzung von<br />
Ressourcen für unterschiedliche Produktions- und Distributionsprozesse zugleich eine<br />
Subadditivität der Kosten einhergeht. Alternativ werden Verbundeffekte oft auch als Synergien<br />
oder Komplementaritäten bezeichnet. Sie lassen sich generell über eine Nicht-Auslastung von<br />
Produktionsfaktoren und -ressourcen und die damit verbundenen Leerkosten erklären. Einerseits<br />
haben manche Produktionsfaktoren in einem Unternehmen den Charakter quasi-öffentlicher Güter<br />
und sind – nach ihrer einmaligen Anschaffung – mehr oder weniger frei verfügbar. Hierzu zählen<br />
bspw. die unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die für das<br />
Unternehmen versunkene Kosten darstellen. Die Nutzung der F&E-Ergebnisse für zusätzliche<br />
Aktivitäten dagegen birgt oft nur geringe Grenzkosten. Andererseits müssen manche<br />
Produktionsfaktoren aufgrund ihrer Unteilbarkeit oft in größeren Einheiten beschafft wurden, als<br />
sie für die aktuelle Produktion notwendig sind. Solche Inputs sind zum Beispiel EDV-Anlagen, der<br />
Fuhrpark, Fertigungshallen oder auch Humankapital. Aus den nicht genutzten Anteilen dieser<br />
Faktoren resultieren in allen Unternehmensbereichen Kosten (Leerkosten).<br />
Skalenvorteile und Verbundvorteile stehen in engem Zusammenhang. In beiden Fällen geht<br />
es letztlich darum, die Produktionsfaktoren und -ressourcen durch erhöhte Produktionsmengen<br />
besser auszulasten und deren Kapitalkosten zu decken. Jedoch basiert die Kostenreduktion bei<br />
Skaleneffekten auf der wiederholten Produktion identischer Güter, bei Verbundeffekten dagegen<br />
auf der Produktion verschiedener Güter, die aber ganz oder teilweise mit den gleichen<br />
Produktionsfaktoren hergestellt werden können. Die Quellen von Skalen- und Verbundeffekten<br />
ähneln sich folglich: (a) Ein spezialisierter Gebrauch von Maschinen führt bei homogenen<br />
Massengütern ebenso wie bei verbundenen heterogenen Gütern zu Effizienzvorteilen; (b) die<br />
Durchschnittskosten sinken bei Produktion einer weiteren Gütereinheit auf einer Maschine, die mit<br />
der Produktion der ersten Einheit nicht ausgelastet war; (c) es kommt sowohl bei homogenen<br />
Massen- wie auch bei heterogenen Verbundgütern zu einer Reduktion von Risiken durch<br />
Ausweitung der Produktion.<br />
2.2.3 Grenzen des Taylorismus: Heterogenisierung der<br />
Nachfrage und Empowerment aktiver Kunden<br />
Das Wissen um diese Prinzipien wissenschaftlicher Betriebsführung hat einen Typ der<br />
Wertschöpfungsorganisation hervorgebracht, der bis vor kurzem die Industrieproduktion<br />
geprägt hat. Die stabilen Verhältnisse auf den Märkten, die Langlebigkeit der<br />
Produkte und die hohe Produktivität gaben diesem Organisationstyp bis in die späten<br />
siebziger Jahre seine Rechtfertigung. Diese Effizienz und der Erfolg der wissenschaft-<br />
21<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
lichen Betriebsführung sind aber ganz wesentlich von stabilen und langfristig prognostizierbaren<br />
Marktbedingungen abhängig, die eine Produktion großer Mengen an<br />
homogenen Massengütern erlauben. Doch gibt es für solche Produkte immer weniger<br />
einen Markt. Wichtigste Ursache, warum die Anwendung der tayloristischen<br />
Prinzipien heute immer weniger effizienzsteigernd, sondern vielmehr oft genau<br />
gegenteilig wirkt, ist der Wandel der Absatzmärkte. Wir wollen in diesem Abschnitt<br />
mit der Heterogenisierung der Nachfrage und der wachsenden Nachfragemacht der<br />
Abnehmer einen zentralen Trend betrachten, der für unser Modell der interaktiven<br />
Wertschöpfung die wesentliche Grundlage bildet.<br />
“It is the customer who determines what a business is”, sagte Peter Drucker (1954: 37)<br />
in einem viel zitierten Ausspruch. Galt diese Aussage für viele Unternehmen bislang<br />
eher abstrakt, so wird sie heute immer mehr zur sprichwörtlichen Wahrheit. Viele<br />
Kunden fordern heute Produkte, die genau ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen.<br />
Zwar ist die Einsicht, dass Kundenwünsche nicht homogen, sondern heterogen und<br />
verschieden sind, nichts Neues und wurde mikroökonomisch schon lange modelliert<br />
(Chamberlin 1950, 1962). Schon in den 1970er Jahren sieht der amerikanische Futurist<br />
Daniel Bell in seiner berühmten Konzeption der postindustriellen Gesellschaft die<br />
“fateful question”, “weather the promise will be realized that instrumental technology<br />
will open the way to alternative modes of achieving individuality and variety within a<br />
vastly increased output of goods” (Bell 1980: 545). Doch erst die heutige Marktsättigung<br />
und der starke Wettbewerb haben dazu geführt, dass Kunden, unterstützt durch<br />
Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten durch das Internet, auch ihre Forderung<br />
nach individuellen Produkten durchsetzen können und Unternehmen zu einer<br />
Reaktion zwingen.<br />
Gründe für eine zunehmende Individualisierung der Nachfrage<br />
Wir können an dieser Stelle nicht ausführlich auf die Gründe eingehen, warum eine<br />
Individualisierung der Märkte (bzw. Heterogenisierung der Nachfrage) weiter fortschreitet,<br />
sondern wollen lediglich einen Überblick der wichtigsten Entwicklungslinien<br />
geben. Für eine ausführliche Diskussion der Hintergründe der fortschreitenden Heterogenisierung<br />
der Nachfrage verweisen wir auf die Literatur (siehe vor allem <strong>Piller</strong><br />
2006a; Zuboff / Maxim 2002; einen schönen Einblick geben auch Beck 1986; Blaho 2001;<br />
Cox / Alm 1999; Heil / Parker / Stephens 1999; Ludwig 2000 und Schnäbele 1997,<br />
Lindemann / <strong>Reichwald</strong> 1998).<br />
Der Industriegüterbereich ist seit jeher durch eine ausgeprägte Individualisierung als<br />
Folge der Verwendung der nachgefragten Güter in der (individuellen) Wertkette der<br />
Abnehmer gekennzeichnet (Jacob 1995, Kleinaltenkamp / Marra 1995; Stotko 2005). Die<br />
bezogenen Produktionsfaktoren sollen den firmenspezifischen Besonderheiten ihrer<br />
Verwendung in den Wertschöpfungsaktivitäten entsprechen. Da die einzigartige Gestaltung<br />
der Wertaktivitäten nicht nur Basis zum Aufbau dauerhafter Wettbewerbsvorteile<br />
ist (Porter 1996), sondern zwangsläufig auch zu stark heterogenem Bedarf der nachfragenden<br />
Betriebe führt, hat die Individualisierung hier schon lange eine sehr hohe Bedeutung.<br />
Diese Individualisierung im Industriegüterbereich, die häufig durch eine Einzelfertigung<br />
und eine Projektorganisation gekennzeichnet ist, wird heute durch eine zuneh-<br />
22
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
mende Individualisierung im privaten Verbrauch ergänzt. Dazu tragen unter anderem<br />
Änderungen im beruflichen Umfeld vieler Konsumenten bei. Der weitgehende<br />
Wandel der Arbeit in entwickelten Gesellschaften von körperlicher zu einer reinen<br />
“Wissensarbeit” betont die kreative Nutzung des Humankapitals. Die dadurch bedingte<br />
qualifiziertere Ausbildung und eine ständige Weiterbildung lehren den Menschen,<br />
die Komplexität von Problemen zu erkennen und alternative Perspektiven zu betrachten.<br />
Als Folge einer größeren Entscheidungsautonomie vieler Mitarbeiter im Rahmen<br />
dezentraler Organisationsprinzipien steigt auch die Bedeutung von Eigenverantwortung,<br />
Selbständigkeit und Individualität. Es ist anzunehmen, dass solchermaßen<br />
durch die veränderten betrieblichen Rollen und eine neue “Selbständigkeit” emanzipierte<br />
Mitarbeiter ihre berufliche Mitbestimmung und ihr Einkaufsverhalten im beruflichen<br />
Bereich (passende Produkte, Denken in Dimensionen langfristiger “Anwendungskosten”<br />
etc.) auch auf ihr privates Konsumverhalten übertragen (<strong>Piller</strong> 2006a).<br />
Dies ist ein wesentlicher Treiber der Heterogenisierung der Nachfrage.<br />
Oft wird der Trend zur Individualisierung auch durch soziodemographische Änderungen<br />
erklärt. Mit zunehmendem Wohlstand, der sich u. a. in einem höheren Einkommen,<br />
mehr Freizeit und einem höheren Bildungsniveau manifestiert, wächst der<br />
Wunsch nach individuellen Produkten. Diesen Zusammenhang beschrieb nicht nur<br />
Maslow mit seiner Bedürfnispyramide, sondern hier setzt auch die soziologisch<br />
begründete Argumentation der Individualisierung an. Wissenschaftler wie Beck (1986)<br />
oder Scitovsky (1989) halten die Massenproduktion für eintönig und neuen<br />
Ansprüchen nicht mehr angemessen, da “das menschliche Bedürfnis nach Abwechslung<br />
und Neuheit genauso groß ist wie der Wunsch zu überleben. Die Massenproduktion<br />
hat ihren Reiz verloren, weil immer mehr Menschen die gleichen oder ähnliche<br />
Gegenstände besitzen” (Fournier 1994: 59). Gerade kaufkräftige Konsumenten<br />
versuchen, ihre Persönlichkeit durch eine individuelle Produktwahl zu demonstrieren.<br />
Auch führen bevölkerungsdemographische Verschiebungen zu einer steigenden<br />
Zahl an älteren konsumintensiven Bevölkerungsgruppen, die großen Wert auf ein qualitativ<br />
hochwertiges und passendes Angebot legen. Hinzu kommen noch die steigende<br />
Zahl an Single-Haushalten und Veränderungen in der Zusammensetzung der<br />
Bevölkerung (nationale Identität, soziale Gruppen), die ebenfalls zu einer Fragmentierung<br />
der Nachfrage führen.<br />
Neben einer zunehmenden Pluralisierung individueller und gesellschaftlicher<br />
Wertsysteme ist der Wertewandel auch gekennzeichnet von einer verstärkten<br />
Hinwendung zur Erlebnisorientierung, einer zunehmenden Designorientierung und<br />
einem neuen Qualitäts- und Funktionalitätsbewusstsein, das langlebige und verlässliche<br />
Produkte fordert. Schätzungsweise beherrscht bei 20-30 Prozent der Käuferschaft<br />
der Hedonismus die grundlegende Konsumhaltung. Hedonistisches Verhalten betont<br />
auf individueller Ebene Spontaneität und kurzfristige Kaufentscheidungen und führt<br />
auf einer aggregierten Ebene zu einer zunehmenden Heterogenität der Nachfrage<br />
(Litzenroth 1997). Hinzu kommt in allen Konsumentenschichten ein steigendes<br />
Engagement im Freizeitbereich. Im Zusammenhang mit kleineren Haushaltsgrößen<br />
und abnehmenden familiären Bindungen können speziellere Hobbys und Interessen<br />
verwirklicht werden. Dieser soziale Individualismus überträgt sich auf die materiellen<br />
Bedürfnisse. Auch lässt die Markentreue der Konsumenten immer mehr nach, selbst<br />
23<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
wenn diese mit einem Produkt zufrieden sind (“Variety-Seeking-Behavior”). Der<br />
Markenwechsel als solcher stiftet Nutzen – unabhängig von der Zufriedenheit mit dem<br />
alten Produkt oder Geschmacksveränderungen (Kahn 1998).<br />
Hintergründe und Kennzeichen einer zunehmenden Macht der Abnehmer<br />
Diese Entwicklungen auf der Nachfragerseite verdienen insbesondere deshalb besondere<br />
Beachtung, da zunehmende globale Konkurrenz und steigender Marktdruck<br />
viele Branchen von Verkäufer- zu Käufermärkten mit stark ausgeprägter abnehmerseitiger<br />
Verhandlungsmacht gewandelt haben (<strong>Reichwald</strong> / Höfer / Weichselbäumer 1996).<br />
Zeichen hierfür ist bei institutionellen (industriellen) Abnehmern die wachsende<br />
Bedeutung eines systematischen Beschaffungsmanagements (Lieferantenscreening<br />
und -analyse, Qualitätspolitik). Hinzu kommt, dass sich nicht wenige Branchen durch<br />
eine erhebliche Nachfragekonzentration auszeichnen. Das damit verbundene<br />
Verhandlungspotenzial wird von den nachfragenden Unternehmen heute konsequent<br />
eingesetzt und führt zu einer Verschärfung des Wettbewerbs. Damit können sich<br />
Anbieter in diesen Märkten nicht mehr auf eine der klassischen Wettbewerbstheorien<br />
Kostenführerschaft oder Differenzierungsstrategie (Porter 1980) verlassen, sondern<br />
müssen trotz hoher Differenzierung und passender Produkte auch günstigste Preise<br />
anbieten. Eine solche Hybrid-Strategie verlangt aber eine andere Ausrichtung der<br />
betrieblichen Wertschöpfungssysteme, die in den klassischen Prinzipien nach Taylor<br />
nicht vorgesehen ist (siehe Corsten / Will 1995; Fleck 1995; Knyphausen-Aufsess /<br />
Ringsletter 1991 und <strong>Piller</strong> 1998 zu einer ausführlichen Diskussion des Wesens und<br />
der Anforderungen hybrider Wettbewerbsstrategien).<br />
Diese Forderung gilt heute aber gleichermaßen auch für Hersteller von Leistungen für<br />
private Konsumenten. In diesem Bereich ist trotz eines größeren und komplexeren<br />
Produktangebots heute eine zunehmende Aufgeklärtheit der Käufer festzustellen.<br />
MacDonald und Tobin (1998) sprechen analog zum “Empowerment” der Mitarbeiter<br />
eines Unternehmens von einem Empowerment der Abnehmer. Viele Autoren betrachten<br />
die aktive Rolle der Kunden im Wertschöpfungsprozess als direkte Folge dieses<br />
Empowerment (Gouthier 2004; Hennig-Thurau 1998; Köhne / Klein 2004; Lewis / Bridger<br />
2001; Baethage / Wilkens 2001; McKenna 2002; Seybold / Marshak / Lewis 2001). Die<br />
Ursachen für eine zunehmende Macht der Kunden sind vielfältig (die meisten Gründe<br />
gelten sowohl für private als auch industrielle Kunden): Dank der Informationstransparenz<br />
durch das Internet ist nicht nur eine lokale Preisdiskriminierung immer<br />
schwieriger durchzusetzen, sondern vor allem Kundenbewertungen und -empfehlungen<br />
gewinnen stark an Bedeutung. Solche Bewertungen stammen entweder von professionellen<br />
Akteuren wie die “Stiftung Warentest” oder Computerzeitschriften, oder aber<br />
heute direkt von Konsumenten, die sich auf Meinungsplattformen und in Online-<br />
Katalogen über ihre Erfahrungen mit einer Leistung austauschen. In diesen Bewertungen<br />
wird meist das Produkt mit dem besten Preis- Leistungsverhältnis betont. Der Preis<br />
büßt so seine Wirkung als Qualitätsindikator immer mehr ein (Fleck 1995: 46). Kunden<br />
kaufen heute von einem Anbieter, der weiß, dass seine Kunden alles über das jeweilige<br />
Gut wissen und welche Alternativen es gibt, dass sie wissen, wer auf der Welt dieses Gut<br />
noch verkauft und welche Reputation der jeweilige Anbieter hat. In dieser Beziehung hat<br />
das Internet schließlich geliefert, was Wissenschaftler wie Malone, Yates und Benjamin<br />
24
(1987) schon lange vorher versprochen haben: Größere Markttransparenz reduziert die<br />
Risiken aus Abnehmersicht und führt zu sinkenden Preisen.<br />
Kunden-Empowerment geht jedoch über den reinen Kaufakt hinaus. Kunden, die befähigt<br />
sind, besser zwischen verschiedenen Angeboten zu unterschieden, und die die<br />
Macht verspüren, Teil eines Informationsnetzwerks zu werden, werden angeregt, sich<br />
weiter zu artikulieren und weiter gehend zu handeln. Kunden äußern heute Kritik und<br />
Unzufriedenheit schneller und mit mehr Nachdruck (Hansen / Hennig 1995: 312;<br />
Prahalad / Ramaswamy 2004: 4). Es kommt zu einer neuen Dimension von Kundenaktivismus,<br />
der weit über die Aktivitäten einiger Kleingruppen hinausgeht. Ein<br />
Beispiel sind hunderte von Web-Sites, die von Kunden geschaffen wurden und sich<br />
nur mit einer Marke oder einen Produkt beschäftigen (meist entweder Fan- oder Hass-<br />
Seiten). Blogs (web logs) fördern eine öffentliche Debatte weiter und schaffen ein Netz<br />
verbundener Meinungen, Kommentare und weiter führender Links (siehe dazu auch<br />
Abschnitt 3.5.4). Selbst wenn so nur ein kleiner Teil an Kunden selbst aktiv wird, so<br />
erreicht ihr Wort heute viel schneller immer größere Adressatenkreise (siehe ausführlich<br />
Voß / Rieder 2005).<br />
Doch Kunden loben oder kritisieren nicht nur schneller und lauter, sondern handeln<br />
heute auch aktiver, um sich selbst eine Lösung zu schaffen, die ein Hersteller nicht oder<br />
nicht bequem genug anbietet. Ihre Motivation ist dabei vor allem, diese Lösung selbst<br />
für ein offenes Bedürfnis zu nutzen – und in der Regel nicht, diese zu verkaufen.<br />
Hierbei werden sie durch eine vielfältige neue Infrastruktur unterstützt, die oft über<br />
das Internet transaktionskostenminimal bereitgestellt wird. Unternehmen wie<br />
Cafepress oder Lulu.com unterstützen Konsumenten bei Publikation, Druck und<br />
Vertrieb von Büchern und anderen Drucksachen. Das Konsumentenmagazin MAKE<br />
(makezine.com) stellt detaillierte Anregungen und Anleitungen zur Verfügung, wie<br />
Kunden von den Herstellern auferlegte Beschränkungen von Produkten umgehen können<br />
(wie z. B. den Kopierschutz bei digitalen Videorekordern, die Wiederverwendung<br />
von Einweg-Kameras, das Auswechseln von Batterien von iPods). eMachineshop.com<br />
stellt jedem Konsumenten in den USA über das Internet gar eine komplette<br />
Produktionsapparatur zur Verfügung. Maschinen und Werkzeuge, die sonst nur professionellen<br />
Nutzern zur Verfügung standen oder hohe Investitionskosten hatten, können<br />
dank einer einfachen kostenlosen CAD-Software, die die Schnittstelle zwischen<br />
Kunden und Maschinen darstellt, von jedem Interessenten genutzt werden. Damit fällt<br />
die Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten zunehmend.<br />
Aktiver Kunde vs. Zwangsarbeiter Kunde<br />
Die tayloristische Industrieproduktion<br />
Es ist wichtig, diese Form des aktiven Kunden vom “Zwangsarbeiter Kunde” zu unterscheiden,<br />
der als Folge von Rationalisierungsbestrebungen von Unternehmen dazu<br />
“gezwungen” wird, bestimmte Aufgaben selbst zu erfüllen. Der zunehmende Grad an<br />
Selbstbedienungsangeboten (vom Bankautomaten über Self-Check-In im Etap-Hotel<br />
bis zum Selbstmanagement der Finanzen im Online-Banking) ist eine typische<br />
Reaktion vieler Unternehmen in der Tradition tayloristischen Denkens: Im<br />
Vordergrund steht das Streben nach weiterer operationaler Effizienz. Auch wenn dies<br />
aus Kundensicht nicht immer so negativ gesehen wird, wie es Voß und Rieder (2005)<br />
in ihrem Buch “Der arbeitende Kunde: Wenn Konsumenten zu unbezahlten<br />
25<br />
2.2
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Mitarbeitern werden” schildern (siehe z. B. für einen gegenteilige Argumentation<br />
Blaho 2001; Fließ 2001; Kim / Mauborgne 2001; Meuter et al. 2000; Schreier 2005), so ist<br />
unbestritten, dass ein immer weiter gehender Grad an “Outsourcing von Arbeit” an die<br />
Nutzer zu negativen Serviceerlebnissen oder Überforderung mancher Kunden führen<br />
kann. Der aktive und “empowerte” Kunde im Verständnis der vorangehenden<br />
Argumentation aber wird nicht aktiv, weil ihn ein Unternehmen dazu zwingt, sondern<br />
aus eigenem Antrieb, sei es aufgrund eines offenen Bedürfnisses oder weiterer<br />
Motive, die wir noch ausführlich betrachten werden (siehe Abschnitt 2.4.4). Diese<br />
wichtige Unterscheidung ist eine Hauptthese dieses Buchs und eine wesentliche<br />
Abgrenzung unserer Argumentation zu früheren Arbeiten zur Co-Produktion.<br />
Der aktive Kunde im Sinne dieses Buches wird nicht aktiv, weil ihm ein Unternehmen dazu aus<br />
Gründen der Effizienzsteigerung zwingt, sondern aus eigenem Antrieb, sei es aufgrund eines<br />
offenen ungestillten Bedürfnisses und / oder weiterer Motive wie z. B. Spaß an der Interaktion<br />
und sozialem Austausch, Wettbewerbsdenken, monetären Anreizen.<br />
Individualität fördert Kreativität und Aktivität der Nachfrager<br />
Mit der zunehmenden Individualität der Kundenanforderungen und -bedürfnisse geht<br />
vor allem oftmals auch ein Wunsch nach besonderen Produkten oder Leistungen einher,<br />
die durch das derzeitige Angebot der jeweiligen Hersteller auf einem Markt nicht<br />
gedeckt werden. Wie wir noch ausführlich sehen werden, ist es vor allem der Wunsch<br />
zur Lösung eines speziellen Problems oder einer besonderen Anforderung, der<br />
Kunden zu kreativen Mitwirkenden ehemals rein betrieblicher Wertschöpfung werden<br />
lässt. Zahlreiche Studien in Investitionsgüter- und Konsumgütermärkten zeigen heute,<br />
dass fortschrittliche Kunden regelmäßig nicht auf eine Lösung durch einen Hersteller<br />
warten, sondern selbst aktiv werden und passende Produkte für ihre neuartigen<br />
Anforderungen entwickeln bzw. zumindest einem Hersteller den entscheidenden<br />
Impuls für eine solche Entwicklung selbst vermitteln (z. B. <strong>Frank</strong>e / Shah 2003; <strong>Frank</strong>e<br />
/ von Hippel 2003; Lüthje 2003a, 2004; Urban / von Hippel 1988; von Hippel 2005). In<br />
der Konsequenz dieses anspruchsvolleren und heterogeneren Nachfrageverhaltens<br />
ergeben sich neue Herausforderungen der Unternehmen bei der Produktentwicklung<br />
und Produktion. Traditionelle Methoden der Produktentwicklung zielen auf<br />
Standardprodukte, welche die durchschnittlichen Bedürfnisse einer möglichst großen<br />
Anzahl an Kunden treffen sollen. Dazu wird mittels Marktforschung versucht, die<br />
Bedürfnisse der Kunden ex-ante zu erfahren – unter der Prämisse, dass Kunden im<br />
anvisierten Marktsegment die gleichen Präferenzen für bestimmte Produkteigenschaften<br />
haben. Das potenziell hohe Umsatzvolumen im vermeintlich homogenen<br />
Zielmarktsegment rechtfertigt so auch hohe Fixkosten der Entwicklung und des<br />
Aufbaus eines abgestimmten Produktionsapparats.<br />
Die klassische Reaktion der Anbieter auf die zunehmende Individualität<br />
Werden durch die Heterogenisierung der Nachfrage die Zielmärkte aber kleiner, reagieren<br />
viele Anbieter mit einer immer ausgedehnteren Modell- und Variantenvielfalt<br />
26
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
(Cox / Alm 1999; <strong>Piller</strong> 1998). Vorhandene Grundprodukte werden um neue Variationen<br />
für immer kleinere, in sich aber homogene Marktsegmente erweitert, indem für<br />
jede Nische eine eigene Produktvariation inklusive begleitender Vermarktungsmaßnahmen<br />
entworfen wird. Doch die vermeintlich marktbezogene Variantenfertigung<br />
bedeutet in der Regel eine große Produktpalette ähnlicher Erzeugnisse in geringen<br />
Mengen, die vorab auf Lager produziert werden. Dabei sind die genauen Absatzzahlen<br />
aber immer schwerer zu prognostizieren (Lee / Padmanabhan / Whang 1997), da die<br />
Fertigung lediglich auf Marktprognosen und Schätzungen des Vertriebs basiert. Bei<br />
gleich bleibenden oder nur leicht steigenden gesamten Absatzzahlen nimmt zudem<br />
der Aufwand der Marktbearbeitung enorm zu. Diese Vorgehensweise führt so vor<br />
allem zu einer steigenden Komplexität – in der Produktion gleichermaßen wie im<br />
Produktmanagement und Vertrieb. Besonders schwerwiegend erscheint, dass diesen<br />
Problemen mit Ausnahme einer etwas besseren Annäherung an die Präferenzstruktur<br />
der Kunden keine neuen erlösseitigen Potenziale gegenüberstehen. Die vermeintlich<br />
kundennahe Variantenfertigung entpuppt sich oft als teure und unzulängliche<br />
Fehlentscheidung. Der Ausweg vieler Unternehmen ist dabei aber heute nicht etwa,<br />
die grundlegenden Prinzipien zu erweitern, die hinter ihrer Reaktion stehen – also statt<br />
für mit ihnen genau passende individuelle Lösungen zu schaffen, sondern vielmehr<br />
immer noch der Versuch, das bestehende System industrieller Wertschöpfung in seinem<br />
Kern unverändert zu lassen, es jedoch durch die Integration externer Akteure<br />
wandlungsfähiger und flexibler zu machen. Von dieser Übertragung der Prinzipien<br />
klassischer industrieller Wertschöpfung auf die Bildung von Netzwerkorganisationen<br />
handelt der folgende Abschnitt.<br />
Kasten 2–3: Literaturempfehlungen zum Wandel der Märkte und zum Empowerment der<br />
Kunden<br />
Grün, Oskar / Brunner, Jean-Claude (2002). Der Kunde als Dienstleister: Von der Selbstbedienung<br />
zur Co-Produktion. Wiesbaden: Gabler 2002.<br />
Voß, Günter / Rieder, Kerstin (2005). Der arbeitende Kunde: Wenn Konsumenten zu unbezahlten<br />
Mitarbeitern werden. <strong>Frank</strong>furt / New York: Campus 2005.<br />
Zuboff, Shoshana / Maxmin, James (2002). The support economy: why corporations are failing<br />
individuals and the next episode of capitalism. London: Viking Penguin 2002.<br />
2.3 Auflösung der Unternehmensgrenzen:<br />
Von der internen Abwicklung zu Netzwerken<br />
und Märkten<br />
Kasten 2–4 schildert als einführendes Beispiel die Geschichte Michael Dells, der durch<br />
eine radikale Weiterentwicklung der klassischen Wertschöpfungsprinzipien ein erfolgreiches<br />
Unternehmen schaffen konnte. Das Dell-Modell ist nicht nur eine erfolgreiche<br />
27<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Antwort auf die Individualisierung der Nachfrage und eine zunehmende Heterogenität<br />
der Kundenwünsche, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel für die bis<br />
heute vorherrschende Beständigkeit der alten Prinzipien industrieller Wertschöpfung.<br />
Keiner der bereits vor Dell etablierten großen Computerhersteller, die alle dem klassischen<br />
intern ausgerichteten tayloristischen Denken entsprungen sind, hat es je<br />
geschafft, dass Dell-Modell im PC-Markt erfolgreich zu kopieren. Dell hatte als Startup-Unternehmen<br />
auf der grünen Wiese den großen Vorteil, keinen Ballast konventionellen<br />
Denkens tragen zu können und konnte konsequent alle Wertschöpfungsaktivitäten<br />
auf sein neues Modell ausrichten. Das Dell-Modell zeigt aber auch, dass die<br />
Prinzipien klassischer Betriebsführung an sich weiterhin Bestand und als Gesetzmäßigkeit<br />
Richtigkeit haben (Dell setzt z. B. stark auf Skaleneffekte im Einkauf und<br />
nutzt durch seine modularen Rechnerarchitekturen starke Verbundeffekte). Auch<br />
heute sind Skalen- und Verbundvorteile noch wichtige Prinzipien, die die Entscheidungen<br />
vieler Unternehmen zu Recht prägen. Jedoch sind sie nicht mehr zentraler<br />
Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns, sondern werden durch neue Prinzipien<br />
ergänzt und dominiert.<br />
Kasten 2–4: Das Beispiel Dell: Netzwerke als Antwort auf den marktlichen und technologischen<br />
Wandel<br />
(Quelle: Holzner, Steven: How Dell does it, New York: McGraw-Hill 2006)<br />
Die Erfolgsgeschichte des Computerherstellers Michael Dell ist ein gutes Beispiel für die<br />
Anwendung neuer Prinzipien zur Organisation der Wertschöpfung in Unternehmensnetzwerken.<br />
Als junger Student der Medizin in Austin Texas lernte Michael Dell, dass die auf dem Markt verfügbaren<br />
Personal Computers (PCs) nicht den Anforderungen entsprachen, die sich aus dem<br />
Anwendungsbereich seines Medizin-Labors ergaben. Schnell entdeckte er die Möglichkeit, seinen<br />
PC durch einzelne Bauteile und Zusatzausstattungen so zu ergänzen, dass er seinen<br />
Anforderungen Rechnung tragen konnte. Mit der Zeit erwarb er einen immer besseren Überblick<br />
über verfügbare Einzelteile und konnte so (zunächst seine eigenen) individuelle Anforderungen<br />
immer besser erfüllen. Auf dieser Grundlage baute Michael Dell zunächst für einen beschränkten<br />
Interessentenkreis aus seinem Umfeld PCs auf Bestellung, die er nach den jeweiligen<br />
Anforderungen seiner Kunden unterschiedlich zusammenstellte. Mit der Faszination, die das PC-<br />
Geschäft und die Anpassung von Computertechnologie an individuelle Nutzerbedürfnisse ausübte,<br />
wuchs auch seine Branchenkenntnis. Schnell begriff er, dass die Gesamtkosten der im<br />
Computerhandel verfügbaren Einzelteile für einen PC nur etwa 50 % der Kosten eines im Handel<br />
erhältlichen PC ausmachte. Ein Anbieter, der ohne Lagerrisiko diese Komponenten schnell und flexibel<br />
zu bereits bestellten Computern zusammenfügen konnte, hätte große Gewinnmöglichkeiten,<br />
vor allem, wenn er in einem Direktvertriebsmodell ohne Einschaltung des Handels direkt mit den<br />
Abnehmern interagieren würde.<br />
Das Geschäft wuchs so schnell, dass Dell bald darauf sein Medizinstudium beendete, um sich<br />
ganz der individuellen Produktion von PCs zu widmen. Mit dem Aufkommen des Internet an den<br />
amerikanischen Universitäten baute er Schritt für Schritt sein Wertschöpfungsnetzwerk aus.<br />
Zunächst nutzte Michael Dell den Telefonvertrieb (der auch heute noch der wichtigste<br />
Vertriebskanal ist), später auch das Internet als Kommunikations- und Vertriebsweg. Da er nicht<br />
das notwendige Kapital für eine Entwicklungsabteilung, Lagerhaltung oder die Einrichtung großer<br />
Produktionsstätten hatte, beschränkte er sich darauf, die eingegangenen Bestellungen und deren<br />
28
2.3.1 Marktorientierung und Flexibilität als Leitziele in<br />
Unternehmensnetzwerken<br />
Das Beispiel Dell verdeutlicht die Fortentwicklung der klassischen Organisation industrieller<br />
Wertschöpfung. Nicht mehr ein physisches Unternehmen, sondern ein Datennetz<br />
wird zur zentralen Wertschöpfungsplattform. Die wesentliche Geschäftsidee<br />
Michael Dells für die Wertschöpfungsorganisation legt den Fokus auf den Aufbau von<br />
Koordinationskompetenz überbetrieblicher Wertschöpfungsprozesse in Netzwerken<br />
(anstelle der klassischen der Kompetenz zur optimalen Allokation betrieblicher<br />
Ressourcen im Unternehmen).<br />
Reaktion auf die Forderung hybrider Wettbewerbsstrategien<br />
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
Komponenten in seinem Netzwerk von Händlern zu beschaffen und nach individuellem Zuschnitt<br />
in seine PCs einzubauen. So konnte er auf eine eigene Entwicklung von Computerelementen verzichten<br />
und damit etwaigen Entwicklungsrisiken entgehen. Sobald Computerkomponenten vom<br />
technischen Fortschritt überholt waren, kaufte er jeweils die neueste technologische Version, um<br />
seinen Kunden nur aktuellste PC-Technologie anzubieten. Die Energie seines eigenen<br />
Unternehmens steckte er viel mehr in Aktivitäten, die die Interaktion mit den Kunden und die interne<br />
Abstimmung seines Netzwerks verbessern konnten.<br />
Ein neues Wertschöpfungsmodell in der Computerindustrie war geboren. Die Produktion von PCs,<br />
individuell für den jeweiligen Kundenbedarf nach einem modularen Baukastensystem.<br />
Informationsnetzwerke dienten statt Werkshallen als Logistikplattform für die Koordination des<br />
Wertschöpfungsprozesses vom Bestellvorgang bis zur Auslieferung des PCs an den Kunden. Mit<br />
diesem Wertschöpfungsmodell hat Michael Dell eine beispiellose Erfolgsstory hervorgebracht, die<br />
bis heute anhält. Das Wertschöpfungsmodell der Dell Corporation dreht den Wertschöpfungsprozess<br />
aus einer Input-Output-Orientierung in seine Gegenrichtung um. Auslöser aller Wertschöpfungsaktivitäten<br />
ist die Kundenbestellung, zu der sich der Kunde entweder alleine im Internet<br />
oder in Zusammenarbeit mit einem Telefonverkäufer sein individuelles Computersystem selbst<br />
konfiguriert. Der Bestellvorgang löst den Wertschöpfungsprozess in seinen weiteren Schritten aus.<br />
Die Komponenten werden aus einem weltweiten Zulieferernetzwerk bezogen. Nach einem ausgeklügelten<br />
logistischen System, das von der Firma Dell zentral koordiniert wird, werden die<br />
Einzelteile für jeden Bestellvorgang durch weltweit agierende Logistikunternehmen (z. B. DHL,<br />
Fedex) transportiert und entweder in Dell-Fertigungswerkstätten oder direkt beim Kunden<br />
zusammengebaut und eingerichtet. Dieser Prozess wird vom Bestellzeitpunkt bis zur Auslieferung<br />
mit einer zugesicherten Durchlaufzeit realisiert, die auch in 95 % der Fälle eingehalten wird.<br />
(Anmerkung: In den USA ist Dell seit Anfang 2005 stark in der Gunst der Kunden gefallen und wird<br />
derzeit für seinen schlechten Kundenservice, nicht mehr innovative Produkte und lange<br />
Lieferzeiten gescholten. Mit dem starken Wachstum des Unternehmens scheint das ursprüngliche<br />
Geschäftsmodell verwässert worden zu sein. So ist der Großteil der von Dell heute angebotenen<br />
Produkte reine vorgefertigte Standardware, wo die klassischen Erfolgprinzipien nicht mehr greifen.)<br />
Wir haben im letzen Abschnitt gesehen, dass die klassischen Prinzipien der wissenschaftlichen<br />
Betriebsführung vor allem deshalb an ihre Grenzen stoßen, weil sich heue<br />
die meisten Märkte von Verkäufer- zu Käufermärkten gewandelt haben. Kunden sind<br />
nicht mehr bereit, organisatorisch bedingte Koordinationsprobleme, wie z. B. nicht<br />
genau passende Produkte, lange Lieferzeiten oder Schnittstellenprobleme bei Pro-<br />
29<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
zessen zu akzeptieren. Das neue Käuferverhalten ist ein wesentlicher Einflussfaktor für<br />
die Entwicklung neuer Güter und Dienstleistungen bei wachsenden Qualitätsansprüchen.<br />
Dies gilt für Konsumgüter, Investitionsgüter und für Dienstleistungen<br />
aller Art. In Käufermärkten rücken die betriebswirtschaftlichen Ziele “Qualität”, “Zeit”<br />
(Entwicklungs- und Lieferzeit) oder “Flexibilität” als gleichwertige Ziele neben die<br />
klassischen Ziele “Produktivität” und “Kostenwirtschaftlichkeit”. (<strong>Reichwald</strong> 1992;<br />
<strong>Reichwald</strong> / Schmelzer 1990; <strong>Reichwald</strong> / Koller 1996; <strong>Reichwald</strong> / Höfer / Weichselbäumer<br />
1996)<br />
Hierzu bieten ihnen neue Technologien eine Vielfalt von Potenzialen. Neue<br />
Fertigungstechnologien (computerintegrierte Produktion und flexible Fertigungssysteme)<br />
lösen die Zielkonflikte zwischen Flexibilität (Variantenvielfalt) und Qualität<br />
einerseits und Produktivität und Effizienz andererseits auf. Darüber hinaus sind es<br />
aber vor allem neue Informations- und Kommunikationstechnologien, die eine tief<br />
greifende Veränderung der unternehmerischen Wertschöpfung erlauben. Information<br />
wird zum dominierenden Produktionsfaktor, Güter-, Arbeits- und Informationsmärkte<br />
werden zu globalen Märkten. Die Nutzung der neuen Kommunikationsnetze<br />
verschafft weltweiten Zugang zu Standorten, die vormals schwer erreichbar<br />
waren. Die Intensivierung des Wettbewerbs vollzieht sich so durch den Eintritt<br />
neuer Wettbewerber in ehemals angestammte oder verschlossene Märkte. Beeindruckend<br />
ist das Wachstum der ostasiatischen Märkte und das erfolgreiche Agieren<br />
ostasiatischer Wettbewerber, besonders im Bereich industrieller Massengüter und der<br />
Informationsdienstleistungen. Seit der Öffnung der Märkte Osteuropas kommen<br />
Anbieter hinzu, in deren nationalen Volkswirtschaften Industriegüter zu erheblich<br />
geringeren Produktionskosten hergestellt werden und die mit ihren qualitativ immer<br />
besser werdenden Gütern und Dienstleistungen zunehmend Anschluss an den<br />
Weltmarkt finden. Informationsdienstleister bieten ihre Leistungen weltweit über<br />
Datennetze an.<br />
Öffnung der Grenzen des Unternehmens<br />
Märkte und Unternehmen wandeln sich vor dem Hintergrund dieser vernetzten Ökonomie.<br />
Dabei wird es schwieriger, Unternehmen als in sich relativ geschlossene, integrierte<br />
Gebilde zu identifizieren (vgl. Picot / <strong>Reichwald</strong> 1994). Die Grenzen der<br />
Unternehmen verschwimmen. Die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Märkten,<br />
die klare Unterscheidung zwischen innen und außen schwindet. Stattdessen ergeben<br />
sich immer häufiger Organisationsformen zwischen Unternehmen und Märkten, wie<br />
z. B. Netzwerkorganisationen, Kooperationsgeflechte, virtuelle Organisationsstrukturen<br />
oder Telekooperationen. Sie sind Resultate von Reaktionen auf neue Marktund<br />
Wettbewerbsbedingungen und der Möglichkeiten neuer Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien (siehe Kasten 2–5 für eine Erläuterung und weiter führende<br />
Literatur zum Begriff der Grenze von Unternehmen). Als Resultat verändern<br />
sich eher stabile Technologien der Fertigung und eher dauerhafte Organisationsformen<br />
und Führungsstrukturen zugunsten flexiblerer Formen, die sich rasch an neue<br />
Gegebenheiten anpassen lassen. An die Stelle überschaubarer, regionaler Geschäftstätigkeiten<br />
tritt eine globale Orientierung. Damit verändern sich auch die institutionellen<br />
Rahmenbedingungen, mit denen Unternehmen konfrontiert werden und die bisher<br />
30
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
in der Regel stabile und überschaubare Grundlagen unternehmerischer Tätigkeiten lieferten.<br />
Durch enge kommunikative Vernetzungen sowie durch die Internationalisierung<br />
der Geschäftstätigkeiten entsteht eine Vielfalt neuer institutioneller Gegebenheiten,<br />
mit denen sich Unternehmen vermehrt auseinanderzu setzen haben.<br />
Der technologischen folgt eine organisatorische Weiterentwicklung der Wertschöpfung.<br />
Notwendig ist eine Abflachung oder sogar Auflösung hierarchischer<br />
Strukturen. Klassische Abteilungen und Hierarchieebenen verlieren ihre Bedeutung,<br />
streng festgelegte Kommunikationsstrukturen werden durch den direkten Weg einer<br />
nicht im Einzelnen kanalisierten Gruppenkommunikation ersetzt. Die Zusammenführung<br />
von dispositiver und objektbezogener Arbeit sowie die Zusammenführung<br />
von Dienstleistung und Sachleistung zu geschlossenen Wertschöpfungsketten hat aber<br />
noch eine weitere Konsequenz, welche die Grenzen der Unternehmung auch in räumlicher<br />
Hinsicht in Frage stellt: Je stärker das Prinzip der autonomen Organisationseinheiten<br />
die Wertschöpfungskette durchdringt und je besser die autonomen<br />
Unternehmenseinheiten durch Informations- und Kommunikationstechniken koordiniert<br />
werden können, desto stärker tritt auch die Standortfrage in den Vordergrund.<br />
Können mit einer Standortverlagerung ökonomische Vorteile erzielt werden, z. B.<br />
durch größere Marktnähe, durch die Nutzung von Kostenvorteilen, durch Erhöhung<br />
der Lebensqualität für die Mitarbeiter oder durch Versorgungsvorteile, dann folgt der<br />
organisatorischen Dezentralisierung auch die räumliche Dezentralisierung, d. h. die<br />
Standortverlagerung von Organisationseinheiten. Diese erstreckt sich auf die<br />
Standorte von ganzen Unternehmen, von modularen Organisationseinheiten, Gruppen<br />
oder einzelnen Arbeitsplätzen. Im Zuge einer Modularisierung der Unternehmensorganisationen<br />
und Neustrukturierung der Arbeitsteilung kommt es häufig zu<br />
Kooperationen von Unternehmen und Zulieferern in Produktionsnetzwerken, die<br />
über eine regionale Ausdehnung hinaus auch international angesiedelt sein können<br />
(Frohlich / Westbrook 2001; Mildenberger 2001; Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003;<br />
<strong>Reichwald</strong> et. al 2004).<br />
Kasten 2–5: Organisationsgrenzen: Begriff und Ebenen<br />
(Quelle: <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2004a). Organisationsgrenzen. In: Georg Schreyögg / Axel von Werder<br />
(Hg.): Handwörterbuch der Unternehmensführung und Organisation. 4. Aufl., Stuttgart: Schäffer-<br />
Poeschel 2004: 998-1008)<br />
Die Definition der Grenzen einer Organisation ist erst aus betriebswirtschaftlicher Sicht seit dem<br />
Zeitpunkt ein Thema, zu dem die Ziehung der Grenzen als Gestaltungsoption in das Blickfeld der<br />
Organisationsforschung des Managements gerückt ist. Aus neoklassischer Sichtweise sind<br />
Organisationen zur Abwicklung von wirtschaftlichen Leistungen nicht notwendig: Die Koordination<br />
am Markt, gelenkt durch die unsichtbare Hand, führt zu einem unter Effizienzaspekten idealen<br />
Zustand (vgl. Smith 1776). Ohne Organisationen existieren auch keine Organisationsgrenzen.<br />
Aber auch in der klassischen Organisationslehre scheinen die Grenzen einer Organisation als<br />
Gestaltungsoption keine Rolle zu spielen. Im Mittelpunkt steht dort die Frage nach der Gestaltung<br />
des Aufbaus und der internen Abläufe in einer gegebenen Organisation. Dabei wurde die Ziehung<br />
31<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
der Grenzen einer Organisation bereits von Coase (1937) thematisiert, der die neoklassische<br />
Theorie bei der Verteilung von knappen Gütern auf Märkten in Frage stellt und die Organisation<br />
als effizienten Mechanismus der Abwicklung von Transaktionen bei unvollständigen Informationen<br />
untersucht. Die Untersuchung der Existenz von Organisationen führt damit auch zu der Frage, wo<br />
die Grenze der Organisation gezogen wird, insbesondere wenn, wie bei Coase, die Festlegung<br />
des optimalen Aufgabenumfangs in einer Organisation thematisiert wird. Die grundsätzliche Frage<br />
nach den Grenzen einer Organisation hängt von der verfolgten Auffassung über die Bestandteile<br />
einer Organisation und damit auch davon ab, was jenseits der Grenzen einer Organisation gesehen<br />
wird.<br />
Sieht man die Organisation als soziales System (Gutenberg 1983), hängt die Organisationsgrenze<br />
eng mit der Struktur und Größe eines Unternehmens zusammen. Die Zahl an Mitarbeitern, der<br />
Umsatz, die Marktkapitalisierung, der Wertschöpfungsanteil, der Marktanteil, die Anzahl der<br />
Geschäftsfelder oder die geographische Ausdehnung sind beispielhafte Kennzahlen zur<br />
Beschreibung der Größe einer Organisation, die wiederum durch die Ziehung der Grenzen um<br />
diese Organisation abhängt (vgl. Bieberbach 2001). Versteht man unter einem Unternehmen eine<br />
organisatorische und wirtschaftliche Einheit mit einer hierarchischen Struktur und zentralen<br />
Weisungsrechten (vgl. Picot 1999), dann lassen sich unter den verschiedenen möglichen<br />
Determinanten zwei unabhängige Variablen finden, die zur Bestimmung der Unternehmensgröße<br />
herangezogen werden können: die horizontale und die vertikale Unternehmensgröße (Tirole<br />
1995). Die horizontale Größe bezieht sich auf die Zahl der Märkte, auf denen das Unternehmen<br />
aktiv ist, und die jeweilige Output-Menge auf einem Markt. Damit bestimmt sich die Leistungsbreite<br />
eines Unternehmens. Die vertikale Unternehmensgröße dagegen bezieht sich auf die Tiefe der<br />
Wertschöpfung, d. h. die Leistungstiefe bzw. der Grad der vertikalen Integration. Sie ist analytisch<br />
definiert durch die Zahl der Wertschöpfungsstufen, die innerhalb eines Unternehmens abgewickelt<br />
werden, oder praktisch bestimmbar durch die Wertschöpfung (Gesamtleistung abzüglich<br />
Vorleistungen). Die Festlegung der Leistungsbreite (Bestimmung der horizontalen Organisationsgrenze)<br />
und Leistungstiefe (Bestimmung der vertikalen Organisationsgrenze) können als<br />
wichtige Bestimmungsgrößen der Grenzziehung der Organisation gesehen werden.<br />
Eine andere Sichtweise sieht die Organisation als ökonomische Institution zu Lösung des Organisationsproblems<br />
vor dem Hintergrund einer arbeitsteiligen Wirtschaft und der Existenz verschiedener<br />
Institutionen zur Abwicklung der Arbeitsteilung (Picot 1999). Gegenstand des Organisationsproblems<br />
ist die Beseitigung der Mängel als Folge von Koordinations- und Motivationsproblemen<br />
bei Arbeitsteilung und Spezialisierung, wie auch bei Tausch und Abstimmung, die<br />
möglichen Produktivitätsgewinne (aus Spezialisierung) entgegenstehen. (vgl. u. a. Picot 1982;<br />
Milgrom / Roberts 1992). Allerdings verbraucht der Organisationsprozess selbst Ressourcen<br />
(Koordinationskosten). Folglich stellt das Organisationsproblem eine Optimierungsaufgabe dar,<br />
bei der diejenige Organisationsform gesucht wird, die den Produktivitätsanstieg durch<br />
Arbeitsteilung und Spezialisierung so auszunutzen vermag, dass unter Berücksichtigung des<br />
Ressourcenverbrauchs bei Tausch und Abstimmung möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden<br />
können (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). Unterschiedliche Organisationsformen bestimmen sich<br />
dabei durch verschiedene Ansatzpunkte zur Lösung des Koordinations- und Motivationsproblems,<br />
namentliche Hierarchie, interorganisationale Netzwerke (Kooperation) und Markt. Diese Ansätze<br />
sind dabei durch die Dominanz unterschiedlicher Institutionen geprägt. Als Institutionen werden<br />
sozial sanktionierbare Erwartungen bezeichnet, die sich auf die Handlungs- und Verhaltensweisen<br />
eines Akteurs beziehen. Sie informieren jeden Akteur sowohl über seinen eigenen Handlungsspielraum<br />
als auch über das wahrscheinliche Verhalten anderer Akteure und fungieren somit als<br />
verhaltensstabilisierende Mechanismen. Die Organisationsgrenze bezieht sich dabei auf die<br />
Definition des Überganges zwischen Hierarchie und Markt sowie zwischen Markt bzw. Hierarchie<br />
und interorganisationalen Netzwerken. Sie muss für alle Transaktionsbeziehungen entlang der<br />
Wertschöpfungskette zur Erstellung der Gesamtleistung festgelegt werden. Die effiziente Grenze<br />
32
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
ist dann bestimmt, wenn beim Übergang von einer Organisationsform zur nächsten keine Koordinationskosten<br />
(bei gegebenen Produktionskosten) mehr eingespart werden können. Die Organisationsgrenze<br />
definiert damit das Spektrum all der Aufgaben, die innerhalb einer Organisation zu der aus<br />
Gesamtkostensicht geringsten Summe von Koordinations- und Produktionskosten erbracht werden.<br />
In der bisherigen Argumentation wurde die Organisationsgrenze in erster Linie als externe (interorganisationale)<br />
Grenze zwischen einem Unternehmen und seiner Umwelt gesehen. Dies entspricht<br />
auch der weiten Verwendung dieses Begriffs in der angeführten Literatur. Der externen<br />
Organisationsgrenze kann aber auch eine interne (intraorganisationale) Grenze gegenübergestellt<br />
werden. Diese bezieht sich auf die Verteilung von Aufgaben, Weisungs- und Entscheidungsrechten<br />
sowie Macht innerhalb eines Unternehmens und die Ziehung der Grenzen zwischen den<br />
verschiedenen organisatorischen Einheiten (Aufbauorganisation) eines Unternehmens aus formaler<br />
und informeller Sicht. Auch hier lässt sich die zu Beginn angeführte Unterscheidung zwischen<br />
horizontalen und vertikalen Grenzen ziehen, indem auch innerhalb einer Organisation das horizontale<br />
Aufgabenspektrum festgelegt werden muss, also beispielsweise die Breite der Produktlinie<br />
einer Geschäftseinheit.<br />
2.3.2 Ökonomie der Netzwerkorganisationen und Move-tothe-Market<br />
Die Unternehmensführung befindet sich so in einem Prozess der Neuorientierung und<br />
des Umdenkens. Wahrend in der klassischen Theorie der Unternehmung Produktivität<br />
und Produktionskosten die Kriterien für die Gestaltung der industriellen Wertschöpfung<br />
bilden, sind es nun die Kosten der Information und Kommunikation in bestimmten<br />
Wertschöpfungsarrangements, die Transaktionskosten, die den Pfad erfolgreicher<br />
Unternehmensführung bestimmen. Das Problem der Güterknappheit wird auch hier<br />
durch Arbeitsteilung und Spezialisierung bewältigt. Allerdings tritt in den neuen<br />
Organisationsformen der modularen Organisation bzw. der Unternehmensnetzwerke<br />
das Problem der Koordination und Motivation in den Vordergrund. Es geht primär<br />
darum, die resultierenden Tausch- und Abstimmungsvorgänge möglichst effizient zu<br />
gestalten. Koordinations- und Motivationsprobleme entstehen hier, weil das Wissen um<br />
die effizientesten Wertschöpfungsarrangements selbst ein knappes Gut ist (Picot / Dietl /<br />
Franck 2005). Damit tritt die klassische Erkenntnis Kirzners (1978) in den Vordergrund,<br />
dass erfolgreiches Unternehmertum letztlich auf Informationsvorsprüngen basiert.<br />
Die Ausnutzung dieser Informationsvorsprünge verlangt immer die Wahl einer passenden<br />
Organisationsform, um mit der knappen Ressource Information möglichst effizient<br />
umzugehen. Das Management von Information muss sich dabei mit den besonderen<br />
Eigenschaften des Gutes Information auseinander setzen, deren Charakteristika mit<br />
jeder weiteren Vernetzung zwischen Akteuren an Bedeutung gewinnt. Einen<br />
Ansatzpunkt zur Modellierung und Erklärung bieten die Transaktionskostentheorie und<br />
der verbundene Ansatz der Property-Rights-Theorie (siehe Kasten 2–6), zwei der zentralen<br />
Bestandteile der so genannten Institutionenökonomik. Diese stellt (abstrakte)<br />
Erklärungsansätze zur Verfügung, wie eine Unternehmung als Bestandteil eines globalen<br />
Wertschöpfungsnetzwerks die Grenzen der Arbeitsteilung optimal zieht. Die Institutionenökonomik<br />
wird damit zum ergänzenden Erklärungsansatz, da die klassischen<br />
Gesetze Tayloristischen Denkens diese Fragen nicht ausreichend beantworten können.<br />
33<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Kasten 2–6: Ansätze zur Erklärung organisationaler Grenzen: Transaktionskosten und<br />
Property-Rights-Ansatz<br />
(Quelle: <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2004b). Organisationsgrenzen. In: Georg Schreyögg / Axel von Werder<br />
(Hg.): Handwörterbuch der Unternehmensführung und Organisation, 4. Aufl., Stuttgart: Schäffer-<br />
Poeschel 2004: 998-1008)<br />
Transaktionskostentheorie: Grundlegende Untersuchungseinheit der Transaktionskostentheorie<br />
ist die einzelne Transaktion, die als Übertragung von Verfügungsrechten (Property-Rights) definiert<br />
wird (vgl. u. a. Coase 1937; Picot / Dietl / Franck 2005; Williamson 1975, 1985). Die dabei anfallenden<br />
Kosten werden als Transaktionskosten bezeichnet und umfassen Kosten der Anbahnung<br />
(z. B. Recherche, Reisen, Beratung), Vereinbarung, (z. B. Verhandlungen, Rechtsabteilung),<br />
Abwicklung, (z. B. Prozesssteuerung), Kontrolle (z. B. Qualitäts- und Terminüberwachung) und<br />
Anpassung (z. B. Zusatzkosten aufgrund nachträglicher qualitativer, preislicher oder terminlicher<br />
Änderungen). Die Höhe dieser Transaktionskosten hängt einerseits von den Eigenschaften der zu<br />
erbringenden Leistungen und andererseits von der gewählten Einbindungs- bzw. Organisationsform<br />
- und damit Setzung der Organisationsgrenzen - ab. Ziel der Transaktionskostenanalyse<br />
ist es, diejenige Organisationsform zu finden, die bei gegebenen Produktionskosten die<br />
Transaktionskosten minimiert. Transaktionskosten sind damit Effizienzmaßstab zur Beurteilung<br />
und Auswahl unterschiedlicher institutioneller Arrangements. Dabei werden der Markt, die organisationsinterne<br />
Hierarchie und Netzwerke bzw. Kooperationen als elementare Strukturen der<br />
Leistungserstellung betrachtet. Die Organisationsgrenze kann hier als Trennung zwischen der<br />
Organisation als Träger der Leistungserstellung und dem umgebenden Marktsystem gesehen werden.<br />
Aus Sicht der Transaktionskostentheorie konstituieren sich die effizienten Grenzen einer<br />
Organisation an dem Punkt, wo die Kosten der internen Abwicklung von Transaktionen den Kosten<br />
der externen Abwicklung dieser Transaktion entsprechen (Holmström / Roberts 1998), also durch<br />
Umverteilung keine Effizienzgewinne mehr realisiert werden können.<br />
Property-Rights-Theorie: Nach Holmström und Roberts (1998) resultiert die Frage der<br />
Organisationsgrenze aus der so genannten “hold-up” Problematik, also der Gefahr der opportunistischen<br />
Ausnutzung bestehender Abhängigkeiten zwischen Vertragsparteien mit asymmetrischer<br />
Informationsverteilung. Wenn eine der Vertragsparteien für eine Transaktion irreversible, transaktionsspezifische<br />
Vorleistungen tätigt (sog. “sunk costs”), die außerhalb dieser Transaktion von<br />
geringerem Wert oder wertlos sind, gerät sie nach Vertragsabschluss in Abhängigkeit von der<br />
anderen Partei, weil sie auf deren Leistung angewiesen ist. Zusätzlich ist es aufgrund zu hoher<br />
Transaktionskosten unmöglich, einen vollständigen Vertrag zu schließen, der alle möglichen<br />
Umweltzustände ex-post umfasst. Diese Problemstellung bildet der Property-Rights-Ansatz ab<br />
(vgl. u. a. Grossman / Hart 1986; Hart / Moore 1990; Hart 1995). In seinem Mittelpunkt stehen<br />
Handlungs- und Verfügungsrechte (sog. Property Rights) und deren Wirkung auf das Verhalten<br />
von ökonomischen Akteuren. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, dass der Wert von<br />
Gütern einerseits und die Handlungen von Menschen andererseits von den Rechten abhängen,<br />
die ihnen zugeordnet sind. Property Rights sind die mit einem Gut verbundenen und<br />
Wirtschaftssubjekten aufgrund von Rechtsordnungen und Verträgen zustehenden Rechte. Die<br />
Übertragung von Property Rights kann auf Märkten durch Verträge und innerhalb von Organisationen<br />
durch hierarchische oder marktliche Anweisungen geregelt werden. Durch unvollständige<br />
Zuordnung und / oder Verteilung von Property Rights auf mehrere Individuen entstehen sog.<br />
verdünnte Property Rights mit der möglichen Folge externer Effekte. Die Handlungen eines<br />
Akteurs haben dadurch Auswirkungen auf den Nutzen der übrigen Akteure, die ebenfalls im Besitz<br />
der verdünnten Property Rights sind.<br />
Bei unvollständigen Verträgen und hoher Spezifität der betroffenen Güter kann eine Integration<br />
aller Property Rights innerhalb einer Organisationsgrenze diese Problematik verhindern. Folge ist<br />
34
Effizienz alternativer Wertschöpfungsarrangements<br />
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
eine vertikale Integration, also das Verändern der vertikalen Grenze der Organisation. Die effiziente<br />
Organisationsgrenze ist hiernach durch eine effiziente Allokation von Property Rights determiniert.<br />
Diese ist erreicht, wenn die Summe aus Transaktionskosten und die durch externe Effekte<br />
hervorgerufenen Wohlfahrtsverluste in ihrem Minimum ist. Die Grenze der Organisation definiert<br />
sich damit als Bündel von Property Rights über mehrere Güter, die sich im Besitz einer Institution<br />
befinden.<br />
Aus Sicht der Transaktionskostentheorie stellen Kooperationen in Netzwerken so<br />
genannte hybride Organisationsformen dar, die auf einem Kontinuum zwischen den<br />
beiden Extremformen Markt und Hierarchie angesiedelt sind. Sie vereinigen Elemente<br />
marktlicher als auch hierarchischer Organisation. Dazu zählen beispielsweise langfristig<br />
angelegte Unternehmenskooperationen, strategische Allianzen, Joint Ventures,<br />
Franchisingsysteme, Lizenzvergabe an Dritte, dynamische Netzwerke sowie langfristige<br />
Abnahme- und Belieferungsverträge. Ziel von Netzwerkorganisationen ist die<br />
Kombination der Vorteile von hierarchischen und marktlichen Organisationsformen:<br />
die Zusammenlegung von komplementären Ressourcen verschiedener Unternehmen<br />
für die gemeinsame Wertschöpfung soll nahezu die Effizienz einer einheitlichen hierarchischen<br />
Organisation erreichen. Gleichzeitig soll aber die Flexibilität und<br />
Autonomie der einzelnen Unternehmen aufrechterhalten werden, indem sich die<br />
Unternehmen durch marktliche Arrangements nur lose aneinander binden (Picot /<br />
<strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). Die scheinbar einfache Wahl zwischen unternehmensinterner<br />
und unternehmensexterner Erstellung von Leistungen entpuppt sich damit als<br />
komplexe Optimierungsaufgabe innerhalb eines breiten Kontinuums von Möglichkeiten.<br />
Einen Anhaltspunkt für die Entscheidung, ob eine Leistung intern, rein extern oder<br />
kooperativ abgewickelt werden soll, gibt der Grad der Spezifität und Unsicherheit der<br />
entsprechenden Aktivität, der wesentlich die Höhe der Transaktionskosten bestimmt.<br />
Dabei ist die Spezifität einer Transaktion um so höher, je größer der Wertverlust ist,<br />
der entsteht, wenn die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Ressourcen nicht in der<br />
angestrebten Verwendung eingesetzt, sondern ihrer nächst besten Verwendung zugeführt<br />
werden (vgl. Klein / Crawford / Alchian 1978). So sind z. B. bei Beendigung einer<br />
Geschäftsbeziehung unspezifische Ressourcen wie Standardsoftware etc. weiterhin<br />
ohne Einschränkung verwendbar. Spezifische Investitionen wie z. B. Spezialmaschinen<br />
verlangen hingegen eine Umrüstung oder werden vollkommen wertlos (z. B. Kundendaten).<br />
Unsicherheit drückt sich in Anzahl und Ausmaß nicht vorhersehbarer Aufgabenänderungen<br />
aus. In einer unsicheren Umwelt wird die Vertragserfüllung durch<br />
häufige Änderungen von Terminen, Preisen, Konditionen und Mengen erschwert, was<br />
Vertragsmodifikationen und damit die Inkaufnahme erhöhter Transaktionskosten<br />
erfordert. Hybride Organisationsformen (Netzwerke und Kooperationen) sind vor<br />
allem bei mittlerer Spezifität und Unsicherheit des Leistungsaustauschs geeignet, um<br />
die Transaktionskosten zur Abstimmung und Kontrolle unter den Tauschpartnern zu<br />
minimieren (Abbildung 2–4).<br />
35<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 2–4: Alternative Wertschöpfungsarrangements<br />
Einfluss der Informationstechnologie auf die Effizienz von Wertschöpfungsarrangements<br />
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben im Rahmen dieser<br />
Diskussion einen wichtigen Einfluss. Abbildung 2–5 verdeutlicht den Sachverhalt graphisch.<br />
Der Wechsel von S1 zu S1’ entspricht dem modellhaften Zuwachs des Feldes,<br />
an dem nun auch der Bezug von Leistungen mit einer höheren Spezifität (oder<br />
Unsicherheit) auf Märkten die vorteilhafteste Alternative darstellt. Gleichzeit steigt<br />
aber auch der Bereich, in dem eine Abwicklung über Netzwerke vorteilhaft ist (S2’ statt<br />
S2). Damit verkleinert der Einsatz der neuen Informationstechnologien den Bereich,<br />
der für eine reine interne (hierarchische) Abwicklung der Wertschöpfungsaktivitäten<br />
spricht, wesentlich.<br />
Zunehmende Bedeutung von Netzwerkarrangements<br />
Im Bereich von Zuliefererbeziehungen und Business-to-Business-Transaktionen<br />
können wir heute feststellen, dass eine Abwicklung der Wertschöpfung in Netzwerken<br />
die dominierende Form geworden ist. Das zuvor beschriebene Beispiel von Dell ist ein<br />
gutes Beispiel dafür, ein anderes sind die oft zitierten Zulieferernetzwerke in der<br />
Automobilindustrie. Viele Unternehmen versuchen heute aus Gründen der effizienten<br />
Differenzierung, sich auf ihre Kernkompetenzen zu beschränken, d. h. die Bereiche, in<br />
denen sie besondere Kompetenzen zur Erfüllung der Kundenwünsche haben<br />
(Prahalad / Hamel 1990). Dies heißt aber auch, dass sie alle Aktivitäten, die nicht diesen<br />
Kernfunktionen angehören, an externe Lieferanten abgeben, die zu ihrer<br />
Erbringung eine Vielzahl an Spezialisierungseffekten haben (auf Basis der Economies<br />
36<br />
Transaktionskosten<br />
Markt<br />
Hybride<br />
Koordinationsformen<br />
Hierarchie<br />
S1 S2 Spezifität/ Unsicherheit
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
of Scale und Scope). Das Ergebnis sind sowohl vertikale Partnerschaften entlang der<br />
Supply Chain (Zuliefererintegration in die Fertigung) als auch horizontale<br />
Partnerschaften im Vertrieb (z. B. Vertriebskooperationen). Diese Felder sind breit in<br />
der Literatur beschrieben worden und sollen hier nicht weiter ausgeführt werden<br />
(siehe dazu z. B. Frohlich / Westbrook 2001; Ghoshal / Bartlett 1995; Hayes /<br />
Wheelwright 1984; Picot / <strong>Reichwald</strong> 1994; Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003; Zahn /<br />
Foschiani 2002).<br />
Abbildung 2–5: Einfluss der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)<br />
auf die Vorteilhaftigkeit von Organisationsstrukturen (entnommen aus Picot /<br />
<strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003)<br />
Transaktionskosten<br />
Markt<br />
Hybride<br />
Koordinationsformen<br />
Hierarchie<br />
Mit IKT-Einfluss<br />
Ohne IKT-Einfluss<br />
S1 S1´ S2 S2´ Spezifität/ Unsicherheit<br />
Der Netzwerkgedanke spielt aber nicht nur in der Produktion, sondern auch bei der<br />
Neuproduktentwicklung und Innovation eine wichtige Rolle. Der Innovationsprozess<br />
wird dann als interaktive Beziehung zwischen einem fokalen Unternehmen<br />
(OEM) und verschiedensten Organisationen der Unternehmensumwelt gesehen<br />
(Laursen / Salter 2004). Demzufolge basiert die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens<br />
zu einem großen Anteil darauf, entlang aller Phasen des Wertschöpfungsprozesses<br />
einen Wissenstransfer mit externen Akteuren einzugehen (Hirsch-Kreinsen<br />
2004). Vor allem der Bereich einer Integration der Zulieferer in die Produktentwicklung<br />
ist heute gut erforscht (siehe z. B. LaBahn / Krapfel 1999; Roy / Sivakumar /<br />
Wilkinson 2004; Ragatz / Handfield / Scannell 1997; Spina / Verganti / Zotteri 2002;<br />
Wagner 2003; Wagner 2003; Wynstra / van Weele / Weggemann 2001; Bullinger /<br />
Warnecke / Westkämper 2002). Wir werden diesen Aspekt auch noch einmal in<br />
Abschnitt 3.2.2 aufgreifen. In allen Bereichen von Netzwerkorganisationen und über-<br />
37<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
betrieblicher Zusammenarbeit stellen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
die wesentlichen Potenziale, ortsübergreifend und mit hoher Informationsreichhaltigkeit,<br />
aber dennoch effizient zu interagieren.<br />
Move-to-the-Market-Hypothese<br />
Jedoch haben gleichzeitig mit der Zunahme der Bedeutung von Netzwerkarrangements,<br />
die einer kooperativen Form der Leistungserbringung entsprechen, auch die<br />
Möglichkeiten einer (rein preisgetriebenen) Abwicklung von Transaktionen auf<br />
Märkten an Bedeutung gewonnen. Malone, Yates und Benjamin (1987) beschreiben mit<br />
ihrer “Move-to-the-Market”-Hypothese den erweiterten Spielraum, in dem eine<br />
Koordination durch Märkte auch für den Leistungsaustausch von spezifischen<br />
Produkten und Dienstleistungen die transaktionskostenminimale Alternative ist. Denn<br />
im Vergleich zu hybriden und hierarchischen Koordinationsformen sind Märkte klassischerweise<br />
mit höheren Transaktionskosten belastet, so dass hier eine Reduktion<br />
durch den IT-Einsatz viel stärker wirkt. Dadurch gewinnen die Vorteile einer<br />
Abwicklung von Aktivitäten auf Märkten im Vergleich zu hybriden oder hierarchischen<br />
(internen) Koordinationsformen an Bedeutung (wesentlicher Vorteil von<br />
Märkten sind niedrigere Produktionskosten durch Spezialisierungs- und Skaleneffekte<br />
durch Nachfrageaggregation). Ferner wird die wahrgenommene Produktkomplexität<br />
und -spezifität durch verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten der Produktbeschreibungen<br />
reduziert bzw. die Kommunikationskosten einer “Einheit”<br />
Komplexität und Spezifität gesenkt. Durch die fallenden Transaktionskosten der Informationssuche,<br />
Vereinbarung und Produktbewertung können Informationsasymmetrien<br />
und Unsicherheiten über das Verhalten des Anbieters besser abgebaut<br />
werden. Kosten für die Suche von Preis- und Produktinformationen werden weitgehend<br />
reduziert, so dass die Markttransparenz und damit die Marktmacht der Kunden<br />
steigen. Die Notwendigkeit für Kunden, sich zum Zweck der Unsicherheitsreduktion<br />
längerfristig an einen Anbieter zu binden, wird weniger wichtig, wenn sich die Suche<br />
nach dem günstigsten und besten Anbieter verstärkt lohnt.<br />
Die voranschreitende Konvergenz im Bereich neuer Medien und ihr Einsatz im<br />
Internet als Vertriebskanal beschleunigt diese Entwicklung. Denn damit lassen sich<br />
nun auch komplizierte Produkteigenschaften durch hohe Bildauflösungen,<br />
Videosequenzen, 3D-Animationen oder Virtual Reality kommunizieren. Nachfrager<br />
können dadurch nicht nur standardisierte, sondern auch komplexere Güter evaluieren,<br />
ohne große Unsicherheiten in Kauf nehmen zu müssen. Andererseits versetzen geringe<br />
Kosten bei Informationssuche und Produktbeurteilung die Nachfrager auch in eine<br />
stärkere Verhandlungsposition, was prinzipiell den Preiswettbewerb unter den<br />
Anbietern verschärft. Zwar belegen bestehende Preisunterschiede zwischen<br />
Internetanbietern, dass die Bedingungen vollständiger Information hier ebenfalls nicht<br />
vollständig erreicht werden. Marktineffizienzen bestehen fort, weil Anbieter selbst für<br />
scheinbar homogene Güter unterschiedliche Preise erheben können. Zum Teil spiegelt<br />
sich darin die Tatsache wider, dass sich der zu gleichen Kosten erreichbare<br />
Informationsstand für die Konsumenten zwar erhöht, er aber nach wie vor nicht<br />
kostenlos und perfekt ist. Anbieter können so weiterhin Informationsvorteile gegenüber<br />
heterogen informierten Nachfragern für eine Preisdiskriminierung nutzen, ohne<br />
38
dass eine Leistungsdifferenzierung offensichtlich ist. Insgesamt jedoch ist unbestritten,<br />
dass im “Frictionless Commerce” die Kunden gegenüber den Anbietern durch verbilligte<br />
Informationssuche, höhere Markttransparenz sowie steigenden Preiswettbewerb<br />
profitieren. Zumindest im Internethandel wurden bereits für den Handel mit<br />
Standardgütern niedrigere Preise als im realen Handel empirisch nachgewiesen<br />
(Brynjolfsson / Smith 2000). Die Frage einer langfristigen Kundenbeziehung stellt sich<br />
für die derart begünstigten Kunden eher nicht, wenn deren Kosten für einen<br />
Lieferantenwechsel immer weiter sinken. Manche Branchen (z. B. Mobilfunk,<br />
Kreditkartenunternehmen, Autovermietungen) verlieren als Folge einer steigenden<br />
Preissensibilität auf der einen und einer höheren Produktkenntnis der Abnehmer auf<br />
der anderen Seite heute innerhalb von drei Jahren mehr als die Hälfte ihrer Kunden.<br />
2.3.3 Grenzen der grenzenlosen Organisation<br />
Auflösung der Unternehmensgrenzen<br />
Zusammenfassend zeigen sich so zwei wesentliche Entwicklungen: (1) Die neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien erlauben auf der einen Seite eine intensive<br />
Zusammenarbeit in Netzwerken, ohne dass dabei hohe Interaktions- und Transaktionskosten<br />
die Vorteile einer solchen Zusammenarbeit wieder aufheben. Typisches<br />
Zeichen dieser Netzwerkpartnerschaften ist häufig ein hoher Grad an Vertrauen zwischen<br />
den Partnern und eine dauerhafte Zusammenarbeit. (2) Zur gleichen Zeit jedoch sinken<br />
auf der anderen Seite auch die Kosten der Informationssuche. Dies reduziert aus<br />
Nachfragersicht die Informationsasymmetrie, Unsicherheit und Komplexität von<br />
Produktbewertungen. Das Bedürfnis der Kunden nach Loyalität zu und Bindung an einen<br />
einzigen Anbieter in langfristigen Kundenbeziehungen wird so aus Kundensicht zugunsten<br />
der Suche nach dem günstigsten Anbieter auf dem Markt geringer. Für Anbieter<br />
ergibt sich aus der erhöhten Markttransparenz ein härterer Preiswettbewerb.<br />
Das Beispiel von Dell zeigt einen Ausweg aus dieser Situation: Neben der hoch flexiblen<br />
Netzwerkorganisation des Unternehmens in Bezug auf die operativen Aktivitäten<br />
erlaubt der Fokus auf eine Individualisierung der Produkte Dell auch, den Preiskampf<br />
im Internet zu umgehen. Der modulare Aufbau der Produkte ermöglicht dem<br />
Unternehmen zunächst in der Werbung, sehr günstige Einstandspreise anzugeben. Ein<br />
Kunde, der sich jedoch einmal im Konfigurator oder im Telefon-Verkaufssystem befindet,<br />
wird ständig dazu angehalten, Upgrades bzw. höher wertige Komponenten zu<br />
bestellen bzw. seine Bestellung um Peripheriegeräte zu erweitern (eine Intensivierung<br />
der Interaktion ist ein klassisches Mittel zur Erhöhung der Zahlungsbereitschaft; siehe<br />
<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004). Damit steigt der Wert einer Bestellung erheblich – und damit die<br />
Marge des Unternehmens. Dennoch gilt Dell aus Kundensicht als günstiger Anbieter,<br />
da die individuelle Bündelung bzw. Zusammenstellung die Preistransparenz sehr<br />
erschwert. Hintergund dieser Potenziale ist die Besonderheit der individuellen<br />
Interaktion mit jedem einzelnen Abnehmer, die Dell im Vergleich zu einem klassischen<br />
Anbieter standardisierter Güter mit seinen Kunden hat.<br />
Die meisten Unternehmen jedoch haben bislang Netzwerkarrangements nur auf der<br />
Beschaffungsseite genutzt. Ihre Kunden dagegen galten und gelten meist als passiver<br />
39<br />
2.3
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Wertempfänger, nicht jedoch als Partner in einem Wertschöpfungsnetzwerk (Grün /<br />
Brunner 2002; <strong>Piller</strong> 2004; Prahalad / Ramaswamy 2004). Zwar betont die Literatur fast<br />
schon mantra-artig die Bedeutung der Marktorientierung, d. h. dass Unternehmen<br />
die “Stimme der Kunden” als wesentliches Mittel zur Reduktion von marktlichen<br />
Unsicherheiten berücksichtigen müssen (de Brentani 2001; Jaworski / Kohli 1993).<br />
Marktorientierung wird aber in vielen Fällen durch klassische Marktforschung realisiert,<br />
um frühzeitig eine breite Marktakzeptanz der Produkte sicherzustellen. Dieses<br />
Vorgehen birgt einerseits das Risiko, dass Unternehmen durch eine Orientierung an<br />
“durchschnittlichen” Kundenbedürfnissen und der Entwicklung eines entsprechenden<br />
Standardproduktes der Heterogenität der Kundenwünsche nicht Rechnung tragen<br />
können. Andererseits vergeben Unternehmen so das Potenzial, Kunden als aktiven<br />
Partner an allen Phasen der Wertschöpfung zu beteiligen – und so die klassischen<br />
Vorteile einer Netzwerkorganisation und Kooperation auch in Bezug auf die<br />
Kundenbeziehungen zu nutzen. Die Kernidee einer solchen Kundenintegration in die<br />
Wertschöpfung ist, dass durch den Einbezug von Abnehmern bzw. Nutzern in ehemals<br />
vom Herstellerunternehmen dominierte Aktivitäten ein Wissenstransfer zwischen den<br />
Akteuren stattfindet, der bei einer klassischen Abwicklung der Leistungserstellung<br />
nicht möglich ist (<strong>Reichwald</strong> / <strong>Piller</strong> 2002, 2003; Thomke / von Hippel 2002). Der Zugriff<br />
auf dieses Wissen ermöglicht nun im Herstellerunternehmen eine völlig neue Art der<br />
Organisation der Wertschöpfung, die über die bislang bekannten Formen einer<br />
Netzwerkintegration hinausgeht. Hieraus ergeben sich sowohl Ansatzpunkte für eine<br />
weit reichende Produktdifferenzierung, die gleichermaßen Ausweg aus dem<br />
Preiswettbewerb als auch Antwort auf die zunehmende Individualisierung der<br />
Nachfrage (siehe Abschnitt 2.2.3) ist, als auch Möglichkeit für eine neue Organisation<br />
des Innovationsprozesses.<br />
Genau an dieser Stelle setzt die Idee der interaktiven Wertschöpfung an, die wir im<br />
folgenden Abschnitt näher ausführen wollen. Diese kann auch eine weitere Grenze der<br />
bisherigen Vorstellung einer Organisation betrieblicher Wertschöpfung in Netzwerken<br />
überwinden: Zwar ist die Nutzung des Potenzials unternehmensexterner Wissensquellen<br />
und Kapazitäten in Wissenschaft und Wirtschaftspraxis eine allgemein akzeptierte<br />
Option zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Üblicherweise finden solche<br />
Kooperationen jedoch innerhalb klarer vertraglicher Vereinbarungen zwischen den<br />
Partnern statt (z. B. in Form von Lieferpartnerschaften oder Entwicklungskooperationen<br />
zwischen Unternehmen). Diese stärker institutionalisierten Netzwerkformen<br />
lassen aber das stark verteilte Potenzial individueller Wissensträger, insbesondere von<br />
Anwendern und Endabnehmern der jeweiligen Produkte, als aktive Teilhaber an der<br />
Wertschöpfung meist unberücksichtigt (Huff et al. 2006). Mit dem Internet bestehen<br />
jedoch für Unternehmen neue Möglichkeiten des kostengünstigen und informelleren<br />
Wissensaustauschs mit Individuen und der aktiven Beteiligung vormals anonymer<br />
Kunden an der Wertschöpfung. Durch den Verzicht auf vertragliche Regelungen<br />
zugunsten informellerer Mechanismen, wie bspw. eine Selbstorganisation, können<br />
Transaktionskosten eingespart werden. Dadurch kann der Gedanke der Wertschöpfungspartnerschaft<br />
um neue Formen der absatzseitigen Zusammenarbeit und<br />
Arbeitsteilung mit Kunden erweitert werden. Dies ist die dritte Stufe der Evolution der<br />
Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung.<br />
40
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
2.4 Interaktive Wertschöpfung – neue Formen der<br />
Arbeitsteilung und des Wissenstransfers<br />
zwischen Anbietern und Kunden<br />
Bei der interaktiven Wertschöpfung handelt es sich um eine bewusste, arbeitsteilige<br />
Zusammenarbeit zwischen Anbieterunternehmen und Kunden im Sinne eines sozialen<br />
Austauschprozesses. Die Besonderheit dabei ist die aktive und freiwillige Rolle des<br />
Kunden in der Wertschöpfung. Der Kunde ist weder rein passiver Empfänger einer<br />
vom Anbieter autonom geleisteten Wertschöpfung noch wird er zwangsweise in die<br />
Wertschöpfung integriert, wie dies die typische Folge von Rationalisierungsbestrebungen<br />
ist, die eine Bedienung durch Self-Service-Angebote ersetzen. Aus der vom<br />
Anbieter (Hersteller) dominierten Wertschöpfung wird durch die aktive Rolle der<br />
Kunden eine interaktive Wertschöpfung. Das im Folgenden dargestellte Konzept stellt<br />
einen Bezugsrahmen dar, der verschiedene Theorie-Bausteine und Prinzipien zusammenfügt,<br />
die aus der Organisationsforschung sowie dem Innovations-, Technologie-<br />
und Produktionsmanagement abgeleitet werden. Interaktive Wertschöpfung ist<br />
nicht universell anwendbar und soll keine bewährten Konzepte ersetzen. Es handelt<br />
sich vielmehr um eine Ergänzung etablierter Instrumente des Innovations- und<br />
Produktionsmanagements. Bezugspunkt der interaktiven Wertschöpfung können alle<br />
Unternehmensaktivitäten sein (<strong>Piller</strong> 2004). Wir werden uns in diesem Buch auf das<br />
Innovations- und das Produktionsmanagement konzentrieren, dabei aber auch<br />
Anwendungen aus dem Marketing oder After-Sales-Service vorstellen.<br />
Kasten 2–7: User Innovation in Kite-Surfing: Wenn die Abnehmer die Wertschöpfung<br />
dominieren<br />
(Quelle: Eric von Hippel: Democratizing Innovation, Cambridge, MA: The MIT Press 2005)<br />
Kite-Surfing ist eine der derzeit aufstrebenden Trendsportarten. Der Sport wurde von Surfern initiiert,<br />
die – getrieben von dem Wunsch nach immer höheren und weiteren Sprüngen – mit der<br />
Kombination eines Surfboards und eines Segels vom Drachenfliegen experimentierten. Aus diesen<br />
anfänglichen Versuchen entwickelte sich in den letzten Jahren eine beachtliche<br />
Nischenindustrie, die inzwischen viele Anhänger hat. Die Kite-Surfing-Industrie ist ein Beispiel<br />
dafür, wie Kunden als Produktentwickler die Regeln industrieller Wertschöpfung ändern können.<br />
Im Kite-Surfing-Bereich tragen sie nicht nur entscheidend zur Entwicklung des Equipments bei,<br />
sondern übernehmen inzwischen auch viele andere Aufgaben, die früher in der Verantwortung professioneller<br />
Hersteller gesehen wurden, allen voran die Koordination des Produktionsprozesses.<br />
Diese Hersteller, oft gegründet von Sportlern, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, bilden<br />
heute eine ca. 100-Millionen-USD-Industrie, die vor allem die Kites (Drachensegel) entwickelt, produziert<br />
und vertreibt. Um ein neues Produkt im Kite-Surfing erfolgreich umzusetzen, werden einen<br />
Vielzahl an Fähigkeiten benötigt: Kenntnisse über Materialien und deren Eigenschaften für die<br />
Segel, Kenntnisse über Aerodynamik und Physik für die Formen der Segel, Kenntnisse über<br />
Mechanik für die Seilsysteme etc. Die Hersteller sind bei der Entwicklung neuer Designs in der<br />
Regel auf die Kenntnisse beschränkt, die sie in ihren eigenen Wänden haben, meist kleine<br />
Entwicklungsabteilungen aus 3 bis 5 Mitarbeitern. Das Ergebnis sind eher kontinuierliche<br />
Weiterentwicklungen und Verbesserungen bestehender Designs als radikal neue Entwicklungen.<br />
41<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Die Kunden dagegen haben ein viel größeres Potenzial zur Verfügung und keine Werksgrenzen zu<br />
beachten. Initiiert und koordiniert von einigen begeisterten Kite-Surfern existieren heute eine Reihe<br />
von Internet-Communities, in denen die Mitglieder neue Designs für Drachensegel veröffentlichen<br />
und kommentieren. Mit Hilfe einer Open-Source-Design-Software (eine Art CAD-System) können<br />
die Nutzer auf, zum Beispiel, zeroprestige.org neue Designs für die Kites entwerfen und zum<br />
Download bereitstellen. Anderen Nutzern dienen diese Designs als Ausgangslage für eine<br />
Weiterentwicklung, oder sie bekommen vielleicht die Idee für eine radikale neue Entwicklung. Unter<br />
den vielen hunderten teilnehmenden Nutzern sind vielleicht einige, die in ihrem Berufsleben mit<br />
neuen Materialien arbeiten, andere studieren vielleicht Physik oder sind gar als Strömungstechniker<br />
bei einem Autohersteller tätig. Oft kann diese Gruppe von Kundenentwicklern auf einen viel größeren<br />
Pool an Talenten und Fähigkeiten zurückgreifen, als dies einem Hersteller möglich ist. Das<br />
Ergebnis ist eine Vielzahl an neuen Entwicklungen, Tests, Modifikationen und schließlich neuer<br />
Designs für Drachensegel, die allen Mitgliedern der Community zur Verfügung stehen.<br />
Kite-Surfing ist ein besonders spannender Fall, da hier die Kunden als Anwender noch einen<br />
Schritt weiter gehen: Denn was nützt der innovativste neue Entwurf für einen neuen Kite, wenn<br />
dieser nur als Datenfile existiert? Findige Kunden haben herausgefunden, dass an jedem größeren<br />
See ein Segelmacher existiert, der CAD-Files verarbeiten kann. Die Kunden können so ein<br />
Design ihrer Wahl runterladen, diesen File zum Segelmacher bringen und dort professionell in ein<br />
Produkt umsetzen lassen. Da dieser Prozess keinerlei Innovationsrisiko und Entwicklungskosten<br />
für den Hersteller beinhaltet, sind die derart hergestellten Drachen oft um mehr als die Hälfte billiger<br />
als die Produkte der professionellen Kite-Hersteller, und das bei oft überlegender Leistung. Die<br />
Koordinationsleistung des Produzierens wird dabei ebenfalls von den Anwendern übernommen.<br />
Setzt sich diese Entwicklung fort, ist leicht vorzustellen, dass die Kunden Teile dieser Industrie<br />
“übernehmen” werden. Ihre Motivation ist dabei nicht Profitmaximierung oder die Marktführerschaft,<br />
sondern das Streben nach dem bestmöglichen Produkt zur Eigennutzung. Die Anwender,<br />
die sich an diesem Prozess beteiligen, haben verstanden, dass dieses Ziel am besten nicht durch<br />
einen geschlossenen, sondern durch einen offenen Innovationsprozess erreicht werden kann. Ihr<br />
eigenes Engagement ruft Reaktionen und Beiträge anderer hervor und schafft damit einen höheren<br />
Mehrwert für alle.<br />
2.4.1 Prinzipien und Eigenschaften der interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
Das Spektrum der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden kann als<br />
Kontinuum aufgefasst werden. Die Extrempunkte dieses Kontinuums bilden der<br />
gänzlich hersteller- bzw. der gänzlich kundendominierte Wertschöpfungsprozess.<br />
Diese Extrempunkte kommen im so genannten “customer-active paradigm” (CAP) in<br />
seiner Gegenüberstellung zum traditionellen “manufacturing-active paradigm”<br />
(MAP) zum Ausdruck (von Hippel 1986). Im CAP dominieren Kunden den<br />
Wertschöpfungsprozess derart, dass sie alle Wertschöpfungsaufgaben vollständig und<br />
autonom leisten. Das MAP entspricht dem klassischen Fall der unternehmensbezogenen,<br />
autonomen Wertschöpfung (siehe zu diesem Paradigmenwechsel ausführlich<br />
Abschnitt 3.2.3).<br />
Betrachten wir einige Beispiele entlang dieses Kontinuums:<br />
Der in Kasten 2–7 dargestellte Fall von Kundenentwicklungen bei Kite-Surfing ist<br />
ein herausragendes Beispiel für einen Wertschöpfungsprozess, der aus eigener<br />
42
Motivation und mit eigenen Mitteln von den Kunden bzw. Nutzern aus der Hand<br />
der klassischen Hersteller genommen und in eine neue Organisationsform der<br />
Wertschöpfung überführt wurde. Der Wertschöpfungsprozess wird hier von den<br />
Kunden dominiert. Ein ähnliches Beispiel ist auch das Online-Lexikon Wikipedia,<br />
das ebenfalls ohne einen Anbieter bzw. Hersteller im klassischen Sinne ein hochkomplexes<br />
Produkt erstellt, vertreibt und pflegt (siehe Fallstudie in Abschnitt 5.2).<br />
Der zu Beginn dieses Kapitels in Kasten 2–1 dargestellte Wertschöpfungsprozess<br />
von Ford mag zwar heute überholt und Geschichte sein. Jedoch entsprechen die<br />
dort dargestellten Prinzipien genau dem Bild des MAP, der allein durch das<br />
Herstellerunternehmen dominiert wird.<br />
Das Beispiel Dell (Kasten 2–4) dagegen ist eine Mischform zwischen beiden<br />
Extremen, auch wenn hier die Herstellerdominanz noch recht ausgeprägt ist (Dell<br />
hat sich zudem mit zunehmender Unternehmensgröße immer mehr vom originären<br />
Netzwerkmodell weg entwickelt). Jedoch können die Kunden anders als im<br />
klassischen tayloristischen Modell in die Wertschöpfungskette eingreifen und<br />
zumindest Konfigurationsmöglichkeiten selbst nutzen.<br />
Eine wirklich kooperative Organisationsform finden wir dagegen in unserem<br />
ersten Beispiel Threadless (Kasten 1–1). Threadless stellt eine Wertschöpfungsplattform<br />
zur Verfügung, auf der die Kunden dann weit reichende Freiheiten und<br />
Gestaltungsmöglichkeiten haben. Auch wenn der Anbieter auf den ersten Blick als<br />
der Profiteur des Modells scheint (schließlich partizipiert allein Threadless an den<br />
Umsätzen durch den Verkauf von T-Shirts, die durch die Nutzer gestaltet und ausgewählt<br />
wurden), so zeigen Interviews mit den teilnehmenden Kunden jedoch,<br />
dass diese ihre Mitarbeit nicht als kostenlose “Arbeit” für das Unternehmen interpretieren,<br />
sondern vielmehr durch vielschichtige Anreize belohnt werden (Ogawa /<br />
<strong>Piller</strong> 2005, 2006). Diese Anreize reichen von einem Honorar von 1000 $ für die<br />
Gewinner des Designwettbewerbs bis zu Anerkennung, Aufmerksamkeit<br />
(Selbstmarketing) oder Freude am sozialen Austausch in der Community.<br />
Begriffsbestimmung<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Unser Konzept der interaktiven Wertschöpfung geht von einem kooperativen Prozess<br />
aus. Zwischen den Extremen einer gänzlich hersteller- bzw. kundendominierten<br />
Wertschöpfung ergeben sich zahlreiche Varianten einer kooperativen Zusammenarbeit<br />
zwischen Hersteller und Kunde in den unterschiedlichen Phasen des<br />
Wertschöpfungsprozesses. Bezugspunkt der Zusammenarbeit können dabei sowohl<br />
operative Aktivitäten innerhalb eines gegebenen Lösungsraums als auch Tätigkeiten<br />
im Bereich der Produkt- und Prozessentwicklung (Innovation) sein. Sowohl<br />
Unternehmen als auch Kunden können dabei die interaktive Wertschöpfung initiieren.<br />
Im ersten Fall signalisiert das Unternehmen durch Bereitstellung von Ressourcen<br />
und Infrastruktur seine Empfangsbereitschaft für Kundenbeiträge zur Wertschöpfung,<br />
die sich dann von Beginn an als eine kooperative Zusammenarbeit gestaltet. Im zweiten<br />
Fall leisten Kunden Wertschöpfungsaktivitäten zunächst autonom, willigen in<br />
der Folge aber in eine Zusammenarbeit mit und Verwertung durch ein Unternehmen<br />
ein.<br />
43<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Interaktive Wertschöpfung beschreibt einen Prozess der kooperativen (und freiwilligen)<br />
Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Kunde (Nutzer) zwischen den Extremen einer gänzlich<br />
hersteller- bzw. gänzlich kundendominierten Wertschöpfung. Die Zusammenarbeit kann<br />
sich sowohl auf operative Aktivitäten als auch auf eine Produkt- und Prozessentwicklung beziehen.<br />
Der interaktive Wertschöpfungsprozess wird dabei entweder durch das Unternehmen oder<br />
durch den Kunden initiiert.<br />
Prinzipien interaktiver Wertschöpfung<br />
Bevor wir im Verlauf der folgenden Abschnitte unter Bezugnahme auf diverse<br />
Theorien und Konzepte detailliert die einzelnen Prinzipien und Eigenschaften der<br />
interaktiven Wertschöpfung genauer untersuchen, soll einleitend eine erste Übersicht<br />
und Kurzdefinition einzelner Prinzipien für ein Grundverständnis sorgen. Abbildung<br />
26 zeigt dabei den Bezugsrahmen der Argumentation.<br />
Abbildung 2–6: Das Modell der interaktiven Wertschöpfung<br />
Anbieterunternehmen<br />
als Gestalter<br />
der Wertschöpfung<br />
44<br />
Open Innovation<br />
Produktindividualisierung<br />
Interaktionsfeld<br />
Ideengenerierung<br />
Konzeptentwicklung<br />
Prototyp<br />
Produkt/Markttest<br />
Markteinführung<br />
Fertigung<br />
Montage<br />
Vertrieb<br />
After Sales<br />
Wertschöpfungsphasen<br />
Kunden / Nutzer als<br />
Wertschöpfungspartner<br />
Begrenztheit des Lösungsraums<br />
Grad der Kundenintegration<br />
Gestaltungsraum<br />
Prinzipien interaktiver Wertschöpfung:<br />
1) Freiwilliger Interaktionsprozess zwischen Anbieterunternehmen<br />
und Kunden mit Ziel gemeinsamer Problemlösung und sozialer<br />
Austausch<br />
2) Gemeinsamer Problemlösungsprozess ist durch gegenseitigen<br />
Transfer von lokalem Wissen charakterisiert<br />
3) Wissenstransfer vom Kunden zum Anbieter durch<br />
Kundenintegration in die Wertschöpfung<br />
4) Nach der Wertschöpfungsphase, in der die Kundenintegration<br />
erfolgt, werden zwei Formen der interaktiven Wertschöpfung<br />
unterschieden: Open Innovation und Produktindividualisierung<br />
5) Diese Formen der interaktiven Wertschöpfung beschreiben<br />
auch die Grenzen des Lösungsraums; Lösungsraum erweitern<br />
(Open Innovation) vs. Konkretisieren<br />
(Produktindividualisierung)<br />
6) Interaktive Wertschöpfung bildet eine neue Form der<br />
Arbeitsteilung auf Basis von Granularität (Mikro-<br />
Spezialisierung), Selbstselektion und -koordination<br />
7) Bedingung eines angemessenen Kundennutzens durch<br />
Bedürfnisbefriedigung, extrinsische Entlohnung und<br />
intrinsische Anreize<br />
8) Nutzen für Unternehmen sind neue Potentiale zur effizienten<br />
Differenzierung im Wettbewerbs durch individualisierte<br />
und/oder innovative Produkte<br />
9) Interaktive Wertschöpfung verlangt Kompetenzen sowohl auf<br />
Seiten der Kunden als auch der Anbieter<br />
10) Grenzen der interaktiven Wertschöpfung: Trade-off zw.<br />
Aufgabenteilung und internen Transaktionskosten
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
(1) Grundlage der interaktiven Wertschöpfung ist ein freiwilliger Interaktionsprozess<br />
zwischen Unternehmen und Kunden, der sowohl gemeinsamer Problemlösungsprozess<br />
als auch sozialer Austauschprozess ist. Interaktion heißt dabei (Backhaus<br />
1990), dass zwei oder mehr Akteure (in unserem Fall ein/mehrere Anbieterunternehmen<br />
und ein/mehrere Kunden bzw. Nutzer) miteinander in Kontakt treten. Die<br />
Handlungen der Interaktionspartner sind dabei interdependent und sinngemäß aufeinander<br />
ausgerichtet. Es kommt zu einer Abfolge verbaler und/oder nicht-verbaler<br />
Aktionen und Reaktionen zwischen den Akteuren. Der Austausch zwischen den<br />
Akteuren kommt aber nur dann erfolgreich und dauerhaft zustande, wenn die<br />
Interaktion für alle Beteiligten Nutzen stiftet und nicht zu hohe Kosten verursacht.<br />
(2) Inhalt der Interaktion ist ein gemeinsamer Problemlösungsprozess im Kontext der<br />
betrieblichen Wertschöpfungsaufgaben, in welchem die Akteure materielle und immaterielle<br />
Ressourcen zur Lösung der Problemstellung austauschen. Dabei dominiert vor<br />
allem der gegenseitige Zugriff auf lokales Wissen der Partner.<br />
(3) Der Transfer von lokalem Wissen aus der Domäne der Kunden basiert auf dem<br />
Prinzip der Kundenintegration. Die Kunden nehmen an Aktivitäten teil, die zuvor<br />
allein in der Domäne des Anbieters gesehen wurden.<br />
(4) Gemäß den Wertschöpfungsphasen, in die Kunden integriert werden (Ort und<br />
Grad der Kundenintegration), können zwei grundlegende Formen der interaktiven<br />
Wertschöpfung unterschieden werden:<br />
Open Innovation bezeichnet jene Aktivitäten zwischen Herstellerunternehmen<br />
und Kunden, die sich auf den Innovationsprozess beziehen und so auf die<br />
Entwicklung neuer Produkte für einen größeren Abnehmerkreis abzielen.<br />
Produktindividualisierung (Mass Customization) ist hingegen die Zusammenarbeit<br />
zwischen Unternehmen und Kunden, die sich auf Wertschöpfungsaktivitäten<br />
im operativen Produktionsprozess bezieht und auf die Entwicklung<br />
eines individualisierten Produktes für einen Abnehmer abzielt.<br />
(5) Diese Formen beschreiben auch die Grenzen des Lösungsraums. Der Lösungsraum<br />
ist die Gesamtheit aller Problemlösungen, die ein Unternehmen auf Basis vorhandener<br />
Produktarchitekturen und darauf abgestimmter Fertigungs- und Vertriebsprozesse<br />
gegenwärtig anbieten kann. Bei der Produktindividualisierung stehen die Kunden<br />
einem begrenzten bzw. geschlossenen Lösungsraum gegenüber, den sie im Hinblick<br />
auf ein individuelles Produkt konkretisieren. Open Innovation dagegen bezieht sich<br />
auf einen offenen Lösungsraum, den die Kunden erweitern bzw. modifizieren.<br />
(6) Kundenintegration und die kooperative Arbeit an gemeinsamen Aktivitäten ist eine<br />
neue Form der Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Kunden, die auch eigener<br />
Organisations- und Koordinationsmechanismen bedarf. Ein wesentliches Organisationsprinzip<br />
ist die Bildung von Teilaufgaben, die sich an den Transferkosten bzw.<br />
der Lokalität (Impliziertheit) des benötigten Wissens orientiert. Resultat soll eine möglichst<br />
“modulare” bzw. “granulare” Aufgabenstruktur sein, die es einer großen und<br />
heterogenen Kundengruppe ermöglicht, auf Basis jeweiliger Neigungen und<br />
Fähigkeiten selbst eine geeignete Teilaufgabe zu wählen. Hierarchische Aufgaben-<br />
45<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
zuteilungen (wie auch bei der klassischen Selbstbedienung) werden durch eine<br />
Selbstselektion ersetzt.<br />
(7) Eine erfolgreiche interaktive Wertschöpfung muss einen angemessenen Kundennutzen<br />
in Aussicht stellen. Kunden transferieren häufig Eigentums- und Verfügungsrechte<br />
an ihrem Wissen ohne unmittelbare monetäre Gegenleistung zu einem<br />
Hersteller, da sie sich dadurch einen extrinsischen Nutzen der Produktverwendung<br />
versprechen, der sich durch Weitergabe ihres Wissens ggf. erhöht. Allerdings ist teilweise<br />
auch eine monetäre Entlohnung der Kunden vorteilhaft. Hinzu tritt oftmals ein<br />
intrinsischer Nutzen, der sich am Interaktionserlebnis des Kunden festmacht.<br />
(8) Den Nutzen für das Unternehmen bilden die Potenziale für eine effiziente<br />
Differenzierungspolitik durch individualisierte und/oder innovative Leistungsangebote<br />
als Wettbewerbsstrategie (siehe Abschnitt 2.2.3 und 2.3.3) Interaktive<br />
Wertschöpfung bietet einen Zugang zu Marktinformationen, den eine klassische<br />
Marktforschung nicht realisieren kann. Die Folge sind höhere Marktakzeptanz, ein<br />
geringeres Floprisiko neuer Produkte (“fit-to-market”) und weitere Möglichkeiten zur<br />
Differenzierung und Kundenbindung.<br />
(9) Sowohl der Anbieter als auch der Kunde benötigen neue Kompetenzen zur<br />
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben. Auf Seiten der Kunden muss die Bereitschaft und<br />
Fähigkeit vorhanden sein, Beiträge zu dem kooperativen Wertschöpfungsprozess zu<br />
leisten (“Lead User”-Eigenschaften). Vor allem aber müssen Unternehmen, die die<br />
Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung nutzen wollen, Interaktionskompetenzen<br />
aufbauen, die die technische und vor allem organisatorische Plattform der arbeitsteiligen<br />
Aufgabenerfüllung darstellen. Sie konkretisieren sich in interaktionsförderlichen<br />
Organisations-, Kommunikations- und Anreizstrukturen.<br />
(10) Eine interaktive Wertschöpfung hat auch Grenzen, da ein Trade-off zwischen<br />
einer zunehmenden Granularität der Aufgabenteilung einerseits und den daraus resultierenden<br />
internen Koordinationskosten andererseits besteht. Je besser sich eine<br />
Wertschöpfungsaufgabe für eine sehr feingliedrige Aufteilung eignet, desto leichter<br />
kann ein größerer Aufgabenumfang an Kunden zu vergleichsweise geringen<br />
Produktions- und externen Transaktionskosten externalisiert werden. Allerdings<br />
bedarf es der innerbetrieblichen Koordination und Integration der einzelnen<br />
Wertschöpfungsbeiträge, was bei einer feingliedrigen Aufgabenteilung hohe interne<br />
Kosten verursacht.<br />
Abgrenzung zu anderen Konzepten der Kundenintegration und Co-Produktion<br />
An dieser Stelle scheint eine kurze Abgrenzung dieser Prinzipien mit der bestehenden<br />
Literatur zu Kundenintegration und Co-Creation angebracht, die wir bereits zu Beginn<br />
der Einleitung in Kapitel 1 angeführt haben. Die Abgrenzung zu klassischen Formen<br />
von Prosumerismus und Selbstbedienung (“erzwungene” Kundenintegration) ist<br />
durch die Freiwilligkeit der Integration und die Betonung sozialer (reziproker)<br />
Austauschprozesse in unserem Konzept schnell deutlich (hier liegt auch eine wesentliche<br />
Antwort auf die Kritik von Voß und Krieger (2005) am “arbeitenden Kunden”).<br />
Wir teilen die Sichtweise Kleinaltenkamps Schule der Kundenintegration (z. B.<br />
Kleinaltenkamp 1997a), dass eine interaktive Wertschöpfung mit den bestehenden<br />
46
Vorstellungen der Produktions- und Kostentheorie bricht, da sie “(…) speziell im<br />
Gegensatz zum Gutenbergschen Paradigma explizit die Tatsache berücksichtigt, dass<br />
Nachfrager via externer Faktoren auf die Leistungserstellungsprozesse von Anbietern<br />
einwirken und dass einzelbetriebliche Wertschöpfungsprozesse nicht an den Unternehmensgrenzen<br />
enden” (Kleinaltenkamp 1997a: 108). Unser Fokus ist allerdings<br />
nicht die Entwicklung einer “Leistungslehre (…), welche die logisch nichthaltbare<br />
Trennung von Sach- und Dienstleistungen aufgibt” (ebd.), sondern die Untersuchung<br />
von Organisations- und Koordinationsprinzipien kooperativer Formen der<br />
Wertschöpfung. Daraus folgt auch eine stärkere Betrachtung der Sichtweise der<br />
Kunden.<br />
Grün und Brunner (2003) definieren ihr Modell der Co-Produktion als eine<br />
Weiterentwicklung der traditionellen Selbstbedienung zu einem integrierten<br />
Management-Konzept. Ihre Vorstellung von Co-Produktion geht aber von einem<br />
Hersteller aus, der explizit Aktivitäten auf seine Kunden verlagert. Jedoch betonen<br />
auch Grün und Brunner die zentrale Rolle der Kooperation, “d. h. Produzent und<br />
Prosumer müssen trotz möglicher divergierender Interessen zusammenarbeiten, um<br />
das Produkt zu erstellen” (Grün / Brunner 2003: 87). Sie beziehen sich dabei aber weitgehend<br />
auf operative (Produktions-) Prozesse und behandeln den Bereich der<br />
Innovation nur sehr knapp (siehe ähnlich Prahald und Ramaswamys (2000, 2004)<br />
Konzept der Value Co-Creation).<br />
Dies ist die Domäne der Forschungsarbeiten von von Hippel und seiner Co-Autoren.<br />
Diese Arbeiten gehen jedoch originär von einem autonomen Nutzer aus, der ohne<br />
Interaktion mit einem Unternehmen neue Lösungen zur Eigennutzung entwickelt (so<br />
die Vorstellung des klassischen “Lead Users” nach von Hippel 1986; Urban / von<br />
Hippel 1988). Das Konzept so genannter “Toolkits for User Innovation” nach Thomke<br />
und von Hippel (2002) ist dagegen deckungsgleich mit unserem Verständnis (siehe<br />
Abschnitt 3.5.2), da es auf einem expliziten Kooperations- und Interaktionsprozess<br />
zwischen Hersteller und Kunde beruht. Dies ist auch der Hauptgedanke von Normann<br />
und Ramirez (1993, 1998) sowie Wikström (1996a), auf deren Ideen von Interaktivität<br />
und gemeinsamen Wertschöpfungsaktivitäten, wir uns beziehen. Die rasante<br />
Weiterentwicklung im Bereich der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
hat jedoch eine Vielzahl an Organisations- und Koordinationsformen<br />
ermöglicht, die zum Entstehungspunkt der Arbeiten von Norman, Ramirez und<br />
Wikström noch nicht effizient möglich waren.<br />
2.4.2 Kundenintegration und Lösungsraum<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Für eine nähere Beschreibung der interaktiven Wertschöpfung ist es zunächst hilfreich,<br />
das Prinzip der Kundenintegration näher zu beleuchten. Dieses knüpft an den<br />
Gedanken der “Customer Integration” nach Werner Engelhardt und Michael<br />
Kleinaltenkamp an und erweitert die klassische Produktions- und Kostentheorie (z. B.<br />
Engelhardt / Freiling 1995; Kleinaltenkamp 1996, 1997a, 1997b, 2002). In einem engeren<br />
Begriffsverständnis dient der Begriff Kundenintegration zur Beschreibung der<br />
47<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Aktivitäten, die zur Erstellung einer Leistung mit Dienstleistungscharakter notwenig<br />
sind. Danach unterscheidet sich der Leistungs- und Faktorkombinationsprozess von<br />
Sach- und Dienstleistungen nach dem Ausmaß der Kundenintegration (Engelhardt /<br />
Kleinaltenkamp / Reckenfelderbäumer 1993; siehe auch ähnlich Bitner et al. 1997;<br />
Bowen 1986; Langeard et al. 1981).<br />
Kundenintegration als Konzept der Dienstleistungsproduktion<br />
Grundlage ist die Vorstellung einer zweistufigen Struktur des Wertschöpfungsprozesses,<br />
wie sie in Abbildung 2–7 dargestellt ist. Auf der ersten Wertschöpfungsebene<br />
der Vorkombination muss der Hersteller interne Produktionsfaktoren kombinieren<br />
und baut so autonom ein Leistungspotenzial auf (Kleinaltenkamp / Haase 2000).<br />
Eine zweite Stufe, die dieses Potenzial nutzt und die eigentliche aus Kundensicht<br />
wahrgenommene Leistung erstellt, kann aber nicht ohne Integration des so genannten<br />
externen Faktors stattfinden. Externe Faktoren sind nach Kleinaltenkamp (1997a) der<br />
Kunde als Person sowie vor allem Bedürfnisinformationen des Kunden. Ergänzende<br />
externe Faktoren können (physische) Ressourcen des Kunden sein, die für die<br />
Aufbereitung der Bedürfnisinformation notwendig sind, z. B. Material oder Software<br />
oder ein Computer und Internetzugang. Ein externer Faktor wird temporär dem<br />
Leistungsersteller zur Verfügung gestellt und von diesem zusammen mit internen<br />
Produktionsfaktoren im Produktionsprozess kombiniert (Engelhardt / Kleinaltenkamp<br />
/ Reckenfelderbäumer 1993: 301).<br />
Abbildung 2–7: Kundenintegration zur Produktion von Dienstleistungen und individuellen<br />
Produkten (in Anlehnung an Hildebrand 1997: 33)<br />
48<br />
Interne<br />
Faktoren<br />
Interne<br />
Faktoren<br />
Bereitstellungsleistung<br />
(Vorkombination)<br />
Leistungspotenzial<br />
Leistungserstellungsprozess<br />
(Endkombination)<br />
Leistungsergebnis<br />
Autonome Disposition<br />
des Unternehmens<br />
Externe Faktoren<br />
(Integration des<br />
Kunden)<br />
Integrative Disposition<br />
des Unternehmens
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Dieses Prinzip der Kundenintegration gilt nicht nur für reine Dienstleistungen, sondern<br />
ist insbesondere auch im Kontext des Lösungsgeschäfts in der Investitionsgüterindustrie<br />
die Regel (Engelhardt / Freiling 1995; Fließ 2001; Jacob 2003; Kleinaltenkamp<br />
/ Marra 1995). Hier werden meist kundenindividuelle Problemlösungen nachgefragt,<br />
die neben Sachgütern immer auch Dienstleistungsanteile haben, bzw. Produkte,<br />
die in Dienstleistungen eingebettet sind. Der Versuch einer strikten Trennung von<br />
Produkt und Dienstleistung ist somit nicht sinnvoll (Normann / Ramirez 1993). Wann<br />
immer die am Markt verfügbaren, standardisierten Leistungen nicht ausreichen, werden<br />
Kunden in die Wertschöpfung integriert, um eine kundenspezifische Leistung zu<br />
generieren (in diesem Sinne ist jede Dienstleistung eine individuelle Leistung).<br />
Lösungsraum zur Bestimmung von Art und Grad der Kundenintegration<br />
Im Rahmen unserer Konzeption der interaktiven Wertschöpfung greifen wir diese<br />
Sichtweise auf. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei aber der Integration von<br />
Informationen und Kundenwissen, das Aktivitäten entstammt, die klassischerweise<br />
in der Domäne des Anbieterunternehmens gesehen wurden. Wie wir noch ausführlich<br />
in Abschnitt 2.4.3.1 ausführen können, kann diese Information sich nicht nur auf<br />
Bedürfnisse des Kunden beziehen, sondern auch Information über Möglichkeiten zur<br />
Lösung dieses Bedürfnisses enthalten.<br />
Kundenintegration bezeichnet die Kombination von Informationen und Wissen aus der<br />
Domäne des Kunden mit internen Faktoren des Anbieterunternehmens als Voraussetzung der<br />
Leistungserstellung.<br />
Zur Unterscheidung verschiedener Arten der Kundenintegration hilft das Konzept des<br />
Lösungsraums (“Solution space”). Nach von Hippel (2001: 250) ist ein “[solution<br />
space] the pre-existing capability and degrees of freedom built into a given manufacturer’s<br />
production system”. Dies entspricht in der produktionstheoretischen Auffassung<br />
von Kleinaltenkamp et al. dem Leistungspotenzial als Bereitstellung von<br />
Potenzialfaktoren. Die flexible Kombinierbarkeit der Potenzialfaktoren bieten Freiheitsgrade<br />
in der Wertschöpfung, die dem Unternehmen das Angebot eines gewissen Leistungsspektrums<br />
ermöglicht. Allerdings sind dieser Kombinierbarkeit gewisse Grenzen<br />
gesetzt, die aus dem Stand der vorhandenen Technologien und der Leistungsfähigkeit<br />
der Potenzialfaktoren (z. B. Maschinenpark, Software-Infrastruktur, Produktarchitekturen,<br />
Personalkapazitäten, Distributionssystem) folgen.<br />
Der Lösungsraum ist die Gesamtheit aller Problemlösungen, die ein Unternehmen auf Basis<br />
stabiler Produktarchitekturen und darauf abgestimmter Fertigungstechnologien und -prozesse<br />
gegenwärtig herstellen und anbieten kann.<br />
Ziel der tayloristischen Wertschöpfungsprinzipien (Abschnitt 2.2) ist die weitestgehende<br />
Stabilität eines einmal definierten Lösungsraums. Stabilität führt damit auch<br />
zwangsläufig zu einer Begrenztheit des Lösungsraums und damit des entsprechenden<br />
49<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Leistungsspektrums, das ein Unternehmen gegenwärtig kosteneffizient und mit wirtschaftlich<br />
angemessenem Aufwand herstellen und anbieten kann. Im Massenproduktionssystem<br />
von Ford und vielen anderen Unternehmen war dieses Leistungsspektrum<br />
eng begrenzt und lange Zeit unverändert. Kundenintegration findet in einem solchen<br />
Fall nicht statt. Im Beispiel von Dell wurde der Lösungsraum erweitert (Kasten 2–4).<br />
Er ist zum einen durch die Umsetzung der Prinzipien der Netzwerkökonomie deutlich<br />
flexibler und wandlungsfähiger. Zum anderen ist er aber auch offener und weniger<br />
begrenzt und ermöglichte einen Einbezug der Kunden in die Konkretisierung (Konfiguration)<br />
ihrer Wunschleistungen.<br />
Ein Anbieter kann den Lösungsraum durch Innovationstätigkeiten erweitern bzw.<br />
modifizieren. Eine Produktentwicklung schafft neue Produktarchitekturen und damit<br />
neue technische Möglichkeiten zur Befriedigung neuer Kundenbedürfnisse. Eine<br />
Prozessinnovation ermöglicht z. B. die effizientere oder qualitativ hochwertigere Befriedigung<br />
der Kundenbedürfnisse. Eine Kundenintegration kann auch auf dieser<br />
Ebene der Erweiterung bzw. Modifikation des Lösungsraumes ansetzen. Ein Kunde<br />
bzw. Nutzer kann einem Anbieter im Rahmen des Interaktionsprozesses Informationen<br />
über neue Bedürfnisse, aber auch Lösungsansätze zur Befriedigung dieser<br />
Bedürfnisse übermitteln. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Anbieter seinen<br />
Lösungsraum entsprechend offen gestaltet hat. Betrachten Sie noch einmal Abbildung<br />
2–6. Dort zeigt sich, dass die Begrenztheit des Lösungsraums und der (mögliche) Grad<br />
der Kundenintegration genau gegenläufig sind.<br />
Zur Differenzierung verschiedener Formen der interaktiven Wertschöpfung kann<br />
genau dieses Kontinuum beitragen. Die Begrenztheit des Lösungsraums bildet in diesem<br />
Sinne das Abgrenzungskriterium der zwei wesentlichen Objektbereiche der interaktiven<br />
Wertschöpfung, die wir in diesem Buch primär betrachten wollen (siehe auch<br />
Abbildung 2–8):<br />
Bei der Produktindividualisierung (Mass Customization) stehen die Kunden<br />
einem begrenzten bzw. geschlossenem Lösungsraum gegenüber. Die Zusammenarbeit<br />
zwischen Anbieter und Kunde bezieht sich auf Wertschöpfungsaktivitäten<br />
im operativen Produktionsprozess und auf die Konkretisierung eines individualisierten<br />
Produktes für einen Abnehmer.<br />
Open Innovation dagegen bezieht sich auf einen offenen Lösungsraum, den die Kunden<br />
erweitern bzw. modifizieren. Damit geht es um Aktivitäten zwischen Herstellerunternehmen<br />
und Kunden, die sich auf den Innovationsprozess beziehen und<br />
so auf die Entwicklung neuer Produkte für einen größeren Abnehmerkreis abzielen.<br />
In beiden Fällen gibt es wiederum Abstufungen der Intensität der Kundenintegration,<br />
je nachdem auf welcher Stufe des Innovationsprozesses die Kunden gemeinsam mit<br />
den Herstellern aktiv werden bzw. auf welcher Stufe der operativen Prozesse eine<br />
Produktindividualisierung ansetzt (siehe die Untergliederung in Abbildung 2–6).<br />
Diese verschiedenen Optionen werden ausführlich in Teil 3 und 4 diskutiert. Der<br />
Lösungsraum bildet in der interaktiven Wertschöpfung darüber hinaus auch die<br />
Grundlage für die Kommunikation der Problemlösungsfähigkeit eines Anbieters für<br />
ein konkretes Kundenbedürfnis:<br />
50
Abbildung 2–8: Ebenen der interaktiven Wertschöpfung<br />
Interne (Infrastruktur-)<br />
Ressourcen;<br />
Lösungsinformation<br />
Innovationsmanagement<br />
Produktionsmanagement und<br />
Vertriebsmanagement<br />
Interne<br />
Produktionsfaktoren;<br />
Lösungsinformation<br />
Interaktiver<br />
Leistungsentwicklungsprozess<br />
Innovatives<br />
Produkt<br />
Erweiterung<br />
Lösungsraum<br />
Konkretisierung<br />
Interaktiver<br />
Leistungserstellungsprozess<br />
Individualisiertes<br />
Produkt<br />
Ein offener Lösungsraum bedeutet für den Kunden, dass diese als gleichberechtigte<br />
Partner im interaktiven Wertschöpfungsprozess in die Lage versetzt sind, völlig neuartige<br />
Lösungen im Sinne echter Innovationen Zustande zu bringen.<br />
Ein begrenzter Lösungsraum erlaubt dem Kunden lediglich eine Konkretisierung im Sinne<br />
einer Produktindividualisierung (z. B. durch ein Produktkonfigurationssystem) – oder aber<br />
im Falle starker Begrenztheit und hoher Stabilität lediglich die Auswahl aus Standardprodukten<br />
(im letztern Falle wollen wir nicht mehr von Kundenintegration sprechen).<br />
Ein Beispiel zur Gestaltung und Nutzung des Lösungsraums<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Externe Ressourcen:<br />
Bedürfnisinformation<br />
und Lösungsinformation<br />
Interaktive Wertschöpfung im<br />
Sinne von Open Innovation<br />
Externe Ressourcen:<br />
Bedürfnisinformation<br />
Interaktive Wertschöpfung im Sinne<br />
von Produktindividualisierung<br />
Abschließend kann ein weiteres Beispiel der “T-Shirt Economy” das Prinzip der Kundenintegration<br />
und des Lösungsraums gut erläutern. Kasten 2–8 schildert die spannende<br />
Geschichte des Leipziger Unternehmens Spreadshirt, dessen Geschäftsprinzip vollkommen<br />
auf Kundenintegration beruht. Kundenintegration findet hier zunächst im Rahmen der<br />
Produktindividualisierung statt, indem Kunden eigene individuelle Designs gestalten können,<br />
die dann vom Anbieter produziert werden. Das in der Fallstudie beschriebenen Prinzip<br />
des Micro-Merchandising erweitert allerdings die Kundenintegration auch in Tätigkeiten<br />
von Marketing und Vertrieb. Auch hier übernehmen die Kunden typische Aufgaben, die<br />
traditionell in der Domäne eines Anbieters gesehen wurden, wie Markterschließung,<br />
Sortimentspolitik, Werbung und Kundenpflege. Distribution und Fakturierung werden<br />
dagegen von Spreadshirt übernommen. Der Lösungsraum ist allerdings begrenzt. So können<br />
die Kunden nur jene Grundprodukte anbieten, die auch im Sortiment von Spreadshirt<br />
enthalten sind. Auch müssen technische Vorgaben bei der Motiverstellung eingehalten werden,<br />
die mit dem Produktionssystem von Spreadshirt übereinstimmen. Der Lösungsraum<br />
und Grad der Kundenintegration ist aber deutlich weiter als im Fall von Dell, der ebenfalls<br />
auf einer Kundenintegration im Rahmen der Produktindividualisierung beruht.<br />
51<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Kasten 2–8: Spreadshirt: Rasantes Wachstum durch Interaktive Wertschöpfung<br />
(Quellen: Verschiedene Postings von Jochen Krisch in seinem sehr lesenswerten Blog ‘Exciting E-<br />
Commerce’ [www.excitingcommerce.com] zwischen Oktober 2005 und Januar 2006;<br />
Pressemappe des Unternehmens)<br />
Spreadshirt verkauft individuelle T-Shirts und andere Bekleidungsprodukte. Diese können von<br />
jedem einzelnen Kunden selbst gestaltet werden, entweder mit einem eigenen Graphikprogramm<br />
auf dem heimischen PC oder aber durch ein einfaches Mal-Programm im Internet. Anders als bei<br />
Threadless (siehe Kasten 1–1) wird allerdings auf Wunsch jeder Kundenentwurf gefertigt. Das<br />
Unternehmen hat dazu ein hochflexibles Produktionssystem aufgebaut, das per Digitaldruck eine<br />
effiziente Einzelfertigung möglich macht. Eine weitere Besonderheit ist, dass jeder Kunde nicht nur<br />
ein eigenes T-Shirt gestalten und produzieren lassen kann, sondern dieses auch via Spreadshirts<br />
Online-Shoppingsystem an andere Kunden weiterverkaufen kann. Mit wenigen Mausklicks kann<br />
sich jeder Kunde einen eigenen Online-Shop eröffnen und selbst zum Anbieter werden.<br />
Spreadshirt produziert und vertreibt die Waren und kassiert eine Provision (“Micro-Merchandising”<br />
hat das Unternehmen dieses Vertriebssystem getauft). Durch die flexible Einzelfertigung ist dieses<br />
System sowohl für Kunden-Anbieter als auch für Spreadshirt ohne Absatzrisiko.<br />
Durch seine vielen kleinen Minishops in seiner Bedeutung weithin unterschätzt, expandiert Spreadshirt<br />
gerade weltweit. Spreadshirt ist heute der europäische Marktführer unter den T-Shirt-Händlern im<br />
Internet (T-Shirts sind eines der erfolgreichsten E-Commerce-Produkte überhaupt). Seit einem Jahr<br />
baut Spreadshirt sein internationales Geschäft stark aus und ist inzwischen auch in den USA vertreten.<br />
Erste Achtungserfolge konnten die Leipziger dort schon erzielen. So betreibt seit September die populäre<br />
US-Bloggingseite BoingBoing einen Merchandise-Shop bei Spreadshirt. Im Unterschied zu anderen<br />
Händlern und Herstellern bekommen Spreadshirt-Produkte ihren Feinschliff jeweils erst vor Ort.<br />
Jedes Shirt wird “on demand” im Zielland produziert und erst von dort aus verschickt. So können deutsche<br />
Nutzer nach ausgefallenen Motiven in britischen, spanischen oder polnischen Spreadshirt-Shops<br />
stöbern und sich die Shirts, Taschen und Sticker dann aus Leipzig zuschicken lassen.<br />
Da das Unternehmen seine Produkte quasi auf Zuruf vor Ort produziert, fallen bei Spreadshirt keine internationalen<br />
Versandkosten an. Bestellungen deutscher BoingBoing-Fans werden zum Beispiel von<br />
Deutschland aus verschickt. Auch darin sieht Spreadshirt einen Vorteil seiner globalen Expansionsstrategie<br />
mit lokaler Präsenz. Vom Direktvertriebsmodell von Spreadshirt profitieren die Kunden ebenso<br />
wie die lokalen Designer. Letztere partizipieren direkt an den Verkaufserlösen. Wie stark, das bestimmen<br />
sie über den frei wählbaren Verkaufspreis selbst. Über 100.000 Partnershops betreibt Spreadshirt inzwischen<br />
auf seiner Plattform und übernimmt von der Produktion über den Versand bis hin zur Zahlungsabwicklung<br />
alles für seine Handelspartner. Die Partner bekommen eine selbst festgelegte Provision auf<br />
alle Artikel, die sie verkaufen. Spreadshirt gewinnt eigenen Angaben zufolge jede Woche 1.000 neue<br />
Shoppartner hinzu. Jeden Monat kann die Plattform 10.000 neu designte Produkte anbieten. Auch wenn<br />
sich mittlerweile 220 Mitarbeiter um die Abwicklung kümmern, ist diese Produktvielfalt nur möglich, da die<br />
Kunden aktiv an der Wertschöpfung beteiligt sind. Gefragt ist vor allem die Kreativität beim Design der<br />
Motive und das Verkaufstalent der Kunden, um die selbst kreierten “Designerstücke” auch optimal zu vermarkten.<br />
Doch Spreadshirt zieht seine Kunden inzwischen auch weiter in die Wertschöpfung ein. So<br />
sucht das Unternehmen im Januar 2006 in einem offenen Design- und Auswahlprozess ein neues<br />
Firmenlogo. Die Logo-Aktion ist eine von mehreren Initiativen, mit denen Spreadshirt die Design-<br />
Community stärker aktivieren und an sich binden will. Erst kürzlich hat Spreadshirt zusammen mit dem<br />
London Design Festival die besten Shirt-Designer gesucht und ausgezeichnet.<br />
Auszug aus einem Interview mit Spreadshirt-Gründer Lukasz Gadowski<br />
Frage: In der New-Economy-Phase hatten die meisten Unternehmer [oft] zu viel Fantasie, mit den<br />
bekannten schädlichen Folgen für ihre Firmen.<br />
52
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Die Erwartungen, die insbesondere E-Commerce vor Jahren ausgelöst hat, waren sicherlich<br />
übertrieben. Doch ich bin mir nach meinen Erlebnissen der letzten Jahre sicher, dass es noch<br />
etwas Schlimmeres als zu viel Fantasie gibt: nämlich zu wenig Fantasie. Das trifft ja besonders<br />
die Unternehmen mit neuen Ideen – zu denen ich natürlich auch Spreadshirt zähle – gerade in<br />
ihrer kritischsten Phase, in der sie sich nach Unterstützung umsehen. Was Matthias (Anm.:<br />
Matthias Spieß, Mitgründer von Spreadshirt) und ich uns an unqualifizierter Kritik anhören mussten<br />
und welche Zeitverschwendung es war, Investoren von unserem Geschäftsmodell überzeugen<br />
zu wollen. Die haben ja gar nicht richtig zugehört. Schon mit dem Wort “E-Commerce”<br />
war es meistens vorbei. Ich habe nie begriffen, wieso diese Leute nicht wenigstens versucht<br />
haben, einmal unvoreingenommen und aus einer Art antizyklischen Perspektive an die Sache<br />
zu gehen.<br />
Die Investoren konnten Sie nicht überzeugen. Wie haben Sie aber genau dies bei Ihren Kunden<br />
geschafft?<br />
Durch hohen Kundennutzen. Bei uns hat man sein Wunschshirt schon nach 2-3 Tagen in den<br />
Händen, und das bei hoher Druckqualität und ohne jegliche Mindestabnahme! Verglichen mit dem<br />
herkömmlichen Prozedere von Siebdruck mit Vorlaufzeiten von 2-3 Wochen sowie Mindestabnahmen<br />
von 30 oder gar 50 Stück ist das schon ein gewaltiger Quantensprung! Weiter<br />
ermöglicht das Spreadshirt-Angebot allen Homepage-Besitzern vom Privatmann bis zum<br />
Großunternehmen, über ihre Website eigene Merchandising-Artikel zu vertreiben und so ohne<br />
Aufwand und Kosten zusätzliche Gewinne zu machen. Ich glaube, dass dieses “Rundum-Sorglos-<br />
Paket” ein entscheidender Erfolgsfaktor für uns ist. Letztendlich trifft der Kunde alle kreativen<br />
Entscheidungen, wird aber gleichzeitig nicht mit der Produktion, dem Versand, dem Kundenservice<br />
usw. belastet.<br />
Kasten 2–9: Literaturempfehlungen zu grundlegenden Schriften zur Kundenintegration<br />
Bowen, David (1986). Managing customers as human resources in service organizations.<br />
Human Resource Management, 25 (1986) 3 (Fall): 371-383.<br />
Engelhardt, Werner / Freiling, Jörg (1995). Die integrative Gestaltung von Leistungspotentialen.<br />
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 47 (1995) 10: 899-918.<br />
Fließ, Sabine (2001). Die Steuerung von Kundenintegrationsprozessen: Effizienz in Dienstleistungsunternehmen.<br />
Wiesbaden: Gabler 2001.<br />
Jacob, <strong>Frank</strong> (2003). Kundenintegrations-Kompetenz: Konzeptionalisierung, Operationalisierung<br />
und Erfolgswirkung. Marketing-Zeitschrift für Forschung und Praxis, 25 (2003) 2: 83-<br />
98.<br />
Kleinaltenkamp, Michael (1996). Customer Integration – Kundenintegration als Leitbild für das<br />
Business-to-Business-Marketing. in: Michael Kleinaltenkamp / Sabine Fließ / <strong>Frank</strong> Jacob<br />
(Hg.): Customer Integration: Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration, Wiesbaden:<br />
Gabler 1996: 13-24.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> T. (2002). Der Kunde als Wertschöpfungspartner. In: Horst Albach<br />
et al. (Hg.): Wertschöpfungsmanagement als Kernkompetenz, Wiesbaden: Gabler 2002:<br />
27-52.<br />
53<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
2.4.3 Arbeitsteilung und Organisation in der interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
2.4.3.1 Arbeitsteilung und Nutzen<br />
Üblicherweise sind die Rollen und Funktionen, die Anbieter und Kunden in der Wertschöpfung<br />
einnehmen, klar verteilt. Diese Unterscheidung basiert auf den verschiedenen<br />
Vorteilen, die sich jeweils für die beiden Parteien aus der Wertschöpfung ergeben.<br />
Hersteller (bzw. Anbieter) profitieren typischerweise als Produktentwickler und<br />
Produzenten vom Verkauf ihrer Leistung an viele Kunden. Kunden profitieren als<br />
Abnehmer dementsprechend von der Nutzung der Leistungen für den Eigenbedarf<br />
im Sinne der Bedürfnisbefriedigung. Dabei ist unerheblich, ob der Kunde ein Konsument<br />
oder aber auch ein Unternehmen ist, das z. B. eine Maschine kauft und diese<br />
dann zur Erstellung weiterer Produkte nutzt. Die herkömmliche Annahme ist, dass der<br />
Verkauf an viele Abnehmer gegenüber der Nutzung für den Eigenbedarf die überlegene<br />
Art und Weise ist, um die Kosten der Produktentwicklung und -herstellung zu<br />
decken und einen Profit zu erwirtschaften. Deshalb übernehmen in der Regel Herstellerunternehmen<br />
diese Wertschöpfungsaktivitäten.<br />
Diese Annahme muss allerdings unter bestimmten Bedingungen in Frage gestellt werden.<br />
Wenn für Kunden der relative Nutzenvorteil höher ist als für das Unternehmen,<br />
dann lohnt sich der Entwicklungs- und Herstellungsaufwand unter Umständen eher<br />
für Kunden als für Unternehmen. Je größer dieser relative Vorteil für Kunden ist, desto<br />
wahrscheinlicher ist es, dass die Produktentwicklung und -herstellung von Kunden<br />
ausgeht oder sogar ganz von ihnen übernommen wird (von Hippel 1986; 1988). So hat<br />
die Forschergruppe um Eric von Hippel vom MIT beobachtet, dass Kunden in verschiedenen<br />
Produktdomänen in erstaunlich hohem Ausmaße Produkte für den<br />
Eigenbedarf modifizieren oder (als Prototypen) sogar vollständig ohne die Mitwirkung<br />
eines herstellenden Unternehmens entwickeln (siehe zur Dokumentation dieser<br />
Arbeiten von Hippel 2005; siehe auch Abschnitt 3.2.3, wo wir diesen Aspekt vertiefend<br />
darstellen). Wir haben dies bereits am Beispiel Kite-Surfing (Kasten 2–7) gesehen:<br />
Hier gingen maßgebliche Innovationen von den Kunden aus, da diese schneller als die<br />
Hersteller neue Bedürfnisse erkannt hatten und auch ein größeres Set an Kompetenzen<br />
besaßen, um daraus resultierenden Probleme zu lösen.<br />
Kunden können gegenüber Unternehmen insbesondere unter zwei Bedingungen einen<br />
größeren Nutzen aus der Entwicklung und Herstellung von Produkten ziehen:<br />
(1) Je heterogener die Kundenbedürfnisse in einem Markt verteilt sind, desto schwerer<br />
ist es für einen Hersteller, die Marktnachfrage durch ein Standardprodukt zu befriedigen.<br />
Ein Markt zeichnet sich durch eine starke Heterogenität aus, wenn es viele<br />
Marktsegmente gibt, die sich jeweils durch spezifische Präferenzen für bestimmte<br />
Produkteigenschaften auszeichnen. Dadurch wird prinzipiell für jedes Marktsegment<br />
eine spezielle Produktvariante erforderlich, um den nachgefragten Eigenschaften im<br />
jeweiligen Marktsegment gerecht zu werden. Im Extremfall entstehen “Segments-of-one”<br />
(Peppers / Rogers 1997), d. h. die Präferenzen jedes Nachfragers werden so einzigartig,<br />
54
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
dass prinzipiell jeder einzelne Nachfrager zur Bedürfnisbefriedigung eine speziell angefertigte<br />
Produktvariante erhalten müsste. Dieser Zustand scheint heute in vielen Märkten<br />
immer mehr Norm als Ausnahme zu werden (siehe zur Begründung Abschnitt 2.2.3; für<br />
einen empirischen Nachweis auf Basis der Cluster-Analyse siehe <strong>Frank</strong>e / Reisinger 2003).<br />
Eine zunehmende Heterogenisierung der Bedürfnisse, verbunden mit einer<br />
Verkürzung der Lebenszeiten einzelner Produktspezifikationen, resultiert folglich in<br />
einer Nachfrage nach immer mehr Produktvarianten. Dies führt dazu, dass die<br />
Realisierung von Skaleneffekten (siehe Abschnitt 2.2.2) für den Hersteller immer<br />
schwieriger wird. Kleinere Absatzmengen einer Produktvariante erschweren die<br />
Amortisation von Investitionen in Produktionsanlagen und treiben die Stückkosten in<br />
die Höhe. Unter solchen Bedingungen können Entwicklungs- und Herstellungskosten<br />
die Vorteile für ein Unternehmen aus dem Verkauf des Produktes leicht aufheben, wo<br />
hingegen sich für Kunden der Entwicklungs- und Herstellungsaufwand für die eigene<br />
Nutzung immer noch lohnen kann. Unternehmen können die Produktentwicklung<br />
und -herstellung dann entweder den Kunden überlassen oder aber neue Kostensenkungspotenziale<br />
und Spielraum für Preissteigerungen im Rahmen einer Produktindividualisierungsstrategie<br />
erschließen.<br />
(2) Der Bedarf lokalen Wissens für die Produktentwicklung und -herstellung stellt<br />
eine weitere Herausforderung für Hersteller im Wertschöpfungsprozess dar. Der<br />
Bedarf ergibt sich aus der notwendigen Aufgabe des Unternehmens, marktseitige und<br />
technologische Unsicherheiten am “fuzzy front end” (Wheelwright / Clark 1992) zu<br />
reduzieren. Dazu müssen Anbieter Informationen aus der Domäne der Kunden (und<br />
aus anderen externen Quellen) in die interne Wertschöpfung transferieren. Grundsätzlich<br />
sind zwei Arten von Information zu unterscheiden, die für den Wertschöpfungsprozess<br />
benötigt werden (Thomke 2003):<br />
Bedürfnisinformation (“need information”) über die Kunden- und Marktbedürfnisse,<br />
d. h. Informationen über die Präferenzen, Wünsche, Zufriedenheitsfaktoren<br />
und Kaufmotive der aktuellen und potenziellen Kunden bzw. Nutzer<br />
einer Leistung. Der Zugang zu Bedürfnisinformation beruht auf einem intensiven<br />
Verständnis der Nutzung- und Anwendungsumgebung der Abnehmer.<br />
Lösungsinformation (“solution information”) beschreibt die technologischen<br />
Möglichkeiten und notwendigen Potenziale, um Kundenbedürfnisse möglichst<br />
effizient und effektiv in eine konkrete Leistung zu überführen. Lösungsinformation<br />
bildet folglich für Hersteller die Entscheidungsgrundlage, um zu erkennen, welche<br />
Kundenbedürfnisse im Rahmen des unternehmerischen Wertschöpfungsprozesses<br />
überhaupt wirtschaftlich zu erfüllen sind.<br />
Klassischerweise wird Bedürfnisinformation der Kundendomäne und Lösungsinformation<br />
der Herstellerdomäne zugeordnet. Für eine erfolgreiche Wertschöpfung<br />
müssen beide Informationsarten an einem Ort (beim Anbieter) zusammengeführt werden.<br />
Ein Herstellerunternehmen versucht deshalb durch den Einsatz verschiedenster<br />
Marktforschungsinstrumente Bedürfnisinformation am Markt abzugreifen, um dann<br />
unter Anwendung intern vorhandener Lösungsinformation (bzw. unter Erwerb neuer<br />
Lösungsinformation, z. B. neue Technologien oder Mitarbeiter) ein passendes Produkt<br />
55<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
zu kreieren. Im so genannten “manufacturing-active paradigm” ist Wertschöpfung<br />
dann alleinige Aufgabe von Unternehmen; Kunden nehmen nur eine passive Rolle ein:<br />
“speaking only when spoken to” (von Hippel 1978a).<br />
Allerdings gerät dieses Paradigma ins Wanken, wenn die Bedürfnisinformation in der<br />
Domäne der Kunden eher den Charakter von implizitem Wissen hat. Dann kann der<br />
notwendige Transfer in einer brauchbaren Form so aufwändig und kostspielig sein,<br />
dass sich die Wertschöpfung ggf. nicht mehr für Unternehmen, sondern eher für<br />
Kunden als Wissensträger lohnt. In diesem Fall wollen wir von “lokalem Wissen” bzw.<br />
“sticky information” sprechen. Wichtig ist dabei zu betonen, dass auch in der<br />
Nutzerdomäne Lösungsinformation vorhanden sein kann. Gerade bei funktional<br />
neuen Innovationen (und nicht nur Verbesserungsinnovationen) beruht eine innovative<br />
Problemlösung häufig auf Verfahrungswissen, das mit dem vorhandenen Wissen<br />
eines Herstellers bricht. Manche besonders fortschrittliche Nutzer sind eine wertvolle<br />
Quelle für dieses Lösungswissen (siehe auch Abschnitt 3.2.1).<br />
2.4.3.2 Logik der Arbeitsteilung nach dem Konzept der<br />
“wissensökonomischen Reife”<br />
Ein Konzept zur Bestimmung der Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Nachfragern<br />
ist das Konzept der wissensökonomischen Reife (siehe dazu grundlegend Dietl 1993).<br />
Es zielt darauf ab, Teilaufgaben so zu bilden, dass zwischen ihnen nur eine geringe<br />
Interdependenz besteht. Eine hohe Interdependenz zwischen Teilaufgaben liegt z. B.<br />
vor, wenn bestimmter Teile des menschlichen Wissens nur schlecht artikulierbar sind<br />
und deshalb nur mit sehr hohen Transaktionskosten übertragbar sind. Dies können z.<br />
B. durch Erfahrung erworbene körperliche Fähigkeiten oder in unserem Kontext die<br />
latenten Wünsche von Kunden nach neuartigen Produkten und Möglichkeiten zur<br />
Bedürfnisbefriedigung sein. Der Transfer dieses impliziten, lokalen Wissens stellt ein<br />
ökonomisches Problem dar, weil mit einem ressourcenaufwändigen Transferverfahren<br />
prohibitiv hohe Transaktionskosten entstehen (Picot / Dietl / Franck 2005).<br />
Das Konzept der wissensökonomischen Reife legt nahe, die Bildung von Teilaufgaben,<br />
die an Kunden übertragen werden sollen, so zu organisieren, dass der ressourcenaufwändige<br />
Wissenstransfer möglichst gering ist, das heißt, dass möglichst niedrige<br />
Transaktionskosten verursacht werden. Darüber hinaus kann der Transfer lokalen<br />
Wissens auch umgangen werden, indem Hersteller und Anbieter (Informations-)<br />
Produkte und Artefakte austauschen, die das lokale Kundenwissen bereits verkörpern,<br />
z. B. Blueprints von Produktkonzepten. Ein Beispiel sind die CAD-Files im Kite-<br />
Surfing-Beispiel (Kasten 2–7) oder die T-Shirt-Designs bei Spreadshirt (Kasten 2–8).<br />
Anstelle der Übertragung der Information “ich will einen Kite, der bei starken<br />
Windverhältnissen eine hohe Stabilität bietet, und dazu sollte das Seil XY straffer sein”<br />
übertragen die Kunden hier einen CAD-File, der bereits abbildet, wie dazu Seil XY anders<br />
befestigt werden muss. Gleichermaßen bei Spreadshirt: Anstelle des Bedürfnisses<br />
“Ich will ein T-Shirt mit einem Pandabären, der cool und nicht drollig schaut”, übermitteln<br />
die Kunden hier eine Zeichnung, um diesen subjektiven Gesichtsausdruck zu<br />
erhalten.<br />
56
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Für die Weiterverarbeitung durch das Unternehmen ist der Wissenstransfer dann<br />
nicht mehr nötig. Derartige Produkte und Artefakte, die weiterverwertet werden<br />
können, ohne dass ein Rückgriff auf das Kundenwissen erforderlich ist, besitzen wissensökonomische<br />
Reife. Das bedeutet, dass die Teile des unternehmerischen<br />
Wertschöpfungsprozesses, die einen hohen Grad an wissensökonomischer Reife besitzen,<br />
geeignete Ansatzpunkte für die Zerlegung der gesamten Wertschöpfungsaufgabe<br />
sind. So gebildete Teilaufgaben können an Kunden übertragen werden. Es entfällt<br />
der aufwändige Wissenstransfer durch den einfachen Austausch der Ergebnisse.<br />
2.4.3.3 Logik der Arbeitsteilung nach dem Konzept der “sticky<br />
information”<br />
Ein sehr ähnliches Konzept hat von Hippel (1994) unabhängig von Dietl speziell für<br />
den Wissenstransfer zwischen Herstellern und Kunden im Innovationsprozess entwickelt.<br />
Er nennt Bedürfnisinformationen “sticky information” (“klebrige” Informationen).<br />
“Stickiness” definiert er als “the incremental expenditure required to transfer<br />
a unit [of information] from one place to another, in a form that can be accessed by<br />
the recipient. When this expenditure is low, information stickiness is low; when it is<br />
high, stickiness is high” (von Hippel 1994: 430). Die Gründe für hohe “stickiness” können<br />
in den Merkmalen der Information selbst liegen: z. B. implizites Wissen, Spezifität<br />
von Informationen, Grad und Art der Kodierung (Nelson 1982; Pavitt 1987; Polanyi<br />
1958; Rosenberg 1982). Alternativ können die Gründe für stickiness in den Merkmalen<br />
des Informationssuchenden bzw. -liefernden liegen, z. B. in der mangelnden Aufnahmefähigkeit<br />
des Informationssuchenden (Vorwissen, Qualifikation) oder in der<br />
Kapazität der Informationsaufnahme (z. B. fehlende Instrumente oder Fehlen von<br />
komplementären Informationen) (Cohen / Levinthal 1990).<br />
Bedürfnisinformation kann in der Kundendomäne so “sticky” sein, dass die Kosten für<br />
den notwendigen Informationstransfer vom Kunden zum Hersteller den Nutzen für<br />
das Unternehmen übersteigen. Bei hoher “stickiness” lokaler Bedürfnisinformation<br />
sind zahlreiche, zeitaufwändige Iterationen und “Trial-and-Error”-Zyklen zwischen<br />
Unternehmen und Kunden für den Transfer notwendig. Bei Heterogenität der<br />
Kundenbedürfnisse kommt hinzu, dass sich durch einmalige Aufwendungen kaum<br />
Skaleneffekte im Informationstransfer für andere Kunden erzielen lassen. Im Prinzip<br />
entstehen dann Transferkosten für jeden einzelnen Kunden.<br />
Im Extremfall ist “stickiness” so hoch, dass Kunden in einer besseren Kostenposition sind<br />
als Unternehmen in Bezug auf die Produktentwicklung und -herstellung. Wenn besonders<br />
fortschrittliche Kunden neben Bedürfnisinformation auch ausreichend Lösungsinformation<br />
besitzen, können sie Produkte vollständig und eigenständig entwickeln und<br />
herstellen (diese Kunden werden als “Lead User” bezeichnet, siehe Abschnitt 3.3.1). Im<br />
hier diskutierten Konzept der interaktiven Wertschöpfung gehen wir vom Regelfall aus:<br />
der Vorteil von Kunden bezieht sich auf einige Wertschöpfungsaufgaben des<br />
Unternehmens, zu deren Ausführung lokale Bedürfnisinformation von hoher “stickiness”<br />
benötigt wird. Zur Lösung dieses Problems schlägt von Hippel (1990) genau wie auch Dietl<br />
(1993) Arbeitsteilung vor (“task partitioning”): Der Wertschöpfungsprozess wird in<br />
57<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Teilaufgaben zerlegt, für die entweder primär Bedürfnisinformationen von Kunden oder<br />
aber primär Lösungsinformationen von Unternehmen notwendig sind. Aufgaben, die<br />
weitgehend Lösungsinformation benötigen, verbleiben im Unternehmen. Aufgaben, die<br />
weitgehend Bedürfnisinformation (“sticky information”) benötigen, werden auf den<br />
Kunden übertragen. Der Transfer von “sticky information” findet dann jeweils innerhalb<br />
des Arbeitsgebiets des Unternehmens bzw. der Kunden statt (von Hippel / Katz 2002).<br />
Die Konzepte der “wissensökonomischen Reife” und der “sticky information” bilden<br />
so Erklärungsansätze, die zu ähnlichen Ergebnissen für neue Formen der Arbeitsteilung<br />
zwischen Unternehmen und Kunden gelangen:<br />
Aufgaben, die an Kunden übertragen werden, sollten überwiegend implizites<br />
Wissen der Kunden zum Einsatz bringen (“sticky information”-Ansatz).<br />
Sie sollten in sich abgeschlossen sein, d. h. einen hohen Grad wissensökonomischer<br />
Reife besitzen.<br />
Der ursprünglich vom Unternehmen dominierte Wertschöpfungsprozess wird so in<br />
unternehmens- und kundendominierte Teilaufgaben zerlegt, je nach dem, welche<br />
Partei das jeweils relevante lokale Wissen besitzt. Abbildung 2–9 fasst die Logik der<br />
Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Kunden zusammen.<br />
Abbildung 2–9: Logik der Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Kunden<br />
2.4.3.4 “Commons-based Peer Production” als Organisationsprinzip<br />
Die Notwendigkeit des Transfers von Bedürfnis- und Lösungsinformation und die<br />
durch die “stickiness” dieser Informationen begründeten Probleme bzw. Kosten dieses<br />
Transfers haben gezeigt, warum grundsätzlich eine Arbeitsteilung zwischen<br />
Herstellerunternehmen und Kunden sinnvoll sein kann. Im Folgenden wollen wir<br />
58<br />
Impliztes Wissen & „Stickiness“:<br />
Prohibitiv hohe Transaktionskosten<br />
des direkten Wissenstransfers<br />
Unternehmensdomäne<br />
Lokale<br />
Lösungsinformation<br />
Informationsartefakte<br />
Lokale<br />
Lösungsinformation<br />
Teilaufgabe<br />
1<br />
Teilaufgabe<br />
2<br />
…<br />
Teilaufgabe<br />
n<br />
Kundendomäne<br />
Lokale<br />
Bedürfnisinformation<br />
Lokale<br />
Lösungsinformation
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Möglichkeiten einer geeigneten Organisationsform für die Arbeitsteilung zwischen<br />
Anbieter und Kunden betrachten. Grundlage dieser Betrachtung ist das Modell der<br />
“Commons-Based Peer Production” von Benkler (2002).<br />
Open-Source-Software-Produktion als Modell einer neuen Organisation der Wertschöpfung<br />
In den klassischen Modellen wird Wertschöpfung durch Individuen entweder als Angestellte<br />
in einem Unternehmen (gesteuert durch die Anweisungen von Vorgesetzten)<br />
oder als Akteure auf Märkten (gesteuert durch Preise) vollzogen oder in kooperativen<br />
Zwischenformen dieser Modelle (Coase 1937; Williamson 1985). Benkler jedoch beobachtet<br />
eine verteilte Wissensproduktion im Internet, die mit diesen klassischen Koordinationsmechanismen<br />
der Arbeitsteilung nicht vereinbar scheint. Im Internet sind heute in<br />
einer Vielzahl von Projekten Nutzer mit der gemeinsamen Produktion und Weiterentwicklung<br />
von Wissen und Informationsprodukten beschäftigt. Die Entwicklung von<br />
Open-Source-Software ist wohl populärste Bewegung dieser Art (siehe Abschnitt 3.5.4).<br />
Hierbei werden eine große Anzahl von Nutzern in einer Vielzahl von Aktivitäten tätig,<br />
angefangen von der Definition eines Problems über dessen Ausschreibung in einer<br />
Community, der Bereitstellung einer Lösung dieses Problems – oft in Zusammenarbeit<br />
zwischen verschiedenen Nutzern –, dem Testen und De-Bugging dieser Lösung und<br />
schließlich ihrer Verbreitung und Dokumentation. Das zentrale Organisationsprinzip von<br />
Open Source Software ist, dass die Ergebnisse der gemeinsamen Entwicklungsarbeit frei<br />
und ohne die traditionellen Restriktionen zum Kopieren und Nutzen proprietärer Software<br />
verfügbar sind. Niemand besitzt die Software in einem traditionellen Verständnis<br />
oder kontrolliert ihre Verwendung. Das Ergebnis ist eine lebhafte, engagierte und hochproduktive<br />
Form der Zusammenarbeit, wobei die Beteiligten nicht in Hierarchien organisiert<br />
sind und ihre Projektbeteiligung auch nicht an Preissignalen ausrichten.<br />
Benkler (2002) strukturiert drei beispielhafte Typen von Aktivitäten bzw. Ansatzpunkten:<br />
Generation of Content, z. B. die Identifikation von Marskratern auf einer NASA-<br />
Website;<br />
Accreditation/Determination of Relevance, z. B. Buchkritiken bei Amazon oder<br />
Prüfung von Internet-Links für eine öffentliche Suchmaschine sowie<br />
Value-added Distrubution, z. B. Korrekturen und Fehlerbeseitigung in öffentlichen<br />
Enzyklopädien wie Wikipedia (siehe Abschnitt 5.2) oder das Gutenberg-Projekt.<br />
Diesen Phänomenen ist gemein, dass sich die Wertschöpfung in der “Informationssphäre”<br />
abspielt und im Wesentlichen ohne klassische Eigentumsrechte, Verträge oder<br />
hierarchische Organisationsstrukturen auskommt. Benkler (2002) argumentiert, dass<br />
hier ein völlig neues Wertschöpfungsmodell entsteht, welches unter geeigneten<br />
Bedingungen einen systematischen Vorteil gegenüber den klassischen hierarchischen,<br />
hybriden oder marktlichen Formen hat, die sich primär auf eine formale Koordination<br />
durch den Preis- oder Weisungsmechanismus stützen. Der Begriff “commons-based<br />
peer-production” soll dieses Modell von den klassischen Modellen der Kooperation<br />
durch Hierarchien und Märkte (Preise) abgrenzen, die auf einer klaren Property-<br />
Rights-Verteilung und Verträgen beruhen. Zentrales Charakteristikum der Peer-<br />
59<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Production ist, dass Gruppen von Individuen erfolgreich in (oft sehr großen) Projekten<br />
zusammenarbeiten und dabei durch eine Vielzahl unterschiedlicher Anreize und<br />
sozialer Signale motiviert werden, jedoch eher nicht durch Marktpreise oder<br />
Anweisungen eines Vorgesetzen. Ein wesentlicher Mechanismus dieses Modells ist so<br />
auch die Selbstselektion der an der Wertschöpfung Beteiligten, die effizienter bei der<br />
Identifikation von beteiligten Wissensträgern und deren Zuordnung zu entsprechenden<br />
Wertschöpfungsaufgaben sein kann (siehe z. B. Schoder / Fischbach 2002; Schoder<br />
/ Fischbach / Schmitt 2005 zu den technsichen Aspekten einer Peer-to-Peer-Produktion<br />
im Sinne der Wirtschaftsinformatik, ein verwandtes, aber inhaltlich anderes Konzept).<br />
Vorteile der Commons-Based Peer Production gegenüber klassischen Organisationsformen<br />
Benkler bezieht sein Modell vor allem auf die Produktion von Information oder<br />
“Kulturgütern” (Musik, Schriften etc.), da hier die notwendigen Produktionsmittel<br />
(Kapitalanlagen wie Computer und Kommunikationsmittel) weit verbreitet und nicht<br />
an einer Stelle konzentriert sind (wie z. B. in einem Stahlwerk). Zur Produktion dieser<br />
Güter ist das Peer-Production-Modell aus zwei Gründen besser als die klassische<br />
Aufgabenerfüllung in Hierarchien oder Märkten.<br />
(1) Das Modell ist besser in der Identifikation und Allokation der genau passenden<br />
Humankapazitäten (besondere Fähigkeiten einzelner Individuen) zu einzelnen Aufgaben<br />
des Informationsproduktionsprozesses. Er begründet dies mit den so genannten<br />
“Informationsopportunitätskosten” (“information opportunity cost”). Es hat geringere<br />
Verluste (Opportunitätskosten) als die klassischen Modelle, um aus der Gesamtmenge<br />
möglicher Aufgabenträger genau den am besten passenden Akteur zu identifizieren<br />
und zur Aufgabenerfüllung zu motivieren. Das Peer-Production-Modell “loses<br />
less information about who the best person for a given job might be than do either of<br />
the other two organizational modes” (Benkler 2002: 1). Ein Manager, der eine Aufgabe<br />
einem seiner vielen Mitarbeiter zuordnet, nutzt dabei oft nicht alle möglichen Informationen,<br />
ob dieser Mitarbeiter und nicht vielleicht ein anderer der beste Aufgabenträger<br />
anhand seiner persönlichen Fähigkeiten und Motivation ist (da diese Information insbesondere<br />
bei Nicht-Routine-Aufgaben sehr “sticky” ist). Wird aber eine Aufgabe nicht<br />
zugeordnet, sondern “ausgeschrieben”, kann ein Akteur diese selbst bewerten und<br />
sein eigenes Wissen über seinen Kenntnisstand und seine Motivation nutzen um zu<br />
entscheiden, ob er diese Aufgabe lösen kann oder nicht:<br />
“The idea is that different modes of organizing human activity entail different losses of<br />
information relative to an ideal state of perfect information. […] The different strategies<br />
differ from each other in their ‘lossiness’ […] This difference among modes of organizing<br />
in terms of the pattern of lossiness is that mode’s information opportunity cost”<br />
(Benkler 2002: 27).<br />
(2) Weiterhin unterliegt die Effizienz der Aufgabenzuweisung durch Selbstselektion<br />
substantiellen Skaleneffekten durch Spezialisierungseffekte. Stehen große Gruppen<br />
von potenziellen Mitwirkenden einer großen Zahl an Teilaufgaben und Informationsressourcen<br />
gegenüber, dann ist es recht wahrscheinlich, dass sich für eine<br />
bestimmte Aufgabe ein Akteur findet, der zu ihrer Lösung besonders geeignet (spezi-<br />
60
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
alisiert) und/oder motiviert ist und diese Fähigkeiten auch in mehrere Projekte einbringen<br />
kann. Wenn dabei auf die Definition von Eigentums- und Verfügungsrechten<br />
durch Verträge als Grundlage einer Zusammenarbeit zwischen den Akteuren verzichtet<br />
wird (siehe hierzu Abschnitt 2.4.3.5), können durch das Peer-Production-Modell die<br />
externen Transaktionskosten der Interaktion beträchtlich gesenkt werden. Die Akteure<br />
können selbst entscheiden, welches Problem sie lösen und auf welche (freien)<br />
Informationsressourcen sie dabei zurückgreifen, und mit wem sie dabei zusammenarbeiten<br />
wollen. Das bedeutet, je mehr potenziell einzubindende Akteure im Hinblick<br />
auf eine große Anzahl von Teilaufgaben im Kontext vorhanden sind, je höher ist die<br />
Effizienz dieser Organisationsform im Vergleich zu den konventionellen Organisationsformen<br />
(Benkler 2002: 30). Abbildung 2–10 zeigt diese Argumentation in<br />
Erweiterung des Modells der Netzwerkökonomie (siehe Abschnitt 2.3).<br />
Abbildung 2–10: Einsparungen von externen Transaktionskosten in der interaktive<br />
Wertschöpfung<br />
Transaktions-<br />
Interaktive<br />
Wertschöpfung durch<br />
kosten Markt „Peer Production“<br />
Hybrid Hierarchie<br />
S1 S2<br />
Anwendungsbereich der interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
Einsparungen von externen<br />
Transaktionskosten durch den<br />
Verzicht auf vertragliche Regelungen<br />
zugunsten informeller Koordination<br />
Spezifität / Unsicherheit<br />
Übertragung des Modells auf unsere Konzeption der interaktiven Wertschöpfung<br />
Genau wie die klassischen Formen Hierarchie und Markt als Extremformen auf einem<br />
Kontinuum konventioneller Organisationsformen gesehen werden können, genauso<br />
kann auch die “Commons-based Peer Production” nach Benkler als Extremform einer<br />
rein teilnehmerkoordinierten Form der arbeitsteiligen Problemlösung gesehen werden.<br />
Unsere Konzeption der interaktiven Wertschöpfung greift stark auf die Ideen Benklers<br />
zurück, stellt diese jedoch in Gleichklang mit anderen Organisationsformen, die der<br />
klassischen Netzwerkorganisation entsprechen. Unsere Motivation war nicht die Ablö-<br />
61<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
sung der Unternehmung durch eine neue Form der Organisation, sondern die Erweiterung<br />
der Möglichkeiten, Problemlösung im Unternehmen zu betreiben.<br />
Auch wollen wir unsere Argumentation nicht wie Benkler auf eine Informationsproduktion<br />
beschränken, sondern auch auf Bereiche ausdehnen, wo wichtige Produktionsmittel<br />
zentral an einer Stelle vereint sind und nicht allen Akteuren zur Verfügung<br />
stehen. Das heißt, die Ausführung einzelner Teilaufgaben durch die Kunden findet oftmals<br />
nicht losgelöst vom Herstellerunternehmen statt, sondern ist bedingt durch die<br />
Bereitstellung von Ressourcen durch das Unternehmen. Obwohl das Modell der “Peer<br />
Production” grundsätzlich das Anwendungsspektrum der interaktiven Wertschöpfung<br />
erweitert, übernehmen Kunden in den seltensten Fällen die gesamte<br />
Wertschöpfung. Von Hippel (2002) spricht in diesen Fällen von so genannten “User<br />
Innovation Networks”, die dem Motto “No Manufacturer required!” folgend die<br />
gesamte Wertschöpfung selbständig und verteilt über zahlreiche User leisten. Dies gilt<br />
für komplexe Informationsprodukte wie z. B. Software, kann aber bei Existenz<br />
bestimmter Infrastrukturen auch für materielle Güter gelten (Beispiel Kite-Surfing,<br />
siehe Kasten 2–7).<br />
In der Regel jedoch wird ein fokales Herstellerunternehmen wie Threadless, Spreadshirt<br />
oder Dell bestimmte Bereiche der Wertschöpfung weiterhin intern organisieren<br />
und klassisch hierarchisch oder über den Marktmechanismus koordinieren. Bestimmte<br />
Bereiche entlang der Wertschöpfungskette können aber kooperativ mit den Kunden<br />
und innerhalb dieser Bereiche nach den Prinzipien der Commons-based Peer Production<br />
gestaltet werden. Nach Benkler müssen zwei Problembereiche gelöst werden, damit<br />
“Peer Production” generell und als Organisationsform für die interaktive<br />
Wertschöpfung funktioniert:<br />
Das Motivationsproblem besagt, dass ausreichende Anreize für die Beteiligten<br />
bestehen müssen. Dies bedeutet aber auch, dass die Resultate der gemeinschaftlichen<br />
Arbeit für alle Beteiligten nutzbringend verwertbar sein müssen.<br />
Das Koordinationsproblem verlangt, dass die einzelnen Teilbeiträge im Unternehmen<br />
intern zu einem verwertbaren Gesamtbeitrag integriert werden müssen.<br />
Ob diese Problembereiche im Kontext der interaktiven Wertschöpfung gelöst werden<br />
können, hängt von folgenden Bedingungen ab, die ein Anbieterunternehmen im Sinne<br />
von “Stellschrauben” zu beeinflussen versuchen kann:<br />
Ausreichend große Zahl an Akteuren: Es muss eine ausreichend große Zahl an<br />
Kunden oder Nutzern oder sonstigen Mitwirkenden zur Beteiligung am Problemlösungsprozess<br />
gewonnen werden können.<br />
Modularität der Teilaufgaben: Die Wertschöpfungsaufgabe kann in Teilaufgaben<br />
zerlegt werden, die eine unabhängige Bearbeitung erlauben, so dass sich die<br />
Wertschöpfung gestaltet als “incremental and asynchronous, pooling the efforts of<br />
different people, with different capacities, who are available at different times”<br />
(Benkler 2002: 379).<br />
Granularität der Teilaufgabe: Die Teilaufgaben sind im Wesentlichen fein gegliedert<br />
und klein im Umfang. Sie haben einen heterogenen Inhalt und Umfang, so<br />
62
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
dass eine heterogene Kunden- oder Nutzergruppe eine ihren Vorlieben und Fähigkeiten<br />
entsprechende Auswahl treffen kann.<br />
Niedrige interne Transaktionskoten für die Integration der Teilaufgabe: Die Integration<br />
der Teilaufgaben beinhalten sowohl die Qualitätskontrolle und Auswahl der einzelnen<br />
Beiträge als auch die Kombination der Teilergebnisse zu einem verwertbaren<br />
Gesamtergebnis. Diese grundsätzlich neuen Aktivitäten für das Unternehmen verursachen<br />
eigene Kosten, die wir mit internen Transaktionskosten der interaktiven<br />
Wertschöpfung bezeichnen wollen.<br />
Erst durch die neuen IuK-Technologien können die mit der Peer-Production verbundenen<br />
Kosten ausreichend reduziert werden. Die Möglichkeit, umfangreiche Wertschöpfungsaufgaben<br />
digital abzubilden, erleichtert ihre Modularisierung (Bessen / Maskin<br />
2000). Dabei wird durch das Internet die notwendige Transparenz erreicht, die für eine<br />
Zuordnung der Kunden zu den Teilaufgaben durch Selbstselektion entsprechend ihrer<br />
Motivation und Fähigkeiten notwendig ist (Benkler 2002). Die Kundeninteraktion kann<br />
zudem in der sozialen Sphäre, d. h. der in Vernetzung von Kunden untereinander in<br />
virtuellen Communities, erfolgen.<br />
Voraussetzungen für den Erfolg einer interaktiven Wertschöpfung nach dem<br />
“Commons-based Peer Production”-Modell<br />
Je mehr ein Unternehmen “Modularität” und “Granularität” der Teilaufgaben gewährleistet,<br />
die an den Kunden übertragen werden sollen, desto besser wird das Problem<br />
der notwendigen Anreize für die Kunden gelöst. Detaillierte Überlegungen zum notwendigen<br />
Kundennutzen werden in Abschnitt 2.4.4 angestellt. Dazu gehört auch die<br />
Überwindung der Vorstellung, an den Ergebnissen der Wertschöpfung strikte<br />
Property-Rights anzumelden. Denn gerade die freie Verfügbarkeit von Wissen und der<br />
breite Zugriff auf vorhandene Wissensressourcen sind ein wesentlicher Wirkungsmechanismus<br />
und Anreiz der Peer-Production. Wir werden diesen Aspekt im kommenden<br />
Abschnitt 2.4.3.5 noch näher betrachten – liegt doch in der Ökonomie der<br />
Informations- und Wissensproduktion ein weiteres wesentliches Grundprinzip der<br />
Organisation der interaktiven Wertschöpfung.<br />
Eine weitere Erfolgsvoraussetzung der interaktiven Wertschöpfung ist, wie effizient<br />
ein Unternehmen die Aufgabe der Re-Integration der Teilaufgaben löst (siehe hierzu<br />
Abschnitt 2.4.7). Mittel dazu ist der Aufbau entsprechender “Interaktionskompetenz”,<br />
die wir in Abschnitt 2.4.6 vertiefend betrachten werden. Doch auch dem Aufbau dieser<br />
Kompetenzen sind inhaltliche und finanzielle Grenzen gesetzt. Deshalb wird das<br />
Modell der Commons-based Peer-Production nicht für alle Wertschöpfungsaufgaben<br />
eines Unternehmens eine Rolle spielen. Wenn jedoch die genannten Bedingungen<br />
erfüllt sind, dann kann dieses Modell einen hoch effizienten und leistungsfähigen<br />
Organisationsmechanismus zur Verfügung stellen, der die konventionellen Organisationsmechanismen<br />
Markt und Hierarchie ersetzt. Diese Frage stellt sich auch der<br />
amerikanische Journalist Eric Schonfeld in seinem in Kasten 2–10 auszugsweise abgedruckten<br />
Beitrag, der die Argumentation dieses Abschnitts mit weiteren Beispielen<br />
abrundet.<br />
63<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Kasten 2–10: Could The Culture of Participation Threaten The Existence of The Firm?<br />
(Quelle: Auszug aus dem Posting “The Economics of Peer Production” von Erick Schonfeld im<br />
Blog B2day vom 30. September 2005 [tinyurl.com/k9z89])<br />
(…) Peer production is part and parcel of what I call the culture of participation – that is, the explosion<br />
of user-generated goods (mostly digital), including open-source software, the Wikipedia online<br />
encyclopedia, blogs, podcasts, and photo-sharing sites like Flickr. Just as companies and markets<br />
coordinate economic activity (through management control and contracts, respectively), the<br />
Web allows individual producers and consumers to swarm together with like-minded individuals to<br />
create complex products. It also allows them to easily find an audience to test, use, and provide<br />
feedback on the content and products they create. Either way, peer production in some cases threatens<br />
to decimate the information advantage of companies and markets. (…) In peer production it<br />
gets communicated directly between producers and is stored on the Web. Since peer production<br />
is not primarily driven by the profit motive, it threatens to destroy profits in those areas where it can<br />
effectively compete. If consumers are using peer-produced goods and content, many times it’s at<br />
the expense of company-produced goods. So even if the peer producers are not making any<br />
money, they are potentially taking away sales and market share from companies. Witness what<br />
Linux has done to Sun Microsystems.<br />
(…) Peer production takes specialization down to the next level – that of the individual, rather than<br />
the business unit. Umair Haque, a management consultant and author of the blog Bubble<br />
Generation, explains: “You can only specialize in a firm to whatever degree it costs to coordinate<br />
you. Now what is happening with peer production is that it is a self-coordinating thing.” Take<br />
Wikipedia as an example. There are more than 1.8 million articles on Wikipedia. Since it is a group<br />
blog (also known as a wiki), anyone can write a new entry or edit an existing one. If you are an<br />
expert in, say, quantum mechanics, you can contribute the two sentences of knowledge that you<br />
know best to the entry. This allows people to specialize in a way that is not economical in the real<br />
world. After all, Encyclopaedia Britannica cannot farm out a single article to 100 people, but 100<br />
people can contribute to a single article on Wikipedia. (…) But does a peer-produced good like<br />
Wikipedia really threaten a firm-produced good like the Encyclopaedia Britannica? In other words,<br />
is it a better product? Haque says that’s the wrong question. “It’s not that it is a better product,” he<br />
maintains. “It’s that it is just a little bit worse – but it doesn’t cost as much.” Wikipedia is more errorprone<br />
than the Encyclopaedia Britannica, but it is also easier to correct. For a surprising number<br />
of subjects, that makes it good enough for most people – and it’s free. Peer production seems to<br />
work best with information-based goods, especially those that can be assembled in a modular<br />
fashion (like software or an encyclopedia). (…) For this reason we are already seeing the rise of<br />
peer-produced publishing (blogs) and radio (podcasts). Video is not far off. And as the cost of fabrication<br />
comes down, light manufacturing and one-off physical goods are beginning to lend themselves<br />
to peer production as well. How hard would it be for engineers or product designers to find<br />
each other on the Web, collaborate to design a product using shared computer-aided design software,<br />
and then have it manufactured at a custom fab like eMachineShop.com?<br />
(…) Since there are virtually no transaction costs in peer production (anyone can contribute or consume),<br />
it is suddenly viable for millions of potential contributors to review and select the resources,<br />
projects, and collaborators they want to work with. Haque maintains that these knowledge pools<br />
are the key information-sharing resources for peer-production communities. They act as a collective<br />
memory for such communities and make them more productive by storing the most efficient<br />
way to transform economic inputs (like those two sentences on quantum mechanics) into finished<br />
goods (the collectively written article on quantum mechanics). (…) With Flickr, every time someone<br />
tags a photo with keywords (like “Italy,” “pool,” or “bubbles”), Flickr’s knowledge pool increases.<br />
The economic inputs are the photo and the tag. The output is Flickr’s growing database of sear-<br />
64
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
chable photos, which becomes more valuable as more photos are uploaded to it with related tags<br />
so that others can more easily find them. Unlike at companies, where decisions about things like<br />
software coding and product design are kept private, in peer production all such knowledge is<br />
made explicitly public. This creates a feedback loop that can help the community learn to build,<br />
design, or code more efficiently and, thus, create better output.<br />
(…) But why do people participate in peer production in the first place? Why do they donate so<br />
much time and effort to write their blogs, upload their photos to Flickr, or tag their webpages on<br />
del.icio.us? It’s certainly not for the money (as nearly any blogger can attest to). Some say it’s for<br />
the sheer enjoyment of contributing to something you’re really interested in. Others point to the ego<br />
boost that comes with burnishing your reputation online. I find all of these explanations unsatisfactory.<br />
(After all, nobody knows you on Wikipedia. There are no bylines.) Rather, the strongest explanation<br />
is also the simplest: It is in people’s self-interest to contribute. People participate in peer production<br />
because a) it’s cheaper than buying the product outright, or b) the product would not be<br />
available otherwise. At its best, the final good is the result of a collective intelligence and could<br />
never be produced any other way. The peer producers are their own consumers. They get a better<br />
product by tapping into the knowledge pool. And they get a product that exactly fits their needs<br />
because they help design it (often with minimal effort). How do you compete with that?<br />
2.4.3.5 Organisation der Informations- und Wissensproduktion:<br />
Offenheit vs. proprietärer Schutz von Information<br />
Wir wollen in diesem Abschnitt noch einen zentralen Aspekt der interaktiven Wertschöpfung<br />
im Sinne der Peer-Production vertiefen: die Besonderheiten einer Informations-<br />
und Wissensproduktion und der Offenlegung der resultierenden Information.<br />
Denn das wesentliche Gut, das in gemeinsamen Aktivitäten zwischen den<br />
Akteuren Hersteller und Kunde ausgetauscht und neu geschaffen wird, ist Information<br />
und Wissen.<br />
Wir haben bereits in Abschnitt 2.3 gesehen, dass Märkte als Organisationsform durch<br />
neue Informations- und Kommunikationstechnologien effizienter werden – im Sinne<br />
einer Annäherung an das neoklassische Ideal perfekter Märkte ohne Informationsasymmetrien.<br />
Jedoch stoßen bei der Organisation der interaktiven Informations- und<br />
Wissensproduktion auch Märkte und klassische hybride Netzwerkansätze an ihre<br />
Grenzen, da sie auf einer formalen (vertraglichen) Definition und Übertragung von<br />
Handlungs- und Verfügungsrechten zur Durchsetzung von Eigentum beruhen (siehe<br />
Kasten 2–6 zur Property-Rights-Theorie). Dies würde aber bei der geforderten hohen<br />
Granularität und Teilung der Aufgaben zu viel zu hohen Transaktionskosten führen.<br />
Klassische Schutzrechte geistigen Eigentums sind deshalb bei der interaktiven Wertschöpfung,<br />
aber auch bei einer Informations- und Wissensproduktion im Allgemeinen,<br />
nur bedingt möglich und sinnvoll.<br />
Klassische Begründung für die Bedeutung von Schutzrechten für Informationsgüter<br />
Nehmen wir Patente, ein bekanntes und viel diskutiertes Mittel zur Durchsetzung<br />
von Intellectual Property Rights (IPR). Patente wurden lange Zeit in ihrer Funktion<br />
in Produktmärkten diskutiert, in denen sie Eigentümern erlauben, das Produkt los-<br />
65<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
gelöst vom zugrunde liegenden intellektuellen Eigentum zu verkaufen. Nach Arrow<br />
(1962) sind Patente und ähnliche IPR aber auch notwendig, um Märkte für<br />
Information und Wissen selbst zu ermöglichen. Er macht dies mit seinem so genannten<br />
Informationsparadoxon deutlich. Ohne Patente würde die Verhandlung zwischen<br />
Eigentümern und potenziellen Interessenten über die Bedingungen des<br />
Informationstausches schwierig werden. Wenn der Eigentümer seine Information<br />
preisgibt, hat ein Interessent sie bereits umsonst erhalten und braucht sie nicht mehr<br />
zu kaufen. Gibt der Eigentümer seine Information nicht preis, ist der Interessent<br />
aber zu einer Beurteilung der Information nicht fähig und deshalb nicht zur<br />
Zahlung des geforderten Preises bereit. Patente erlauben es den Eigentümern,<br />
Information gegenüber potenziellen Interessenten zu offenbaren, das Verwertungsrecht<br />
aber zurückzubehalten. Trotzdem können sich beide Verhandlungspartner<br />
auf Basis des offen gelegten Patentes in der Zwischenzeit über die<br />
Konditionen eines Informations- und Wissenstransfers einig werden, der auf eine<br />
konkrete Anwendung beim interessierten Unternehmen abzielt. Damit schafft die<br />
Möglichkeit der Patentierbarkeit überhaupt erst den Anreiz, neue wertvolle<br />
Informationen (Innovationen) zu produzieren.<br />
Gründe für eine Problematik von Schutzrechten bei Informationsgütern<br />
Mandeville (1996) baut auf diesen Gedanken auf, kommt allerdings zu einem etwas<br />
differenzierteren Schluss. Patente zum Schutz von intellektuellem Eigentum setzen<br />
zwar Anreize für Investition in Forschung- und Entwicklung. Jedoch verhindern auch<br />
eine Reihe anderer Faktoren, dass technologische Information leicht zu kopieren und<br />
von einer Domäne in eine andere zu transferieren ist. Deshalb ist der Marktmechanismen<br />
(auf Basis des Preismechanismus sowie klare Schutz- und Eigentumsrechte)<br />
nicht unbedingt immer das beste Mittel für einen Informationsaustausch. Er führt drei<br />
Faktoren an:<br />
(1) Mangelnde Knappheit bzw. Rivalität von Informationsgütern: Nicht zuletzt<br />
durch die Digitalisierung und das Internet entstehen neue Möglichkeiten, Informationsprodukte<br />
in unbegrenztem Ausmaß zu (re-)produzieren und zu verteilen. Sind<br />
Informationen erst einmal in digitalisierter Form verfügbar, können sie zu minimalen<br />
Kosten im Überfluss produziert, kopiert, transformiert und versendet werden. Dies<br />
kann die Knappheit an Information drastisch reduzieren. Diesen Effekt beschreiben die<br />
Skaleneffekte der Informationsproduktion, die in Kasten 2–11 näher erklärt sind.<br />
Diese Skaleneffekte legen aus Kostengesichtspunkten tendenziell eine hohe Ausbringungsmenge<br />
und Verbreitung nahe, sobald eine Information erstmals produziert<br />
ist (Zerdick et al. 2001). Hinzu kommt eine fehlende Rivalität im Konsum, die es beliebig<br />
vielen Menschen erlaubt, eine (Kopie der) Information zu kennen, ohne dass die<br />
Informationen aufgebraucht oder andere durch eine Knappheit im Konsum eingeschränkt<br />
würden (Picot / <strong>Reichwald</strong> 1991). Diese Umstände können die Knappheit<br />
einer Information derart verringern, dass ein Marktpreis unzweckmäßig erscheint<br />
bzw. dass nach ökonomischer Argumentation kein Marktpreis erhoben werden sollte.<br />
Die neoklassische Faustregel für einen effizienten Marktmechanismus, bei dem der<br />
Preis den Grenzkosten entspricht, impliziert sogar ein Verschenken digitaler<br />
Informationsgüter.<br />
66
Kasten 2–11: Skaleneffekte der Informationsproduktion<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Dem Ertragsgesetz folgend wird für Sachgüter üblicherweise ein U-förmiger Grenzkostenverlauf<br />
angenommen, d. h. die Kosten für eine zusätzlich produzierte Einheit sinken zunächst, steigen<br />
jedoch ab einer bestimmten Ausbringungsmenge wieder an (siehe Kasten 2–2). Die<br />
Durchschnittskosten verlaufen dementsprechend auch U-förmig und schneiden die Grenzkosten<br />
in ihrem Minimum. Hier liegt die für den Produzenten optimale Ausbringungsmenge, deren Überschreitung<br />
mit wieder steigenden Grenzkosten verbunden ist. Durch eine Steigerung der<br />
Ausbringungsmenge können Unternehmen also zunächst ihre Stückkosten senken bzw.<br />
Skaleneffekte erzielen. Aufgrund des Kostenverlaufs und anderer Faktoren, wie einem ansteigenden<br />
Koordinationsaufwand mit steigender Unternehmensgröße, sind sie jedoch limitiert.<br />
First<br />
Copy<br />
Cost<br />
Durchschnittskosten (DK)<br />
Grenzkosten (GK)<br />
GK physisch<br />
DK digital<br />
GK digital<br />
DK physisch<br />
Ausbringungsmenge<br />
Abbildung: Skaleneffekte bei der Produktion digitaler Informationsgüter<br />
Im Gegensatz dazu gibt es bei der digitalen Produktion von Information keine limitierenden<br />
Faktoren. Für die erste Kopie einer Information fällt ein einmaliger Aufwand an Fixkosten an (“First-<br />
Copy-Costs”), der aber in der digitalen Produktion sehr gut skalierbar ist. Die Grenzkosten der folgenden<br />
digitalen Reproduktion und Verbreitung sind vergleichsweise gering, idealisiert gleich Null.<br />
Die Skaleneffekte durch Fixkostendegression sind also viel stärker, weil das Verhältnis von fixen<br />
Kosten zu Grenzkosten größer ist. Ein Unterschreiten von Grenzkosten nahe Null ist fast nicht<br />
möglich, so dass die optimale Ausbringungsmenge sehr hoch, im Grenzfall sogar unendlich ist.<br />
(2) Mangelnde Ausschließbarkeit: Eine weitere Besonderheit bei Informationsgütern<br />
ist, dass der Urheber einer Information andere Akteure, die weder einen Beitrag zur<br />
Produktion geleistet noch eine Gegenleistung oder einen Kaufpreis erbracht haben,<br />
nicht (bzw. nur zu prohibitiv hohen Transaktionskosten) von Zugang und Nutzung der<br />
Information abhalten kann. Genau hier setzt Arrows (1962) Begründung für die<br />
Notwendigkeit von Patenten aufgrund des Informationsparadoxons an. Ausschließbarkeit<br />
ist gerade bei digitaler Informationsproduktion problematisch. Dies verdeutlicht<br />
bspw. der Umstand, dass der Käufer eines Informationsgutes immer nur eine digitale<br />
Kopie erhält, das „Original“ jedoch im Besitz des Verkäufers bleibt. Der Käufer<br />
wiederum kann Kopien der Kopie an viele andere (nicht berechtigte) Konsumenten<br />
weitergeben.<br />
67<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Allgemein bestimmt sich der Wert eines Gutes für einen Akteur nicht nur aufgrund<br />
seiner Eigenschaften, sondern auch durch seine Knappheit und die ausübbaren<br />
Handlungs- und Verfügungsrechte. Können die Handlungs- und Verfügungsrechte<br />
nicht vollständig einem Akteur zugeordnet werden oder werden sie gleichzeitig von<br />
mehreren Akteuren getragen (Situation so genannter “verdünnter” Property Rights)<br />
verursachen die Handlungen eines Akteurs Externalitäten, d. h. positive oder negative<br />
Nutzenveränderungen, die unkompensiert bleiben, weil eine Internalisierung durch<br />
Verträge oder Marktpreise an zu hohen Transaktionskosten scheitert (Coase 1960).<br />
Entweder verursacht ein Akteur durch sein Handeln soziale Kosten, die höher sind als<br />
seine eigenen zu tragenden Kosten (negative Externalitäten), oder er schafft einen<br />
sozialen Nutzen, der höher ist als sein eigener Nutzen (positive Externalitäten).<br />
Klassische Koordinationsmechanismen des Leistungsaustauschs beruhen deshalb auf<br />
der Ausschließbarkeit nicht berechtigter Akteure. Das Ausschlussprinzip des Property-<br />
Rights-Ansatz fordert klar zugeordnete Handlungs- und Verfügungsrechte (Property-<br />
Rights) an einem auf einem Markt transferierten Gut unter Inkaufnahme von<br />
Transaktionskosten bspw. durch Verträge. Innerhalb von Unternehmen kann die Übertragung<br />
von Verfügungsrechten auch durch andere Institutionen wie z. B. Weisung<br />
oder organisatorische Regelungen erfolgen (Picot / Dietl / Franck 2005).<br />
Abbildung 2–11: Gütertypologie (in Anlehnung an Hess / Ostrom 2003)<br />
Bei Informationsgütern aber fehlt, wie zuvor argumentiert, diese Ausschließbarkeit.<br />
Zusammen mit der mangelnden Rivalität wird Information deshalb häufig als öffentliches<br />
Gut charakterisiert (z. B. Arrow 1962; Ludwig 1998). Öffentliche Güter sind<br />
Güter, von deren Nutzung niemand (zu vertretbaren Kosten) ausgeschlossen werden<br />
kann (Abbildung 2–11). Produzenten von Information müssen positive Externalitäten<br />
in Kauf nehmen, weil auch Akteure Zugang erhalten können, die nicht zur Produktion<br />
beigetragen oder eine Gegenleistung entrichtet haben. Die verbleibenden Anreize kön-<br />
68<br />
schwierig<br />
Ausschließbarkeit<br />
einfach<br />
Reine öffentliche Güter<br />
(Sonnenaufgang,<br />
naturwissenschaftl.<br />
Wissen)<br />
Maut-/Clubgüter<br />
(Kabelfernsehen,<br />
Autobahn, Golfclub)<br />
niedrig hoch<br />
Rivalität<br />
Allmendegüter<br />
(Hochseefischgründe,<br />
Büchereien)<br />
Private Güter<br />
(Brot, PC,<br />
Wohnung)
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
nen dadurch so gering werden, dass die Information gar nicht erst produziert wird.<br />
Hardin (1968) spricht in diesem Zusammenhang von der „Tragödie der Allmende“,<br />
die im Fall der Nicht-Rivalität in der Nutzung von Information, primär in der Gefahr<br />
der Unterversorgung als der Übernutzung liegt. Einen Ausweg aus der „Tragödie der<br />
Allmende“ bei der Erstellung öffentlicher Güter scheinen nur die Einführung zentraler<br />
Steuerungs- und Sanktionierungsinstanzen oder die Etablierung von Eigentumsrechten<br />
zu bieten.<br />
(3) Unterscheidung von implizitem und explizitem Wissen: Eine weitere elementare<br />
Eigenschaft von Wissen, welche die Eignung für einen marktlichen Tausch beeinflusst,<br />
ist der Grad der Kodifizierung von Wissen (Mandeville 1996). Dies lässt sich durch die<br />
Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen veranschaulichen, wie<br />
in Abbildung 2–12 dargestellt (Polanyi 1958). Grundlage des Wissens sind<br />
Informationen, bestehend aus Daten, Zeichen und Signalen. Einige der relevanten<br />
Informationen liegen in stark kodifizierter Form vor, z. B. weil sie explizierter<br />
Bestandteil von Maschinen, Blaupausen, Fachartikeln oder Patenten sind. Kodifiziertes<br />
Wissen in dokumentierter und vielfach auch publizierter Form ist explizites Wissen.<br />
Es kann beliebig vervielfacht, versandt und gespeichert werden. Aber oftmals liegt<br />
relevantes Wissen in deutlich weniger kodifizierter Form vor, z. B. ausgereifte Ideen,<br />
unartikuliertes Wissen über Arbeitsvorgänge oder Erfahrungswissen. Dieses implizites<br />
Wissen („tacit knowledge“) hat eine persönliche Qualität, durch die es nur schwer<br />
formalisierbar und vermittelbar ist. Es ist verborgenes, nicht artikulierbares Wissen.<br />
Zudem ist es stark mit Handlungen, Verpflichtungen und Mitwirkungen des spezifischen<br />
Kontextes verknüpft – und ist damit oft “sticky” im Sinne des Konzepts von von<br />
Hippel (1994) (siehe Abschnitt 2.4.3.3; Hinweis: von Hippel differenziert nicht zwischen<br />
‘Information’ und ‘Wissen’, meint aber eher Wissen in unserer Definition).<br />
Nach Mandeville (1996) nimmt der Grad der Kodifizierung von Wissen im Wertschöpfungsprozess<br />
zu: Wissen im Prototypen einer Maschine ist kodifizierter als in der<br />
Entwicklungszeichnung, das Wissen in der in Serie produzierten Maschine ist wiederum<br />
kodifizierter als im Prototypen. Der Grad der Kodifizierung beeinflusst den<br />
Aufwand und die Art des Transfers von Information und Wissen. Für den Transfer<br />
von implizitem Wissen bedarf es bspw. größtenteils einer persönlichen Kommunikation<br />
oder „Learning by doing“. Folglich nehmen auch die Kosten für den<br />
Wissenstransfer bei niedrigem Kodifizierungsgrad zu. Marktliche Austauschprozesse<br />
scheitern tendenziell bei stark unkodifiziertem Wissen, so dass es anderer Organisationsformen<br />
bedarf, die eher auf eine intensive Interaktion und Zusammenarbeit<br />
hinauslaufen.<br />
Übertragung auf die Offenlegung von Information bei interaktiver Wertschöpfung<br />
Als Zwischenfazit lässt sich deshalb festhalten, dass eine Reihe von generellen<br />
Gründen, die aus den Besonderheiten des Guts Information bzw. Wissen abgeleitet<br />
sind, gegen die Eignung starrer und klar zugeordneter Schutzrechte und der Nutzung<br />
des Marktmechanismus zu ihrer Übertragung sprechen. Wir argumentieren, dass diese<br />
Argumente sogar noch verstärkt im Rahmen einer interaktiven Wertschöpfung gelten,<br />
da, aus einer Informations- und Wissensperspektive, Wertschöpfung als kumulativer<br />
und kollektiver Prozess darstellt wird. Interaktive Wertschöpfung ist kumulativ, da sie<br />
69<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
auf bisher verfügbarem Wissen aufbaut, und kollektiv, da sie die Interaktion mit einer<br />
Vielzahl von Akteuren zum Transfer dieses Wissens notwendig macht. Diese<br />
Interaktion für den Wissenstransfer lässt sich nur zu einem sehr geringen Teil auf der<br />
Basis von Preismechanismus und Eigentum organisieren.<br />
Abbildung 2–12: Das Kontinuum zwischen implizitem und explizitem Wissen (in<br />
Anlehnung an Frost 2005: 157)<br />
Jedoch kann die vorherige Argumentation auch ein wesentliches Problem begründen,<br />
das gegen die Funktionsfähigkeit der Commons-based Peer Production sprechen<br />
würde: Auch im Falle der Informationsproduktion durch Kunden im Internet muss der<br />
Frage nach der Überwindung einer “Tragödie der Allmende” und nach ausreichenden<br />
Anreizen nachgegangen werden. Gerade im Internet können auch diejenigen<br />
Kunden und Unternehmen von frei zugänglichen Informationen profitieren, die nicht<br />
zur Produktion im Sinne eines interaktiven Problemlösungs- und Austauschprozesses<br />
beigetragen haben (“Trittbrettfahrer”). Engagieren sich deshalb zu wenige Akteure bei<br />
der Produktion, so kann die Produktion ganz ausbleiben.<br />
Die Praxis zeigt allerdings, dass dieses “soziale Dilemma” (Osterloh / Kuster / Rota<br />
2002) trotzdem gelöst werden kann. Open Source Software (siehe Abschnitt 3.5.4)<br />
stellt ein öffentliches Informationsgut dar, dessen Programmiercode frei zugänglich<br />
und dessen Nutzung kostenlos ist. Für Open Source Software besteht wegen der Nicht-<br />
Rivalität im Konsum zwar keine Gefahr der Übernutzung, in der Regel aber die Gefahr<br />
der Unterversorgung, d. h. der Programmierung des Codes. Es könnte nämlich ein<br />
Anreizproblem bestehen, weil nicht der gesamte Nutzen der Software an die<br />
Programmierer fällt. Denn die Software kann auch von denjenigen genutzt werden, die<br />
nicht zur Programmierung beigetragen haben und einen Marktpreis ja nicht zahlen<br />
müssen. Die Programmierer sind also Produzenten, und die Nicht-Programmierer die<br />
Empfänger positiver Externalitäten. NASA Clickworkers (Freiwillige klassifizieren<br />
Krater auf dem Mars) oder die Wikipedia- Enzyklopädie, die sich aus den Beiträgen<br />
70<br />
Implizites<br />
Wissen<br />
reines „tacit knowledge“:<br />
unbewusst und<br />
nicht-artikulierbar<br />
Wissen kann durch<br />
Interaktion bewusst<br />
gemacht werden<br />
Wissen kann durch<br />
Interaktion artikuliert<br />
und kodifiziert werden<br />
Bewusst, aber wegen<br />
fehlender oder gestörter<br />
Interaktion nicht artikuliert<br />
oder kodifiziert<br />
unbewusst und<br />
bewusst und<br />
nicht artikuliert<br />
artikuliert<br />
nicht-artikulierbar artikulierbar<br />
kodifiziertes<br />
Wissen<br />
Explizites<br />
Wissen
von tausenden Freiwilligen zusammensetzt, sind weitere Beispiele für solche öffentlichen<br />
Informationsgüter, die sich aus den aktiven Beiträgen vieler Akteure zusammensetzen<br />
(siehe auch die Beispiele in Kasten 2–10).<br />
Diese Projekte haben gemeinsam, dass es sich um eine freiwillige und kollektive Informationsproduktion<br />
und -verbreitung mit dem Resultat eines öffentlichen Guts unter<br />
weitgehendem Verzicht der Beitragenden auf private Eigentums- und Verfügungsrechte<br />
handelt. Dennoch existieren sie in der Praxis – auch wenn sie klassische Theorien<br />
in Frage stellen. Die Teilnehmer lassen sich nicht durch Externalitäten von ihrer<br />
Mitwirkung abschrecken. Dies ist ein starker Indikator für das Vorhandensein anderer<br />
Anreize für ihren Problemlösungsbeitrag, den die klassische Diskussion um Schutzund<br />
Verfügungsrechte nicht abdeckt. Unter der ökonomischen Annahme eines zielgerichteten<br />
Verhaltens der Akteure scheinen deshalb Bedingungen zu herrschen, in<br />
denen der Nutzen aus der Beteiligung an dieser Art der Wertschöpfung die Kosten der<br />
Akteure übersteigt. Was genau dieser Nutzen ist, wird Abschnitt 2.4.4 näher diskutieren.<br />
Einmalige fixe Produktionskosten der interaktiven Wertschöpfung<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Greifen wir noch einen anderen Aspekt der oben angesprochenen Besonderheiten der<br />
Informationsproduktion auf: die einmalig fixen Produktionskosten im Vergleich zu<br />
den Verbreitungskosten sind sehr hoch (“First-Copy-Costs”). Diese einmaligen<br />
Produktionskosten existieren auch bei einer interaktiven Wertschöpfung. Beispiele sind<br />
Interaktionsplattformen, auf denen sich die Beitragenden austauschen (Denken Sie an<br />
die Entwicklungsplattform, die im Kite-Surfing-Beispiel notwendig war. Oder die Web-<br />
Site von Threadless.com, ohne die das Design und die Bewertung der T-Shirts durch die<br />
Kunden nicht einfach möglich wären). Im Rahmen einer interaktiven Wertschöpfung<br />
zwischen einem Hersteller und seinen Kunden ist es oft Aufgabe des Herstellers, diese<br />
Produktionskosten zu übernehmen und allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen (oder<br />
aber besonders motivierte Nutzer übernehmen diese Investitionskosten). Diese<br />
Investition signalisiert allen potenziellen Beitragenden auch das Commitment des<br />
Herstellers (oder Betreibers) in diese Form der Wertschöpfung – und stellt zugleich eine<br />
wesentliche Voraussetzung dar, damit die Kosten für die Beitragenden möglichst gering<br />
sind. Diese Anfangsinvestitionen sind Bestandteil eines größeren Sets an bestimmten<br />
Kompetenzen und Kapazitäten (“Interaktionskompetenz”), die ein Anbieterunternehmen<br />
besitzen muss, um erfolgreich an der interaktiven Wertschöpfung teilzunehmen.<br />
Kasten 2–12: Literaturempfehlungen zu den Prinzipien der Arbeitsteilung und<br />
Organisation der interaktiven Wertschöpfung<br />
Benkler, Yochai (2002). Coase’s Penguin, or: Linux and the nature of the firm. The Yale Law<br />
Journal, 112 (2002): 369-446 (Online-Publikation unter www.benkler.org/CoasesPenguin.html)<br />
Ramirez, Rafael (1999). Value co-production: intellectual origins and Implications for practice<br />
and research. Strategic Management Journal, 20 (1999) 1: 49-65.<br />
Wikström, Solveig (1996a). Value creation by company-consumer interaction. Journal of<br />
Marketing Management, 12 (1996): 359-374.<br />
71<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
2.4.4 Interaktive Wertschöpfung aus Kundenperspektive:<br />
Free Revealing und Nutzen der Interaktion<br />
Interaktive Wertschöpfung als sozialer Austauschprozess (Abschnitt 2.4.1) ist nur dann<br />
erfolgreich, wenn alle Beteiligten einen angemessenen Nutzen daraus ziehen<br />
(<strong>Reichwald</strong> / Bullinger 2000). Eine interessante Frage stellt sich deshalb insbesondere<br />
nach dem Nutzen der Kunden, die ihr Wissen beispielsweise in Form von fertigen<br />
Prototypen oftmals ohne erkennbare monetäre Gegenleistung preisgeben oder “verschenken”.<br />
Dieses Phänomen wird von Harhoff / Henkel / von Hippel (2003) als “free<br />
revealing” bezeichnet und ist wie folgt definiert: “[…] granting of access to all interested<br />
agents without imposition of any direct payment.”<br />
“Free revealing” bezeichnet die Beobachtung, dass viele Kunden bzw. Nutzer ihr Wissen<br />
unter bewusstem Verzicht auf Gegenleistung sowie Eigentums- und Verfügungsrechte an<br />
andere Akteure, insbesondere den Hersteller, weitergeben.<br />
“Free Revealing” – Kunden erwarten keine Gegenleistung<br />
Geben Kunden ihr Wissen unter bewusstem Verzicht auf Gegenleistung sowie<br />
Eigentums- und Verfügungsrechte weiter, so tragen sie zu einem quasi-öffentlichen<br />
Gut bei. Deshalb dürften eigentlich keine gemeinschaftlich hervorgebrachten<br />
Wertschöpfungsergebnisse entstehen, für die Kunden ihre Ansprüche ohne erkennbare<br />
Gegenleistung abtreten und das Unternehmen der direkte Nutznießer ist. Harhoff,<br />
Henkel und von Hippel (2003) nennen aber folgende Gründe dafür, warum Kunden<br />
ihr Wissen ohne direkte Gegenleistung an ein Herstellerunternehmen weitergeben.<br />
Diese Gründe geben schon einen ersten Einblick in die vielfältigen Anreize (erwarteter<br />
Nutzen), die die Kunden im Rahmen der interaktiven Wertschöpfung zur Teilnahme<br />
motivieren:<br />
Produktnutzung und Verbesserungen: Kunden können durch die freiwillige Weitergabe<br />
profitieren, wenn sie die betreffende Leistung durch die Zusammenarbeit<br />
mit einem Unternehmen überhaupt erst oder aber billiger beziehen können als bei<br />
der Eigenerstellung. Auch die potenziellen Verbesserungen durch weitere Kunden<br />
können für eine Offenlegung ausschlaggebend sein.<br />
Netzeffekte und Standards: Durch die Weitergabe können Kunden die Verbreitung<br />
einer Leistung unter den Abnehmern fördern. Aufgrund von (indirekten)<br />
Netzeffekten kann das den Wert der Leistung für den Urheber erhöhen, bspw.<br />
durch die Herausbildung eines zertifizierten Standards oder eines Markts für komplementäre<br />
Leistungen.<br />
Niedrige Rivalität: Kunden sind eher geneigt zur Weitergabe, wenn sie nicht in<br />
unmittelbarer Konkurrenzbeziehung zu den anderen Abnehmern stehen, bspw.<br />
aufgrund geographischer Distanz. Das reduziert die Gefahr, dass die Wettbewerber<br />
ebenso oder sogar stärker Nutznießer werden können.<br />
72
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Reputation: Durch die Weitergabe können Kunden ferner eher indirekten Nutzen<br />
erfahren, z. B. positive Signale auf dem Arbeitsmarkt, eine verbesserte Beziehung<br />
zum jeweiligen Herstellerunternehmen, einen vorteilhaften Ruf unter Kunden<br />
sowie abgeleitet den Stolz auf die eigene Leistung.<br />
“Collective Invention” und “Peer Production” als Erklärung für den Verzicht auf<br />
Gegenleistung<br />
Das Modell der “Collective Invention” (Allen 1983) nimmt den Gedanken auf, dass<br />
eine freie Weitergabe von Wissen über Produkte insbesondere dann erfolgt, wenn<br />
Verbesserungen des Produktes durch andere zu erwarten sind. Die Erwartung dieser<br />
Verbesserungen stellt den wesentlichen Anreiz für die Nutzer zur Mitwirkung am<br />
gemeinsamen Wertschöpfungsprozess dar. Einige Nutzer werden das Produkt zwar<br />
lediglich adoptieren und nachbauen, sobald es frei verfügbar. Andere Nutzer aber werden<br />
es verbessern und stehen damit ebenfalls vor der Entscheidung über eine freie<br />
Weitergabe. Das Modell der “Collective Invention” geht so von einer Sequenz von<br />
Nutzern aus, die das Produkt inkrementell verbessern, weitergeben und so neue<br />
Verbesserungen anstoßen. Jeder kooperative Beteiligte leistet somit einen Beitrag zu<br />
einem gemeinsamen Wissenspool, der als öffentliches Gut unter einer marktlichen<br />
Institutionalisierung nicht entstehen würde (Abschnitt 2.4.3.5). Beispiele für<br />
“Collective Invention” reichen vom Wissenschaftsprozess generell, über die<br />
Stahlindustrie während der frühen Industrialisierung (Allen 1983) bis hin zu unserem<br />
Kite-Surfing-Beispiel in Kasten 2–7 oder der Open-Source-Software-Entwicklung, bei<br />
der Entwickler durch die Copyleft-Lizenz sogar zur Weitergabe ihrer Modifikationen<br />
verpflichtet sind (von Hippel / von Krogh 2002; siehe auch Abschnitt 3.5.4). Durch die<br />
Institution “Collective Invention” sind Wissenstransfers möglich, die unter<br />
Marktbedingungen oder unter formalen geregelten und stärker institutionalisierten<br />
Kooperationsbedingungen nicht stattfinden würden. Im Kontext der interaktiven<br />
Wertschöpfung kann ein Unternehmen folglich eine Interaktion mit Kunden auf Basis<br />
der Nutzenerwartungen durch Verbesserungen stimulieren. Dafür sollte es den<br />
“Collective Invention”-Prozess eventuell durch eine geeignete Plattform unterstützen,<br />
jedoch in keinem Fall die Kette freier Weitergaben durch eigenes proprietäres<br />
Verhalten (Erwerb und Verfolgung gewerblicher Schutzrechte) durchbrechen.<br />
Einen weiteren Anhaltspunkt zur Ableitung des Kundennutzens gibt das in Abschnitt<br />
2.4.3 dargestellte Modell der “Commons-based Peer Production”. Dort wird die<br />
Problematik tendenziell dadurch gelöst, dass Wertschöpfungsaufgaben soweit wie<br />
möglich “modularisiert” und “granularisiert” sind. In dem Maße, wie es Unternehmen<br />
gelingt, die betreffenden Wertschöpfungsaufgaben in verschiedene (kleinste) Teilaufgaben<br />
zu zerlegen, können sich heterogene Kunden Teilaufgaben entsprechend ihrer<br />
Disposition und (intrinsischen) Nutzenerwartung auswählen. Die Problematik des<br />
Kundennutzens wird so tendenziell marginalisiert. Wir werden aber in Abschnitt 2.4.7<br />
zeigen, dass diese “Stellschraube” mit zusätzlichen Kosten erkauft werden muss.<br />
Dass die interaktive Wertschöpfung generell ohne explizite Gegenleistung für die<br />
Kunden erfolgen kann, ist eine optimistische Auffassung, die nicht alle Autoren teilen<br />
(Brockhoff 2005). Viele Erklärungen gehen davon aus, dass Kunden bereits im Vorfeld<br />
ein Produkt entwickelt haben und deshalb gar nicht mehr vor der Entscheidung ste-<br />
73<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
hen, Aufwand in einen Beitrag zur gemeinsamen Wertschöpfung mit einem Unternehmen<br />
zu leisten. Ferner wird häufig davon ausgegangen, dass die Geheimhaltung<br />
ohnehin nur für kurze Zeit möglich ist und eine Lizenzierung der Entwicklung keine<br />
bedeutenden Ertragsmöglichkeiten aus Sicht der Kunden birgt (von Hippel 2005). Hier<br />
bestätigen Ausnahmen die Regel, denn es kommt durchaus vor, dass innovative<br />
Kunden zu erfolgreichen Herstellern ihrer eigenen Entwicklung werden (meist aber<br />
erst dann, wenn sich ein etablierter Hersteller nicht für ihre Innovation interessiert hat;<br />
siehe hierzu Lettl / Herstatt / Gemünden 2004). Wissenschaftliche Beiträge zeigen zu<br />
diesem Thema ein uneinheitliches Bild:<br />
<strong>Frank</strong>e und <strong>Piller</strong> (2004) zeigen in einer empirischen Untersuchung sogar das<br />
Gegenteil: In der Erwartung, dass Kunden ein Produkt erhalten, das ihre<br />
Vorstellung besser als ein Standardprodukt erfüllt, sind sie bereit, mehr zu zahlen,<br />
obwohl sie im Vorfeld zur Entstehung des Produktes beigetragen haben.<br />
Dellaert und Syam (2001) zeigen in einem spieltheoretischen Modell, dass Kunden<br />
eigentlich vorab für den Beitrag zur Wertschöpfung und ihre Interaktionskosten<br />
bezahlt werden müssten, weil Unternehmen nach Fertigstellung des Produktes<br />
keine Anreize mehr zu Preisnachlässen haben (Hold-up-Problem). Im Gegensatz<br />
zu dem empirischen Ergebnis von <strong>Frank</strong>e und <strong>Piller</strong> sind Unternehmen auch im<br />
Monopolfall nicht in der Lage, einen höheren Preis zu verlangen, weil Kunden zur<br />
Wertschöpfung beigetragen haben.<br />
Brockhoff (2005) zeigt in einem einfachen spieltheoretischen Modell, dass<br />
Transferzahlungen in beide Richtungen denkbar sind. Die Partei, die einen größeren<br />
Nutzen aus der interaktiven Wertschöpfung zieht, muss einen Teil dieses<br />
Mehrnutzens an die andere Partei abgeben. Die Höhe des aufzuteilenden<br />
Gesamtnutzens aus der interaktiven Wertschöpfung ergibt sich in diesem Modell<br />
aus (1) dem Nutzenzuwachs für den einzelnen Kunden aus dem neuen Produkt, (2)<br />
den (Entwicklungs- und Produktions-)Kosten für die Anpassung des Lösungsraums<br />
des Unternehmens sowie (3) den entgangenen bzw. zusätzlichen Gewinnen,<br />
die das Unternehmen auf Basis des angepassten Lösungsraums mit anderen<br />
Kunden erzielen kann. Eine Transferzahlung des Kunden an das Unternehmen ist<br />
denkbar, wenn der Nutzenzuwachs des Kunden größer ist als die Gewinnpotenzialveränderung,<br />
verringert um die Anpassungskosten des Unternehmens.<br />
Darauf lässt sich der Kunde aber nur ein, wenn der Nutzenzuwachs aus dem neuen<br />
Produkt größer ist als die verlangte Transferzahlung (z. B. der Produktaufpreis,<br />
den auch <strong>Frank</strong>e und <strong>Piller</strong> 2004 nachweisen). Eine Transferzahlung des<br />
Unternehmens an den Kunden ist erforderlich, wenn die Anpassung des Lösungsraums<br />
das Gewinnpotenzial des Unternehmens über die Maßen des Nutzenzuwachses<br />
für den einzelnen Kunden erhöht.<br />
Extrinsicher vs. Intrinsischer Nutzen<br />
Zukünftige Forschung muss zeigen, ob diese zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse<br />
auf eine unterschiedliche Berücksichtigung des intrinsischen Nutzens im Gegensatz<br />
zum extrinsischen Nutzen zurückzuführen sind. Extrinsischer Nutzen wird aus dem<br />
Ergebnis einer Tätigkeit abgeleitet. Die Tätigkeit wird nicht um ihrer selbst willen aus-<br />
74
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
geführt, sondern im Hinblick auf eine adäquate Belohnung (Osterloh / Kuster / Rota<br />
2004). In der interaktiven Wertschöpfung ist das entweder die Aussicht auf ein besseres<br />
Produkt (d. h. bessere Erfüllung eines bislang offenen Problems bzw. unbefriedigenden<br />
Bedürfnisses) oder aber eine monetäre Gegenleistung in Form von<br />
Transferzahlungen oder Rabatten. Ein Menschenbild, welches das alleinige Streben<br />
nach extrinsischem Nutzen unterstellt, greift jedoch zu kurz.<br />
Eine zweite Nutzenkategorie, die von Bedeutung für die interaktive Wertschöpfung<br />
aus Kundensicht ist, ist der intrinsische Nutzen. Dieser bezieht sich auf die Ausführung<br />
einer Tätigkeit selbst. Eine Aktivität wird um ihrer selbst willen geschätzt und<br />
auch ohne unmittelbare Gegenleistung ausgeführt. Intrinsischer Nutzen hat zwei<br />
Dimensionen (Lindenberg 2001; Osterloh / Kuster / Rota 2004), die sich auf den Kontext<br />
der interaktiven Wertschöpfung übertragen lassen:<br />
Freude an einer Tätigkeit (Deci et al. 1999): Das Interaktionserlebnis als solches ist<br />
positiv und nutzenstiftend, wenn es das Gefühl von Spaß, Kompetenz, Exploration<br />
und Kreativität vermittelt.<br />
Erfüllung von Normen um ihrer selbst willen (Frey 1997): Das Interaktionserlebnis<br />
ist nutzenstiftend, wenn die Interaktion mit dem Unternehmen oder anderen<br />
Kunden die Erfüllung von sozialen Normen bedingt. Beispiele für eine solche<br />
Norm sind z. B. (generalisierte) Reziprozität, Gemeinnützigkeit (Frey / Meyer<br />
2002) oder Fairness (Fehr / Schmidt 1999). Fehr und Schmidt (2002) zeigen beispielsweise,<br />
dass die Berücksichtigung des Nutzens aus sozialer Normerfüllung ein<br />
an materiellen Leistungsbeziehungen gemessenes Gefangenendilemma in ein<br />
Koordinationsspiel transformieren kann, in dem dann auch kooperatives Verhalten<br />
optimal sein kann.<br />
Wir werden die Nutzenperspektive aus Kundensicht in den folgenden Teilen des Buchs<br />
noch deutlich weiter vertiefen, wenn wir die einzelnen Formen der interaktiven Wertschöpfung,<br />
Open Innovation und Produktindividualisierung, näher betrachten (siehe<br />
Abschnitte 3.3 und 4.3). Wir können aber schon an dieser Stelle festhalten, dass in<br />
Ergänzung zum extrinsischen Nutzen, der in der klassischen Argumentation stets im<br />
Vordergrund steht (Entlohnung durch Lohn), auch das Interaktionserlebnis als intrinsischer<br />
Nutzen von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der interaktiven<br />
Wertschöpfung sein kann. Dies gilt selbst für den Fall, dass Kunden eigentlich den Kauf<br />
eines individualisierten Produktes anstreben (Dellaert / Stremersch 2005; Ihl et al. 2006).<br />
2.4.5 Interaktive Wertschöpfung aus Unternehmensperspektive:<br />
Effiziente Differenzierung und Zugriff auf knappe<br />
Ressourcen<br />
Im Folgenden wollen wir auf den Nutzen der interaktiven Wertschöpfung für<br />
Unternehmen eingehen. In Abschnitt 2.4.3 haben wir bereits die Nutzenpotenziale der<br />
interaktiven Wertschöpfung als Organisationsform aufgezeigt: Wertschöpfungsaufgaben<br />
des Unternehmens werden durch die Übertragung auf Kunden und den Wegfall<br />
75<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
eines kostenintensiven Wissenstransfers effizienter ausgeführt. Da tendenziell auf vertragliche<br />
Regelungen verzichtet wird, fallen dabei auch vergleichsweise geringe Transaktionskosten<br />
zur Abstimmung an. Diese Effizienzbetrachtung soll um eine Effektivitätsbetrachtung<br />
auf Basis der strategischen Vorteilhaftigkeit der interaktiven Wertschöpfung<br />
aus Unternehmenssicht erweitert werden. Deshalb stellen wir uns die klassische<br />
Frage des strategischen Managements (Rumelt / Schendel / Teece 1991): Kann<br />
die interaktive Wertschöpfung Erfolgsunterschiede zwischen und insbesondere Wettbewerbsvorteile<br />
von Unternehmen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern erklären? Für<br />
die Erklärung und Gestaltung von Wettbewerbsvorteilen haben sich zwei dominante<br />
Ansätze herausgebildet, vor deren Hintergrund im Folgenden die strategische Vorteilhaftigkeit<br />
der interaktiven Wertschöpfung herausgearbeitet werden soll: der marktorientierte<br />
und der ressourcenorientierte Ansatz des strategischen Managements.<br />
Eine marktorientierte Strategieperspektive auf die interaktive Wertschöpfung<br />
Der marktorientierte Ansatz (Porter 1980, 1985, 1996) nimmt eine Outside-in-Perspektive<br />
ein und betrachtet die Branchenstruktur und Determinanten der Branchenattraktivität,<br />
operationalisiert durch das Gewinn- bzw. Renditepotenzial. Der Ansatz folgt<br />
dem so genannten SCP-Modell (“structure-conduct-performance”) und versucht, aus<br />
der Branchenstruktur (structure) und dem strategischen Verhalten (conduct) den<br />
Erfolg eines Unternehmens in einer Branche zu erklären. Wesentliche Determinanten<br />
der Brachenattraktivität sind die Anzahl der Wettbewerber und die Verhandlungsmacht<br />
der Abnehmer.<br />
In Abschnitt 2.2.3 und 2.3.3 haben wir argumentiert, dass das Gewinnpotenzial für<br />
viele Unternehmen wegen der zunehmenden Markttransparenz durch IuK-Technologie,<br />
der Individualisierung der Nachfrage sowie das Empowerment der Kunden tendenziell<br />
eher sinkt. Deshalb müssen viele Unternehmen ihr strategisches Verhalten<br />
ändern. Dazu gehört für viele westliche Unternehmen vor allem die Abwendung von<br />
einer strategischen Positionierung als Kostenführer zugunsten einer stärkeren<br />
Differenzierung. Hierzu kann die interaktive Wertschöpfung einen wichtigen Beitrag<br />
leisten.<br />
Wie in Abschnitt 2.4.3 dargelegt, zielt eine interaktive Wertschöpfung auf einen besseren<br />
Zugang zu Bedürfnisinformationen der Kunden ab, der in diesem Ausmaß durch<br />
eine bloße Marktorientierung und Marktforschung nicht realisiert worden wäre. Diese<br />
Marktinformation erlaubt als Grundlage einer jeden Differenzierungsstrategie einen<br />
besseren “fit-to-market”, d. h. höhere Marktakzeptanz, geringeres Floprisiko und bessere<br />
Abstimmung der entwickelten Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden. Diese<br />
Marktinformation kann nun entsprechend der (volkswirtschaftlichen) Unterscheidung<br />
in eine vertikale und eine horizontale Produktdifferenzierung auf zwei Ebenen genutzt<br />
werden (Cabral 2000; Dellaert / Syam 2001; Meffert / Bruhn 2003):<br />
Bei vertikaler Produktdifferenzierung wird davon ausgegangen, dass alle Kunden<br />
eines Marktsegmentes den gleichen Geschmack und gleiche Präferenzen haben.<br />
Kunden kaufen ein Produkt ausschließlich aufgrund von objektiv besseren Produkteigenschaften<br />
und Qualitätsunterschieden. Bei identischen Preisen bevorzugen<br />
alle Kunden dasselbe Produkt, das eine höhere Qualität gegenüber anderen<br />
76
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Produkten aufweist. Kunden helfen durch ihren Beitrag zur Wertschöpfung einem<br />
Anbieter bei einer vertikalen Produktdifferenzierung, wenn ihr Informationstransfer<br />
dem Unternehmen ermöglicht, seinen Lösungsraum um ein Produkt zu<br />
erweitern, das aus Sicht aller Kunden eine Verbesserung bzw. einen Nutzenzuwachs<br />
darstellt (Dellaert / Syam 2001). Dies entspricht dem Fall der Open<br />
Innovation (siehe zu diesem Nutzenaspekt ausführlich Abschnitt 3.2.1).<br />
Im Gegensatz dazu spricht man von horizontaler Produktdifferenzierung, wenn<br />
die Kunden trotz desselben Preises unterschiedliche Präferenzen für Produkte<br />
haben. Unter den Kunden herrscht keine allgemeine Meinung darüber, welches<br />
Produkt dem anderen überlegen ist. Kunden ziehen je nach ihren persönlichen<br />
Präferenzen Produkte mit bestimmten Merkmalen (Farbe, Größe usw.) anderen<br />
Produkten vor. Die Nutzung der Bedürfnisinformation eines einzelnen Kunden<br />
trägt genau zu dieser horizontalen Differenzierung bei, wenn im Falle der<br />
Produktindividualisierung ein Anbieter ein auf die Präferenzen und Vorlieben<br />
eines einzelnen Kunden genau abgestimmtes Produkt herstellen kann. Der für diesen<br />
einzelnen Kunden entstehende Nutzenzuwachs, entsprechend einer höheren<br />
wahrgenommenen Produktqualität, äußert sich dann oft durch eine höhere<br />
Zahlungsbereitschaft (siehe hierzu ausführlich Abschnitt 4.3.1).<br />
Aus Unternehmenssicht kann der Wert des Beitrags von Kunden zur Wertschöpfung<br />
folglich große Unterschiede haben. Ein Wertschöpfungsbeitrag, der Unternehmen zu<br />
einer Erweiterung des Lösungsraums verhilft und für alle Kunden einen<br />
Nutzenzuwachs birgt, ist oft von deutlich höherem Wert als der Beitrag, der zu einer<br />
Konkretisierung oder Anpassung des Lösungsraums führt, um die Bedürfnisse eines<br />
einzelnen Kunden zu befriedigen. Doch auch hier handelt es sich um zwei Extreme<br />
eines Kontinuums entlang dem Innovations- bzw. Neuigkeitsgrades der interaktiv entwickelten<br />
Leistung (Brockhoff 2003; Hausschildt / Schlaak 2001). Die interaktive<br />
Wertschöpfung zielt darauf ab, auch für tendenziell hohe Innovationsgrade eine breite<br />
Marktakzeptanz frühzeitig sicherzustellen.<br />
Eine ressourcenorientierte Strategieperspektive auf die interaktive Wertschöpfung<br />
Der ressourcenorientierte Ansatz sieht in einer Inside-Out-Perspektive strategisch<br />
wertvolle Ressourcen (Fähigkeiten, Kompetenzen oder Routinen) eines Unternehmens<br />
als Ausgangspunkt zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen (Barney 1991; Amit /<br />
Schoemaker 1993). Der strategische Wert von Ressourcen bestimmt sich vor allem aus<br />
ihrem Charakter sowie ihrer Einzigartigkeit bzw. Seltenheit. Zur nachhaltigen<br />
Sicherung des Ressourcenwerts gewinnen deshalb jene Aspekte für das Unternehmen<br />
an Bedeutung, die es gestatten, den Unterschied in der Ressourcenausstattung zu den<br />
Wettbewerbern aufrecht zu erhalten (“Kernkompetenzen”). Begünstigt wird dies<br />
durch den Umstand, dass Ressourcenaufbau und -nutzung meist intransparente und<br />
komplexe Lern- und Wirkungsprozesse im Unternehmen zugrunde liegen, die häufig<br />
zu einem gewissen Grad vor Imitation schützen (Dierickx / Cool 1989). Strategisch<br />
wichtige Ressourcen lassen sich auch meist nicht auf Märkten beschaffen (Barney<br />
1986). In der Vergangenheit wurden Unternehmen häufig als eigenständige<br />
Wertschöpfungseinheiten betrachtet, über deren Ressourcen unternehmensintern verfügt<br />
wurde. Interne, unternehmensspezifische Verfahren bildeten die maßgebliche<br />
77<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Grundlage zur Entwicklung von Kernkompetenzen. Mit der Ablösung der tayloristischen<br />
durch die Netzwerk-Perspektive hat sich dieses Ressourcenverständnis jedoch<br />
gewandelt. Unternehmen erlangen Kernkompetenzen demnach nicht nur durch den<br />
Aufbau, den Verbund und die Pflege eigener Ressourcen, sondern zunehmend durch<br />
den Zugang zu Ressourcen und Kompetenzen ihrer Wertschöpfungspartner. Hierzu<br />
zählen klassischerweise die Zulieferer, Entwicklungs- und Vertriebspartner oder Investoren<br />
(Bamberger / Wrona 1996).<br />
Im Konzept der interaktiven Wertschöpfung werden insbesondere die Kunden bzw.<br />
Information der Kunden als strategische externe Ressource gesehen (Gouthier /<br />
Schmid 2001; Grün / Brunner 2003; Prahalad / Ramaswamy 2000; Shankar / Bayus<br />
2003), eine Sichtweise, die im Dienstleistungsmanagement schon länger verbreitet ist<br />
(z. B. Bateson 1985; Fitzsimmons 1985; Day 1994; Langeard et al. 1981; Meyer /<br />
Blümelhuber / Pfeiffer 2000; Plinke 1998). Schafft es ein Unternehmen, Zugang zu dieser<br />
Ressource zu bekommen, kann es einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der<br />
Konkurrenz bekommen. Die “strategische Ressource Kunde” umfasst dabei nicht nur<br />
den Zugang zu deren “sticky information” (bzw. Artefakten, die diese repräsentieren),<br />
sondern auch die Beziehung, das Vertrauen und den sozialen Austausch, der im<br />
Zuge der Interaktion mit den Kunden aufgebaut wurde. Gerade letzterer Aspekt<br />
macht auch bei Offenlegung der Informationen als quasi-öffentliches Gut eine strategische<br />
Verwendung dieser Information möglich, selbst wenn auch die<br />
Konkurrenten Zugriff auf die Information selbst bekommen können. Dazu kommt<br />
auch, dass die Verwendung der Information oft auf einen konkreten Lösungsraum<br />
eines Unternehmens bezogen ist, der ebenfalls eine schlecht imitierbare Ressource<br />
darstellt, da er Ergebnis eines komplexen interaktiven Lern- und Wirkungsprozesses<br />
ist.<br />
Abhängigkeit von der Ressource Kundenwissen<br />
Anbieter, die ihre Kunden als Ressource begreifen, müssen im Hinblick auf eine erfolgreiche<br />
Wertschöpfung allerdings komplementäre Kompetenzen zur Interaktion mit<br />
ihren Kunden aufbauen. Dies kann mit der verwandten Theorie der Ressourcenabhängigkeit<br />
(Resource Dependence Theory nach Pfeffer / Salancik 1978) beschrieben<br />
werden. Sie hat für das Verständnis von Interaktionsbeziehungen zwischen<br />
Unternehmen und Kunden große Bedeutung. Nach der Resource Dependence Theory<br />
hängt die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens davon ab, ob es sich benötigte<br />
und knappe Ressourcen aus der externen Unternehmensumwelt verschaffen kann.<br />
Ressourcen können finanzielle Mittel, Personal, Produkte, Macht oder Information und<br />
Wissen sein. Die Abhängigkeit eines Unternehmens von externen Ressourcen resultiert<br />
aus verschiedenen Umständen wie<br />
der Wichtigkeit der Ressource für den Fortbestand des Unternehmens und seiner<br />
operativen Tätigkeit,<br />
der Stärke des Einflusses, den die externe Interessensgruppe auf die Ressource<br />
bzw. seine Allokation und Verwendung ausübt, oder<br />
der Existenz alternativer Beschaffungsmöglichkeiten.<br />
78
In ihrer Abhängigkeit wird den Unternehmen aber nicht eine passive Haltung, sondern<br />
eine aktive Gestalterrolle unterstellt. Unternehmen müssen nach Strategien suchen, um<br />
die Abhängigkeit zu planen und zu steuern. Dazu schlägt die Resource Dependence<br />
Theory vor, die Austauschbeziehungen des Unternehmens durch mehr oder weniger<br />
formale Beziehungen zu externen Partnern wie Kunden, Lieferanten oder Distributoren<br />
zu strukturieren. Der Aufbau dieser Beziehungen als Maßnahme zur Reduktion<br />
der Abhängigkeit läuft auf eine bewusste Intensivierung der Koordination und<br />
Interaktion zwischen den Geschäftspartnern hinaus (Gruner / Homburg 2000; Zahra /<br />
George 2002). Maßnahmen zur Intensivierung der Koordination, die den Zugang zu<br />
der kritischen Ressource sicherstellen sollen, werden auch “Bridging-Strategien”<br />
genannt (Pfeffer / Salancik 1978: 144). Ziel ist es, die Unternehmensgrenzen durchlässiger<br />
zu machen und eine informationelle Brücke zu externen Organisationen zu<br />
bauen, um den Ressourcenaustausch zu erleichtern. Häufig wählen Unternehmen<br />
Bridging-Strategien, um ihre eigene Innovationstätigkeit zu verbessern. Insbesondere<br />
Wissen, das innerhalb der eigenen Organisationsgrenzen nicht verfügbar ist, zeigt sich<br />
oft als innovationskritische Ressource, so dass Bridging-Strategien auf einen regelmäßigen<br />
und wiederholten Wissensaustausch mit den externen Partnern abzielen. Genau<br />
dies ist das strategische Ziel der interaktiven Wertschöpfung im Sinne der Resource<br />
Dependence Theory. Um allerdings den erfolgreichen Zugriff auf die kritische<br />
Ressource Kundenwissen im Rahmen der interaktiven Wertschöpfung durchführen zu<br />
können, braucht ein Anbieterunternehmen selbst bestimmte interne Fähigkeiten und<br />
Kompetenzen, die als Investitionen zur Verwirklichung der “Briding Strategie” aufgefasst<br />
werden können. Diese internen Fähigkeiten eines Anbieters, um selbst an der interaktiven<br />
Wertschöpfung erfolgreich teilzunehmen, nennen wir Kundeninteraktionskompetenz.<br />
Diesen wichtigen Aspekt behandeln wir im folgenden Abschnitt 2.4.6.<br />
Kundeninteraktion als Erfolgsfaktor<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Dass es sich für einen Anbieter lohnt, diese Kundeninteraktionskompetenz aufzubauen<br />
und in entsprechende Maßnahmen zu investieren, zeigen erste empirische Studien, die<br />
einen Nachweis für den (strategischen) Erfolgsbeitrag von Kundeninteraktion liefern. So<br />
zeigen z. B. Gruner und Homburg (2000), dass die Interaktion mit Kunden insbesondere<br />
in frühen und späten Phasen Erfolg versprechend ist (Abbildung 2–13, links). Die<br />
Erfolgswirkung ist dabei auf die marktbezogene Absicherung von Produktkonzepten, den<br />
Test von Prototypen und die Unterstützung bei der Markteinführung zurückzuführen.<br />
Ernst (2001) zeigt ergänzend, dass die Erfolgswirkung insbesondere dann besonders<br />
ausgeprägt ist, wenn die interaktive Wertschöpfung einer hohen Marktunsicherheit,<br />
Spezifität und Abhängigkeit von Kundenwissen in der Wertschöpfung entgegengewirkt.<br />
Darüber hinaus zeigt er aber auch, dass der Zusammenhang zwischen Profitabilität<br />
und dem Umfang des Beitrages, den Kunden zur Wertschöpfung leisten, nicht<br />
linear ist (Abbildung 2–13, rechts). Es existiert ein optimaler Grad der interaktiven<br />
Wertschöpfung. Wird das Optimum überschritten, nimmt die Profitabilität ab. Das<br />
deutet darauf hin, dass interaktive Wertschöpfungsprozesse eines umsichtigen<br />
Managements bedürfen, um eventuell auch negativen Auswirkungen der interaktiven<br />
Wertschöpfung entgegenzuwirken, wie z. B. eine Ablehnung durch die Mitarbeiter<br />
(“Not Invented Here”-Syndrom, siehe Howells 1990; Staudt / Bock / Mühlmeyer 1990).<br />
79<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 2–13: Interaktive Wertschöpfung und Unternehmenserfolg (modifiziert nach<br />
Ernst 2004)<br />
Die Graphen in Abbildung 2–13 zeigen auch, dass die Erfolgswirkung der interaktiven<br />
Wertschöpfung durch den Einsatz neuer IuK-Technologien als “enabling technology”<br />
angehoben werden kann (skizziert in den beiden Abbildungen durch die gestrichelte<br />
Linie). So ermöglichen neuartige internetbasierte Instrumente nun auch die<br />
Kundenintegration in mittleren Wertschöpfungsphasen wie Konzepttest und Design<br />
(Bartl 2005). Mit so genannten Toolkits oder Konfiguratoren (siehe Abschnitte 3.5.2 und<br />
4.4.4) können Produkte gemeinsam mit Kunden virtuell entworfen, modelliert und<br />
simuliert werden. Dies bewirkt eine Verschiebung der U-förmigen Kurve im Bild von<br />
Gruner und Homburg nach oben.<br />
Durch die neuen IuK-Technologien wird die interaktive Wertschöpfung auch insgesamt<br />
kontinuierlicher, regelmäßiger und flexibler in Bezug auf Umfang und<br />
Ausmaß von Kundenbeiträgen zur Wertschöpfung, verdeutlicht durch einen längeren<br />
Anstieg der Kurve im Bild von Ernst (Abbildung 2–13 rechts). Die Möglichkeit,<br />
umfangreiche Wertschöpfungsaufgaben digital abzubilden, zu modularisieren und<br />
in granulare Teilaufgaben zu zerlegen, verbessert die Anwendbarkeit der “Peer<br />
Production”. Das heißt, die Übertragung komplexer Aufgaben auf eine Vielzahl an<br />
Kunden kann unter weitestgehender Vermeidung von Störungen im Ablauf und<br />
der Koordination erfolgen (Bessen / Maskin 2000; Bessen 2002). Dabei wird durch<br />
das Internet die Transparenz erreicht, die für eine Zuordnung der Kunden zu<br />
den Teilaufgaben durch Selbstselektion entsprechend ihrer Motivation und Fähigkeiten<br />
notwendig ist (Benkler 2002). Die Kundeninteraktion kann zudem in der<br />
sozialen Sphäre, d. h. in Vernetzung von Kunden untereinander in Communities,<br />
erfolgen.<br />
80<br />
Erfolg<br />
Gruner/ Homburg 2000 Ernst 2001<br />
Erfolg<br />
Früh Mittel Spät<br />
Wertschöpfungsphase<br />
Ausmaß der interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien
2.4.6 Interaktionskompetenz und interaktionsförderliche<br />
Organisations- und Kommunikationsstrukturen<br />
Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass es sich aus vielerlei Gründen für ein<br />
Anbieterunternehmen lohnt, die interaktive Wertschöpfung als Organisationsprinzip<br />
für eine arbeitsteilige Leistungserstellung mit den Kunden zu verwirklichen. Jedoch<br />
bedeutet interaktive Wertschöpfung nicht einfach das “Outsourcen” von Aufgaben an<br />
den Kunden, sondern verlangt vielmehr auch eine aktive Beteiligung durch den<br />
Anbieter, der hierfür bestimmte Ressourcen und Fähigkeiten besitzen muss. Dieser<br />
Aspekt wurde bereits im letzen Abschnitt in Zusammenhang mit “Bridging Strategies”<br />
im Rahmen des Resource Based View angesprochen. Ebenfalls haben wir bereits in<br />
Abschnitt 2.4.3.4 gesehen, dass der grundlegende Organisationsmechanismus<br />
Granularität und Selbstselektion nur dann funktionieren kann, wenn der Hersteller<br />
anschließend mit relativ geringen Transaktionskosten eine Integration der<br />
Teilaufgaben vornehmen kann. Dies beinhaltet sowohl die Qualitätskontrolle und<br />
Auswahl der einzelnen Beiträge als auch die Kombination der Teilergebnisse zu einem<br />
verwertbaren Gesamtergebnis. Auch hierzu bedarf es neuer Kompetenzen und<br />
Fähigkeiten, die wir in ihrer Gesamtheit als Interaktionskompetenz eines Hersteller<br />
bezeichnen.<br />
Notwendige Fähigkeiten teilnehmender Kunden (Lead User)<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Kasten 2–13: Literaturempfehlungen zu den Wettbewerbsvorteilen durch Interaktive<br />
Wertschöpfung<br />
Gouthier, Matthias / Schmid, Stefan (2001). Kunden und Kundenbeziehungen als Ressourcen<br />
von Dienstleistungsunternehmen. Die Betriebswirtschaft (DBW), 61 (2001) 2: 223-239.<br />
Grün, Oskar / Brunner, Jean-Claude (2003). Wenn der Kunde mit anpackt: Wertschöpfung<br />
durch Co-Produktion. Zeitschrift Führung Organisation ZFO, 72 (2003) 2: 87-93.<br />
Normann, Richard / Ramirez, Rafael (1993). From value chain to value constellation. Harvard<br />
Business Review, 71 (1993) 4 (July / August): 65-77.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Ramaswamy, Venkatram (2000). Co-opting customer competence.<br />
Harvard Business Review, 79 (2000) 1 (January / February): 79-87.<br />
Natürlich müssen auch auf der Kundenseite entsprechende Fähigkeiten vorhanden<br />
sein, damit sich Kunden gewinnbringend in die kooperative Wertschöpfung mit dem<br />
Hersteller einbringen und einen wirklichen Beitrag zur Problemlösung leisten können.<br />
Nicht alle Kunden eines Unternehmens eignen sich gleichermaßen für eine Integration<br />
in einen gemeinsamen Innovationsprozess mit einem Anbieter. Vielmehr konzentriert<br />
sich diese Eignung auf eine ausgewählte Gruppe von Nutzern bzw. Kunden. Nach von<br />
Hippel (1986) sind es „fortschrittliche Kunden” (Lead User) mit bestimmten<br />
Charakteristika, die innovative Leistungen initiieren und demzufolge konsequent in<br />
den Innovationsprozess integriert werden sollten. Diese fortschrittlichen Kunden<br />
haben sowohl Bedürfnis- als auch Lösungsinformation, d. h. sind in der Lage, ein<br />
81<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
neues Bedürfnis zu erkennen und in eine Problemlösung zu überführen. Da Lead User<br />
per Definition der Gesamtheit der Kunden in einem Markt voraus sind, ist ihre Zahl<br />
begrenzt (auch wenn es die Idee der in Kapitel 3 vorgestellten Methoden ist, diese Zahl<br />
zu erhöhen). Deshalb ist nicht nur ihre Innovationsfähigkeit, sondern auch ihre<br />
Innovationsbereitschaft von hoher Bedeutung, damit sich Lead User am<br />
Innovationsvorhaben einer Unternehmung beteiligen. Wir werden beide Aspekte ausführlich<br />
in Abschnitt 3.2.3 und vor allem Abschnitt 3.3.1 diskutieren. Wenden wir uns<br />
aber im Folgenden der Interaktionskompetenz des Herstellerunternehmens zu.<br />
Knappheit von Wissen und industrieller Wandel<br />
Zum Verständnis der Interaktionskompetenz (des Herstellers) ist ein kurzer Rückblick<br />
auf die drei Phasen industrieller Entwicklung von der tayloristischen Industrieproduktion<br />
bis zur interaktiven Wertschöpfung hilfreich. Die Entwicklung von einer<br />
Stufe zur nächsten kann mit einem Wandel der Bedeutung von Wissen erklärt werden.<br />
In allen drei Stufen basiert erfolgreiches Unternehmertum auf der Transformation von<br />
Wissen (Foray / Lundvall 1996), jedoch mit jeweils unterschiedlichem Fokus. In der<br />
industriellen Produktion ist dies die Transformation von Wissen in Maschinen und<br />
Werkzeuge sowie, nach Taylor, in arbeitsorganisatorische Abläufe zur Produktivitätsoptimierung.<br />
In der zweiten Phase der Netzwerkökonomie steht die Transformation<br />
von Wissen in vernetzten Organisationsstrukturen zum Aufbau von<br />
Wettbewerbsvorteilen durch Flexibilität und Marktnähe im Vordergrund. Die aktuelle<br />
ökonomische Entwicklung ist durch die Transformation von Wissen in Wissensprodukte<br />
geprägt (Drucker 1998). In vielen Branchen entsteht innovative Wertschöpfung<br />
nicht mehr primär durch Materialbearbeitung, sondern durch intelligente Lösungen<br />
für die Gestaltung des Wertschöpfungsprozess. Franz Lehner (2005) betont diesen<br />
Zusammenhang, indem er feststellt dass “Wachstum nicht mehr durch höheres<br />
Produktionsvolumen entsteht, sondern durch mehr Wissen in den Produkten, mehr<br />
Wissen in den Vertriebswegen (z. B. intelligente Verteilungslösungen im Web), mehr<br />
Wissen in den Nutzungsstrukturen (Mobilität, Navigation). Der Wert eines PCs, eines<br />
mobilen Kommunikationsgerätes, einer Werkzeugmaschine oder eines Haushaltsgerätes<br />
wird nicht durch die Materialien oder deren Bearbeitung bestimmt, sondern<br />
durch das im Produkt enthaltene Lösungswissen, d. h. durch die investierten<br />
Entwicklungsleistungen.<br />
Wandelt sich dadurch jedoch auch die Produktion materieller Güter immer mehr zur<br />
Wissensproduktion, dann werden die in Abschnitt 2.4.3.5 genannten Besonderheiten<br />
der Ökonomie von Informations- und Wissensproduktion auch für weitere Güter<br />
relevant. Sind Wissensgüter wie Software, Musik, Tools, Dokumente, Bilder, Filme erst<br />
einmal in digitaler Form vorhanden, können sie zu minimalen Kosten im Überfluss<br />
produziert, kopiert, transformiert und versendet werden (Zerdick et al. 2001).<br />
Wissensgüter als digitale Ware sind nicht mehr knapp. Damit scheinen die ökonomischen<br />
Gesetze der traditionellen Güterproduktion hier nicht mehr zu gelten. Denn in<br />
der klassischen Marktlehre bestimmt der Knappheitsgrad der Ressourcen den Preis<br />
und deren Verwendungsrichtung bei der Lösung des Allokationsproblems. Nach dieser<br />
ökonomischen Logik dürften Unternehmen ihre knappen Produktionsfaktoren<br />
nicht einsetzen, um Güter zu produzieren, die nicht knapp, sondern im Überfluss vor-<br />
82
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
handen sind. Trotzdem werden heute Wissensgüter von Unternehmen in immer<br />
schnelleren Zyklen und größer werdenden Stückzahlen weiter produziert. Eine plausible<br />
Antwort auf dieses scheinbare Paradox geben Lundvall und Johnson (1994) in<br />
ihrem Aufsatz „The Learning Economy“: Sie befassen sich mit der Knappheitshypothese<br />
in der Wissensökonomie und kommen zu dem Ergebnis “Knowledge is<br />
abundant, but the ability to use it is scare.” Wissen ist im Überfluss vorhanden, aber<br />
die Fähigkeit, es wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen, ist knapp. In der Folge unterscheiden<br />
sie zwei Kategorien von Wissen: das technisch-naturwissenschaftliche Wissen,<br />
das in der Regel kodifiziert ist und somit explizites Wissen und im Überfluss vorhanden<br />
ist und das Anwendungswissen, das in der Regel nicht kodifiziert ist und häufig<br />
ein knappes Gut ist (Abbildung 2–14).<br />
Abbildung 2–14: Unterscheidung von technisch-naturwissenschaftlichem Wissen und<br />
Anwendungswissen<br />
Technisches Wissen:<br />
Basiert auf wissenschaftlich fundiertem<br />
Theorie- und Faktenwissen<br />
• im Überfluss vorhanden<br />
• überwiegend explizites Wissen<br />
• digitalisierbar<br />
• Transfer bei geringen Transaktionskosten<br />
• Zugriff orts- und zeitunabhängig<br />
• Eingeschränkte Eigentums- und<br />
Schutzrechte<br />
• veraltet schnell<br />
• leicht kopierbar<br />
• schafft kurzfristige Wettbewerbsvorteile<br />
Wissen als Ressource<br />
Anwendungswissen:<br />
Basiert auf Erfahrungs- und<br />
Umsetzungswissen<br />
• knappe Ressource<br />
• überwiegend implizites Wissen<br />
• kaum digitalisierbar<br />
• Transfer bei hohen Transaktionskosten<br />
• Zugriff stark orts- und zeitabhängig<br />
• kaum eingeschränkte Eigentums- und<br />
Schutzrechte<br />
• veraltet langsam<br />
• schwer kopierbar<br />
• schafft nachhaltige Wettbewerbsvorteile<br />
Damit hat das Schumpetersche (1934) Gesetz des Unternehmertums, Wissensvorsprünge<br />
in Innovationen umzusetzen, weiterhin Bestand. Im Wettbewerb um die<br />
Innovationsfähigkeit sind heute nicht die Unternehmen überlegen, die (nur) über ein<br />
hohes Maß an technisch-naturwissenschaftlichem Wissen verfügen, das oft im Überfluss<br />
vorhanden ist. Für den Unternehmenserfolg ist vielmehr die knappe Ressource<br />
“Anwendungswissen” im Sinne von Lundvall und Johnson (1994) entscheidend. Dies<br />
gilt auch bei der interaktiven Wertschöpfung, die ja, wie wir in Abschnitt 2.4.3.4 gese-<br />
83<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
hen haben, in erster Linie eine Wissensproduktion ist, deren direktes Ergebnis auch<br />
häufig ohne direkte Schutzrechte allen Akteuren zur Verfügung steht.<br />
Das Wissen jedoch, wie interaktive Wertschöpfung organisiert und ökonomisch gestaltet<br />
werden kann, um Wettbewerbsvorsprünge zu erwerben, ist knapp. Die erfolgreiche<br />
Umsetzung der Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung hängt von diesem<br />
Anwendungswissen ab, das wir als Interaktionskompetenz bezeichnen. Kundeninteraktionskompetenz<br />
weist einen konkreten Zielbezug auf, der in der Integration von<br />
Kundenwissen in den Wertschöpfungsprozess des Unternehmens liegt. Sie ist dann<br />
hoch, wenn auf der Umsetzungsebene des Anbieters die Bedingungen für eine erfolgreiche<br />
Wissensintegration und Ideenumsetzung bis zum Markterfolg gegeben sind.<br />
Interaktionskompetenz bezeichnet die Gesamtheit der Kompetenzen und Fähigkeiten eines<br />
Anbieters, um die Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung erfolgreich umzusetzen (vgl. Abb.<br />
2-6). Sie konkretisiert sich in den Organisationsstrukturen (interaktionsfördernde<br />
Ablaufstrukturen), in Anreizstrukturen (z. B. monetäre Anreize) als auch in den Systemen und<br />
Werkzeugen der Information und Kommunikation (z. B. Toolkits, Interaktionsplattformen).<br />
Der Erfolg des Unternehmens wird weniger von der Leistungsfähigkeit der vorhandenen<br />
Produktionsfaktoren bestimmt, als vielmehr von der Verfügbarkeit der knappen Ressource<br />
„Anwendungswissen“. Nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielt ein Unternehmen durch den<br />
Aufbau von Interaktionskompetenz (vgl. Abb. 2-15).<br />
Bausteine der Interaktionskompetenz im Unternehmen<br />
Kundeninteraktionskompetenz zeichnet sich dadurch aus, dass ein Unternehmen ein<br />
Maßnahmenbündel für die Kundeninteraktion im Sinne von Bridging-Strategien<br />
(siehe Abschnitt 2.4.5) so implementiert und aufeinander abgestimmt wird, dass die<br />
erfolgskritische Ressource Kundenwissen kontinuierlich zugänglich ist und erfolgreich<br />
im Wertschöpfungsprozess genutzt wird. Der Begriff der Kompetenz folgt dabei<br />
einem holistischen-organisationalen Verständnis “als die Fähigkeit eines Unternehmens<br />
zur Ereichung spezifischer Ziele. ... Kompetenz erfasst somit nicht nur die<br />
Qualifikation, etwas zu tun, sondern auch die Anwendung dieser Qualifikation in<br />
Form der Erfüllung von Aufgaben” (Ritter 1998: 53 und 56). Interaktionskompetenz<br />
wird damit zu einer Kernkompetenz der Organisation im Sinne des Resource-Based<br />
View (siehe Abschnitt 2.4.5). Hierbei ist nicht nur das Vorhandensein der Ressourcen<br />
von Bedeutung, sondern auch die Art und Weise, wie verschiedene Ressourcen miteinander<br />
verbunden werden können (Prahalad / Hamel 1990). Zum Aufbau von Kernkompetenzen<br />
tragen klassische Produktionsfaktoren wie maschinelle oder<br />
Kapitalressourcen weniger bei als “organisationale Ressourcen” im Sinne von etablierten<br />
Verfahren, Routinen und Methoden.<br />
Im Ansatz der Theorie der Ressourcenabhängigkeit gilt die “Absorptionsfähigkeit”<br />
eines Unternehmens (“absorptive capacity” nach Cohen / Levinthal 1990) als Maß, wie<br />
gut eine Bridging Strategy den Zugang zu externen Ressourcen ermöglicht. Die<br />
Absorptionsfähigkeit bezeichnet so die Fähigkeit oder Kompetenz eines Unternehmens<br />
zur Nutzung und zum Lernen von externen Quellen für die eigene Wissens-<br />
84
generierung mit dem Ziel der Innovation. Zahra und George (2002) unterscheiden vier<br />
unterschiedliche, aber komplementäre Teilkompetenzen, die die Absorptionsfähigkeit<br />
eines Unternehmens ausmachen:<br />
Die Akquisition bezieht sich auf die Fähigkeit, extern vorhandenes Wissen zu<br />
identifizieren und aufzunehmen. Die beinhaltet aber auch die Gestaltung von<br />
Anreizsystemen, damit Akteure überhaupt zur Produktion und Offenlegung von<br />
Wissen bereit sind.<br />
Die Verarbeitung bezieht sich auf unternehmensinterne Abläufe zur Analyse,<br />
Prüfung, Selektion und Interpretation des erworbenen Wissens.<br />
Die Transformation beschreibt die Unternehmensfähigkeit, organisatorische<br />
Routinen zu entwickeln und abzustimmen, die eine gezielte Kombination des neu<br />
erworbenen Wissens mit bereits vorhandenem Wissen anstrebt. Diese Integration<br />
extern erworbenen Wissens in interne Prozesse geht über die Kompetenz normaler<br />
Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen hinaus. Hier ist in unserem Zusammenhang<br />
vor allem die Reintegration der Teilleistungen im Konzept der “Peer-Production”<br />
gemeint.<br />
Die Exploitation bezieht sich letztendlich auf die Prozesse der Nutzung des<br />
Wissens und dessen kommerzielle Verwertung durch Innovationen und Produktindividualisierung.<br />
Kundeninteraktionskompetenz kann als Konkretisierung der Absorptionsfähigkeit<br />
in Bezug auf die Integration von Kundenwissen in einen unternehmerischen Wertschöpfungsprozess<br />
gesehen werden. Sie sollte derart in der Führungs-, Organisationsund<br />
Infrastruktur des Unternehmens verankert sein, dass die Kundeninteraktionskompetenz<br />
zu einer sch wer imitierbaren organisationalen Fähigkeit bzw. Routine<br />
werden kann. Auf Basis dieses Begriffsverständnisses bieten sich erste Anhaltspunkte<br />
für konkrete Teilkompetenzen einer Kundeninteraktionskompetenz an, die wir im<br />
Folgenden kurz ansprechen wollen. Wir unterscheiden dabei interaktionsförderliche<br />
Kommunikations-, Anreiz- und Ablaufstrukturen (Abbildung 2–15).<br />
Interaktionsförderliche Kommunikationsstrukturen<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Die kommunikationstechnische Unterstützung der interaktiven Wertschöpfung hat<br />
das Ziel, die traditionell einseitig ausgerichtete Kommunikation in einen kontinuierlichen<br />
zweiseitigen Dialog mit den Kunden umzuwandeln. Dazu gibt es drei Leitlinien:<br />
Unmittelbare Kommunikation beschreibt die Forderung der direkten gegenseitigen<br />
Erreichbarkeit und Interaktionsmöglichkeit. Kommunikation darf nicht einseitig<br />
sein, sondern muss im Sinne eines interaktiven Problemlösungsprozesses gegenseitigen<br />
Austausch ermöglichen. Durch neue Formen eines virtuellen Kundendialogs<br />
kann dies häufig zeitnah und zu relativ geringen Kosten realisiert werden.<br />
Bedingtheit von Kommunikation bedeutet, dass Kunden gezielt auf eine Ansprache<br />
durch den Anbieter und andere Kunden reagieren können. Ihre Beiträge sind<br />
also bedingt durch vorherige Beiträge bzw. können auf diesen in ergänzender<br />
Weise aufbauen. Zusätzlich sind die Kundenbeiträge bedingt durch Motivation,<br />
85<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Interesse, Fähigkeiten und Wissen des jeweiligen Kunden. Kunden können also Art<br />
und Umfang ihres Beitrags sehr einfach gemäß ihrer momentanen Disposition und<br />
Laune auswählen, anpassen und skalieren (Pribilla / <strong>Reichwald</strong> / Goecke 1996).<br />
Vielseitigkeit der Kommunikation bedeutet eine größere Reichweite und Vernetzung<br />
als beim individuellen Kundendialog. Durch den Aufbau virtueller Gemeinschaften<br />
bzw. Communities erhalten Anbieter z. B. Einblick in die soziale Denkwelt der Kunden<br />
(Kozinets 1999; Sawhney / Prandelli 2000). Der in virtuellen Kundengemeinschaften<br />
mitgeteilte, gemeinsam erzeugte und zusammengetragene Erfahrungsschatz lässt<br />
Unternehmen weiter in die soziale Dimension des Kundenwissens vordringen.<br />
Abbildung 2–15: Bausteine der Interaktionskompetenz<br />
Leitfragen der Interaktionskompetenz<br />
1)Über welche Anreizsysteme wird der<br />
Interaktionsprozess gesteuert?<br />
2)Wie erfolgt der wechselseitige Transfer von<br />
lokalem Wissen („sticky information“)?<br />
3)Wie wird der Prozess der Kundenintegration in<br />
den Wertschöpfungsphasen gestaltet?<br />
4)Welche Werkzeuge der Interaktion stehen für<br />
die Phasen der Innovation und Produktion zur<br />
Verfügung?<br />
5)Nach welchen Kriterien gestaltet sich der<br />
Lösungsraum für Open Innovation/<br />
Produktindividualisierung?<br />
6)Welche Kommunikationskanäle und –formen<br />
fördern die Interaktion?<br />
7)Welche Entlohnungsformen sind im Hinblick<br />
auf den Kundennutzen notwendig?<br />
8)Wie werden arbeitsteilige Prozesse über<br />
Führungskonzepte und -instrumente<br />
koordiniert?<br />
9)Über welche Kompetenzen muss der Kunde<br />
verfügen (Lead-User-Merkmale)?<br />
10)Wie kann die Ökonomie der interaktiven<br />
Wertschöpfung für das Unternehmen gesichert<br />
werden (Kosten der Interaktion)?<br />
86<br />
Interaktionskompetenz<br />
Generierung von Anwendungswissen als knappe Ressource<br />
Interaktionsfördernde Strukturen<br />
• Interaktionsförderliche<br />
Kommunikationsstrukturen<br />
• Unmittelbarkeit<br />
• Bedingtheit<br />
• Vielseitigkeit<br />
• Interaktionsförderliche Ablaufstrukturen<br />
• Automatisierte Abwicklung der<br />
Intergrationsaufgabe<br />
• Peer-Production<br />
• Reintegration hierarchischer<br />
Koordinationsformen<br />
• Interaktionsförderliche Anreizstrukturen<br />
• Gate-Keeper-Konzept<br />
• Dezentrale Unternehmensstrukturen<br />
• Entscheidungsdelegation und<br />
Ergebnisverantwortung<br />
• Instrumente zum Wissensaustausch<br />
• Vertrauenskultur
Wie diese Prinzipien im Einzelnen gestaltet werden sollen, wird im Rahmen der<br />
Darstellung konkreter Interaktionsprozesse und -instrumente bei Open Innovation<br />
und Produktindividualisierung näher dargestellt (siehe vor allem Abschnitte 3.5, 4.1.3<br />
und 4.4).<br />
Interaktionsförderliche Ablaufstrukturen<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Wenn Innovationen zunehmend über Netzwerke unterschiedlicher Organisationstypen<br />
generiert werden, ist der Prozess der Ablauforganisation für die Leistungserstellung<br />
über die interne Herstellerorganisation hinaus zu erweitern. Im Mittelpunkt<br />
steht die Frage nach dem „wie“ der Integration unterschiedlicher Akteure und ihrer<br />
Beiträge vor dem Hintergrund diverser Interessen in einem vernetzten Innovationsund<br />
Produktionsprozess. Wir werden diese Aspekte auch im Zusammenhang mit der<br />
Diskussion der konkreten Instrumente in Kapitel 3 und 4 wieder aufgreifen. An dieser<br />
Stelle sollen aber bereits einige allgemeine Prinzipien der Ablauforganisation bei der<br />
interaktiven Wertschöpfung angesprochen werden. Es sei jedoch betont, dass die<br />
Erforschung dieser Ablaufprozesse erst ganz am Anfang steht (Benkler 2002). Bislang<br />
hat sich die Wissenschaft in erster Linie damit beschäftigt zu zeigen, dass interaktive<br />
Wertschöpfung existiert und was die wesentlichen Elemente dieses Systems sind.<br />
Arbeiten jedoch, die empirische Belege für “promising practices” zur Organisation der<br />
interaktiven Wertschöpfung aus Unternehmenssicht geben, sind jedoch so gut wie<br />
noch nicht existent (für eine aktuelle Ausnahme siehe Foss / Laursen / Pedersen 2005).<br />
Benkler (2002) selbst unterscheidet eine Reihe von Mechanismen, die das<br />
Integrationsproblem der Teilbeträge verteilter Akteure bei einer Commons-based Peer<br />
Production lösen können:<br />
eine automatisierte Abwicklung der Integrationsaufgabe über dedizierte Informationsplattformen,<br />
die Peer Production der Integration selbst, d. h. auch die externen Teilnehmer<br />
übernehmen die Integration der Beiträge einzelner in die Wertschöpfungskette,<br />
Integration durch Reintegration hierarchischer Koordinationsformen, d. h. eine<br />
interne Abwicklung durch das Herstellerunternehmen.<br />
(1) Vor allem, wenn die Beiträge einzelner Beitragenden relativ gering sind, können<br />
moderne Informationsplattformen einen Teil der notwendigen Integration automatisiert<br />
abwickeln. Ein Beispiel ist die Entwicklungsplattform im Kite-Surfing-Beispiel<br />
(Kasten 2–7). Diese mit einem CAD-System vergleichbare Software sorgt bei bestimmten<br />
Entwicklungsbeiträgen für eine automatische Integration in die Gesamtentwicklung.<br />
Ebenso ist im Fall von Spreadshirt eine automatische Integration der<br />
Kreationen einzelner Kunden (bzw. Betreiber eines “virtuellen T-Shirt-Mini-Shops”) in<br />
das Produktionssystem von Spreadshirt sichergestellt (Kasten 2–8). Lediglich die<br />
Prüfung, ob ein Motiv nicht gegen die guten Sitten bzw. Markenrechte eines Dritten<br />
verstößt, wird noch manuell durch Mitarbeiter von Spreadshirt vorgenommen.<br />
Gleiches gilt für Produktkonfigurationssysteme, wie sie bei Dell zum Einsatz kommen<br />
(Kasten 2–4). Auch hier können die individuellen Spezifikationen einzelner Kunden<br />
durch die Anwendung dieses “Toolkits” automatisch in das Produktionssystem von<br />
Dell übernommen werden. Im Falle wirklich innovativer Beiträge und Ideen von<br />
87<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Nutzern und Kunden, die den Lösungsraum stark erweitern, scheint jedoch eine automatische<br />
Integration der Beiträge nicht möglich.<br />
(2) Eine Möglichkeit aus Herstellersicht ist es in diesem Fall, die Integrationsfunktion<br />
auszulagern und durch die Teilnehmer selbst vollziehen zu lassen (Peer Production<br />
der Integration). Ein gutes Beispiel hierfür ist Threadless. Hier übernehmen die Nutzer<br />
bzw. Kunden den Auswahlprozess weitgehend selbst und entscheiden als Kollektiv,<br />
welche neuen Entwicklungen Teil des Angebots von Threadless werden (Kasten 1–1).<br />
Ein weiteres Beispiel ist Wikipedia, wo die Teilnehmer selbst sowohl neue Beiträge in<br />
das Gesamtsystem integrieren als auch Ergänzungen und Verbesserungen bestehender<br />
Beiträge vornehmen. In diesem Fall ist auch die wichtige Aufgabe der Qualitätssicherung,<br />
eine Teilfunktion der Integrationsaufgabe, auf die Gesamtheit der<br />
Beitragenden ausgelagert. Basis der Qualitätssicherung ist dabei das Normen-System<br />
dieser Organisation (siehe dazu Fallstudie in Abschnitt 5.2)<br />
(3) In den meisten Fällen bedeutet jedoch die Integrationsaufgabe eine Reintegration<br />
hierarchischer Koordinationsformen, d. h. die Anwendung eines klassischen<br />
Koordinationsmechanismus im Herstellerunternehmen. Dies gilt vor allem, wenn es<br />
sich bei interaktiver Wertschöpfung um einen durch den Hersteller initiierten Prozess<br />
handelt, bei denen die Kunden in einen Teilbereich der unternehmerischen<br />
Wertschöpfung integriert sind. In diesem Fall sind es die Mitarbeiter des Herstellers,<br />
die in einer klassischen Ablauforganisation die Beiträge der Kunden integrieren und<br />
zum Bestandteil der Gesamtleistung machen.<br />
Ein Beispiel dazu ist Stata Corp., ein Hersteller statistischer Software (von Hippel<br />
2005). Kunden von Stata sind häufig Wissenschaftler oder Entwickler, die die Software<br />
für eine Vielzahl statistischer Tests anwenden. Die Software erlaubt dabei die einfache<br />
Programmierung neuer Tests, falls die vorhandenen Anwendungen in dem Programm<br />
eine bestimmte Aufgabe nicht ausreichend (elegant) lösen können. Stata hat deshalb<br />
seine Software in zwei Teile gespalten: in einen proprietären Teil, der die Grundfunktionen<br />
bereitstellt und durch das Unternehmen selbst weiterentwickelt wird (und<br />
durch eine klassische Software-Lizenz kostenpflichtig vertrieben wird), und in einen<br />
offenen Teil, zu dem die Gemeinschaft aller Nutzer wesentliche Beiträge in Form neuer<br />
statistischer Algorithmen und Tests leistet. Stata unterstützt diese Expertennutzer, in<br />
denen es ihnen einen Entwicklungsumgebung und ein Online-Forum zur Verfügung<br />
stellt, wo die Nutzer ihre eigenen Test austauschen, anderen Nutzern Fragen stellen<br />
und Entwicklungen anderer weiterentwickeln können. Da allerdings nicht alle Nutzer<br />
derart versiert sind oder ausreichende Programmierkenntnisse haben, hat Stata ein<br />
Prozedere entwickelt, mit dem das Unternehmen regelmäßig die “besten” bzw. populärsten<br />
Weiterentwicklungen aus der Nutzer-Community auswählt und zum<br />
Bestandteil der nächsten kommerziellen Release-Version macht. Diese Entscheidung<br />
wird allein im Hause Stata getroffen, dessen Software-Entwickler auch die ausgewählten<br />
Anwendungen der Nutzer verbessern und reibungslos mit der Standardsoftware<br />
integrieren. Diese zusätzliche Wertschöpfung durch das Unternehmen ist auch Anreiz<br />
für die Nutzer, ihre Eigenentwicklungen in der Regel ohne monetäre Gegenleistung<br />
Stata zur Verfügung zu stellen (denn das Motiv für die Eigenentwicklung war ja sowieso<br />
die Nutzung der eigenen Anwendung für die eigene wissenschaftliche Arbeit).<br />
88
Interaktionsförderliche Anreizstrukturen<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Daran schließt sich unmittelbar die Forderung nach interaktionsförderlichen Anreizstrukturen<br />
an. Geeignete innerbetriebliche Anreize müssen die Weitergabe von<br />
Kundenwissen im Unternehmen und die Aufnahme von externem Wissen belohnen. Es<br />
ist bekannt, dass nicht in allen Unternehmen eine derartige Offenheit für den Input der<br />
Nutzer herrscht wie bei Stata oder Threadless. Für viele Hersteller ist die Vorstellung, dass<br />
Nutzer einen (besseren) Beitrag zur Weiterentwicklung der eigenen Produkte leisten können,<br />
sehr neu. Oft sind es einige fortschrittlich denkende Abteilungen im Unternehmen,<br />
die eine Initiative zur Integration von Kundeninformation starten und Beiträge durch die<br />
Nutzer anregen. Diese müssen dann aber im Unternehmen durch andere Abteilungen<br />
weiterverarbeitet und genutzt werden (siehe dazu die Fallstudie in Abschnitt 5.1). Unter<br />
dem Begriff “Not Invented Here (NIH) Syndrom wird aber im Innovationsmanagement<br />
ein Problem diskutiert, das genau diesen Transfer betrifft. Katz und Allen (1982: 7) definieren<br />
das NIH-Syndrom als “(...) the tendency of a project group of stable composition to<br />
believe that it possesses a monopoly of knowledge in its field, which leads it to reject new<br />
ideas from outsiders to the detriment of its performance.” Klassischerweise wurde das<br />
NIH-Phänomen unternehmensintern zwischen verschiedenen Bereichen nachgewiesen<br />
(d. h. z. B. Widerstände der Entwicklungsingenieure, Input aus der Marketingabteilung<br />
zu berücksichtigen). Es ist anzunehmen, dass Widerstände gegen externes Wissen oft<br />
noch größer sein können als in Bezug auf Input eigener Kollegen. Dies bedeutet im Falle<br />
einer interaktiven Wertschöpfung zwischen Kunden und einem Herstellerunternehmen,<br />
dass Wissen aus externen Quellen auf Widerstand bei wenigstens einem Teil der internen<br />
Nutzer dieses Wissens stoßen kann (Huff / Möslein 2004).<br />
Ein klassisches Konzept zur Überwindung des NIH-Syndroms ist die Betonung von<br />
“Gatekeepern” (Allen 1977), die ein Entwicklungsteam mit externen Wissensquellen<br />
verbinden, aber zugleich auch nicht zielführende Informationen ausfiltern. Gatekeeper<br />
haben sowohl Mechanismen als auch Anreize, ihr Wissen über externes Wissen mit<br />
den relevanten Teilen der restlichen Organisation zu teilen (siehe Allen 1977 sowie<br />
Gemünden 1981 und Moenaert / Souder 1990 zur Gestaltung der Gatekeeper-Rolle).<br />
Unternehmen sollten in diesem Sinne Gatekeeper einrichten, deren spezielle Rolle die<br />
Aufnahme und Weitergabe von Kundeninformation in den internen Entwicklungsprozess<br />
des Unternehmens ist. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Microsoft<br />
(Prahalad / Ramaswamy 2000). Microsoft hat eine Gruppe von ca. 1500 zentralen<br />
Nutzern mit Lead-User-Charakter (Web-Master, Programmierer oder Software-Distributeure),<br />
die als so genannte “Microsoft Buddies” wichtigen Input für die langfristige<br />
Entwicklung der Microsoft-Software geben (siehe auch http://msdn.microsoft.com/isv/isvbuddy).<br />
Die Mitglieder dieser Gruppe werden als erste Beta-Tester in neue Releases<br />
einbezogen, geben intensives Feedback zu bestehenden Produkten und übermitteln<br />
Ideen für neue Funktionalitäten. Im Austausch bekommen sie freie Software und<br />
Einladungen zu speziellen Events. Um das NIH-Problem zwischen den Ideen den<br />
“Buddies” und dem Unternehmen zu verhindern, hat Microsoft “Liaison Officers”<br />
nominiert, die als Gatekeeper zwischen Microsofts internen Entwicklungsteams und<br />
den Nutzern agieren. Diese Manager sind bereits seit langem in der Organisation,<br />
haben ein großes internes Netzwerk, aber auch eine gewisse hierarchische Macht, um<br />
die Integration des Nutzerinputs so gut wie möglich voran treiben zu können.<br />
89<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Eine andere Maßnahme zum Aufbau von Integrationskompetenz auf der Ebene der<br />
Anreizstrukturen ist die Schaffung einer offenen Unternehmensstruktur. Hierzu<br />
wird in der Literatur zum internen Wissensmanagement, das genau vor der gleichen<br />
Herausforderung der Verteilung und Nutzung lokalen Wissens zwischen verschiedenen<br />
Domänen steht, der Vorteil dezentraler Unternehmensstrukturen und einer<br />
Delegation von Entscheidungen auf die operative Ebene betont (Foss / Laursen /<br />
Pedersen 2005). Die Idee ist es, Entscheidungskompetenz auf die Ebene zu verlagern,<br />
auf der auch das relevante notwendige Wissen für die Entscheidungsfindung und -exekution<br />
liegt. Denn auch im Unternehmen ist ein Informationstransfer häufig durch<br />
“sticky” Information geprägt, dass eine einfache Weitergabe von einer Stelle zur anderen<br />
verhindert. Das konkrete Ausmaß dieser Reintegration dispositiver und administrativer<br />
Aufgaben hängt dabei von der Betrachtungsebene und der Aufgabenstellung<br />
ab. Grundsätzlich wird jedoch das Subsidiaritätsprinzip als Richtlinie für die<br />
Dezentralisierung von Funktionen befolgt (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003):<br />
Entscheidungskompetenz und Ergebnisverantwortung sollen in der Hierarchie so niedrig<br />
wie möglich (also möglichst nahe am eigentlichen Wertschöpfungsprozess) angesiedelt<br />
sein. So bedeutet z. B. die prozessnahe Entscheidungskompetenz eine deutlich<br />
höhere Flexibilität der Unternehmung durch viele dezentrale und kundennahe<br />
Regelkreise und den Wegfall langer und fehleranfälliger Entscheidungswege.<br />
Gleichzeitig soll die Motivation der Mitarbeiter durch ganzheitliche Aufgabenerfüllung<br />
erhöht und der Anreiz zu marktgerechtem Handeln verstärkt werden.<br />
Ein hoher Delegationsgrad von Aufgaben kann deshalb zunächst die Nutzung lokalen<br />
Wissens verbessern, vor allem, wenn die Entscheidungsdelegation von entsprechenden<br />
Anreizen begleitet wird, die eine Abstimmung mit den Gesamtzielen der<br />
Organisation fördern. Die Erfolge japanischer Unternehmen zu einer kontinuierlichen<br />
Verbesserung und Prozessinnovation werden weitgehend der Fähigkeit dieser<br />
Unternehmen zugeschrieben, Entscheidungskompetenz auf die Ebene zu verlagern,<br />
wo auch das lokale Wissen zur Problemlösung vorhanden ist. Die hieraus resultierenden<br />
Innovationen sind jedoch in der Regel Verbesserungsinnovationen.<br />
Wird jedoch lokales Wissen nicht nur lokal angewendet, sondern mit lokalem Wissen<br />
aus anderen Quellen zusammengebracht, kann Innovation auf einer höheren Ebene<br />
resultieren. Die Weitergabe und das Teilen von Wissen unterstützen die Bildung<br />
nicht-trivialer Prozessverbesserungen oder neuer Kombinationen im Sinne<br />
Schumpeters (1934) “schöpferischer Zerstörung”, die auch in (radikal) neuen Leistungen<br />
resultieren können (Kogut / Zander 1992; Tsai / Ghoshal 1998). Instrumente<br />
zur Unterstützung des Wissensaustauschs wie Job Rotation, interfunktionale<br />
Gruppen oder ein ausgeprägtes formales Wissensmanagement können in diesem<br />
Sinne die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens erhöhen. In Einklang mit Foss,<br />
Laursen und Pedersen (2005) schließen wir deshalb, dass eine Entscheidungsdelegation<br />
auf lokale Ebene und die Förderung offener, auf Wissensteilung und -<br />
transfer ausgelegte Strukturen auf intraorganisationaler Ebene auch die<br />
Absorptionsfähigkeit von Anbieterunternehmen in Bezug auf externes Kundenwissen<br />
erhöhen kann. Eine offene und dezentrale Ablauforganisation eines Unternehmens<br />
scheint in diesem Sinne eine wichtige Voraussetzung für die Bildung von Interaktionskompetenz.<br />
90
Eine enge Kooperation unter Einschluss der Weitergabe des Wissens kann bei einzelnen<br />
Personen zur Befürchtungen führen, sich entbehrlich zu machen und damit im<br />
Extremfall den eigenen Arbeitsplatz zu gefährden. Auf der Unternehmensebene führt<br />
Innovationskooperation häufig zu der Befürchtung, die Konkurrenzfähigkeit einzubüßen.<br />
Entsprechend ist es erforderlich, auf diesen Feldern durch transparente Maßnahmen<br />
Vertrauen zu generieren und durch ein gezieltes “Vertrauensmanagement”<br />
die Basis für eine erfolgreiche Kooperation zu schaffen. Wie jedoch entsprechende<br />
Prozesse aussehen können, die zu erfolgreichen Innovationsnetzwerken führen, was in<br />
unterschiedlichen Bereichen fördernde und hemmende Faktoren sind − das hängt von<br />
den betrieblichen und überbetrieblichen Anreizsystemen ab.<br />
Anreize für den Leser zur Weiterentwicklung des Themas „Interaktionskompetenz“<br />
Für viele Unternehmen ist das Denken in Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung<br />
noch sehr neu. Wie bereits erwähnt, stehen die empirische Forschung und die Ableitung<br />
von erfolgreichen Praktiken im Unternehmen zum Aufbau von Interaktionskompetenz<br />
erst am Anfang der Untersuchung. Deshalb sollen die Ausführungen in<br />
diesem Abschnitt vor allem als Anregungen gesehen werden, welche Aspekte zum<br />
Aufbau von Interaktionsfähigkeit als Anwendungswissen für interaktive Wertschöpfung<br />
beachtet werden müssen. Wie diese jedoch genau zu gestalten sind, wird<br />
die unternehmerische Praxis noch zeigen – nicht zuletzt, da wir genau hier in der<br />
Zukunft die Quelle nachhaltiger Wettbewerbsvorteile vermuten. Wir laden unsere<br />
Leser und Erfahrungsträger ein, an der Weiterentwicklung dieses wichtigen Feldes,<br />
nämlich der Generierung der knappen Ressource Anwenderwissen aus Theorie und<br />
Unternehmenspraxis mizuwirken (siehe hierzu auch das Vorwort).<br />
2.4.7 Grenzen der interaktiven Wertschöpfung:<br />
Aufgabenteilung und Transaktionskosten<br />
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
Kasten 2-14: Literaturempfehlungen zur Interaktionskompetenz und zu interaktionsförderlichen<br />
Organisations- und Kommunikationsstrukturen<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Möslein, Kathrin (1999). Management und Technologie. In : Lutz von Rosenstiel<br />
et al. (Hrsg.): Führung von Mitarbeitern: Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement.<br />
4. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschl 1999<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Möslein, Kathrin / Siebert, Jörg (2005). Leadership Excellence: Learning<br />
from an exploratory study on leadership systems in large multinationals. Journal of European<br />
Industrial Training, 3 (2005):184-198.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Siebert, Jörg / Möslein, Kathrin (2004).<br />
Leadership Excellence: Führungssysteme auf dem Prüfstand. Personalführung (2004): 50-56<br />
Wir haben in den vorangehenden Abschnitten gesehen, dass eine interaktive Wertschöpfung<br />
unter bestimmten Voraussetzungen eine effiziente und effektive Form zur<br />
Organisation arbeitsteiliger Prozesse sein und durch die Integration von Wissen der<br />
91<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 2–16: Trade-Off zwischen Produktionskosten und Transaktionskosten in der<br />
interaktiven Wertschöpfung<br />
Kunden neue Wettbewerbsvorteile für den Hersteller schaffen kann. Die Bedingung<br />
dafür ist, dass Unternehmen in der Lage sind, ihre Wertschöpfungsaufgaben in<br />
“modulare” und “granulare” Teilaufgaben zu zerlegen, diese so am Markt zu präsentieren,<br />
dass aus einer großen Menge an Kunden und Nutzern diejenigen per Selbstselektion<br />
eine Aufgabe suchen, für die sie am besten qualifiziert und/oder motiviert<br />
sind, den Input der Kunden effizient ins Herstellerunternehmen zu transferieren und<br />
schließlich die Integration der einzelnen Kundenbeiträge zu geringen internen<br />
Transaktionskosten zu vollziehen (Aufbau von Interaktionskompetenz). Allerdings<br />
zeigt sich an dieser Stelle bereits ein Trade-off, der die Grenzen der interaktiven<br />
Abbildung beschreibt.<br />
Wie Abbildung 2–16 modellhaft zeigt, steigt der Aufgabenumfang, der an die Kunden<br />
externalisiert werden kann, in dem Maße, in dem sich die Wertschöpfungsaufgaben<br />
eines Unternehmens für eine sehr feingliedrige Aufteilung eignen. Dadurch sinken die<br />
verbleibenden Produktionskosten des Unternehmens. Die externen Transaktionskosten<br />
für die Abstimmung mit den Kunden sinkt gemäß den Prinzipien der “Peer<br />
Production” mit zunehmender Modularität und Granularität der Teilaufgaben, weil<br />
für sehr kleine Beiträge, die sich die Kunden selbst auswählen, tendenziell keine<br />
zusätzlichen Anreize notwendig sind. Allerdings bedarf es dann der innerbetrieblichen<br />
Koordination und Integration einer größeren Anzahl von Einzelbeiträgen. Diese<br />
Integrationsaufgabe verursacht dann tendenziell höhere interne Transaktionskosten.<br />
Aus dieser Argumentation folgen drei Grenzen der interaktiven Wertschöpfung.<br />
(1) Kosten für die Integration der Teilergebnisse: Wenn ein Unternehmen die internen<br />
Transaktionskosten für die Integration der Teilaufgaben senken kann, so ver-<br />
92<br />
Gesamtkosten<br />
der interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
Gesamtkosten<br />
Ökonomisch<br />
optimaler Grad<br />
Interne Transaktionskosten<br />
(innerbetriebliche Koordination<br />
und Integration der Teilaufgaben)<br />
Produktionskosten /<br />
externe Transaktionskosten<br />
(Externalisierung der Teilaufgaben)<br />
Grad der Aufgabenteilung<br />
(Modularisierung, Granularität)
Neue Formen der Arbeitsteilung<br />
schiebt sich der ökonomische optimale Grad der Arbeitsteilung und Externalisierung<br />
von Wertschöpfungsaufgaben nach rechts. Das Unternehmen wäre also in der Lage,<br />
das Ausmaß der interaktiven Wertschöpfung in ökonomisch sinnvoller Weise auszudehnen.<br />
Hieraus folgt aber aus der Notwendigkeit des effizienten Transfers der<br />
Kundenbeiträge ins Unternehmen sowie aus dem Bedarf nach interner Integration ein<br />
Bedarf nach geeigneten technischen Hilfsmitteln (Aufbau der Interaktionskompetenz),<br />
der neue Kosten verursacht (z. B. Kosten für Aufbau und Pflege von Interaktionsplattformen<br />
zur synchronen Kollaboration im Internet, Aufbau von Toolkits<br />
etc.). Aus dem gleichen Grund sind komplementäre organisationale Mechanismen in<br />
der Kundendomäne erforderlich, die geeignete Möglichkeiten und Anreize für die<br />
Kunden bieten, einen Teil der Integrationsaufgabe selbst zu übernehmen (z. B.<br />
Ideenwettbewerbe, Maßnahmen zur Peer-Recognition).<br />
(2) Anforderungen an die Eignung betrieblicher Wertschöpfungsaufgaben für die<br />
interaktive Wertschöpfung: Voraussetzung der interaktiven Wertschöpfung ist weiterhin<br />
eine weit reichende Zerlegbarkeit der betrieblichen Wertschöpfungsaufgaben. Ist<br />
diese Zerlegbarkeit (Granularität) nicht gegeben, bleiben die Teilaufgaben, die wegen<br />
ihres Bedarfs an externem Kundenwissen potenziell ausgelagert werden sollten, so<br />
umfangreich und anspruchsvoll, dass sie kaum ohne eine vertragliche Vereinbarung<br />
von Gegenleistungen abgewickelt werden. Damit steigen aber wieder die externen<br />
Transaktionskosten – oder es entstehen Opportunitätskosten durch die entgangenen<br />
Nutzengewinnen als Folge der interaktiven Wertschöpfung.<br />
Inwieweit sich die Wertschöpfungsaufgaben eines Unternehmens für eine einfache<br />
Modularisierung und Re-Integration eignen, macht sich an den Aufgabenmerkmalen<br />
fest (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). So eigenen sich prinzipiell Aufgaben von hoher<br />
Strukturiertheit, die exakte, einander eindeutig zuzuordnende Lösungsschritte und<br />
Input-Output-Relationen beinhalten. Dabei ist die Komplexität im Sinne der Anzahl<br />
notwendiger Lösungsschritte und deren Ursache-Wirkungs-Beziehungen weniger ein<br />
Problem, so lange sie grundsätzlich ex ante bekannt sind. An seine Grenzen stößt das<br />
reine Konzept der Peer-Production bei wissensintensiven Aufgaben der Produktentwicklung<br />
und -designs von hohem technischen Neuigkeitsgrad, die heute in<br />
Unternehmen oftmals in Teams ausgeführt werden. Solche Aufgaben sind nicht in relativ<br />
kleine Teilaufgaben von wissensökonomischer Reife zu zerlegen. Doch auch hier<br />
zeichnet sich ab, dass eine interaktive Wertschöpfung möglich ist, insofern geeignete,<br />
dem Aufgabenumfang entsprechende Anreize gesetzt werden (ein gutes Beispiel dafür<br />
ist das in Kapitel 3 in Kasten 31 beschriebene Beispiel Innocentive).<br />
(3) Wichtigkeit materieller Inputfaktoren: Eine dritte Grenze der interaktiven Wertschöpfung<br />
lässt sich in der Wichtigkeit materieller Inputfaktoren für die Wertschöpfung<br />
in vielen Unternehmen ausmachen. Benkler (2002) sieht als wesentlichen Grund für die<br />
Verbreitung der interaktiven Wertschöpfung nach dem Prinzip der “Peer Production”<br />
die drastische Reduktion der Informations- und Kommunikationskosten. Wenn die<br />
Kosten der notwendigen materiellen Ressourcen (Internetzugang, Computer etc.) relativ<br />
kostengünstig und weit verteilt sind und der notwendige Inputfaktor Information tendenziell<br />
ein nicht knappes, öffentliches Gut darstellt, dann ist das Wissen bzw. Talent<br />
oder Humankapital der beteiligten Akteure der einzig knappe und wichtigste Input-<br />
93<br />
2.4
2<br />
Entwicklungen und Trends auf dem Weg zur interaktiven Wertschöpfung<br />
faktor. Unter diesen Bedingungen ist interaktive Wertschöpfung ein geeignetes Modell.<br />
Wie das Kite-Surfing-Beispiel zeigt, ist es auch nicht auf die Produktion reiner Informationsgüter<br />
beschränkt. Jedoch ist die Wertschöpfung und der dazu notwendige<br />
Wissenstransfer für viele materielle Güter auch unwiderruflich verbunden mit dem<br />
Austausch materieller Inputfaktoren, deren Produktion aufgrund von Skaleneffekten am<br />
besten von einem Unternehmen anstatt von Kunden ausgeführt wird.<br />
Schlussfolgerung<br />
Wir haben in diesem Kapitel einen weiten Weg von der tayloristischen Organisation<br />
arbeitsteiliger betrieblicher Wertschöpfung über die Netzwerkorganisation bis zum<br />
neuen Konzept einer interaktiven Wertschöpfung auf Basis der “Commons-based Peer<br />
Production” beschritten. Das letztgenannte Konzept ist eine neue Alternative zur<br />
Abwicklung der Leistungserstellung in der Hierarchie oder im Markt bzw. einer hybriden<br />
Zwischenform. Unter bestimmten Bedingungen und innerhalb gewisser Grenzen<br />
stellt dieses Modell eine für viele Unternehmen völlig neue Alternative zur<br />
Organisation der Wertschöpfung dar. Es wird aber die klassischen Formen nicht ablösen<br />
und in vielen Wertschöpfungssystemen auch nicht in Reinform, sondern im Mix<br />
mit anderen Organisationsformen zum Einsatz kommen. Auch wird es in einer “verwässerten”<br />
Form auftreten, d. h. es sind nicht alle Prinzipien der interaktiven<br />
Wertschöpfung genau umgesetzt.<br />
Ziel der folgenden Kapitel ist es deshalb, aus einer mehr anwendungsorientierten Sicht<br />
das Konzept der interaktiven Wertschöpfung zu konkretisieren und seine Umsetzung<br />
in der betrieblichen Praxis aufzuzeigen. Wir sehen dabei aber heute, dass – wie im<br />
Beispiel Kite-Surfing – in vielen Fällen die Initiative zur interaktiven Wertschöpfung<br />
nicht von den Anbietern, sondern von den Kunden ausgeht. Deshalb sind die im<br />
Folgenden dargestellten Möglichkeiten vielleicht gar nicht immer eine Option, sondern<br />
teilweise auch eine notwendige Reaktion. Denn Kunden und Nutzern geht es in erster<br />
Linie um einen höheren Grad an Bedürfnisbefriedigung und die Lösung offener<br />
Probleme. Ob sie dieses selbst oder in Zusammenarbeit mit einem Hersteller tun, ist<br />
vielen von ihnen häufig zweitrangig.<br />
94
3 Interaktive Wertschöpfung in der<br />
Innovation: Open Innovation<br />
Die erfolgreiche Generierung von Innovation ist eine stetige Aufgabe aller Unternehmen.<br />
Ursache ist dafür zum einen der technische Wandel, der sich in den letzten<br />
Jahren in immer kürzeren Produktlebenszyklen vollzieht. So schrumpfte beispielsweise<br />
der Produktlebenszyklus in der Automobilindustrie über das letzte Jahrzehnt<br />
von durchschnittlich zehn Jahren auf sechs Jahre und nimmt weiter ab (Brockhoff<br />
1999). Unterhaltungselektronik wird in der Regel schon nach sechs bis zwölf Monaten<br />
von Nachfolgeprodukten in den Verkaufsregalen abgelöst. Dieses Phänomen wird<br />
durch die zunehmende Individualisierung der Nachfrage verstärkt, wie wir in<br />
Abschnitt 2.2.3 gesehen haben. Hinzu kommt der globale Wettbewerb. Er zwingt<br />
Industrienationen wie Deutschland, Standortnachteile gegenüber Niedrigkostenländern<br />
durch Wissensvorsprung zu kompensieren (Bullinger 2002; Grupp / Legler /<br />
Licht 2004). Hohe Innovationsfähigkeit gilt deshalb als Schlüssel für Wachstum und<br />
Unternehmenserfolg.<br />
Inhalt dieses Kapitels ist eine neue Sichtweise der Innovationsfähigkeit. Das klassische<br />
Innovationsmanagement hat sich damit beschäftigt, wie ein Unternehmen in<br />
einem zielgerichteten Prozess eine neue Idee in ein innovatives Produkt oder eine<br />
neuartige Leistung überführt und diese erfolgreich am Markt platziert. Diese Fragen<br />
sind bereits breit erforscht und beschrieben worden (siehe z. B. Cooper 1993;<br />
Gerybadze 2004; Hauschildt 2004; Ulrich / Eppinger 2000; Utterback 1994). Im<br />
Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Suche und das Aufspüren der Quellen von<br />
Innovation und neue Wege, wie der Problemlösungsprozess als Grundlage jeder<br />
innovativen Tätigkeit gestaltet werden kann. Denn wir wissen aus zahlreichen<br />
empirischen Befunden, dass viele Innovationen ihren Ursprung nicht der<br />
Entwicklungsleistung von Herstellern verdanken, sondern der Kreativität von<br />
Nutzern und Kunden. Wir werden dieses Phänomen „Nutzer und Kunde als<br />
Quelle und Co-Produzent von Innovationen“ im Folgenden näher betrachten. Im<br />
Sinne einer neuen Form der Arbeitsteilung durch interaktive Wertschöpfung werden<br />
wir untersuchen, wie Hersteller und Kunden kooperativ Innovationen hervorbringen<br />
können. Dieses Vorgehen wollen wir mit dem Begriff “Open Innovation”<br />
belegen. Open Innovation bezeichnet die Abkehr von einem klassischen<br />
Innovationsprozess, der sich weitgehend innerhalb der Unternehmen abspielte.<br />
Open Innovation beschreibt den Innovationsprozess als einen vielschichtigen offenen<br />
Such- und Lösungsprozess, der zwischen mehreren Akteuren über die<br />
Unternehmensgrenzen hinweg abläuft. Diese Öffnung des Innovationsprozesses für<br />
externen Input und die Auslagerung von Aufgaben an die Akutere, die besondere<br />
Kompetenzen oder lokales Wissen zu ihrer Lösung haben, schafft viele neue<br />
Potentiale.<br />
95
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Open Innovation bezeichnet eine interaktive Wertschöpfung im Innovationsprozess, indem<br />
ein Herstellerunternehmen mit ausgewählten Kunden bzw. Nutzern gemeinschaftlich<br />
Innovationen generiert. Dies erfolgt durch gezielte, jedoch relativ informale und vor allem partizipative<br />
Koordination des Interaktionsprozesses zwischen Herstellern und einer Vielzahl an<br />
Kunden und Nutzern. Dabei kommt es zu einer systematischen Integration von<br />
Kundenaktivitäten und Kundenwissen in die Ideengenerierung, die Entwicklung erster konzeptioneller<br />
technischer Lösungen, Design und Fertigung erster Prototypen und die Diffusion der<br />
Innovation.<br />
Kasten 3–1 gibt hierzu ein einführendes Beispiel: Das Unternehmen Innocentive ist ein<br />
herausragendes Beispiel, wie die Effizienz und Effektivität des Innovationsprozesses<br />
durch die Integration externer Akteure erhöht werden kann. Statt der hierarchischen<br />
Zuteilung von Aufgaben an einzelne Akteure werden hier die Probleme offene ins<br />
Netz gestellt, und mögliche Problemlöser selektieren selbst, welche Aufgaben sie vollziehen<br />
wollen (Hinweis: Innocentive ist kein Beispiel für eine Innovation, wo die<br />
Kunden bzw. Nutzer in den Innovationsprozess einbezogen werden. Es ist aber ein<br />
gutes Beispiel für einen verteilten Problemlösungsprozess als ein wesentliches<br />
Prinzip der interaktiven Wertschöpfung.)<br />
Es sei an dieser Stelle aber bereits betont, dass Open Innovation das in modernen<br />
Industrieunternehmen praktizierte Innovationsmanagement ergänzen, aber nicht<br />
ersetzen kann. Die Interaktion mit dem Kunden erschließt neue Quellen des Wissens<br />
über Bedürfnisse und Lösungen. Sie erhöht somit die Innovationsfähigkeit eines<br />
Herstellers und kann Unsicherheiten und Marktrisiken für viele Unternehmen reduzieren.<br />
Neben Branchen, in denen der Interaktionsprozess mit Kunden die wettbewerbsentscheidende<br />
Innovationsstrategie bilden wird, wird es aber weiterhin<br />
Branchen geben, in denen der Innovationsprozess weitgehend auf die unternehmensinternen<br />
Vorgänge reduziert bleibt.<br />
Kasten 3–1: Innocentive: Ideenbörse für Tüftler<br />
(Quelle: Auszug aus dem Artikel “Ideenbörse für Tüftler” von Hilmar Schmundt in Der Spiegel, Nr.<br />
5 2005 vom 19. Dezember 2005: 142)<br />
Eigentlich saß Ambros Hügin an jenem Abend nur in seiner Genfer Wohnung und surfte ein wenig<br />
im Netz. Er genoss sein neues Leben als Hausmann. Den Job an der Uni-Klinik hatte der 50-jährige<br />
Forscher gekündigt. Unversehens befand er sich nach ein paar Mausklicks in einem Labor<br />
inmitten Tausender Erfinder. Auch einen Forschungsauftrag hatte er plötzlich: die Entwicklung<br />
einer neuen Methode zum Testen von entzündungshemmenden Mitteln. Er grübelte, las, experimentierte<br />
herum. Dann hatte er das Problem gelöst. Prompt landete auf seinem Konto ein Honorar<br />
von 10.000 Dollar. Von wem das Geld stammt, weiß er bis heute nicht. Für den freiberuflichen<br />
Erfinder Hügin war es ein Traum, für die US-Firma Innocentive (www.innocentive.com) knallhartes<br />
Kalkül. Der Name ist ein Kunstwort, in dem “Innovation” mit Anreiz (“incentive”) verschmolzen ist.<br />
Das Geschäftsprinzip der Ideenbörse ist einfach: Eine Firma sucht nach einer Lösung für ein<br />
Problem, das ihre Entwicklungsabteilung allein nicht lösen kann. Sie stellt also ihre Frage mit ein<br />
paar Sätzen, Formeln oder Grafiken auf der Website von Innocentive [innocentive.com] dar und<br />
96
3.1 Der interaktive Innovationsprozess<br />
Wir wollen im Folgenden zunächst einige wichtige Begriffe und Strukturierungsansätze<br />
im Zusammenhang mit Innovationen vorstellen, die wir in der weiteren Argumentation<br />
benötigen, um die Eigenheiten einer Innovation als Ergebnis einer interaktiven<br />
Wertschöpfung zu beschreiben.<br />
Begriff und Dimensionen der Innovation<br />
Der interaktive Innovationsprozess<br />
lobt ein Preisgeld aus, zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Insgesamt 80 000 Tüftler interessieren<br />
sich für das Herumknobeln an den hier gestellten Aufgaben; wer die beste Lösung hat,<br />
bekommt die Belohnung, die anderen gehen leer aus. Der Auftraggeber bleibt dabei anonym, um<br />
Firmengeheimnisse zu schützen. Im Gegenzug verlangt die Börse vom Fragesteller eine Gebühr.<br />
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 expandiert die Tüftlerbörse kräftig. Ursprünglich war sie eine<br />
Ausgründung des Pharma-Riesen Eli Lilly. Zu den Kunden zählen sogar konkurrierende Konzerne<br />
wie BASF, Novartis, Nestlé oder der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, der in den vergangenen<br />
drei Jahren den Anteil von externen Produktideen von 20 auf 35 Prozent steigern konnte.<br />
(...)<br />
“Oft sind die Leute, die ein Produkt benutzen, die besten Fachleute, einfach durch ihren täglichen<br />
Umgang”, ergänzt Professor Cornelius Herstatt von der Technischen Universität Hamburg-<br />
Harburg. Der Medizintechnik-Hersteller Ethicon zum Beispiel sammle in seiner Deutschland-Filiale<br />
bei Hamburg systematisch per Internet die Erfahrungen von Chirurgen, um ihre Verbesserungswünsche<br />
zu berücksichtigen. Rasch findet die Offene Innovation neue Anhänger, vom<br />
Autobauer BMW über die japanische Einzelhandelskette Muji bis hin zur Modelleisenbahnfirma<br />
Roco. (...)<br />
Als eine Art Ebay der Ideen folgt die Offene Innovation den Gesetzen der Globalisierung: Auffällig<br />
viele Russen und Inder nehmen bei Innocentive teil. Für sie entspricht das Preisgeld teils einem<br />
ganzen Jahresgehalt. (...) Auch die starre Vertragspolitik sorgt bisweilen für Unmut: “Alle Rechte<br />
am geistigen Eigentum an eine anonyme Firma abzutreten, wie es oft geschieht, ist schon sehr<br />
gewöhnungsbedürftig”, sagt etwa der Privatforscher Hügin aus Genf. Dennoch jobbt er weiter im<br />
globalen Ideenlabor. Kürzlich hat er wieder 20.000 Dollar bekommen, weil er geholfen hat,<br />
Joghurtkulturen haltbarer zu machen. Aber seine besten Ideen behält er künftig für sich:<br />
Demnächst will er ein eigenes Patent anmelden.<br />
Die Erkenntnis, dass Innovation für den wirtschaftlichen Erfolg eine zentrale Rolle<br />
spielt, ist nicht neu. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts propagierte der Ökonom<br />
Josef Schumpeter (1934) in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung Innovation<br />
als Treiber für Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Schumpeter (1934: 100) sieht das<br />
Wesen einer Innovation in der “Durchsetzung neuer [Faktor-]Kombinationen”, die<br />
nicht stetig erfolgt, sondern diskontinuierlich auftritt. Zum Begriff der Innovation existiert<br />
bis heute eine semantische Vielfalt. Die folgenden Zitate geben einen Einblick in<br />
die Vielfalt von Definitionen in Wissenschaft und Praxis:<br />
“Liegt eine Erfindung vor und verspricht sie wirtschaftlichen Erfolg, so werden<br />
Investitionen für die Fertigungsvorbereitung und die Markterschließung erforderlich,<br />
Produktion und Marketing müssen in Gang gesetzt werden. Kann damit die<br />
Einführung auf dem Markt erreicht werden oder ein neues Verfahren eingesetzt<br />
97<br />
3.1
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
werden, so spricht man von einer Produktinnovation oder einer Prozessinnovation.”<br />
(Brockhoff 1992: 62).<br />
“Daraus wird deutlich, dass mit Innovation eigentlich das Ergebnis zweier<br />
Prozesse beschrieben wird. Auf der einen Seite steht der potenzielle Wandel der<br />
Verfügbarkeit bzw. des Angebots von Problemlösungen durch neue Ideen,<br />
Erfindungen und Entdeckungen, auf der anderen Seite die Nachfrage nach<br />
Problemlösungen, die ebenfalls veränderlich ist. Werden beide Seiten zur Deckung<br />
gebracht, also eine Anwendung bzw. Verwendung erreicht bzw. durchgesetzt,<br />
wobei auf mindestens einer Seite etwas Neues auftritt, so spricht man von<br />
Innovation.” (Pfeiffer / Staudt 1975).<br />
“Als Innovation sollen alle Änderungsprozesse bezeichnet werden, die die Organisation<br />
zum ersten Mal durchführt.” (Kieser 1969: 742).<br />
Hausschildt (2004: 7) entwickelt eine aus vier Dimensionen bestehende Systematisierung<br />
zur Bestimmung des Innovationsbegriffs: Die Frage, was neu ist, beschreibt die<br />
(1) inhaltliche Dimension der Innovation; diese Neuartigkeit muss allerdings als solche<br />
wahrgenommen werden. Die Frage für wen dies neu ist, stellt folglich die (2) subjektive<br />
Dimension dar. Durch die Frage, wie viele Stufen des Prozesses von der ersten<br />
Idee bis zur routinemäßigen Verwendung der Innovationsbegriff einschließt, wird der<br />
Fokus auf die (3) prozessuale Dimension gelenkt. Die abschließende Frage, ob die<br />
Innovation aus betriebswirtschaftlicher Sicht einen Erfolg darstellt, zielt auf die (4) normative<br />
Dimension ab.<br />
Erfindung = Innovation?<br />
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Innovation häufig mit einer technischen<br />
Erfindung gleichgesetzt. Doch ist jede Innovation auch eine Erfindung? Einen ersten<br />
Anhaltspunkt geben dazu die Richtlinien des deutschen Patentamts, die die<br />
Eigenschaften einer Erfindung genau beschrieben:<br />
“Gemäß § 4 Abs. 1 PatG [Patentgesetz] gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen<br />
Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus<br />
dem Stand der Technik ergibt. […] Als Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen<br />
Tätigkeit sind z. B. eine sprunghafte Weiterentwicklung, die Überwindung technischer<br />
Vorurteile, vergebliche Bemühungen von Fachleuten, Befriedigung eines lange bestehenden<br />
Bedürfnisses, ein einfacher und billiger Weg zur Herstellung von Massenartikeln,<br />
Verbilligung von Fertigungsmethoden und dergleichen anzusehen.”<br />
Obwohl das deutsche Patentamt auf mögliche ökonomische Effekte einer Erfindung<br />
hinweist, impliziert eine Erfindung (auch: Invention) nicht notwendigerweise eine<br />
wirtschaftlich erfolgreiche Verwertbarkeit. Anders verhält es sich bei Innovationen.<br />
Von einer Innovation soll nur dann gesprochen werden, wenn sich die Neuartigkeit<br />
einer Erfindung im innerbetrieblichen Einsatz bewährt oder im Markt verwerten<br />
lässt. Umgekehrt genügt aber auch nicht jede Innovation den strengen Richtlinien des<br />
Patentamtes an eine Erfindung. Dies gilt zum Beispiel für eine Vielzahl an<br />
Innovationen der Informations- und Kommunikationswirtschaft, die sich (in Europa)<br />
in der Regel nicht patentieren lassen. Zu solchen “postindustriellen Innovationen”<br />
98
gehören z. B. Online-Vertriebskanäle, Franchising, Finanzierungs- und Investitionskonzepte<br />
oder Neuerungen im Einzelhandel (Hauschildt 2004). Auch hat die Definition<br />
Kiesers (1969) den subjektiven Neuhaltsgehalt einer Innovation für ein Unternehmen<br />
angesprochen: Was für ein Unternehmen neu und somit eine Innovation ist,<br />
ist für andere bereits etablierte Praxis.<br />
Produkt- und Prozessinnovationen<br />
Der interaktive Innovationsprozess<br />
Die Unterscheidung in Produkt- und Prozessinnovationen spricht die Zielaspekte<br />
“innerbetrieblicher Einsatz” oder “marktliche Verwertbarkeit” an:<br />
Eine Produktinnovation ist eine Neuerung im Sachleistungs- bzw. Angebotsprogramm<br />
einer Unternehmung (marktliche Verwertbarkeit). “Die Produktinnovation<br />
offeriert eine Leistung, die dem Benutzer erlaubt, neue Zwecke zu erfüllen oder<br />
vorhandene Zwecke in einer völlig neuartigen Weise zu erfüllen.” (Hauschildt<br />
2004). Bei einer Produktinnovation kann es sich somit um ein völlig neues Produkt<br />
handeln, aber auch um die Weiterentwicklung eines bestehenden Produktes oder<br />
um die Einführung einer neuen Verpackung.<br />
Eine Prozessinnovation hingegen ist eine neuartige Faktorkombination (innerbetrieblicher<br />
Einsatz), “durch die die Produktion eines bestimmten Gutes kostengünstiger,<br />
qualitativ hochwertiger, sicherer oder schneller erfolgen kann. Ziel dieser Innovation<br />
ist die Steigerung der Effizienz” (Hauschildt 2004). Prozessinnovationen können z. B.<br />
ein neues Produktionsverfahren, der Einsatz neuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aber<br />
auch ein neues Vertriebssystem sein. Eine Umfrage der Unternehmensberatung<br />
Accenture unter 107 der 300 umsatzstärksten deutschen Unternehmen ermittelte die in<br />
Abbildung 3–1 genannten Ziele von Prozessinnovationen (Fink 2005):<br />
Abbildung 3–1: Ziele von Prozessinnovationen (entnommen aus Fink 2005)<br />
Senkung der unternehmensinternen Kosten<br />
Beschleunigung der Reaktionsfähigkeit<br />
Verringerung der Fehlerquote<br />
Flexibilisierung der Prozesse<br />
Kostensenkung in der Zusammenarbeit mit<br />
Zulieferern<br />
Kostensenkung in der Zusammenarbeit mit<br />
Kunden<br />
Etablierung eines innovativen Images<br />
Umsatzsteigerung<br />
Kostensenkung in der Zusammenarbeit mit<br />
Vertriebspartnern<br />
Individualisierung des Angebots<br />
44%<br />
52%<br />
51%<br />
48%<br />
48%<br />
62%<br />
56%<br />
82%<br />
78%<br />
72%<br />
99<br />
3.1
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
In der Realität ist eine strikte Trennung von Innovationen in Produkt- und Prozessinnovationen<br />
jedoch schwer beobachtbar. Vielmehr bestehen zwischen den zwei<br />
Innovationsarten hohe Interpendenzen. Beispielsweise kann eine Produktinnovation<br />
die Umstellung bestehender Produktionsprozesse bedingen.<br />
Innovation als Erweiterung des Lösungsraums<br />
Wir haben in Abschnitt 2.4.2 als wesentliches Prinzip der interaktiven Wertschöpfung<br />
das Konzept der Kundenintegration eingeführt. Kundenintegration kann dabei innerhalb<br />
eines gegebenen Lösungsraums stattfinden und die durch einen Anbieter vorgegebenen<br />
Potenziale (lediglich) ausnutzen. Kundenintegration kann aber auch diesen<br />
Lösungsraum erweitern bzw. modifizieren. Genau diese Erweiterung entspricht dem<br />
Innovationsbegriff: Eine Innovation soll als Erweiterung des Lösungsraumes eines<br />
Nutzers oder Herstellers verstanden werden. Eine Produktentwicklung schafft neue<br />
Produktarchitekturen und damit neue technische Möglichkeiten zur Befriedigung<br />
neuer Kundenbedürfnisse. Eine Prozessinnovation ermöglicht z. B. die effizientere<br />
oder qualitativ hochwertigere Befriedigung der Kundenbedürfnisse.<br />
Innovationsgrad<br />
Bisher unberücksichtigt blieb die Frage nach dem Neuheitsaspekt einer Innovation<br />
(Innovationsgrad): Wie viel Neuigkeit verlangt eine Innovation? Aus Sicht des<br />
Herstellerunternehmens gelten sämtliche Produkte oder Verfahren als innovativ, die<br />
innerhalb der Unternehmung erstmalig eingeführt werden. Aus Kundenperspektive<br />
hingegen ist Innovation “das, was für innovativ gehalten wird” (Hauschildt 2004). Der<br />
Nachfrager einer Leistung entscheidet (subjektiv) darüber, ob eine Innovation vorliegt<br />
oder nicht. Da Kunden Prozessinnovationen in der Regel nicht beobachten und wahrnehmen<br />
können, eignet sich die Kundenperspektive in der Regel nur zur Beurteilung<br />
von Produktinnovationen (Garcia / Calantone 2002; Gerpott 1999; Hauschildt 2004).<br />
Mittlerweile haben sich statt einfachen Dichotomien (“innovativ / nicht innovativ”)<br />
multidimensionale Ansätze zur Beschreibung des Innovationsgrads durchgesetzt<br />
(Green / Gavin / Aiman-Smith 1995). Diese analysieren den Einfluss einer Innovation<br />
auf Veränderungen im Unternehmen bzw. in einem Markt. Der Innovationsgrad ist<br />
ceteris paribus umso höher, je stärker diese Änderungsprozesse sind. Dabei können<br />
Innovationen Einfluss auf folgende Bereiche haben (Hauschildt 2004; Schlaak 1999):<br />
Produkttechnologie: Neuartigkeit, Substitutionscharakter, notweniges Wissen und<br />
Erfahrung;<br />
Absatzmarkt: neuartige Kundenbedürfnisse, neue Kunden, neue Vertriebskanäle;<br />
Produktionsprozess: Anforderungen an Maschinen und Montage;<br />
Beschaffung: Notwendigkeit neuer Materialien;<br />
Kapitalbedarf: Hohe Kosten für F+E und Marketing;<br />
Formale Organisation: Notwenigkeit von Spin-Offs oder neue Abteilungen;<br />
Informale Organisation: Veränderungen im Bereich Unternehmenskultur, Strategie,<br />
Management.<br />
100
Kombiniert man beispielsweise die Dimensionen “Absatzmarkt” und “Produkttechnologie”,<br />
kann die in Abbildung 3–2 gezeigte Unterscheidung Anhaltspunkte für<br />
verschiedene Innovationsgrade liefern. Bei einer inkrementellen Innovation nutzt<br />
ein Unternehmen eine etablierte Technologie, um einen vorhandenen Markt mit<br />
einem bereits existierenden, aber aus Sicht des Nachfragers überlegenen Produkt zu<br />
bearbeiten. Die Überlegenheit vollzieht sich z. B. entlang der Kriterien Preis,<br />
Qualität, Attribute oder Performance. Marktinnovationen hingegen penetrieren<br />
durch Nutzung einer etablierten Technologie einen neuen Markt (z. B.<br />
Espressomaschinen für den privaten Haushalt). Nutzt ein Unternehmen eine neue<br />
Technologie um einen bestehenden Markt zu bedienen, liegt eine technische<br />
Innovation vor. Die Ablösung des Walkman durch einen portablen CD-Player war<br />
eine solche Innovation. Schließlich können neue Märkte durch neue Technologien<br />
erschlossen werden. In diesem Fall spricht man von einer radikalen Innovation (z. B.<br />
Mobilfunk).<br />
Abbildung 3–2: Arten von Innovationen<br />
neu<br />
Markt<br />
alt<br />
Marktinnovation<br />
inkrementale Innovation<br />
Der interaktive Innovationsprozess<br />
Der interaktive Innovationsprozess<br />
radikale Innovation<br />
technische Innovation<br />
alt neu<br />
Technologie<br />
Empirische Untersuchungen haben vielfach gezeigt, dass sich der Innovationsprozess<br />
nicht linear vollzieht, sondern vielmehr in rekursiven Schleifen verläuft und mitunter<br />
durch zahlreiche Brüche gekennzeichnet ist (Braun-Thürmann 2005; Hauschildt 2004).<br />
Der Weg von einer Invention (Erfindung) zu einer im Markt erfolgreich platzierten<br />
Innovation erfolgt in verschiedenen Phasen. Die Gesamtheit dieser Phasen wird als<br />
Innovationsprozess bezeichnet. Innovationsprozesse werden dabei häufig in einen<br />
idealtypischen Ablauf gegliedert. Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Ablauf ist<br />
das lineare Phasenmodell mit den fünf Phasen: Ideengenerierung, Konzeptentwicklung,<br />
Prototyp, Produkt-/Markttest und Markteinführung (Cooper / Kleinschmidt<br />
1991; Staud / Auffermann 1999; Wheelwright / Clark 1992).<br />
101<br />
3.1
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Eine Innovation ist eine neuartige Zweck-Mittel-Kombination und das Ergebnis eines Problemlösungsprozesses.<br />
Diese hat sich unter dem Zielaspekt der Effizienzsteigerung innerbetrieblich<br />
(Prozessinnovation) oder/und unter dem Zielaspekt der Effektivität im Markt<br />
(Produktinnovation) zu bewähren. Der Innovationsgrad ist umso höher, je stärker die<br />
Umsetzung einer Innovation innerbetriebliche und marktliche Veränderungsprozesse bedingt.<br />
Idealtypisch durchläuft eine Innovation bis zu ihrer Markteinführung die Phasen<br />
Ideengenerierung, Konzeptentwicklung, Prototyp, Markttest und Markteinführung.<br />
Abbildung 3–3: Phasen eines idealtypischen Innovationsprozesses<br />
Anbieterunternehmen<br />
als Gestalter<br />
der Wertschöpfung<br />
Open Innovation<br />
Interaktionsfeld<br />
Ideengenerierung<br />
Konzeptentwicklung<br />
Prototyp<br />
Produkt/Markttest<br />
Markteinführung<br />
Wertschöpfungsphasen<br />
Kunden / Nutzer als<br />
Wertschöpfungspartner<br />
Grad der<br />
Kundeintegration<br />
Begrenztheit des<br />
Lösungsraums<br />
Gestaltungsraum<br />
Wie Abbildung 3–3 zeigt, können diese Phasen Ansatzpunkte für eine interaktive<br />
Wertschöpfung im Innovationsbereich sein (“Open Innovation”, wir werden diesen<br />
Begriff später noch genauer charakterisieren). Bildhaft vollzieht sich dieser<br />
Interaktionsprozess nach dem Phasenmodell von der Ideengenerierung über die<br />
Konzeptentwicklung bis hin zur Prototypen-Entwicklung und mündet schließlich aus<br />
der Sicht des Kunden in der Phase der Problemlösung. Der Open-Innovation-Ansatz<br />
102
ist insoweit ein ergänzender Ansatz zum herkömmlichen Innovationsmanagement, als<br />
dass Produkt- und Markttest sowie Markteinführung aus der Sicht des Herstellers<br />
nicht überflüssig werden, aber wegen der Kundeninteraktion in den vorherigen<br />
Phasen nach einem anderen Muster und mit einem erheblich geringeren Marktrisiko<br />
ablaufen. Die folgende kurze Beschreibung der Phasen gibt erste Anhaltspunkte für die<br />
Rolle von Kunden und Nutzern im Rahmen eines interaktiven Wertschöpfungsprozesses,<br />
die in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels noch vertiefend diskutiert<br />
werden.<br />
(1) Ideengenerierung (“Ideation”)<br />
Den Ausgangspunkt einer Innovation bildet die Phase der Ideengenerierung (oft auch<br />
“Ideation” genannt). Diese Phase wird auch als “Fuzzy Front End” des Innovationsprozesses<br />
bezeichnet (Cooper 1988; Khurana / Rosenthal 1997). Ein Unternehmen verfolgt<br />
in dieser frühen Phase das Ziel, seinen Ideenpool für Innovationen zu bilden bzw.<br />
zu vergrößern. Dabei kann es sich zum einen um Ideen für völlig neuartige Produkte<br />
oder Dienstleistungen handeln, welche das Unternehmen zuvor noch nicht am Markt<br />
angeboten hat. Zum anderen können Ideen darauf abzielen, bestehende Produkte oder<br />
Dienstleistungen des Unternehmens zu verbessern und für den Nachfrager attraktiver<br />
zu gestalten. Grundlage der Ideengenerierung sind Informationen über die (angenommenen<br />
offenen) Bedürfnisse der (potenziellen) Nachfrager und Nutzer einer<br />
Innovation (Bedürfnisinnovation). Bei einer Innovationsidee handelt es sich selten<br />
um ein ausgereiftes Konzept. Vielmehr verkörpert die Idee ein entwicklungsfähiges<br />
Potenzial. Nach einer Sammlung und Systematisierung eingehender Ideen werden<br />
diese anschließend bewertet. Im Vordergrund stehen dabei weniger ökonomische<br />
Aspekte als vielmehr die Kompatibilität der Idee mit dem angestrebten Leistungsprogramm<br />
und der (Technologie-) Strategie des Unternehmens, möglichen gesetzlichen<br />
Restriktionen sowie die Einzigartigkeit der Idee im Vergleich zum Wettbewerb.<br />
Die Bewertung der Ideen wird in der Regel unternehmensintern vorgenommen und<br />
basiert häufig auf der Erfahrung und der Expertise des Senior Managements. In der<br />
traditionellen Vorstellung des Innovationsmanagements erfolgt die Ideengenerierung<br />
aus internen Quellen. Als Ideengeber spielt die unternehmenseigene Forschungs- und<br />
Entwicklungsabteilung eine zentrale Rolle. Auch angrenzende Unternehmensbereiche,<br />
z. B. das Marketing oder der Vertrieb, als auch Mitarbeiter des Produktions- und<br />
Beschaffungsbereichs gelten als wichtige Ideenquellen. Der Open-Innovation-Ansatz<br />
erschließt dagegen zusätzlich externe Quellen für den Innovationsprozess. Open<br />
Innovation fokussiert besonders auf diese Phase des Innovationsprozesses: die Rolle<br />
von Kunden und Nutzern als Urheber oder Mitwirkende bei der Generierung innovativer<br />
Ideen und deren Bewertung.<br />
(2) Konzeptentwicklung<br />
Der interaktive Innovationsprozess<br />
Positiv bewertete Ideen treten in die zweite Phase der Konzeptionalisierung ein. Die<br />
Innovationsidee – von Natur aus eine noch recht vage verbale Beschreibung der angestrebten<br />
Innovation – wird nun verfeinert und weiterentwickelt. In dieser Phase finden<br />
die zentralen Tätigkeiten der Forschung und Entwicklung (F&E) statt. Dies beinhaltet<br />
zunächst eine Visualisierung der Idee durch Skizzen, Mock-ups oder Animationen.<br />
103<br />
3.1
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Des Weiteren erfolgt die Ausarbeitung eines definierten Zeitplans, eines Investitionsplans<br />
sowie Abschätzungen hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit und des<br />
Marktpotenzials der Innovationsidee. Die abschließende Konzeptbewertung erfolgt<br />
klassischerweise durch Experten, das Senior Management und vor allem durch<br />
Analysen der Marktforschung (Wheelwright / Clark 1992). Die Idee von Innocentive<br />
(Kasten 3–1), externe Akteure in die Problemlösung einzubeziehen, setzt genau in dieser<br />
Phase an. Doch auch so genannte Lead User, besonders fortschrittliche Kunden,<br />
überführen häufig eine Idee, wie ein neues Bedürfnis befriedigt werden könnte, in ein<br />
konkretes Konzept.<br />
(3) Prototyp-Erstellung<br />
In der dritten Phase wird das Innovationskonzept in einen Prototyp überführt. Ein<br />
Prototyp bezeichnet ein voll funktionsfähiges Versuchsmodell eines geplanten Produktes<br />
oder Bauteils. Neue Technologien wie Stereolithografie oder selektives Lasersintern<br />
erlauben es heute, CAD-Dateien ohne manuelle Umwege direkt in voll funktionsfähige<br />
Prototypen umzusetzen (Rapid Prototyping). Dabei werden die Werkstücke<br />
schichtweise aus formlosem oder formneutralem Material unter Nutzung physikalischer<br />
und/oder chemischer Effekte aufgebaut (Gebhardt 2000). Es wird nun<br />
geprüft, ob der Prototyp den Anforderungen des Konzepts Stand hält. Dies beinhaltet<br />
Tests hinsichtlich der Performance und der Akzeptanz des Prototyps unter<br />
Laborbedingungen. Zudem wird die Einhaltung der Entwicklungs- und Produktionskosten<br />
überprüft.<br />
Kunden und Nutzer spielen auch in der Phase der Prototypen-Erstellung eine wichtige<br />
Rolle. Lead User überführen ihr innovatives Konzept oft auch in einen funktionsfähigen<br />
Prototypen, mit dem sie ihr Bedürfnis zu befriedigen versuchen. In diesem Fall<br />
gehen die Phasen 1 bis 3, Ideengenerierung, Konzeptentwicklung und Prototypenerstellung,<br />
aus Sicht des Kunden ineinander über und münden in eine integrierte<br />
Problemlösungsphase. Ein anderer Ansatz von Open Innovation ist, Kunden durch<br />
den Einsatz bestimmter Hilfsmittel, die das Herstellerunternehmen bereitstellt, dazu<br />
zu befähigen, einen (virtuellen) Prototyp zu erstellen. Dies ist die Idee von “Toolkits for<br />
Open Innovation”, die wir noch genauer beschreiben werden.<br />
(4) Produkt- und Markttest<br />
Bei einer konventionellen Herstellerinnovation wird der Prototyp in dieser Phase in<br />
das Produktionssystem überführt und in der Regel zunächst in kleinen Stückzahlen für<br />
einen Testmarkt produziert. In einem solchen Testmarkt wird nun die Akzeptanz und<br />
Performance der Innovation unter realen Marktbedingungen evaluiert. Die Ergebnisse<br />
lassen Rückschlüsse auf notwenige Modifikationen des Produktes sowie auf die<br />
Gestaltung des Marketing-Mix zu. Im Rahmen des Open-Innovation-Ansatzes können<br />
Unternehmen bspw. Funktionstests und aufwendige Fehlersuchen auf die Kunden<br />
übertragen. Doch sind bei einer Nutzer-dominierten Innovation Produkt- und<br />
Markttests zum Test der Akzeptanz häufig gar nicht mehr notwendig, wenn die<br />
Innovation ursächlich auf den Ideen der Kunden beruhte. Der Open-Innovation-<br />
Ansatz ist insoweit ein ergänzender Ansatz zum herkömmlichen Innovationsmanagement,<br />
als dass Produkt- und Markttest sowie Markteinführung aus der Sicht des<br />
104
Herstellers nicht überflüssig werden, aber wegen der Kundeninteraktion in den vorherigen<br />
Phasen nach einem anderen Muster und mit einem erheblich geringeren<br />
Marktrisiko ablaufen.<br />
(5) Markteinführung<br />
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Im Rahmen der Markteinführung kommt dem Marketing eine zentrale Rolle zu. Innovationsmarketing<br />
bezeichnet sämtliche Aktivitäten im Rahmen der Kommunikation<br />
und Vermarktung der Innovation. Dies umfasst beispielsweise die Preissetzung, die<br />
Auswahl und Kombination geeigneter Distributionskanäle, das Marken- und<br />
Kommunikationsmanagement oder die Schulung von Verkaufspersonal. Open<br />
Innovation stellt an die Stelle einer groß angelegten Markteinführung für einen anonymen<br />
Markt eine dezidierte Vermarktung mit Pilotkunden, um durch die gesammelten<br />
Erfahrungen das Marktpotenzial schrittweise aufzubauen. Ebenso können die Kunden<br />
eine wichtige Rolle zur Diffusion übernehmen, indem sie in die Vermarktung und<br />
Distribution der Produkte mit einbezogen werden (gute Beispiele sind wieder die T-<br />
Shirt-Händler Threadless und Spreadshirt (Kasten 1–1 und Kasten 2–8): Hier wirken<br />
die Kunden auch entscheidend zur Vermarktung der Produkte bei, indem sie Freunde<br />
als Käufer werben, als Models für den Online-Katalog mitwirken und durch positive<br />
Mundpropaganda die Marke an sich bekannt machen.<br />
3.2 Von der Kundenorientierung zur<br />
Kundenintegration im Innovationsprozess:<br />
der Weg zu Open Innovation<br />
Der folgende Abschnitt beleuchtet die in der Literatur diskutierten Ansätze, die sich<br />
mit der Einbeziehung von Kunden in bestimmte Phasen des Innovationsprozesses<br />
befassen. Allerdings erfüllen diese Ansätze nicht vollständig die in Kapitel 2 beschriebenen<br />
Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung (Kapitel 2.4.1). Jedoch ist ihr<br />
Verständnis wichtig, um die Schritte auf dem Weg zu Open Innovation zu verstehen<br />
und diesen Ansatz von anderen Ideen der Integration von Kundeninformation in den<br />
Innovationsprozess abgrenzen zu können:<br />
Die Marketing-Forschung hat breite methodische Absätze entwickelt, um die<br />
Kundenorientierung im Innovationsprozess sicherzustellen. Diese so genannten<br />
„voice of the customer“-Ansätze belassen den Kunden allerdings noch in einer<br />
passiven Rolle (Abschnitt 3.2.1).<br />
Weitreichender sind dagegen schon Innovationsansätze in Netzwerkorganisationen.<br />
Diese Ansätze öffnen Innovationsprozesse über die Unternehmensgrenzen<br />
hinaus und betrachten verteilte Problemlösungsprozesse (“distributed innovation”)<br />
mit Technologielieferanten, Zulieferern, Wettbewerbern und ansatzweise<br />
auch Kunden bzw. Nutzern. Die Integration der Beiträge folgt allerdings den klassischen<br />
Organisationsprinzipien Hierarchie oder Markt. Hier ist auch der von<br />
105<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Chesbrough (2003) propagierte Ansatz einzuordnen, der bereits den Begriff “Open<br />
Innovation” verwendet (Abschnitt 3.2.2).<br />
Am weitestgehenden ist der Ansatz Eric von Hippels, der mit seinem “Lead User”-<br />
Ansatz und “Customer-Active-Paradigm” einen Paradigmenwechsel einleitete<br />
und Kunden bzw. Nutzer als die wesentliche Quelle von Innovationen sieht<br />
(Abschnitt 3.2.3). Der Ansatz von Hippels kommt unserer Vorstellung von<br />
Innovationsprozessen als interaktive Wertschöpfungspartnerschaft mit Kunden<br />
nahe, betont aber nicht die kooperative und gemeinsame Problemlösung zwischen<br />
Herstellern und Kunden.<br />
Open Innovation in unserem Sinne beschreibt den Innovationsprozess als einen vielschichtigen<br />
offenen Such- und Lösungsprozess, der zwischen Akteuren im Unternehmen<br />
und über die Unternehmensgrenzen hinaus mit externen Akteuren abläuft.<br />
Dieser Interaktionsprozess folgt weiterhin dem Phasenmodell von der Ideengenerierung<br />
über die Konzeptentwicklung bis hin zur Prototypen-Entwicklung und mündet<br />
aus Sicht der Kunden in der Phase der Problemlösung. Produkt- und Markttest<br />
sowie Markteinführung werden aus Sicht des Herstellers jedoch nicht überflüssig. Sie<br />
laufen aber wegen der Kundeninteraktion in den vorherigen Phasen nach einem anderen<br />
Muster und mit einem erheblich geringeren Marktrisiko ab. Der Open-Innovation-<br />
Ansatz ist so ein ergänzender Ansatz zum herkömmlichen Innovationsmanagement<br />
(Abschnitt 3.2.4).<br />
3.2.1 Ansätze der Kundenorientierung: “Voice of the<br />
Customer”<br />
Empirische Studien belegen, dass in Abhängigkeit von der jeweiligen Branche bis zu 90<br />
Prozent der potentiellen Innovationen am Markt keinen Erfolg haben (Cooper 1999;<br />
Crawford 1987). Die Erfolgsfaktorenforschung hat deshalb eine lange Tradition in der<br />
Literatur zum Innovationsmanagement. Ihr Ziel is die Identifikation von Determinanten,<br />
die den Erfolg oder Misserfolg einer Innovation erklären. Dabei wird nach<br />
Faktoren gesucht, die unternehmensintern oder im Umfeld von Unternehmen liegen<br />
und den Innovationsprozess initiieren, begünstigen oder beschleunigen (Ernst 2002).<br />
Faktoren erfolgreicher Innovation<br />
In der traditionellen Form des Innovationsmanagements geht man davon aus, dass vor<br />
allem unternehmensinterne Faktoren den Innovationserfolg positiv beeinflussen, wie<br />
z. B. die Unternehmenskultur, die Unternehmensstrategie, die Organisation des Unternehmens,<br />
das Führungssystem und die formale Ausgestaltung des Innovationsprozesses.<br />
Als externe Faktoren gelten insbesondere der Standort (z. B. die Nähe zu<br />
Universitäten oder Wissenschaftszentren), die rechtlichen Rahmenbedingungen (Recht<br />
des geistigen Eigentums), die wirtschaftliche Entwicklung, die Infrastruktur für<br />
Verkehr und Kommunikation, politische und gesellschaftliche Umweltfaktoren und<br />
die Einflussgrößen des Marktes (Cooper 1988; Cooper 1999; Cooper / Kleinschmidt<br />
1987; Ernst 2002).<br />
106
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Jedoch reichen diese Faktoren noch nicht aus, den Erfolg einer Innovation – und die<br />
hohen Flopraten von Innovationen – zu erklären. Denn selbst wenn ein Unternehmen<br />
all diese Faktoren beherrscht, können die resultierenden Innovationen noch an den<br />
Bedürfnissen der Nachfrager vorbeigehen. Immer wieder werden technisch ausgefeilte<br />
und aus unternehmensinterner Sicht hoch attraktive Produkte auf den Markt gebracht,<br />
die aber dennoch die Erwartungen der Unternehmen an das Produkt nicht erfüllen.<br />
Diese Produkte erfüllen entweder die Bedürfnisse der Kunden nicht besser (oder<br />
zu einem günstigeren Preis) als die bereits am Markt etablierten Produkte, oder aber<br />
sie schaffen keinen neuen Markt für ein Produkt, das bislang noch nicht existierte.<br />
Kundenorientierung als Erfolgsfaktor<br />
Deshalb herrscht heute in der Literatur Übereinstimmung über die Bedeutung der<br />
Kundenorientierung im Innovationsprozess. Unternehmen müssen die “Stimme der<br />
Kunden” als wesentliches Mittel zur Reduktion von marktlichen Unsicherheiten<br />
berücksichtigen (siehe z. B. Ernst 2002; Gemünden 1981; Gruner / Homburg 2000;<br />
Herrmann et al. 2000; Jenner 2004; Kahn 2001; Katila / Ahuja 2002; Krieger 2005; Lüthje<br />
2000; Montoya-Weiss / Calantone 1994). Wir werden diesen Faktor im Folgenden näher<br />
betrachten. Dabei werden wir sowohl die klassische Sichtweise als auch eine neue,<br />
erweiterte Sichtweise einnehmen.<br />
Kundenorientierung ist ein weiter Begriff, der den Wert einer Leistung für den Kunden<br />
in den Vordergrund stellt und alle Bereiche eines Unternehmens auf die Schaffung<br />
dieses Wertes ausrichtet (Homburg 2000). Eigenschaften eines kundenorientierten<br />
Unternehmens sind (i) eine Unternehmensvision, die den Kunden an erste Stelle stellt;<br />
(ii) die Fähigkeit des Unternehmens, besser als die Wettbewerber Informationen über<br />
die Kunden zu sammeln, zu verarbeiten und zu nutzen; (iii) die Koordination funktionsübergreifender<br />
Prozesse zur Schaffung von Wert für die Kunden (Day 1994;<br />
Jendrosch 2001; Lüthje 2003b). Bezogen auf den Innovationsprozess lassen sich diese<br />
Eigenschaften wie in Abbildung 3–4 dargestellt konkretisieren.<br />
Abbildung 3–4: Faktoren von Kundenorientierung im Innovationsprozess<br />
Erfolgsfaktoren einer Kundenorientierung im Innovationsprozess<br />
Sammlung von Marktinformationen<br />
Einsatz von Test-Märkten<br />
Verstehen von Kundenwünschen<br />
Kenntnis der Preissensitivität<br />
Testmarkt für Prototypen<br />
Bedürfnis- und Lösungsinformation<br />
Kundenbezug in allen Innovationsphasen<br />
Intensive Marktforschung<br />
Verstehen des Konsumentenverhaltens<br />
Kundenorientierter Market-Launch<br />
Frühe go-/no-go Entscheidungen<br />
Erfolgreiche Innovationen entstehen demnach dann, wenn Informationen über Bedürfnisse<br />
potentzieller Kunden (Bedürfnisinformationen) optimal mit Informationen hin-<br />
107<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
sichtlich der Lösung und Umsetzung dieser Bedürfnisse in ein entsprechendes Leistungsangebot<br />
(Lösungsinformationen) verknüpft werden. Wir haben diese Begriffe<br />
schon in Abschnitt 2.4.3 eingeführt und wollen die Argumentation hier nun vertiefen.<br />
Danach beinhalten Bedürfnisinformationen Wünsche, Präferenzen und Anforderungen<br />
der Kunden an eine Leistung sowie an deren Leistungsfähigkeit, Qualität,<br />
Design oder Preis (von Hippel 1994; Gruner / Homburg 2000). Bedürfnisinformation<br />
der Kunden kann sich zum einen auf Produkte und Dienstleistungen beziehen, die bisher<br />
noch nicht auf dem Markt angeboten werden. In diesem Falle verspüren Kunden<br />
ein Bedürfnis, welches bisher noch durch kein existierendes Marktangebot befriedigt<br />
wird. Bedürfnisinformation kann sich aber auch auf Erfahrungen des Kunden mit dem<br />
bisherigen Leistungsangebot eines Unternehmens erstrecken. Unzufriedene Kunden<br />
können demnach über Informationen verfügen, welche (fehlenden) Attribute eines<br />
Leistungsangebots diese Unzufriedenheit (ungestilltes Bedürfnis) hervorrufen<br />
(Brockhoff 2003). Doch nicht nur unzufriedene Kunden, sondern auch zufriedene<br />
Kunden können für einen Hersteller wichtige Informationen haben, beispielsweise<br />
darüber, welchen neuen Anforderungen das Leistungsangebot eines Anbieters in<br />
Zukunft genügen sollte.<br />
Im Gegensatz zu Bedürfnisinformationen umfassen Lösungsinformationen Informationen<br />
zur Transformation von Bedürfnissen in ein konkretes Leistungsangebot<br />
(Specht 1992). Dabei kann es sich um den Einsatz von Wissen, Technologien,<br />
Fertigungstechniken oder Humankapital handeln. Lösungsinformationen sorgen also<br />
dafür, dass Bedürfnisinformationen (potenzieller) Kunden in ein konkretes, marktfähiges<br />
Leistungsangebot übersetzt werden (von Hippel 1978a).<br />
Wesentliche Inputfaktoren für den Innovationsprozess sind Bedürfnis- und Lösungsinformation.<br />
Bedürfnisinformationen beinhalten Wünsche, Präferenzen und Anforderungen aktueller<br />
oder potentieller Kunden an ein neues Produkt oder eine neue Leistung sowie an deren<br />
Leistungsfähigkeit, Qualität, Design oder Preis. Lösungsinformation dagegen umfasst Wissen<br />
zur Transformation dieser Bedürfnisse in ein konkretes Leistungsangebot. Dabei kann es sich<br />
um den Einsatz von Wissen, Technologien, Fertigungstechniken oder Humankapital handeln.<br />
“Voice of the customer”<br />
Der traditionelle Innovationsprozess unterstellt eine stetige, vordefinierte Verteilung<br />
von Lösungs- und Bedürfnisinformationen. Demnach verfügen Kunden über Bedürfnisinformationen<br />
und das innovierende Unternehmen über Lösungsinformationen.<br />
Für das Unternehmen besteht die zentrale Herausforderung darin, über<br />
Marktforschungstechniken Bedürfnisinformation vom Markt in die firmeneigene<br />
Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu transferieren (dieser Vorgang wird oft<br />
auch als Aufnehmen der “voice of the customer” bezeichnet; siehe Griffin / Hauser<br />
1993). Dort wird die Bedürfnisinformation des Kunden dann unter Nutzung der<br />
Lösungsinformation von Forschern und Entwicklern in ein entsprechendes Leistungsangebot<br />
übersetzt (von Hippel 1978a; 1998). Weitere Marktforschungsaktivitäten<br />
und der Test von Prototypen sollen dabei sicherstellen, dass die Ergebnisse der eigenen<br />
108
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Produktentwickler auch den tatsächlichen Bedürfnissen des Zielmarktes entsprechen.<br />
Damit kommt es oft zu einer iterativen Annäherung zwischen dem Feedback der<br />
Marktforschung und weiteren Verbesserungen und Anpassungen der Entwickler des<br />
Herstellers.<br />
Allgemeine Methoden zur Generierung kundenorientierter Informationen im<br />
Innovationsprozess<br />
Im traditionellen Innovationsprozess stellt die Marktforschung eines Unternehmens<br />
das dominierende Bindeglied zwischen Kunde und Unternehmen dar, um einen<br />
Transfer von Bedürfnisinformationen potenzieller Nachfrage zu realisieren. Marktforschung<br />
bezeichnet dabei einen systematischen Prozess der Gewinnung und Analyse<br />
von Daten für Marketing- Entscheidungen (Berekhoven / Eckert / Ellenrieder 2004;<br />
Herrmann / Homburg 2000; Hruschka 1996). Der Einsatz spezifischer Marktforschungsmethoden<br />
orientiert sich dabei an den Anforderungen an die Datengrundlage<br />
und dem Ziel der formulierten Fragestellung. Während die entdeckende Marktforschung<br />
darauf abzielt, ein bisher noch wenig bekanntes Phänomen erstmals zu<br />
beleuchten, dient die testende Marktforschung der Vergleichbarkeit der Antworten<br />
einer Vielzahl von Befragten. Im Vordergrund der testenden Marktforschung steht die<br />
Repräsentativität der Daten. Dies ist genau dann der Fall, wenn Bedürfnisse einer ausgewählten<br />
Stichprobe auf die Grundgesamtheit übertragbar sind, d. h. die Bedürfnisse<br />
einer Stichprobe repräsentieren die Bedürfnisse einer definierten Grundgesamtheit.<br />
Die entdeckende Marktforschung hingegen verfolgt weniger das Ziel der Repräsentativität<br />
als die Exploration eines unbekannten Phänomens.<br />
Ein weit verbreitetes Instrument zur Erhebung von Primärdaten ist eine Befragung.<br />
Hierbei können sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zum Einsatz kommen.<br />
Die am weitest verbreiteten qualitativen Methoden stellen das Tiefeninterview<br />
und die Gruppendiskussion dar. Ein Tiefeninterview ist ein recht freies Interview in<br />
Form eines persönlichen Gesprächs. Der Interviewer lenkt den Gesprächsablauf auf<br />
Basis eines Interviewleitfadens. Durch Einsatz spezieller Fragetechniken lässt die<br />
Befragung Aussagen über Einstellungen und Motive des Befragten zu. Strebt das<br />
Tiefeninterview ein tieferes Verständnis individueller Verhaltensweisen und<br />
Meinungen an, zielt die Gruppendiskussion darauf ab, die Meinung und Ideen mehrer<br />
Personen zu erheben und gruppendynamische Effekte zu nutzen. Gruppendiskussionen<br />
finden meist in Fokusgruppen statt (Lüthje 2003b). Dabei handelt es sich<br />
um eine Gruppe von sechs bis zehn Mitgliedern, die unter Leitung eines qualifizierten<br />
Moderators einen Themenkatalog in der Gruppe diskutieren. Bei der Auswahl der<br />
Mitglieder empfiehlt es sich sowohl extrem heterogene als auch homogene Gruppen<br />
zu vermeiden. Im Ergebnis führt eine Gruppendiskussion im Idealfall dazu, dass sich<br />
die Gruppenmitglieder wechselseitig zu detaillierten und spontanen Äußerungen<br />
anregen.<br />
Die qualitative Befragung ist eine entdeckende Marktforschung, d. h. man versucht<br />
ein noch wenig bekanntes Phänomen erstmalig zu verstehen. Quantitative Befragungen<br />
hingegen zielen darauf ab, Antworten einer Vielzahl von Befragten unmittelbar<br />
zu vergleichen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Antworten bei dieser<br />
109<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Befragungsform standardisiert sind. Die Befragung erfolgt entweder mündlich, telefonisch,<br />
schriftlich oder online. Die quantitative Befragung ist eine testende<br />
Marktforschung. Die Ergebnisse einer Stichprobe müssen auf die Grundgesamtheit<br />
übertragbar sein. Im Gegensatz zur Befragung werden bei der Beobachtung wahrnehmbare<br />
Sachverhalte, Verhaltensweisen und Eigenschaften ausgewählter Personen<br />
planmäßig erfasst. Der Einsatz der Methode setzt voraus, dass sich die Antworten einer<br />
spezifischen Fragestellung tatsächlich beobachten lassen. Dies gilt z. B. im Rahmen der<br />
Werbewirkungsmessung oder der Beobachtung von Konsumentenverhalten.<br />
In der Marktforschungspraxis hat besonders eine Mischform aus Befragung und<br />
Beobachtung – das Experiment – eine zentrale Bedeutung. Experimente dienen der Erkennung<br />
von Ursache-Wirkungs-Beziehungen durch den Einsatz von Manipulationsgrößen.<br />
Unterschieden werden Labor- und Feldexperimente. Laborexperimente<br />
finden unter künstlichen Bedingungen (vereinfachte Nachbildung der Realität) statt,<br />
während Feldexperimente in einer natürlichen Umgebung durchgeführt werden.<br />
Laborexperimente besitzen in der Regel eine höhere interne Validität als Feldexperimente.<br />
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die unabhängige Variable sowie die<br />
Störgrößen unter Laborbedingungen besser kontrolliert werden können als im freien<br />
Feld. Feldexperimente weisen hingegen aufgrund der realeren Bedingungen eine<br />
höhere externe Validität als Laborexperimente auf. Abbildung 3–5 fasst die unterschiedlichen<br />
Methoden zur Datengewinnung abschließend zusammen.<br />
Abbildung 3–5: Typische konventionelle Methoden der Datengewinnung zum Zugang zu<br />
Bedürfnisinformation (“voice of the customer”)<br />
Quality Function Deployment als integrierte Methode der Kundenorientierung<br />
Während die zuvor genannten Methoden auch, aber nicht nur im Innovationsprozess<br />
zum Einsatz kommen, ist Quality Function Deployment (QFD), ein umfassendes<br />
110<br />
Beobachtung<br />
Datengrundlage<br />
Primärdaten Sekundärdaten<br />
Mischform: Experiment<br />
Befragung<br />
qualitativ quantitativ<br />
Feldexperiment Laborexperiment<br />
Interne Daten Externe Daten
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Planungssystem für einen kundenorientierten Innovationsprozess. Ziel der QFD ist<br />
die Ausrichtung sämtlicher Ressourcen eines Unternehmens auf die Bedürfnisse und<br />
Wünsche potenzieller Kunden. Es kommt bei Anwendung der Methode zu einer strikten<br />
Trennung von Kundenbedürfnissen und den technischen Anforderungen an ein<br />
Produkt (Akao 1992; Daetz / Barnard / Norman 1995; Griffin / Hauser 1993; Lai-Kow /<br />
Ming-Lu 2002; ReVelle / Moran / Cox 1998). Der Ansatz unterstellt, dass ein Unternehmen<br />
bereits eine konkrete Innovationsidee (oder gar ein existierendes Produkt, das<br />
zur Weiterentwicklung ansteht) besitzt und potenzielle Kunden in der Lage sind, ihre<br />
Bedürfnisse und Anforderungen an dieses Produkt zu artikulieren. Kasten 3–2 gibt<br />
einen Einblick in das Vorgehen. QFD wird heute in vielen Unternehmen, aber auch oft<br />
in der Literatur zum Innovationsmanagement, als prototypische Methode gesehen,<br />
um eine hohe Kundenorientierung als übergeordneten Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement<br />
zu verwirklichen (Wildemann 1999).<br />
Kasten 3–2: Quality Function Deployment (QFD) als umfassende Methode eines kundenorientierten<br />
Innovationsprozesse<br />
Quality Function Deployment (QFD) ist ein umfassendes Planungssystem für einen kundenorientierten<br />
Innovationsprozess. Ziel des Verfahrens ist die Konzeption, Erstellung und der Verkauf von<br />
Produkten und Dienstleistungen, die der Kunde wirklich wünscht. Die Methode des QFD als<br />
Grundkonzept zur Qualitätsplanung geht zurück auf den Japaner Yoji Akao im Jahre 1966. Die<br />
erste praktische Anwendung ist 1972 auf der Kobe-Schiffswerft der Mitsubishi Heavy Industries<br />
datiert. Der Name des Quality Function Deployment entstammt dem Japanischen. Ausgehend vom<br />
Original-Begriff Hin Shitsu (Merkmale, Attribute, Features) Ki No (Funktion) Ten Kai (Darstellung,<br />
Aufstellung, Entwicklung) ist eine Übersetzung als “Merkmal-Funktions-Darstellung” treffend.<br />
Durch einen Übersetzungsfehler ins Englische entstand der heute gebräuchliche Begriff QFD<br />
(Übersetzung von Hin Shitsu in ‘quality’ (Qualität) statt in ‘qualities’ (Merkmale) [Quelle:<br />
Wikipedia.org].<br />
Der erste Schritt der QFD-Methodik ist in der Regel die Durchführung einer Conjoint-Analyse, um<br />
die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zu erheben. Diese quantitative Methode der<br />
Marktforschung beruht meist auf einer Befragung und unterstellt, dass sich der Gesamtnutzen<br />
eines Produktes aus Sicht des Nachfragers additiv aus den Nutzen der Komponenten (Teilnutzenwerte)<br />
zusammensetzt. Die Datenbasis bilden so die Gesamtnutzenurteile (Präferenzurteile)<br />
befragter Personen. Die Teilnutzenwerte beziehen sich in der Conjoint-Analyse auf einzelne<br />
Ausprägungen von Produkteigenschaften (z. B. Preis, Marke, Produktattribute, technische<br />
Funktionen). Diese Eigenschaften sollten unabhängig sein und zueinander in kompensatorischer<br />
Beziehung stehen. Es gilt zu beachten, dass nur solche Merkmalsausprägungen Eingang in die<br />
Untersuchung finden, welche das Unternehmen tatsächlich operativ steuern kann. Die Conjoint-<br />
Analyse konfrontiert potenzielle Kunden nun mit einem solchen Set an Merkmalsausprägungen.<br />
Bei der Profilmethode besteht ein Stimulus aus der Kombination je einer Ausprägung aller<br />
Eigenschaften. Bei der trade-off-Methode werden stets zwei Eigenschaften gegeneinander abgewogen.<br />
Die Conjoint-Analyse ermittelt im Anschluss den Beitrag unterschiedlicher Merkmalsausprägungen<br />
zum Gesamtnutzen des Produktes (Backhaus et al. 2005; Teichert 2001).<br />
In einem zweiten Schritt erfolgt die Übersetzung der durch die Conjoint-Analyse ermittelten Kundenanforderungen<br />
in die “Sprache des Ingenieurs”. Dabei werden die ermittelten Produktanforderungen<br />
und Eigenschaften zunächst in Konstruktionsmerkmale transformiert und anschließend<br />
in Teilmerkmale übertragen. Dieses Vorgehen unterstellt, dass nicht das physische Produkt,<br />
111<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
sondern ein Eigenschaftsbündel das Nachfrageinteresse beeinflusst. Charakteristisches Merkmal<br />
für diesen “Übersetzungsprozess” ist daher die Beschränkung auf die Erfassung physikalisch-chemisch-technischer<br />
Produkteigenschaften im Rahmen der Identifikation von Kundenwünschen. Aus<br />
Abnehmerperspektive bemisst sich die Qualität des Produktes nach der Qualität einzelner<br />
Produktmerkmale (siehe auch Abschnitt 4.3.1). Die Qualitätsurteile können sowohl auf ergonomischen<br />
(physikalisch-chemisch-technischen) als auch auf hedonistischen, d. h. immateriellen,<br />
nicht-funktionalen Eigenschaften wie sozialen und psychischen Nutzenkomponenten beruhen<br />
(Akao 1992).<br />
Das House of Quality stellt den Kern des Quality Function Deployment dar und kann als Übersetzungsmatrix<br />
zwischen Kunden- und Designanforderungen interpretiert werden. Den<br />
Ausgangspunkt des House of Quality bildet die Erfassung und strukturierte Aufnahme gewichteter<br />
Kundenanforderungen. Diese Kundenanforderungen werden anhand der Prioritäten der Kunden<br />
bei Anschaffung und Nutzung des Produktes gewichtet. In der Matrix werden die Beziehungen im<br />
Block 6.1 entsprechend aufgetragen, so dass frühzeitig Zielkonflikte sichtbar werden (Gustafsson<br />
/ Huber 2000). Die aufgelisteten Anforderungen haben den im Lastenheft hinterlegten<br />
Anforderungen zu entsprechen. Im Block 2 werden die Kundenanforderungen mit Produkten der<br />
Wettbewerber verglichen. Ein Stärken-Schwächen-Profil legt den Zielkorridor für die angestrebte<br />
Produktqualität. Diese horizontale Achse (Marketing-Block) wird nun in die “Sprache des<br />
Ingenieurs” übersetzt. Es erfolgt die Ermittlung technischer Konstruktionsmerkmale, Interpendenzen<br />
und Zielkonflikte. Die in Block 3 aufgeführten technischen Merkmale des Produktes<br />
werden in der Beziehungsmatrix im Block 4 hinsichtlich ihrer Beziehungsstärke zu den gewichteten<br />
Kundenanforderungen aufgetragen um bisher unberücksichtigte Kundenanforderungen zu entdecken.<br />
1. Zusammenstellung<br />
QFD-Team<br />
2. Produktauswahl<br />
3. Kundenbestimmung<br />
4.2 Gewichtung<br />
4.1 Kundenforderung<br />
5.4 Schwierigkeit<br />
5.3 Messbare<br />
Zielwerte<br />
8. Wettbewerbsvergleich<br />
6.2 Techn.<br />
Bedeutung<br />
11. Kritische<br />
Merkmale<br />
5.1 techn.<br />
Merkmale<br />
6.1 Beziehungen<br />
0 = keine<br />
positiv<br />
1 = schwach<br />
2 = mittel<br />
3 = stark<br />
negativ: mit<br />
Betragsstrichen<br />
eigenes und<br />
Konkurrenzprodukte<br />
9. Zielkonflikte<br />
5.2 Optimierungsrichtung<br />
4.3 Servicegewichtung<br />
eigenes und<br />
Konkurrenzprodukte<br />
7.1<br />
Marktbewertung<br />
7.2 Analyse der<br />
Marktbewertung<br />
10. Verkaufsschwerpunkte<br />
Abbildung: Das House of Quality (entnommen aus Akao 1992: 21)<br />
Unter Beachtung wirtschaftlicher Zielkorridore und der technischen Machbarkeit erfolgt so die<br />
Ableitung von Zielvorgaben für einzelne Konstruktionsmerkmale. Diese werden einer erneuten<br />
112
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Überprüfung bzgl. ihres Erfüllungsgrades der Kundenanforderungen unterzogen. Dies umfasst<br />
fallweise auch einen Vergleich mit Konkurrenzprodukten zur Verifizierung der Zielerreichung zur<br />
Schließung von Leistungslücken. Das Ergebnis der finalen Abstimmung der Konstruktionsvorgaben<br />
in Block 5 ist im Regelfall das Pflichtenheft. Im Ergebnis liefert der Einsatz von QFD<br />
Erkenntnisse über die kundenorientierte Gestaltung eines Produkts.<br />
Das “manufacturing-active paradigm”<br />
Von Hippel (1978a, 1978b) bezeichnet dieses Bild vom Innovationsprozess als “manufacturing-active<br />
paradigm”. Innovation ist hier Aufgabe des fokalen Anbieterunternehmens,<br />
das aus eigener Kraft Informationen über Bedürfnisse “repräsentativer”<br />
Nutzer bzw. Kunden sammelt und diese dann intern in eine innovative Lösung<br />
umsetzt (Eliashberg / Lilien / Rao 1997; Griffin 1997; Haman 1996; Lonsdale / Noel /<br />
Stasch 1996; Rangaswamy / Lilien 1997). In dieser Vorstellung haben die Kunden nur<br />
eine passive Rolle, “speaking only when spoken to” (von Hippel 1978b: 243) im<br />
Marktforschungsprozess. Innovation als geschlossener, unternehmensinterner Prozess<br />
manifestiert sich auch heute noch in Schilderungen der glorreichen Leistungen großer,<br />
von der Öffentlichkeit eng abgeschirmter unternehmensinterner Forschungslaboratorien<br />
wie Xerox PARC, Lucent Bell Labs oder dem Garching-Lab von General<br />
Electric.<br />
Kritik an der klassischen Vorstellung von Kundenorientierung im Innovationsprozess<br />
Die zuvor angeführten Methoden einer Kundenorientierung im Innovationsprozess<br />
haben sicherlich zur Verbesserung der Erfolgsrate von Innovationen beigetragen.<br />
Jedoch hat ihre Anwendung auch Risiken. Ausgehend von einer Produktidee nähert<br />
sich das Unternehmen in einem iterativen Prozess zwischen der Bewertung von Ideen,<br />
der Identifikation essentieller Produktattribute für die Konzeptdefinition, der<br />
Gewichtung von Kundenpräferenzen in der Entwurfsphase sowie der Beurteilung von<br />
Prototypen in der Testphase dem finalen Produkt an. Ein Innovationsprozess, der viele<br />
Iterationen durchläuft, nimmt viel Zeit und hohe Kosten in Anspruch, ohne dass am<br />
Ende notwendigerweise ein neues marktfähiges Produkt steht.<br />
Denn auch wenn sich das Innovationsmanagement aus einer Außensicht an den<br />
Präferenzen und Zufriedenheitsurteilen eines “durchschnittlichen” Kundensegments<br />
orientiert, wird die Heterogenität der Kundenwünsche durch ein Standardproduktdesign<br />
nicht berücksichtigt, d. h. die entwickelte Lösung trifft gegebenenfalls die<br />
Bedürfnisse bestimmter Marktsegmente nicht (<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004). Zudem setzt eine<br />
klassische Marktforschung an den Kundenerwartungen und Zufriedenheitsurteilen zu<br />
Beginn des Kaufprozesses oder gar erst nach einer Nutzungsphase an. Die<br />
Informationsgenerierung für die frühen Phasen des Innovationsprozesses fehlt allzu<br />
oft. Im Fall wirklich innovativer Bedürfnisse, Ideen und Konzepte scheitern die<br />
Methoden der herkömmlichen Marktforschung auch bei ausgeklügelten “voice of the<br />
customer”-Methoden regelmäßig (Christensen 2000).<br />
113<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
3.2.2 Innovationsprozesse in interorganisationalen<br />
Netzwerken<br />
Bevor wir im kommenden Abschnitt eine neue Sichtweise des Innovationsprozesses<br />
betrachten, die Kunden nicht nur als Informationsquelle für Marktforschungsanstrengungen,<br />
sondern als aktive Partner oder gar Initiatoren eines Innovationsprozesses<br />
sieht, wollen wir in einem ersten Schritt eine weitere Vorstellung des klassischen<br />
Unternehmensprozesses auf die Probe stellen: Lösungen für innovative Aufgaben und<br />
Probleme entstammen zum Großteil unternehmensinternen Abteilungen. So galt eine<br />
starke interne Forschung- und Entwicklungsabteilung über Jahrzehnte als Garant für<br />
den Unternehmenserfolg – und gilt heute in Zeiten von Outsourcing und der<br />
Verschlankung der Unternehmen oft als wesentliche verbleibende Kerntätigkeit. Ideen<br />
der internen Forschung und Entwicklung sichern langfristiges Wachstum und stellten<br />
eine nicht zu vernachlässigende Markteintrittsbarriere für potenzielle Konkurrenten<br />
dar. Doch diese Innenorientierung des Innovationsprozesses wird schon lange durch<br />
eine erweitere Sichtweise ergänzt. Die Auflösung der Unternehmensgrenzen, die wir<br />
in Abschnitt 2.3 bereits diskutiert haben, macht auch vor der Entwicklung neuer<br />
Produkte und Prozesse nicht halt. Kasten 3–3 zeigt hierzu als einführendes Beispiel,<br />
wie ein großer Konsumgüterhersteller, Procter & Gamble (P&G), systematisch externe<br />
Partner in seine Innovationsprozesse einbezieht.<br />
Kasten 3–3: Procter & Gamble’s Strategy to Harness Outside Talent to Boost Innovation<br />
(Quelle: Auszug aus dem Artikel “Innovation inside out” von Gary H. Anthes in Computerworld,<br />
September 13, 2004 [www.computerworld.com/printthis/2004/0,4814,95854,00.html])<br />
(…) Aided by the internet and advanced search techniques, a handful of companies is leading a<br />
revolution in the way new products are designed and developed. By looking beyond their own R&D<br />
labs — to suppliers, universities, freelance inventors and even competitors — they are accelerating<br />
the pace of innovation while sidestepping the costs and risks of in-house research. “The R&D model<br />
that most companies are following is broken,” says Larry Huston, vice president for research and<br />
development at Procter & Gamble (P&G) in Cincinnati. “There’s a drive to increase innovation budgets<br />
beyond the [revenue] growth of the firm. That’s not a sustainable business model.” (…)<br />
But P&G, which spent $1.7 billion on R&D last year, has found a new model, called open-market<br />
innovation. Indeed, the consumer products maker has embraced the idea so enthusiastically that<br />
it no longer refers to its product-innovation process as R&D; it’s now C&D, for “connect and develop.”<br />
Larry Huston, vice president for research and development at Procter & Gamble, makes the<br />
case for out-of-the-box innovation:<br />
P&G has 7,500 researchers in 150 branches of science. Outside of P&G, there are 1.5 million<br />
equally qualified scientists around the world. “So, for every person we have, there are 200 on<br />
the outside,” Huston says.<br />
R&D staff at U.S. companies cost their employers well over $100,000 a year on average.<br />
“Somebody in India with a master’s degree in a science probably starts at about $3,000 a<br />
year,” Huston says.<br />
P&G is a $51 billion company growing at 6 % to 7 % a year. It wants half of all its product innovations<br />
to come from external sources. “You can do the math,” he says. “If 50 % is coming from<br />
114
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
outside, this is over a $1 billion challenge to bring sales in from the outside through connect<br />
and develop.”<br />
P&G makes the connections among its employees and external sources with a variety of tools and<br />
techniques, including an intranet, Web sites, commercial and homegrown search engines as well<br />
as several “innovation networks” — intermediary companies that match innovation seekers and<br />
suppliers. In just two years, the company has boosted the percentage of product innovations that<br />
come from outside sources from less than 20 % to 35 %. P&G’s CEO wants to raise that to 50 %.<br />
“This is a classic application of the Internet, going back to its origins,” says Darren Carroll, CEO of<br />
InnoCentive Inc., one of the innovation matchmakers. “For those of us on Arpanet in the beginning,<br />
it was all about scientists and engineers sharing problems and solutions.” The following are some<br />
of the resources P&G uses to connect and develop:<br />
InnovationNet. InnovationNet is an intranet Web portal for 18,000 P&G innovators in R&D,<br />
engineering, market research, purchasing and patents. Nabil Sakkab, a senior vice president<br />
for R&D, calls it a “global lunchroom” for the exchange of ideas.<br />
InnoCentive. Founded by Eli Lilly and Co. but operating independently, Andover, Mass.-based<br />
InnoCentive claims to be the “largest virtual laboratory in the world.” It posts scientific problems<br />
from its 30 “seeker” members to a proprietary network of 70,000 registered “solvers” around<br />
the world. Each posting includes a promised cash award for the solution. “The success rate so<br />
far has been around 50 %,” Sakkab says. “Not bad for problems we failed to crack in-house.”<br />
NineSigma Inc. This Cleveland-based firm helps its 50 or so clients prepare technical briefs<br />
describing projects or problems they are trying to solve and then sends the briefs — without<br />
identifying the originating companies — to thousands of researchers around the world. The<br />
idea is not to get back specific solutions, as InnoCentive does, but to identify people most likely<br />
to be able to provide solutions on a contract basis.<br />
YourEncore Inc. An Indianapolis-based network of about 400 retired scientists and engineers,<br />
YourEncore was created 10 months ago by P&G and Lilly but now operates independently. It<br />
matches its members with clients for specific, short-term job assignments and pays them their<br />
salaries at retirement plus 20 %.<br />
(…) Cutting-edge search technologies are essential to the connect-and-develop approach.<br />
NineSigma creates a unique database of potential respondents for every client request. “The databases<br />
are generated through a variety of searching techniques, some of which are proprietary,”<br />
says Shauna Brummet, vice president for operations at NineSigma. “It goes significantly beyond<br />
Google, and the techniques are evolving.” For each problem, NineSigma sends out 6,000 bid<br />
requests on average and receives 10 to 100 responses. Getting high-quality responses is a key to<br />
success, says Richard Swarz, chairman of NineSigma, and that requires sophisticated search<br />
algorithms to build just the right mailing list, as well as carefully crafted requests for proposals. (…)<br />
P&G is seeking to identify what it calls “superconnected giants” in the networks. “They are connected<br />
through patent literature, they are publishing a lot, they speak at conferences, maybe they are<br />
at the center of a hub as department head at a major research hospital,” Huston says. The average<br />
researcher knows 2,000 people; the superconnected ones that P&G covets know 10,000 people,<br />
he says.<br />
While companies like P&G are beginning to tap into open-market innovation, the various methods<br />
of doing so are not yet well integrated, says Navi Radjou, an analyst at Forrester Research Inc.<br />
“The laboratory management systems and discovery tools that scientists use must provide seamless<br />
integration with things like InnoCentive,” he says. “I think you’ll see that happen in the next<br />
two or three years.” But Lilly isn’t waiting for software vendors to step up to the challenge. It recently<br />
launched a project to automate the internal processes surrounding the use of InnoCentive and<br />
is also developing interfaces to InnoCentive’s own workflow. “We are doing the IT design for an<br />
115<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
internal portal to these [third-party] systems so that it becomes part of the scientist’s natural workflow,”<br />
Bingham says. For example, a Lilly scientist today seeking help with a problem would first<br />
have to know InnoCentive exists and then find someone at Lilly to explain how it works, fill out<br />
approval forms and disclosure forms, contact the relevant person at InnoCentive and so on, says<br />
Bingham. With new workflow automation and interfaces to InnoCentive, that scientist will be able<br />
to accomplish the same things with a few mouse clicks. And once the problem definition has been<br />
posted by InnoCentive, the Lilly scientist will be able to track its progress online.<br />
Carroll says open-market innovation will dramatically expand in scope over the next five years.<br />
“You will see it expand into statistical analysis of business problems, graphics design, advertising<br />
and other services industries where this model may apply even more strongly,” he says. Asked<br />
about the future of open-market innovation at P&G, Huston says, “The current business model that<br />
people are following is not sustainable, and more and more companies will move this way. It’s<br />
going to become even more important as we face a scientific talent shortage in the U.S. “This is<br />
the future,” he says. “People just don’t realize it yet.”<br />
Innovationsnetzwerke: Verteilte Problemlösungsprozesse<br />
Das Beispiel von Procter & Gamble (Kasten 3–3) ist ein weit reichendes, aber in einigen<br />
Unternehmen heute nicht mehr außergewöhnliches Beispiel für eine Öffnung des<br />
Innovationsprozesses für externen Input. Wie wir in Abschnitt 2.3 gesehen haben, hat<br />
in der Organisationstheorie der heutige Fokus auf Netzwerke mit Lieferanten, mit<br />
dem Handel und teilweise sogar mit Konkurrenten bis hin zur Vision des virtuellen<br />
Unternehmens die Sicht einer rein internen, geschlossenen Wertschöpfung schon lange<br />
revidiert (Picot / <strong>Reichwald</strong> 1994; Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). Ebenso kann der<br />
Innovationsprozess als interaktive Beziehung zwischen einem fokalen Herstellerunternehmen<br />
(klassisch: der “Innovator”) und seinen Zulieferern, Kunden und anderen<br />
Institutionen gesehen werden (Laursen / Salter 2004). Das frühe Bild des “einsamen”<br />
innovativen Unternehmers nach Schumpeter (1942) weicht so einer deutlich vielschichtigeren<br />
Sichtweise des Innovationsprozesses als Netzwerk verschiedenster Akteure<br />
(Brown / Eisenhardt 1995; Freeman / Soete 1997; Laursen / Salter 2004; <strong>Piller</strong> 2003, 2004;<br />
Rosenberg 1982; Szulanski 2003; von Hippel 1988). Der Erfolg einer Innovation basiert<br />
folglich zu einem großen Anteil auf der Fähigkeit des Unternehmens, entlang aller<br />
Phasen des Innovationsprozesses Netzwerke mit externen Akteuren einzugehen<br />
(Hirsch-Kreinsen 2004).<br />
Der Innovationsprozess entspricht in seinem Kern einem Problemlösungsprozess.<br />
Problemlösung hat zwei wesentliche Eigenschaften: “Trial-and-Error” und die<br />
Rekombination vorhandenen Wissens in einem neuen Kontext (Allen 1966; Baron<br />
1988; von Hippel / Tyre 1995; von Hippel 2005). Ein Unternehmen, das diese Schritte<br />
nur rein intern vollzieht, ist zum einen auf die Wissensbasis angewiesen, die innerhalb<br />
der Unternehmensgrenzen vorhanden ist. Zum anderen muss es alle Versuchs- und<br />
Evaluierungsschritte ebenfalls selbst vollziehen. Werden dagegen externe Akteure in<br />
den Problemlösungsprozess einbezogen, kann dieser oft schneller, kostengünstiger<br />
und/oder auf einem höheren Niveau vollzogen werden. Oft wurden bestimmt Probleme<br />
bereits in einer anderen Domäne gelöst, die Lösung ist aber im Anwendungsbereich<br />
des suchenden Unternehmens nicht bekannt. Die Tendenz von Akteuren,<br />
116
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
zunächst (und oft nur) in einem lokalen (geographisch und disziplinären bzw. funktionalen)<br />
Umfeld nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, ist in der Managementliteratur<br />
seit langem beschrieben. Konzepte wie das Phänomen der beschränkten<br />
Rationalität (March / Simon 1958), das Agieren in Routinen (Nelson / Winter 1982) oder<br />
die so genannte Kompetenzfalle (Levitt / March 1988) sind Folge der Verwendung rein<br />
lokal verfügbarer Information. Wir haben diesen Sachverhalt bereits in Abschnitt<br />
2.4.3.3 bei der Betrachtung von “sticky” Information gesehen.<br />
Ein Innovationsnetzwerk revidiert die Vorstellung einer rein internen Wertschöpfung und setzt<br />
auf eine interaktive Beziehung zwischen einem fokalen Herstellerunternehmen (klassisch: der<br />
“Innovator”) und seinen Zulieferern, Kunden und anderen Institutionen. Der Erfolg einer<br />
Innovation basiert hier zu einem großen Anteil auf der Fähigkeit des fokalen Unternehmens,<br />
entlang aller Phasen des Innovationsprozesses verteilte (distribuierte) Problemlösungsprozesse<br />
mit externen Akteuren einzugehen. Ziel dieser verteilten Problemlösungsprozesse ist<br />
die Rekombination vorhandenen (lokalen) Wissens aus verschiedenen Domänen zu neuem<br />
Wissen.<br />
Ein klassischer und bereits recht breit beschriebener Fall des Einbezugs externer<br />
Akteure in den Innovationsprozess sind Entwicklungskooperationen eines industriellen<br />
Herstellers mit seinen Lieferanten (siehe z. B. Hirsch-Kreinsen 2004; Ragatz /<br />
Handfield / Scannell 1997; Spina / Verganti / Zotteri 2002; Wagner 2003; Wildemann<br />
2004; Wynstra / van Weele / Weggemann 2001). Das Fallbeispiel von Procter &<br />
Gamble in Kasten 3–3 verdeutlicht diese Sichtweise eindrucksvoll und zeigt, dass<br />
selbst eines der größten Unternehmen der Welt, das zudem für seine Marktforschungskompetenz,<br />
aber auch starke eigene Forschung & Entwicklung bekannt ist,<br />
die Vernetzung mit weiteren externen Partnern und den Zugang zu externem Wissen<br />
als zentralen Bestandteil seiner Innovationsstrategie sieht. Procter & Gamble ist aber<br />
noch weiter gegangen und hat nicht nur seine direkte Lieferanten, sondern beliebige<br />
andere Akteure in den Innovationsprozess miteinbezogen. Die in Kasten 3–1 und<br />
Kasten 3–3 genannte Firma Innocentive ist ein herausragendes Beispiel für eine neue<br />
Art von Intermediär, die unternehmerische F&E-Abteilungen den Zugang zu einer<br />
großen Wissensbasis eröffnet (die Website des Unternehmens gibt einen sehr guten<br />
Einblick in dieses Wertschöpfungsmodell).<br />
Chesbroughs Konzept von Open Innovation<br />
Ein aktueller Kritiker der Innenperspektive des Innovationsprozesses ist Henry<br />
Chesbrough (2003a). Das Innovationsmodell einer ausschließlichen Innenorientierung<br />
in der Phase der Ideengenerierung und Konzeptentwicklung bezeichnet er als<br />
geschlossenes Innovationsmodell (“closed innovation model”). Chesbrough argumentiert,<br />
dass eine reine Kommerzialisierung interner Ideen nicht mehr ausreicht, um<br />
langfristig die Stellung des Innovationsführers zu erhalten. Dies liegt im Speziellen an<br />
einer zunehmenden Mobilität innovationsrelevanten Wissens, einem mangelnden<br />
Schutz geistigen Eigentums sowie vereinfachter Möglichkeiten der Gründung innovativer<br />
Jungunternehmen durch Bereitstellung von Wagniskapital. Chesbrough unter-<br />
117<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
streicht seine Argumentation durch exemplarische Fallstudien (Chesbrough 2003b). So<br />
beleuchtet er beispielsweise den Wettbewerb zwischen Lucent Technologies und Cisco<br />
in den neunziger Jahren. Lucent Technologies ging aus der Aufspaltung des amerikanischen<br />
Telekommunikationsunternehmens AT&T und einer Umfirmierung der Bell<br />
Laboratories hervor. Sowohl das Kerngeschäft von Lucent Technologies als auch Cisco<br />
Systems konzentriert sich auf Technologien für Mobilfunknetze, optische Netze,<br />
Sprach- und Datennetze der nächsten Generation sowie Software für den Netzbetrieb.<br />
Über viele Jahre galten die Bell Laboratories von Lucent Technology als eine der weltweit<br />
renommiertesten Forschungs- und Entwicklungsinstitute der Industriegüterforschung.<br />
So geht beispielsweise die Entwicklung des Telefons, der erste Laser oder<br />
der erste DNA-Motor auf die Forscher der Bell Laboratories zurück. Im Vergleich zu<br />
Lucent Technologies verfügt Cisco Systems über ein weit geringeres internes Innovationspotenzial.<br />
Dennoch konnte sich Cisco System im direkten Wettbewerb zu<br />
Lucent Technologies behaupten. Während Lucent Technologies mit seiner internen<br />
Forschung- und Entwicklung nach fundamentalen Erfindungen strebt, nutzt Cisco<br />
Entwicklungsexpertise außerhalb des Unternehmens, z. B. durch Investments in Startups,<br />
die ironischerweise häufig von ehemaligen Lucent-Entwicklern gegründet wurden.<br />
Mit dieser Strategie gelingt es Cisco mit Lucent Technologies Schritt zu halten –<br />
ohne große Investitionen in interne Forschung- und Entwicklung.<br />
In Ciscos Modell der offenen Innovation kommerzialisieren Unternehmen sowohl<br />
intern generierte Ideen als auch Innovationen, die außerhalb des eigenen Unternehmens<br />
entstehen. Dieses Modell bezeichnet Chesbrough (2003a) als “Open Innovation”.<br />
Beispiele hierfür sind Lizenzierungen, Entwicklungskooperationen, Wagniskapitalbeteiligungen<br />
oder Spin-Offs (siehe auch Abbildung 3–6). (Hinweis: Wir verwenden<br />
im Folgenden den Begriff ‘Open Innovation’ in einer fokussierten Sichtweise<br />
in Hinblick auf Innovationsprozesse, die ein Unternehmen zusammen mit seinen<br />
Kunden bzw. Nutzern vollzieht). Diese Strategie kann, wie bereits angesprochen, aus<br />
mehreren Gründen erfolgreich sein:<br />
Der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung fehlt häufig der “Blick über<br />
den Tellerrand”, z. B. hinsichtlich relevanter Entwicklungen in anderen<br />
Industrien. Dieser Effekt wird durch das “not-invented-here”-Syndrom noch verstärkt.<br />
Das Syndrom bezeichnet die Ablehnung von Innovationen, die nicht der<br />
unternehmensinternen Forschung- und Entwicklung entsprungen sind, sondern<br />
z. B. unabhängigen Forschungseinrichtungen oder Zulieferern (siehe Abschnitt<br />
2.4.6).<br />
Oftmals werden (intern und extern generierte) Innovationsideen eines Unternehmens<br />
in der Phase der Ideenbewertung mit der Begründung verworfen, die Idee decke sich<br />
nicht mit den Kernkompetenzen und technischen Fähigkeiten des Unternehmens.<br />
Später haben Start-ups die Idee aufgegriffen, erfolgreich kommerzialisiert und ihr<br />
Erfahrungskurvenvorsprung ist nur noch schwer einzuholen. In diesem Fall wäre es<br />
für das Unternehmen vorteilhaft gewesen, im Rahmen von Open Innovation nach<br />
Partnern Ausschau zu halten, welche über die nötigen komplementären<br />
Kompetenzen verfügen. Die Innenorientierung verhindert, dass ex-post erfolgreiche<br />
Innovationsideen falsch eingeschätzt werden.<br />
118
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Die zunehmende Wissensmobilität erschwert den absoluten Schutz geistigen<br />
Eigentums. Gleichzeitig verzeichnet der Markt für Venture Capital kontinuierliche<br />
Wachstumsraten. Für Unternehmen entsteht so die strategische Option, durch<br />
Kapitalbeteiligungen an externen Forschungseinrichtungen und Start-ups relativ<br />
flexibel und kurzfristig an deren Innovationspotenzial und innovativen Organisationsstrukturen<br />
zu partizipieren.<br />
Abbildung 3–6: Closed versus Open Innovation nach Chesbrough (in Anlehnung an<br />
Chesbrough 2003a)<br />
Ideen<br />
Closed Innovation Modell Open Innovation Modell<br />
Unternehmensgrenze<br />
Unternehmensgrenze<br />
Markt<br />
Unternehmen entwickeln und kommerzialisieren ausschließlich<br />
Ideen, die unternehmensinternen Bereichen, insbesondere der<br />
Forschung und Entwicklung, entstammen.<br />
Ideen<br />
Vorteile und Grenze von Innovationsnetzwerken<br />
Unternehmensgrenze<br />
Unternehmensgrenze<br />
neuer<br />
Markt<br />
Markt<br />
Unternehmen kommerzialisieren neben unternehmensintern<br />
entwickelten Innovationen auch fremde Innovationen und gehen<br />
Innovationskooperationen mit Start-ups und unabhängigen<br />
Forschungseinrichtungen ein.<br />
Der Hebeleffekt von Kooperationen im Innovationsprozess beruht auf der<br />
Erweiterung der Spannbreite der Ideen- und Lösungsfindung. Ziel ist nicht nur, durch<br />
den Einbezug externer Akteure den Zugang zu Bedürfnisinformation zu verbessern,<br />
sondern auch einen erweiterten Zugang zu Lösungsinformation zu erhalten. “Closed”-<br />
Innovationsprozesse sind auf den kreativen Input und das Wissen einer relativ kleinen<br />
Gruppe von Ingenieuren, Produktmanagern und anderen Mitgliedern des<br />
Produktentwicklungsteams beschränkt. Wird nun diese Gruppe um externe Akteure<br />
erweitert, können Ideen, Kreativität, Wissen und Lösungsinformation einer deutlich<br />
größeren Gruppe von Individuen und Organisation in den Innovationsprozess einfließen<br />
− und damit Inputfaktoren erschlossen werden, die zuvor nicht für den<br />
Innovationsprozess zur Verfügung standen (siehe noch mal die Beispiele in Kasten 3–1<br />
und Kasten 3–3). Alle bislang angesprochenen Kooperationen und Netzwerke im<br />
Innovationsprozess beruhen dabei auf klassischen hybriden Koordinationsformen (z.<br />
B. Entwicklungskooperation mit Lieferanten) bzw. dem Einkauf der Leistung am<br />
Markt (z. B. Innocentive). In diesen Fällen beherrscht ein fokales Unternehmen den<br />
Innovationsprozess und initiiert Beiträge externer Akteure, die dafür in der Regel<br />
einen monetären Ausgleich bekommen.<br />
119<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Diese Art von interorganisationalen Netzwerken bleibt aber weiterhin in der<br />
Vorstellung des “manufacturing-active paradigms”: Der Hersteller ermittelt durch<br />
den Einsatz klassischer Marktforschungsinstrumente potenzielle Kundenbedürfnisse,<br />
transferiert diese Bedürfnisinformationen der Kunden durch eigene Anstrengungen<br />
oder formale Kooperationen mit Partner in Lösungsideen und testet deren Akzeptanz<br />
und Potenzial iterativ in den nachfolgenden Innovationsphasen bis zur finalen<br />
Markteinführung der Leistung. Der Abnehmer wird als repräsentative statistische<br />
Durchschnittsgröße interpretiert. Ihm fällt die Aufgabe zu, Innovationsideen des<br />
Herstellers mit eigenen Bedürfnissen abzugleichen und seine individuelle<br />
Nutzenfunktion zu artikulieren. Bedürfnisse des Kunden werden als latent<br />
(Bedürfnisinformationen) angesehen. Sie enthalten keine Anhaltspunkte, wie dieses<br />
latente Bedürfnis in eine Lösung überführt werden kann (Lösungsinformation). Über<br />
Lösungskompetenz verfügt ausschließlich der Hersteller bzw. sein formales Netzwerk<br />
an Partnern. Die Organisationsaufgabe (Koordination und Motivation) schließlich<br />
wird in diesem Innovationsnetwerk klassisch durch hierarchische oder marktliche<br />
Koordinationsmechanismen gelöst.<br />
3.2.3 Kunden als Quelle von Innovationen: Vom<br />
Manufacturer-Active zum Customer-Active Paradigm<br />
Eine Vielzahl an empirischen Belegen weist jedoch darauf hin, dass die Vorstellung des<br />
manufacturer-active paradigms unvollständig ist und der Gedanke von<br />
Innovationsnetzwerken um einen weiteren zentralen Akteur erweitert werden muss:<br />
die Kunden bzw. Nutzer einer Leistung. Denn neben Lieferanten, Wettbewerbern und<br />
externen Forschungseinrichtungen können auch die aktiven oder potenziellen Nutzer<br />
wichtige Quellen externen Wissens für den Innovationsprozess sein. Der Beitrag von<br />
Nutzern für den Innovationsprozess wurde vor allem durch den Innovationsforscher<br />
Eric von Hippel im Rahmen des so genannten “customer-active paradigm” postuliert<br />
(von Hippel 1978a, 1978b, siehe von Hippel 2005 für eine Zusammenfassung der<br />
Forschungsarbeiten in diesem Gebiet).<br />
Anteile von Innovationen aus der Kundendomäne<br />
Von Hippel analysierte für eine Vielzahl von Innovationsprojekten (in der<br />
Industriegüterbranche), durch welche Partei (Hersteller, Kunde, Lieferant) die konkrete<br />
Entwicklung angestoßen und in den ersten Schritten durchgeführt wurde. Dabei<br />
kommt er zu dem Ergebnis, dass viele Innovationsaktivitäten nicht ausschließlich<br />
durch den Hersteller dominiert werden. Vielmehr entfällt ein signifikanter Anteil des<br />
Innovationspotenzials auf deren Kunden. Je nach Branche können zwischen knapp 20<br />
und 80 Prozent aller Neuproduktentwicklungen auf eine Idee (und oft auch ersten<br />
Prototyp) der Nutzer zurückverfolgt werden. Von Hippel (1998) und Shah (2000) nennen<br />
folgende Beispiele:<br />
Traktorschaufeln: 6% der Innovationen wurden von den Nutzern entwickelt.<br />
Plastikadditive: 8%<br />
120
Kabelverarbeitungsgeräte: 11%<br />
Industriegasverarbeitung: 42%<br />
Sportgeräte (z. B. Surfboards): 58%<br />
Wissenschaftliche Messgeräte: 77%<br />
Pultrusionsprozess: 90%<br />
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Abbildung 3–7: Ausgewählte Studien zum Anteil innovativer Nutzer an allen Nutzern der<br />
Produkte einer Branche (verändert entnommen aus von Hippel 2005)<br />
Beispiel Stichprobe Anteil an<br />
innovativen<br />
Nutzer<br />
Industrieprodukte<br />
CAD Software für<br />
integr. Schaltkreise<br />
Quelle<br />
136 Angehörige von Nutzerfirmen 24.3% Urban / von<br />
Hippel 1988<br />
Industrieinstallationen Angestellte in 74 Firmen, die<br />
Rohrinstallationen durchführen<br />
Bibl. Info-Systeme Bibliothekare in 102 australischen<br />
Bibliotheken, die OPAC Systeme nutzen<br />
36% Herstatt / von<br />
Hippel 1992<br />
26% Morrison et<br />
al. 2000<br />
Medizintechnik 261 Chirurgen in dt. Universitätskliniken 22% Lüthje 2003a<br />
Sicherheitsfeatures für<br />
Apache Web-Server<br />
Software<br />
Konsumgüter<br />
131 technische versierte Nutzer<br />
(Webmasters)<br />
Outdoor Produkte 153 Empfänger eines Mail-Order-<br />
Katalogs für Trecking-Produkte<br />
"Extrem"<br />
Sportequipment<br />
197 Mitglieder aus 4 Sportclubs in<br />
neuen Sportarten<br />
19.1% <strong>Frank</strong>e / von<br />
Hippel 2003<br />
9.8% Lüthje 2004<br />
37.8% <strong>Frank</strong>e /<br />
Shah 2003<br />
Mountain Biking 291 Mountain Biker in einer Region 19.2% Lüthje et al.<br />
2005<br />
Dabei sind es in der Regel zudem nicht nur wenige “Serieninnovatoren”, die den Großteil<br />
der genannten Kundeninnovationen initiiert haben, sondern die Innovationstätigkeit<br />
verteilt sich auf viele verschiedene Nutzer innerhalb einer Branche. Die Tabelle<br />
in Abbildung 3–7 fasst hierzu die Ergebnisse weiterer Studien zusammen, die alle<br />
Nutzer eines Produktes gefragt haben, ob sie schon einmal eine innovative Idee umge-<br />
121<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
setzt oder ein bestehendes Produkt weiterentwickelt (für den Eigengebrauch) haben.<br />
Wie die Tabelle zeigt, sind erstaunlich viele Nutzer innovativ tätig. Selbst im klassischen<br />
Konsumgüterbereich, in dem z. B. von Lüthje (2004) die Empfänger eines<br />
Versandkatalogs von Outdoor-Bekleidung befragt wurden, sind fast zehn Prozent aller<br />
Kunden innovativ tätig! Der Beitrag der Kunden bzw. Nutzer bewegt sich dabei innerhalb<br />
eines Kontinuums von einer Bedarfserkennung über die Entwicklung erster konzeptioneller<br />
technischer Lösungen zur Befriedigung dieses Bedarfs bis hin zum Design<br />
und der Fertigung von Prototypen. Dem Hersteller kommt nun lediglich die Aufgabe<br />
zu, den Kundeninput zu entdecken und zu prüfen und in ein Massenmarkt-kompatibles<br />
Produkt zu überführen (von Hippel 1994).<br />
Kundeninnovation als Folge ungestillter Bedürfnisse<br />
Betrachtet man die Ergebnisse der in Abbildung 3–7 zusammengefassten empirischen<br />
Studien, zeichnet sich ein anderer Weg zu erfolgreicher Innovation ab, als es dem klassischen<br />
Vorgehen einer kundenorientierten Produktentwicklung auf Basis von<br />
Marktforschung und “voice-of-the-customer”-Methoden entspricht: Anstatt die<br />
Kunden zu befragen, was denn ihre offenen Wünschen und Bedürfnissen seien und<br />
diese Information dann in neue Produkte und Leistungen umzusetzen, ist eine andere<br />
Methode, bei den Kunden und potenziellen Nutzern direkt nach neuen Lösungen zu<br />
suchen. Kunden scheinen nach diesen Studien nicht nur als Subjekte von Befragungen<br />
beizutragen, sondern eine weitaus aktivere Rolle zu haben: Wenn sie ein neues<br />
Bedürfnis haben, dass durch das aktuelle Angebot am Markt nicht oder nur unzureichend<br />
befriedigt werden kann, werden sie selbst aktiv und entwickeln eine eigene<br />
Lösung. Hierdurch ergibt sich eine wichtige Unterscheidung (von Hippel 2005):<br />
Kunden- bzw. Nutzerinnovatoren profitieren von einer Entwicklung, indem sie<br />
diese selbst nutzen, sei es im Rahmen des privaten Konsums oder zur Erstellung<br />
anderer Produkte oder Leistungen. Die Motivation zur Innovation ist in der Regel<br />
ein ungestilltes eigenes Bedürfnis des Nutzerinnovators in Bezug auf die Nutzung<br />
des zugrunde liegenden Produkts, das durch die Eigenentwicklung befriedigt werden<br />
soll.<br />
Herstellerinnovatoren profitieren im Gegensatz dazu vom Verkauf der Innovation<br />
am Markt, sei es in Form neuer Produkte oder Lizenzen zur Nutzung der Technologie.<br />
Die Motivation zur Innovation ist die Wahrnehmung eines offenen (bzw.<br />
neuen) Bedürfnisses am Zielmarkt der Leistung.<br />
Von Hippel (2005) plädiert deshalb für die Verwendung des Begriffs Nutzer anstatt<br />
von Kunden, da Nutzer und Käufer eines Produktes häufig zwei verschiedene Akteure<br />
sind. Wir werden jedoch im Folgenden beide Begriffe weiterhin synonym betrachten.<br />
Das customer-active paradigm (CAP) sieht demnach den Kunden bzw. Nutzer als<br />
Quelle und Initiator des Innovationsprozesses. Nutzer schaffen bzw. entdecken demnach<br />
ein neues Bedürfnis, sie entwickeln eine Idee, wie dieses Bedürfnis befriedigt werden<br />
könnte und übersetzen diese Idee dann in vielen Fällen in einen funktionsfähigen<br />
Prototypen, den sie oft in weiteren Stufen noch verfeinern und verbessern. Wenn der<br />
Prototyp ihr Bedürfnis befriedigt, ist für die meisten Kunden der Innovationsprozess<br />
beendet. In anderen Fällen treten sie jedoch oft an einen Hersteller heran und übertra-<br />
122
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
gen ihm die Lösung mit der Hoffnung, dass der Hersteller sie in ein funktional besseres<br />
Produkt überführt, da er Zugang zu besseren Fertigungsverfahren oder Materialien<br />
hat. In anderen Fällen “entdeckt” ein Hersteller die Verbesserung, Weiterentwicklung<br />
oder gar Neuentwicklung seiner Produkte bei seinen Kunden und überführt sie aus<br />
eigener Initiative in ein marktfähiges Produkt, das dann einem größeren Markt angeboten<br />
wird. In allen Fällen jedoch sind es die Kunden bzw. Nutzer, die als die eigentlichen<br />
“Innovatoren” bezeichnet werden können (Abbildung 3–8).<br />
Abbildung 3–8: Vom MAP zum CAP (in Anlehnung an von Hippel 1978a: 242)<br />
Manufacturer-Active-Paradigm<br />
Kunden Hersteller<br />
Grundgesamtheit<br />
Stichprobe<br />
Kunden<br />
Kunde 1<br />
Kunde 2<br />
Kunde 3<br />
Kunde 4<br />
Kunde 5<br />
…<br />
Kunde n<br />
Bedürfniserhebung<br />
und Test in<br />
repräsentativer<br />
Stichprobe<br />
• Analyse latenter<br />
Kundenbedürfnisse<br />
durch Kundenbefragungen<br />
• Ideengenerierung<br />
durch den Hersteller<br />
• Test der Akzeptanz<br />
der Ideen durch<br />
weitere<br />
Marktforschung<br />
Customer-Active-Paradigm<br />
Innovation<br />
eines Kunden<br />
Hersteller<br />
Evaluierung der Idee<br />
des Kunden<br />
ggfs.<br />
Kommerzialisierung<br />
für alle Kunden<br />
Das customer-active paradigm (CAP) sieht den Kunden bzw. Nutzer als Quelle und Initiator des<br />
Innovationsprozesses. Im Gegensatz zur konventionellen Vorstellung des Innovationsprozess<br />
(manufacturer-active paradigm), in dem ein Hersteller via Marktforschung (oder Bauchgefühl)<br />
ein Bedürfnis der (potenziellen) Kunden zu erkennen versucht und dieses dann in eine Lösung<br />
überführt, geht das CAP davon aus, dass die Nutzer selbst ein vorhandenes Bedürfnis durch<br />
eigene Aktivitäten lösen. Das heißt, sie entwickeln eine Idee, wie dieses Bedürfnis befriedigt<br />
werden könnte und übersetzen sie dann meist auch in einem funktionsfähigen Prototyp.<br />
123<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Unterschiede zwischen Kunden- und Herstellerinnovationen<br />
In späteren Forschungsarbeiten hat von Hippel die Beiträge der Kunden genauer<br />
erforscht. Wir haben bereits zuvor das Problem der Nutzung lokaler Information für<br />
einen Problemlösungsprozess betrachtet. Genau dieses Phänomen tritt auch bei<br />
Kundeninnovation auf. Kunden haben in der Regel oft implizite, aber sehr genaue<br />
Kenntnis ihrer Bedürfnisse, sind allerdings in Bezug auf ihre Lösungsmöglichkeiten<br />
auf Wissen in ihrer Domäne beschränkt. Deshalb sind Nutzerinnovationen oft technisch<br />
nicht so ausgereift wie Innovationen von Herstellern, die in der Regel deutlich<br />
besseres Verfahren- und Produktionswissen haben (ein gutes Beispiel liefert die in<br />
Kasten 3–4 beschriebene Erfindung von “Tipp-Ex” durch eine Sekretärin aus Dallas).<br />
Dies erklärt auch die empirische Beobachtung, dass Innovationen aus der<br />
Herstellerdomäne oft Verbesserungsinnovationen sind, während Kundeninnovationen<br />
funktional neue Anwendungen sind (Riggs / von Hippel 1994; von Hippel<br />
2005). Dieser beschränkte Fokus auf lokal vorhandenes Bedürfnis- und Lösungsinformation<br />
führt nun zu zwei wesentlichen Situationen:<br />
Innovative Kunden entwickeln eine neue Lösung für ein neues Problem, das die<br />
Hersteller bislang noch nicht betrachtet haben. Sie verwenden dabei aber nur konventionelle<br />
Verfahren, die nicht dem “State-of-the-Art” entsprechen und dann vom<br />
Hersteller in eine bessere Lösung überführt werden. In diesem Fall treten oft die<br />
Kunden an einen Hersteller heran mit der Bitte, eine neue Lösung professionell<br />
herzustellen. Da sie in erster Linie die Innovation nutzen wollen, kommt es zum<br />
Phänomen des “Free Revealings” (siehe Abschnitt 2.4.4)<br />
In einem zweiten Fall aber haben die Kunden neben der Bedürfnisinformation auch<br />
Zugang zu innovativer Lösungsinformation. Im Falle industrieller Kunden verwenden<br />
sie beispielsweise in ihren eigenen Produktionsprozessen bereits einen neuen<br />
Werkstoff oder eine neue Bearbeitungsmethode, die sie dann auch für die Lösung<br />
ihres eigenen Bedürfnisses heranziehen. Damit erweitern sie oft auch den<br />
Lösungsraum des originären Herstellers (siehe Abschnitt 2.4.2). Ein Beispiel für<br />
diesen Fall wäre ein Materialwissenschaftler, der gleichzeitig begeisterter<br />
Marathonläufer ist. Er hat Probleme mit den Dämpfungseigenschaften seiner<br />
Schuhe. Da er aber in seinem Beruf mit einem innovativen Gummi experimentiert,<br />
kommt er auf die Idee, diesen Gummi in eine selbstgebaute Innensohle seines<br />
Schuhs einzubauen.<br />
Kasten 3–4: Portrait of a User Innovator: How Bette Nesmith Graham (1922-1980)<br />
invented Liquid Paper (white-out liquid like Tipp-Ex)<br />
(Quelle: Auszug aus einem Beitrag von Merry Bellis auf About.com [inventors.about.com])<br />
Bette Nesmith Graham never intended to be an inventor; she wanted to be an artist. However,<br />
shortly after World War II ended, she found herself divorced with a small child to support. She learned<br />
shorthand and typing and found employment as an executive secretary. An efficient employee<br />
124
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
who took pride in her work, Graham sought a better way to correct typing errors. She remembered<br />
that artists painted over their mistakes on canvas, so why couldn’t typists paint over their mistakes?<br />
Bette Nesmith Graham put some tempera water based paint, colored to match the stationery<br />
she used, in a bottle and took her watercolor brush to the office. She used this to correct her typing<br />
mistakes… her boss never noticed. Soon another secretary saw the new invention and asked for<br />
some of the correcting fluid. Graham found a green bottle at home, wrote “Mistake Out” on a label,<br />
and gave it to her friend. Soon all the secretaries in the building were asking for some, too.<br />
In 1956, Bette Nesmith Graham started the Mistake Out Company (later renamed Liquid Paper)<br />
from her North Dallas home. She turned her kitchen into a laboratory, mixing up an improved product<br />
with her electric mixer. Graham’s son, Michael Nesmith, and his friends filled bottles for her<br />
customers. Nevertheless, she made little money despite working nights and weekends to fill<br />
orders. One day an opportunity came in disguise. Graham made a mistake at work that she couldn’t<br />
correct, and her boss fired her. She now had time to devote to selling Liquid Paper, and business<br />
boomed.<br />
By 1967, it had grown into a million dollar business. In 1968, she moved into her own plant and<br />
corporate headquarters, automated operations, and had 19 employees. That year Bette Nesmith<br />
Graham sold one million bottles. In 1975, Liquid Paper moved into a 35,000-sq. ft., international<br />
headquarters building in Dallas. The plant had equipment that could produce 500 bottles a minute.<br />
In 1976, the Liquid Paper Corporation turned out 25 million bottles. Its net earnings were $1.5<br />
million. (…) Graham died in 1980, six months after selling her corporation for $47.5 million.<br />
Fortschrittliche und weniger fortschrittliche Nutzer: Lead User<br />
Andere Forschungsarbeiten zeigen jedoch, dass nicht alle Kunden bzw. Anwender<br />
fähig und bereit sind, eigenständig Innovationen hervorzubringen (Shah 2000; von<br />
Hippel 1998). Die Gegenüberstellung von Studien in Abbildung 3–7 über die Anteile<br />
innovativer Kunden zeigt, dass je nach Branche zwischen zehn und fast vierzig<br />
Prozent aller Nutzer in der Weiterentwicklung, Modifikation oder Verbesserung<br />
eines vorhandenen Produktes engagiert sind oder sogar völlig neue Produkte entwerfen<br />
(Lüthje / Herstatt / von Hippel 2005). Doch dies bedeutet auch, dass in vielen<br />
Branchen der Großteil der Kunden noch der klassischen Arbeitsteilung zwischen<br />
Kunden und Herstellern folgt: Kunden konsumieren, Hersteller innovieren und produzieren.<br />
Jedoch gibt es in fast allen Branchen. wenn auch mit stark unterschiedlichen<br />
Anteilen, bestimmte Kundengruppen, die als besonders fortschrittliche Kunden<br />
bezeichnet werden können. Diese in der englischsprachigen, aber auch deutschen<br />
Literatur als “Lead User” bezeichneten Nutzer haben zwei wesentliche Eigenschaften<br />
(von Hippel 1986, 1994; siehe auch Braunstein / Hoyer / Huber 2000; Herstatt / von<br />
Hippel 1992; Herstatt / Lüthje / Lettl 2002; Kleinaltenkamp / Dahlke 2001; Lilien et al.<br />
2002; Lüthje 2003c; Lüthje / Herstatt 2004; Urban / von Hippel 1988; von Hippel /<br />
Thomke / Sonnack 1999):<br />
Zu einem Zeitpunkt t verfügen Lead User bezüglich ihrer Anforderungen an ein<br />
Produkt über ein Bedürfnis, welches sich durch kein existierendes Marktangebot<br />
befriedigen lässt. Ihr singuläres Bedürfnis wird zum Zeitpunkt t+1 für einen mehr oder<br />
weniger großen Kundenkreis ebenfalls relevant.<br />
125<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Ihr unbefriedigtes Bedürfnis äußert sich in einer Unzufriedenheit mit dem bisherigen<br />
Marktangebot. Um dieser zu begegnen, haben Lead User sowohl die Fähigkeit als auch<br />
die Motivation, eigenständig innovative Lösungen zu entwickeln.<br />
Ein Beispiel wäre ein Meister in einer Fabrik, der als erster einen neuen Werkstoff einsetzt<br />
und dabei merkt, dass eine bestehende Maschine bestimmte Ansprüche bei der<br />
Bearbeitung dieses Materials nicht erfüllt. Die Vertriebsabteilung der Fabrik hat den<br />
Meister zum Umgang mit dem Material aufgefordert, um neue Sicherheitsbestimmungen<br />
in einem Exportmarkt erfüllen zu können. Der Meister schafft es aber<br />
nicht, mit der bestehenden Maschine den Werkstoff angemessen zu verarbeiten. Durch<br />
den Druck der Vertriebsabteilung könnte er aber zum Beispiel mit verschiedenen<br />
Einstellungen oder Modifikationen der Maschine experimentieren, um den neuen<br />
Werkstoff besser verarbeiten zu können. Diese Aktivitäten finden entweder autonom<br />
in der Domäne des Nutzers statt und bleiben dem Hersteller (in unserem Fall dem<br />
Maschinenbauer der Bearbeitungsmaschine) unbekannt, können aber auch in<br />
Kooperation mit dem Hersteller stattfinden. Das Beispiel zeigt auch, dass ein Lead<br />
User nicht eine einzelne Person sein muss, sondern durchaus ein Kollektiv verschiedener<br />
Akteure in der Nutzerdomäne sein kann (in unserem Fall liegt die ursprüngliche<br />
Bedürfnisinformation in der Vertriebsabteilung; die Problemlösungskompetenz aber<br />
beim Meister). Die Argumentation in Abschnitt 3.5.4 über Communities als Quelle<br />
von Innovationen setzt genau hier an.<br />
Lead User verfügen so über Bedürfnisinformationen hinsichtlich einer Leistung.<br />
Während diese Bedürfnisinformationen bei durchschnittlichen Kunden latent sind,<br />
sind Lead User in der Lage zu definieren, welche Faktoren diese Unzufriedenheit hervorrufen<br />
(der Lead User leistet so einen Transfer, welchen Unternehmen traditionell<br />
intern durch das “House of Quality” in der QFD-Methodik zu realisieren versuchen,<br />
siehe Abschnitt 3.2.1). Neben diesen expliziten Bedürfnisinformationen halten Lead<br />
User jedoch zusätzlich auch Lösungsinformationen. Im engeren Sinne handelt es sich<br />
bei Lead Usern somit um (potenzielle) Kunden einer Unternehmung, die als<br />
Eigenentwickler selbständig im Markt auftreten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu<br />
befriedigen. Speziell die eigene Unzufriedenheit mit dem bisherigen Marktangebot<br />
sorgt dabei für die notwendige Motivation unter Lead Usern. Diese Motivation ist vor<br />
allen dann von zentraler Bedeutung, wenn Lead User ihre innovativen Produkte von<br />
Grund auf eigenständig planen, konzipieren und entwickeln, da ein solcher Prozess<br />
aus Sicht eines Lead Users durchaus mit hohem Aufwand verbunden ist. Wir werden<br />
in Abschnitt 3.3.1 diese Eigenschaften innovativer Kunden noch genauer betrachten.<br />
Lead User haben früher als die Mehrheit eines Zielmarktes ein persönliches Bedürfnis für eine<br />
bestimmte Problemlösung (ein Produkt, ein Bearbeitungsprozess, ein bestimmtes Material<br />
etc.), und erwarten sich einen hohen persönlichen Nutzen von diesen Neuentwicklungen. Lead<br />
User antizipieren demnach frühzeitig innovative Leistungseigenschaften, die für andere<br />
Kunden erst sehr viel später relevant werden. Lead User haben darüber hinaus aber auch die<br />
Fähigkeiten, eine voll funktionsfähige Lösung für ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Sie besitzen<br />
also nicht nur Bedürfnis-, sondern auch gleichermaßen Lösungsinformationen.<br />
126
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Demokratisierung von Innovationen<br />
Wir wollen aber im folgenden Abschnitt die bisherige Argumentation zunächst noch<br />
um einen wichtigen Schritt erweitern: Der klassische “Lead-User”-Ansatz geht von<br />
einer mehr oder weniger strikten Trennung der Aktivitäten von Hersteller und Nutzer<br />
aus: Kunden, die selbst innovativ tätig werden, tun dies aus eigenem Antrieb, aber<br />
auch auf eigene Kosten und mit eigenen Mitteln, ohne Kooperation mit dem Hersteller<br />
des Produkts. Jedoch werden einige Hersteller auch von sich aus aktiv. Sie haben das<br />
innovative Potenzial ihrer Kunden erkannt und versuchen dieses, proaktiv zu nutzen.<br />
Diese Hersteller warten nicht, bis innovative Kunden mit einer Lösung auf sie zukommen<br />
oder sie zufällig eine solche in der Kundendomäne entdecken, sondern werden<br />
vielmehr selbst aktiv und versuchen, gemeinsam mit ihren Kunden und Nutzern, neue<br />
innovative Produkte zu schaffen.<br />
Die Grundidee ist die Erweiterung der Akteure in einem Innovationsnetzwerk um die<br />
wichtige Gruppe der Kunden, die in der klassischen Argumentation keine Rolle spielen.<br />
Die Vorstellung eines “offenen Innovationsprozesses” (z. B. bei Chesbrough 2003a)<br />
propagiert zwar den Einbezug vieler externer Partner als Quelle für innovative<br />
Lösungen, ließ aber die Kunden und Nutzer meist außen vor. Doch erst wenn Herstellerunternehmen<br />
gerade auch aktiv ihre Kunden und Nutzer in die Produktentwicklung<br />
mit einbeziehen (und nicht nur externe “Experten”), kann das wahre<br />
Potenzial eines verteilten, offenen Innovationsprozess genutzt werden. Von Hippel<br />
spricht in diesem Zusammenhang von einer Demokratisierung der Innovation (von<br />
Hippel 2005), wie das Interview in Kasten 3–5 erläutert.<br />
Kasten 3–5: Ein Interview mit Eric von Hippel, MIT, über die Demokratisierung von<br />
Innovation<br />
Professor Eric von Hippel leitet die Technological Innovation and Entrepreneurship Group an der<br />
MIT Sloan School of Management. In einem Interview kommentiert er über einige der zentralen<br />
Gedanken seines Buches “Democratizing Innovation” (MIT Press, 2005). Das Buch ist im<br />
Internet unter einer Creative Common Lizenz auch als freies Pdf-Download bei MITPress.com<br />
erhältlich.<br />
Q: Professor von Hippel, what do you mean when you say innovation is becoming democratized?<br />
A: I mean that product and service users – both individuals and firms - are increasingly able to<br />
innovate for themselves. Open source software has brought this phenomenon to general academic<br />
attention. However, I and my colleagues find that innovation is actually being democratized<br />
quite broadly: this is the case for physical products as well as information products like software.<br />
I think that this trend is a “good thing.” It seems to me that user-centered innovation processes<br />
offer great advantages over the manufacturer-centric innovation development systems that have<br />
been the mainstay of commerce for hundreds of years. Users that innovate can develop exactly<br />
what they want, rather than relying on manufacturers to act as their (often very imperfect)<br />
agents. Moreover, individual users do not have to develop everything they need on their own:<br />
they can benefit from innovations developed by others and freely shared within user communities.<br />
Q: Why is user innovation growing?<br />
127<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
A: Users develop products for themselves when they cannot find what they want on the market.<br />
Available data indicates that user need is highly heterogeneous – many users have “custom”<br />
needs. Advances in computing and communication technologies are enabling users with custom<br />
needs to design and build what they want for themselves at steadily lower prices. This leads to<br />
increasing levels of innovation by users. Indeed, levels of user innovation appear to be remarkably<br />
high. Empirical research conducted by Luthje, <strong>Frank</strong>e and Shah and others finds that from 10 %<br />
to nearly 40 % of sampled users engage in developing or modifying products in various fields.<br />
Q: Why does innovation by users matter?<br />
A: Innovation by users matters for two major reasons. First, users that innovate – both individual<br />
consumers and user firms - have been found to be “lead users.” That is, relative to other users in<br />
their populations they are ahead of the majority with respect to an important marketplace trend and<br />
expect to gain relatively high benefits from a solution to their leading-edge needs. The correlations<br />
found between innovation by users and these lead user characteristics are highly significant, and<br />
the effect sizes found are also very large. This means that the innovations users develop for themselves<br />
will be of interest to many users. Second, it has been found that users that innovate often<br />
freely reveal what they have developed. This means that other users – and manufacturers – are<br />
able to imitate what lead users have developed. The net result is that manufacturers often do produce<br />
innovations pioneered by lead users. Indeed, these innovations are a major feedstock for the<br />
new products that manufacturers produce and sell to the general marketplace.<br />
Q: So, do manufacturers like user innovation?<br />
A: Not all of them! The ongoing shift of product development activities from manufacturers to users<br />
is painful and difficult for many manufacturers. Open and distributed innovation is “attacking” a<br />
major structure of the traditional division of labor. Many firms and industries must make fundamental<br />
changes to long-held business models in order to adapt.<br />
Q: These fundamental changes seem to imply also changes for governments and legislation.<br />
A: Yes. Together with Joachim Henkel I have explored the social welfare implications of user innovation.<br />
We found that, compared to a world in which only manufacturers innovate, social welfare<br />
is very probably increased by the presence of freely-revealed innovation by users. This finding<br />
implies that policymaking should support user innovation, or at least should insure that legislation<br />
and regulations do not favor manufacturers at the expense of user-innovators. Governmental policy<br />
and legislation have long contained the assumption that manufacturers are the developers of<br />
new products and services. As a result, innovation-related government incentives have sometimes<br />
been directed preferentially to them. Social welfare considerations suggest that this must change.<br />
Especially, the workings of the intellectual property system are of special concern. But, despite the<br />
difficulties, it seems to me that the goal of a democratized user-centric innovation system appears<br />
well worth striving for!<br />
3.2.4 Open Innovation: Ein Zwischenfazit<br />
Fassen wir die bisherige Argumentation zusammen: In der Sichtweise des klassischen<br />
Innovationsprozess (manufacturer-active paradigm) beschränkt sich die Rolle des<br />
Kunden auf die eines passiven Nachfragers. Unternehmen ermitteln durch<br />
Marktforschungsmethoden durchschnittliche Kundenbedürfnisse. Kunden werden<br />
nur nach Aufforderung durch den Hersteller aktiv. Das customer-active paradigm<br />
erweitert diese Sichtweise: Demnach verfügen ausgewählte, besonders fortschrittliche<br />
Nutzer eines Produkts (“Lead User”) neben Bedürfnisinformationen auch über<br />
128
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
Lösungsinformationen. Sie schaffen aus eigenem Antrieb und mit eigenen Mitteln<br />
innovative Produkte und Leistungen.<br />
Abgrenzung Open Innovation und “Voice of the Customer”<br />
Die Existenz einer solchen Kundengruppe fordert eine Ergänzung der klassischen<br />
Methoden testender Innovationsmarktforschung bzw. “Voice of the Customer”-<br />
Methoden im Sinne des manufacturing-active paradigm (MAP):<br />
Marktforschung im traditionellen Innovationsprozess behandelt den Kunden als<br />
repräsentative, statistische Durchschnittsgröße. Kunden mit besonders neuen<br />
Bedürfnissen verlieren somit an Bedeutung oder werden durch das Unternehmen<br />
nicht erkannt (da sie ja gerade nicht die Bedürfnisse der aktuellen Mehrheit der<br />
Kunden haben, sondern neue Bedürfnisse, die die Mehrheit ggfs. erst in einer der<br />
folgenden Perioden entwickelt).<br />
Die Nutzung von Kundenwissen erstreckt sich bei klassischer Marktforschung<br />
nicht auf den gesamten Innovationsprozess. Bedürfnisinformation der Kunden wird<br />
meist nur in der Phase der Ideengenerierung sowie Markteinführung verwendet.<br />
Viele Probleme der Marktforschung im Innovationsprozess resultieren zudem aus<br />
der Tatsache, dass neue Bedürfnisse oft “sticky” und in der lokalen Domäne der<br />
Kunden sind, d. h. nicht einfach oder nur zu hohen Kosten durch einen Hersteller<br />
zu erkennen und in die eigene Domäne zu überführen sind.<br />
Die Erkenntnis der Lead-User-Forschung hat diese Sichtweise ergänzt (Abbildung<br />
3–9). Innovative Kunden im Sinne von Lead Usern werden dann aus eigenem Antrieb<br />
innovativ tätig, wenn die Mehrheit der Kunden (also genau die “Zielgruppe” von<br />
Herstellern!) dieses Bedürfnis noch nicht haben. Deshalb greifen auch Methoden zu<br />
kurz, die diese klassischen Zielkunden nach ihren offenen Bedürfnissen befragen.<br />
Vielmehr müssen Unternehmen versuchen, Lead User zu identifizieren und ihre<br />
Innovationen in die Unternehmensdomäne zu übertragen. Ein Unternehmen, das<br />
Lead-User-Entwicklungen erkennt, muss nicht mehr unbedingt das ursächliche<br />
Bedürfnis (Problem) der Kunden erkennen, sondern bekommt unmittelbar Zugang zu<br />
einem Artefakt, das bereist eine Lösung zur Bedürfnisbefriedigung erhält. Damit<br />
wird der schwierige Zugang zu “sticky” Information durch den Zugang zu einer<br />
Lösung ersetzt.<br />
Dieses Vorgehen ist deutlich auch von neuen “Voice of the Customer”-Verfahren wie<br />
QFD oder die als “Listening in” bzw. “Virtual Customer” bezeichneten Methoden<br />
abzugrenzen (Dahan / Hauser 2002; Herrmann et al. 2000; Toubia / Hauser / Simester<br />
2004; Urban / Hauser 2003). Diese Verfahren stellen zwar sehr leistungsfähige und<br />
deutlich erweiterte Methoden zur Verfügung, wie Unternehmen die Bedürfniserhebung<br />
und den Akzeptanztest verbessern können. Sie verbleiben jedoch im MAP<br />
und entsprechen nicht unserer Auffassung von interaktiver Wertschöpfung.<br />
Vom klassischen Lead-User-Ansatz zu Open Innovation<br />
In der Wissenschaft ist Nutzerinnovation als autonomes Phänomen seit langem erforscht<br />
(z. B. Anderson / Crocca 1993; Ciborra 1991; Cooper 1993; Enos 1962; Freeman<br />
129<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
1968; Herstatt / von Hippel 1992; Rice / Rogers 1980; Rosenberg 1976; von Hippel 1986).<br />
Diese Studien haben die Existenz fortschrittlicher Nutzer und Kunden ebenso belegt<br />
wie ihre wichtige Rolle als Urheber und Initiator vieler innovativer Produkte und<br />
Leistungen, die heute von Herstellern im Markt angeboten werden. Diese Forschung –<br />
und die konventionelle Vorstellung des Lead Users als ein vom Herstellerunternehmen<br />
unabhängiger Innovator – erweitert die konventionelle Vorstellung des Innovationsprozesses<br />
um die Sichtweise eines offenen Problemlösungsvorganges, der den Input<br />
vieler Akteure beinhaltet.<br />
Abbildung 3–9: Gegenüberstellung des Lead-User-Gedankens und des klassischen “Voice of<br />
the Customer”-Konzepts (in Anlehnung an von Hippel 2005)<br />
Jedoch sehen sowohl diese originären als auch die recht umfangreichen neueren<br />
Forschungsarbeiten zu innovativen Nutzern (aktuell zusammengefasst in von Hippel<br />
2005) die Rolle des Herstellerunternehmens als relativ passiv: Unternehmen warten,<br />
130<br />
Zahl der<br />
Kunden mit<br />
diesem<br />
Bedürfnis<br />
Nur Lead User<br />
Prototypen erhältlich<br />
Lead<br />
User<br />
Methoden der Lead User Innovation<br />
Generelle Idee<br />
• Identifizierung aller Lösungen (Prototypen),<br />
die Lead User zur Eigennutzung entwickelt<br />
haben.<br />
• Kommerzialisierung der Entwicklungen, die<br />
am meisten Erfolg im Gesamtmarkt<br />
versprechen.<br />
Spezielle Instrumente<br />
• Methoden zur Identifikation von Lead Usern<br />
• User Toolkits um Kundenentwicklungen zu<br />
unterstützen und Transfer zu vereinfachen<br />
• Arbeit mit Kunden-Communities<br />
Kommerzielle Versionen<br />
des Produktes erhältlich<br />
Kunden im<br />
Zielmarkt<br />
Zeit<br />
"Voice of the Customer"-Methoden<br />
Generelle Idee<br />
• Marktforschung, um Bedürfnisse der Kunden<br />
im Zielmarkt zu finden.<br />
• Interne Entwicklung passender Produkte und<br />
Leistungen.<br />
Spezielle Instrumente<br />
• Umfrage, Fokusgruppen, Beobachtung von<br />
Kunden, Tiefeninterviews<br />
• Multiattribut Analyse der Bedürfnisinformation<br />
(z.B. Conjoint Analyse)<br />
• Ethnographische Studien der Kunden<br />
• Quality Function Deployment
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
bis ein Lead User mit einer innovativen Lösung an sie herantritt, oder aber sie suchen<br />
nach Lead-User-Lösungen unter ihren Kunden. Die Entwicklung der Lead-User-<br />
Innovation wird aber sowohl durch den Kunden bzw. Nutzer initiiert als auch autonom<br />
durchgeführt – mit Produktionsfaktoren, die sich allein in der Domäne des Nutzers<br />
befinden. Unsere Vorstellung von interaktiver Wertschöpfung im Innovationsbereich<br />
geht einen Schritt weiter: In Ergänzung zum “klassischen” Lead-User-Ansatz<br />
gehen wir davon aus, dass Kundeninnovation ein Vorgang ist, der durch ein<br />
Herstellerunternehmen aktivierbar und (zumindest teilweise) steuerbar ist (<strong>Piller</strong><br />
2004; siehe auch Gassmann / Enkel 2004; Jeppesen / Molin 2003; <strong>Piller</strong> 2003; Prahalad /<br />
Ramaswamy 2004).<br />
Denn Hersteller können nicht nur nach Kundenentwicklungen im Sinne von funktionsfähigen<br />
Prototypen der Lead User suchen, sondern auch versuchen, mittels<br />
bestimmter Hilfsmittel Lead-User-Innovationen zu unterstützen oder gar anzuregen<br />
(z. B. mittels “Toolkits for User Innovation”, siehe Abschnitt 3.5). Ziel ist die Erweiterung<br />
bzw. Neudefinition des Lösungsraumes des Herstellerunternehmens. Die<br />
Anwendung dieser Methoden wandelt so den klassischen Lead-User-Ansatz, der von<br />
autonom handelnden Kunden ausgeht, in eine Strategie der interaktiven Wertschöpfung<br />
(Kooperation zwischen Hersteller und Kunden). Damit kann die Zahl der<br />
potentiellen Kunden, die sich für eine Integration in den Innovationsprozess eignen,<br />
ggfs. deutlich erhöht werden, da die Hürde zur Partizipation an Problemlösungsaktivitäten<br />
gesenkt wird. Wir verwenden im Folgenden den Begriff Open Innovation<br />
als Konkretisierung der Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung im Innovationsprozess.<br />
Dies erfolgt im Rahmen eines losen, relativ informellen Netzwerks partizipativer<br />
Koordination zwischen einem Herstellerunternehmen und einer Vielzahl (potenzieller)<br />
Nutzer bzw. Kunden, mit den Ziel, gemeinsam neue Produkte oder Leistungen<br />
zu entwickeln.<br />
Open Innovation im Verständnis dieses Buchs<br />
Open Innovation bezeichnet so die systematische Integration von Kundenaktivitäten<br />
und Kundenwissen in einzelne oder (im Extremfall) alle Phasen des Innovationsprozess.<br />
Auf diese Weise entsteht zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden eine<br />
Wertschöpfungspartnerschaft, die durch eine integrierte System- und Problemlösungskompetenz<br />
charakterisiert ist. Kunden werden selbst aktiv und konkretisieren ihr<br />
implizites Wissen über neue Produktideen und Konzepte, unter Verwendung<br />
bestimmter Hilfswerkzeuge des Unternehmens (<strong>Piller</strong> 2004). Produktionstheoretisch<br />
betrachtet bedeutet Open Innovation einen Transfer von Produktionsfaktoren<br />
(Ressourcen) vom Kunden zum Unternehmen. Bei den eingebrachten Ressourcen handelt<br />
es sich um Informationen und Anforderungen an ein Produkt sowie um<br />
Fähigkeiten der Konkretisierung und Realisierung von Problemlösungen.<br />
Bildhaft vollzieht sich dieser Interaktionsprozess nach dem Phasenmodell von der<br />
Ideengenerierung über die Konzeptentwicklung bis hin zur Prototypen-Entwicklung<br />
und mündet schließlich aus der Sicht des Kunden in der Phase der Problemlösung. Der<br />
Open-Innovation-Ansatz ist insoweit ein ergänzender Ansatz zum herkömmlichen<br />
Innovationsmanagement. Produkt- und Markttest sowie Markteinführung werden<br />
aus Sicht des Herstellers nicht überflüssig, laufen jedoch wegen der Kundeninteraktion<br />
131<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
in den vorherigen Phasen nach einem anderen Muster und mit einem erheblich geringeren<br />
Marktrisiko ab. Dabei tritt neben die klassischen Organisationsprinzipien<br />
Hierarchie und Markt vor allem auch das neue Organisationsprinzip einer<br />
“Commons-based Peer-Production” (Selbstselektion, Mikrospezialisierung und<br />
Selbstintegration) als Instrument zur Koordination der arbeitsteiligen Wertschöpfung.<br />
Open Innovation bezeichnet eine interaktive Wertschöpfung im Innovationsprozess, indem<br />
ein Herstellerunternehmen mit ausgewählten Kunden bzw. Nutzern gemeinschaftlich<br />
Innovationen generiert. Dies erfolgt durch gezielte, jedoch relativ informale und vor allem partizipative<br />
Koordination des Interaktionsprozesses zwischen Hersteller und einer Vielzahl an<br />
Kunden und Nutzern. Dabei kommt es zu einer systematischen Integration von Kundenaktivitäten<br />
und Kundenwissen innerhalb eines Kontinuums von einer Ideengenerierung über die<br />
Entwicklung erster konzeptioneller technischer Lösungen bis hin zum Design und der Fertigung<br />
erster Prototypen. Zur Koordination der arbeitsteiligen Wertschöpfung tritt dabei neben die klassischen<br />
Organisationsprinzipien Hierarchie und Markt vor allem auch das neue Organisationsprinzip<br />
einer “Commons-based Peer-Production” (Selbstselektion, Mikrospezialisierung<br />
und Selbstintegration).<br />
Der Begriff Open Innovation ist in diesem Zusammenhang auch eine Anspielung auf<br />
den Begriff Open Source Software, deren Entwicklungsprinzipen ebenso auf diesem<br />
Netzwerk von Nutzern beruhen. Hier besteht auch eine enge Verbindung zum<br />
Schlagwort “Web 2.0”, das neue Wertschöpfungsprinzipien von Informationsgütern<br />
im Internet bezeichnet, wie Patricia Seybold in Kasten 3–6 erklärt.<br />
Kasten 3–6: What’s Really Up with Web 2.0: Customer Innovation and Design It Yourself<br />
(Quelle: Auszug aus einem Posting vom 17. Nov. 2005 im Blog Outside Innovation [outsideinnovation.blogs.com]<br />
von Patricia Seybold)<br />
Chris Nuttall’s comment and analysis in the Financial Times on November 17, 2005 titled, “Way of<br />
the Web: Start-ups Map the Route as Big Rivals Get Microsoft in Their Sights” does a great job of<br />
summarizing the challenge that’s facing Microsoft and other established industry leaders by Web<br />
2.0. Chris describes the challenge this way: “A new wave of internet development is drawing on<br />
established software tools to offer a more dynamic online experience at low cost.” He describes<br />
the new wave of startups enabled and empowered by Web 2.0 technologies and principles (…)<br />
Chris Nuttall cites Bill Gates’ October 30th memo to Microsoft employees in which Bill said “This<br />
next generation of the internet is being shaped by its grassroots adoption and popularisation<br />
model.” He cited the Ray Ozzie memo from October 28th in which Ray described the “tremendous<br />
software-and-services activity (that) is occurring within start-ups and at the grassroots level.” Chris<br />
cites a raft of now-famous companies as examples of this Web 2.0 phenomenon-companies like<br />
Flickr, Rollyo, Jotspot Live, Wikipedia, Writely.com, and Flock as examples of Web 2.0 companies.<br />
He refers to the enabling influence of Google’s AdSense in fueling an advertising-supported business<br />
model that enables these startups to get off the ground in an earn-as-you-go fashion. He talks<br />
about the fact that we’re back to the two guys in a garage model of business startups. Instead of<br />
raising millions of dollars and spending a year or two on product development, this new wave of<br />
132
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration im Innovationsprozess<br />
entrepreneurs invests tens of thousands of dollars, roll out quickly-built software tools (many of<br />
them developed on top of open source piece parts), and rely on grass roots innovation and iterative<br />
development to add functionality and gain traction. He offers a great little Web 2.0 Glossary<br />
with terms like “mash-ups”-”Services created by mashing together two or more Web applications,”<br />
and cites all the Google Map-based applications as a great example of the genre-and Ajax (asynchronous<br />
Java Script and XML), RSS, and tagging.<br />
Here’s what I see. Watching the buzz over the Web 2.0 phenomenon reminds me of the Web /<br />
Internet / ecommerce / ebusiness buzz in 1998. Then, as now, there was a huge amount of hype.<br />
Then, as now, people were combining a group of intersecting trends into a single exciting bucket.<br />
Many companies had their first or second generation Web sites. Consumer ecommerce was the<br />
big new thing. Disintermediation was all the rage. “Get big fast” was the prescription for early Webbased<br />
businesses. Everyone was confused about the differences between ecommerce and ebusiness.<br />
Upstart Netscape was all the rage. Microsoft was just waking up to the threat and possibilities<br />
of the Internet. That was when I published Customers.com. The timing was perfect. That book<br />
became a lightning rod. It cut through the hype and offered one simple prescription: Use the Web<br />
to “make it easy for your customers to do business with you.”<br />
Now, with a sense of deja vu, I’m looking at this current next generation of rich Internet client tools,<br />
granular plug-in-and-use services, end-user tagging, blogging, Wikis, social networking, and massively<br />
multiplayer gaming, and what do I see? I see customers co-designing their own products<br />
and services. I see customers contributing and building upon each others’ content, designs, solutions,<br />
and knowledge. I see customers rolling up their sleeves and redesigning our business processes<br />
and business models. In this new “Design It Yourself” world, end customers have become<br />
the innovators. They’re the designers of applications, the contributors of content, the customizers<br />
of products and services, the promoters of ideas, the inventors of new business models, the builders<br />
of entire ecosystems and the change agents for industries. What’s the real business driver in<br />
Web 2.0? Use Web tools to unleash customer innovation to let your customers co-design your<br />
business.<br />
By the way, this DIY phenomenon isn’t a Web-only phenomenon. It’s much broader than that.<br />
Customers all over the world are customizing their own cars (Scion), toys (Build-a-Bear), apparel<br />
(Lands’ End), backpacks (Timbuk2, L.L. Bean). Customers are selecting and selling products<br />
(Karmaloop). They’re co designing their own products (GE Labs, 3M, St. Gobain, National<br />
Semiconductor). Our clients’ customers are co-designing business processes to support their ideal<br />
scenarios (Symantec, Toro, Amazon, Sprint, Expedia). Customers are challenging business<br />
models (music, publishing, entertainment) and reshaping industries (customized drugs, do-it-yourself<br />
group travel, etc.). The pattern that I see is an amazing combination of “having it my way” and<br />
sharing my designs and innovations with others. Customers build on each others’ inventions and<br />
ideas. Customers start by solving their problems, and then share those solutions with others. They<br />
create something that works for them-a playlist, a Podcast, a photo album, an itinerary, a restaurant<br />
review-and offer it back to the community to build upon. As they do, they feel good about<br />
making life better for everyone. Customer innovation is at the heart of the Web 2.0 phenomenon.<br />
Neue Erfolgsfaktoren im Innovationsprozess<br />
Das neue Verständnis von Open Innovation verlangt auch eine Erweiterung der klassischen<br />
Erfolgsfaktoren von Innovation (siehe Beginn von Abschnitt 3.2.1). Dieser Ansatz<br />
eines grenzüberschreitenden Innovationsprozesses verlangt vom Unternehmen wie<br />
auch vom externen Partner (Kunde, Nutzer, Wettbewerber) Interaktionskompetenz.<br />
Aufbauend auf die Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung (siehe Abschnitt 2.4.1)<br />
133<br />
3.2
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
beherrschen die folgenden Faktoren einen erfolgreichen Innovationsprozess im Sinne<br />
der interaktiven Wertschöpfung:<br />
Erschließung des Kundenwissens als Ressource,<br />
gemeinsame Generierung von Bedürfnisinformationen und Lösungsinformationen,<br />
Reduzierung des Innovationsrisikos durch frühzeitige Integration des Kunden,<br />
Auswahl geeigneter Kunden (sog. Lead -User-Konzept),<br />
die Gestaltung des Innovationsprozesses über die Unternehmensgrenzen hinaus<br />
sowie<br />
die Bereitstellung von Kommunikationsplattformen und Werkzeugen, die die<br />
Kundenintegration in den Innovationsprozess ermöglichen und für alle Akteure<br />
attraktiv werden lassen.<br />
Wir werden diese Aspekte in den restlichen Abschnitten dieses Kapitels noch weiter<br />
betrachten. An dieser Stelle sei jedoch schon angemerkt, dass im Gegensatz zur klassischen<br />
Erfolgsfaktorenforschung eine empirische Überprüfung dieser Erfolgsfaktoren<br />
interaktiver Wertschöpfung erst am Anfang steht.<br />
Grenzen der Umsetzung interaktiver Wertschöpfung<br />
Allerdings wird nicht jede Art von Open Innovation alle Prinzipien der interaktiven<br />
Wertschöpfung, die wir in Abschnitt 2.4 diskutiert haben, vollständig verwirklichen.<br />
Dort wurde insbesondere mit dem Modell der “Commons-based Peer Production” der<br />
Idealtyp einer neuen Art der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung beschrieben.<br />
Bei den in der betrieblichen Realität heute bereits vorhandenen Beispielen von Open<br />
Innovation vollzieht sich dagegen die Integration von Kundenbeiträgen oft noch im<br />
Rahmen hierarchischer Arrangements – insbesondere, wenn es sich um materielle<br />
Güter handelt, bei denen höhere Ansprüche an die Produktionsausstattung zur<br />
Erstellung der Produkte gestellt werden (siehe für ein aktuelles Beispiel aus der<br />
Industrie Lang 2005). Auch werden die resultierenden Entwicklungen oft unter den<br />
proprietären Schutz des fokalen Herstellerunternehmens gestellt (mittels klassischer<br />
Schutzrechte). Ziel unserer Ausführungen ist es deshalb, in den folgenden Abschnitten<br />
ein realistisches Bild einer interaktiven Wertschöpfung im Innovationsbereich zu<br />
zeichnen, dass mit der heutigen Wirklichkeit übereinstimmt. (Kasten 3–6 hat dagegen<br />
gezeigt, dass bei Informationsgütern die Idee der Commons-based Peer Production<br />
heute schon viel eher umzusetzen ist).<br />
Weiterhin ist wichtig zu betonen, dass Open Innovation vorhandene Praktiken im<br />
Innovationsmanagement ergänzt, sie aber nicht ersetzt. Die Interaktion mit den Kunden<br />
im Innovationsprozess erleichtert den Zugang zu Bedürfnis- und Lösungsinformation<br />
und kann so Unsicherheiten im Innovationsprozess reduzieren. Es wird aber<br />
weiterhin Bereiche geben, in denen die interne Organisation und der interne Vollzug<br />
von Innovationsaktivitäten einen Vorteil gegenüber offenen Innovationsprozessen<br />
haben. Auch gibt viele Beispiel, bei denen Unternehmen sehr erfolgreich ohne größere<br />
Marktforschungsaktivitäten und nur aus eigener Kraft hoch erfolgreiche Produkte ent-<br />
134
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
wickelten und am Markt platzieren konnten, die entweder auf einer besonders hohen<br />
technischen Kompetenz, einer hohen Qualität (auch in Hinblick auf die Bedienbarkeit)<br />
und/oder anderen Kriterien der ergonomischen Leistungsfähigkeit oder aber auf hedonistischen<br />
Kriterien wie dem Markennamen oder einem ansprechenden ästhetischen<br />
Design beruhen. Open Innovation ersetzt diese Praktiken nicht, sondern will einen<br />
weiteren Weg aufzeigen, wie Unternehmen den Erfolg von neuen Produkten erhöhen<br />
und das Innovationsrisiko senken können.<br />
Wir werden in den folgenden Abschnitten konkrete Instrumente und Ansätze<br />
betrachten, mit denen ein Herstellerunternehmen einen aktiven Open-Innovation-<br />
Prozess mit seinen Kunden und Nutzern anstoßen und unterstützen kann. Unsere<br />
Sichtweise ist dabei die des Herstellerunternehmens. Als Hintergrund dieser<br />
Argumentation müssen wir aber zunächst die Erwartungshaltung des Herstellers an<br />
Open Innovation, vor allem aber der Kunden an eine Mitwirkung am<br />
Innovationsprozess näher betrachten.<br />
Kasten 3–7: Literaturempfehlungen zu Grundidee und Hintergrund von Open Innovation<br />
Chesbrough, Henry (2003).The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44<br />
(2003) 4 (Summer): 35-41.<br />
Ernst, Holger (2004). Virtual customer integration: Maximizing the impact of customer integration<br />
on new product performance. In: Soenke Albers (ed.): Cross-Functional Innovation<br />
Management, Wiesbaden: Gabler 2004: 191-208.<br />
Gruner, Kjell / Homburg, Christian (2000). Does customer interaction enhance new product<br />
success? Journal of Business Research, 49 (2000) 1: 1-14.<br />
Ogawa, Susumu / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> T. (2006). Reducing the risk of new product development. MIT<br />
Sloan Management Review, 48 (2006) 1 (Winter): 65-72.<br />
von Hippel, Eric (1978a). Successful industrial products from customer ideas: presentation of<br />
a new customer-active paradigm with evidence and implications. Journal of Marketing, 42<br />
(1978) 1 (January): 39-49.<br />
von Hippel, Eric (2005). Democratizing innovation. Cambridge, MA: MIT Press 2005.<br />
3.3 Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open<br />
Innovation<br />
Nicht alle Kunden eines Unternehmens eignen sich gleichermaßen für eine Beteiligung<br />
an Open Innovation. Vielmehr konzentriert sich diese Eignung auf eine ausgewählte<br />
Gruppe, Nutzer bzw. Kunden mit Lead-User-Eigenschaften. Dieser Abschnitt diskutiert<br />
die beiden folgenden Schlüsselfragen der Integrationskompetenz aus<br />
Kundensicht:<br />
Innovationsfähigkeit: Über welche Eigenschaften, Fähigkeiten und welches<br />
Können verfügen Lead User?<br />
135<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Innovationsbereitschaft: Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit sich Lead<br />
User an Innovationsvorhaben einer Unternehmung beteiligen (Motivation bzw.<br />
erwartete Nutzen aus Kundensicht)?<br />
Die grundsätzliche Beteiligung eines Kunden sowie Art, Umfang und Häufigkeit an<br />
einem interaktiven Open-Innovation-Prozess wird durch die Erwartung des Gesamtnutzens<br />
dieser Aktivität für den Kunden bestimmt. Die Erwartungswerttheorie<br />
beschreibt den Gesamtnutzen durch den erwarteten Nutzen von Handlungen.<br />
Einzelne Nutzenvorstellungen gelten hier als Triebkräfte bzw. Motive des Handelns,<br />
die in ihrer Struktur und Stärke des Zusammenwirkens zu Motivation führen (Picot /<br />
Dietl / Franck 2005; von Rosenstiel 1980). Demnach entschließt sich ein Kunde zur<br />
Beteiligung an Open Innovation, falls der erwartete Nutzen seine Teilnahmekosten<br />
übersteigt. Denn Lead User haben nicht nur Nutzen, sondern auch zusätzliche Kosten<br />
und Aufwand durch eine Beteiligung am Innovationsprozess. Die Einschätzung und<br />
Beurteilung der Nutzen und Kosten ist wiederum von individuellen Eigenschaften des<br />
jeweiligen fortschrittlichen Nutzers abhängig (Abbildung 3–10). Wir werden die einzelnen<br />
Bestandteile bzw. Treiber des Gesamtnutzens im Folgenden näher betrachten.<br />
Abbildung 3–10: Determinanten der Kundenbeteiligung an Open Innovation<br />
Spezifika der<br />
Produktkategorie<br />
Nutzenerwartungen<br />
Unzufriedenheit mit bestehenden Angebot<br />
Erfolgreiche Absolvierung einer<br />
lohnenswerten Aufgabe<br />
Stolz auf das Ergebnis<br />
Reduktion von Unsicherheit<br />
Soziale Bestätigung, externe<br />
Anerkennung<br />
Eigenschaften<br />
Unzufriedenheit :<br />
Konsumexpertentum<br />
Meinungsführerschaft<br />
Involvement<br />
kognitive Komplexität<br />
Teamkompetenz<br />
Gesamtnutzen<br />
:<br />
Beteiligung an<br />
Open Innovation<br />
Art, Ausdauer und Intensität<br />
der Beteiligung an<br />
Open Innovation<br />
Spezifika der<br />
Innovationsaufgabe<br />
Kostenerwartungen<br />
Zeit & Aufwand<br />
(Interaktionskosten)<br />
wahrgenommenes Risiko<br />
(psychologische<br />
Kosten)<br />
Diese Diskussion ist auch deshalb sehr wichtig, da sie das auf dem ersten Blick sehr<br />
irrationale Verhaltens eines “free revealings” von Nutzerinnovatoren erklären kann.<br />
Wie wir bereits in Abschnitt 2.4.4 gezeigt haben, lässt sich empirisch nachweisen, dass<br />
viele Kunden scheinbar ohne Gegenleistung ihre Entwicklungen an einen Hersteller<br />
136
(und/oder andere Nutzer) offenbaren – selbst wenn der Hersteller die Innovation in<br />
folgenden Perioden produziert und damit einen Profit erzielt. Jedoch scheinen viele<br />
Kunden durch eine Vielzahl weiterer Anreise motiviert zu werden, die aus ihrer Sicht<br />
die Offenlegung ihrer Entwicklungen rational macht.<br />
3.3.1 Eigenschaften von Kundeninnovatoren (Lead Usern)<br />
Bevor wir aber die Anreise innovativer Kunden näher betrachten, wollen wir diese<br />
näher kennen lernen: Welche Eigenschaften besitzen innovative Kunden? Wie wir<br />
bereits gesehen haben, besitzen Lead User Anforderungen an ein Produkt oder eine<br />
Dienstleistung, die bisher noch durch kein existierendes Marktangebot erfüllt werden,<br />
jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Bedürfnisse eines relativ großen Marktsegments<br />
repräsentieren. Demnach antizipieren Lead User frühzeitig innovative<br />
Leistungseigenschaften, die für andere Kunden erst sehr viel später relevant werden.<br />
Lead User verfügen somit über Bedürfnisinformationen. Ihr unbefriedigter Bedarf<br />
sorgt für eine Unzufriedenheit mit dem bisherigen Marktangebot. Aus dieser<br />
Unzufriedenheit heraus entwickeln Lead User eigenständig Lösungen, um ihrer<br />
Unzufriedenheit zu begegnen. Neben Bedürfnisinformationen halten Lead User demnach<br />
auch Lösungskompetenz. Im engeren Sinne handelt es sich bei Lead Usern somit<br />
um (potenzielle) Kunden einer Unternehmung, die als Eigenentwickler selbständig im<br />
Markt auftreten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Speziell die eigene<br />
Unzufriedenheit mit dem bisherigen Marktangebot sorgt dabei für die notwenige<br />
Motivation unter Lead Usern (Lüthje 2000; Morrison / Roberts / Midgley 2004). Diese<br />
Motivation ist vor allem dann von zentraler Bedeutung, wenn Lead User ihre innovativen<br />
Produkte von Grund auf eigenständig planen, konzipieren und entwickeln, da<br />
ein solcher Prozess aus Sicht eines Lead Users mit teilweise hohem Aufwand verbunden<br />
ist. Hinsichtlich unseres Ziels, Merkmale, Fähigkeiten und Eigenschaften innovativer<br />
Kunden zu determinieren, können wir an dieser Stelle folgendes Zwischenfazit<br />
ziehen (von Hippel 2005):<br />
Lead User verfügen über Bedürfnisinformationen, die zu einem späteren Zeitpunkt für<br />
ein relativ großes Marktsegment relevant werden. Da ihre Bedürfnisse bisher nicht<br />
befriedigt werden, sind Lead User mit dem bestehenden Marktangebot unzufrieden.<br />
Diese Unzufriedenheit motiviert Lead User, eigenständig aktiv zu werden und<br />
Lösungen zur Beseitigung ihrer Unzufriedenheit zu entwickeln. Lead User verfügen<br />
demnach über Lösungsinformationen und nutzen diese zur Befriedigung ihres<br />
Bedarfs.<br />
Wir werden im Folgenden aufbauend auf diesen beiden grundsätzlichen Eigenschaften<br />
fortschrittlicher Nutzer verschiedene Faktoren betrachten, die diese Eigenschaften<br />
weiter konkretisieren.<br />
Unzufriedenheit und Konsumkompetenz<br />
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
Unzufriedenheit entsteht, wenn ein Kunde bei der Nutzung eines Produktes oder<br />
einer Dienstleistung eine Diskrepanz zwischen seinen Leistungserwartungen und der<br />
137<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Leistungswahrnehmung feststellt. Leitet ein Kunde aus seiner aktuellen Unzufriedenheit<br />
mit dem Leistungsangebot eines Unternehmens Bedürfnisinformationen ab, sind<br />
diese Informationen nur dann von innovationsrelevanter Bedeutung, wenn der Kunde<br />
sein Bedürfnis auch tatsächlich nicht durch das aktuelle Leistungsangebot decken<br />
kann. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Vielmehr entsteht bei einem Kunden häufig<br />
dann eine Unzufriedenheit mit einer Leistung, wenn dieser nicht in der Lage ist, den<br />
Nutzen der Leistung vollständig zu erschließen. Der Kunde entwickelt dann keine<br />
innovationsrelevanten Bedürfnisinformationen, da lediglich seine Unwissenheit bzw.<br />
sein Unvermögen in Bezug auf die Verwendung und den Umgang mit einem Produkt<br />
oder einer Dienstleistung diese Unzufriedenheit hervorruft (Brockhoff 2003).<br />
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument eines Produktes innovationsrelevante<br />
Bedürfnisinformationen generiert, ist ceteris paribus umso wahrscheinlicher, je besser<br />
es diesem Kunden gelingt, den Produktnutzen vollständig zu erschließen. In der<br />
Marketingwissenschaft wird diese Fähigkeit Konsumkompetenz genannt (Hennig-<br />
Thurau 1998). Konsumkompetenz bezeichnet die Summe des Wissens sowie der physischen<br />
und sozialen Fertigkeiten von Nutzern, die ihren Umgang mit einem Produkt<br />
in sämtlichen Teilbereichen der Nachkaufphase betreffen. Hierzu zählen insbesondere<br />
die Nutzungsvorbereitung, die Nutzung sowie die Nutzungsbegleitung. Die<br />
Nutzungsvorbereitung beginnt mit dem Abschluss des Kaufvertrages und endet mit<br />
der erstmaligen Nutzung des Produktes. Sie umfasst demnach den Transport, den Aufbzw.<br />
Zusammenbau des Produktes, die Installation sowie die Ingangsetzung. Bei der<br />
eigentlichen Nutzung des Produktes wird dann zwischen Nutzungsintensität und<br />
Nutzungsvariabilität unterschieden. Die Nutzungsintensität beschreibt die Häufigkeit<br />
der Inanspruchnahme eines Produktes durch die Kunden, während die Nutzungsvariabilität<br />
den Einsatz des Produktes für verschiedene Zwecke sowie die verschiedenen<br />
Nutzungsanwendungen kennzeichnet. Die Nutzungsbegleitung hingegen ist<br />
geprägt durch Aktivitäten, die zeitlich parallel zur eigentlichen Nutzung anfallen und<br />
diese unterstützen oder ergänzen (z. B. Wartungen, Pflege, Reinigung oder Updates).<br />
In der Summe sorgt eine ausgeprägte Konsumkompetenz bei Konsumenten dafür,<br />
dass sich diese den Nutzen eines Produktes nach dem Kauf vollständig erschließen<br />
(Hennig-Thurau 1998).<br />
Meinungsführerschaft, Early Adopter und Involvement<br />
Empirische Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Lead User im Markt weiterhin<br />
häufig als Meinungsführer agieren (Morrison / Roberts / Midgley 2004; Morrison /<br />
Roberts / von Hippel 2000; Sawhney / Prandelli 2000). Meinungsführer sind<br />
Konsumenten, die innerhalb einer spezifischen Produktkategorie im Rahmen der persönlichen<br />
Kommunikation einen starken Einfluss auf andere Verbraucher ausüben.<br />
Dieser Einfluss erstreckt sich auf die Kaufentscheidung, aber auch auf Konsummotive,<br />
-einstellungen sowie auf konsumrelevante Verhaltensweisen. Dabei steigert das<br />
Interesse eines Individuums an einer Produktkategorie dessen Bereitschaft zur persönlichen<br />
Einflussnahme auf die Kaufentscheidung anderer Marktteilnehmer (Childers<br />
1986). Halten wir uns erneut vor Augen, dass Bedürfnisinformationen auf eine<br />
Unzufriedenheit der Lead User zurückzuführen sind, so können diese Kunden auch<br />
die Eigenschaft besitzen, die man als Early-Adopter-Verhalten bezeichnet (Rogers<br />
138
1995; Ram / Jung 1994). Dies ist die Bereitschaft, bei Neueinführung eines Produktes im<br />
Vergleich zum sozialen Umfeld als “Pionier” aufzutreten. Der Pionierkäufer übernimmt<br />
diese Rolle in der Hoffnung, durch einen frühen Kauf einer Innovation seine<br />
Unzufriedenheit mit dem bisherigen Marktangebot zu beseitigen.<br />
Dieses Interesse eines Individuums an einer Produktkategorie wird häufig mit dem<br />
Begriff Involvement gleichgesetzt. Involvement kann als die auf den Informationserwerb<br />
und die Informationsverarbeitung gerichtete Aktiviertheit zu objektgerichteten<br />
Informationsprozessen definiert werden (Kroeber-Riel / Weinberg 1999; Zaichowsky<br />
1985). Differenziert wird zwischen High- und Low-Involvement-Produkten. Bei High-<br />
Involvement-Produkten handelt es sich häufig um teure Produkte oder Produkte, die<br />
sich der Konsument für eine lange Zeit anschafft. Das High-Involvement erklärt sich<br />
aus dem drohenden Risiko eines Fehlkaufs und des damit verbundenen finanziellen<br />
Verlusts. Der Preis eines Produktes ist jedoch nicht alleinig ausschlaggebend. High-<br />
Involvement-Produkte können auch solche Produkte darstellen, mit denen sich Kunden<br />
in speziellem Maße identifizieren bzw. Produkte, denen sie sich regelmäßig bedienen,<br />
um sich gegenüber ihrer sozialen Umwelt abzugrenzen. Für die Charakteristika<br />
innovativer Kunden heißt dies, dass diese eher dann zu finden sind, wenn ein Produkt<br />
auch ein High-Involvement-Produkt ist.<br />
Kognitive Komplexität<br />
Damit sich Kunden für eine Integration in Open Innovation eignen, stellt die kundenseitige<br />
Generierung innovationsrelevanter Bedürfnisinformationen ein notweniges,<br />
jedoch keinesfalls hinreichendes Kriterium dar. Vielmehr sollten Kunden neben<br />
Bedürfnisinformationen auch über Lösungsinformationen und -kompetenz verfügen<br />
und diese entsprechend nutzen und einbringen. Für ein Herstellerunternehmen stellt<br />
sich so die Frage, welche Merkmale und Eigenschaften der Kunden für die Entwicklung<br />
ausgeprägter Lösungsmechanismen verantwortlich sind. Wir argumentieren im<br />
Folgenden, dass Lead User über innovationsfördernde Persönlichkeitsmerkmale<br />
verfügen. Diese Persönlichkeitsmerkmale sorgen zum einen dafür, dass Kunden in<br />
der Lage sind, Bedürfnisinformationen zu generieren. Zum anderen jedoch befähigen<br />
diese Persönlichkeitsmerkmale einen Nutzer erst, Lösungsinformationen zu entwickeln<br />
und so ein Bedürfnis in ein konkretes Lösungsdesign zu überführen.<br />
Besondere Beachtung erfährt dabei die kognitive Komplexität eines Kunden. Bei statischer<br />
Betrachtung werden unter das Konstrukt der kognitiven Komplexität die<br />
Intelligenz und die Kreativität subsumiert. Bei der Operationalisierung der kognitiven<br />
Komplexität kann dabei auf einen in der Persönlichkeitstheorie (Digman 1997;<br />
John 1990) beschriebenen Faktor zurückgegriffen werden, der als relativ breites Maß<br />
die intellektuellen, kreativen und künstlerischen Neigungen, Vorlieben, und<br />
Fähigkeiten einer Person umfasst (McAdams 1992). Der Faktor bildet damit sowohl<br />
die Fähigkeit zum konvergenten als auch zum divergenten Denken eines Menschen<br />
ab (Buss 1996).<br />
Teamkompetenz<br />
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
In einer Wertschöpfungspartnerschaft zwischen einem Unternehmen und seinen<br />
(potenziellen) Kunden bildet die Teamkompetenz von Nutzern ein weiteres wichtiges<br />
139<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Persönlichkeitsmerkmal (Belbin 1993). Unter einem Team werden zwei oder mehr<br />
Personen verstanden, die über eine gewisse Zeit eine partnerschaftliche Beziehung eingehen,<br />
so dass jede Person die anderen Personen beeinflusst und von ihnen beeinflusst<br />
wird, und so ein gemeinsames Ziel und eine Gruppenstruktur mit Rollen und Normen<br />
entsteht. Der Erfolg eines solchen Arbeitsteams hängt dann entscheiden von der<br />
Teamkompetenz der einzelnen Mitglieder ab. Dabei beinhaltet die Teamkompetenz<br />
unter anderem die Konflikt- und Kooperationsfähigkeit, das Interesse an Neuem,<br />
Flexibilität, Selbständigkeit sowie Lernbereitschaft und Gewissenhaftigkeit (Hertel /<br />
Geister / Konradt 2005).<br />
Nutzen von Open Innovation aus Sicht von Lead Usern<br />
Im letzten Abschnitt haben wir mögliche Eigenschaften von Lead Usern diskutiert,<br />
welche diese für eine Integration in den Innovationsprozess einer Unternehmung qualifizieren<br />
(Innovationsfähigkeit). Das zweite wichtige Merkmal dieser Nutzer ist<br />
jedoch ihre Motivation oder Innovationsbereitschaft. Nur wenn Lead User ausreichend<br />
motiviert sind, sich in den Innovationsprozess zu integrieren, kann eine<br />
Unternehmung das innovative Potenzial dieser Kunden vollständig nutzen.<br />
Motivation von Lead Usern erklärt Art, Umfang und Häufigkeit ihrer Beiträge zu<br />
Innovationsaktivitäten eines Herstellers. Motivation begründet menschliches<br />
Verhalten in seiner Art, Ausdauer und Intensität. Nach von Rosenstiel (1980) entsteht<br />
Motivation, wenn in konkreten Situationen durch wahrgenommene Anreize verschiedene<br />
Motive aktiviert werden, die in ihrer Struktur und Stärke des Zusammenwirkens<br />
zu einem bestimmten Verhalten führen. Motivation entsteht als Wechselwirkung von<br />
inneren Bedürfnissen (Motiven) und von äußeren, situativen Faktoren (Anreizen). Ein<br />
Motiv ist ein isolierter Beweggrund menschlichen Verhaltens und wird als Erwartung<br />
erlebt, dass ein bestimmtes Verhalten zur Befriedigung eines Bedürfnisses, Wunsches,<br />
Dranges etc. führt (das Vorhandensein eines oder mehrerer Motive allein genügt<br />
jedoch oft nicht, um die Beteiligung von Kunden an Innovationsaktivitäten zu erklären,<br />
es müssen noch weitere Eigenschaften hinzutreten, die sie befähigen, diese<br />
Aktivitäten auch auszuführen).<br />
Kasten 3–8 nennt anhand des Beispiels zweier Amateur-Erfinder die Motive von<br />
Nutzern, die selbst zu Problemlösern werden. Der Artikel gibt auch noch einmal einen<br />
guten Einblick in die neue unterstützende Infrastruktur, die heute Kundenentwicklern<br />
zur Verfügung steht. Aus übergeordneter Sicht können wir folgende Klassen von<br />
Motiven bzw. Nutzenerwartungen fortschrittlicher Nutzer unterscheiden (siehe Ihl et<br />
al. 2006; <strong>Reichwald</strong> / Seifert / Ihl 2004; <strong>Piller</strong> 2006a), die in den nächsten Abschnitten<br />
näher betrachtet werden:<br />
Unzufriedenheit mit bestehenden Lösungen und Erwartung eines besseren Fits<br />
zwischen Produkteigenschaften und Kundenbedürfnissen,<br />
Erfolgreiche Absolvierung einer lohnenswerten Aufgabe und Stolz auf das<br />
Ergebnis,<br />
Reduktion von Unsicherheit,<br />
Soziale Bestätigung und externe Anerkennung.<br />
140
Kasten 3–8: Motives and Tools of Do-It-Yourself Inventors<br />
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
(Quelle: Auszug aus dem Beitrag “The amazing rise of the do-it-yourself economy” von Daniel<br />
Roth in der Zeitschrift Fortune (Europe), Nr. 9 / 2005 vom 30. Mai 2005: 24-35)<br />
(...) Pat Misterovich is just producing the next great MP3 music player. Only instead of the simple,<br />
elegant lines of the iPod, Misterovich’s device will look just like a Pez dispenser. Oh, and instead<br />
of working from a corporate campus in Cupertino, Calif., with nearly 12,000 employees,<br />
Misterovich is a stay-at-home dad, creating his Pez MP3 player from the basement of his<br />
Springfield, Mo., home.<br />
Misterovich is the former head of IT at the University of Detroit Mercy. He has few of the engineering<br />
skills necessary to build a device like this, no marketing experience, and absolutely no corporate<br />
infrastructure. And yet he’s got two factories—one in China, one in the U.S.-vying to build the<br />
player. He has a small Austin company started by an ex-Apple engineer designing the innards. And<br />
on his blog, pezmp3.com, he uses prospective buyers - some 1,500 people have already expressed<br />
interest—as an R&D-center-meets-focus-group. What’s better, he asks, AAA batteries or Li-<br />
Ion? In come dozens of replies (“Go for the AAA with a USB NiMh recharger if possible,” suggests<br />
one reader). What’s a good slogan? Some 50 ideas roll in (one of the best: “Candy for your ears”).<br />
By the end of this month the first prototype should be in Misterovich’s hands. “I don’t know that this<br />
product could have come to life years ago,” he says. “I seriously doubt it. And if it did, it wouldn’t<br />
have come through a guy in his basement.”<br />
It used to be that a tinkerer like Misterovich could, at best, hope to sell his idea to a big company.<br />
More likely, he’d entertain friends with his Pez-sized visions. But a number of factors are coming<br />
together to empower amateurs in a way never before possible, blurring the lines between those<br />
who make and those who take. Unlike the dot-com fortune hunters of the late 1990s, these do-ityourselfers<br />
aren’t deluding themselves with oversized visions of what they might achieve. Instead,<br />
they’re simply finding a way – in this mass-produced, Wal-Mart world – to take power back, prove<br />
that they can make the products that they want to consume, have fun doing so, and, just maybe,<br />
make a few dollars. “What’s happened is a tremendous change in awareness,” says Eric von<br />
Hippel, a professor at the MIT Sloan School of Management and author of the recent<br />
Democratizing Innovation. “Conventional wisdom is so strong [in business] about find-a-need-andfill-it:<br />
‘We’re the manufacturers; we design products; we ask users what they need; we do it.’ That<br />
has begun to crack.”<br />
(...) “Before, only the rich had access to tools and so only the rich were professionals, and the rest<br />
were amateurs,” says Noah Glass, the co-founder of Odeo, which offers a free service for making,<br />
hosting, and distributing podcasts. “But now, as the creation tools have become easier to use and<br />
more freely distributed through open source, through the Internet, through awareness, more people<br />
have more access to more tools, so the whole amateur-professional dichotomy is dissolving.”<br />
Citizen engineers are taking this even further, trying their hand not just in the digital world but in<br />
the physical world too. Much as eBay transformed distribution, they’re redefining design and manufacture.<br />
The infrastructure is there: Yahoo Groups make it easier for people to trade ideas and<br />
learn quickly; free or cheap computer-aided-design (CAD) programs allow users to cobble together<br />
blueprints; and inexpensive manufacturing in China allows the idea to go from file to factory.<br />
There are even websites like Alibaba.com that will help these small-timers find Chinese factories<br />
eager for their work, meaning that the amateur nation has its own Match.com.<br />
This may seem like a lot of effort to, say, create a funny-looking MP3 player. But that’s not this<br />
group’s ethos. “DIYers do things for irrational reasons,” says Saul Griffith. “If it’s your passion and<br />
your love, you don’t count how many hours you spend doing it. That’s why so many of these things<br />
end up being great.”<br />
141<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Griffith should know. A dedicated kite-surfer – the sport involves riding a small board through water<br />
while attached to a parachute-like “kite” – he was unhappy with the goods on the market. In 2001<br />
he started Zeroprestige.com, a website where he posted his kite designs. Soon other amateurs<br />
submitted their own concepts, and sail manufacturers with excess capacity offered to make kites<br />
from the plans. The amateur designers kept coming back to make exactly what they wanted to buy.<br />
And though no one got rich, a few small businesses popped up to sell the finished products. Since<br />
then, kites have become commodities, but Griffith hasn’t let go of the spirit. His four-person engineering<br />
company, Squid Labs, is launching a site this summer tentatively called iFabricate, “a<br />
Wikipedia for atoms,” he says, referring to the user-created online encyclopedia. Do-it-yourselfers<br />
of all stripes will be able to go to the site to trade ideas and work together, get easy access to programs<br />
for manipulating materials, and eventually use it to pool their resources for buying raw materials<br />
from suppliers.<br />
(...) To be fair, all this amateur energy isn’t exactly a new force. When exciting technologies emerge,<br />
Americans have always pounced and created something original. In his 1936 New Yorker article<br />
“Farewell, My Lovely,” E.B. White eulogized the Model T and the creativity it inspired in its<br />
owners: “When you bought a Ford, you figured you had a start -a vibrant, spirited framework to<br />
which could be screwed an almost limitless assortment of decorative and functional hardware....<br />
Gadget bred gadget. Owners not only bought ready-made gadgets, they invented gadgets to meet<br />
special needs.” The difference today is simply the technology, says University of Virginia technology<br />
historian Bernie Carlson.<br />
And so Misterovich keeps at his goal of building the kind of MP3 player that he wants to carry<br />
around. One with a collectible head and AAA batteries and a user-created slogan. And even if he<br />
pulls it off, it’s doubtful that he’ll get rich. That’s fine with him. The purpose in the amateur economy<br />
isn’t always the same as in the big-company economy. “My main goal is not to lose my house,”<br />
he says. “You put it on the line and you want to be rewarded. But when it comes down to it, I just<br />
don’t want to go broke. It’s an amateur attitude -you’re doing it for the love.”<br />
3.3.2 Unzufriedenheit mit bestehenden Lösungen<br />
und Erwartung eines besseren Fit zwischen<br />
Produkteigenschaften und Kundenbedürfnissen<br />
Kunden erhalten einen Nutzen durch ihre Mitwirkung bei den Innovationsaktivitäten<br />
eines Herstellers, wenn die hieraus resultierenden innovativen Produkte latente<br />
Bedürfnisse besser und präziser erfüllen können als die vorherigen Produkte dieses<br />
Herstellers oder die vorhandenen Produkte der Konkurrenz. Dieser Zuwachs entspricht<br />
dem Wert einer besser passenden Leistung im Vergleich zur nächst Besten bereits<br />
existierenden Lösung und ist eine typische extrinsische Motivation. Extrinsische<br />
Motive sind Motive der Tätigkeit, die durch Folgen der Tätigkeit und ihrer<br />
Begleitumstände befriedigt werden. Ein wesentliches extrinsisches Motiv liegt in der<br />
Erwartung der Kunden, eine Produkt- oder Dienstleistungsinnovation selbst nutzen zu<br />
können (Morrison / Roberts / von Hippel 2000).<br />
Erfüllung eines bislang unbefriedigten Bedürfnisses<br />
Die Literatur zur Präferenzbildung von Nachfragern diskutiert bereits seit<br />
Jahrzehnten, dass die Zahlungsbereitschaft und Produktzufriedenheit von Kunden<br />
vom Fit der Produkteigenschaften mit den Präferenzen der Nutzer abhängt<br />
142
(Chamberlin 1950, 1962; Lancaster 1966). Diesen Zusammenhang zeigen auch viele der<br />
empirischen Arbeiten zu den Anreizen für Nutzer, selbst innovativ tätig zu werden:<br />
Als eines der Hauptargumente wird immer wieder die Erfüllung eines bislang unbefriedigten<br />
Bedürfnisses genannt. Dies ist z. B. für die Beteiligung von Nutzern an der<br />
Entwicklung von Open-Source-Softwareprodukten sehr gut dokumentiert (Lakhani /<br />
Wolf 2005). Viele Open-Source-Projekte werden von Nutzern initiiert, die ein Bedürfnis<br />
an eine bestimmte Software haben, das in einer bestimmten Qualität (z. B. in Hinblick<br />
auf Sicherheitseigenschaften) oder für einen bestimmten Anwendungsbereich nicht<br />
erfüllt wird (<strong>Frank</strong>e / von Hippel 2003; Hars / Ou 2002; Lakhani / Wolf 2005). Gleiches<br />
gilt für Nutzerinnovationen im Industriegüterbereich, wo das dominierende Motiv ein<br />
neues Anwendungsbedürfnis eines Nutzers ist, welches die bestehenden Hersteller<br />
noch nicht erfüllen (Morrison / Roberts / von Hippel 2000; Ogawa 1998). Doch auch im<br />
Konsumgüterbereich kann Nutzer-Innovation oftmals auf ein Bedürfnis zurückgeführt<br />
werden, das der Markt noch nicht erfüllt (<strong>Frank</strong>e / Shah 2003; Lüthje 2004; Lüthje /<br />
Herstatt / von Hippel 2005; <strong>Piller</strong> 2004).<br />
“Low-cost user innovation niches”<br />
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
Wir haben bereits oben in Abschnitt 2.4.3.3 und 3.2.1 argumentiert, dass das “sticky<br />
Information”-Phänomen oft verhindert, dass ein Hersteller selbst die (neuen)<br />
Bedürfnisse erkennt und in ein passendes Produkt überführt. Die Folge sind<br />
Informationsasymmetrien zwischen Nutzern und Herstellern. Hat ein Hersteller die<br />
Vermutung, dass sich die Informationsasymmetrie auf ein großes Marktsegment<br />
bezieht, wird er in der Regel auch größere Anstrengungen und Kosten in Kauf nehmen,<br />
um Zugang zu den fehlenden Informationen zu erlangen. Bezieht sich die<br />
Informationsasymmetrie allerdings auf Gebiete, die durch relative kleine Nutzerzahlen<br />
geprägt sind, scheut der Hersteller oft, Zugriff auf die „sticky” Information zu<br />
bekommen und versucht, diese Nischen auch weiterhin mit einem existierenden<br />
Standardprodukt zu bedienen, anstatt für sie ein genau passendes Produkt zu entwikkeln.<br />
In solch einer Situation existieren so genannte “effiziente Nischen für<br />
Kundeninnovation” (“low-cost user innovation niches”, von Hippel 2005: 75). Diese<br />
Nischen sind oft recht klein und adressieren eine spezifische Lösung, die nur von einer<br />
kleinen Nutzerzahl besonders honoriert wird. Die Lösung beruht in diesem Fall auf<br />
hochspezifischer Bedürfnis- und Lösungsinformation, geprägt durch die Erfahrungen,<br />
Einsatzbedingungen und Umgebungsbedingungen der Nutzer in dieser Nische. In<br />
solch einer Situation hat ein potentieller Nutzer große Anreize, selbst innovativ tätig zu<br />
werden.<br />
Ein gutes Beispiel für eine solche Nische ist die zunehmende Verbreitung mobiler<br />
Geräte der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation, die meist eine<br />
Vernetzung und Synchronisation mit stationären Geräten verlangen (z. B. zur<br />
Abstimmung eines bestimmten Mobiltelefons mit einer bestimmten Zeitplanungssoftware).<br />
Aufgrund der Vielzahl an möglichen Schnittstellen, dem schnellen technischen<br />
Fortschritt und der teilweise relativ kleinen Zahl an Nutzern, die dieses Problem<br />
haben, widmen sich die etablierten Anbieter in der Regel diesem Bedürfnis nicht dezidiert.<br />
Bestimmte Nutzer allerdings, die neben dem Bedürfnis auch die notwendigen<br />
Kenntnisse haben, dieses Problem zu lösen, werden deshalb selbst aktiv. Dabei nutzen<br />
143<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
sie oft das Resultat nicht nur selbst, sondern stellen es entweder über eine Web-Site des<br />
Herstellers anderen Nutzern zur Verfügung, oder aber vertreiben die Lösung oft direkt<br />
im Internet.<br />
Kann ein Nutzer derart Eigenschaften eines Produktes genau an seine spezifischen<br />
Wünsche anpassen, sollte der wahrgenommene Nutzen steigen. Dieser Effekt ist umso<br />
größer, je heterogener sich die Wünsche der Kunden in Bezug auf die Produkteigenschaften<br />
verteilen, d. h. je schwieriger es für einen Hersteller ist, durch wenige<br />
Standardvarianten eines Produktes alle gewünschten Eigenschaftsbündel des angestrebten<br />
Marktsegments abzubilden. Dieser Zustand scheint heute in vielen Märkten<br />
immer mehr Norm als Ausnahme zu werden (siehe Abschnitt 2.2.3). Eine zunehmende<br />
Heterogenisierung der Bedürfnisse, einhergehend mit einer Verkürzung der<br />
Lebenszeiten einzelner Produktspezifikationen, ist einer der wesentlichen Faktoren,<br />
warum klassische Verfahren der Marktforschung im Rahmen der Neuproduktentwicklung<br />
immer schwieriger genaue Aussagen treffen können, ob ein Produktkonzept<br />
tatsächlich die Bedürfnisse der Nachfrager trifft. Damit steigt die Bedeutung<br />
der Kundenintegration in den Innovationsprozess. Der in Abschnitt 3.5.2 noch<br />
beschriebene Einsatz von Toolkits for User Innovation and Co-Design ist eine der<br />
zentralen Maßnahmen von Herstellern, auf diese Erkenntnis zu reagieren. Toolkits dienen<br />
in ihrem Kern genau zur Erfassung der “sticky” Bedürfnis-, aber auch zu<br />
Lösungsinformation einzelner Nutzer und der Überführung dieser Information in ein<br />
neues Produkt durch den Hersteller.<br />
Ebenso setzt die in Kapitel 4 beschriebene Mass-Customization-Strategie genau an<br />
dieser Stelle an: Bei Mass Customization reagiert ein Hersteller ebenfalls auf eine große<br />
Heterogenität der Bedürfnisse seiner Kunden, in dem er die Produktentwicklung nicht<br />
auf Ebene eines Endproduktes abschließt, sondern den möglichen Fit zwischen<br />
Produkteigenschaften und Bedürfnissen jedes individuellen Kunden dadurch erhöht,<br />
dass jeder Kunde (innerhalb eines gegebenen Lösungsraumes) eine Konkretisierung<br />
des Produktes vornehmen kann, das anschließend auf Bestellung gefertigt wird.<br />
3.3.3 Erfolgreiche Absolvierung einer lohnenswerten<br />
Aufgabe und Stolz auf das Ergebnis<br />
Die bisherige Argumentation bezog sich weitgehend auf die so genannte ergonomische<br />
Produktqualität, d. h. den funktionalen Nutzen eines Produkts. Doch Kundenintegration<br />
kann – für die integrierten aktiven Kunden bzw. Nutzer – auch die<br />
Wahrnehmung der hedonistischen Qualität eines Produkts beeinflussen. Beispiele<br />
sind der Neuheitswert, Status oder die Originalität einer Leistung. Kundenintegration<br />
in den Innovationsprozess kann vor allem in Konsumgütermärkten den Nutzen für<br />
den Kunden steigern, wenn Nutzerinnovatoren einem selbst entwickelten Produkt<br />
einen höheren emotionalen Wert zuschreiben oder aber soziale Anerkennung ihrer<br />
Umwelt erhoffen (Brockhoff 2003; Schreier 2004; Tepper / Bearden / Hunter 2001).<br />
Gleichermaßen kann auch der eigentliche Prozess der innovativen Lösungsfindung<br />
von den Nutzern als positiv wahrgenommen werden und so die Gesamtzufriedenheit<br />
144
steigern. Die Konsumentenforschung hat seit langem gezeigt, dass Kundenzufriedenheit<br />
nicht nur durch die Wahrnehmung des Kernprodukts und seiner<br />
Funktionalitäten beeinflusst wird, sondern auch durch Aktivitäten bei Auswahl, Kauf<br />
und Inbetriebnahme eines Gutes (Bitner 1992; Campbell 1997; Oliver 1993; Tanner<br />
1996). Dieser Bereich adressiert so genannte intrinsische Motive, die durch die<br />
Tätigkeit selbst befriedigt werden. Kunden beurteilen eine Innovationsaufgabe positiv,<br />
wenn sie das Gefühl von Spaß, Exploration und Kreativität vermittelt (Baumgartner /<br />
Steenkamp 1996).<br />
Prozesszufriedenheit: Das Flow-Konstrukt<br />
Der vielleicht wichtigste Faktor ist, dass der Prozess des Innovierens selbst als erfolgreich<br />
wahrgenommen wird. Diese Kompetenzfrage umfasst das Flow-Konstrukt, das<br />
heute von vielen Forschern genutzt wird, um die Zufriedenheit mit einem Prozess zu<br />
erklären (Csikszentmihalyi 1990; siehe auch Bowers / Martin / Luker 1990; <strong>Frank</strong>e /<br />
<strong>Piller</strong> 2003; Novak / Hoffmann / Yung 2000). Flow tritt ein, wenn die Nutzer einen<br />
Prozess als optimal wahrnehmen, da ihre Fähigkeiten mit dessen Anforderungen übereinstimmen.<br />
Dann erreichen sie einen “Flow”-Zustand, in dem sie sich von ihrer<br />
Umwelt lösen und von der Aufgabe fesseln lassen. Nutzer, die z. B. während der<br />
Interaktion mit einer Online-Shoping-Seite ein Flow-Erlebnis erfahren, tätigen eher<br />
einen Kaufabschluss (Novak / Hoffmann / Yung 2000). Auch steigert ein Flow-Erlebnis<br />
das Selbstvertrauen und gibt ein Gefühl von Selbstzufriedenheit (Bowers / Martin /<br />
Luker 1990; Michel 2000). Offe und Heinze (1990) zeigen, dass das Streben nach einer<br />
positiven Prozesswahrnehmung ein wesentlicher Treiber von Konsumenten ist, handwerklichen<br />
Tätigkeiten selbst nachzugehen (do-it-yourself). Hobbyisten geben neben<br />
dem Wert der selbst erstellten Lösung zur Bedürfnisbefriedigung immer auch die<br />
“Erlebnisqualität des Arbeitsvollzugs” als wesentliche Motivation für die Eigenarbeit<br />
an. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Forschung über die Motivation von Open-<br />
Source-Programmieren (Franck / Jungwirth 2003; Lakhani / Wolf 2005). Die<br />
Mitwirkung an einer Open-Source-Entwicklungsaufgabe kann als kreativer<br />
Problemlösungsvorgang angesehen werden, der anregend und befriedigend auf die<br />
Beteiligten wirkt. Anwender beurteilen eine Innovationsaufgabe positiv, wenn sie das<br />
Gefühl von Spaß, Exploration und Kreativität vermittelt. Damit sie die Beteiligung an<br />
Innovationsaktivitäten aber wertschätzen, ist es wichtig, dass sie einerseits der<br />
Aufgabe gewachsen sind und andererseits die Aufgabe auch als Herausforderung<br />
betrachten. Erhalten sie unmittelbare Rückkopplung über ihre Leistung, entsteht bei<br />
den innovativen Nutzern ein Gefühl der Selbstbestimmung, Kontrolle und Kompetenz<br />
(siehe zu entsprechenden Studien z. B. Ihl et al. 2006; Kamali / Loker 2002; Oon /<br />
Khalid 2003; Dellaert / Stremersch 2005; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004; Randall / Terwiesch /<br />
Ulrich 2005; Schreier 2004).<br />
“Pride-of-authorship”-Effekt<br />
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
In Bezug auf das Ergebnis könnte ferner ein “pride-of-authorship”-Effekt beobachtbar<br />
sein, d. h. die Zufriedenheit mit dem Ergebnis als Resultat eines eigenen Problemlösungsprozesses<br />
(Schreier 2004). Dieser Effekt ist im Bezug auf das Verhalten interner<br />
Produktentwickler beschrieben worden (Lea / Webley 1997) und ist auch im Do-ityourself-Bereich<br />
ein wesentliches Motiv (Michel 2000; Offe / Heinze 1990). Diese posi-<br />
145<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
tive Wahrnehmung könnte wiederum den wahrgenommenen Nutzen der Interaktion<br />
mit einem Hersteller steigen lassen. Auch dieser Effekt hängt stark von den<br />
Eigenschaften der Kunden ab. Sie müssen adäquate Fähigkeiten besitzen, die kreative<br />
Aufgabe zu bewältigen. Fehlen diese Eigenschaften, kann die Zufriedenheit aufgrund<br />
einer mangelhaften Prozesswahrnehmung sogar negativ beeinflusst werden.<br />
3.3.4 Reduktion von Unsicherheit<br />
Open Innovation kann weiterhin Unsicherheit bei den Kunden vermindern und ein<br />
Gefühl von Kontrolle vermitteln. Kontrolle und Sicherheit sind ein Leitmotiv in westlichen<br />
Gesellschaften und bestehen aus dem Streben nach Transparenz und Übersicht<br />
sowie Einflussmöglichkeit und Feedback (Fließ 2001; Gouthier 2003; Michel 2000).<br />
Kundenintegration in den Innovationsprozess kann die Unsicherheit aus Nutzersicht<br />
in mehrfacher Hinsicht vermindern und so zur Steigerung der Zufriedenheit mit einem<br />
Anbieter beitragen. So erlangen die Nutzer einen weitaus besseren Einblick in die<br />
Funktionsweise und Komponenten einer Lösung und gelangen deshalb zu einer realistischeren<br />
Einschätzung des Leistungspotenzials und der Grenzen eines Produktes<br />
(Anpassung der Erwartungskomponente). Dies gilt sowohl für autonom durch die<br />
Kunden initiierte Lösungsprozesse, die oft erst zu Anerkennung für die Komplexität<br />
einer Lösung durch den Hersteller führen, als auch für herstellerinitiierte Prozesse, bei<br />
denen z. B. ein Innovation-Toolkit als Instrument dient, Kunden an die Bestandteile<br />
und Zusammenhänge einer Leistung heranzuführen. Ebenso erlaubt das im Rahmen<br />
des Innovationsprozess bei den Nutzern gebildete Produktwissen, Erfüllungsprozesse<br />
des Herstellers besser zu überwachen und zu beobachten (Nambisan 2002). Im<br />
Resultat sollte die wahrgenommene Sicherheit der Nutzer in Bezug auf Produkt und<br />
Anbieterverhalten zunehmen.<br />
3.3.5 Soziale Bestätigung und externe Anerkennung<br />
Schließlich kann Open Innovation auch Nutzen durch soziale Bestätigung hervorrufen.<br />
Soziale Faktoren spielen eine Rolle, wenn menschliches Handeln durch andere beeinflusst<br />
ist bzw. auf andere Personen Einfluss nimmt (<strong>Reichwald</strong> / Seifert / Ihl 2004).<br />
Gerade in einem Umfeld, in dem das Engagement eines Kunden in Innovationsaktivitäten<br />
für andere Marktteilnehmer sichtbar ist, treten eine Reihe sozial-psychologischer<br />
Motive hinzu. Dies zeigen nicht zuletzt Erfahrungen der Open-Source-<br />
Software-Entwicklung, bei der eine unüberschaubare Zahl von Entwicklern ihre<br />
Aktivitäten gegenseitig “beobachtet” und bewertet (Franck / Jungwirth 2003; Hars / Ou<br />
2002; Lakhani / Wolf 2005). Eine internetbasierte Kundenintegration bietet auch in vielen<br />
anderen Produktbereichen die Möglichkeit, eine große Anzahl von Kunden mit<br />
verhältnismäßig geringem Aufwand zu vereinen. Das soziale “Moment” solcher<br />
Communities kann unter Umständen die Innovationsbereitschaft der Kunden steigern,<br />
indem Kunden sich gegenseitig bei Innovationsaufgaben unterstützen oder diese<br />
gemeinsam ausführen (<strong>Piller</strong> et al. 2005). Kunden erwarten durch ihr Engagement in<br />
146
Die Kundenperspektive: Beteiligung an Open Innovation<br />
Interaktion mit anderen Kunden unter Umständen Anerkennung oder entsprechende<br />
Gegenleistungen für geleistete Hilfestellung (Butler et al. 2002). Die Erwartung von<br />
Anerkennung und Reziprozität wird in ökonomischen Betrachtungen oft als extrinsisches<br />
Motiv betrachtet (Harhoff / Henkel / von Hippel 2003). In einer sozialen Betrachtung<br />
findet dieser Austausch zwischen Kunden auch aufgrund des symbolischen<br />
Wertes ihres Verhaltens und sozialer Normerfüllung wie Altruismus statt (Belk / Coon<br />
1993; Ekeh 1974; Ozinga 1999). Die Interaktion zwischen Kunden entsteht aus<br />
Vertrauen und der moralischen Verpflichtung heraus, einander zu helfen, unter<br />
Umständen auch ohne unmittelbar eine Gegenleistung zu erwarten (Haas / Deseran<br />
1981). Ihre Wertschätzung kann auch im Knüpfen sozialer Kontakte mit Gleichgesinnten<br />
liegen oder in der Möglichkeit, auf ihre Umwelt Einfluss zu nehmen<br />
(Bandura 1995; Kollock / Smith 1999). Idealerweise passen die Ziele und Werte der<br />
Gemeinschaft in das eigene Wertesystem der Nutzer und sind mit den Zielen des<br />
Herstellers vereinbar. Erfahren innovative Kunden durch ihre Mitwirkung am<br />
Innovationsprozess eine positive soziale Rückkopplung, kann ihre Zufriedenheit mit<br />
dem Gesamtprozess steigen. Insgesamt aber zeigen aktuelle Studien, dass soziale<br />
Motive zwar ein wichtiger Antriebsfaktor für Kunden sind, sich an einem<br />
Innovationsprozess zu beteiligen, als alleiniges Motiv jedoch nicht ausreichen, ihre<br />
Beteiligung und eine Steigerung der Zufriedenheit zu erklären. Soziale Faktoren können<br />
im Zusammenhang mit unserer Argumentation vor allem als moderierender<br />
Faktor gesehen werden, der andere Zufriedenheitstreiber verstärkt.<br />
Soziale Motive können auch als extrinische Motivation gesehen werden. Dies gilt vor<br />
allem, wenn die Motivation nicht nur reine Anerkennung und Bestätigung durch andere<br />
Nutzer ist, sondern vielmehr die Hoffnung, dass die Anerkennung der eigenen<br />
Innovationstätigkeit auch monetäre Gegenleistungen bringt. Hierzu zählen beispielsweise<br />
monetäre Anreize, Rabatte, Bonusprogramme, Gratisprodukte oder freiwillige<br />
Zahlungen des Herstellerunternehmens (Brockhoff 2003). Ferner können Kunden längerfristig<br />
auf Karriereperspektiven in dem jeweiligen Unternehmen abzielen, indem<br />
sie durch ihre Teilnahme an Innovationsaktivitäten Zusatzkompetenzen erwerben<br />
oder sie die Unternehmen durch außerordentliches Engagement auf sich aufmerksam<br />
machen (Hirschleifer 1971; Lerner / Tirole 2002; Raymond 1999; von Hippel 2005).<br />
3.3.6 Kosten der Beteiligung am Innovationsprozess aus<br />
Sicht der Nutzer<br />
Neben den Nutzenerwartungen als Motive beziehen Kunden aber auch erwartete<br />
Kostenaspekte in ihre Entscheidung ein, an Innovationsprozessen mitzuwirken. In<br />
einer ökonomischen Betrachtung entstehen in Innovationskooperationen zwischen<br />
Kunden und Anbietern Transaktionskosten für beide Parteien. Neben der<br />
Koordination der Kooperation können bspw. für den Kunden prohibitive Kosten entstehen,<br />
um die exklusive Nutzung der Innovation sicherzustellen. Dies kann z. B. in<br />
Investitionsgütermärkten von Interesse sein, wenn es darum geht, Konkurrenten von<br />
einer Innovation auszuschließen (Harhoff / Henkel / von Hippel 2003). Im Folgenden<br />
sollen Transaktionskosten des Interaktionsprozesses aus Kundensicht behandelt wer-<br />
147<br />
3.3
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
den. Dabei wird der Begriff Kosten unter verhaltensrelevanten Aspekten verwendet.<br />
Aus Kundensicht werden der Zeiteinsatz und der Aufwand für die Beteiligung am<br />
Innovationsprozess als (nicht monetäre) Kosten wahrgenommen.<br />
Interaktionskosten<br />
Das Anliegen von Kunden, Zeit und Aufwand zu minimieren, ist seit langem bekannt<br />
(Anderson 1972). Sie honorieren einen Zeitgewinn durch erhöhte Zahlungsbereitschaft<br />
oder entscheiden sich in bestimmten Situationen gegen eine Kaufhandlung, wenn der<br />
zu investierende kognitive Aufwand zu groß erscheint (Simon 1976). Besonders wenn<br />
Kunden mehr auf das Resultat einer Aktivität abzielen als auf die Aktivität selber,<br />
legen sie Wert auf eine effiziente Durchführbarkeit ohne zusätzliche Barrieren (Babin /<br />
Darden / Griffin 1994). Beiträge über Bequemlichkeit und das Management zeitlicher<br />
Ressourcen implizieren, dass Kunden den Zeiteinsatz und Aufwand generell als<br />
(nicht-monetäre) Kosten wahrnehmen. Beiträge zum Innovationsprozess sind umso<br />
attraktiver, je geringer der Zeiteinsatz und der -aufwand für den Kunden als wahrgenommene<br />
Kosten ausfallen. Dementsprechend müssen Unternehmen nicht nur<br />
Kaufprozesse, sondern auch einen interaktiven Innovationsprozess bequem und einfach<br />
gestalten (Berry / Seiders / Grewal 2002) oder den Komplexitätsgrad der Aufgabe<br />
an den jeweiligen Kunden anpassen. Sind die Interaktionskosten aus Kundensicht zu<br />
hoch, entscheiden sich Kunden gegen eine Beteiligung am Innovationsvorhaben (Hui /<br />
Bateson 1991).<br />
Psychologische Kosten<br />
Neben Interaktionskosten können Kunden psychologische Kosten entstehen. Während<br />
Interaktionskosten (Zeit und Aufwand) Gegenstand rationaler Überlegungen sind, entstehen<br />
psychologische Kosten vor dem Hintergrund emotionaler Abwägung von<br />
Unsicherheiten (Baker et al. 2002). Die Unsicherheit, ob das eigene Engagement im<br />
Innovationsprozess auch zum Ergebnis führt und damit zum erwarteten Nutzen des<br />
Kunden bildet ein Beispiel für die Verursachung psychologischer Kosten.<br />
Psychologische Kosten haben ihren Ursprung im wahrgenommenen Risiko, das als<br />
Verlusterwartung des Kunden definiert werden kann (Stone / Grønhaug 1993). Kaplan,<br />
Szybillo und Jacoby (1974) nennen unterschiedliche Komponenten von Unsicherheiten<br />
bzw. Risiken, die auf die Innovationsentscheidung übertragen werden können: die<br />
Befürchtung nicht gezahlter Aufwandsentschädigungen durch das Unternehmen<br />
(finanzielles Risiko), keinen Innovationsbeitrag leisten zu können (Leistungsrisiko), bei<br />
Produkttests verletzt zu werden (physisches Risiko), sich zu blamieren (soziales<br />
Risiko), Zeit zu verschwenden (Zeitrisiko) sowie schließlich das Risiko psychologischer<br />
Unannehmlichkeiten wie Stress. Die kognitiven Kosten, die aus dem wahrgenommenen<br />
Risiko des Scheiterns resultieren, beeinflussen ebenso wie die Interaktionskosten<br />
die Entscheidung des Kunden über die Teilnahme am Innovationsprozess.<br />
Zusammenfassung<br />
Nicht alle Kunden eines Unternehmens eignen sich gleichermaßen für eine aktive<br />
Beteiligung an Open Innovation. Vielmehr konzentriert sich diese Eignung auf ein ausgewähltes<br />
Kundensegment. Diese Kunden werden als Lead User bezeichnet. Lead<br />
User sind mit dem bestehenden Marktangebot – trotz Early-Adopter-Verhaltens –<br />
148
Die Unternehmensperspektive – Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation<br />
unzufrieden und leiten auf Basis ihrer Konsumkompetenz innovationsrelevante<br />
Bedürfnisinformationen ab. Des Weiteren agieren Lead User im Markt als Meinungsführer<br />
und der Produktbereich ist für sie von zentraler Bedeutung. Ihre kognitive<br />
Komplexität erlaubt es Lead Usern zudem, Lösungsinformationen für ihre Bedürfnisse<br />
zu entwickeln. Die Art, Ausdauer und Intensität der Beteiligung eines Lead Users an<br />
Open Innovation wird durch dessen wahrgenommenen Gesamtnutzen bestimmt. In<br />
ihre Innovationsentscheidung beziehen Lead User sowohl Nutzenerwartungen (im<br />
Sinne verschiedener extrinsischer, intrinsischer und sozialer Motive) als auch<br />
Kostenerwartungen (Interaktionskosten, psychologische Kosten) ein. Jedoch erlauben<br />
heute IuK-unterstützte Methoden der interaktiven Wertschöpfung, den Kreis der<br />
aktiv in eine Phase des Innovationsprozesses eingebundenen Kunden stark zu erweitern.<br />
Methoden wie Innovationswettbewerbe oder Toolkits for User Innovation senken<br />
dabei aber nicht nur die Interaktionskosten aus Herstellersicht, sondern vor<br />
allem auch aus Sicht der Kunden und senken damit die “Einstiegskosten” der<br />
Interaktion.<br />
Kasten 3–9: Literaturempfehlungen zur Kundenperspektive<br />
Brockhoff, Klaus (2003). Customers’ perspectives of involvement in new product development.<br />
International Journal of Technology Management (IJTM), 26 (2003) 5 / 6: 464-481.<br />
Franck, Egon / Jungwirth, Carola (2003). Die Governance von Open-Source-Projekten.<br />
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 73 (2003) Ergänzungsheft 5: 1-21.<br />
Harhoff, Dietmar / Henkel, Joachim / von Hippel, Eric (2003). Profiting from voluntary information<br />
spillovers: how users benefit by freely revealing their innovations. Research Policy, 32<br />
(2003) 10: 1753-1769.<br />
Jacob, <strong>Frank</strong> (2003). Kundenintegrations-Kompetenz: Konzeptionalisierung, Operationalisierung<br />
und Erfolgswirkung. Marketing-Zeitschrift für Forschung und Praxis, 25 (2003) 2: 83-<br />
98.<br />
Lüthje, Christian (2004). Characteristics of innovating users in a consumer goods field: An<br />
empirical study of sport-related product consumers. Technovation, 24 (2004) 9: 683-695.<br />
von Hippel, Eric (1998). Economics of product development by users: the impact of “sticky”<br />
local information. Management Science, 44 (1998) 5: 629-644.<br />
3.4 Die Unternehmensperspektive –<br />
Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation<br />
Ein Herstellerunternehmen kann durch Open Innovation eine Vielzahl an Erfolgskennziffern<br />
des Innovationsprozesses verbessern (siehe Abbildung 3–11). Eine generische<br />
Gliederung unterscheidet in dieser Hinsicht unter (<strong>Piller</strong> 2004):<br />
Time-to-Market: Verkürzung des Zeitraums von Beginn der Entwicklung eines<br />
Produktes bis zu dessen Markteinführung.<br />
149<br />
3.4
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Cost-to-Market: Reduktion der im Rahmen eines Innovationsprozesses von Beginn<br />
der Planung eines Produktes bis zu dessen Markteinführung tatsächlich angefallenen<br />
und dem Produkt zurechenbaren Kosten.<br />
Fit-to-Market: Steigerung der Marktakzeptanz eines neuen Produktes im Sinne<br />
einer positiven Kaufeinstellung der Nachfrager (und damit Schaffung einer höheren<br />
Zahlungsbereitschaft).<br />
New-to-Market: Steigerung des durch die Nachfrager wahrgenommenen<br />
Neuigkeitsgrads einer Innovation und damit der Attraktivität des entsprechenden<br />
Produkts.<br />
Abbildung 3–11: Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation<br />
3.4.1 Reduzierung der Time-to-Market<br />
Time-to-Market beschreibt den Zeitraum von Beginn der Entwicklung eines Produktes<br />
bis zu dessen Markteinführung. Eine zeitbasierte Wettbewerbsstrategie “umfasst die<br />
bewusste Gestaltung der zeitlichen Dimension von Wertschöpfungsprozessen und<br />
intendiert den Aufbau von Fähigkeiten, die der Unternehmung erlauben, Neuprodukte<br />
im Vergleich zur Konkurrenz schneller zu entwickeln […] oder ganz allgemein<br />
einen sich auftuenden Marktbedarf möglichst schnell durch ein entsprechendes<br />
Marktangebot zu befriedigen” (Bitzer 1991). Die Reduzierung von Time-to-Market<br />
gewinnt durch sich stetig verkürzende Produktlebenszyklen an entscheidender<br />
Bedeutung. Unternehmen, die ihre Produkte vor der Konkurrenz im Markt einführen<br />
können, haben die Möglichkeit, rasch einen hohen Marktanteil und somit Markteintrittsbarrieren<br />
aufzubauen. Sie nutzen Erfahrungskurven- und Skaleneffekte sowie die<br />
erhöhte Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden in den frühen Phasen des Produktlebenszyklus.<br />
Des Weiteren fördert ein früher Markteintritt das Image eines Innovationsführers.<br />
Die Reduktion von Entwicklungszeiten durch Open Innovation basiert auf den<br />
Prinzipien und Vorteilen der Arbeitsteilung (Picot / <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). Dabei<br />
werden insbesondere diejenigen Innovationsaktivitäten von Kunden getragen, die<br />
150<br />
Fit-to-Market New-to-Market<br />
Wettbewerbsvorteile<br />
durch<br />
Open Innovation<br />
Time-to-Market Cost-to-Market
Die Unternehmensperspektive – Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation<br />
implizites (lokales) Kundenwissen benötigen. Auf diese Weise können zeitraubende<br />
Iterationen zwischen einem Hersteller und dessen potenziellen Kunden vermieden<br />
werden. Im traditionellen Innovationsprozess durchläuft eine Innovationsidee bis zu<br />
ihrer Marktreife zahlreiche Feedback-Schleifen zwischen einem Hersteller und dessen<br />
potenziellen Kunden. Durch eine Iteration zwischen Variation und Kombination zulässiger<br />
Lösungsmöglichkeiten auf der einen und der Beurteilung dieser Möglichkeiten<br />
(oft auf Basis von Prototypen) durch den Markt und/oder interne Stellen im<br />
Unternehmen (Produktmanagement, Vertrieb, Marketing) auf der anderen Seite nähert<br />
sich ein Hersteller den tatsächlichen (erwarteten) Bedürfnissen seiner (künftigen)<br />
Kunden an (Tyre / von Hippel 1997).<br />
Ein solches iteratives Vorgehen ist mit erheblichem zeitlichen Aufwand verbunden –<br />
und das ohne dabei die Garantie zu geben, tatsächlich in einer erfolgreichen<br />
Markteinführung zu enden. Open Innovation setzt dagegen an der Idee an, die Suche<br />
nach einem geeigneten Lösungsdesign auf die Kunden zu übertragen. Dabei wird ein<br />
iterativer Trial-and-Error-Prozess in der Domäne der Kunden angestoßen, bis diese<br />
sich selbst ihrer individuellen optimalen Problemlösung angenähert haben. Eine zeitraubende<br />
Kunden-Hersteller-Iteration wird dagegen vermieden. Besonders die<br />
Nutzung von Innovation-Communities und der Einsatz von Toolkits for User Innovation<br />
basieren auf diesem Prinzip. Dabei können die unterschiedlichsten Innovationsaufgaben<br />
an Anwender ausgelagert werden. Diese reichen von der Generierung<br />
neuer Innovationsideen über erste Lösungskonzepte bis hin zur Entwicklung voll<br />
funktionsfähiger Prototypen. Im Ergebnis führt diese Arbeitsteilung und Spezialisierung<br />
zu einer Zeitersparnis im Innovationsprozess des Herstellers.<br />
3.4.2 Reduzierung der Cost-to-Market<br />
Cost-to-Market bezeichnet die im Rahmen eines Innovationsprozesses von Beginn der<br />
Planung eines Produktes bis zu dessen Markteinführung tatsächlich angefallenen und<br />
dem Produkt zurechenbaren Kosten. Insbesondere im Rahmen zunehmend globaler<br />
Märkte kommt dem Kostenfaktor der Produktentwicklung eine kritische Bedeutung<br />
zu. Ceteris paribus steigert eine Senkung der Kosten für Forschung und Entwicklung<br />
eines Produktes dessen Rentabilität und sichert das langfristige Wachstum einer<br />
Unternehmung (Hauschildt 2004). Bei der Reduzierung von Forschungs- und<br />
Entwicklungskosten leistet Open Innovation einen entscheidenden Beitrag, da die<br />
Auslagerung definierter Innovationsaktivitäten eines Unternehmens an ausgewählte<br />
Kunden nicht nur zu einer Zeit-, sondern auch einer Kostenersparnis führt. Dies ist<br />
besonders dann der Fall, wenn Kunden Innovationsaktivitäten tragen, die über eine<br />
reine Ideengenerierung hinausgehen und Investitionen in entsprechende Ressourcen<br />
erfordern (z. B. Eigenentwicklung eines ersten Prototyps).<br />
In der Phase der Markteinführung kommt ausgewählten Kunden eines Unternehmens<br />
noch eine weitere Bedeutung zur Senkung der Cost-to-Market zu, wenn diese<br />
im Markt als Meinungsführer auftreten. Meinungsführer üben innerhalb ihres sozialen<br />
Netzwerkes einen starken Einfluss auf andere aus und sind in der Lage, als<br />
151<br />
3.4
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Multiplikator im Markt zu agieren und so die Bekanntmachung des Produktes ohne<br />
finanzielle Motive zu forcieren (Flynn / Goldsmith / Eastman 1996; King / Summers<br />
1970).<br />
3.4.3 Steigerung des Fit-to-Market<br />
Fit-to-Market beschreibt die Marktakzeptanz eines neuen Produktes im Sinne einer<br />
positiven Kaufeinstellung der Nachfrager. Eine hohe Marktakzeptanz impliziert, dass<br />
eine Innovation geeignet ist, existierende Marktbedürfnisse zu befriedigen. In diesem<br />
Fall decken sich die Anforderungen eines Nachfragers an die Leistungsmerkmale eines<br />
Produktes (z. B. Technologie, Qualität, Performance, Preis) mit dem Leistungsangebot<br />
eines Herstellers (Diamantopoulos / Schlegelmilch / DuPreez 1995). Ein hoher Fit-to-<br />
Market bedeutet in der Regel auch, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für ein<br />
Produkt steigt (<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004). Damit ist Fit-to-Market Bestandteil einer Differenzierungsstrategie<br />
im Rahmen des marktorientierten Ansatzes (siehe Abschnitt 2.4.5).<br />
Ein hoher Fit-to-Market setzt voraus, dass Informationen über Bedürfnisse potenzieller<br />
Kunden (Bedürfnisinformationen) optimal mit Informationen hinsichtlich der<br />
Lösung und Umsetzung dieser Bedürfnisse in ein entsprechendes Leistungsangebot<br />
(Lösungsinformationen) verknüpft werden. Aus Sicht eines Herstellers verbessern sich<br />
die Chancen eines hohen Fit-to-Market, wenn die Qualität an Bedürfnisinformationen<br />
und/oder die Qualität an Lösungsinformationen zunimmt. Beides kann durch Open<br />
Innovation realisiert werden.<br />
Bedürfnisse eines einzelnen Nachfragers sind für ein Unternehmen besonders dann<br />
von entscheidungsrelevanter Bedeutung, wenn sie für ein attraktives Marktsegment<br />
der Zukunft repräsentativen Charakter haben. In diesem Fall verfügt der Nachfrager<br />
über ein Bedürfnis, welches für ein relativ großes Marktsegment ebenfalls an Relevanz<br />
gewinnt. Solche innovativen Bedürfnisse lassen sich durch traditionelle Methoden der<br />
Marktforschung jedoch nur unzureichend erheben. Marktforschung im traditionellen<br />
Innovationsprozess behandelt den Kunden als repräsentative, statistische Durchschnittsgröße.<br />
Durch den Einsatz reaktiver Marktforschungsinstrumente wird versucht,<br />
latente Kundenbedürfnisse zu erfassen und zu testen. Bedürfnisse des “Normalkunden”<br />
haben jedoch keinen Problemlösungscharakter im Sinne einer gezielten<br />
Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen.<br />
Open Innovation hingegen fokussiert die aktive Integration von Lead Usern in den<br />
Innovationsprozess. Wie wir bereits gesehen haben, verfügen Lead User über<br />
Bedürfnisse, die zeitlich nachgelagert für ein relativ großes Marktsegment an<br />
Bedeutung gewinnen. Informationen über Bedürfnisse von Lead Usern verbessern so<br />
die Qualität an Bedürfnisinformationen im Innovationsprozess eines Unternehmens.<br />
Deshalb kann der Hersteller die resultierende Innovation oft erfolgreich im<br />
Gesamtmarkt platzieren. So berichten Lilien et al. (2002), dass die Lead-User-Methodik<br />
bei der Firma 3M Produkte hervorgebracht hat, die sowohl radikaler auf neue<br />
Kundenbedürfnisse eingehen als auch finanziell deutlich erfolgreicher sind als Produkte,<br />
die das Resultat eines klassischen Entwicklungsprozesses aus Marktforschung<br />
152
Die Unternehmensperspektive – Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation<br />
und interner Entwicklung sind (siehe ähnlich Gruner / Homburg 2000; Kleinaltenkamp<br />
/ Dahlke 2001; Herstatt / von Hippel 1992; Lüthje / Herstatt / von Hippel 2005; Lüthje /<br />
Herstatt 2004; von Hippel / Thomke / Sonnack 1999). Die deutlich höheren Umsätze der<br />
Lead-User-Produkte im Verhältnis zu vergleichbaren, aber konventionell entwickelten<br />
Produkten lassen sich durch ihre höhere Marktattraktivität erklären, die auch mit einer<br />
höheren Kundenzufriedenheit durch einen besseren Fit zwischen Produkteigenschaften<br />
und Nutzerbedürfnis einhergehen sollte.<br />
Open Innovation trägt des Weiteren zu einer Verbesserung der Qualität an Lösungsinformationen<br />
im Innovationsprozess bei. Lösungsinformationen umfassen Informationen<br />
zur Transformation von Bedürfnisinformationen in ein konkretes Leistungsangebot.<br />
Im klassischen Innovationsprozess nutzen Unternehmen die Lösungsinformationen<br />
ihrer Experten aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wie in<br />
Abschnitt 3.2.1 aufgezeigt wurde, verfügen Lead User ebenfalls über Lösungskompetenz.<br />
Open Innovation macht sich dieses Phänomen zu Nutze. Der Kundenbeitrag<br />
zur Gesamtinnovation bewegt sich innerhalb eines Kontinuums und erstreckt<br />
sich von einer Bedarfserkennung über die Entwicklung erster konzeptioneller technischer<br />
Lösungen zur Befriedigung dieses Bedarfs bis hin zum Design und der Fertigung<br />
erster Quasi-Prototypen. Es kommt so zu einer Erweiterung der Spannbreite an Ideenund<br />
Lösungsfindungsinformationen (Katila / Ahuja 2002).<br />
3.4.4 Erhöhung des New-to-Market<br />
New-to-Market beschreibt den durch die Nachfrager wahrgenommenen Neuigkeitsgrad<br />
einer Innovation. Der traditionelle Innovationsprozess bringt regelmäßig inkrementelle<br />
Innovationen hervor. Solche Innovationen basieren auf vorhandenem<br />
Wissen, orientieren sich an bestehenden Problemlösungen und zeichnen sich aus Sicht<br />
des Nachfragers durch einen geringen Neuigkeitsgrad aus. Häufig handelt es sich um<br />
Weiterentwicklungen eines bestehenden Produktes oder um Modellpflegen (Christensen<br />
1997; Christensen / Overdorf 2000). Die Ursache für dieses Verhalten haben wir<br />
bereits beschrieben: Da Hersteller in der Regel eher Lösungsinformation in ihrer<br />
Domäne haben, setzen sie vor allem dieses Verfahrens- und Produktionswissen für den<br />
Innovationsprozess ein (Ogawa 1998,; Riggs / von Hippel 1994; Szulanski 2000).<br />
Nutzerinnovationen dagegen sind in der Regel eher funktional neue Innovationen, da<br />
sie eben an einem unbefriedigten Bedürfnis der Nutzer ansetzen. Die Nutzung von<br />
Bedürfnis- und Lösungsinformationen ausgewählter Kunden im Rahmen der Open<br />
Innovation unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationen, die über<br />
inkrementelle Verbesserungen hinausgehen (Riggs / von Hippel 1994). Kunden sind<br />
jedoch nicht nur in der Lage, bestehende Produkte eines Unternehmens durch neue<br />
Funktionalitäten zu verbessern. Vielmehr ist eine Reihe von Märkten speziell im<br />
Bereich der Sportindustrie erst durch Open Innovation entstanden. Kite-Surfing wurde<br />
beispielsweise von Surfern initiiert, die – getrieben von dem Wunsch nach immer höheren<br />
und weiteren Sprüngen – mit der Kombination eines Surfboards und eines Segels<br />
vom Drachenfliegen experimentierten (siehe oben Kasten 2–7). Auch die Wurzeln des<br />
153<br />
3.4
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Snowboards, Skateboards und Surfboards gehen auf die Bedürfnisse und Lösungen<br />
von Nutzern zurück und nicht auf Innovationslabors von Unternehmen (von Hippel<br />
2005). Diese Beispiele lassen die Vermutung zu, dass Lead User insbesondere auch<br />
radikale Innovationen hervorbringen.<br />
3.4.5. Kosten aus Sicht des Herstellers<br />
Neben den in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Vorteilen von Open<br />
Innovation sehen sich Hersteller regelmäßig mit einer Reihe von Kosten konfrontiert,<br />
die bei der Implementierung und operativen Umsetzung der Innovationsstrategie entstehen.<br />
Einer prozessorientierten Perspektive folgend können wir an dieser Stelle<br />
unterscheiden zwischen Kosten der Durchsetzung, Umsetzung und Kontrolle von<br />
Open Innovation.<br />
Kosten der Durchsetzung von Open Innovation sind Kosten innerbetrieblicher<br />
Organisation. Es handelt sich um finanzielle und zeitliche Aufwendungen, um Open<br />
Innovation als Innovationsstrategie innerhalb der Organisation zu verankern. Da<br />
Open Innovation eine substanzielle Abweichung von herkömmlichen<br />
Innovationsprozessen, im Sinne des manufacturer-active paradigms, darstellt, entstehen<br />
im Wesentlichen Kosten der innerbetrieblichen Kommunikation der<br />
Prinzipien von Open Innovation. Diese Kosten sind tendenziell umso höher, je ausgeprägter<br />
ein Hersteller die Ablauforganisation bisher auf einen geschlossenen<br />
Innovationsprozess hin ausrichtete. Zu den Kosten der Durchsetzung von Open<br />
Innovation zählen somit Kosten der Information sowie Kommunikationskosten zur<br />
Überwindung innerbetrieblicher Widerstände, insbesondere des not-invented-here-<br />
Syndroms.<br />
Kosten der Umsetzung von Open Innovation sind Kosten der Integration von<br />
Kunden in den Innovationsprozess. Einem Hersteller entstehen zunächst Kosten zum<br />
Aufbau geeigneter Infrastruktur, um Kundenwissen zu absorbieren. Hierbei kann es<br />
sich beispielsweise um Kosten für den Aufbau, die Pflege und Wartung virtueller<br />
Plattformen handeln, über welche der Hersteller mit seinen Kunden in Kontakt tritt.<br />
Einen weiteren Kostenblock bilden Kosten der Identifikation innovativer Kunden.<br />
Dieser umfasst Kosten zur Entwicklung eines validen und reliablen Identifikationsinstruments<br />
innovativer Kunden (z. B. durch Screening-Fragebögen oder virtuelle<br />
Börsen), Kosten der Kommunikation mit dem Kunden sowie Kosten zur Schaffung<br />
geeigneter Kunden-Anreizstrukturen. Schließlich entstehen einem Hersteller Kosten<br />
bei der operativen Integration von Kunden, beispielsweise bei der Durchführung von<br />
Innovationsworkshops im Rahmen der Lead User Methode.<br />
Kosten der Kontrolle von Open Innovation sind Kosten der Evaluation des<br />
Kundeninputs. So ist die Bewertung von Kundenbeiträgen regelmäßig mit hohem zeitlichem<br />
Aufwand verbunden (siehe hierzu die manuelle Auswertung von<br />
Kundenbeiträgen in virtuellen Communities, Abschnitt 3.5.4). Kosten der Evaluation<br />
entstehen weiterhin, um missbräuchliches Verhalten bestimmter Kunden zu verhin-<br />
154
dern bzw. frühzeitig zu erkennen. So ist es denkbar, dass Wettbewerber eines<br />
Herstellers sich als Kunden ausgeben, mit dem Ziel, den Hersteller zu nicht marktgerechten<br />
Aufwendungen – z. B. durch technologisch unrealisierbare Vorschläge (“perpetuum<br />
mobile-Erfindungen“) – zu veranlassen (Brockhoff 2005). Weiterhin besteht<br />
die Gefahr, dass Individuen die Hersteller-Kunden-Aktion durch gehäufte unqualifizierte<br />
Beiträge (i.S.v. Spam) bewusst zu stören versuchen. Kosten der Kontrolle umfassen<br />
demnach die Summe an Kosten, welche beim Aufbau geeigneter Prüfroutinen des<br />
Kundeninputs im Rahmen von Open Innovation entstehen.<br />
Konkrete Instrumente, mit denen Unternehmen die Vorteile und Kosten von Open<br />
Innovation erfassen, bewerten und steuern können, existieren noch nicht. Klassische<br />
Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung greifen an dieser Stelle aber zu kurz. Für<br />
die erfolgreiche Verbreitung der Gedanken von Open Innovation in der Wirtschaftspraxis<br />
sind aber Maßzahlen und Systeme zu ihrer Erfassung wichtige<br />
Voraussetzung. An dieser Stelle ergeben sich viele Aufgaben und Möglichkeiten für<br />
zukünftige Forschung und Beratung. Einen ersten Anhaltspunkt könnte die<br />
Diskussion um die Entwicklung zu Maßzahlen des Kundenwerts und des Erfolgs von<br />
Initiativen des Customer Relationship Management (CRM) sein.<br />
Kasten 3–10: Literaturempfehlungen zur Herstellerperspektive<br />
3.5 Instrumente von Open Innovation<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Bartl, Michael (2005). Virtuelle Kundenintegration in die Neuproduktentwicklung. Dissertation<br />
an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU), Koblenz, September<br />
2005.<br />
Henkel, Joachim / von Hippel, Eric (2005). Welfare implications of user innovation. Journal of<br />
Technology Transfer, 30 (2005) 1-2 (January): 73-88.<br />
Herstatt, Cornelius / Lüthje, Christian / Lettl, Christopher (2002). Wie fortschrittliche Kunden zu<br />
Innovationen stimulieren. Harvard Business Manager, 24 (2002) 1: 60-68.<br />
Krieger, Katrin (2005). Customer Relationship Management und Innovationserfolg: Eine theoretisch-konzeptionelle<br />
Fundierung und empirische Analyse. Wiesbaden: Gabler 2005.<br />
Lüthje, Christian (2000). Kundenorientierung im Innovationsprozess. Eine Untersuchung der<br />
Kunden-Hersteller-Interaktion in Konsumgütermärkten. Wiesbaden: Gabler 2000.<br />
Die vorangehenden Abschnitte dieses Kapitels haben argumentiert, dass es sich lohnt,<br />
konventionelle Innovationsprozesse zu öffnen und durch den Gedanken von Open<br />
Innovation zu ergänzen. Dazu wollen wir in diesem Abschnitt eine Reihe von<br />
Instrumenten vorstellen, die Open Innovation konkret umsetzen. Wir argumentieren<br />
dabei aus der Perspektive eines Herstellers, der aktiv einen Open-Innovation-Prozess<br />
anstoßen und gestalten will. Rein empirisch vollziehen sich bislang die meisten Fälle<br />
von Nutzerinnovation außerhalb der Domäne eines Herstellers, indem ein Lead User<br />
155<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
aus eigenem Antrieb eine innovative Lösung schafft, um ein offenes Bedürfnis zu stillen.<br />
Die vier Instrumente von Open Innovation, die wir im Folgenden vorstellen, haben<br />
teilweise zum Ziel, diese autonomen Lead-User-Innovationen zu entdecken und für<br />
das Unternehmen nutzbar zu machen. Sie zielen aber vor allem darauf ab, innovative<br />
Kunden im Sinne unserer Vision der interaktiven Wertschöpfung aktiv und zielgerichtet<br />
in den Innovationsprozess mit einzubeziehen und gemeinsam mit ihnen eine neue<br />
Problemlösung zu schaffen.<br />
Die Lead-User-Methode besteht auf der Identifikation innovativer Nutzer und<br />
deren Einbindung in Innovationsworkshops.<br />
Toolkits für Open Innovation sind ein internetgestütztes Instrument, das Nutzer<br />
unterstützen soll, selbst ihre Bedürfnisse in neue Produktkonzeptionen zu übertragen.<br />
Innovationswettbewerbe zielen auf die Generierung von Input für die frühen<br />
Phasen des Innovationsprozesses und fördern innovative Ideen durch einen<br />
Wettbewerb zwischen verschiedenen Nutzern.<br />
Communities für Open Innovation tragen der Tatsache Rechnung, dass<br />
Innovation meist das Ergebnis eines kollaborativen Zusammenarbeitens mehrerer<br />
Akteure ist und zielen auf die Bewertung, aber auch Generierung neuer Ideen in<br />
einer virtuellen Gemeinschaft.<br />
3.5.1 Die Lead-User-Methode<br />
Die Lead-User-Methode ist eine qualitative, prozessorientierte Vorgehensweise und<br />
zielt auf die aktive Einbindung ausgewählter Kunden, um mit diesen Ideen und Konzepte<br />
für neue Produkt- oder Prozessinnovationen zu generieren. Den Kern der<br />
Methode bilden so genannte Lead-User-Workshops, die das kreative Kundenpotenzial<br />
durch Nutzung gruppendynamischer Effekte zu Tage fördern. Idealtypisch lässt sich<br />
die Methode, wie in Abbildung 3–12 gezeigt, in vier Phasen strukturieren (Herstatt /<br />
von Hippel 1992; Lüthje / Herstatt 2004; Urban / von Hippel 1988; von Hippel 1986), die<br />
wir im Folgenden näher betrachten wollen.<br />
Die ersten beiden Schritte sind dabei eher allgemeiner Natur und typische grundlegende<br />
Aktivitäten vieler Projekte im Innovationsmanagement. Zentrale Phase ist die<br />
Identifikation von Lead Usern, wozu es verschiedene Methoden gibt. Die letzte<br />
Phase, die gemeinsame Konzeptentwicklung zwischen Hersteller und identifizierten<br />
Lead Usern, geht dagegen bereits von der Vorstellung eines interaktiven Wertschöpfungsprozesses<br />
aus, in der gemeinsam zwischen Anbieter und Nachfrager eine<br />
innovative Problemlösung entwickelt wird. In der klassischen Literatur zum Lead<br />
User (Urban/von Hippel 1988; von Hippel 1986) findet dieser Schritt nicht statt. Hier<br />
wird davon ausgegangen, dass der Lead User bereits in der eigenen Domäne einen<br />
innovativen Prototyp entwickelt hat, den der Hersteller autonom in seinen Bereich<br />
überträgt.<br />
156
Abbildung 3–12: Phasen der Lead-User-Methode<br />
Phase 1: Projektinitiierung<br />
Ein Unternehmen definiert in dieser Phase ein internes Team, welches die Durchführung<br />
der Methode verantwortet. Wie für viele Aufgaben des Innovationsmanagement<br />
gefordert, sollte sich dieses Team interfunktional aus erfahrenen Mitarbeitern<br />
der Bereiche Forschung- und Entwicklung, Fertigung sowie Marketing zusammensetzen.<br />
Bei der Auswahl der Teammitglieder ist insbesondere deren zeitliche Restriktion<br />
zu beachten. Fallstudien berichten von einem Arbeitsaufwand von ca. 20 Wochenstunden<br />
pro Teammitglied – bei einer Projektlaufzeit von vier bis sechs Monaten<br />
(Herstatt / von Hippel 1992; von Hippel / Thomke / Sonnack 1999). Zunächst evaluieren<br />
die Teammitglieder durch Interviews mit den jeweiligen Entscheidungsträgern,<br />
welcher Produktbereich des Unternehmens sich in besonderem Maße für einen<br />
Einsatz der Lead User Methode eignet: Besteht innerhalb eines Produktbereiches ein<br />
hoher Innovationsdruck? Ist der Produktbereich von der Methode überzeugt und<br />
bereit, zeitlichen und finanziellen Aufwand zu investieren? Sind dem Produktbereich<br />
bereits innovative Kunden bekannt oder existiert ein guter Zugang zur Kundenbasis?<br />
Im Ergebnis erfolgt so die Auswahl eines Produktbereichs, in welchem die Methode<br />
zum Einsatz kommt.<br />
Phase 2: Trendanalyse<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3<br />
Schritt 4<br />
Lead-User-<br />
Projektinitiierung<br />
• Teambildung<br />
• Definition Zielmarkt<br />
• Zieldefinition des<br />
Projekts<br />
Trendanalyse<br />
• Desk Research<br />
• Experteninterviews<br />
• Delfi-Studie<br />
• Szenarioanalyse<br />
Lead User<br />
Identifikation<br />
• Pyramiding<br />
• Screening<br />
• Analoge Märkte<br />
• Selbstselektion<br />
Konzeptdesign<br />
• Lead User Workshop<br />
• Evaluierung und<br />
Dokumentation der<br />
Ergebnisse<br />
Das Innovationsvorhaben aus Phase 1 wird nun einer Trendanalyse unterzogen, die<br />
dann in der nächsten Phase den Ausgangspunkt für die Identifikation potenzieller<br />
Lead User darstellt. Ein Trend bezeichnet eine erfassbare gesellschaftliche, wirtschaftliche<br />
oder technische Grundtendenz. Zur Identifikation solcher Trends stehen verschiedene<br />
Optionen zur Verfügung. Typischerweise erfolgt eine erste Trenddefinition durch<br />
Nutzung von Branchen- und Technologiereports, Veröffentlichungen externer<br />
Forschungseinrichtungen sowie Methoden der Interpolation und der historischen<br />
Analogie. Zudem können unternehmensinterne Experten im Bereich der Forschungund<br />
Entwicklung oder des Vertriebs erste Anhaltpunkte für sich abzeichnende Trends<br />
liefern. Weiterhin existieren für die Prognose von Trends eine Reihe von speziellen<br />
qualitativen Techniken wie die Delphi-Methode oder die Szenario-Analyse (de Lurgio<br />
1998; Hanke / Reisch 2004):<br />
157<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Die Delphi-Methode basiert auf einer strukturierten Gruppenkommunikation, um<br />
valide Zukunftsinformationen zu ermitteln. Ihr (sehr aufwändiges) Vorgehen<br />
basiert auf einer von der RAND-Corporation im Jahr 1964 entwickelten<br />
Befragungsmethode. Eine Fachkommission erarbeitet zunächst Thesen bezüglich<br />
der Existenz und der Entwicklung eines Trends im Zeitablauf. Diese Thesen werden<br />
dann in einen standardisierten Fragebogen übersetzt und einer Expertengruppe<br />
zur Beantwortung vorgelegt. In der Regel erfolgt kein Austausch unter den<br />
Experten, d. h. jeder Experte gibt sein individuelles Urteil auf Basis seiner<br />
Erfahrung ab. Nach Auswertung der Expertenmeinungen in Form eines<br />
Mittelwertes über die Urteile aller Beteiligten wird dieses Ergebnis im Rahmen<br />
einer anonymisierten Rückmeldung nochmals den Experten vorgelegt und um ein<br />
erneutes Urteil gebeten. Auf diese Weise kommt es zur gezielten Auslösung kognitiver<br />
Prozesse und schließlich zu einer Verbesserung der Qualität der<br />
Ausgangsinformationen (Grupp 1995; Häder / Häder 1994; Köhler 1978).<br />
Den Ausgangspunkt der Szenario-Analyse bildet ein Trendszenario im Zeitablauf,<br />
d. h. eine prognostizierte Trendentwicklung unter der Prämisse stabiler externer<br />
Faktoren. Im Regelfall muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich<br />
Umweltbedingungen und somit auch der prognostizierte Trend im Zeitablauf<br />
ändern. Dies berücksichtigt die Szenarioanalyse durch die Identifikation negativer<br />
und positiver Extremszenarios. Zunächst gilt es, die Gesamtheit an Faktoren zu<br />
ermitteln, welche Einfluss auf den untersuchten Trend haben. In einer Einflussanalyse<br />
wird nun mit einer Vernetzungstabelle (“Einflussmatrix”) untersucht,<br />
wie sich die einzelnen Faktoren wechselseitig beeinflussen. In einem nächsten<br />
Schritt erfolgt die Ermittlung möglicher Ausprägungen dieser Faktoren, z. B.<br />
durch den Einsatz eines morphologischen Kastens. Die mathematische Kombination<br />
dieser Faktorausprägungen spiegelt dann unterschiedliche Szenarien wider.<br />
Diese werden im Anschluss auf logische Konsistenz der Faktorausprägungen<br />
geprüft und aufgrund ihrer Ähnlichkeit oder Bedeutung komprimiert. Im Ergebnis<br />
entstehen so Trendszenarios in einem Intervall, welches durch ein positives und<br />
negatives Extremszenario begrenzt wird (Brauers / Weber 1986; Gausemeier / Fink /<br />
Schlake 1996; Mißler-Behr 1993).<br />
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es sich bei der Vorhersage eines Trends stets um<br />
eine Prognose handelt. Zwischen der Prognose und dem tatsächlich eintretenden<br />
Ereignis bestehen stets Abweichungen. Um den Prognosefehler jedoch zumindest zu<br />
minimieren, erfordert die Trendprognose besondere Sorgfalt, Aufmerksamkeit und<br />
Methodenwissen. Phase 1 und 2 bilden den Anfangspunkt vieler Maßnahmen des<br />
Innovationsmanagements. Sie sind aber vor allem im Zusammenhang mit der Lead-<br />
User-Methode sehr wichtig – und deshalb durch das gleiche Team auszuführen, das<br />
auch für die folgenden Schritte verantwortlich ist – damit die Beiträge und Ideen der<br />
Lead User in einem der Situation des Unternehmens angemessenen Kontext interpretiert<br />
werden können.<br />
Phase 3: Identifikation von Lead Usern<br />
Bisher wurde das Innovationsvorhaben des Unternehmens (angestrebte Innovation<br />
innerhalb eines definierten Produktbereiches) konkretisiert und einer Trendanalyse<br />
158
Instrumente von Open Innovation<br />
unterzogen. Es gilt nun, innovative Nutzer zu identifizieren, welche die festgelegten<br />
Trends anführen, um diese in der nächsten Phase im Rahmen eines Workshops in den<br />
Innovationsprozess zu integrieren.<br />
Wie wir jedoch in Abschnitt 3.3.1 bereits diskutiert haben, sind nicht alle potenziellen<br />
Kunden bzw. Nutzer einer Leistung in der Lage, innovatives Verhalten zu entwickeln<br />
und eigenständige Innovationsideen und -konzepte hervorzubringen. Die zentrale<br />
Herausforderung ist somit, die Charakteristika innovativer Kunden an der<br />
Grundgesamtheit aller potenziellen Kunden zu spiegeln, um auf diese Weise innovative<br />
von weniger innovativen Kunden zu trennen. Ein solches Vorgehen setzt jedoch voraus,<br />
dass das Unternehmen die zukünftige Grundgesamtheit potenzieller Kunden des<br />
Innovationsvorhabens kennt. Tendenziell ist dies ceteris paribus umso unwahrscheinlicher,<br />
je höher der Neuheitsgrad einer Innovation (und vice versa).<br />
Speziell bei radikalen Innovationen und Marktinnovationen ist die Definition der<br />
Grundgesamtheit oft schwierig. Ferner konnte in empirischen Studien gezeigt werden,<br />
dass innovative Kunden nicht nur im eigentlichen Zielmarkt des Innovationsvorhabens<br />
existieren, sondern auch in so genannten analogen Märkten (Pötz / <strong>Frank</strong>e<br />
2005; von Hippel / Thomke / Sonnack 1999). Ein analoger Markt ähnelt hinsichtlich der<br />
Bedürfnisse der Nachfrager und/oder der eingesetzten Technologie dem Zielmarkt,<br />
gehört aber oft einer völlig anderen Branche an. Gerade Lead User aus einem solchen<br />
Markt können für einen interaktiven Wertschöpfungsprozess in der Innovation entscheidend<br />
beitragen, da sie eine Kombination des Wissens aus verschiedenen<br />
Domänen erlauben und somit oft den Problemlösungsraum erweitern (ein Beispiel<br />
wäre die Nutzung von Experten in der Auswertung von Satellitenbildern als Lead User<br />
zur Definition einer innovativen Lösung zur automatischen Auswertung von<br />
Röntgenbildern). Jedoch ist die Identifikation analoger Märkte oft nicht einfach, und es<br />
existieren keine Lehrbuchmethoden in diesem Bereich.<br />
Methodisch stehen einem Unternehmen eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung,<br />
innovative Kunden zu identifizieren. Die am häufigsten diskutierten Verfahren sind<br />
die Suchtechniken “Screening” und “Pyramiding” (von Hippel / <strong>Frank</strong>e / Prügl 2005).<br />
Der Einsatz beider Verfahren setzt voraus, dass die in Abschnitt 3.3.1 diskutierten<br />
Eigenschaften innovativer Kunden in ein dem Innovationsvorhaben angepassten Set<br />
an Fragen überführt werden. Das Antwortverhalten eines Befragten lässt dann<br />
Rückschlüsse zu, ob dieser sich für die Partizipation an einem Lead User Workshop<br />
eignet. Während die Suchtechnik des Screening eine Parallelsuche darstellt, handelt es<br />
sich bei Pyramiding um eine sequentielle Suche (Abbildung 3–13).<br />
Welche Suchmethode ist geeigneter, um innovative Kunden zu identifizieren? Auf<br />
diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Jedoch lassen sich die folgenden<br />
Vermutungen anstellen.<br />
Die Suchtechnik “Pyramiding” ist besonders dann geeignet, wenn die zukünftige<br />
Grundgesamtheit potenzieller innovativer Kunden schwer abgrenzbar ist (technische<br />
und radikale Innovationen), innerhalb des Suchfeldes ein starkes soziales<br />
Netzwerk unter den Befragten besteht und der Fragenkatalog zur Identifikation<br />
aus wenigen, einfach zu beantwortenden Fragen besteht.<br />
159<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Abbildung 3–13: Die Suchtechniken Pyramiding und Screening (in Anlehnung an von<br />
Hippel / <strong>Frank</strong>e / Prügl 2005)<br />
Die Eignung von “Screening” ist dann gegeben, wenn sich die Grundgesamtheit<br />
potenzieller Kunden gut abgrenzen lässt (Inkremental- und Marktinnovationen),<br />
kein oder nur ein sehr schwach ausgeprägtes Netzwerk unter den Befragten vermutet<br />
wird und der Fragenkatalog zur Identifikation umfangreich und komplex<br />
ausfällt (siehe für ein aktuelles Beispiel aus der Industrie Lang 2005).<br />
Neben den Suchtechniken des “Pyramiding” und des “Screening” werden in der<br />
Literatur noch eine Reihe weiterer Techniken diskutiert. Diese zielen darauf ab, dass<br />
sich innovative Kunden selbst identifizieren (Self-Selection):<br />
Eine Möglichkeit der Selbstselektion ist, dem eigentlichen Innovationsvorhaben<br />
einen Ideenwettbewerb vorzuschalten (siehe dazu Abschnitt 3.5.3). Die Qualität der<br />
Innovationsidee eines Teilnehmers des Wettbewerbs dient hier als Prädiktor für dessen<br />
innovatives Potenzial (Walcher 2006). Ebenso können Nutzer eines Toolkits für<br />
Open Innovation, die dort besonders innovative Lösungen geschaffen haben, zu<br />
einem Lead-User-Workshop eingeladen werden (zu Toolkits siehe Abschnitt 3.5.2).<br />
Andere Arbeiten diskutieren die Eignung virtueller Börsen als Methode der<br />
Selbstselektion (Spann et al. 2004). Auf virtuellen Börsen werden, den Prinzipien<br />
160<br />
Screening Pyramiding<br />
Beim Screening werden Charakteristika<br />
innovativer Kunden in einen Fragebogen<br />
übersetzt, der einer repräsentativen<br />
Stichprobe bzw. der Grundgesamtheit<br />
parallel zur Beantwortung vorgelegt wird.<br />
Die Selbstauskunft der Probanten über ihre<br />
subjektive Eignung für eine Partizipation an<br />
der jeweiligen Innovationsaufgabe dient<br />
dann als Entscheidungsgrundlage für die<br />
Auswahl innovativer Kunden.<br />
Pyramiding beruht auf der Existenz sozialer<br />
Netzwerke, d.h. einem Beziehungsgeflecht,<br />
welches Menschen mit anderen Menschen<br />
verbindet. Den Ausgangspunkt bildet die<br />
Befragung eines beliebigen Mitglieds dieses<br />
Netzwerks in Bezug auf die Empfehlung einer<br />
Person, welche hinsichtlich der Charakteristika<br />
innovativer Kunden aus Sicht des Befragten<br />
qualifizierter ist. Auf diese Weise entsteht ein<br />
„Schneeballeffekt“ und man tastet sich<br />
sequentiell an die innovativsten Kunden heran.
echter Aktienmärkte folgend, zukünftige Marktzustände gehandelt (z. B. der Absatz<br />
bestimmter Produkte innerhalb eines definieren Zeitraums). Die Erwartungen der<br />
Teilnehmer bezüglich zukünftiger Marktzustände spiegeln sich dann im Wert der<br />
virtuellen Aktien wider. Entsprechend der Hayek-Hypothese werden durch eine<br />
virtuelle Börse asymmetrisch verteilte Informationen der Marktteilnehmer am effizientesten<br />
aggregiert. Erfolgreiche “virtuelle Börsianer” verfügen gegenüber erfolglosen<br />
demnach über einen Informationsvorsprung (Wissen und Erfahrung in Bezug<br />
auf den virtuellen Markt). Eben dieser ist ein Merkmal innovativer Kunden.<br />
An dieser Stelle sollte deutlich werden, dass es keinen “Königsweg” zur Identifikation<br />
innovativer Kunden gibt. Jede Methode verfügt sowohl über Vor- als auch Nachteile.<br />
Sinnvoll erscheint insbesondere, unterschiedliche Methoden miteinander zu kombinieren.<br />
So könnte beispielsweise nach erfolgreichem “Pyramiding” ein “Screening” weiteren<br />
Aufschluss über eine Eignung ausgewählter Kunden geben oder eine virtuelle<br />
Börse als Anknüpfungspunkt für ein “Screening” oder “Pyramiding” dienen. Im<br />
Ergebnis erfolgt durch den individuellen Einsatz unterschiedlicher Suchmethoden in<br />
dieser Phase eine Auswahl innovativer Kunden.<br />
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts angeführt, gehen die in diesem Kapitel<br />
beschriebenen Methoden und Instrumente von der Vorstellung eines herstellerinitiierten<br />
Open-Innovation-Prozesess aus. Dies heißt für die Lead-User-Methodik die aktive<br />
Suche nach Kunden und Nutzern mit potenziellen Lead-User-Eigenschaften, die<br />
dann im folgenden Schritt aktiviert und zu “innovativem Verhalten” motiviert werden<br />
können. In vielen Fällen aber werden Lead User ohne Anregung oder Identifikation<br />
durch einen Hersteller aktiv. Eine Selbstselektion kann deshalb auch über die<br />
Ermittlung bereits gezeigten innovativen Verhaltens erfolgen. Viele Lead-User-<br />
Innovationen werden vom Hersteller zufällig entdeckt (und zunächst oft als unbedeutend<br />
eingestuft) oder von einem Lead User aus eigener Motivation an den Hersteller<br />
herangetragen. Damit erhält das Unternehmen auch ohne einen formalen Prozess<br />
Zugang zu Lead-User-Information. Allerdings eröffnen Nutzer, die bereits in der<br />
Vergangenheit eigenständig Innovationen im Zielmarkt hervorgebracht haben, oft<br />
auch große Potenziale für zukünftige unternehmensdefinierte Innovationsprojekte. Die<br />
Pflege der einmal erfolgreich identifizierten Lead User wird so zu einer wichtigen<br />
Aufgabe (“Innovator Relationship Management”).<br />
Phase 4: Konzeptdesign in Lead-User-Workshops<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Die identifizierten innovativen Kunden werden nun durch den Hersteller zu einem<br />
Innovationsworkshop eingeladen, in welchem für das definierte Innovationsvorhaben<br />
gemeinsam Innovationsideen und -konzepte entwickelt werden. Alle vorangehenden<br />
Schritte sind im Grunde nur Mittel zum Zweck, einen solchen Workshop erfolgreich<br />
durchführen zu können. Die Qualität der hier generierten Ergebnisse bestimmt den<br />
Erfolg des Lead-User-Projektes. Auch wenn es keine genaue Anleitung für den erfolgreichen<br />
Ablauf eines Lead-User-Workshops gibt, so besteht dieser in der Regel aus<br />
einigen Elementen, die wir im Folgenden ansprechen wollen.<br />
Ein Innovationsworkshop setzt sich in der Regel aus ca. zehn Kunden, dem Lead-User-<br />
Team und einem erfahrenen Moderator, welcher den Workshop lenkt, zusammen. Die<br />
161<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
zeitliche Dauer beträgt zwischen einem halben und zwei Tagen (anhängig von der<br />
Komplexität des Problems). Die Rolle des (in der Regel externen) Moderators ist die Vermittlung<br />
zwischen den Beiträgen der Kunden und der Unternehmensteilnehmer. Auch<br />
leistet ein Moderator wichtige methodische Unterstützung bei der Anregung und Strukturierung<br />
der Beiträge der Teilnehmer. Ein Workshop ist neben dem fachlichen auch stets<br />
durch den sozialen Austausch zwischen den Teilnehmern geprägt. Ein Moderator sollte<br />
hier eventuelle Spannungen abbauen und die in der Regel gewollte Heterogenität der<br />
Teilnehmer nutzen, um einen zielführenden Problemlösungsprozess anzustoßen.<br />
Der Workshop beginnt in der Regel mit einem Briefing durch das Unternehmen, eine<br />
Vorstellung des grundsätzlichen Produktbereiches und einer Definition des Problems.<br />
Anschließend werden die Teilnehmer durch den gezielten Einsatz ausgewählter<br />
Kreativitätstechniken angeregt, in mehreren Runden eigene Ideen zur Lösung des<br />
Problems zu generieren (Abbildung 3–14 nennt einige dieser Techniken; siehe hierzu<br />
im einzelnen Geschka / Lantelme 2005). Kreativitätstechniken sind Methoden, die den<br />
Ideenfluss einer Gruppe beschleunigen, gedankliche Blockaden umgehen, die<br />
Suchrichtung erweitern und die Problemformulierung präzisieren (Hornung 1996).<br />
Unterschieden werden intuitive und diskursive Techniken. Intuitive Methoden zielen<br />
darauf ab, Gedankenassoziationen zu fördern, während diskursive Methoden eine<br />
systematische, logisch-prozessorientierte Lösungssuche anstreben.<br />
Abbildung 3–14: Kreativitätstechniken im Innovationsprozess (siehe zu diesen Verfahren<br />
Geschka / Lantelme 2005)<br />
Intuitive Methoden diskursive Methoden<br />
Techniken der freien Assoziation<br />
Brainstorming<br />
Ringtauschtechnik<br />
Kartenumlauftechnik<br />
Mind Mapping<br />
Techniken der strukturierten Assoziation<br />
Walt Disney Methode<br />
6-Hüte-Methode<br />
Kombinationstechniken<br />
Morphologisches Tableau<br />
Morphologische Matrix<br />
Attribute Listing<br />
Konfrontationstechniken<br />
Exkursionssynektik<br />
Reizwortanalyse<br />
Visuelle Konfrontation<br />
Bildkarten-Brainwriting<br />
TRIZ-Lösungsprinzipien<br />
Imaginationstechniken<br />
Take a Picture of the Problem<br />
Try to become the Problem<br />
Geleitete Fantasiereise<br />
Die so generierten Ideen und Problemlösungsvorschläge werden, wenn möglich, noch<br />
während des Workshops durch Experten aus der Firma gespiegelt und – sollte eine<br />
Simulation mit Rapid-Prototyping-Verfahren möglich sein – auch umgesetzt, um auch<br />
162
die Teilnehmer in die Evaluierung einzubinden. Die Ergebnisse des Workshops werden<br />
im Anschluss durch das Unternehmen dokumentiert und bewertet. Als Bewertungskriterien<br />
eignen sich beispielsweise das Marktpotenzial, der Innovationsgrad<br />
sowie der Fit einer Idee mit dem Leistungsprogramm und den Ressourcen des Unternehmens.<br />
Positiv bewertete Ideen werden dann in weiteren Innovationsworkshops<br />
weiterentwickelt oder in den internen Innovationsprozess eingespeist.<br />
Kasten 3–11: Literaturempfehlungen zur Lead-User-Methode<br />
3.5.2 Toolkits für Open Innovation<br />
Lead-User-Workshops sind oft ein sehr erfolgreiches, aber auch recht aufwändiges und<br />
teures Verfahren von Open Innovation. Ihr Erfolg hängt sowohl von der richtigen Auswahl<br />
und Rekrutierung geeigneter Teilnehmer als auch von der Gestaltung und<br />
Moderation des Workshops selbst ab. Auch wenn in der Literatur sehr eindrucksvolle<br />
Belege für den Erfolg dieser Methodik existieren (Gruner / Homburg 2000; Herstatt /<br />
von Hippel 1992; Lilien et al. 2002; Lüthje / Herstatt / von Hippel 2005; von Hippel /<br />
Thomke / Sonnack 1999), so scheuen viele Unternehmen den Aufwand, regelmäßig<br />
klassische Lead-User-Projekte durchzuführen.<br />
Grundgedanken von Toolkits für Open Innovation<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Churchill, Joan / von Hippel, Eric (2002): Video-Tutorial zur Anwendung der Lead-User-<br />
Methode, online verfügbar unter web.mit.edu/evhippel/www/tutorials.htm.<br />
Lilien, Gary / Morrison, Pamela / Searls, Kathleen / Sonnack, Mary / von Hippel, Eric (2002).<br />
Performance assessment of the lead user idea-generation process for new product development.<br />
Management Science, 48 (2002) 8: 1042-1059.<br />
Lüthje, Christian / Herstatt, Cornelius (2004). The lead user method: Theoretical-empirical<br />
foundation and practical implementation. R&D Management, 34 (2004) 5: 549-564.<br />
Urban, Glen / von Hippel, Eric (1988). Lead user analysis for the development of new industrial<br />
products, Management Science, 34 (1988) 5: 569-582.<br />
Ein neuer Ansatz, der oft kostengünstiger und deshalb auch als kontinuierliche Maßnahme<br />
implementiert werden kann, ist der Einsatz von Toolkits für Open Innovation<br />
(auch: Toolkits for User Innovation and Co-Design; von Hippel 2001; von Hippel /<br />
Katz 2002). Diese meist internetbasierten Instrumente erlauben den Einbezug einer<br />
großen Zahl an Kunden in verschiedene Phasen des Innovationsprozesses. Es gibt verschiedene<br />
Arten von Toolkits, die jedoch alle dem gleichen grundlegenden<br />
Gedankengang folgen (siehe auch Abbildung 3–15):<br />
Wie bereits gesehen (Abschnitt 3.2.1), nähert sich klassischerweise ein Hersteller<br />
im Entwicklungsprozess durch Variation, Kombination und Evaluation von<br />
Lösungsmöglichkeiten für ein Innovationsproblem unter iterativer Spiegelung dieser<br />
potenziellen Lösungen an den Bedürfnissen der (potenziellen) Nutzer der end-<br />
163<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
gültigen Lösung an. Dieser Trial-and-Error-Prozess ist sehr aufwändig, da eine stetige<br />
Iteration und Kommunikation zwischen der Nutzer- und Herstellerdomäne<br />
nötig ist. Dieser Austausch ist aber aufgrund der “Stickiness” (Ortsgebundenheit)<br />
von Bedürfnis- und Lösungsinformation oft durch hohe Transaktionskosten<br />
geprägt und zeitaufwändig (von Hippel 1998).<br />
Toolkits für Open Innovation basieren dagegen auf der Idee, diesen Trial-and-<br />
Error-Prozess an die Nutzer zu übergeben (<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004; <strong>Frank</strong>e / Schreier<br />
2002; von Hippel 2001; von Hippel / Katz 2002; Thomke / von Hippel 2002). Ein<br />
Toolkit beschreibt eine Entwicklungsumgebung, welche Kunden befähigt, ihre<br />
Bedürfnisse iterativ in eine konkrete Lösung zu überführen, häufig ohne dabei mit<br />
dem Hersteller in persönlichen Kontakt zu treten. Dazu stellt der Hersteller eine<br />
Interaktionsplattform bereit, auf der die Nutzer selbst – unter Nutzung eines vorhandenen<br />
und im Toolkit abgebildeten Lösungsraumes – ihre Bedürfnisse konkretisieren<br />
und in eine fertige Lösung überführen können.<br />
Abbildung 3–15: Ablauf des iterativen Problemlösungsprozesses im klassischen<br />
Innovationsprozess und bei Einbezug der Nutzer mittels Toolkits für Open<br />
Innovation (in Anlehnung an Thomke / von Hippel 2002)<br />
Schnittstelle<br />
Dabei ermöglichen Toolkits ihren Nutzern durch ein Feedback und Simulation<br />
einer möglichen Lösung, diese selbst hinsichtlich der Ausprägungen relevanter<br />
Attribute (z. B. Design, Performance, Preis) zu beurteilen. Auf diese Weise wird ein<br />
Lernprozess bei den Nutzern angestoßen, der auch als experimentelles Vorgehen<br />
164<br />
Traditionelle<br />
Produktentwicklung<br />
Vorhergehende<br />
Entwicklungen<br />
Design<br />
Bau (Prototypen)<br />
Test (Feedback)<br />
Hersteller<br />
Wieder -<br />
holungen<br />
Kunde<br />
Kunde als Produkt -<br />
entwickler /Innovator<br />
Vorhergehende<br />
Entwicklungen<br />
Design<br />
Bau (Prototypen)<br />
Test (Feedback)<br />
Schnittstelle
Instrumente von Open Innovation<br />
gesehen werden kann (Thomke 2003). Die Nutzer werden so lange mit dem<br />
Lösungsraum des Toolkits experimentieren, bis sie sich einer optimalen<br />
Problemlösung angenähert haben. Das hierzu gehörige Bündel aus Bedürfnis- und<br />
Lösungsinformationen übertragen sie im Anschluss (meist automatisiert) an den<br />
Hersteller. Kasten 3–12 gibt hierfür ein gutes Beispiel. Auch wenn die in diesem<br />
Artikel beschriebenen Toolkits von d.tools als Instrumente beschrieben werden,<br />
die professionellen Produktdesignern zugute kommen sollen, so spricht die einfache<br />
Handhabung dieser Tools natürlich auch dafür, sie als unterstützende<br />
Infrastruktur Nutzern und Kunden in die Hand zu geben.<br />
Dem Hersteller kommt so nicht mehr die Aufgabe zu, Bedürfnisse der Nutzer exakt<br />
zu verstehen und selbst in eine mögliche Lösung zu übersetzen und diese dann zu<br />
evaluieren. Vielmehr muss der Hersteller “nur” die vom Nutzer selbst geschaffene<br />
Lösung produzieren und distribuieren. Da der Nutzer die Lösung aber durch<br />
Nutzung einer Interaktionsplattform des Herstellers erstellt hat, ist die Fertigungsfähigkeit<br />
oft recht einfach.<br />
Kasten 3–12: Prototyping und Experiment als grundlegende Idee von Toolkits<br />
(Quelle: Auszug aus dem Artikel “Qualität durch Basteln” von Martin Virtel in der Financial Times<br />
Deutschland vom 24. Februar 2006 [www.ftd.de/rd/51032.html])<br />
Wie lange braucht ein Laie, um einen MP3- Player zu entwerfen und zu bauen? 95 Minuten - mit<br />
den richtigen Werkzeugen. Als da wären: Teppichmesser, Styroporplatten, Klebeband, Schalter,<br />
Kabel, Display, Chips und eine Software, die dem Haufen Technik Leben einhauchen kann. Das<br />
Ergebnis ist ein kantiges Ding, das an ein Stück aus dem Werkunterricht der sechsten Klasse<br />
erinnert. Aber man kann es in die Hand nehmen, es reagiert auf jeden Knopfdruck. Der Geräte-<br />
Baukasten, d.tools genannt, ist ein ernsthafter Versuch, der Elektronik- und Computerbranche<br />
einen Weg aus der Krise zu weisen [hci.stanford.edu / research / dtools / ]. Die Hersteller von MP3-<br />
Playern, Handys und Kameras haben den technischen Fortschritt nicht mehr richtig im Griff: Die<br />
Geräte werden mit immer neuen Zusatzfunktionen auf den Markt geworfen, gleichzeitig sind sie<br />
immer komplizierter zu bedienen. “Wir werden bald in einer Welt leben, in der jeder fünf oder sechs<br />
elektronische Geräte mit sich herumschleppt”, sagt Scott Klemmer, Dozent für die Gestaltung von<br />
Mensch-Maschine-Schnittstellen an der Universität in Stanford, Kalifornien, “aber die menschlichen<br />
Fähigkeiten bleiben ja konstant.”<br />
Jede Idee lässt sich schnell in einen Prototypen umsetzen, um sie mit zukünftigen Nutzern zu<br />
testen. “Das Bauen von Prototypen muss zur Gewohnheit werden, so, wie ein Musiker jeden Tag<br />
sein Instrument spielt”, sagt Klemmer. “Unser Ziel ist, dass der ganze Zyklus nicht mehr als eine<br />
Stunde dauert.” Auch heute lassen Produktdesigner Modelle von ihren Ideen anfertigen - meist<br />
Gehäuse-Prototypen ohne Funktion. Der Erkenntniswert der leeren Hüllen ist begrenzt, um die<br />
Funktion zu testen, müssen die Designer ihren Entwurf “über die Mauer werfen”, so lautet der<br />
Fachausdruck. Auf der anderen Seite der Mauer sitzen die Mechatroniker und Programmierer, die<br />
für die nötige Hard- und Software im neuen Gehäuse sorgen. Erst danach kann getestet werden -<br />
eine umständliche Prozedur, die nicht dazu animiert, eine schlechte Design-Idee noch mal zu<br />
überdenken. “Wir lassen die Mauer verschwinden”, sagt Klemmer. Zusammenstecken und Zusammenklicken<br />
kann jeder - Schalter, Display, Drehregler und so weiter erkennen, wann und wie sie<br />
zusammengestöpselt werden, und melden es an den angeschlossenen Laptop weiter. Programmieren<br />
lässt sich das Gebilde ohne besondere Vorkenntnisse, einfach durch das Umher-<br />
165<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
schieben und Verbinden von Symbolen auf dem Computerbildschirm. Der Rest der Herstellung<br />
hängt derzeit noch vom handwerklichen Geschick mit Teppichschneider und Klebeband ab. Um die<br />
unansehnlichen Styroporplatten eines Tages zu ersetzen, experimentiert Klemmers Team mit verschiedenen<br />
Maschinen, die computergesteuert Plexiglas so zurechtstutzen, dass sich daraus<br />
Gehäuse zusammenkleben lassen. Ein handelsüblicher Laptop, durch einen Kabelstrang mit dem<br />
Modell verbunden, sorgt dafür, dass tatsächlich Musik ertönt, wenn der “Play”-Knopf gedrückt wird.<br />
Denn die Prototypen, so bläut Klemmer seinen Studenten ein, sind nicht dazu da, um schick auszusehen<br />
und nett in der Hand zu liegen, sondern um sich Feedback von den Nutzern zu holen.<br />
Anforderungen an Toolkits für Open Innovation<br />
Um dieses Ablaufprinzip von Toolkits für Open Innovation sowohl auf Kunden- als<br />
auch auf Herstellerseite effizient zu gestalten, werden fünf Basisanforderungen an<br />
Toolkits gestellt (von Hippel 2001; von Hippel / Katz 2002):<br />
1 Vollständiges Trial-and-Error: Nutzer eines Toolkits sind mit ihrer selbst entwikkelten<br />
Bedürfnislösung tendenziell dann zufriedener, wenn sie den Problemlösungszyklus<br />
vollständig durchlaufen können. Dies erfordert, dass ein Nutzer auf<br />
seine mit dem Toolkit entwickelte Lösung ein simuliertes Feedback erhält, welches<br />
ihm ermöglicht, die aktuelle Lösung zu bewerten, iterativ zu verbessern und seinen<br />
individuellen Anforderungen anzunähern. Auf diese Weise kommt es auch zur<br />
Auslösung kognitiver und affektiver Lernprozesse (learning-by-doing), die die<br />
Qualität der Lösungsfindung verbessern.<br />
2 Zulässiger Lösungsraum (Solution Space): Der Lösungsraum eines Toolkits<br />
bezeichnet die Gesamtheit an Variationen und Kombinationen zulässiger Lösungsmöglichkeiten<br />
und wird vom Hersteller definiert. Grundsätzlich sollte der<br />
Lösungsraum nur solche Variationen und Kombinationen an Attributen zulassen,<br />
die aus Sicht des Herstellers unter Berücksichtigung insbesondere produktionstechnischer<br />
Restriktionen realisierbar sind. Diese Einschränkung ist je nach Art<br />
eines Toolkits jedoch mehr oder weniger strikt (siehe unten).<br />
3 Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzerfreundlichkeit beschreibt die durch einen<br />
Nutzer wahrgenommene Qualität der Interaktion mit einem Toolkit. Sie wird im<br />
Wesentlichen durch die vom Nutzer wahrgenommenen Kosten (Zeit, intellektueller<br />
Aufwand) sowie den wahrgenommenen Nutzen (Zufriedenheit mit der entwickelten<br />
Leistung, Spaß bei der Entwicklung) während der Interaktion mit dem<br />
Toolkit beeinflusst. Bei heterogener Ausprägung dieser Faktoren innerhalb einer<br />
Nutzergruppe empfiehlt es sich für den Hersteller, unterschiedliche Ausführungen<br />
an Toolkits bereitzustellen.<br />
4 Module und Komponenten: Module und Komponenten sind Einzelteile eines<br />
Toolkits (z. B. Programmiersprachen, Visualisierungen, Hilfe-Menüs, Zeichenprogramme,<br />
Textfelder, Bibliotheken), welche dessen Funktionsweise herstellen<br />
und einem Nutzer zur Lösung seines Problems zur Verfügung stehen. Module und<br />
Komponenten bilden den Lösungsraum des Toolkits ab und bestimmen dessen<br />
Benutzerfreundlichkeit.<br />
166
5 Übersetzung der Kundenlösung: Hat der Nutzer eines Toolkits die für seine<br />
Bedürfnisse optimale Problemlösung entwickelt, überträgt er diese an den<br />
Hersteller. Ein solcher Transfer bedingt eine fehlerfreie Übersetzung der Kundenlösung<br />
in die “Sprache” des Herstellers.<br />
Arten von Toolkits für Open Innovation<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Es gibt verschiedene Arten von Toolkits, die sich anhand der Ausprägung und Gestaltung<br />
von der zuvor vorgestellten Basisanforderungen unterscheiden. Es sei an dieser<br />
Stelle aber bereits betont, dass der Einsatz von Toolkits für Open Innovation im<br />
Vergleich zur Lead-User-Methodik erst am Anfang der betrieblichen Praxis steht und<br />
deshalb nur wenige empirisch fundierte Erfahrungen über die Gestaltung von Toolkits<br />
vorliegen.<br />
In Anlehnung an <strong>Frank</strong>e und Schreier (2002) können zwei Arten von Toolkits unterschieden<br />
werden, die sich vor allem durch die Größe bzw. Offenheit des Lösungsraums<br />
differenzieren: Toolkits for User Innovation sowie Toolkits for User Co-Design<br />
(Abbildung 3–16). Sie kommen in unterschiedlichen Phasen des Wertschöpfungsprozesses<br />
zum Einsatz (siehe auch Dockenfuß 2003; <strong>Frank</strong> / <strong>Piller</strong> 2003, 2004). In Erweiterung<br />
dieser Abgrenzung können wir noch eine weitere Art von Toolkit unterscheiden,<br />
die ganz zu Beginn des Innovationsprozesses zum Einsatz kommt: Toolkits zum<br />
Ideentransfer (externes Vorschlagswesen).<br />
Abbildung 3–16: Arten von Toolkits für Open Innovation<br />
Ziel<br />
Prinzip<br />
Nutzer<br />
Toolkits für User<br />
Innovation<br />
Generierung von<br />
Innovationsideen<br />
Generierung innovativer<br />
Leistungseigenschaften<br />
"Chemiekasten"<br />
Sehr großer<br />
Lösungsraum<br />
Hohe Nutzungskosten<br />
Vollständiges Trialand-Error<br />
Nutzer mit Lead-User-<br />
Eigenschaften<br />
Toolkits für User<br />
Co-Design<br />
Leistungsindividualisierung<br />
durch Produktkonfiguration(Verkaufstool)<br />
"Lego-Baukasten"<br />
Vordefinierter Lösungsraum<br />
durch technische<br />
Restriktionen des<br />
Herstellers<br />
Geringe Nutzungskosten<br />
durch Standardmodule<br />
Trial-and-Error nur teilweise<br />
möglich<br />
Toolkits zum<br />
Ideentransfer<br />
Transfer vorhandener<br />
Innovationsideen aus der<br />
Nutzerdomäne (externes<br />
Vorschlagswesen)<br />
"Black Board"<br />
Unbegrenzter<br />
Lösungsraum<br />
Geringe Nutzungskosten<br />
Kein Trial-and-Error<br />
(bzw. nur Feedback<br />
durch andere Nutzer)<br />
alle Kunden Nutzer mit Lead-User-<br />
Eigenschaften<br />
167<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Toolkits for User Innovation ähneln im Prinzip einem Chemiekasten. Ihr<br />
Lösungsraum ist in der Regel unbegrenzt. Nutzer des Toolkits fügen nicht nur vom<br />
Hersteller vorgegebene Standardmodule und Komponenten zu einem für sie optimalen<br />
Produkt zusammen, sondern experimentieren in einem aufwändigen trial-anderror-Prozess<br />
an bisher unbekannten Lösungen für ihre Bedürfnisse. Bei den notwendigen<br />
Lösungsinformationen, welche der Hersteller in seinem Toolkit bereitstellt, handelt<br />
es sich beispielsweise um Programmiersprachen oder Zeichenprogramme. Diese<br />
verlangen von ihren Nutzern ein hohes Maß an Kreativität und technischem<br />
Verständnis und sind deshalb nur für ausgewählte Nutzergruppen (Lead User) geeignet.<br />
Diese Toolkits ermöglichen es ihren Nutzern, sich aktiv an einem Innovationsprozess<br />
des Herstellers zu beteiligen. Dabei können Nutzer mit Hilfe des Toolkits entweder<br />
Ideen für neue Innovationen entwickeln oder innovative Leistungseigenschaften generieren.<br />
Der Unterschied zu einer rein autonomen Entwicklungstätigkeit der Nutzer<br />
(d. h. ohne ein Toolkit des Herstellers) liegt in zwei wesentlichen Faktoren: (i) Der Hersteller<br />
stellt sein vorhandenes Lösungswissen den Kunden in Form des Toolkits zur<br />
Verfügung. Dies kann beispielsweise durch eine Bibliothek an Funktionen, eine<br />
Rückgriffsmöglichkeit auf vorhandene Entwicklungen (CAD-Files) oder genaue<br />
Informationen über das Fertigungssystem geschehen. Die Nutzer können damit auf<br />
einem oft weit höheren Niveau innovativ tätig werden. (ii) Des Weiteren bedingt der<br />
Einsatz von Toolkits for User Innovation, dass ihre Nutzer in sämtlichen Phasen ein<br />
detailliertes (simuliertes) Feedback auf ihre Entwicklungen erhalten. Ein Beispiel für<br />
ein solches Toolkit ist das von Thomke und von Hippel (2002) beschriebene Toolkit von<br />
BAA Flavors, einem Hersteller von Nahrungsmittel-Aromen (siehe Kasten 3–13).<br />
Kasten 3–13: Ein Toolkit in der Nahrungsmittelindustrie<br />
(Quelle: Thomke / von Hippel (2002) dokumentieren folgenden Fall der Produktentwicklung bei<br />
einem Hersteller von Aromen für die Nahrungsmittelindustrie, der die Einsatzpotenziale eines Tool-<br />
Kits gut zeigt.)<br />
Produkte von BBA (jetzt International Flavors and Fragrances) sind spezielle Aromen, um den<br />
Geschmack von nahezu allen verarbeiteten Nahrungsmitteln zu verstärken und zu verbessern. Die<br />
Entwicklung dieser hinzugefügten Aromastoffe erfordert einen hohen Grad an Expertise und kundenspezifischer<br />
Anpassung und gleicht in der Praxis mehr derKunst als der Wissenschaft. Ein traditionelles<br />
Produktentwicklungsprojekt bei BBA läuft folgendermaßen ab: Ein Kunde fordert einen<br />
fleischartigen Geschmack für ein Soja-Produkt, und die Probe soll innerhalb einer Woche geliefert<br />
werden. Die Aromaexperten von BBA machen sich an die Arbeit und verschicken die Probe innerhalb<br />
von sechs Tagen. Drei frustrierende Wochen folgen, bis der Kunde antwortet “Eigentlich<br />
schon gut, aber wir brauchen es weniger rauchig und eher kraftvoll.” Der Kunde weiß genau, was<br />
er damit meint, aber für die Aromaexperten von BBA ist diese Aussage oft schwer interpretierbar.<br />
Je nach Produkt wechselt der Prozess zwischen BBA und Kunde noch einige Male – mit Aufwand,<br />
Wartezeit und Kosten für beide Seiten. Denn BBA trägt einen Großteil der Entwicklungskosten, hat<br />
aber erst dann Einnahmen, nachdem sowohl der Kunde als auch dessen Kunden (die<br />
Konsumenten) vollständig zufrieden sind (ein Entwicklungsprozess kostet dabei zwischen wenigen<br />
1000 USD für die Abänderung eines existierenden Geschmacks bis zu mehr als 300.000 USD<br />
168
Instrumente von Open Innovation<br />
für eine neue Geschmackfamilie). Im Durchschnitt akzeptiert der Abnehmer letztendlich nur 15<br />
Prozent aller neuen Geschmacksstoffe für einen vollständigen Markttest, und nur 5 Prozent bis 10<br />
Prozent werden schließlich im Markt eingeführt.<br />
Um auf dieses Problem zu reagieren, hat BBA Innovationsaktivitäten auf die Kunden verlagert.<br />
Dazu wurde ein Tool-Kit entwickelt, das zum einen aus einer großen Datenbank mit<br />
Geschmacksprofilen besteht. Ein Kunde kann diese Information am Bildschirm auswählen, verändern<br />
und bekommt sofort ein Feedback, wie die neue Aroma-Kombination sich auf den Preis des<br />
fertigen Produktes auswirken wird (da unterschiedliche Aromen unterschiedlich teuer sind). jedoch<br />
ist es schwer, Aromen nur am Bildschirm zu beurteilen – hier liegt ja genau das Problem des<br />
Informationsaustausches zwischen Nutzer und Hersteller begründet.<br />
Um dieses Problem zu lösen, hat BAA einen neuartigen “Baukasten” entwickelt, den die<br />
Chefköche für ihre “Produktentwicklung” nutzen können: eine Kollektion kleiner Tüten mit den<br />
Aromastoffen. Jede Zutat im Baukasten ist die dabei die BAA-Fabrikversion einer klassischen<br />
Zutat, die traditionellerweise von Chefköchen während der Produktentwicklung benutzt wird. So<br />
würde ein Baukasten für mexikanische Saucen z. B. ein Chili-Püree enthalten, das in den<br />
Maschinen von BAA verarbeitet werden kann. Für eine mexikanische Sauce besteht der<br />
Baukasten aus 20 bis 30 Komponenten in kleinen Plastikbeuteln mit Anweisungen zur korrekten<br />
Verwendung. Obwohl die Komponente von ihren frischen Versionen abweichen, werden diese<br />
Unterschiede per “learning-by-doing” durch den Koch entdeckt, der auf den gewünschten<br />
Geschmack und die Beschaffenheit per trial-and-error hinarbeiten kann. Wenn ein Rezept, basierend<br />
auf diesen Komponenten fertig ist, kann es sofort und präzise in den Fabriken von Nestle<br />
reproduziert werden – denn nun benutzt der Nutzer/Entwickler dieselbe Sprache wie die Fabrik. Im<br />
Fall BAA konnte so die Entwicklungszeit von 26 auf 3 Wochen reduziert werden, indem wiederholte<br />
Neuentwicklung und Verbesserungen zwischen Nestle und seinen Kunden eliminiert wurden.<br />
Toolkits for User Co-Design dienen weniger der Neuentwicklung von Produkten und<br />
Leistungen als vielmehr ihrer Individualisierung und Anpassung an spezifische<br />
Kundenwünsche. Ihr Prinzip ist mit dem eines Lego-Baukastens zu vergleichen.<br />
Toolkits for User Co-Design bieten ihren Nutzern eine mehr oder weniger große<br />
Auswahl an Einzelbausteinen (Modulen, Komponenten, Parametern), welche diese zu<br />
einem ihren individuellen Anforderungen entsprechenden Gesamtprodukt<br />
zusammenstellen (Konfiguration, siehe auch Abschnitt 4.4.4). Der Lösungsraum des<br />
Toolkits ist somit begrenzt und erlaubt nur solche Kombinationen an “Bausteinen”, die<br />
im wirtschaftlichen und technischen Machbarkeitsbereich des Herstellers liegen. In der<br />
Regel erhalten die Nutzer eine Visualisierung ihrer konfigurierten Leistung und können<br />
diese iterativ entsprechend ihrer Anforderungen verbessern. Im Anschluss übermitteln<br />
die Nutzer ihr konfiguriertes Design an den Hersteller, welcher die Produktion<br />
übernimmt. Bekannte Beispiele dieser Toolkits sind die Konfiguratoren von Dell oder<br />
der Automobilindustrie.<br />
Während aus Sicht des Herstellers durch den Einsatz von Toolkits for Co-Design keine<br />
Innovationen, sondern lediglich individuell konfigurierte Produkte entstehen, können<br />
diese von den Nutzern durchaus als (inkrementelle) Innovation wahrgenommen werden.<br />
Wir werden diesen Bereich noch ausführlich in Zusammenhang mit der<br />
Produktindividualisierung (Mass Customization) in Kapitel 4 behandeln und dabei<br />
auch auf eine Gestaltung dieser Werkzeuge eingehen (Dockenfuß 2003). Da der Stand<br />
der Entwicklung und Implementierung von Toolkits for User Co-Design deutlich wei-<br />
169<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Abbildung 3–17: Beispiele für Toolkits für User Co-Design in der Schuhindustrie (entnommen<br />
aus <strong>Piller</strong> 2005a)<br />
Brand, name of the<br />
customization program,<br />
and year of<br />
introduction<br />
mi adidas<br />
(adidas.com)<br />
since 2000<br />
Converse (converse.<br />
com / converseone)<br />
since 2004<br />
Nike iD<br />
(nikeid.com)<br />
since 1998<br />
Puma Mongolian<br />
BBQ (puma.com /<br />
mongolianbbq)<br />
since 2005<br />
Reebok<br />
(rbkcustom.com)<br />
since 2005<br />
Vans<br />
(shop.vans.com)<br />
since 2005<br />
Timberland<br />
(timberland.com /<br />
customboots)<br />
since 2004<br />
FootJoy GolfShoes<br />
(myjoys.com)<br />
since 2003<br />
JG Customs<br />
(booktown.com /<br />
jgcustoms)<br />
since 2003<br />
170<br />
Customization options,<br />
price range, and<br />
distribution channel<br />
Retail based<br />
Custom fit & design<br />
Price range: 140-160 USD<br />
Internet based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 60 USD<br />
Internet based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 50-80 USD<br />
Retail based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 100 USD<br />
Internet based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 60-80 USD<br />
Internet based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 50-60 USD<br />
Internet based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 170-180 USD<br />
Internet based<br />
Custom fit (limited) and<br />
aesthetic design<br />
Price range: 140-165 USD<br />
Internet & retail based<br />
Aesthetic design<br />
Price range: 300-400 USD<br />
Scope of the program<br />
Six shoes (two running shoes, one soccer,<br />
tennis, indoor, and basketball shoe<br />
respectively).<br />
Three areas of customization: fit (length<br />
and width of each foot), performance (outsole<br />
and mid sole options and seasonal<br />
upper materials), and aesthetic design.<br />
Three shoes (Chuck Taylors high and low,<br />
Jack Purcells). Custom colour and embroidered<br />
lettering.<br />
Fifty-one shoes (thirty-one for men, seventeen<br />
for women and three for kids), six<br />
bags, five watches and three golf balls.<br />
Custom colour and lettering.<br />
Individual style by combining different<br />
parts of the shoe on kiosks installed at<br />
selected Puma locations. Very tactile with<br />
a DIY flavour.<br />
Two shoes.<br />
Custom colour and patterns<br />
Two shoes.<br />
Custom colour and patterns<br />
Six shoes (two for men, three for women,<br />
two for kids).Many colour options.<br />
Popular golf shoe.<br />
Custom colour and individual length and<br />
widths for both right and left shoes.<br />
DIY approach (small user company modifying<br />
standard Nike shoes with own creations).<br />
Real personalization, hand painted,<br />
small batch sizes
Instrumente von Open Innovation<br />
ter ist als die Implementierung von Toolkits for User Innovation, bieten Erstere wichtige<br />
Anhaltspunkte zur Gestaltung letzterer (wir betrachten die Gestaltung von Toolkits<br />
im Rahmen der Produktindividualisierung in Abschnitt 4.4). Einen guten Überblick<br />
des Stands der Entwicklung von Toolkits for User Co-Design bietet die Sportschuhindustrie.<br />
Hier gibt es inzwischen keinen großen Hersteller mehr, der kein Toolkit anbietet.<br />
Die meisten dieser Toolkits sind internetbasiert, andere aber auch spezielle<br />
Anordnungen in einem Ladengeschäft (Abbildung 3–17).<br />
Jedoch ist die Abgrenzung zwischen Toolkits for User Innovation und User Co-<br />
Design nicht immer einfach. Wie bereits erwähnt, ist aus Sicht der Nutzer oft die<br />
Interaktion mit einem Konfigurationstoolkit ein kreativer Problemlösungsprozess, der<br />
einem Entwicklungsprozess sehr ähnlich ist (<strong>Frank</strong>e 2003). Ein gutes Beispiel ist der<br />
Einsatz von Toolkits in der Halbleiterindustrie, wo industrielle Kunden heute unter<br />
Rückgriff auf Plattformen der Halbleiterfabrikanten weitgehend selbst spezifische integrierte<br />
Schaltkreise entwerfen (von Hippel / Katz 2002). Diese Toolkits (z. B. von ISL)<br />
erlauben die nutzerindividuelle Entwicklung neuer Funktionen, können aber nicht das<br />
grundsätzliche Design eines Halbleiters ändern (um diesen beispielsweise energie-effizienter<br />
zu machen. Aufgrund des sehr großen Lösungsraums kann dieser Vorgang<br />
durchaus als Innovationsprozess bezeichnet werden, auch wenn die weitgehende<br />
Digitalisierung der Entwicklung und Fertigung Produktionsprozesse der individuellen<br />
Chips erlaubt, die sehr stabil sind und eher einer Mass-Customization-Situation<br />
entsprechen.<br />
Eine weitere Art von Toolkits setzt ganz zu Beginn des Innovationsprozesses in der<br />
Phase der Ideengenerierung ein: Toolkits zum Ideentransfer (externes Vorschlagswesen).<br />
Diese Toolkits unterstützen weniger einen eigenen Problemlösungsprozess<br />
beim Kunden, sondern zielen vielmehr auf die einfache Übertragung vorhandener<br />
Ideen und Lösungen aus der Nutzerdomäne. Sie bieten innovativen Nutzern einen<br />
“offenen Kanal” zum Unternehmen. Viele Hersteller haben heute unternehmensintern<br />
ein kontinuierliches Verbesserungswesen etabliert, das meist auf Basis einer Intranet-<br />
Plattform erlaubt, Ideen und Verbesserungsvorschläge zu übermitteln. Ziel von<br />
Toolkits zum Ideentransfer ist es entsprechend dieser Intranet-Plattformen, eine<br />
strukturierte Eingabe von Verbesserungsvorschlägen und neuen Verfahren zu unterstützen.<br />
Hierbei geht es sowohl um das breite Abgreifen genereller Bedürfnisinformation<br />
als auch um die Möglichkeit für innovative Nutzer, Verfahrens- oder Materialverbesserungen<br />
preiszugeben. Procter & Gamble ist beispielsweise bekannt für den<br />
Einsatz dieser Art von Toolkits (siehe noch mal Kasten 3–3). Auf der Homepage des<br />
Unternehmens gibt es einen prominenten Link zu der entsprechenden Ideen-<br />
Plattform. Auch die Plattform von Innocentive (siehe Kasten 3–1) kann in diese Kategorie<br />
eingeordnet werden. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das große Feld der Open-<br />
Source-Software-Entwicklung. Die verteilte Entwicklung von Open-Source-Software<br />
wird erst durch den Einsatz dezidierter Entwicklungsplattformen möglich, die die<br />
Beiträge der verschiedenen Nutzer bündeln und integrieren (siehe Abschnitt 3.5.4).<br />
Eine Erweiterung dieser Toolkits ist die Idee, den Wissenstransfer durch einen Wettbewerb<br />
zu verstärken. In einem solchen Innovationswettbewerb ruft ein Unternehmen<br />
seine Kunden und Nutzer entweder ganz allgemein zur Preisgabe innovativer Ideen<br />
171<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
und Verbesserungsvorschläge auf oder aber fragt ganz konkret nach einer Lösung für<br />
eine bestimmte Innovationsaufgabe. Wir werden die Gestaltung solcher Innovationswettbewerbe<br />
im nächsten Abschnitt näher betrachten.<br />
Kasten 3–14: Literaturempfehlungen zu Toolkits für Open Innovation<br />
Dockenfuß, Rolf (2003). Praxisanwendungen von Toolkits und Konfiguratoren zur<br />
Erschließung taziten Userwissens. In: Cornelius Herstatt und Birgit Verworn (Hg.):<br />
Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden: Gabler 2003: 215-232.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / Schreier, Martin (2002). Entrepreneurial opportunities with toolkits for user<br />
innovation and design. International Journal on Media Management, 4 (2002) 4: 225-234.<br />
Sawhney, Mohanbir / Verona, Gianmario / Prandelli, Emanuela (2005). Collaborating to create:<br />
The internet as a platform for customer engagement in product innovation. Journal of<br />
Interactive Marketing, 19 (2005) 4 (August): 4-17.<br />
Thomke, Stefan / von Hippel, Eric (2002). Customers as innovators: a new way to create value.<br />
Harvard Business Review, 80 (2002) 4 (April): 74-81.<br />
von Hippel, Eric / Katz, Ralph (2002). Shifting innovation to users via toolkits. Management<br />
Science, 48 (2002) 7 (July): 821-833.<br />
3.5.3 Innovationswettbewerbe<br />
Wettbewerb kann grundsätzlich als der Wettstreit verschiedener Parteien definiert<br />
werden und findet sich in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens - angefangen<br />
vom evolutionstheoretischen Wettbewerb der Arten ums Dasein bis hin zu<br />
Wettbewerben in Sport, Musik (z. B. “Jugend musiziert”), Wissenschaft (z. B. “Jugend<br />
forscht”), Kreativ- (z. B. Architektur-, Design-, Mal-, Literaturwettbewerbe etc.) oder<br />
auch Schönheitsbereich (z. B. Miss Germany Wahl). Gerade im karriereorientierten<br />
Unternehmensalltag ist der Wettbewerbsgedanke für die besonderen Leistungen der<br />
meisten Mitarbeiter verantwortlich. Auf volkswirtschaftlicher Ebene ist Wettbewerb<br />
das zentrale Paradigma der freien Marktwirtschaft.<br />
Wettbewerb als Naturprinzip<br />
Als Begründer der klassischen Wettbewerbstheorie gilt Adam Smith. Bereits 1776 entwickelt<br />
er in seinem Werk “The Wealth of Nations” das Modell einer auf freiem<br />
Wettbewerb basierenden Gesellschaft, in der Eigennutz durch das Wirken einer<br />
“unsichtbaren Hand” zu Gemeinnutz und Exzellenz führt. Innerhalb der neoklassischen<br />
Wettbewerbstheorie nehmen Schumpeter und von Hayek zentrale Positionen<br />
ein. Schumpeter (1934) sieht im Wettbewerb den Motor für technischen Fortschritt<br />
und somit für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, wobei er das Bild vom<br />
Unternehmer als kreativen Zerstörer prägt, der sich im wettbewerbsorientierten<br />
Umfeld durch steten Wandel und Innovation behauptet. Auch von Hayek sieht den<br />
Wettbewerb als Methode zur Entdeckung von neuem Wissen. Aufbauend auf seine<br />
172
Forschungen im makroökonomischen Bereich kommt Hayek zur Erkenntnis, dass<br />
Wettbewerb ein alle Bereiche des Lebens durchziehendes Grundprinzip darstellt und<br />
den Menschen zu Höchstleistungen und besonderer Kreativität antreibt. Wettbewerb<br />
ist somit die Grundlage zur Schaffung von Neuem:<br />
Ideenwettbewerbe als Instrument von Open Innovation<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
“So verhalten wir uns nicht nur in der Ökonomie, sondern auch im Sport, bei Prüfungen, beim<br />
Vergeben von Regierungsaufträgen oder in der wissenschaftlichen Forschung. Wenn wir den<br />
Sieger vorab kennen würden, wäre es sinnlos, einen Wettbewerb zu veranstalten. Wettbewerb<br />
ist deswegen nur deshalb und insoweit wichtig, als seine Ergebnisse unvoraussagbar und im<br />
Ganzen verschieden von jenen sind, die irgendjemand bewusst hätte anstreben können. […].<br />
Nur der Wettbewerb schafft mit seinen Gewinnmöglichkeiten und Verlustrisiken jenes<br />
Anreizsystem, das Höchstleistungen hervorbringt. Ohne Wettbewerb in Wirtschaft und Kultur<br />
wäre eine Gesellschaft statisch. Jeder Fortschritt beruht darauf, dass in einer wettbewerblichen<br />
Auseinandersetzung verschiedene Lösungsvorschläge erprobt werden. […]. Der<br />
Wettbewerb ist daher der Motor der gesellschaftlichen Evolution. […]. Die Menschen werden<br />
umso selbständiger und kreativer sein, je mehr Wettbewerb gegeben ist” (von Hayek / Kerber<br />
1996: 250).<br />
Ein Ideenwettbewerb ist die Aufforderung eines privaten oder öffentlichen Veranstalters<br />
an die Allgemeinheit oder eine spezielle Zielgruppe, themenbezogene<br />
Beiträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzureichen, die von einem<br />
Beurteilungsgremium an Hand von Beurteilungsdimensionen bewertet und leistungsorientiert<br />
prämiert werden. Das Ziel eines Ideenwettbewerbs als Ansatz von<br />
Open Innovation ist, Kunden bzw. Nutzer in die frühen Phasen des Innovationsprozesses<br />
(Ideengenerierung) zu integrieren. Der Wettbewerbscharakter soll die<br />
Kreativität und Qualität der Beiträge der Teilnehmer anregen und diesen auch einen<br />
zusätzlichen Incentive zur Teilnahme vermitteln. Das Einsatzspektrum eines<br />
Ideenwettbewerbs ist sehr breit (Ernst 2004) und reicht von einem kontinuierlichen<br />
Einsatz als offene Plattform zu konzentrierten Aktionen zur Lösung spezifischer<br />
Problemstellungen. Trotz der hohen Beliebtheit von Ideenwettbewerben in der Praxis<br />
finden sich auf wissenschaftlicher Seite bislang nur wenige systematische<br />
Untersuchungen (siehe hierzu Walcher 2006).<br />
Ein Ideenwettbewerb ist die Aufforderung eines privaten oder öffentlichen Veranstalters an die<br />
Allgemeinheit oder eine spezielle Zielgruppe, themenbezogene Beiträge innerhalb eines<br />
bestimmten Zeitraums einzureichen, die von einem Beurteilungsgremium an Hand von<br />
Beurteilungsdimensionen bewertet und leistungsorientiert prämiert werden.<br />
Im Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile eines Ideenwettbewerbs als Mittel zu<br />
Open Innovation näher beschrieben werden:<br />
173<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Veranstalter<br />
Innovationen sind für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens notwendig, weshalb<br />
Ideenwettbewerbe nicht nur von privatwirtschaftlichen Unternehmen oder<br />
Privatpersonen ausgeschrieben werden, sondern ebenfalls von gemeinnützigen<br />
Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen. So finden sich Ideenwettbewerbe<br />
sowohl bei wirtschaftlich orientierten Institutionen wie LEGO oder dem FC-Bayern<br />
München, die dazu auffordern, Ideen für neue Bausätze bzw. Vorschläge für den<br />
Namen eines neuen Maskottchens einzusenden, als auch im öffentlichen Bereich. Die<br />
deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt beispielsweise einen<br />
Wettbewerb aus, Motive für eine HIV-Präventionskampagne einzureichen. Die<br />
Technische Universität München (TUM) veranstaltet einen dauerhaften Ideenwettbewerb<br />
“Academicus”, der kreative Beiträge zur Verbesserung der Lehre und<br />
Studiensituation erwartet.<br />
Themenbezogenheit und Zielgruppe<br />
Grundsätzlich werden Ideenwettbewerbe themenbezogen ausgeschrieben. Aus der<br />
Spezifität der Thematik, die in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen erheblich<br />
variieren kann, ergibt sich die Zielgruppe des Ideenwettbewerbs, da oftmals besondere<br />
Eigenschaften oder Kompetenzen Voraussetzung zur Teilnahme sind. So richtet sich<br />
der Aufruf der Bundeszentrale für Aufklärung an die gesamte Öffentlichkeit, während<br />
der Ideenwettbewerb der Technischen Universität München an alle Studierende,<br />
Mitarbeiter, Wissenschaftler, Professoren und Alumni der TUM adressiert ist. Gerade<br />
im Wissenschaftsbereich, wie beispielsweise bei Ausschreibungen zu Wettbewerben<br />
und Forschungsprojekten innerhalb der Molekularbiologie, aber auch im Kreativbereich,<br />
wie bei Architekturwettbewerben, setzt die Teilnahme am Wettbewerb umfassende<br />
Kenntnisse und langjährige Beschäftigung mit der Thematik voraus, was die<br />
Gruppe der in Frage kommenden Teilnehmer oftmals stark einschränkt.<br />
Beurteilungsgremium und Beurteilungsdimensionen<br />
So beliebt Ideenwettbewerbe in der Praxis sind, so unsystematisch und oftmals willkürlich<br />
erweist sich die Besetzung des Beurteilungsgremiums sowie die Verwendung<br />
geeigneter Beurteilungsdimensionen. Tatsächlich existieren im Bereich der Kreativitätsforschung<br />
zahlreiche Methoden zur verlässlichen (reliablen) Bewertung von<br />
Kreativleistungen, bei der dezidierte Aussagen zur Größe und Besetzung der Jury<br />
sowie zu den Beurteilungsdimensionen gemacht werden. Eine praktikable Methode<br />
stellt die auf den subjektiven Urteilen von Experten basierende “Consesual Assesment<br />
Technique (CAT)” dar, die von der Psychologin Amabile entwickelt und innerhalb der<br />
letzten drei Jahrzehnte stetig erprobt und fortentwickelt wurde (Amabile 1996). Die<br />
Güte der Beurteilung wird durch den Grad der Beurteilerübereinstimmung bestimmt.<br />
Aufbauend auf den Erfahrungen aus einer Vielzahl von Studien, innerhalb derer<br />
Kreativleistungen im künstlerischen und sprachlichen Bereich wie auch im betrieblichen<br />
Innovationskontext bewertet wurden, gibt die Forscherin die Empfehlung, dass<br />
es sich bei den Jurymitgliedern um echte Experten handeln soll, die sich durch eine<br />
hohe Vertrautheit mit dem Untersuchungsgebiet auszeichnen. Bei Tests mit unerfahrenen<br />
Juroren oder beim gegenseitigen Beurteilen der Kreativleistungen durch die<br />
174
Ausführenden selbst wurden die Gütekriterien regelmäßig nicht erfüllt. Je nach<br />
Aufgabenstellung sollen mindestens drei und maximal zehn Personen der Expertenjury<br />
angehören.<br />
Hinsichtlich der Beurteilungsdimensionen stellt Amabile fest, dass eine Bewertung<br />
der Leistung nur anhand der Dimension Kreativität zu kurz greift. Vielmehr sollten<br />
zumindest die Dimensionen Neuigkeitsgrad, Angemessenheit und Umsetzung bewertet<br />
werden, um verschiedene Facetten des komplexen Konstrukts Kreativität zu<br />
beleuchten. Darüber hinaus stehe es dem Versuchsleiter frei, weitere der<br />
Kreativaufgabe entsprechende Bewertungsdimensionen zu ergänzen.<br />
Zeitraum<br />
Konstitutives Merkmal von Ideenwettbewerben ist der abgeschlossene Zeitraum,<br />
innerhalb dessen die Kreativleistungen vollbracht werden müssen. Dieser Erbringungszeitraum<br />
variiert je nach Aufgabenstellung. So kann sich – vor allem im<br />
künstlerischen Bereich – der Ausarbeitungszeitraum auf wenige Minuten oder gar<br />
Sekunden reduzieren, wie beispielsweise bei Wettbewerben zum Testen der spontanen<br />
Kreativität (Zeichnen, Malen, Dichten, Musizieren, Rappen etc.), bei denen unmittelbar<br />
nach der Aufgabenstellung die Erbringung erfolgt. Im betrieblichen Innovationsbereich,<br />
wie auch bei Wissenschafts- und Architekturwettbewerben sind dagegen<br />
Bearbeitungszeiträume von mehreren Wochen bzw. Monaten gebräuchlich.<br />
Prämierung<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Grundsätzlich besteht die Incentivierung zur Teilnahme an einem Ideenwettbewerb in<br />
einer leistungsorientierten Prämierung. Vergleichbar mit Sportkämpfen werden in<br />
aller Regel die besten drei Einsendungen prämiert. Die Ermittlung der besten Idee<br />
kann mit Hilfe eines Bewertungssystems (Scoringmodell) erfolgen, wobei für jede<br />
gewählte Beurteilungsdimension eine bestimmte Anzahl an Punkten vergeben wird<br />
und sich der Gewinner aus der Gesamtpunktzahl ergibt. Die Prämien können sowohl<br />
aus Sachpreisen wie auch aus Geldbeträgen bestehen, in manchen Fällen, wie im Fall<br />
der von der Bundeszentrale für Aufklärung ausgeschriebenen HIV-Kampagne, werden<br />
lediglich die Namen der Gewinner veröffentlicht. Beim jährlich durchgeführten<br />
Ideenwettbewerb des Skiherstellers Salomon winken dem Einsender des kreativsten<br />
Gestaltungsvorschlags für ein Snowboard tausend Euro als Geldpreis sowie ein professionelles<br />
Snowboard als Sachpreis (artworkcontest.com).<br />
Dieser Geldpreis erscheint jedoch als sehr gering, betrachtet man, welche Prämien<br />
bei InnoCentive, einem auf Ideenwettbewerbe spezialisierten Unternehmen, angeboten<br />
werden. Die Grundidee von InnoCentive besteht aus dem Anbieten einer<br />
internetbasierten Plattform, auf der Unternehmen Innovationsprobleme an die<br />
Öffentlichkeit bzw. an spezialisierte Wissenschaftler ausschreiben, die innerhalb<br />
eines bestimmten Zeitraums bearbeitet werden sollen. InnoCentive übernimmt als<br />
Mittler alle Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben. Die Lösungen werden vom<br />
auftraggebenden Unternehmen bewertet und prämiert, wobei Geldpreise bis zu<br />
$100.000 ausbezahlt werden. Darüber hinaus werden ebenfalls die Namen der<br />
Gewinner veröffentlicht, was einem zusätzlichen Reputationsgewinn entspricht<br />
(innocentive.com).<br />
175<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Identifikation von innovativen Kunden<br />
Neben dem Sammeln von kreativen Beiträgen stellt der Ideenwettbewerb darüber hinaus<br />
auch eine Methode zur Identifikation besonders innovativer Kunden (Lead User)<br />
dar. Grundsätzlich findet bei Ideenwettbewerben ein doppelter Selektionsprozess<br />
statt. So unterscheiden sich Kunden, die am Wettbewerb teilnehmen, allein durch ihre<br />
Entscheidung zur Teilnahme von Kunden, die nicht am Wettbewerb teilnehmen<br />
(Selbstselektion). Des Weiteren erfolgt eine leistungsbezogene Selektion durch die<br />
Expertenbeurteilungen der Kreativbeiträge (Leistungsselektion). Stellt die<br />
Teilnahmeselektion eine Form der Selbstselektion dar, so handelt es sich bei der<br />
Leistungsselektion um eine Fremdselektion (ein doppelter Selektionsprozess findet<br />
sich auch bei der Methode “Virtual Stock Markets”, die bereits oben in Zusammenhang<br />
mit der Identifikation von Lead Usern angesprochen wurde).<br />
Walcher (2006) weist in seiner Untersuchung eines Ideenwettbewerbs im Sportbereich<br />
nach, dass sich Teilnehmer von Nicht-Teilnehmern sowie besonders innovative von<br />
weniger innovativen Kunden an Hand von verschiedenen Motiven und Eigenschaften<br />
signifikant unterscheiden (siehe auch Fallstudie von Adidas in Kapitel 5.1). Auch<br />
konnte gezeigt werden, dass ca. zehn Prozent der eingesendeten Beiträge von der Jury<br />
als vollkommen neue (radikale) Ideen bewertet wurden. Zwar weisen die Einsender<br />
dieser hochinnovativen Beiträge nicht vollständig die klassischen Lead-User-Kriterien<br />
auf, doch kommt diesen Kunden gerade auf Grund der Tatsache, dass sie sich beim<br />
Ideenwettbewerb als besonders kreativ erwiesen haben, ebenfalls eine führende Rolle<br />
zu, weshalb sie vom Unternehmen als wichtige Quelle für Innovationsideen besonders<br />
ernst genommen werden müssen. Weitergehende Maßnahmen zur Erschließung des<br />
kundenseitigen Innovationspotenzials bestehen beispielsweise in der Durchführung<br />
von Innovationsworkshops oder dem Aufbau einer ausschließlich für diese Kunden<br />
geöffneten internetbasierten Entwicklercommunity.<br />
Anders als bei den Methoden zur Identifikation von Lead Usern, bei denen geeignete<br />
Personen durch verschiedene Maßnahmen im Vorfeld der kreativen Leistungserbringung<br />
(z. B. Lead-User-Workshops) aufwändig und oft kostenintensiv durch Fremdselektion<br />
ermittelt werden müssen, findet bei Ideenwettbewerben durch die freiwillige<br />
Selbstselektion eine erste Eingrenzung des Suchfeldes statt, gefolgt von der weitergehenden<br />
Auswahl durch die Expertenjury auf Basis der erbrachten kreativen Leistung.<br />
Gerade durch den Einsatz von internetbasierten Lösungen können diese Prozesse<br />
kostenoptimal gestaltet werden. Auch besteht der Vorteil, dass die ausgewählten Kunden<br />
bereits den Beweis ihrer Kreativität abgelegt haben, während die Auswahl geeigneter<br />
Lead User oft auf rein theoretischen Überlegungen basiert. Kasten 3–15 bietet<br />
abschließend ein Beispiel für einen Ideenwettbewerb bei der Firma Swarovski.<br />
3.5.4 Communities für Open Innovation<br />
Die bislang vorgestellten Instrumente von Open Innovation setzten an der Integration<br />
einzelner Nutzer in die Produktentwicklung an, die dann in Interaktion mit dem<br />
Unternehmen innovative Produkte und Leistungen hervorbringen sollten. Jedoch zeigt<br />
176
Kasten 3–15: Ideenwettbewerb bei Swarovski<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
(Quelle: Füller, Johann / Mühlbacher, Hans / Rieder, Birgit (2003). An die Arbeit, lieber Kunde:<br />
Kunden als Entwickler. Harvard Business Manager, 25 (2003) 5: 36-45)<br />
1999 brachte das auf Kristallbearbeitung spezialisierte österreichische Unternehmen Swarovski<br />
einen Körperschmuck aus kleinen Kristallsteinen, so genannte Crystal Tattoos, auf den Markt.<br />
Nach dem ersten Erfolg lag es im Interesse des Unternehmens herauszufinden, welche Muster<br />
den Geschmack der Kunden am besten treffen und wie neue Trends aussehen könnten. Es wurde<br />
entschieden, die potenziellen Käufer an der Entwicklung neuer Tattoos zu beteiligen. Als<br />
Konsequenz veranstaltete Swarovski Anfang 2002 einen internetbasierten Ideenwettbewerb, bei<br />
dem Kunden mit Hilfe einer Interaktionsplattform Ideen für kreative neue Muster und Formen einbringen<br />
konnten. Auf der Montagefläche der Plattform konnten beliebig viele Perlen, die am<br />
Bildrand in unterschiedlichen Farben und Größen angeboten wurden, durch eine einfache Dragand-Drop-Funktion<br />
angeordnet werden.<br />
Der Ideenwettbewerb war über einen Zeitraum von vier Wochen zugänglich, wobei insgesamt über<br />
300 Personen teilnahmen und über 260 verwertbare Motive entwickelt wurden. Eine interne Jury,<br />
bestehend aus Designern und Mitarbeitern der Marketingabteilung, prämierte die besten drei<br />
Kreationen mit Geldpreisen von wenigen hundert Euro. Die Auswertung aller Motive half, neue<br />
Trends, wie beispielsweise den Wunsch nach Tiermotiven, zu identifizieren. Vor dem eigentlichen<br />
Entwerfen waren die Kunden darüber hinaus gebeten worden, einen Online-Fragebogen mit<br />
Fragen zu Alter, Geschlecht, Vorlieben etc. auszufüllen. Indem die Motivideen mit den<br />
Fragebogendaten verglichen wurden, konnte festgestellt werden, welcher Kundentyp welche Art<br />
von Ornament bevorzugt.<br />
So wurden nicht nur die besten Entwürfe des Ideenwettbewerbs nach geringfügiger Überarbeitung<br />
in Serie produziert und erfolgreich verkauft, sondern die Marketingmanager des Unternehmens<br />
waren auch in der Lage, speziell auf das jeweilige Kundensegment abgestimmte Produkte und<br />
zielgruppenspezifische Kommunikationskampagnen zu entwickeln. Ebenfalls wurden die<br />
Gewinner des Ideenwettbewerbs zu einem Innovationsworkshop eingeladen, innerhalb dessen<br />
weitere Ideen mit den “Kundenexperten” entwickelt aber vor allem bestehende Ideen ausführlich<br />
bewertet und diskutiert wurden.<br />
sich in der Praxis des Innovationsmanagements, dass viele Innovation nicht das<br />
Ergebnis der kreativen Schaffenskraft eines einzelnen Inventors sind, sondern vielmehr<br />
auf der Zusammenarbeit vieler Beteiligter beruhen. Eine Zusammenarbeit<br />
basiert nicht nur auf den Vorteilen einer Arbeitsteilung zur Steigerung der Effizienz bei<br />
komplexen Innovationsprojekten, sondern ist vor allem motiviert durch einen selbst<br />
verstärkenden Effekt des Zusammenwirkens verschiedener Akteure mit unterschiedlichem<br />
Wissen, Stärken und Erfahrungen (Gascó-Hernández / Torres-Coronas 2004;<br />
<strong>Frank</strong>e / Shah 2003; Gerybadze 2003; Nemiro 2001; Sawhney / Prandelli 2000; von<br />
Hippel / Tyre 1995). Wir haben diesen Effekt bereits in Abschnitt 3.2.2 aus der<br />
Netzwerkperspektive des Innovationsprozesses diskutiert. Ebenso beruht die<br />
Konzeption von Lead-User-Workshops auf dem Gedanken, heterogene Akteure in<br />
einem lokalen Problemlösungsprozess zusammenzubringen – genau hier setzen ja<br />
auch die Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung in ihrer Reinform einer<br />
“Commons-based Peer Production” an.<br />
177<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Definition virtuelle Gemeinschaften<br />
Im Internet wird seit langem das Phänomen virtueller Gemeinschaften (“virtual communities”)<br />
diskutiert (siehe z. B. Hagel / Armstrong 1997; Herstatt / Sander 2004). Eine<br />
Gemeinschaft wird allgemein durch ihre Mitglieder und die Beziehungen zwischen<br />
diesen bestimmt, wobei in der Regel auf einen gemeinsamen Bezugspunkt fokussiert<br />
wird. Ein solcher Bezugspunkt kann z. B. regionale Nähe (Nachbarschaft), ein Beruf,<br />
eine gemeinsames Hobby oder auch die Faszination für ein Objekt oder eine Person<br />
sein (Hillery 1955; McAlexander / Schouten / Koenig 2002). Durch das Aufkommen des<br />
Internets und die damit einfacher mögliche ortsunabhängige Interaktion zwischen<br />
Akteuren hat die alte Idee von Gemeinschaften in Form virtueller Gemeinschaften<br />
starke Aufmerksamkeit erfahren. Eine virtuelle Gemeinschaft besteht aus einer Gruppe<br />
von Personen, die über elektronische Medien kommuniziert und/oder interagiert. Auf<br />
diese Weise entsteht ein “nicht radikal strukturiertes, ego-zentriertes Netzwerk im<br />
virtuellen Raum, in dem die Nutzer multidirektional und themenspezifisch interagieren<br />
und so die Basis einer glaubwürdigen Kommunikation schaffen” (Weiber / Meyer<br />
2002; siehe für eine Diskussion der Definition auch Armstong / Hagel 1996; Mathwick<br />
2002; Schubert / Ginsburg 2000).<br />
Abbildung 3–18: Merkmale virtueller Communities<br />
Kommunikationsstruktur<br />
Mitgliederverhalten<br />
Mitgliederzusammensetzung<br />
Mitgliedernutzen<br />
Merkmale virtueller Gemeinschaften<br />
Merkmale von virtuellen Communities<br />
• Communication Rings<br />
•ContentTrees<br />
• Personelle Interaktivität<br />
• Schärfe der Fokussierung<br />
• Kohäsion der Mitflieder<br />
• verbraucherorientiert<br />
• unternehmensorientiert<br />
•funktional<br />
• hedonistisch<br />
Virtuelle Gemeinschaften lassen sich über die in Abbildung 3–18 genannten und im<br />
Folgenden beschriebenen Merkmale charakterisieren (Hanson 2000; Hagel /<br />
Armstrong 1997; Rheingold 1994; Weiber / Meyer 2002):<br />
Kommunikationsstruktur: Für die Kommunikation stehen einer virtuellen<br />
Gemeinschaft unterschiedliche technische Optionen zur Verfügung, die sich in zwei<br />
Kommunikationsstrukturen unterscheiden: Communication Rings und Content<br />
178
Instrumente von Open Innovation<br />
Trees. Bei Communication Rings werden Informationen und Botschaften direkt<br />
zwischen den Individuen versendet, d. h. jedes Gruppenmitglied bekommt die<br />
identischen Nachrichten und Botschaften zugesandt. Die Kommunikation erfolgt<br />
über Email, Net Pagers oder Groupware. Bei Content Trees handelt es sich um eine<br />
indirekte Form der Kommunikation. So existiert ein zentraler Ort (z. B. eine Website)<br />
an dem Informationen und Botschaften über Usenets, Bulletin Boards, Chat<br />
Rooms oder Virtual Worlds dargestellt und gespeichert werden. Die Möglichkeit,<br />
ausgetauschte Informationen zu archivieren und somit das in einer virtuellen Gemeinschaft<br />
produzierte Wissen zu bewahren, ist der größte Vorteil von Bulletin<br />
Boards, da sie asynchrone Kommunikationsmittel darstellen. Chats hingegen ermöglichen<br />
synchrone, also zeitgleiche, Interaktion, indem die Mitglieder Textnachrichten<br />
gleichzeitig auf einer gemeinsamen Plattform veröffentlichen (Hanson 2000).<br />
Mitgliederverhalten: Das Verhalten der Mitglieder der virtuellen Gemeinschaft<br />
manifestiert sich entlang der personellen Interaktivität, Schärfe der Fokussierung<br />
sowie einer Kohäsion der Mitglieder. Das Kontinuum der personellen Interaktivität<br />
wird zwischen den Polen “Interaktion an einem virtuellen Ort” und “Interaktion zu<br />
einem Thema” aufgespannt. Während bei der Interaktion an einem virtuellen Ort<br />
die soziale Kommunikation unter den Mitgliedern das Hauptziel ist (Kommunikation<br />
um der Kommunikation willen), wird bei der Interaktion zu einem Thema<br />
primär themenspezifisch, unter weitestgehender Vernachlässigung persönlicher<br />
Interaktionen, kommuniziert (Kommunikation um der Information willen). Die<br />
Fokussierung einer virtuellen Gemeinschaft beschreibt die Intensität, mit der sich<br />
die Gemeinschaft einem Thema widmet. Generalisierte Gemeinschaften decken<br />
ein breites Spektrum des Themenbereiches ab, spezialisierte hingegen nur einen<br />
Teilbereich der dafür in entsprechender Tiefe diskutiert wird. Die Kohäsion der<br />
Mitglieder schließlich bewegt sich zwischen losen, nur schwach verbundenen und<br />
stark kohäsiven Gemeinschaften mit familiärem Charakter.<br />
Mitgliederzusammensetzung: Bei der Zusammensetzung der virtuellen Gemeinschaft<br />
unterscheiden wir verbraucher- und unternehmensorientierte Gemeinschaften.<br />
Bei verbraucherorientierten Gemeinschaften stehen hauptsächlich private<br />
Interessen und Motive im Vordergrund. Die Mitglieder der Gruppe haben ein<br />
gemeinsames Hobby oder identische Interessen und treten als Privatpersonen auf.<br />
Die Gemeinschaft bildet sich dann aufgrund geografischer, demografischer vor<br />
allem jedoch themenspezifischer Gemeinsamkeiten der einzelnen Mitglieder.<br />
Unternehmensbezogene Gemeinschaften hingegen entstehen aufgrund beruflicher<br />
Interessen einzelner Mitarbeiter oder der Organisation als Einheit<br />
(Communities of Practice).<br />
Nutzen: Hinsichtlich des Nutzens der einzelnen Teilnehmer kann wieder zwischen<br />
funktionalen und hedonistischen Komponenten unterschieden werden. Während<br />
sich der funktionale Nutzen hauptsächlich um den Erwerb und den Austausch<br />
von Informationen und Wissen konstituiert, wird der hedonistische Nutzen durch<br />
die soziale Interaktion mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft geprägt. Im<br />
Vordergrund stehen dann die Interaktion mit den anderen Teilnehmern oder der<br />
Aufbau und die Pflege von Freundschaften.<br />
179<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Das Beispiel von Communities zur Entwicklung von Open Source Software<br />
Besondere Aufmerksamkeit genießen virtuelle Innovationsgemeinschaften bei der<br />
Entwicklung von Open Source Software. Open Source ist ein Sammelbegriff für<br />
Softwarelizenzen, die den Softwarebenutzern nicht nur das Recht einräumen, den<br />
Quellcode zu lesen, sondern diesen auch zu verändern und die Änderungen Dritten<br />
zugänglich zu machen. Außerdem dürfen keinerlei Lizenzgebühren oder andere<br />
Beiträge für die Software erhoben werden. Damit wird der Quellcode zu einem öffentlichen<br />
Gut (siehe zu Open Source z. B. Franck / Jungwirth 2003; Henkel 2003; Koller /<br />
Großmann 2004; Knyphausen-Aufsess / Achtenhagen / Müller 2003; Lakhani / von<br />
Hippel 2000; Lerner / Tirole 2002; Weber 2004). Open Source Software ist ein Beispiel<br />
für Nutzerinnovation in größter Konsequenz: Nutzer haben hier die Idee zum Produkt,<br />
dieses konzipiert und umgesetzt (programmiert), für seine Verbreitung und<br />
Bewerbung gesorgt und das Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert und<br />
mit Zusatzapplikationen versehen. Alle diese Aktivitäten finden dabei in einer<br />
Entwicklungsumgebung statt, die ebenfalls von Nutzern selbst entwickelt wird.<br />
Kommerzielle Unternehmen haben erst in einer zweiten Stufe Geschäftsmodelle entwickelt,<br />
um den Open-Source-Quellcode auch weniger erfahrenen Anwendern<br />
zugänglich zu machen. Bekannte Open-Source-Produkte sind beispielsweise das<br />
Betriebssystem Linux oder der Web-Server Appache.<br />
Bei der Erstellung eines Open-Source-Programmes arbeitet oft eine räumlich verteilte<br />
Gruppe freiwilliger Software-User über das Internet zusammen, ohne dass explizite<br />
Weisungsbefugnisse existieren. Hier finden sich die Prinzipien der “Commons-based<br />
Peer-Production” (Abschnitt 2.4.3.4) genau umgesetzt: Die Gesamtaufgabe ist in viele<br />
kleine Beiträge unterteilt, deren Lösung unterschiedliche Kompetenzen, Motivation<br />
und Zeit beansprucht. Die Teilnehmer identifizieren selbst die Aufgaben, an denen sie<br />
arbeiten wollen und stellen eine Lösung bereit, die anschließend von anderen<br />
Teilnehmern geprüft und ggfs. verbessert und weiter entwickelt werden. Auf diese<br />
Weise entsteht eine virtuelle Innovationsgemeinschaft. Auch die Definition der<br />
Probleme selbst ist Aufgabe der Gemeinschaft. Die Akteure der Open Source<br />
Gemeinschaft treiben zumeist in kleineren Beiträgen die Entwicklung des Projektes<br />
voran, d. h. User der Software beteiligen sich an deren kontinuierlicher Innovation<br />
(Benkler 2002; Osterloh / Rota / von Wartburg 2002; Weber 2004). Dem “Maintainer”<br />
der Software fällt dann lediglich die Aufgabe zu, den Input zu prüfen.<br />
Das Open-Source-Modell weicht erheblich von dem Modell des klassischen<br />
Innovationsprozesses ab. Sämtliche Phasen des Innovationsprozesses von der<br />
Ideengenerierung über die Entwicklung eines Prototyps bis zur Distribution der<br />
Software werden von Nutzern der Software übernommen. Es existiert im Gegensatz zu<br />
proprietärer Software kein Unternehmen, welches sämtliche Innovationen durch interne<br />
Forschung und Entwicklung generiert, rechtlich schützt und anschließend vermarktet<br />
(Brügge et al. 2004). Vielmehr zeigt das Beispiel Open Source Software, dass Nutzer<br />
einer Software – und nicht nur “professionelle” Unternehmen – gemeinsam in der Lage<br />
sind, diese weiterzuentwickeln und neue innovative Software zu generieren (Lakhani /<br />
von Hippel 2000). Kasten 3–16 beschreibt in der Sprache der Entwickler den<br />
Unterschied zwischen Open Source und konventioneller Software.<br />
180
Instrumente von Open Innovation<br />
Kasten 3–16: Beispiel zur Interaktiven Wertschöpfung in Innovation-Communities: Die<br />
Entstehung von Linux<br />
(Quelle: Auszug aus Eric Raymonds (1999) berühmtem Artikel, in dem er die Arbeitsweise der virtuellen<br />
Innovationsgemeinschaft beim Open-Source-Betriebssystem Linux mit einem Basar vergleicht,<br />
während die Organisation der Produktion proprietärer Software der Erstellung einer<br />
Kathedrale gleicht. Deutsche Übersetzung von R. Gantar [www.gnuwin.epfl.ch])<br />
“Linux ist subversiv. Wer hätte auch vor nur fünf Jahren (1991) gedacht, dass sich ein<br />
Betriebssystem der Spitzenklasse wie durch Zauberei materialisieren könnte, geschaffen von tausenden<br />
über den ganzen Planeten verstreuten Nebenerwerbs-Hackern, die durch die eng verwobenen<br />
Stränge des Internets verbunden sind? Ich sicher nicht. Zu dem Zeitpunkt, als Linux 1993<br />
auf meinem Radarschirm auftauchte, hatte ich bereits zehn Jahre in der Unix- und Open-Source-<br />
Entwicklung verbracht. Mitte der Achtziger war ich einer der ersten Beitragenden zu GNU. Ich hatte<br />
bereits umfangreiche Open Source-Software im Internet veröffentlicht, die ich selbst entwickelt<br />
oder mitentwickelt hatte (nethack, Emacs VC und GUD modes, xlife und andere) und die heute<br />
noch viel verwendet wird. Ich dachte, ich wüsste, wie es gemacht wird. Dann stellte Linux alles in<br />
Frage, was ich zu wissen glaubte. Ich hatte das Unix-Evangelium der kleinen Tools, des rapid prototyping<br />
und der inkrementellen Verbesserung seit der ersten Stunde verbreitet. Ich glaubte aber<br />
auch, dass es eine bestimmte kritische Komplexitätsstufe gebe, ab der ein zentralisierterer Ansatz<br />
mit sehr genauer Vorausplanung erforderlich wird. Ich glaubte, dass die wichtigste Software<br />
(Betriebssysteme und wirklich umfangreiche Tools wie Emacs) so gebaut werden müssten wie<br />
Kathedralen, sorgsam gemeißelt von einzelnen Druiden oder kleinen Teams von Hohepriestern,<br />
die in totaler Abgeschiedenheit wirkten und keine unfertigen Beta-Freigaben veröffentlichen dürften.<br />
Linus Torvalds’ Entwicklungsstil auf der anderen Seite - mit seinen frühen und häufigen Freigaben,<br />
seinem Delegieren von allem, was nur irgendwie möglich ist, und der an Promiskuität grenzenden<br />
Offenheit - war eine echte Überraschung. Es handelte sich nicht gerade um eine stille und ehrfurchtsvolle<br />
Tätigkeit, wie der Bau einer Kathedrale eine ist — stattdessen schien die Linux-<br />
Gemeinde ein großer, wild durcheinander plappernder Basar von verschiedenen Zielsetzungen<br />
und Ansätzen zu sein (alles sehr treffend durch die Linux-Archivsites repräsentiert, die Beiträge<br />
von jedem nehmen), der ein kohärentes und stabiles System wohl nur durch eine Reihe von<br />
Wundern hervorbringen konnte. Die Tatsache, dass der Basar zu funktionieren schien, und zwar<br />
sehr gut zu funktionieren schien, war ein ausgesprochener Schock. Während ich lernte, mich in<br />
dieser neuen Umgebung zurechtzufinden, arbeitete ich nicht nur angestrengt an eigenen<br />
Projekten, sondern versuchte auch zu verstehen, warum die Linux-Welt sich nicht nur nicht einfach<br />
in völliger Konfusion auflöste, sondern an Durchschlagskraft immer weiter zulegte und eine<br />
Produktivität ausbildete, die für die Erbauer einer Software-Kathedrale kaum vorstellbar gewesen<br />
ist.<br />
Mitte 1996 dachte ich, dass mir ein genaueres Verständnis dämmerte. Durch Zufall bekam ich eine<br />
ausgezeichnete Gelegenheit, meine Theorie zu testen, und zwar in Form eines Open Source-<br />
Projekts, das ich bewusst im Basar-Stil abwickeln konnte. Das tat ich dann auch — und es wurde<br />
ein bedeutender Erfolg. Dies ist die Geschichte dieses Projekts. Ich verwende es, um einige<br />
Aphorismen über effektive Open Source-Entwicklung vorzustellen. Nicht alle davon erfuhr ich als<br />
erstes in der Linux-Welt, ich werde aber auf Beispiele aus der Linux-Welt zurückgreifen, um<br />
bestimmte Punkte zu illustrieren. Wenn ich damit richtig liege, werden sie helfen zu verstehen,<br />
warum gerade die Linux-Gemeinde zu so einem steten Quell guter Software geworden ist — und<br />
vielleicht auch, wie Sie selbst produktiver werden können.”<br />
181<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Dieses Modell funktioniert aber nur, wenn auch die Rechte an den Ergebnissen des<br />
Entwicklungsprozesses frei für alle Teilnehmer verfügbar sind (“commons-based”), d.<br />
h. nicht durch gewerbliche Schutzrechte blockiert sind. Heute hat sich gezeigt, dass<br />
auch große konventionelle Unternehmen, die klassischerweise stark auf die Wahrung<br />
ihrer Schutzrechte aus waren, das Open-Source-Entwicklungsmodell in ihr<br />
Wertschöpfungsmodell integrieren und davon profitieren können. Vor diesem<br />
Hintergrund ist die Bildung des so genannten ‘Open Invention Networks’ durch diese<br />
Unternehmen zu sehen, das einen Pool an kritischen Patenten hält und diese allen<br />
internen und externen Nutzern ohne Einschränkung zur Verfügung stellt. Damit sollen<br />
vor allem Unternehmen behindert werden, die durch den Erwerb eines kritischen<br />
Schutzrechts den offenen Entwicklungsprozess behindern könnten (und in der Regel<br />
auf hohe Lizenzzahlungen von großen konventionellen Nutzern von Open-Source-<br />
Software aus sind). Kasten 3–16 beschreibt diese Initiative, die durchaus auch als weitere<br />
Form der Nutzerintegration gesehen werden: Hier sind es die Nutzer selbst, die<br />
bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen mitwirken und die Voraussetzungen<br />
schaffen, dass Nutzerinnovation funktioniert.<br />
Kasten 3–17: Open Invention Network Formed to Promote Linux and Spur Innovation<br />
Globally Through Access to Key Patents<br />
(Quelle: Presseerklärung des Open Invention Networks anlässlich der Gründung des Unternehmens<br />
[openinventionnetwork.com])<br />
New York (November 10, 2005) - Open Invention Network (OIN), a company that has and will<br />
acquire patents and offer them royalty-free to promote Linux and spur innovation globally, was<br />
launched today with financial support from IBM, Novell, Philips, Red Hat, and Sony. The company,<br />
believed to be the first of its kind, is creating a new model where patents are openly shared in a<br />
collaborative environment and used to facilitate the advancement of applications for, and components<br />
of, the Linux operating system.<br />
“Open collaboration is critical for driving innovation, which fuels global economic growth. Impediments<br />
to collaboration on the Linux operating system seriously jeopardize innovation. A new model<br />
of intellectual property management for Linux must be established to maintain advances in software<br />
innovation – regardless of the size or type of business or organization,” said Jerry Rosenthal, chief<br />
executive officer at Open Invention Network. The company will foster an open, collaborative environment<br />
that stimulates advances in Linux – helping ensure the continuation of global innovation that<br />
has benefited software vendors, customers, emerging markets and investors, among others.<br />
Patents owned by Open Invention Network will be available on a royalty-free basis to any company,<br />
institution or individual that agrees not to assert its patents against the Linux operating system or certain<br />
Linux-related applications. Open Invention Network believes that creating a new system to manage<br />
and ensure access to key patents for the Linux operating system will have a significant economic<br />
impact. According to International Data Corporation, the worldwide Linux business is expected to<br />
grow 25.9 percent annually, doubling from $20 billion in 2005 to more than $40 billion in 2008.<br />
“Open Invention Network is not focused on income or profit generation with our patents, but on<br />
using them to promote a positive, fertile ecosystem for the Linux operating system and to drive<br />
innovation and choice into the marketplace,” said Mr. Rosenthal. “We intend to spur innovation in<br />
IT and across industries by helping software developers focus on what they do best - developing<br />
great Linux-related software with greater assurance about intellectual property issues.” Among<br />
182
Inzwischen überträgt sich der Gedanke von Open Source aus der Softwareentwicklung<br />
auch auf andere Bereiche (siehe auch Koller / Großmann 2004). Kasten 3–18 nennt abschließend<br />
einige Beispiele. Auch wenn diese Initiativen teilweise eher unprofessionell oder gar<br />
ideologisch-verbrämt erscheinen, so beschreiben sie doch mehr als nur einen weiteren<br />
Trend. Denn wer hätte bei den Anfängen der Linux-Bewegung gedacht, dass eine solche<br />
Initiative die Softwareindustrie verändert hat wie kaum eine andere Prozessinnovation?<br />
Virtuelle Gemeinschaften als Mittel zu Open Innovation<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Open Invention Network’s initial patent holdings is a set of business-to-business electronic commerce<br />
patents that were purchased from Commerce One by JGR, a subsidiary of Novell.<br />
Investor Statements<br />
IBM: “The formation of Open Invention Network signals a growing movement where companies<br />
today are looking beyond their own organizational boundaries,” said Jim Stallings, vice president<br />
of intellectual property and open standards at IBM. “They are strategically sharing their intellectual<br />
property and building broader industry partnerships in order to accelerate innovation and drive<br />
new economic growth.”<br />
Novell: “We are proud to be a founding member of the Open Invention Network,” said Jack<br />
Messman, CEO of Novell. “While Novell has been a major contributor to the open source community<br />
and has shown its commitment to promoting and fostering the adoption of open source and<br />
open standards, this initiative raises our leadership to the highest level. With this new initiative,<br />
users of open source software will have access to a broad set of technologies that will help foster<br />
an even more robust community of developers, customers, business partners and investors. This<br />
is a breakthrough idea whose time has come.”<br />
Philips: “Philips is actively involved in the creation and funding of Open Invention Network because<br />
we believe that OIN will make the Linux platform more attractive for users. This will stimulate<br />
developers to focus their resources on creating high-value, innovative software on this open platform,”<br />
said Ruud Peters, chief executive officer of Philips Intellectual Property & Standards. “We<br />
believe that this initiative will widely boost the use of the Linux platform and its applications.”<br />
Red Hat: “By providing this unique collaborative framework, Open Invention Network will set open<br />
source developers free to do what they do best-innovate,” said Mark Webbink, senior vice president<br />
at Red Hat. “At the same time, Open Invention Network extends to distributors and users of<br />
open source software freedom from concern about software patents.”<br />
Sony: “Linux is clearly an important technology for Sony and the global community in general,” said<br />
Yoshihide Nakamura, SVP, Corporate Executive of Sony Corporation. “We believe Linux and open<br />
standards will provide companies with more options for the development of innovative products.<br />
We have and will continue to support initiatives like Open Invention Network that promote a positive<br />
environment for these developments.”<br />
Open-Source-Softwareentwicklung und die im Kasten zuvor genannten Beispiele sind<br />
alles von Nutzern selbst initiierte Projekte. Wir wollen im Folgenden jedoch betrachten,<br />
wie herstellerinitiierte Communities für Open Innovation aussehen und funktionieren<br />
können (siehe hierzu auch die Beiträge in Herstatt / Sanders 2004). Diese virtuellen<br />
Innovationsgemeinschaften können in sämtlichen Phasen des Innovationsprozesses<br />
eingesetzt werden. Grundsätzlich lassen sich dabei zwei unterschiedliche Vorgehensweisen<br />
unterscheiden:<br />
183<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Kasten 3–18: Beispiele der Übertragung des Gedankens der Open-Source-Software-<br />
Entwicklung auf andere Bereiche<br />
Free-CPU-Projekte (www.f-cpu.org, www.free-ip.com): Diese Projekte wollen zeigen, dass selbst<br />
Mikroprozessoren in einer Innovations-Community entwickelt werden können. “Anyone may join<br />
the team and contribute - or even contribute without officially “joining” in any way. Even those with<br />
limited or no knowledge of CPU development can have something to contribute. The name of the<br />
game is Freedom, so our designs are being developed openly and will be openly distributable<br />
under a GNU GPL-like license, so anyone will be able to (if they have the funding at least) take<br />
our designs and manufacture and sell their own FCPU or derivative chips, but any changes will<br />
have to be made freely available again”. “Free-IP is a block of logic that can be used in making<br />
ASIC’s and FPGA’s. Examples are UART’s, CPU’s, Ethernet Controllers, PCI Interfaces, etc. In<br />
the past, quality cores of this nature could cost anywhere from US$5,000 to more than<br />
US$350,000.”<br />
Open Enzyklopädien (z. B. www.wikipedia.com, www.nupedia.com, www.opencontent.org):<br />
Mittlerweile gibt es zahlreiche Projekte, die den Open-Source-Gedanken auf eine frei zugängliche<br />
Enzyklopädie übertragen. Basierend auf möglichst vielen freiwilligen Beiträgen soll eine qualitativ<br />
hochwertige, verlässliche und vielfältige Enzyklopädie in mehreren Sprachen entstehen. In den<br />
meisten Fällen werden die eingesandten Artikel überprüft, um einen gewissen Qualitätsstandard<br />
zu gewährleisten. Damit soll den vorhandenen, oft sehr teuren professionellen Enzyklopädien ein<br />
Gegenpol entgegengesetzt werden, der auf dem Wissen der Nutzer und unzähliger Fachleute<br />
beruht (siehe auch die Fallstudie zu Wikipedia in Abschnitt 5.2).<br />
OSCar Project (www.theoscarproject.org): Der Name OSCar steht für ein ambitioniertes Projekt,<br />
in dem die Entwicklung eines Autos nach Open-Source-Prinzipien ablaufen soll. Statt der bei<br />
Automobilherstellern üblichen strengen Geheimhaltung sind hier die Ideen, Designs und<br />
Entwicklungspläne öffentliches Gut. Seit Juni 2000 debattieren motivierte Freiwillige, kreative<br />
Tüftler und Bastler, Laien sowie engagierte Spezialisten in verschiedenen Foren unter anderem<br />
über Vorschläge für Design, Antrieb, Technik, Elektronik und Sicherheit des OSCar. Soll das Web-<br />
Auto nun Flügeltüren bekommen? Windschutzscheiben aus Kunststoff? Kameras statt<br />
Außenspiegel? Der Fantasie der Hobby-Ingenieure sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, fast<br />
keine, denn ein paar Kriterien, die das Web-Auto erfüllen muss, standen von Anfang an fest: Das<br />
OSCar sollte auf jeden Fall ein leichter Kleinwagen werden, nicht teurer als 8 000 Euro und 140<br />
Stundenkilometer schnell sein.<br />
Auswertung existierender Gemeinschaften: Zum einen besteht die Möglichkeit,<br />
existierende virtuelle Gemeinschaften zu beobachten und Postings der einzelnen<br />
Mitglieder auf Ideen für den Innovationsprozess auszuwerten.<br />
Etablierung virtueller Innovationsgemeinschaften: Zum anderen können Unternehmen<br />
selbst eine virtuelle Gemeinschaft etablieren, die explizit darauf fokussiert,<br />
Innovationen hervorzubringen. Die Idee ist hier, Innovationsaufgaben an diese virtuelle<br />
Gemeinschaft zu richten, deren Mitglieder dann gemeinsam an Lösungen für<br />
diese Aufgabe arbeiten.<br />
Beobachtung virtueller Gemeinschaften<br />
Bei der Beobachtung virtueller Gemeinschaften werden die Beiträge einzelner Mitglieder<br />
der Gemeinschaft auf innovationsrelevante Inhalte untersucht (Henkel / Sander<br />
184
Instrumente von Open Innovation<br />
2003; Sawhney / Prandelli 2000). Besonders geeignet sind hierfür verbraucher- und<br />
unternehmensorientierte virtuelle Produktgemeinschaften, bei denen sich die Themen<br />
um Produkte oder Marken konstituieren (siehe Abbildung 3–19 für Beispiele). Dabei<br />
kann es sich um Produkte oder Produktgruppen eines einzelnen Herstellers handeln,<br />
aber auch um das Produktangebot einer Branche. Manche dieser Communities sind<br />
herstellerorganisiert, andere von Intermediären, andere von den Nutzern selbst<br />
(Pfeiffer 2002).<br />
Abbildung 3–19: Beispiele für Meinungsplattformen und Marken-Communities im Internet<br />
(in Anlehnung an Pfeiffer 2002: 21)<br />
Community<br />
Geschäftsmodell<br />
dooyoo.de kommerziell<br />
vocatus.de kommerziell<br />
Lugnet.com<br />
Java developer<br />
community<br />
Camp Jeep<br />
Rally<br />
mcspotlight.org<br />
john's swoosh<br />
page (acaria.com<br />
/ jsp / )<br />
starbucked.com<br />
newsgroup.<br />
misc.consumers<br />
newsgroup<br />
alt.destroy.<br />
microsoft<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
kommerziell<br />
kommerziell<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
nicht<br />
kommerziell<br />
Objekt Organisator Inhalt<br />
verschiedene<br />
Kategorien (mehr<br />
als 100 000<br />
Marken)<br />
verschiedene<br />
Kategorien<br />
eine Marke<br />
(LEGO)<br />
ein Produkt<br />
(SUN Java)<br />
eine Marke<br />
(JEEP)<br />
eine Marke<br />
(MC DONALD'S)<br />
eine Marke<br />
(NIKE)<br />
eine Marke<br />
(STARBUCKS)<br />
verschiedene<br />
Kategorien<br />
eine Marke<br />
(MICROSOFT)<br />
Intermediär<br />
Intermediär<br />
Nutzergruppe<br />
Hersteller<br />
Hersteller<br />
positive & negative<br />
Produktbeurteilungen<br />
positive & negative<br />
Produktbeurteilungen<br />
Fan Site, Kommentare<br />
und Handel<br />
Hilfestellungen, Feedback<br />
zu Produkten<br />
positive Erfahrungen,<br />
Produkt-Information<br />
Nutzergruppe negative Erfahrungen<br />
Nutzergruppe<br />
Nutzergruppe<br />
Nutzergruppe<br />
positive Erfahrungen<br />
und Produkt-<br />
Information<br />
negative Ausgangssituation,<br />
positive and<br />
negative Beiträge<br />
anderer Nutzer<br />
positive und negative<br />
Erfahrungen<br />
Nutzergruppe negative Erfahrungen<br />
185<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
Innerhalb einer solchen Gemeinschaft tauschen die Teilnehmer ihre Erfahrungen mit<br />
dem Produkt aus, kommunizieren ihre Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit dem<br />
Produkt oder leisten sich untereinander Hilfestellungen, wenn es darum geht, den<br />
Nutzen des Produktes vollständig zu erschließen oder Reparaturen durchzuführen.<br />
Häufige Diskussionen drehen sich zudem um die Frage, wo ein bestimmtes Produkt zur<br />
Zeit am günstigsten erworben werden kann. Unternehmen können sich eine solche virtuelle<br />
Produktgemeinschaft zu Nutze machen, indem sie die Beiträge der Teilnehmer<br />
nach innovationsrelevanten Informationen durchsuchen. Für ein solches Vorgehen bieten<br />
sich insbesondere virtuelle Gemeinschaften an, die auf Content Trees und Bulletin<br />
Boards basieren. Bulletin Boards erlauben es, verschiedene Themenstränge zu separieren<br />
und die Konversation der Teilnehmer im Nachhinein exakt nachzuvollziehen. Zudem<br />
speichern sie Kommunikationsstränge zentral und langfristig (Henkel / Sander 2003).<br />
Die Beiträge in einzelnen Communities sind oft sehr umfangreich und enthalten eine<br />
Fülle interessanter Informationen für einen Hersteller. Dabei handelt es sich zum einen<br />
um Beschwerden und Unzufriedenheitsäußerungen zu bestimmten Produktfeatures,<br />
zum anderen aber auch um Lob und ein besonderes Hervorheben einzelner Features.<br />
Bereits diese Informationen sind wichtige Anhaltspunkte für die Neuproduktentwicklung.<br />
Manche Beträge beinhalten aber nicht nur wahrgenommene Fehlfunktionen<br />
eines Produkts, sondern auch genaue Vorschläge zur deren Behebung, Lösungsvorschläge<br />
zur Steigerung der Performance, Ideen für weitere Produktattribute oder technologische<br />
Verbesserungsmöglichkeiten. Vorschläge können jedoch auch auf grundlegend<br />
neue Innovationsideen abzielen – von einer Idee bis hin zu ersten Prototypen aus<br />
der Eigenentwicklung eines Gemeinschaftsmitglieds.<br />
Das Problem ist aber oft die Identifikation dieser innovativen Beträge. Die Suche<br />
nach innovativen Beiträgen einzelner Mitglieder der Gemeinschaft kann für ein<br />
Unternehmen mit hohem zeitlichem Aufwand verbunden sein. Henkel und Sander<br />
(2003) belegen dies mit einer empirischen Untersuchung: Die Produktgemeinschaft<br />
smart-club.de für das gleichnamige Automobil verzeichnete beispielsweise innerhalb<br />
von 15 Monaten nach ihrer Gründung 43.000 Beiträge. In einer Untersuchung wurden<br />
6640 Beiträge dieser Gemeinschaft manuell ausgewertet und einer der folgenden vier<br />
Kategorien zugeordnet (Henkel / Sander 2003):<br />
Prototyp vorhanden (Kategorie 1): Beiträge, in denen ein Prototyp beschrieben<br />
wird oder erkennbar ist, dass der Teilnehmer einen solchen bereits realisiert hat<br />
Lösungsvorschlag (Kategorie 2): Beiträge, welche einen theoretischen Lösungsvorschlag<br />
für ein Problem präsentieren<br />
Problem erkannt (Kategorie 3): Beiträge die ein objektiv neues, bisher nicht bekanntes<br />
Problem beschreiben<br />
nicht innovativ (Kategorie 4): alle übrigen Beiträge, zum Beispiel zum Thema<br />
Chiptuning, HiFi-Komponenten, …<br />
Im Ergebnis enthielten nur 1,13 Prozent aller untersuchten Beiträge innovationsrelevante<br />
Informationen (Kategorie 1-3), während 98,87 Prozent der Beiträge vom Typ<br />
“nicht innovativ” (Kategorie 4) waren. Somit besteht die zentrale Herausforderung<br />
186
darin, innovative Beiträge aus der Masse der Postings effizient zu filtern. Dies wäre<br />
dann möglich, wenn sich innovative und nicht innovative Beiträge in bestimmten<br />
Merkmalen signifikant unterscheiden.<br />
Potenziell kommen hierzu drei Unterscheidungsmerkmale in Frage, ohne weitere<br />
Primärerhebungen innerhalb der Gemeinschaft durchzuführen (z. B. Screening-<br />
Fragebögen oder Pyramiding): die Form-, Subjekt- und Inhaltsebene der Beiträge. Die<br />
Formebene umfasst die beiden Eigenschaften “Länge der Beiträge” sowie “Ebene der<br />
Beiträge innerhalb der Baumstruktur des Kommunikationsstranges”. Die<br />
Subjektebene wird durch die Eigenschaften “Anzahl der Beiträge pro Verfasser, Länge<br />
der Zugehörigkeit der Verfasser zur Gemeinschaft” sowie “Existenz innovativer<br />
Cluster”, d. h. Gruppen von Mitgliedern der Gemeinschaft, die innovative Beiträge<br />
untereinander austauschen, aufgespannt. Die Inhaltsebene beschreibt schließlich die<br />
sprachliche Konstruktion der Beiträge durch Verwendung innovationsassoziativer<br />
Ausdrücke (z. B. Idee, unzufrieden, Lösung, Verbesserung, Prototyp, eigene<br />
Konstruktion).<br />
Eine Analyse der smart-club.de Beiträge auf Subjekt- und Objektebene kommt zu folgendem<br />
Ergebnis. Innovative Beiträge der Kategorie “Prototyp erkannt” waren im<br />
Mittel signifikant länger als Beiträge anderer Kategorien. Des Weiteren hat die Ebene<br />
des Kommunikationsstranges signifikanten Einfluss auf Beiträge der Kategorie<br />
“Problem erkannt”. Diese Beiträge finden sich vor allem auf der ersten Ebene des<br />
Kommunikationsstranges. Die Subjektebene hingegen liefert keine signifikanten<br />
Anhaltspunkte, um innovative von nicht innovativen Beiträgen zu unterscheiden.<br />
Keine Erkenntnisse liegen bisher für die Inhaltsebene vor, obwohl vermutet werden<br />
kann, dass diese signifikanten Erklärungswert besitzt.<br />
Bei Existenz unterscheidungsrelevanter Eigenschaften zur Identifikation innovativer<br />
Beiträge verspricht der Einsatz softwaregestützter automatisierter Inhaltsauswertungen<br />
eine Effizienzsteigerung gegenüber einer manuellen Auswertung. Eine solche<br />
Filtersoftware lässt sich auf das Erkennen von Beiträgen mit definierten<br />
Merkmalsausprägungen trainieren und wurde auch in der Smart-Gemeinschaft auf<br />
Eignung getestet. Die Untersuchung kommt zu dem ermutigenden Ergebnis, dass<br />
grundsätzlich eine softwaregestützte Identifikation möglich erscheint, auch wenn verfügbare<br />
Produkte bisher noch Verbesserungsbedarf haben (Henkel / Sander 2003).<br />
Etablierung virtueller Innovationsgemeinschaften<br />
Instrumente von Open Innovation<br />
Bei den zuvor betrachteten virtuellen Produktgemeinschaften entstehen innovationsrelevante<br />
Beiträge als “Nebenprodukt”. Die Gemeinschaft ist nicht originär darauf ausgerichtet,<br />
Innovationen zu generieren. Anders verhält es sich bei virtuellen<br />
Innovationsgemeinschaften. In diesen verfolgen die Mitglieder das Ziel, gemeinsam<br />
innovative Problemlösungen zu erarbeiten. Diese sind häufig auch vom Hersteller<br />
initiiert und werden von diesem betreut (Bartl / Ernst / Füller 2004; Füller et al. 2004).<br />
Wichtigste Aufgabe ist in diesem Zusammenhang die Etablierung einer geeigneten<br />
virtuellen Gemeinschaft. Denn im Gegensatz zur reinen Beobachtung von Produkt-<br />
Communities zielt der Hersteller hier auf eine intensive Interaktion zwischen und mit<br />
den Mitgliedern der Gemeinschaft. Betreibt ein Unternehmen bereits eine aktive vir-<br />
187<br />
3.5
3<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation<br />
tuelle Gemeinschaft (z. B. eine Produktgemeinschaft, Kundenclub), bietet diese meist<br />
eine geeignete Ausgangsbasis für eine Innovationsgemeinschaft. Ist dies nicht der Fall,<br />
entstehen hohe Kosten für den Aufbau, die Pflege und den Betrieb der Community, vor<br />
allem jedoch für die Akquise von Gemeinschaftsmitgliedern. Auch sind viele<br />
Initiativen von Herstellern fehlgeschlagen, selbst virtuelle Gemeinschaften um ihr<br />
Produkt zu etablieren. Überaus erfolgreich war dagegen Muji, ein japanischer<br />
Hersteller und Händler von Haushaltswaren (Kasten 3–19).<br />
Kasten 3–19: Nutzung von Input aus Kunden-Communities bei MUJI<br />
(Quelle: Auszug aus: Susumu Ogawa und <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>: Collective Customer Commitment, MIT<br />
Sloan School of Management Working Paper, October 2005 [online: userinnovation.mit.edu])<br />
Muji is a Japanese specialty retail chain with 2004 sales topping 117,100 million Yen. Muji is a household<br />
name in Japan for all kind of consumer commodities, and highly acclaimed in Europe for its<br />
industrial design and product esthetics. Its major product categories are apparel (38 % of total<br />
sales), household goods & stationary (52%), and food (10%). While the company is famous for its<br />
powerful internal design practice, it has a very strong method to incorporate customer input into<br />
the new product development process.<br />
In its Japanese home market, the company receives more than 8000 suggestions for product<br />
improvements or new product ideas each month. Suggestions are sent as postcards attached to<br />
catalogues, as e-mails or via feedback forms on the company’s website. On the internet, Muji has<br />
an online customer community, Muji.net, with approximately 410,000 members. On the sales floor,<br />
sales associates are encouraged to collect notes on customer behavior and short quotes from<br />
sales dialogues. More than 1000 of these memos are processed each month. The company even<br />
organizes a vacation club, Muji Camp, where customers can experience a summer vacation with<br />
Muji products. The camp provides Muji with the opportunity to observe customers during the camp<br />
and to develop relationships with the vacationers that go beyond the summer.<br />
This dazzling array of customer input is motivated by the customers’ high involvement with the<br />
brand. In return, Muji acknowledges the customer input by marking products triggered by suggestions<br />
of customers clearly in its catalog. Notwithstanding this openness to external input, product<br />
planning and product development remains a closed, internal managed process. Customer input<br />
is collected, categorized and evaluated in a structured process, resulting in an internal short-list of<br />
top ideas which are discussed in a “business improvement meeting” by a management board,<br />
including the company president. This board has also the sole decision how to proceed with a submitted<br />
idea.<br />
Ein alternatives Vorgehen besteht in der Option, eine fremde Gemeinschaft zu nutzen<br />
und Innovationsaufgaben an diese zu richten. Voraussetzung ist dazu, dass diese nicht<br />
nur existiert und aus einer Gruppe von Teilnehmern besteht, die die notwendigen<br />
Eigenschaften in Hinblick auf die Innovationsaufgabe hat, sondern dass der Betreiber<br />
dieser Community auch zur Mitwirkung gewonnen werden kann. Auf diese vorhandene<br />
virtuelle Innovationsgemeinschaft kann ein Hersteller nun verschiedene<br />
Instrumente, die wir bereits zuvor beschrieben haben, anwenden. So bietet eine<br />
Innovationsgemeinschaft eine gute Gelegenheit für einen Innovationswettbewerb, der<br />
188
Instrumente von Open Innovation<br />
aber gegebenenfalls offen gestaltet wird, so dass die Nutzer auf die Beiträge anderer<br />
aufbauen können (ein Beispiel ist der User Contest von MathWorks, siehe mathworks.com/contest).<br />
Ebenfalls können Toolkits for User Innovation durch mehrere<br />
Nutzer bedient werden, die gemeinschaftlich eine Lösung schaffen (<strong>Piller</strong> et al. 2005).<br />
Der Automobilhersteller Peugeot nutzte beispielsweise eine virtuelle Innovationsgemeinschaft,<br />
um von dieser neue Autodesigns entwickeln zu lassen. Grundlage<br />
waren exisiterende Online-Communities von Autofans. Mehr als 2800 Designer aus 90<br />
Nationen beteiligten sich an dieser Aufgabe. Volvo hingegen präsentierte einer<br />
Innovationsgemeinschaft visualisierte Prototypen neuer Fahrzeuge und bat die<br />
Mitglieder der Gemeinschaft um Feedback (Bartl / Ernst / Füller 2004; Füller et al.<br />
2004). Zu Beginn dieses Buchs haben wir bereits anhand des Unternehmens<br />
Threadless gesehen, wie ein Unternehmen sein gesamtes Geschäftsmodell auf eine virtuelle<br />
Innovationsgemeinschaft ausgerichtet hat, die sowohl neue Produkte entwickelt,<br />
diese bewertet, vertreibt und kauft.<br />
Kasten 3–20: Literaturempfehlungen zu Open Innovation Communities<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / Shah, Sonali (2003). How communities support innovative activities: an<br />
exploration of assistance and sharing among end-users. Research Policy, 32 (2003) 1: 157-<br />
178.<br />
Füller, Johann (2005). Community Based Innovations – Virtual Integration of Online Consumer<br />
Groups into New Product Development. Dissertation an der Fakultät für Betriebswirtschaft der<br />
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Oktober 2005.<br />
McAlexander, James H. / Schouten, John / Koenig, Harold (2002). Building brand community.<br />
Journal of Marketing, 66 (2002) 1 (January): 38-54.<br />
Sawhney, Mohanbir / Prandelli, Emanuela (2000). Communities of creation: Managing distributed<br />
innovation in turbulent markets. California Management Review, 42 (2000) 4: 24-54.<br />
Shah, Sonali (2005). Open beyond software. In: Danese Cooper / Chris DiBona / Mark Stone<br />
(eds.): Open Sources 2, Sebastopol, CA: O’Reilly 2005: 339-360.<br />
189<br />
3.5
4 Interaktive Wertschöpfung in der<br />
Produktion: Individualisierung<br />
und Mass Customization<br />
Open Innovation und eine Integration der Kunden in den Innovationsprozess ist – aus<br />
Firmensicht – eine meist sehr neue Vorgehensweise. In einem anderen Fall der<br />
Leistungserstellung dagegen ist die Kundenintegration eine gängige Praxis: bei der<br />
Individualisierung von Produkten und Leistungen. Im Gegensatz zur Produktion<br />
massenhafter, standardisierter Güter kann eine individuelle Leistung nur dann erstellt<br />
werden, wenn der Hersteller mit dem Kunden vor der Leistungserstellung interagiert,<br />
um die Wünsche und Spezifikationen für das individuelle Produkt zu erfragen. Damit<br />
kommt es auch hier zu einer Integration der Kunden in einen gemeinsamen Wertschöpfungsprozess<br />
mit den Anbietern. Wir wollen im Rahmen unserer Diskussion der<br />
interaktiven Wertschöpfung als neue Form der Organisation arbeitsteiliger Leistungserstellungsprozesse<br />
zwischen Kunden und Herstellern die Produktindividualisierung<br />
aus zwei Gründen genauer betrachten:<br />
In der Praxis ist in manchen Industrien heute eine recht weite Verbreitung einer<br />
Produktindividualisierung festzustellen. Damit ergibt sich hier ein gutes Feld für<br />
eine empirische Analyse, um zur untersuchen, wie Wertschöpfungsprozesse und<br />
unterstützende Strukturen bei einer interaktiven Wertschöpfung im Allgemeinen<br />
zielführend gestaltet werden können. Interaktionsprozesse bei Produktindividualisierung<br />
können wichtige Anhaltspunkte für eine Gestaltung eines interaktiven<br />
Innovationsprozesses geben. Dies gilt insbesondere auf der Ebene der<br />
Instrumente: Produktkonfiguratoren zur Individualisierung sind ein wesentliches<br />
Vorbild von Toolkits für Open Innovation.<br />
Jedoch ist auch die Individualisierung an sich eine spannende Strategie für viele<br />
Unternehmen. Lange Zeit schien aufgrund der hohen zusätzlichen Kosten der<br />
Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager eine Individualisierung nur bei<br />
(margenträchtigen) Industriegütern sinnvoll. Im Bereich von Konsumgütern blieb<br />
die Individualisierung ein Nischenphänomen. Jedoch erlauben in jüngster Zeit<br />
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien eine drastische<br />
Senkung der Interaktionskosten. Der Begriff Mass Customization greift diesen<br />
Gedanken auf und beschreibt die Erstellung individueller Güter und Leistungen,<br />
ohne dabei die mit einer Massenproduktion verbundenen Kostenvorteile aufzugeben.<br />
Damit wird eine Produktindividualisierung für deutlich mehr Marktsegmente<br />
als Option zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen interessant. Wir haben bereits<br />
im Grundlagenkapitel mit Dell (Kasten 2–4) und Spreadshirt (Kasten 2–8) typische<br />
Beispiele für Mass Customization kennen gelernt. Ein weiteres prominentes<br />
Beispiel ist das ‘mi adidas’-Programm von Adidas-Salomon (Kasten 4–1).<br />
191
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Eine Produktindividualisierung konkretisiert damit die interaktive Wertschöpfung im<br />
Produktionsbereich und ist ein wesentliches Mittel zur Durchsetzung einer nachhaltigen<br />
Differenzierungsstrategie (siehe Abschnitt 2.4.5). Wir werden in diesem Kapitel<br />
zunächst allgemein die Prinzipien und Eigenschaften der Produktindividualisierung<br />
diskutieren. Schwerpunkt ist dabei der Mass-Customization-Ansatz, d. h. die<br />
Individualisierung von Gütern und Leistungen für eine relativ große Zahl an<br />
Abnehmern unter ähnlichen Effizienzbedingungen eines vergleichbaren Massenproduktionssystems.<br />
Die Betrachtung dieser Effizienzbedingungen steht im<br />
Mittelpunkt der dann folgenden Analyse. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels betrachtet<br />
konkrete Instrumente der Interaktion zwischen Kunden und Herstellern bei Mass<br />
Customization.<br />
Kasten 4–1: mi adidas: Das Mass-Customization-Programm von Adidas<br />
Die internationale Sportschuhindustrie ist ein Paradebeispiel für innovatives Variantenmanagement.<br />
Die fünf größten Marken – Nike, Adidas, Reebok, Asics und Puma – produzieren<br />
nicht mehr selbst, sondern verlassen sich auf ein “Outsourcing” der Produktion, oft bei den gleichen<br />
Lieferanten. Die Kernkompetenzen dieser Firmen sind die Erkennung von Markttrends sowie<br />
das Design und die Entwicklung neuer Produkte. Umfassende Marktforschung, verlässliche<br />
Vorhersagen und ein gutes Supply Chain Management werden so zusammen mit einer starken<br />
Markenführung als Grundlage für den Erfolg in der Branche gesehen. Allerdings stehen auch<br />
Marktführer wie Adidas und Nike Problemen gegenüber: Ihr Markenname wird von neuen, modischen<br />
Kleidungsmarken herausgefordert. Die Konsumenten verlangen hochqualitative Schuhe für<br />
weniger Geld, und die Kundenloyalität sinkt rapide.<br />
Diese und andere Trends veranlassten Adidas, im Jahr 2001 die individualisierbare Produktlinie<br />
“mi adidas” einzuführen. Damit sollte auch ein anderes Problem angegangen werden. Aufgrund<br />
der wachsenden Individualisierung der Nachfrage und einer zunehmenden Segmentierung des<br />
Gesamtmarktes in Mikronischen war die Zahl an Produktvarianten explodiert. Diese Entwicklung<br />
macht die Absatzplanung schwieriger als je zuvor. Folge sind hohe Lagerbestände, ein zunehmendes<br />
Moderisiko, eine sehr hohe Komplexität in der Zuliefer-Kette und immer größere Discounts,<br />
um fehlgeplante Produkte loszuwerden. Dazu kommt verlorener Umsatz bei Produkten, die vom<br />
Markt besser angenommen wurden als erwartet, aber nicht in ausreichenden Mengen oder in richtigen<br />
Größen verfügbar waren.<br />
Das Mass-Customization-Programm von Adidas dient als Antwort auf diese Herausforderungen. In<br />
speziellen Einzelhandelsgeschäften und bei ausgesuchten Veranstaltungen können die Kunden<br />
individualisierte Schuhe erwerben. Sie können dabei ihre Schuhe in Bezug auf Passform, Funktion<br />
und Design selbst anpassen. Solch ein Service war bisher Fußballstars wie David Beckham oder<br />
Top-Läufern wie Haile Gebrselassie vorbehalten. Die Schuhe werden zu einem Preis, der etwa<br />
30% über dem des Standardschuhs liegt, verkauft. Mit Hilfe eines Fußscanners werden die Füße<br />
des Kunden gescannt und die genaue Länge, Breite und Druckverteilung jedes Fußes bestimmt.<br />
Dann bespricht der Kunde zusammen mit geschulten Experten die Ergebnisse des Scans. Diese<br />
Information wird zusammen mit persönlichen Passform-Vorlieben in einen Computer eingegeben,<br />
um einen Schuh zu bestimmen, der am besten passt.<br />
Adidas arbeitet entsprechend eines “match-to-order”-Systems in der Vorproduktion. Um die<br />
Komplexität zu senken und die Lieferzeiten zu reduzieren, wird nicht für jeden Kunden ein eigener<br />
Leisten entwickelt, sondern der Fuß eines Kunden einem vorhandenen Leisten zugeordnet. Das<br />
angebotene Größen- und Weitenspektrum ist dabei weitaus höher als im konventionellen<br />
192
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Programm – und nur bei einer reinen Produktion auf Bestellung ohne große Bestandskosten möglich.<br />
Vorrätig in jedem Laden ist aber ein Beispielschuh in einer Grundfarbe und Funktionalität für<br />
die Anprobe. Hat der Kunde seine individualisierte Funktion und Passform ausgewählt, kann er so<br />
den Schuh testen, bevor er zur letzen Designphase übergeht. Der Kunde wählt dabei die<br />
Farbelemente und sucht Materialien aus. Schließlich kann er sich noch ein Monogramm einsticken<br />
lassen. All diese Schritte werden mit Hilfe eines Konfigurators abgewickelt. Ein PC-basierter<br />
Verkaufskiosk führt den Kunden und den Verkäufer durch den gesamten Konfigurationsprozess.<br />
Alle Schuhe werden “on-demand” in Asien hergestellt, wobei die kundenbezogene Lieferzeit etwa<br />
drei Wochen beträgt. Sind die Kundendaten einmal gespeichert sind, können Folgekäufe über<br />
Internet, Call Center oder im Einzelhandel getätigt werden.<br />
Hinweis: Eine ausführliche Darstellung dieses Falls findet sich in Abschnitt 5.1.<br />
4.1 Produktindividualisierung und Mass<br />
Customization<br />
4.1.1 Der Begriff Produktindividualisierung<br />
In der Regel richten sich die Präferenzen eines Nachfragers nicht auf ein Produkt als<br />
solches, sondern auf (Kombinationen von) Eigenschaften, die in dem nachgefragten<br />
Gut verkörpert sind. Diese Präferenzstruktur kann in einem Idealpunkt-Modell abgebildet<br />
werden, das davon ausgeht, dass jeder Käufer in seiner Vorstellung eine<br />
Kombination von Produkteigenschaften (bzw. Ausprägungen dieser) bildet, die sein<br />
“optimales Produkt” kennzeichnet. Diese Kombination bezeichnet den so genannten<br />
Idealpunkt, von dessen Distanz zu der tatsächlichen Eigenschaftskombination die<br />
Präferenz eines Käufers für ein bestimmtes Produkt abhängt (Homburg / Weber 1996):<br />
Je geringer die Distanz, desto höher wird ein Produkt bewertet bzw. desto eher wird es<br />
gekauft (und wieder gekauft, denn in der Praxis erkennt ein Konsument oft erst während<br />
des Gebrauchs eines Produkts dessen “Lage vom Idealpunkt”).<br />
Beim Kauf einer Spezialmaschine wären dies beispielsweise die Anschaffungskosten,<br />
Wartungsfreundlichkeit, Kompatibilität zum bisherigen Maschinenpark, Möglichkeit<br />
einer Einbindung in einen elektronischen Leitstand sowie das Renommee des<br />
Herstellers. Dieses Eigenschaftsbündel charakterisiert die Vorstellung jedes Käufers<br />
über die Produkteigenschaften, die sein “optimales Produkt” kennzeichnen. Die<br />
Abweichung der realen Eigenschaften eines Angebots zum Wunschprodukt bestimmt<br />
die Präferenz für dieses Angebot, d. h. je näher ein Produkt der Wunschvorstellung<br />
eines potentiellen Abnehmers liegt, desto größer ist seine Kaufwahrscheinlichkeit<br />
(<strong>Piller</strong> 1998). Veranschaulichen wir dies an einem einfachen Beispiel (siehe Abbildung<br />
4–1): Die Käuferin einer Hose entscheidet sich für eine neue Hose anhand der Kriterien<br />
“Übereinstimmung mit persönlichem Modegeschmack” und “Passform”. Punkt 1<br />
beschreibt den Idealpunkt einer durchschnittlichen Käuferin, deren Hose genau passend,<br />
in einer mittleren Preislage und nicht zu modisch, aber auch nicht zu bieder sein<br />
soll. Eine andere Käuferin bevorzugt hingegen exklusive (teure) Hosen, die aber dennoch<br />
nicht ausgefallen sein sollten (Nr. 2). Die Käufer 3 und 4 verkörpern den<br />
Gegensatz zwischen der trendbewussten jungen Käuferin (Nr. 4), die in erster Linie<br />
193<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
eine preiswerte, aber dennoch hochmodische und figurbetonte Hose möchte, und einer<br />
anderen Käuferin, die ein unauffälliges, zeitloses und vor allem bequemes Kleidungsstück<br />
bevorzugt (Nr. 3). Eine Hose mit den Eigenschaftsausprägungen P* würde vielleicht<br />
noch von Kundin 1 in Betracht gezogen, da sie lediglich bei der Passform Eingeständnisse<br />
machen müsste. Für alle anderen Kundinnen aber ist die Distanz zwischen<br />
den Ausprägungen dieses Produkts und den gewünschten Idealpunkten zu groß.<br />
Abbildung 4–1: Idealpunkte eines Produkts aus Kundensicht (Nr. 1-4) im Vergleich zu den<br />
realen Produkteigenschaften (P*) als Kaufentscheidungskriterium (entnommen<br />
aus <strong>Piller</strong> 1998 in Anlehung an Homburg / Weber 1996)<br />
Bei einer Massenfertigung wird während des Entwicklungsprozesses versucht, mittels<br />
Marktforschung die Präferenzen aller potenzieller Kunden des angestrebten<br />
Marktsegments zu antizipieren und zu einem gemeinsamen Mittelwert zu vereinen,<br />
der möglichst nahe an der Wunschvorstellung möglichst vieler Nachfrager liegt (dies<br />
ist genau der Kern der Conjoint-Analyse, einem der heute gängigsten Marktforschungsinstrumente).<br />
Oft werden dabei im Sinne einer Variantenfertigung mehrere<br />
Produktvarianten gebildet, die Clustern von “Idealpunkten” (d. h. Teilsegmenten von<br />
Kunden) im gesamten Eigenschaftsraum entsprechen. Allerdings haben die Abnehmer<br />
auf den meisten Märkten keine vollständige Markttransparenz über alle verfügbaren<br />
Produkte bzw. Varianten, woraus für sie eine latente Unsicherheit hinsichtlich der<br />
Angebotsbreite und –qualität folgt. Ein Käufer ist nie sicher, ob das von ihm gekaufte<br />
Produkt tatsächlich jenes unter allen angebotenen ist, das seinen persönlichen<br />
Präferenzen am besten entspricht. Das Konstrukt der kognitiven Dissonanz in der<br />
Nachkaufphase beschreibt in diesem Zusammenhang den (negativen) Zustand, dass<br />
ein Käufer nach erfolgtem Kauf ein anderes, näher an seinem Idealpunkt liegendes<br />
194<br />
weit<br />
Paßform<br />
eng<br />
3<br />
Mode<br />
bieder modisch<br />
2<br />
1<br />
P*<br />
4<br />
Preis<br />
billig<br />
teuer
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Produkt entdeckt und mit dem getätigten Kauf unzufrieden wird – womit sich die<br />
Chance eines Wiederkaufs des ersten Guts reduziert.<br />
Ein Hersteller kann diese Unsicherheit nutzen, indem er im Zuge einer individuellen<br />
Leistungserstellung die Wünsche der Nachfrager exakt erfüllt (den jeweiligen<br />
“Idealpunkt” produziert) und so gewissermaßen “persönliche” Präferenzen für seine<br />
Produkte schafft. Die Individualisierung seiner Produkte und Leistungen hebt ihn von<br />
seinen Konkurrenten ab, da er aus Abnehmersicht die Unsicherheit über die<br />
“Passgenauigkeit” der gekauften Güter verringert (Du / Tseng 1999; Homburg /<br />
Giering / Hentschel 1999). Bei solch einer Produktindividualisierung werden die<br />
Produkteigenschaften, welche die Präferenz des Abnehmers bestimmen, so angepasst,<br />
dass sie dem Idealpunkt (Präferenzstruktur) des Abnehmers entsprechen (Basis dieses<br />
Präferenzmodells ist die Konsumtheorie nach Lancaster 1979). Der erste Schritt ist folglich<br />
nach der Akquise des Kunden die Erhebung seiner konkreten Bedürfnisse und<br />
deren Überführung in konkrete Produkteigenschaften, an die sich die Leistungserstellung<br />
anschließt (Hildebrand 1997; Jacob 1995). Dieser Vorgang ist durch eine<br />
enge Interaktion zwischen Anbieter und Abnehmer geprägt, die wir in diesem<br />
Kapitel noch ausführlich betrachten werden.<br />
Unter Produktindividualisierung wird somit eine Form der Leistungserstellung verstanden,<br />
die darauf abzielt, die Eigenschaften der angebotenen Produkte und<br />
Leistungen auf die Präferenzstruktur jedes einzelnen Abnehmers auszurichten, um so<br />
einen Differenzierungsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erlangen (Meffert 1998).<br />
Eine kundenindividuelle Produktion hebt die Anonymität des einzelnen Nachfragers<br />
auf und passt die Leistung an die Anforderungen an, die der jeweilige Abnehmer an<br />
sie stellt. Ergebnis ist die optimale Zusammenstellung von Produkteigenschaften aus<br />
Sicht eines Käufers. Grundsätzlich gilt, dass der Nutzenzuwachs einer individuellen<br />
Produktion aus Abnehmersicht je höher ist, desto heterogener die Präferenzen der verschiedenen<br />
Kunden in einem Markt in Bezug auf ein Grundidee sind, d. h. je weiter<br />
die Idealpunkte der einzelnen Kunden auseinander liegen. Das Beispiel von ‘mi adidas’<br />
macht dies für den Konsumgüterbereich deutlich. Hier werden die Passform des<br />
Schuhs, die Funktionalität (Dämpfungssystem) und das äußere Design an die<br />
Wünsche des Kunden angepasst. Ziel der Individualisierung im Industriegüterbereich<br />
ist es, das Angebot den individuellen Besonderheiten seiner Verwendung in<br />
der Wertkette des Nachfragers anzupassen.<br />
Unter Produktindividualisierung wird eine Form der Leistungserstellung verstanden, die darauf<br />
abzielt, die Eigenschaften der angebotenen Produkte und Leistungen auf die Präferenzstruktur<br />
jedes einzelnen Abnehmers auszurichten, um so einen Differenzierungsvorteil gegenüber<br />
der Konkurrenz zu erlangen.<br />
Auch wenn der Individualisierungsbegriff primär auf die Leistungserstellung materieller<br />
Güter bezogen wird, kann eine Individualisierung auch an Dienstleistungen<br />
ansetzen (Abbildung 4–2). Ebenso kann sie auch die Gestaltung der Geschäfts-<br />
195<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
beziehung zwischen Hersteller und Abnehmer einschließen (z. B. in Form einer personalisierten<br />
Kommunikation, siehe Hildebrand 1997).<br />
Eine Individualisierung materieller Produkte entspricht in der Regel einer Einzelfertigung<br />
(auch: Fertigung “on demand” oder “make-to-order”). Während ein<br />
Angebot vorgefertigter Varianten dem Nachfrager lediglich die Auswahl der Variante<br />
ermöglicht, die seinen Bedürfnissen am nächsten kommt, wird bei einer<br />
Einzelfertigung die Produktion erst gestartet, wenn der Kundenauftrag und ein<br />
Produktentwurf vorliegt, der den Anforderungen des Kunden gerecht wird (allerdings<br />
kann aus Kundensicht eine Individualisierung auch mit der Zuordnung der<br />
Kundenwünsche zu einer existierenden Auswahl an vorgefertigten Produkten erfolgen;<br />
dieser Fall ist aber aufgrund von Lagerhaltungskosten und dem Variantenrisiko<br />
in der Regel nicht wirtschaftlich). Darüber hinaus bieten aber auch die das materielle<br />
Kernprodukt begleitenden Dienstleistungen einen Ansatzpunkt zur Individualisierung.<br />
In diesem Fall wird ein materielles Produkt durch Dienstleistungen<br />
ergänzt, die genau auf den einzelnen Abnehmer ausgerichtet sind. Hierbei ist zu<br />
unterscheiden, ob es sich um eine Individualisierung von Primär- oder Sekundärdienstleistungen<br />
handelt oder aber die Kommunikation zwischen Anbieter und<br />
Abnehmer personalisiert wird (“one-to-one-Marketing”). Die ausführliche Fallstudie<br />
in Abschnitt 5.3 gibt ein gutes Beispiel einer Individualisierung von<br />
Dienstleistungen.<br />
Abbildung 4–2: Möglichkeiten der Produktindividualisierung (in Anlehnung an Homburg /<br />
Weber 1996)<br />
Den Gegenpol zur Individualisierung der Leistungserstellung bildet die Standardisierung,<br />
deren Nutzen in erster Linie in der Realisierung einer günstigen Kostenposition<br />
und damit in der Unterstützung der Kostenführerschaft gesehen wird. Die speziellen<br />
Eigenschaften der Individualisierung lassen sich am einfachsten im Vergleich zur<br />
Standardisierung darstellen (siehe Abbildung 4–3). Jedoch sind Individualisierung und<br />
Standardisierung nicht als Gegensätze aufzufassen, sondern bilden die Endpunkte<br />
196<br />
Möglichkeiten einer einzelkundenbezogenen Leistungserstellung<br />
Individualisierung des tangiblen (materiellen)<br />
Leistungsangebots, jeweils bezogen<br />
auf die Funktion, die Qualität oder das<br />
Design des Produkts<br />
Individualisierung des intangiblen<br />
(immateriellen) Leistungsangebots in<br />
Form der Ergänzung des Produkts um<br />
Dienstleistungen<br />
Produktanpassungen<br />
Sonderanfertigungen (kundenbezogene<br />
Variantenfertigung)<br />
Einzelanfertigungen<br />
Ergänzung um Primärdienstleistungen<br />
(Vermarktung unabhängig vom Produkt)<br />
Ergänzung um Sekundärdienstleistungen<br />
(Vermarktung im Verbund mit dem<br />
Produkt)<br />
Personalisierung der Kommunikation
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
eines Kontinuums, zwischen denen eine Vielzahl von Handlungsalternativen liegt<br />
(Hildebrand 1997; Lampel / Mintzberg 1996; Mayer 1993).<br />
Das Beispiel von Adidas in Kasten 4–1 verdeutlich diesen Sachverhalt: Das<br />
Unternehmen hat heute drei verschiedene Strategietypen der Marktbearbeitung. Das<br />
so genannte “Inline”-Programm bedient den Großteil der Nachfrager, die im Handel<br />
aus vorgefertigten Produktprogrammen einen passenden Standardschuh aussuchen.<br />
Dabei handelt es sich aber auch schon nicht mehr um eine klassische Massenfertigung,<br />
sondern um eine hoch variable Variantenproduktion mit vielen tausend verschiedenen<br />
Produktarten, die gleichzeitig auf dem Markt angeboten werden. Dennoch werden alle<br />
Inline-Produkte “auf Verdacht” vorgefertigt. Auf der anderen Seite des Kontinuums<br />
fertigt Adidas in teurer Handarbeit für wenige Premiumkunden seit Bestehen des<br />
Unternehmens individuelle Produkte in Einzelfertigung. Diese Schuhe sind ganz<br />
genau auf die Laufeigenschaften ausgewählter Spitzensportler angepasst. Für einen<br />
Marathonprofi ist der Schuh das wichtigste Arbeitsmittel, entsprechend hoch sind<br />
auch die Investitionen in einen genau passenden Schuh. Die Fallstudie hat aber auch<br />
gezeigt, dass Adidas heute eine dritte Alternative anbietet: ein Produktprogramm, das<br />
sich an die Massenkunden richtet, aber Elemente des Individualprogramms enthält,<br />
jedoch nicht dessen Preise. Diesen dritten Strategietyp nennen wir Mass Customization.<br />
Ihn wollen wir im Folgenden näher betrachten.<br />
Abbildung 4–3: Merkmale der Individualisierung und Standardisierung auf Produktebene<br />
(entnommen aus Mayer 1993)<br />
Merkmale der Individualisierung und Standardisierung auf Produktebene im Vergleich<br />
Merkmal Individualisierung Standardisierung<br />
Ausrichtung der<br />
Leistungsgestaltung<br />
Zahl der Nachfrager je<br />
Leistung<br />
extrem an den Anforderungen<br />
des einzelnen Nachfragers<br />
einer bzw. sehr wenige viele<br />
Kontakt zum Nachfrager eng: Kundenintegration in den<br />
Leistungserstellungsprozess<br />
konjektural an Durchschnittsansprüchen<br />
einer größeren<br />
Zahl von Nachfragern<br />
nicht oder kaum vorhanden<br />
(anonyme Abnehmerschaft)<br />
Erstellung der Leistung nach der Bestellung vor der Bestellung, auf Vorrat<br />
Quelle der Informationen<br />
über die Nachfrageranforderungen<br />
Gleichartigkeit der Leistungen<br />
einer Produktlinie<br />
direkt vom Nachfrager über Marktforschung, Handel<br />
maßgeschneiderte Leistung,<br />
(meist) Losgröße 1<br />
homogenes Massenprodukt /<br />
kollektive Dienstleistung<br />
Leistungsvielfalt sehr groß nur eine Leistung<br />
197<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
4.1.2 Mass Customization als Ausprägung einer<br />
Produktindividualisierung<br />
Mass Customization wird in der Literatur als Antwort auf die zunehmende<br />
Individualisierung der Nachfrage gesehen, die wir in Abschnitt 2.2.3 diskutiert haben<br />
(Blaho 2001; <strong>Piller</strong> 1998, 2006a; Pine 1993; <strong>Reichwald</strong> / <strong>Piller</strong> 2002; Schnäbele 1997). Der<br />
Ausdruck Mass Customization ist ein Oxymoron, das die an sich gegensätzlichen<br />
Begriffe “Mass Production” und “Customization” verbindet (als deutsche Übersetzung<br />
hat sich “kundenindividuelle Massenproduktion” durchgesetzt). Der Begriff wurde<br />
von Davis (1987) geprägt, der ausgehend von einem Beispiel aus der Bekleidungsindustrie<br />
das Phänomen zum ersten Mal beschrieben hat: “Mass Customization of<br />
markets means that the same large number of customers can be reached as in mass<br />
markets of the industrial economy, and simultaneously they can be treated individually<br />
as in the customized markets of pre-industrial economies” (Davis 1987: 169). Er<br />
bezieht sich dabei auf Gedanken von Toffler (1970), der aufbauend auf der These der<br />
zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft den Zerfall von Massenmärkten<br />
(“Entmassung”) und die Orientierung der Produkterstellung an den Wünschen und<br />
Bedürfnissen des einzelnen Individuums vorhersagte. Seit Pine (1993) mit seiner<br />
Buchveröffentlichung den Grundstein für die breite Diskussion um Mass<br />
Customization gelegt hat, sind unzählige Veröffentlichungen zu diesem Thema<br />
erschienen (siehe <strong>Piller</strong> 2006a für eine Übersicht). Dominiert in den meisten Beiträgen<br />
die Euphorie, werden verstärkt auch kritische Stimmen laut (Agrawal / Kumaresh /<br />
Mercer 2001; <strong>Piller</strong> / Ihl 2002; Zipkin 2001).<br />
Auf eine kurze Formel gebracht, bedeutet Mass Customization “producing goods and<br />
services to meet individual customer’s needs with near mass production efficiency”<br />
(Tseng / Jiao 2001). Angesichts der breiten Verwendung des Begriffs für alle möglichen<br />
Formen kundenbezogener Leistungserstellung (oder auch einer klassischen<br />
Variantenfertigung) wollen wir aber eine etwas ausführlichere Beschreibung verwenden,<br />
die die Definition von Tseng und Jiao sowie auch unsere eigenen früheren<br />
Definitionen konkretisiert (siehe <strong>Piller</strong> 1998, 2006a; <strong>Reichwald</strong> / <strong>Piller</strong> 2003).<br />
Mass Customization (kundenindividuelle Massenproduktion) bezeichnet die<br />
Produktion von Gütern und Leistungen für einen (relativ) großen Absatzmarkt, welche<br />
die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Nachfragers dieser Produkte treffen.<br />
Die Produkte und Leistungen werden dabei in einem Co-Design-Prozess gemeinsam<br />
mit den Kunden in einem Interaktionsprozess definiert. Die Produkte werden dabei zu<br />
Preisen angeboten, die der Zahlungsbereitschaft von Käufern vergleichbarer massenhafter<br />
Standardprodukte entsprechen, d. h. die Individualisierung impliziert keinen<br />
Wechsel des Marktsegments in exklusive Nischen, wie dies bei einer klassischen<br />
Einzelfertigung der Fall ist. Eine solche Position kann langfristig nur erreicht werden,<br />
wenn aus einer Gesamtkostenbetrachtung die Leistungserstellung entlang der gesamten<br />
Wertschöpfungskette trotz Individualisierung zu einer Effizienz möglich ist, die<br />
der von Produktion und Vertrieb (massenhafter) Standardprodukte nahe kommt.<br />
Wesentliches Element zur Erreichung dieser Position ist die Etablierung eines stabilen<br />
Lösungsraumes, der dann abnehmerbezogen konkretisiert wird (<strong>Piller</strong> 2006a).<br />
198
Wir werden im nächsten Kapitel die wesentlichen Eigenschaften dieser Definition, die<br />
den Prinzipien von Mass Customization entsprechen, näher betrachten. Das wesentliche<br />
Abgrenzungsmerkmal von Mass Customization gegenüber anderen Formen der<br />
Produktindividualisierung ist die Forderung nach einem stabilen Lösungsraum, der<br />
die Grundlage der geforderten Kosteneffizienz ist.<br />
4.1.3 Prinzipien und Eigenschaften<br />
Auf Basis der vorstehenden Definition von Mass Customization lassen sich vier Ebenen<br />
oder Prinzipien einer Produktindividualisierung nach dem Mass-Customization-<br />
Prinzip nennen (Abbildung 4–4):<br />
Der Genus von Mass Customization ist Kundenintegration im Sinne von Co-<br />
Design.<br />
Das Ergebnis von Mass Customization und das wesentliche Abgrenzungskriterium<br />
zu anderen Formen der Kundenintegration ist die Individualproduktion, d. h. die<br />
Erlangung einer Differenzierungsposition im Markt durch die Anpassung bestimmter<br />
Eigenschaften einer Absatzleistung an die Bedürfnisse eines einzelnen Kunden.<br />
Die Abgrenzung von Mass Customization zu anderen Formen der Individualproduktion<br />
ist eine Preis- und Kostenposition, die die Güter für größere<br />
Abnehmerschichten erschwinglich macht.<br />
Der Schlüssel zu dieser Kostenposition ist ein stabiler Lösungsraum, der stabile<br />
Prozessbedingungen als Grundlage der kundenindividuellen Produktion schafft.<br />
Wir werden diese Punkte im Folgenden kurz übersichtsartig konkretisieren und in den<br />
folgenden Abschnitten dieses Kapitels ausführlicher erklären.<br />
Kundenintegration (Co-Design)<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Mass Customization bezeichnet die Produktion von Gütern und Leistungen, welche die unterschiedlichen<br />
Bedürfnisse jedes einzelnen Nachfragers dieser Produkte treffen, mit der Effizienz<br />
einer vergleichbaren Massen- bzw. Serienproduktion. Grundlage des Wertschöpfungsprozesses<br />
ist dabei ein Co-Design-Prozess zur Definition der individuellen Leistung in Interaktion<br />
zwischen Anbieter und Nutzer.<br />
Das zentrale Element der Definition von Mass Customization ist der Einbezug des<br />
Kunden in die Wertschöpfung im Rahmen eines Co-Design-Vorganges. Hierbei wird<br />
der vorhandene Lösungsraum kundenspezifisch konkretisiert (siehe Abschnitt 2.4.2).<br />
Aus einer Auswahl an Optionen wählen die Kunden die Eigenschaften (für bestimmte<br />
Komponenten der Leistung), die ihren Vorstellungen am ehesten entsprechen. Im<br />
Unterschied zu Do-it-yourself-Aktivitäten, bei denen die Kunden autonom tätig sind,<br />
findet diese Konkretisierung in Interaktion mit dem Hersteller statt (“co-creation”,<br />
Ramirez 1999). In Abgrenzung zur Kundenintegration in den Innovationsprozess geht<br />
es bei Mass Customization aber in erster Linie um einen Co-Design-Prozess, d. h. es<br />
199<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
werden nicht die grundlegenden Eigenschaften eines Produktes für jeden Kunden neu<br />
entwickelt, sondern aus vorgedachten Optionen ausgewählt (siehe auch die<br />
Abgrenzung in Abschnitt 3.5.2). Der Begriff Co-Design bezeichnet in der Literatur<br />
diese Interaktion zwischen Kunde und Hersteller im Rahmen der Konkretisierung<br />
einer Leistung (Ulrich / Anderson-Connell / Wu 2003; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2003, 2004; <strong>Frank</strong>e<br />
/ Schreier 2002; Khalid / Helander 2003; <strong>Piller</strong> / Stotko 2003; <strong>Reichwald</strong> / Seifert / Ihl<br />
2004; Toffler 1980; Tseng / Kjellberg / Lu 2003; Ulrich; Udwadia / Kumar 1991; von<br />
Hippel 1998; Wikström 1996a).<br />
Abbildung 4–4: Prinzipien von Mass Customization<br />
Kostenposition<br />
(Massenproduktionseffizienz)<br />
Differenzierungsvorteil<br />
(Produktindividualisierung)<br />
Stabiler<br />
Lösungsraum<br />
(stabile Prozesse und<br />
Produktarchitekturen)<br />
Kundenintegration<br />
(Kunden Co-Design)<br />
Damit weist Mass Customization große Verwandtschaft mit dem klassischen<br />
Kundenintegrationsprozess im Dienstleistungsmanagement auf (Blaho 2001;<br />
Schnäbele 1997). Auch hier ist in der Regel eine Erstellung der Leistung nur dann möglich,<br />
wenn der Kunde zuvor Informationen in den Leistungserstellungsprozess eingebracht<br />
hat, wobei auf Potenzialfaktoren des Anbieters zurückgegriffen wird. Bei Mass<br />
Customization ist der zentrale Potenzialfaktor eine Interaktionsplattform, die oft auch<br />
als Konfigurationssystem bezeichnet wird. Da dieser Begriff aber meist in einem technischen<br />
Sinn verwendet wird, ziehen wir den Begriff Interaktions- oder Co-Design-<br />
System vor, da wir die technische Systemkomponente nur als unterstützenden Faktor<br />
der Kunden-Mitarbeiter-Interaktion sehen.<br />
Co-Design differenziert Mass Customization von anderen kundenzentrierten<br />
Wertschöpfungsstrategien wie “Agile Manufacturing” oder Postponement (siehe zu<br />
dieser Abgrenzung ausführlich <strong>Piller</strong> 2006a). Co-Design etabliert eine Beziehung zwi-<br />
200
schen Hersteller und Kunde, welche viele Möglichkeiten für die Gestaltung der<br />
Nachkaufphase im Rahmen eines Customer Relationship Management bietet. Hat ein<br />
Kunde einmal erfolgreich ein individuelles Gut erhalten und ist mit dieser Leistung<br />
zufrieden, bilden die Informationen, die er im Rahmen des Co-Design-Vorganges an<br />
den Hersteller übermittelt hat, eine starke Barriere gegen einen Wechsel des Anbieters<br />
(Pine / Peppers / Rogers 1995; Wayland / Cole 1997). Denn ein neuer Anbieter müsste<br />
diese Informationen ja erst wieder sammeln. Bei einem Wiederholungskauf der individuellen<br />
Leistung beim ersten Anbieter dagegen kann der Interaktionsvorgang sehr<br />
schnell ablaufen oder vollkommen automatisiert ablaufen, indem die Konfiguration<br />
des Erstkaufs auf den Folgekauf übertragen wird (dennoch findet ein Co-Design-<br />
Vorgang statt). Wir werden diese Dimension in Abschnitt 4.4.7 im Zusammenhang mit<br />
der Beschreibung von Interaktionssystemen für Mass Customization noch vertiefen.<br />
Differenzierungsvorteil (Produktindividualisierung)<br />
Der Differenzierungsvorteil entsteht durch Anpassung bestimmter Produkteigenschaften<br />
an die Präferenzen einzelner Kunden. Aus der Perspektive des strategischen Managements<br />
ist Mass Customization eine Differenzierungsstrategie (horizontale Produktdifferenzierung,<br />
siehe Abschnitt 2.4.5). In Bezug auf die “theory of monopolistic competition”<br />
nach Chamberlin (1950, 1962) entspricht der Wert einer Individualisierung<br />
aus Kundensicht dem Nutzenzuwachs, den das resultierende Gut durch eine höhere<br />
Übereinstimmung mit der nächstbesten (standardisierten) Alternative bietet. Je größer<br />
deshalb de Heterogenität der Abnehmerbedürfnisse in einem Markt, desto größer ist<br />
der Zuwachs an Nutzen durch Individualisierung (da in einem homogenen Markt der<br />
Hersteller auch (fast) alle Kundenbedürfnisse durch Standardprodukte befriedigen<br />
kann). Allerdings ist Individualisierung kein Selbstzweck. Genau die Individualisierungsfunktionen<br />
zu finden, bei denen die meisten relevanten Kunden ein Bedürfnis<br />
zur Anpassung haben, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.<br />
Allgemein lassen sich drei Kategorien unterscheiden:<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
(1) Erste Individualisierungsmöglichkeit sind die individuellen Maße der Kunden<br />
bzw. Verwender. Hierunter fällt der große Bereich körpernaher Produkte wie Kleidung<br />
oder Schuhe, aber auch Autositze, Bürostühle oder Höhen von Apparaturen. Weiterhin<br />
können auch die Einbaumaße eines Möbelstücks auf die Abmessungen einer Wohnung<br />
abgestimmt werden. Passform kann als das Urmotiv von Mass Customization gesehen<br />
werden.<br />
(2) Aus Verwendungssicht bietet eine Individualisierung der Funktionalität viele<br />
Möglichkeiten. Ansatzpunkt sind die Eigenschaften eines Produkts in Hinblick auf<br />
bestimmte Verwendungszwecke. Beispiele sind die Laufeigenschaften eines<br />
Sportschuhs, die Bespannung eines Tennisschlägers oder der Funktionsumfang eines<br />
PC. Da eine funktionale Individualisierung auf der Ebene materieller Produkte teilweise<br />
recht schwierig und aufwändig ist, bieten sich an dieser Stelle viele Optionen,<br />
durch ergänzende individuelle Dienstleistungen gewünschte Funktionen bereitzustellen.<br />
(3) Schließlich kann sich die Individualisierung auf die gustative bzw. visuelle<br />
Wahrnehmung der Kunden (ästhetisches Design) beziehen. Oft wird Indivi-<br />
201<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
dualisierung auf diesen Bereich beschränkt. Wir halten aber für viele Branchen ein<br />
Mass-Customization-Konzept, das rein am ästhetischen Design ansetzt, für langfristig<br />
nicht tragfähig und zu leicht austauschbar, da nicht in einem Maße Nutzen für die<br />
Abnehmer geschaffen wird, um die Grundlage einer dauerhaften Kundenbeziehung<br />
zu legen.<br />
Ansatzpunkte einer Produktindividualisierung: Eine Produktindividualisierung kann aus<br />
generischer Sicht an drei Dimensionen ansetzen: (1) Passform bzw. Masse der Verwender (z.<br />
B. körpernahe Produkte wie Kleidung oder Schuhe, Bürostühle oder Höhe von Apparaturen).<br />
(2) Funktionalität, d. h. Eigenschaften des Produkts in Hinblick auf bestimmte Verwendungszwecke<br />
(z. B. Dämpfung eines Sportschuhs, Funktionsumfang eines PC). (3) Visuelle<br />
Wahrnehmung (ästhetisches Design) (z. B. Auswahl von Farben oder Mustern).<br />
Kostenposition (Massenproduktionseffizienz)<br />
Oft wird Mass Customization als Individualisierung zu Preisen einer Massenproduktion<br />
– und ohne die Zuschläge einer klassischen Einzelfertigung definiert (Davis<br />
1987; Hart 1995; Pine 1993; Victor / Boynton 1998; Westbrook / Williamson 1993). Jedoch<br />
zeigt die Analyse von Mass-Customization-Anbietern, dass Kunden regelmäßig bereit<br />
sind, hohe Aufpreise für ein individuelles Gut zu zahlen (<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004; Levin et<br />
al. 2002; <strong>Piller</strong> / Hönigschmid / Müller 2002). Dieser Premiumpreis entspricht dem<br />
wahrgenommenen Nutzenzuwachs durch die Individualisierung im Vergleich zu<br />
einem Massengut. Mass Customization sollte deshalb nicht auf “vergleichbare<br />
Massenproduktionspreise”. beschränkt werden. Eine wichtige Abgrenzung zu einer<br />
klassischen Einzelfertig ist aber dennoch wichtig: Mass-Customization-Angebote zielen<br />
auf das gleiche Marktsegment, das zuvor die massenhaften Güter gekauft hat.<br />
Traditionell ist eine Einzelfertigung oft mit derart hohen Aufpreisen versehen, dass<br />
damit ein Wechsel in ein völlig anderes Marktsegment erfolgte. Die Aufschläge bei Mass<br />
Customization mögen zwar recht hoch sein, aber sie müssen noch “erschwinglich” sein.<br />
Mag diese Definition auch aus konzeptioneller Sicht etwas weich sein, so hat sie sich<br />
doch aus Sicht der Praxis zur Abgrenzung von Mass Customization gut bewährt. Aus<br />
Sicht des Herstellers sind diese “erschwinglichen” Preise nur dann möglich, wenn die<br />
Erstellung der Güter zu Kosten möglich ist, der diese moderaten Aufschläge erlaubt.<br />
Wir werden in Abschnitt 4.2.1 noch genauer erklären, wie sich die zusätzlichen Kosten<br />
von Mass Customization zusammensetzen und welche Mechanismen es gibt, diese auszugleichen.<br />
Das Mass-Customization-Konzept hat dazu zwei wesentliche Ansatzpunkte:<br />
Zum einen erlaubt das Wissen, das durch die Integration der Kunden in die<br />
Wertschöpfung erlangt wird, effizienteres Handeln durch die Vermeidung von<br />
Verschwendung und die Erhöhung der Abhängigkeit der Abnehmer (<strong>Piller</strong> / Möslein /<br />
Stotko 2004; Su / Chang / Ferguson 2005; siehe auch Kotha 1995; <strong>Piller</strong> 2006a;<br />
Rangaswamy / Pal 2003; Squire et al. 2004; von Hippel 1998). Die darauf beruhenden<br />
Kostensenkungspotenziale bezeichnen wir als “Economies of Integration” (siehe<br />
Abschnitt 4.2.2). Zum anderen aber sorgt ein stabiler Lösungsraum, d. h. stabile Produkt-<br />
und Prozessarchitekturen, dafür, dass die zusätzlichen Kosten der Produktindividualisierung<br />
deutlich geringer ausfallen als bei einer klassischen Einzelfertigung.<br />
202
Fixer Lösungsraum (solution space)<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Stabile Produkt- und Prozessarchitekturen sind ein wesentliches Charakteristikum von<br />
Mass Customization. Die Individualisierungsmöglichkeiten sind begrenzt und im<br />
Lösungsraum des Anbieters abgebildet. Diese Fähigkeiten und Kapazitäten werden<br />
im Rahmen einer autonomen Vorproduktion vom Anbieter festgelegt (dies entspricht<br />
des Verständnisses der Kundenintegration nach Kleinaltenkamp, siehe Abschnitt<br />
2.4.2). Ein erfolgreiches Mass-Customization-System ist durch stabile, aber dennoch<br />
flexible Prozesse definiert, die einen dynamischen Fluss an individuellen Produkten<br />
erlauben. Jospeh Pine beschreibt diesen Gedanken in einem Gastbeitrag im Anschluss<br />
an diesen Abschnitt in Kasten 4–2. Diese stabilen Prozessbedingungen sind auch ein<br />
wesentliches Differenzierungsmerkmal von Mass Customization zur klassischen (oft<br />
handwerklichen) Einzelfertigung: Ein traditioneller Einzelfertiger erfindet nicht nur<br />
für jeden einzelnen Kunden neue Produkte, sondern auch die dazugehörigen Prozesse.<br />
Mass Customization setzt dagegen auf stabilen Prozessen auf, um eine hohe Varietät<br />
an Produkten effizient bereitstellen zu können. Mass Customization wird so gerade<br />
nicht durch die wesentlichen Kennzeichen einer Einzelfertigung (auftragsbezogene<br />
Kalkulation, hohes Flexibilitätsbedürfnis in allen Fertigungsstufen, individuelle Planung<br />
jedes Produktionsprozesses und spezifische Erstellung der Fertigungsunterlagen)<br />
charakterisiert.<br />
Individualisierung im Rahmen der Mass Customization geht deshalb nicht so weit,<br />
dass ein Kunde von Grund auf ein für das Unternehmen völlig neues Produkt ganz<br />
nach seinen Wünschen kreiert, wie es beispielsweise im Spezialmaschinenbau oder bei<br />
der Anfertigung von Sonderwerkzeugen üblich ist. Dies ist klassische Einzelfertigung,<br />
die Mass Customization nicht ersetzen kann. Diese zeichnet sich durch eine auftragsbezogene<br />
Kalkulation, einen geringen Vorfertigungsgrad, ein hohes Flexibilitätsbedürfnis<br />
in allen Fertigungsstufen und die individuelle Erstellung der Fertigungsunterlagen<br />
(Stücklisten, Arbeits- und Terminpläne, Konstruktionspläne etc.) aus<br />
(Gutenberg 1979; <strong>Reichwald</strong> / Dietl 1991; Zahn / Schmid 1996). Ein Mass-Customization-Konzept<br />
baut stets auf einer vorhandenen Produktspezifikation auf. Ziel ist es,<br />
an wenigen Komponenten, die aus Kundensicht aber den wesentlichen individuellen<br />
Produktnutzen ausmachen, eine Gestaltungs- bzw. Auswahlmöglichkeit zur Verfügung<br />
zu stellen. Die Produkte und Leistungen unterscheiden sich so nicht in ihrem<br />
grundsätzlichen Aufbau. Man kann deshalb auch von einer Standardisierung der<br />
Individualisierung sprechen. Die dazugehörigen Stücklisten sollten dynamisch und<br />
automatisch erstellt werden können, ebenso die Arbeits- und Montageanweisungen.<br />
Mass Customization ist dann erfolgreich, wenn fertigungsseitig in möglichst vielen<br />
Bereichen die individuelle Fertigung zugunsten einer massenhaften zurücktritt.<br />
Hierzu tragen insbesondere modulare Produktarchitekturen bei (Tseng / Du 1998;<br />
Tseng / Jiao 2001). Die richtige Festlegung des Lösungsraumes für Mass Customization<br />
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Konzepts. Die Diskussion verschiedener<br />
Formen von Mass Customization greift diesen Aspekt im folgenden Abschnitt noch<br />
mal auf.<br />
Betrachten wir abschließend noch einmal das Beispiel von ‘mi adidas’ (Kasten 4–1,<br />
siehe auch die Fallstudie in Abschnitt 5.1): Der stabile Lösungsraum wird bei ‘mi adi-<br />
203<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
das’ vor allem durch den Rückgriff auf die vorhandene Leistenbibliothek bestimmt. Ein<br />
klassischer Schuhmacher würde für jeden Kunden einen eigenen Leisten modellieren<br />
– ein sehr teurer und abstimmungsintensiver Prozess. Adidas dagegen ordnet einfach<br />
die Maße eines Kunden dem best-passenden Leisten zu. Da die ‘mi adidas’-Schuhe<br />
aber auf Bestellung gefertigt werden und so kein Lagerhaltungsrisiko besteht, können<br />
deutlich mehr Leisten herangezogen werden als beim Größenspektrum einer<br />
Massenproduktion. Das Problem der Individualfertigung wird so zu einem reinen<br />
Informationsproblem: Adidas muss nur sicherstellen, dass in der Produktion jeder<br />
Mass-Customization-Schuh auch auf Basis des richtigen Leisten gefertigt wird und am<br />
Ende der richtigen individuellen Bestellung zugeordnet wird. Ansonsten unterscheidet<br />
sich die Produktion aber nicht von einem Massenprodukt.<br />
Kasten 4–2: Eigenschaften von Mass Customization<br />
(Quelle: Auszug aus dem Beitrag “Mass Customization – Die Wettbewerbsstrategie der Zukunft”<br />
von B. Joseph Pine, der als Begründer der Mass Customization gilt, in: <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>:<br />
Kundenindividuelle Massenproduktion, München / Wien: Hanser 1998: 1-32)<br />
Mass Customization ist in erster Linie ein Managementsystem – ein Geschäftsmodell eines<br />
Unternehmens und dessen Umgang mit den Kunden, Produkten und Prozessen. Wir wollen das<br />
Wesen der Mass Customization anhand eines Modells verdeutlichen, das in der folgenden<br />
Abbildung dargestellt ist. Um dieses Modell zu verstehen, betrachten wir zunächst seine zwei<br />
Dimensionen:<br />
Die Änderungsrate der Produkte entspricht der Häufigkeit, mit der ein Produkt oder eine<br />
Leistung im Zeitablauf oder für einen bestimmten Kunden modifiziert wird. Ist sie niedrig, sind<br />
die Produkte also stabil, liegen standardisierte Produkte mit nur wenigen, schleichenden und<br />
vorhersehbaren Änderungen vor; dynamische Produkte dagegen besitzen eine hohe Änderungsrate,<br />
sie verändern sich ständig, oft unvorhersehbar und revolutionär – bis hin zu dem<br />
Extrem, dass jedes einzelne hergestellte Produkt von den anderen verschieden ist.<br />
Ähnliches gilt für die Änderungsrate der Prozesse, welche die Häufigkeit beschreibt, mit der<br />
die Geschäftsprozesse zur Fertigung eines Produkts oder Erstellung einer Dienstleistung<br />
modifiziert werden. Entsprechend können Prozesse stabil oder dynamisch sein.<br />
Die sich so ergebende Matrix beschreibt vier generische Geschäftsmodelle, die das Handeln von<br />
Unternehmen in Abhängigkeit ihrer Änderungsrate der Produkte und Prozesse bestimmen (bewusst<br />
oder unbewusst). Unternehmen, die auf der Basis einer ausgeprägten Differenzierung mittels innovativer<br />
und individueller Produkte miteinander konkurrieren, folgen dem Inventionsmodell. Sie erfinden<br />
und entwickeln ununterbrochen neue Produkte und (Fertigungs-)Prozesse für deren Herstellung<br />
(sehr hohe Änderungsraten). Jahrhundertelang folgten Unternehmen diesem Modell:<br />
Spezialisierte, handwerkliche Einzelfertiger (Manufakturen) werden auch dann einen Auftrag annehmen,<br />
wenn ein Kunde etwas will, was das Unternehmen zunächst nicht herstellen kann (sei es ein<br />
neues Produkt oder eine spezifische Anpassung eines bestehenden Produkts), und dann herausfinden,<br />
ob und wie das individuelle Produkt herstellbar ist. Denken Sie zum Beispiel an einen<br />
Spezialmaschinenhersteller, der nur nach Kundenauftrag individuelle Lösungen entwickelt. Selbst<br />
wenn solch ein Unternehmen dieselbe Sache zwei- oder mehrmals erstellen würde, wäre das<br />
Ergebnis jedes Mal etwas anders, da die Produktionsprozesse niemals stabilisiert (standardisiert)<br />
wurden. Es ist die ureigene Natur des Inventionsmodells, dass seine Anwender – wahre Erfinder<br />
und Innovatoren – kontinuierlich Produkte und Prozesse verändern und oft deshalb nur basteln, tüfteln<br />
und experimentieren, um zu sehen, was für ein neuer Output dabei wohl herauskommen wird.<br />
204
hoch<br />
(dynamisch)<br />
Änderungsrate<br />
der Produkte<br />
niedrig<br />
(stabil)<br />
Mass<br />
Customization<br />
Entwicklung<br />
(Stabilisierung)<br />
Massenproduktion<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Erneuerung<br />
Verbindung<br />
Invention<br />
(klassische<br />
Einzelfertigung)<br />
Modularisierung<br />
Continuous<br />
Improvement<br />
niedrig (stabil)) hoch (dynamisch)<br />
Änderungsrate der Prozesse<br />
Abbildung: Die Evolution der Wettbewerbsstrategie<br />
Mit dem Aufkommen der Industriellen Revolution und insbesondere der Entwicklung des Fließbands<br />
durch Henry Ford kam die Zeit der Massenproduktion – dem genauen Gegenteil des<br />
Inventionsmodells. Hier ist alles stabil: Die Unternehmen suchen die beste Methode, ein gegebenes<br />
Produkt zu erstellen, und schöpfen dann so schnell wie möglich die Pozentiale der Lernkurve<br />
aus. Produkt wie Prozesse ändern sich nur sehr langsam, um sicherzustellen, dass die anfänglichen<br />
Investitionsaufwendungen auch gedeckt werden. Ab und zu (typischerweise alle vier bis fünf<br />
Jahre oder später) müssen die Massenproduzenten auf eine Organisation des Inventionsmodells<br />
zurückgreifen (normalerweise die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung), um eine neue<br />
Produktidee einzuführen und im Massenfertigungssystem umzusetzen. Im Grunde ihrer Herzen<br />
wollen Massenproduzenten alles stabilisieren und standardisieren – für alles einen besten Weg<br />
festschreiben – und dann diesen Weg immer wieder unverändert beschreiten. Wenn sie die Wahl<br />
hätten, würden die Produktionsmanager der Massenfertiger nach einmaligem Fertigungsanlauf ein<br />
Standardgut so lange produzieren, bis die “Cash Cows” gemolken sind.<br />
Massenproduzenten sind von einer innovativen Institution sehr abhängig, um neue Produkte einzuführen.<br />
Doch auch Organisationen auf Basis des Inventionsmodells sind von den Massenproduzenten<br />
abhängig, um für ihre hochdifferenzierten Produktinnovationen einen großen Markt<br />
zu schaffen. Diese Synergie zwischen dem Modell der Massenproduktion und dem Inventionsmodell<br />
funktionierte lange Zeit sehr gut. So gut, dass als grundlegendes “Wettbewerbsgesetz” festgehalten<br />
wurde, Unternehmen hätten sich zwischen niedrigen Kosten oder einer hohen Differenzierung<br />
zu entscheiden – kein Unternehmen könne jemals beides erreichen, da beide Alternativen<br />
auf einem völlig anderen, untereinander inkompatiblen Geschäftsmodell aufbauen würden.<br />
Jedoch schafften es (nicht nur, doch hauptsächlich) japanische Unternehmen, sowohl geringere<br />
Kosten als auch eine höhere Qualität als der typische Massenproduzent zu erreichen, indem sie<br />
ständig ihre Prozesse weiterentwickelten. Diese dynamische, kontinuierliche Verbesserung führte<br />
zu einem neuen Wettbewerbsmodell, das den vorhergehenden signifikant überlegen war. Es<br />
unterschied sich so stark von den beiden bestehenden Modellen, dass westliche Unternehmen<br />
lange Zeit brauchten, um es zu begreifen. Heute folgen die meisten Unternehmen (zumindest im<br />
Ansatz) diesem Modell der kontinuierlichen Verbesserung (Continuous Improvement), indem sie<br />
neue Instrumente wie zum Beispiel eine statistische Prozesskontrolle, funktionsübergreifende<br />
Teams und Kennzahlen zur Erhebung der Kundenzufriedenheit im Rahmen eines Total Quality<br />
Managements anwenden. Der Lebenszyklus der Prozesse einer theoretisch idealen Unter-<br />
205<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
nehmung, die diesem Geschäftsmodell folgt, hat eine Dauer von genau einer Ausführung: Jede<br />
Ausführung eines Prozesses ist unterschiedlich – und besser – als die letzte. Die hergestellten<br />
Produkte bleiben aber relativ stabil. Insbesondere die japanischen Produzenten hatten zunächst<br />
eine viel geringere Variantenvielfalt als ihre westlichen Konkurrenten, als sie deren Heimatmärkte<br />
“angriffen”. Dies änderte sich aber mit der Zeit in dem Maße, in dem funktionsübergreifende Teams<br />
– die Basisstruktur der Continuous-Improvement-Unternehmen – ihre Aufmerksamkeit auf die<br />
Rüst- und Wechselzeiten konzentrierten und so die Fähigkeiten der Unternehmen für eine variantenreiche<br />
Produktion stetig verbesserten.<br />
Während überall Unternehmen große Qualitätsfortschritte durch die Anwendung des Continuous<br />
Improvement zu erlangen scheinen, überschreiten heute schon viele Unternehmen die Grenze reiner<br />
Varietät und bewegen sich zum Wettbewerbsmodell der Mass Customization. Hier ermöglichen<br />
stabile, aber zugleich sehr flexible Prozesse einen dynamischen Fluss unterschiedlicher<br />
Produkte. Diese Unternehmen der Mass Customization erreichen sowohl eine kundenindividuelle<br />
Erstellung von Gütern und Leistungen als auch ein niedriges Kostenniveau. In diesem<br />
Geschäftsmodell ist die primäre Aufgabe, die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen<br />
Kunden zu identifizieren und zu erfüllen. Idealerweise dauert der Produktlebenszyklus “ein<br />
Stück”: jedes Produkt ist verschieden von den anderen und genau auf einen Kunden zugeschnitten.<br />
Wirtschaftliche Organisationen können zwischen den verschiedenen hier vorgestellten<br />
Geschäftsmodellen wechseln, und ihre Produkte und Prozesse sind eventuell über die verschiedenen<br />
Ansätze verstreut, aber es gibt nur einen bestimmten Pfad, um Mass Customization zu<br />
erreichen. Dieser Weg beginnt bei der Invention und geht über Massenproduktion und Continuous<br />
Improvement zur Mass Customization (aufgrund der Form dieses Wegs in unserem Modell soll er<br />
als Achterfigur (“Figure-8 path”) bezeichnet werden).<br />
Der erste Schritt – von der Invention zur Massenproduktion – ist die wohlbekannte Aktivität der<br />
Entwicklung stabiler Produkte und Prozesse. Hier müssen neue Produkte und Prozesse entworfen<br />
und dann stabilisiert werden, damit sie für eine massenhafte, kostengünstige Produktion<br />
anwendbar, sprich wiederholbar sind.<br />
Die hieraus resultierende Massenproduktion ist klassischerweise eine streng hierarchische und<br />
bürokratische Organisation, mit sehr geringen Informationsflüssen zwischen den Instanzen. Um<br />
die Prozesse des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern, müssen die getrennten Funktionen<br />
durch abteilungsübergreifende Teams, Informationsaustausch und eine horizontale Prozessfokussierung<br />
miteinander verbunden werden – der zweite Schritt auf dem Weg zur Mass<br />
Customization. Doch nicht nur zwischen den einzelnen funktionalen “Inseln” eines Unternehmens<br />
ist eine Verbindung und einheitliche Datenbasis zu schaffen, sondern es ist ebenso notwendig, die<br />
Lieferanten zu integrieren (“Integration der Wertkette”), damit diese die gleichen Informationen<br />
über die Absatzmärkte besitzen wie der Abnehmer und so aus eigenem Antrieb Komponenten<br />
bereitstellen können, um die Bedürfnisse des Markts zu befriedigen. Das Ergebnis ist ein Set von<br />
eng verbundenen Hochleistungsprozessen, die sich selbständig kontinuierlich verbessern können<br />
und einen hohen Grad an Kundenzufriedenheit garantieren – der zentrale Erfolgsfaktor des<br />
Continuous Improvement.<br />
Der dritte Schritt in Richtung Mass Customization verlangt, dass Produkte und Leistungen modularisiert<br />
werden, um individuelle Kombinationen effizient für jeden Kunden bereitzustellen. Eine<br />
modulare Architektur des Leistungsprogramms erlaubt so, individuelle Produkte auszuliefern, die<br />
genau dem Kundenwunsch entsprechen, seien es Jeans in einer bestimmten Länge, ein spezifischer<br />
Vitaminmix oder ein genau passendes pneumatisches Ventilsystem. Diese Architektur<br />
bestimmt einerseits, wie weit das gesamte Spektrum sämtlicher möglicher Variationen ist, durch<br />
die das Produkt die Bedürfnisse aller Kunden befriedigen kann, und andererseits, welche spezifischen<br />
Ausprägungen das Produkt für einen konkreten Kunden annehmen kann. Diese beiden<br />
206
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Dimensionen werden durch die Zahl und Gestaltung der unterschiedlichen Module und deren<br />
Schnittstellen und Verbindungsmöglichkeiten festgelegt. Die Kombination der Module zum fertigen<br />
Produkt vollzieht sich dabei durch definierte (stabile) Fertigungsprozesse, die ebenfalls in einer Art<br />
Modulsystem miteinander kombiniert werden können.<br />
Um jedoch die Potenziale der Modularisierung zur erlangen, ist ein drittes Element notwendig: Ein<br />
Designwerkzeug, das die Kundenbedürfnisse mit den Fähigkeiten eines Unternehmens in<br />
Einklang bringt. Ohne ein solches Werkzeug (auch Produktkonfigurator genannt) werden die<br />
Kunden (bzw. ihre Vertreter in Form des Handels und Vertriebs) mit so vielen Grundformen und<br />
Verbindungsmöglichkeiten konfrontiert, dass sie aufgrund einer viel zu hohen Komplexität die für<br />
sie genau passende Lösung nicht finden. Designwerkzeuge lassen den Kunden mit sinnvollen<br />
Kombinationen “spielen”. Konfiguratoren müssen dafür sorgen, dass die Komplexität der<br />
Modularisierung genutzt wird, Produkte und Leistungen für einzelne Kunden maßzuschneidern,<br />
aber diese schnell, einfach und ohne Mühe genau die Kombination finden, die für sie den höchsten<br />
Wert schafft.<br />
Doch auch das großartigste Designwerkzeug garantiert noch keine leistungsfähige Mass Customization.<br />
Um die vollen Potenziale der Mass Customization zu verwirklichen, müssen sich industrielle<br />
Organisationen selbst erneuern. Dies ist der vierte und letzte Schritt in Richtung Mass<br />
Customization in der Achterfigur, welche die Pfeile in der Abbildung zeichnen. Immer dann, wenn<br />
ein Unternehmen bemerkt, dass es mit seinen derzeitigen Individualisierungsmöglichkeiten<br />
bestimmte Kundenbedürfnisse nicht mehr erfüllen bzw. neue Marktchancen nicht nutzen kann, ist<br />
eine Erneuerung notwendig. Das Unternehmen geht quasi einen Schritt “zurück” (zur Invention),<br />
um neue, zusätzliche Module oder Prozesse zu implementieren bzw. durch eine neue Schnittstelle<br />
mit internen oder externen Stellen (z. B. Lieferanten) die benötigte Fähigkeit zu beschaffen. Es<br />
kann sogar sein, dass ein Unternehmen seine komplette Produkt- und Prozessarchitektur austauschen<br />
und neu entwickeln muss, um einen dauerhaften Vorteil im Wettbewerb aufzubauen – sonst<br />
tut es die Konkurrenz.<br />
Auch wenn ein Unternehmen auf dem Weg zur Mass Customization niemals mehr in die Massenproduktion<br />
zurückkehren will, so ist es dennoch wichtig, den gesamten dargestellten Prozess der<br />
Achterfigur bei jeder Neuerung zu durchlaufen. Jedes Modul und jeder Prozess muss entwickelt,<br />
stabilisiert, mit dem Rest der Organisation verbunden und zu höchster Qualität gebracht werden,<br />
um schließlich in die modulare Architektur des Unternehmens integriert zu werden. So lebt eine<br />
Organisation Mass Customization und fertigt nicht nur irgendwie kundenindividuelle Produkte. Da<br />
sich Produkte und Prozesse dynamisch an neue Wettbewerbsbedingungen anpassen müssen,<br />
hört der Zyklus der Achterfigur aus Entwicklung, Verbindung, Modularisierung und Erneuerung nie<br />
auf. Für die Abnehmer wird so im Zeitablauf eine ständige Verbesserung der Fähigkeiten des Mass<br />
Customizers spürbar.<br />
4.1.4 Einordnung der Produktindividualisierung in das<br />
Konzept der interaktiven Wertschöpfung<br />
Die vorangehende Argumentation hat schon viele Hinweise gegeben, warum eine<br />
Produktindividualisierung (Mass Customization) neben Open Innovation eine weitere<br />
Konkretisierung der Idee der interaktiven Wertschöpfung ist. Im Gegensatz zur klassischen<br />
Massenproduktion ist jeder einzelne Nutzer in den Wertschöpfungsvorgang<br />
integriert. Ohne die Mitwirkung des Kunden kann kein individuelles Endprodukt<br />
erstellt werden. Damit kommt es zu einer Neudefinition der klassischen Grenzen der<br />
Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Nachfragern. Individualisierung im Ver-<br />
207<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
ständnis dieses Kapitels ist herstellerinitiiert. Ein Anbieter entwickelt eine modulare<br />
Produktarchitektur bzw. ein vergleichbares modifizierbares Leistungsangebot sowie<br />
ein Interaktionssystem, mit dessen Hilfe die Nutzer der Produkte vor Kaufabschluss<br />
ihre eigene Konkretisierung dieses Angebots vornehmen können (Kleinaltenkamp<br />
1996, 2002). Ähnlich wie bei der Nutzung eines Toolkits for User Innovation (siehe<br />
Kapitel 3.5.2) ist auch hier die Idee, die Konkretisierung der (“sticky”, lokalen) Bedürfnisinformation<br />
in der Domäne des Nutzers zu belassen: Anstatt ex-ante zu erforschen,<br />
welche potenziellen Eigenschaften ein Produkt für einen bestimmten Abnehmerkreis<br />
haben soll, können die Kunden selbst diese Konkretisierung vornehmen und interaktiv<br />
eine fertige Produktspezifikation zum Hersteller transferieren.<br />
Konzept der interaktiven Produktrealisierung (Co-Design-Prozess)<br />
In Abgrenzung zu Open Innovation gibt es aber zwei wichtige Aspekte zu beachten:<br />
Mitwirkung der Nutzer (Interaktion): Bei Open Innovation sind es vor allem<br />
Nutzer mit besonderen Eigenschaften, die in den Innovationsprozess einbezogen<br />
werden bzw. diesen sogar anstoßen. Diese fortschrittlichen Nutzer (Lead User)<br />
kreieren in der Regel Lösungen, die anschließend oft für einen größeren<br />
Abnehmerkreis gegebenenfalls sogar “massenhaft” hergestellt werden. Bei einer<br />
Produktindividualisierung findet dagegen ein interaktiver Wertschöpfungsprozess<br />
mit allen Kunden statt. Dieser ist deshalb auch in der Regel besser strukturiert und<br />
repräsentiert einen Problemlösungsprozess, der im Wesentlichen aus einer Auswahl<br />
von Optionen aus einer vorgegebenen Menge bzw. der Konkretisierung vorgegebener<br />
Parameter besteht. Bei Open Innovation ist dieser Problemlösungsprozess<br />
in der Regel deutlich freier und umfasst innovative Tätigkeiten (aus<br />
Nutzersicht sind beide Prozesse aber häufig nicht zu unterscheiden).<br />
Lösungsraum: Mass Customization geht von einem festen Lösungsraum aus. Im<br />
Gegensatz zu Open Innovation, wo durch die Interaktion mit den Nutzern ein<br />
neuer Lösungsraum geschaffen wird, wird bei einer Produktindividualisierung ein<br />
vorhandener Lösungsraum genutzt bzw. konkretisiert. Natürlich ist auch eine<br />
Kombination beider Modelle möglich: Besonders fortschrittliche Nutzer können in<br />
die Gestaltung der angebotenen Optionen oder auch in die Entwicklung des<br />
Interaktionswerkzeuges (Konfigurator) einbezogen werden. Das so entstehende<br />
System wird dann von allen Kunden des Mass-Customization-Angebots genutzt.<br />
Die langfristige Anpassung und Weiterentwicklung des Lösungsraumes kann dann<br />
wiederum mit dem Input einzelner innovativer Nutzer geschehen (ein Beispiel<br />
dazu liefert die Fallstudie zu Adidas in Abschnitt 5.1).<br />
Auf Basis dieser Diskussion lassen sich auch verschiedene Formen von Mass<br />
Customization abgrenzen. Abgrenzungskriterium ist dabei der Zeitpunkt der<br />
Integration der Abnehmer in die Wertschöpfung – und damit das Ausmaß, in<br />
dem eine Konkretisierung des Lösungsraumes möglich ist. Abbildung 4–5 zeigt<br />
die sich derart ergebenden Konzepte (siehe auch Agrawal / Kumaresh / Mercer<br />
2001; Duray et al. 2000; Gilmore / Pine 1997; Lampel / Mintzberg 1996; Mintzberg<br />
1988; <strong>Piller</strong> 1998, 2006a; Schnäbele 1997; Waller / Dabholkar / Gentry 2000; Zäpfel<br />
1996).<br />
208
Match-to-order, locate-to-order<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Abbildung 4–5: Zeitpunkte der Integration des Kunden in die Leistungserstellung<br />
Anbieterunternehmen<br />
als Gestalter<br />
der Wertschöpfung<br />
Open Innovation<br />
Produktindividualisierung<br />
Interaktionsfeld<br />
Ideengenerierung<br />
Konzeptentwicklung<br />
Prototyp<br />
Produkt/Markttest<br />
Markteinführung<br />
Fertigung<br />
Montage<br />
Vertrieb<br />
After Sales<br />
Wertschöpfungsphasen<br />
Kunden / Nutzer als<br />
Wertschöpfungspartner<br />
Gestaltungsraum<br />
Bei einem match-to-order- bzw. locate-to-order-System findet die Kundenintegration<br />
erst in den der Produktion nachgelagerten Wertschöpfungsaktivitäten des Vertriebs<br />
statt. Durch ein entsprechendes Interaktionstool wird versucht, die Wünsche jedes<br />
Kunden zu ermitteln. Anschließend erfolgt eine Zuordnung zu einem vorhandenen<br />
Spektrum an Standardleistungen. Online-Autohändler erlauben z. B. durch ein Netzwerk<br />
an stationären Händlern die Suche nach einem Wagen laut Wunschspezifikation<br />
eines Kunden (locate-to-order). In der Bekleidungsindustrie möchten Unternehmen wie<br />
“Intellifit” oder “MyVirtualModel” an verschiedenen Standorten moderne 3D-<br />
Ganzkörper-Scanner betreiben. Die Scan-Daten jedes Kunden werden genutzt, um im<br />
Handel die Zuordnung zu den Konfektionsgrößen verschiedener Hersteller zu erreichen.<br />
Damit soll vor allem beim Distanzkauf das Passformrisiko reduziert werden. Der<br />
Anbieter Lands’End geht einen Schritt weiter, indem er den 3D-Scan für eine Stilanalyse<br />
verwendet und auf Basis dieser Daten seinen Kunden ein individuelles Outfit anbietet<br />
(bundle-to-order). Diese Formen der Mass Customization basieren nicht auf fertigungsbezogenen<br />
Aktivitäten, sondern auf Tätigkeiten im Vertrieb und Kundenservice. Diese<br />
Aktivitäten zählen daher zum Spektrum von “Soft Customization”.<br />
Begrenztheit des Lösungsraums<br />
Grad der Kundenintegration<br />
Ansatzpunkte<br />
zur Produktindividualisierung<br />
Development-to-order<br />
(Engineer-to-order)<br />
make-to-order<br />
Assemble-to-order<br />
Match-to-order,<br />
locate-to-order<br />
209<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Assemble-to-order, made-to-order<br />
Bei einem assemble-to-order- und made-to-order-System wird die Information über<br />
den Idealpunkt des Kunden genutzt, um ein individuelles Produkt herzustellen. Damit<br />
ist ein Eingriff in die Wertschöpfungsaktivitäten der Fertigung verbunden. Hier setzt<br />
z. B. die Maßkonfektion von Bekleidung an, bei welcher der 3D-Scan dazu dient, ein<br />
parametrisierbares Schnittmuster den Maßen des Kunden anzupassen. Danach erfolgen<br />
ein auftragsspezifischer Zuschnitt und das Vernähen der Stoffe zu einem individuellen<br />
Kleidungsstück. In der Literatur wird unter made-to-order (auch: bulid-toorder)<br />
auch die auftragsbezogene Fertigung von Standardwaren subsumiert. So fertigt<br />
z. B. der Motorradhersteller Harley Davidson alle Motorräder rein nach Kundenbestellung,<br />
jedoch kann der Kunde nur zwischen den verschiedenen Modellen aus<br />
dem Katalog wählen. Alle Individualisierungsoptionen (z. B. Tuning, Designelemente,<br />
etc.) werden nachträglich im Handel realisiert. Auch in diesem Fall findet eine kundenspezifische<br />
Fertigung statt, es kommt allerdings nicht zu einer Integration des Kunden<br />
in die Wertschöpfung im Sinne einer Einflussnahme auf die Produktspezifikation.<br />
Development-to-order<br />
Bei einem development-to-order (auch: engineering-to-order) ist die höchste Form<br />
der Wertschöpfungsintegration erreicht. Hier wird der Kunde auch in die Produktentwicklung<br />
integriert. Es geht nicht mehr nur um eine Anpassung eines Produktes<br />
innerhalb bestimmter Parameter, sondern es erfolgt eine Neukonstruktion, auf<br />
deren Basis dann eine individuelle Leistungserstellung erfolgt. Dies entspricht aus<br />
Kundensicht dem Fall einer klassischen auftragsbezogenen Einzelfertigung, kann aber<br />
heute durch Nutzung der Prinzipien der Mass Customization mit der Effizienz erfolgen,<br />
die der einer Massenproduktion entspricht.<br />
Der optimale Punkt der Kundenintegration<br />
Die Festlegung des optimalen Punkts der Kundeninteraktion und damit der Stelle, an<br />
der das auftragsneutrale System der Potenzialbereitstellung mit dem kundenauftragsbezogenen<br />
System der Konfiguration und Potenzialnutzung zusammentrifft, ist eine der<br />
wichtigsten Aufgaben bei der Einrichtung eines Mass-Customization-Systems (Anderson<br />
1997). Während der erste Teil für die kostengünstige Vorfertigung einzelner Leistungsbestandteile<br />
sorgt, ist das kundenorientierte Segment für ihr Zusammenführen in ein individuelles<br />
Endprodukt verantwortlich. Hierbei sind analog der in Abbildung 4–5 genannten<br />
Formen der Kundenintegration verschiedene Zeitpunke bzw. Orte zu unterscheiden,<br />
an denen auftragsbezogene und auftragsneutrale Wertschöpfungsaktivitäten aufeinander<br />
treffen. Die Trennung zwischen dem auftragsneutralen und auftragsbezogenen Teil beruht<br />
dabei zunächst nicht auf physischen Vorgaben bzw. einer Teilung der Fertigungsapparatur<br />
in zwei Bereiche, sondern ist vielmehr Spiegelbild einer gedanklich-planerischen<br />
Splittung der gesamten Wertschöpfungsaufgabe. Die Entscheidung, wo die Trennung beginnt,<br />
hat eine enge Verwandtschaft mit der Bestimmung des optimalen Vorfertigungsgrads.<br />
Der optimale Vorfertigungsgrad<br />
Die Entscheidung, an welcher Stufe der Kunde in die Wertschöpfung integriert wird,<br />
hat wesentliche Auswirkungen auf die Festlegung des optimalen Vorfertigungsgrades<br />
210
(siehe Definitionskasten). Die Bestimmung des optimalen Vorfertigungsgrads ist eine<br />
wesentliche Stellgröße zur Definition stabiler Prozesse (Corsten 1998a; Schnäbele<br />
1997). Auf der Prozessebene wird die Fertigung in einen kundenunabhängigen, standardisierten<br />
Teil und einen kundenspezifischen Teil gesplittet. Während der erste Teil<br />
für die kostengünstige Vorfertigung der einzelnen Komponenten sorgt, ist das kundenorientierte<br />
Segment für deren Montage in ein individuelles Endprodukt verantwortlich.<br />
Diese Zweiteilung ist eine wesentliche Voraussetzung zur Reduktion der Planungs-<br />
und Steuerungskomplexität, die mit einer kundenindividuellen Produktion<br />
verbunden ist.<br />
Auftragsneutrale und kundenbasierte Vorfertigung<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Der Vorfertigungsgrad charakterisiert den Schnittpunkt zwischen kundenunabhängiger und<br />
auftragsbezogener Fertigung. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, ab welchem Zeitpunkt<br />
“eine Variante zur Variante wird”. Die einzelnen Bauteile und Module eines Produkts werden bis<br />
zu diesem Punkt auftragsneutral vorgefertigt und auf Lager gelegt. Bei Eingang eines Auftrags<br />
werden sie dann entsprechend der gewünschten Auftragsspezifikationen bearbeitet und zum<br />
fertigen Produkt zusammengefügt. Ein Vorfertigungsgrad am Anfang des Fertigungsprozesses<br />
(“Vorfertigungsgrad von null”) bedeutet, dass alle Bearbeitungsschritte erst bei Auftragseingang<br />
beginnen und auftragsspezifisch vollzogen werden.<br />
Die gesamte Planungsaufgabe wird in Subsysteme aufgespalten. Diese bestehen aus<br />
zwei Regelkreisen (Doringer 1991):<br />
Ein kundenauftragsbezogener Regelkreis löst Fertigungsaufträge unmittelbar<br />
aufgrund eines konkret zuordenbaren Kundenauftrags aus.<br />
Ein kundenauftragsneutraler Regelkreis steuert Fertigungsaufträge (für Teile,<br />
Module, Varianten), die ohne direkten Bezug zu einem Kundenauftrag ausgelöst<br />
werden.<br />
Beide Regelkreise können sehr effizient verbunden werden. Dabei beruht die Trennung<br />
dieser Regelkreise zunächst nicht auf physischen Vorgaben bzw. einer Teilung der<br />
Fertigungsapparatur in zwei Bereiche, sondern ist vielmehr Spiegelbild einer gedanklich-planerischen<br />
Splittung der gesamten Fertigungsaufgabe. Ziel der Zweiteilung soll<br />
sein, alle Fertigungsgänge, die kundenauftragsneutral durchgeführt werden können<br />
und folglich der Produktionsplanung höhere Freiheitsgrade bieten, auch als solche zu<br />
planen. Die Komplexität des Gesamtsystems kann so entscheidend gesenkt werden. Die<br />
Entscheidung, wo die Trennung zwischen dem kundenauftragsbezogenen Regelkreis 1<br />
und dem auftragsneutralen, “standardisierten” Regelkreis 2 beginnt, entspricht im<br />
Wesentlichen dem Problem zur Bestimmung des optimalen Vorfertigungsgrads. Dieser<br />
Punkt (auch als Entkopplungs-, oder Variantenbestimmungspunkt sowie im Englischen<br />
als Freeze-, Order-Penetration- und Decoupling-Point bezeichnet) charakterisiert den<br />
Schnittpunkt zwischen kundenunabhängiger und auftragsbezogener Fertigung.<br />
Hierbei sind zwei alternative Vorgehensweise zu unterscheiden (Abbildung 4–6): Bei<br />
Möglichkeit 1 werden die einzelnen Bauteile und Module eines Produkts bis zum<br />
211<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Vorfertigungsgrad auftragsneutral erstellt und auf Lager gelegt. Bei Eingang eines<br />
Auftrags werden sie dann entsprechend der gewünschten Auftragsspezifikationen<br />
weiterbearbeitet und zum fertigen Produkt zusammengefügt. Je weiter der Vorfertigungsgrad<br />
auf eine spätere Stufe des Fertigungsprozesses verschoben werden<br />
kann, desto größer ist die mögliche Komplexitätsreduktion, da der Umfang der individuellen<br />
Leistungen geringer wird. Die Möglichkeit zur Bildung optimaler Losgrößen<br />
und Verstetigung der Produktion in der Vorfertigung erlaubt dort den Einsatz effizienterer<br />
Fertigungssysteme. Auch kommt es zu einer Verkürzung der Lieferzeiten, da<br />
nach Kundenauftrag nur noch wenige individuelle Schritte vollzogen werden müssen<br />
(Corsten 1998a; Homburg / Daum 1997; Köster 1998).<br />
Abbildung 4–6: Auftragsneutrale und kundenbasierte Vorfertigung<br />
Alternative 1:<br />
auftragsneutrale<br />
Vorfertigung<br />
Alternative 2:<br />
auftragsbasierte<br />
Vorfertigung<br />
standard. Vorfertigung individuelle Fertigung<br />
Vorfertigungsgrad<br />
Kundenauftrag<br />
Kundenauftrag<br />
Jedoch bedeutet ein hoher Vorfertigungsgrad aus einer logistikorientierten Sichtweise<br />
der gesamten Wertkette stets Verschwendung im Sinne einer Lagerhaltung, die an sich<br />
bei einer kundenauftragsgesteuerten Produktion nicht notwendig ist. Lagerkosten und<br />
Bestandsrisiko sowie die Planungskomplexität auf Komponentenebene können erst<br />
dann im Sinne einer echten “Customer-Pull-Strategie” vermieden werden, wenn erst<br />
beim Eingang einer Kundenbestellung die Aufbereitung der Rohstoffe beginnt und die<br />
weiteren Verarbeitungsschritte rein auftragsbezogen durchgeführt werden. Expertenschätzungen<br />
nehmen beispielsweise für die Bekleidungsindustrie bis zu 30 Prozent<br />
Verschwendung der Wertschöpfung durch fehlproduzierte Stoffe und fertige Produkte<br />
an.<br />
Hier kann eine Senkung des Vorfertigungsgrads – auch wenn es gängigen Vorstellungen<br />
des Komplexitätsmanagements widerspricht – theoretisch große Potenziale<br />
bergen, verbunden jedoch mit einem weit höheren Steuerungs-, Transport- und<br />
Umstellungsaufwand. Deshalb wird bei Alternative 2 zwar ein recht hoher Anteil auftragsneutraler<br />
Arbeitsgänge festgelegt, die Vorproduktion allerdings erst bei Eintreffen<br />
eines konkreten Kundenauftrags angestoßen. Damit können Zwischenlagerkosten und<br />
Bestandsrisiko vermieden werden. Da es sich bei der Vorfertigung nun zwar um auf-<br />
212<br />
Lager<br />
Kunde<br />
Kunde
tragsbedingte, aber inhaltlich stetige und repititive Prozesse handelt, sinkt die<br />
Planungskomplexität entscheidend. Voraussetzung sind allerdings ausreichende Kapazitäten<br />
in der Vorfertigung sowie eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit des<br />
Gesamtsystems.<br />
Bestimmung des optimalen Vorfertigungsgrads<br />
Die Wahl des optimalen Vorfertigungsgrads liegt so im Spannungsfeld zwischen<br />
Standardisierung und Individualisierung. Gutenberg (1979) spricht deshalb vom<br />
Vorfertigungsgrad als kritisches Standardisierungs- oder Typisierungsmaß. Ziel ist es,<br />
das optimale Verhältnis zwischen standardisierter und individualisierter Leistungsgestaltung<br />
zu finden. Der optimale Integrationsgrad kann sowohl aus Perspektive des<br />
Kunden als auch des Anbieters betrachtet werden. Aus Anbietersicht wird theoretisch<br />
anhand der preislichen Präferenzprämie bestimmt, die aufgrund der größeren<br />
Kundennähe der Leistung erzielt werden kann. Diese Präferenzprämie richtet sich<br />
nach dem Maß, mit dem der kundenindividuelle Idealpunkt getroffen wird. Je näher<br />
Leistungs- und Idealpunkt beieinander liegen, desto höher ist sie. Die Präferenzprämie<br />
wird den damit verbundenen Kosten gegenübergestellt. Das Optimum liegt an dem<br />
Punkt, an dem die Differenz aus zusätzlichen Erlösen und Kosten am größten ist. In<br />
der Praxis ist dieser Punkt aber leider nur schwer quantifizierbar (Homburg / Weber<br />
1996). Als Ersatz werden qualitative Faktoren herangezogen, die beispielsweise mittels<br />
eines Punktwertzahlverfahrens beurteilt werden. Mit diesem Verfahren können auf<br />
Produzentenseite beispielsweise die folgenden Kriterien mit einer geeigneten<br />
Gewichtung miteinbezogen werden:<br />
technische Kriterien (z. B. Handlingfähigkeit und Mehrfachverwendbarkeit der<br />
Module),<br />
Zwischenlagerkosten vorgefertigter Module,<br />
von den Nachfragern akzeptierte Lieferzeit,<br />
die Prognosegenauigkeit des Komponentenbedarfs,<br />
die Kosten einer Produktionsumstellung.<br />
Produktindividualisierung und Mass Customization<br />
Diese Aspekte sind aus Sicht der Abnehmer zu ergänzen. Hier sind beispielsweise die<br />
folgenden Einflussfaktoren relevant:<br />
die Erfahrung des Abnehmers mit dem Produkt (Wiederholungskauf, Vorbildung etc.)<br />
und damit die Fähigkeit zum Umgang mit einer größeren Komplexität bei Systemen<br />
mit sehr frühem Interaktionspunkt,<br />
die Höhe des Risikos eines Fehlkaufs (Umtauschmöglichkeit, Lieferzeit, Beurteilungsmöglichkeit),<br />
der Anteil des Konfigurationsvorganges als Teil der Absatzleistung (Konfiguration als<br />
Erlebniseinkauf und Zeitvertreib).<br />
Wie bereits in Kapitel 2 diskutiert, verlangt die interaktive Wertschöpfung von<br />
beiden Marktpartnern Einsatz. Damit gibt es auch aus Sicht der Kunden einen<br />
213<br />
4.1
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
optimalen Integrationsgrad. Ist zur Definition der kundenindividuellen Leistung<br />
zu viel Engagement des Kunden erforderlich, kann dieser Aufwand den<br />
Nutzenzuwachs zunichte machen. Wir werden diesen Aspekt noch in Abschnitt<br />
4.4 vertiefen.<br />
4.1.5 Effizienzkriterien interaktiver Wertschöpfung bei<br />
Produktindividualisierung<br />
Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, dass eine Individualproduktion<br />
zusätzlichen Nutzen für die Kunden schafft, der von Anbietern im<br />
Rahmen einer Differenzierungsstrategie genutzt werden kann. Jedoch stellt die<br />
Integration der Kunden bei einer Produktindividualisierung im Sinne von Mass<br />
Customization auch eine Kostenbelastung dar. Die Ursache sind höhere<br />
Produktionskosten durch die auftragsspezifische Fertigung und höhere<br />
Transaktionskosten durch den interaktiven Verkaufsprozess. Wir argumentieren<br />
aber im Folgenden, dass Kundenintegration nicht nur die Ursache zusätzlicher<br />
Kosten, sondern zugleich eine Quelle neuer Kostensenkungs- und Erlöspotenziale<br />
darstellt (siehe Abbildung 4–7 zur Übersicht). Eine Mass-Customization-<br />
Strategie ist nur dann erfolgreich, wenn die zusätzlichen Nutzenpotenziale die<br />
zusätzlichen Kosten übertreffen, d. h. wenn die interaktive Wertschöpfung das<br />
Effizienzkriterium erfüllt.<br />
Die folgende Argumentation betrachtet dabei zunächst die Kosteneffizienz einer<br />
interaktiven Wertschöpfung durch Produktindividualisierung (Abschnitt 4.2). Wir<br />
betrachten dazu sowohl die zusätzlichen Produktions- und Transaktionskosten als<br />
auch Ansatzpunkte, diese zusätzlichen Kosten wieder auszugleichen. Dabei lassen<br />
sich systemimmanente und systeminhärente Effekte unterscheiden. Moderne<br />
Produktions- und Informationstechnologien können das (monetäre) Ausmaß der<br />
zusätzlichen Kosten stark reduzieren, nicht aber die eigentlichen Quellen der Kosten.<br />
Systeminhärente Kostensenkungspotenziale einer interaktiven Wertschöpfung durch<br />
Produktindividualisierung resultieren aus den Prinzipien der Kundeninteraktion<br />
selbst, die über den besseren Zugang zu Bedürfnisinformation (“sticky information”)<br />
helfen, Verschwendung zu vermeiden und die Kundenabhängigkeit zu steigern.<br />
Produktindividualisierung hat aber auch positive Wirkungen auf die Erlöse<br />
(Absatzeffizienz). Diese beruhen auf einem wahrgenommenen Nutzenzuwachs der<br />
Abnehmer durch eine höhere Produktqualität (wiederum auf Basis der Möglichkeit für<br />
den Hersteller, Zugang zur Bedürfnisinformation der Nachfrager zu erlangen), aber<br />
auch durch eine positive Wahrnehmung des Interaktionsvorganges in der Co-Design-<br />
Phase (Prozessqualität). Beide Faktoren erlauben einem Anbieter preispolitische<br />
Potenziale, die Wettbewerbsvorteile einer interaktiven Wertschöpfung widerspiegeln<br />
(Abschnitt 4.3).<br />
214
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Abbildung 4–7: Übersicht der Treiber der Effizienz interaktiver Wertschöpfung bei<br />
Produktindividualisierung<br />
Effizienz interaktiver Wertschöpfung<br />
durch Produktindividualisierung<br />
Kosteneffizienz Absatzeffizienz<br />
zusätzliche Kosten Kostensenkungspotentiale<br />
(Economies of Integration)<br />
Zusätzl. Kosten in der<br />
Produktion<br />
Zusätzl. Kosten der<br />
Interaktion<br />
Zusätzl. Kosten im<br />
After-Sales-Prozess<br />
Besserer Zugang zu<br />
"sticky information"<br />
Vermeidung von<br />
Verschwendung<br />
durch besseren<br />
"Fit to market"<br />
Reduktion der Akquisekosten durch<br />
Steigerung der Abnehmerabhängigkeit<br />
Möglichkeit eines<br />
Preispremiums<br />
Erhöhung der<br />
Produktqualität<br />
Erhöhung der<br />
Produktqualität<br />
Kasten 4–3: Literaturempfehlungen zu den Grundlagen der Produktindividualisierung<br />
Duray, Rebecca / Ward, Peter T / Milligan, Glenn / Berry, William (2000). Approaches to mass<br />
customization: configurations and empirical validation. Journal of Operations Managements,<br />
18 (2000): 605-625<br />
Gilmore, James H. / Pine, B. Joseph II (1997). The four faces of mass customization. Harvard<br />
Business Review, 75 (1997) 1: 91-101<br />
Kotha, Suresh (1995). Mass customization: implementing the emerging paradigm for competitive<br />
advantage. Strategic Management Journal, 16 (1995), Special Issue ‘Technological transformation<br />
and the new competitive landscape’: 21-42<br />
Lampel, Joseph / Mintzberg, Henry (1996). Customizing customization. Sloan Management<br />
Review, 37 (1996) 1 (Fall): 21-30<br />
4.2 Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Die Kriterienbetrachtung im letzten Abschnitt hat bereits in die Diskussion neuer<br />
Kostensenkungspotenziale durch Kundenintegration eingeführt. Treiber für die<br />
Kosteneffizienz stehen Treibern für die Absatzeffizienz der Produktindividualisierung<br />
gegenüber.<br />
215<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
4.2.1 Zusätzliche Kosten durch Produktindividualisierung<br />
Eine Individualproduktion verursacht zusätzliche Kosten, die zum einen aus<br />
Investitionen in den Aufbau des Individualisierungspotenzials (Solution Space) resultieren<br />
(fixe Kosten), und zum anderen im operativen Geschäft anfallen (variable<br />
Kosten). Wichtig ist dabei eine Betrachtung über alle Wertschöpfungsbereiche hinweg,<br />
denn allzu oft werden in der Praxis lediglich die Kosten in der Produktion bedacht.<br />
Dabei sind bei vielen Mass Customizern aber vor allem die zusätzlichen Kosten, die<br />
auf die Interaktion mit den Kunden zurückzuführen sind, erfolgskritisch und bedürfen<br />
daher besonderer Aufmerksamkeit. In Anlehnung an eine einfache Unterteilung<br />
aller Kosten in Produktions- und Transaktionskosten (Picot 1982) gehört damit das<br />
besondere Augenmerk im Rahmen unserer Argumentation den Transaktionskosten.<br />
Beide Bereiche sollen im Folgenden kurz betrachtet werden. Dabei werden die einzelnen<br />
Kostenblöcke nur sehr knapp vorgestellt. Wichtiger als Anleitungen zur<br />
Quantifizierung ist uns die sich ergebende Struktur.<br />
Kostentreiber in der Produktion (Zusatzkosten des Herstellers)<br />
Für die Einrichtung und Planung der Produktion fallen im Vergleich zur klassischen<br />
Massenproduktion bei einer Einzelfertigung oftmals höhere Investitionen an. Ein<br />
Mass-Customization-Unternehmen benötigt in der Regel mehrere Universalmaschinen,<br />
um die wechselnden Bearbeitungsvorgänge zu bewältigen. Einem homogenen<br />
Massenfertiger dagegen reicht eine auf hohe Stückzahlen ausgelegte<br />
Spezialmaschine, die in der Regel eine höhere Produktivität pro Stück besitzt. In der<br />
Produktion gilt die Losgröße als ein wesentlicher Kostentreiber (<strong>Reichwald</strong> / Dietl<br />
1991). Bei einer homogenen Massenproduktion verteilt sich der Aufwand für die<br />
Produktionsplanung und –steuerung sowie das Rüsten der Maschinen auf alle produzierten<br />
Stücke eines (großen) Loses. Werden nur wenige oder gar nur ein Stück einer<br />
Produktvariante gefertigt, kommen diese Degressionserscheinungen nicht zum tragen.<br />
Diese Opportunitätskosten entsprechen den verlorenen Effizienzvorteilen einer standardisierten<br />
Massenproduktion. Auch heute gibt es keine effizientere Fertigungsstrategie<br />
als die klassische Massenproduktion. Für einen bearbeiteten Markt wird<br />
genau eine Produktversion entwickelt, die dann in Form einer massenhaften<br />
Produktion auf Vorrat produziert wird (Kleinaltenkamp 1995; Knolmayer 1999). Damit<br />
geht die Standardisierung auf Teileebene einher, was wiederum konstante und abgestimmte<br />
Leistungsprozesse ermöglicht (effiziente Fließsysteme). Dabei sind nicht nur<br />
die Produktionsprozesse, sondern auch Kommunikations-, Distributions- und Serviceleistungen<br />
standardisierbar. Die so zu verwirklichenden Vorteile entsprechen den klassischen<br />
Kostendegressionseffekten, die bei einer Individualfertigung in der Regel nicht<br />
erreicht werden können. Geringere Wiederholungsgrade eines Arbeitschritts führen<br />
auch zu einer eingeschränkten Wirksamkeit des Lerngesetzes der Produktion. Damit<br />
lässt sich nicht nur die Arbeitsproduktivität nicht verbessern, sondern häufig müssen<br />
auch höher qualifizierte Arbeitskräfte (mit einer höheren Flexibilität) eingestellt werden.<br />
Das Resultat sind steigende Arbeits- und damit Herstellkosten.<br />
Allerdings setzt die Idee des “stabilen Lösungsraumes” als Differenzierungsmerkmal<br />
einer Produktindividualisierung durch Mass Customization genau hier an. Eine<br />
216
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Modularisierung von Produkten und Prozessen soll auf der Vorleistungsebene unabhängig<br />
von einer individuellen Leistungserstellung Skaleneffekte verwirklichen (Jiao /<br />
Tseng 1996; Sahin 2000). Die Module stellen Gleichteile dar, d. h. sie gehen trotz ihrer<br />
standardisierten Herkunft ohne Veränderung in eine Vielzahl von verschiedenartigen<br />
Endprodukten ein (Feitzinger / Lee 1997; van Hoek / Commandeur / Vos 1998). Damit<br />
kommt es zu einer kostensenkenden Allokation der Inputfaktoren zur Definition und<br />
Entwicklung dieser Komponenten. Zur Sicherstellung dieser Kompatibilität müssen<br />
die Teile eine gemeinsame Systemarchitektur besitzen. Die synergetische Nutzung dieses<br />
Potenzials resultiert in Verbundeffekten (Feitzinger / Lee 1997). Diese Kombination<br />
von Skalen- und Verbundeffekten ist ein wesentliches Kennzeichen von Mass<br />
Customization (<strong>Piller</strong> 2006a).<br />
Dennoch kommt es in der Produktion zu zusätzlichen Kosten, die vor allem in der steigenden<br />
Komplexität des gesamten produktionstechnischen Aufgabenvollzugs begründet<br />
sind. Ein großes Problem ist dabei oft die Komplexität der Produktionsprogrammplanung.<br />
Die Planungskomplexität resultiert aus der Bewältigung der<br />
Unsicherheit aufgrund des stochastischen Auftragseingangs sowie der Bereitstellung<br />
einer hohen Lieferbereitschaft und Planungsstabilität zur Vermeidung von Engpässen<br />
vor allem in der Montage. In der Durchlauf- und Kapazitätsterminierung steigt die<br />
Komplexität zum einen durch zusätzliche Bearbeitungsschritte, wenn zum Beispiel ein<br />
größeres Bauteil, das bei einer Standardfertigung komplett montiert werden kann, nun<br />
in Teilmodule aufgespalten wird, die jeweils einzeln entsprechend der auftragsspezifisch<br />
durchzuführenden Arbeiten eingeplant werden müssen. Zum anderen steigen<br />
generell durch die Zunahme der einzuplanenden Aufträge die Anzahl und<br />
Vielschichtigkeit der Planungsläufe, da je nach Spezifikation verschiedene alternative<br />
Arbeitsvorgänge berücksichtigt werden müssen (Homburg / Weber 1996).<br />
Während der Bearbeitung selbst führen häufige Produktionsumstellungen zu einer<br />
Zunahme der Wechselkosten. Diese werden nicht nur durch den Rüstvorgang selbst<br />
verursacht (Werkzeugverschleiß, Arbeitsaufwand, Probestücke etc.), sondern enthalten<br />
auch Stillstandskosten während des Werkzeugwechsels und die damit hervorgerufene<br />
Minderauslastung der Fertigungskapazität. Das Ziel, die Wechselkosten durch eine<br />
geschickte Reihenfolgeplanung zu minimieren, führt zu einer weiteren Komplexitätssteigerung<br />
der Terminierungsrechnung. Die genannten Komplexitätssteigerungen<br />
in der Produktionsplanung äußern sich kostenseitig vor allem in einer Zunahme der<br />
Koordinationskosten (Personalkosten, Nutzung aufwendigerer PPS-Systeme etc.).<br />
Jedoch können in der Zukunft flexible Fertigungsverfahren diese Kosten vielleicht entscheidend<br />
senken. Insbesondere wird derzeit unter dem Stichwort Rapid Manufacturing<br />
eine Technologie diskutiert, die die werkzeuglose Erstellung von Produkten<br />
und Komponenten direkt aus einem Datenmodell heraus erlaubt. Kasten 4–4 stellt ein<br />
Beispiel dieser Technologie vor.<br />
Kostenwirkungen ergeben sich in Hinblick auf die Materialwirtschaft. Eine anonyme<br />
Variantenfertigung, die individuelle Kundenwünsche lediglich dadurch erfüllt, dass<br />
viele verschiedene Varianten “auf Verdacht” auf Lager produziert werden, führt natürlich<br />
im Vergleich zur Massenfertigung eines Standardprodukts zu steigenden<br />
Fertigwarenbeständen (und damit Lagerkosten), während eine echte Einzelfertigung<br />
217<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
auf Bestellung diese Fertigwarenbestände völlig abbauen könnte. Um die Kundenwünsche<br />
schnell zu erfüllen, müssen jedoch bei Mass Customization im Eingangslager<br />
anstatt eines Materials in einer bestimmten Qualität mehrere alternative Materialien in<br />
verschiedenen Ausprägungen vorgehalten werden, womit es zu einem Anstieg der<br />
Kosten der Eingangslagerhaltung kommt. Deshalb wird häufig auch eine auftragsspezifische<br />
Bestellung der Materialien gefordert (optimal aus Sicht der gesamten<br />
Wertschöpfungskette wäre natürlich die auftragsspezifische Vorfertigung der<br />
Materialien, siehe Abschnitt 4.1.3). Auch wenn so die Bestandskosten und –risiken sinken,<br />
steigt der Aufwand im Bestellwesen. Weitere Kosten resultieren aus der Notwendigkeit<br />
flexiblerer und aufwändigerer Transport- und Handlingsysteme, um ein<br />
größeres Teilespektrum verarbeiten zu können. Schließlich erhöht eine Zunahme der<br />
Materialvielfalt auch den Aufwand der Materialverwaltung sowie der Beschaffungsmarktforschung.<br />
Schließlich steigen bei einer kundenindividuellen Produktion auch die Ansprüche und<br />
damit die Kosten der Qualitätskontrolle. Während bei einer Fertigung von Standardprodukten<br />
Stichproben genügen, müssen bei einer individualisierten Produktion alle<br />
Produkte einer Qualitätsprüfung unterzogen werden, da nicht nur die stetigen<br />
Fertigungsbedingungen fehlen, die die Voraussetzung einer validen Stichprobe bilden,<br />
sondern auch pro Produkt zusätzlich die Einhaltung der Individualisierungswünsche<br />
des Kunden geprüft werden muss (nichts ist geschäftsschädigender als eine unpassende<br />
Maßfertigung).<br />
Kasten 4–4: Mass-Customization-Produktionstechnologie Rapid Manufacturing: Die<br />
Brille aus dem Drucker<br />
(Quelle: Auszug aus dem Artikel “Die Brille aus dem Drucker” von Susanne Donner in Spiegel-<br />
Online vom 05. November 2005 [tinyurl.com / r6lzo])<br />
(...) Möglich, dass man sich irgendwann einmal eine neue schicke Sonnenbrille drucken wird,<br />
wenn man die alte verlegt hat. Noch sind solche 3D-Druckverfahren zu teuer für den<br />
Alltagsgebrauch. Fraunhofer-Forscher in Magdeburg testen aber schon einmal aus, was alles drinsteckt<br />
in der Technik. Es kommt selten vor, dass eine neue Technik ausgerechnet die Kreativität<br />
von Künstlern und Designern bereichert. Die so genannten Rapid-Technologien sind eine dieser<br />
seltenen Ausnahmen, denn sie werden dem künstlerischen Wunsch nach Einzigartigkeit eines<br />
Produktes gerecht. Schon heute entstehen mithilfe des Verfahrens exklusive Lampen,<br />
Sonnenbrillen und Handtaschen - individuell nach Kundenwunsch hergestellt. Nach einer Vorlage<br />
im Computer entsteht dabei auf Knopfdruck der gewünschte Gegenstand. Möglich wird dies mit<br />
einer Art 3D-Drucker, der das Unikat auf einer festen Unterlage in die Höhe wachsen lässt. Schicht<br />
für Schicht bauen solche Geräte beispielsweise Tassen oder Teller aus Kunststoff oder<br />
Schmuckstücke aus Metall auf. “Jahrhundertelang musste der Produkt-Designer darauf Rücksicht<br />
nehmen, was in der Fertigung überhaupt technisch machbar ist. Mit den Rapid-Verfahren entfällt<br />
dieser Zwang: Jede noch so komplizierte Produktgestalt ist herstellbar”, erläutert Rudolf Meyer von<br />
der Fraunhofer-Allianz Rapid Prototyping in Magdeburg. Mittlerweile lassen sich deshalb viele<br />
Designer von den Möglichkeiten der neuen Technik beflügeln.<br />
Das Rapid-Unternehmen EOS in Krailling bei München beispielsweise profitiert vom Interesse der<br />
Künstler: Hier wird eine Handtasche gefertigt, die nur aus Kunststoffringen von der Größe eines<br />
218
Kosten der Interaktion im Wertschöpfungsprozess<br />
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
10-Cent-Stückes besteht. Jeder Ring ist mit den jeweiligen Nachbarringen verhakt, so dass auf<br />
diese Weise ein Netz entsteht. “Industriell lässt sich so eine Handtasche gar nicht herstellen und<br />
von Hand müsste man alle Ringe einzeln miteinander verlöten, was wiederum nur mit Metall funktionieren<br />
würde. Der Kunde wollte aber einen weißen Kunststoff haben”, berichtet Christof Stotko,<br />
Marketingleiter der Münchner Firma. Um die Handtasche herzustellen, verteilt die Rapid-Maschine<br />
zunächst eine 0,1 Millimeter dünne Schicht Kunststoffpulver auf einer Arbeitsunterlage. Ein<br />
Laserstrahl bringt das Pulverbett genau dort zum Schmelzen, wo später Kettenglieder entstehen<br />
sollen. Beim Abkühlen erhärten die geschmolzenen Stellen und werden zu festem Kunststoff. Ein<br />
Relief aus verschlungenen Ringen ragt nun empor, während ringsum das Pulver liegen bleibt. Ist<br />
die erste Schicht auf diese Weise fertig gestellt, geht die Prozedur von vorne los. Es wird eine neue<br />
Pulverschicht über das Relief der sich herausbildenden Ringe gestreut. Lage um Lage wächst die<br />
Handtasche mit diesem so genannten Laser-Sinter-Verfahren in die Höhe. Nach sieben Stunden<br />
Produktionszeit ist das Accessoire fertig. “Es ist eher ein exklusives Modeobjekt”, sagt Stotko. (...)<br />
“Mit den Rapid-Verfahren lassen sich die Produkte individualisieren und dem Kunden quasi auf<br />
den Leib schneidern. Das ist faszinierend. Aber noch stehen wir hier am Anfang der Entwicklung”,<br />
meint Meyer. Denn der schier unbegrenzten gestalterischen Freiheit steht bislang eine begrenzte<br />
Zahl an Werkstoffen gegenüber. Während der Ingenieur im Maschinenbau oder in der<br />
Textilindustrie zwischen tausenden Materialien wählt, verarbeiten die Rapid-Maschinen bis dato<br />
nur einige Dutzend Spezialwerkstoffe. Neben Kunststoffen können Metall, Papier und Keramik verwendet<br />
werden. (...) Die Technik hat in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte gemacht<br />
und der Preis für die Geräte ist gefallen. “Vielleicht werden in 5 bis 8 Jahren die ersten Haushalte<br />
über ihren eigenen 3D-Drucker verfügen, wenn die preiswertesten Geräte dann nur einige<br />
Tausend Euro statt der heute üblichen 25.000 Euro und mehr kosten”, wagt Meyer einen Blick in<br />
die Zukunft.<br />
Kundenbezogene Wertschöpfung findet im engeren Sinne auf der Informationsebene<br />
statt. Grundlage der Erstellung individueller Produkte und Leistungen ist stets eine<br />
Interaktion zwischen Abnehmer und Anbieter im Leistungserstellungsprozess<br />
(Hibbard 1999; Ramirez 1999). Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kontaktanbahnung,<br />
Verkauf und Bindung der Endkunden als auch in Bezug auf die physische<br />
Warenverteilung. Ein Massen- bzw. Variantenfertiger überträgt diese Aufgaben in der<br />
Regel dem Handel. Eine solche Aufgabenteilung ist aber vor allem hinsichtlich einer<br />
individuellen Leistungserstellung unökonomisch. Je komplexer ein Leistungsobjekt<br />
und der dazu gehörige Spezifikationsprozess ist, desto wichtiger und effizienter wird<br />
aus Transaktionskostensicht die interne Abwicklung der Distributionsfunktion, d. h.<br />
bei einer spezifischen, individuellen Leistung ist eine direkte Kommunikation zwischen<br />
Abnehmer und Hersteller im Sinne eines Direktvertriebs ohne Einschaltung des<br />
Handels vorteilhaft (Picot 1986; Schnäbele 1997).<br />
Wir können auch hier wieder die zusätzlichen Kosten von Mass Customization aus den<br />
Verlusten der Effizienzvorteile einer Massenproduktion begründen, nun aus Sicht des<br />
Vertriebs: Aus Transaktionskostensicht beruhen die Potenziale der Standardisierung<br />
auf der asymmetrischen Informationsverteilung der Abnehmer über die Eigenschaften<br />
von Gütern und Leistungen. Gerade bei neuen Produkten machen fehlende<br />
Erfahrungswerte eine Beurteilung der Eignung unmöglich, womit das Risiko von<br />
219<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Fehlentscheidungen steigt. Eine individuelle Leistungserstellung verstärkt diese<br />
Unsicherheiten drastisch. Bei einer standardisierten Leistung dagegen können potenzielle<br />
Käufer auf bestehendes Wissen über ähnliche Leistungen zurückgreifen.<br />
Standards dienen deshalb genauso wie Preise als Informationsträger im Marktprozess,<br />
die sowohl Nachfrager als auch Anbieter bei ihrer Informationsgewinnung (Screening)<br />
und Informationsübertragung (Signaling) unterstützen. Sie bilden “Verhaltensregeln”<br />
der Marktteilnehmer, die zu sinkenden Transaktionskosten führen (Kleinaltenkamp<br />
1995). Bei einer Individualisierung der Leistungserstellung können diese Vorteile nicht<br />
per se genutzt werden, um den abnehmerseitigen Grad der Unsicherheit zu reduzieren.<br />
Hierzu bedarf es zusätzlicher Maßnahmen. Damit steigen aber die Informationsund<br />
Kommunikationskosten aus Sicht des Herstellers im Vergleich zum Absatz massenhafter<br />
Waren und Leistungen stark an (<strong>Piller</strong> et al. 2005):<br />
Steigende Informations- und Kommunikationskosten durch Erhebung der<br />
Konfigurationsinformation für jeden Kunden: Hierbei geht es bei weitem nicht<br />
nur um die rein funktionale Erhebung der Wünsche, sondern vor allem auch um<br />
Beratung der Kunden bei der Formulierung ihrer Wünsche. Zusätzliche Kosten<br />
entstehen neben den operativen Kosten bei jedem Kundenkontakt vor allem durch<br />
den Aufbau entsprechender Konfigurationssysteme (Technik und Multi-Channel-<br />
Integration).<br />
Aufbau von Vertrauen und Risikoreduktion beim Abnehmer: Der Einbezug der<br />
Kunden in die Wertschöpfung bedeutet für diese nicht nur aktive Mitarbeit, sondern<br />
auch einen Vertrauensvorschuss und zusätzliches Risiko. Hieraus resultiert<br />
die Notwendigkeit von vertrauensstiftenden Maßnahmen und einer ausgeklügelten<br />
Kommunikationspolitik – beides sind wesentliche Kostentreiber von Mass<br />
Customization, die oft unterschätzt werden.<br />
Zusatzkosten für den Kunden<br />
Diese zusätzlichen Kosten lassen sich so auch aus Sicht der Abnehmer beschreiben. Die<br />
direkten Kosten von Mass Customization aus Kundensicht entsprechen dem<br />
Preispremium, das ein Kunde für ein individuelles Gut im Vergleich zum massenhaften<br />
Gut zahlen muss. Doch für die Kunden fallen auch indirekte Kosten an, die aus<br />
ihrer Beteiligung am interaktiven Wertschöpfungsprozess resultieren. Angesichts der<br />
kombinatorisch oft sehr hohen möglichen Variantenzahlen zur Definition eines<br />
Endprodukts bei nur einigen Optionen steht der Käufer vor einer sehr komplexen<br />
Kaufentscheidung im Vergleich zum Kauf eines Standardprodukts (Broekhuizen /<br />
Alsem 2002; Dellaert / Stremersch 2005; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2003; De Meyer, Dutta /<br />
Srivastava 2002; Huffman / Kahn 1998; Zipkin 2001). In industriellen Märkten wird er<br />
zwar häufig das notwendige Know-how für die Produktdefinition besitzen, jedoch ist<br />
auch hier der Konfigurationsprozess oft mit großem Aufwand verbunden und führt<br />
zum beschriebenen Faktortransfer. Im Konsumgütergeschäft dagegen besitzen die<br />
Kunden bei vielen Produkten keine ausreichenden Kenntnisse zur Definition der<br />
Produktspezifikation, die ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können keine<br />
Präferenzreihenfolge zwischen verschiedenen Variationsvorschlägen bilden und das<br />
Preis-/Leistungsverhältnis nicht richtig abschätzen (Baker et al. 2002; Stone / Gronhaug<br />
1993). Das Resultat ist nicht nur ein erheblicher Zeitaufwand für die Konfiguration,<br />
220
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
sondern auch eine steigende Unsicherheit des Abnehmers, da bei Kaufabschluss die<br />
Leistungserstellung noch nicht erfolgt ist (Dellaert / Stremersch 2005; Ludwig 2000;<br />
Huffman / Kahn 1998). Populär bezeichnen <strong>Piller</strong> at al. (2005) deshalb diese Unsicherheit<br />
bei Mass Customization als “mass confusion”. Diese Probleme lassen sich in<br />
zwei wesentliche Treiber indirekter Kosten von Mass Customization aus Kundensicht<br />
gliedern (Huffman / Kahn 1998; Liechty / Ramaswamy / Cohen 2001).<br />
“Qual der Wahl” (“burden of choice”): Eine hohe Variantenvielfalt bzw. das Angebot<br />
individualisierbarer Leistungen erhöht die Informationskosten des<br />
Abnehmers. Such- und Vergleichsprozesse sind unübersichtlicher, die Transparenz<br />
der Angebote ist geringer. Die Marketingforschung hat in vielen Studien gezeigt,<br />
dass viele Konsumenten an einer Minimierung der Zeit und des Aufwandes interessiert<br />
sind, der mit einer Kaufentscheidung verbunden ist. Je geringer der<br />
Aufwand, desto höher oft auch die Zahlungsbereitschaft (Anderson 1972). Ein<br />
Kaufakt, der zu zeitaufwändig erscheint, wird häufig abgebrochen und das Budget<br />
zu anderen Bereichen verlagert (Babin / Darden / Griffin 1994; Simon 1976). Ein<br />
Problem von Mass Customization ist in dieser Hinsicht, dass eine zu hohe Anzahl<br />
an Optionen die Komplexität aus Kundensicht erhöhen mag. Die Kunden können<br />
durch die Auswahlmöglichkeiten schier erschlagen werden (<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004;<br />
Huffman / Kahn 1998; Kamali / Loker 2002; Stump, Athaide / Joshi 2002; Wind /<br />
Rangaswamy 2001). Jeder, der einmal gezwungen war, aus einer großen Auswahl<br />
eine Entscheidung zu treffen, kennt diese Situation (man denke an die Speisekarte<br />
eines Chinesischen Restaurants mit 500 Positionen). Die Möglichkeit von Menschen<br />
zur Verarbeitung von Informationen ist begrenzt (Miller 1956) und kann leicht zu<br />
einem “Information Overload” führen (Maes 1994; Neumann 1955). Als Resultat<br />
lässt sich in der Praxis beobachten, dass Kunden immer wieder den<br />
Interaktionsvorgang bei einem Mass-Customization-Angebot abbrechen und sich<br />
dem Standardangebot zuwenden (Dellaert / Stremersch 2005; Hill 2003). Dieses<br />
Problem wird dadurch noch verstärkt, dass viele Kunden relativ wenig<br />
Produktwissen besitzen und so einfach nicht beurteilen können, welche Variante<br />
ihren Bedürfnissen am ehesten entspricht (Huffman / Kahn 1998). Selbst ein einfaches<br />
Produkt wie ein Paar Jeans kann ein hochkomplexes Gut werden, wenn die<br />
Auswahl des Schnitts, der Farbe, des Garns, der Anzahl von Taschen und<br />
Gürtelschnallen und des Innenfutters unabhängig voneinander gewählt werden<br />
müssen<br />
Qualitätsunsicherheiten des Abnehmers entstehen, da er die Leistung ex ante<br />
nicht überprüfen kann. Dies steht im Gegensatz zu einer Standardisierung komplexer<br />
Leistungen, da hier – selbst wenn die Leistung bei Verkaufsabschluss noch nicht<br />
vorliegt – eine Vergleichbarkeit mit anderen Produkten gegeben ist. Insbesondere<br />
bei wiederholten Käufen standardisierter Produkte eines Abnehmers bei einem<br />
Anbieter wird die Qualitätsunsicherheit stark reduziert (Gersch 1995;<br />
Kleinaltenkamp / Marra 1995). Gleichfalls ist die Situation des Abnehmers von<br />
Unsicherheit bezüglich des Verhaltens des Anbieters geprägt. Bedingt durch den<br />
kooperativen Charakter der individuellen Leistungserstellung besteht zwischen<br />
den Beteiligten eine asymmetrische Informationsverteilung – eine typische<br />
Principal-Agent-Konstellation. Der Anbieter als Agent trifft Entscheidungen, die<br />
221<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
nicht nur seinen eigenen Nutzen, sondern auch den des Abnehmers (Principal)<br />
beeinflussen. Der Nachfrager weiß nicht, inwieweit der Anbieter bereit und in der<br />
Lage ist, sein Leistungsversprechen zu halten. Diese Situation ist umso ausgeprägter,<br />
je neuer und individueller die zu erstellende Leistung ist. Standardisierte<br />
Produkte können hier als Signale verstanden werden, die Leistungsfähigkeit des<br />
Anbieters zu dokumentieren. Zudem sind sie die Voraussetzung für Garantieversprechen<br />
des Anbieters (Agenten), die die Unsicherheit des Nachfragers reduzieren<br />
können. Ohne einen eindeutigen Anhaltspunkt zur Definition einer optimalen<br />
Leistung ist nicht oder nur schwer zu beurteilen, ob ein Garantiefall eingetreten ist.<br />
In diesem Sinne tragen Standards dazu bei, die asymmetrische Informationsverteilung<br />
und Unsicherheitssituation aus Sicht des Abnehmers stark abzuschwächen<br />
und individuelle Handlungsspielräume des Anbieters zu mindern. Ebenso<br />
dienen Produkt-Informationen, Garantien und die Reputation des Anbieters zur<br />
Vermittlung von Kompetenz und den Aufbau von Vertrauen (Gersch 1995;<br />
Hildebrand 1997; Kahn 1998).<br />
Die mit diesen Faktoren verbundenen Unsicherheiten und Faktortransfers können als<br />
zusätzliche Kosten des Kunden interpretiert werden, der sich auf eine Leistungsindividualisierung<br />
einlässt. Eine der wichtigsten Aufgaben des Anbieters – und daraus<br />
resultiert ein wesentlicher Kostentreiber – ist dafür zu sorgen, dass einerseits dieser<br />
Aufwand möglichst gering gehalten wird und andererseits der Nutzen, den der Kunde<br />
aus der Individualisierung erfährt, deutlich höher als die von ihm wahrgenommenen<br />
Mühen bzw. zusätzlichen Kosten der Individualisierung ausfällt. Gerade bei der<br />
Einbindung von Konsumenten in den Prozess der Leistungsgestaltung sollte die<br />
Intensität der Integration auf ein für ihn wirtschaftlich wie geistig zu bewältigendes<br />
Höchstmaß begrenzt werden. Unternehmen, die ihren Kunden eine größtmögliche<br />
Varietät bieten und gleichzeitig durch geeignete Maßnahmen bei der Auswahl helfen,<br />
erlangen einen großen Wettbewerbsvorteil.<br />
Zusatzkosten im After-Sales-Service<br />
Auch in der Nachkaufphase und bei produktbegleitenden Dienstleistungen führt Mass<br />
Customization zu steigenden Kosten. Neben Kosten für Garantien und Gewährleistung<br />
können auch Produktschulungen und andere Serviceleistungen aufwändiger<br />
als bei vergleichbaren Massengütern werden. Auch die beste Interaktion kann<br />
niemals ausschließen, dass das endgültige Produkt einem Kunden nicht gefällt bzw.<br />
seinen Ansprüchen nicht gerecht wird. Aus unserer Sicht ist eine Rücknahmegarantie<br />
nach dem Prinzip “no questions asked” unabdingbar, um das Vertrauen der Kunden<br />
in das System zu gewinnen. Je nachdem, wie gut Anspruch und Wirklichkeit des Mass<br />
Customizers beieinander liegen, kann dieses Angebot ebenfalls einen nicht unerheblichen<br />
Kostenfaktor darstellen.<br />
In der Nachkaufphase kann ein Individualfertiger vor dem Problem einer ausufernden<br />
Ersatzteilbevorratung stehen. Für jede vorhandene Leistungsvariante müssen<br />
Ersatzteile bereitgehalten werden. Auch Leistungen wie beispielsweise Reparaturen<br />
gestalten sich schwieriger, da jede Variante aufgrund abweichender Ausprägungen<br />
unterschiedliche technische Probleme aufwerfen kann, die bei anderen Varianten in<br />
dieser Art noch nicht aufgetreten sind. Damit verlangsamen sich Lerneffekte beim<br />
222
Servicepersonal, die im Bereich von massenhaft produzierten Gütern Kostensenkungspotenziale<br />
eröffnen (Anderson 1997; Mayer 1993). Schließlich sinkt mit zunehmender<br />
Varietät auch die Möglichkeit, Sekundärdienstleistungen, die aus Marketinggründen<br />
das Produkt begleiten, zu standardisieren. Kann beispielsweise bei Massenprodukten<br />
für mehrere Abnehmer gleichzeitig eine Schulung durchgeführt werden, ist<br />
dies bei Individualprodukten oft nicht möglich. Bei komplexen technischen Produkten<br />
können gerade im Industriegüterbereich zusätzliche Kosten für die interne wie externe<br />
produktbegleitende Dokumentation anfallen (Stücklisten, Bedienungsanweisungen,<br />
Schaltpläne etc. ...). In diesem Sinne sind die Prinzipien von Mass Customization<br />
auf die Erstellung dieser Dienstleistungen zu übertragen (siehe z. B. Büttgen / Ludwig<br />
1997; <strong>Piller</strong> / Meier 2001; <strong>Reichwald</strong> / <strong>Piller</strong> / Meier 2002).<br />
4.2.2 Neue Kostensenkungspotenziale durch<br />
Produktindividualisierung<br />
Wir haben im letzten Abschnitt eine Vielzahl an Treibern zusätzlicher Kosten von Mass<br />
Customization beschrieben. Insgesamt gibt es aus Anbietersicht drei Möglichkeiten,<br />
diese zusätzlichen Kosten zu decken (<strong>Piller</strong> / Möslein / Stotko 2004):<br />
Erstens gestattet die Differenzierungswirkung von Mass Customization, höhere<br />
Preise für ein individuelles Gut zu verlangen. Ursache dieses Preissetzungspotenzials<br />
ist die Wahrnehmung einer höheren Qualität durch die Abnehmer (siehe<br />
Abschnitt 4.3).<br />
Zweitens erlauben die Potenziale moderner Produktions- und Informationstechnologien,<br />
die zusätzlichen Kosten einer Produktindividualisierung durch<br />
Mass Customization heute im Vergleich zu einer klassischen Einzelfertigung zu<br />
senken (siehe dazu ausführlich <strong>Piller</strong> 2006a). Ebenso soll der Gedanke des stabilen<br />
Lösungsraumes und der daraus abgeleiteten Forderung nach stabilen Prozessen<br />
und Produktarchitekturen (Modularisierung) die Höhe der zusätzlichen Kosten<br />
beschränken. Auch diesen Aspekt haben wir bereits mehrfach angesprochen.<br />
Drittens aber kann die Kundenintegration auch zugleich eine Quelle neuer<br />
Kostensenkungspotenziale darstellen. Interessanterweise bieten genau die gleichen<br />
Ursachen der Kundenintegration, die für die steigenden Kosten einer<br />
Einzelfertigung verantwortlich sind, auch Ansatzpunkte für zusätzliche Kostensenkungspotenziale,<br />
die beim Angebot standardisierter Produkte nicht möglich<br />
sind (<strong>Piller</strong> 2006a; <strong>Piller</strong> / Möslein / Stotko 2004; <strong>Reichwald</strong> / <strong>Piller</strong> 2003).<br />
Economies of Integration<br />
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Wir fokussieren die Argumentation in diesem Anschnitt auf den dritten Aspekt. Diese<br />
neuen Kostensenkungspotenziale beruhen auf der Möglichkeit, durch die Integration<br />
der Kunden in die Wertschöpfung des Herstellers besseren Zugang zu Kundenwissen<br />
zu erlangen, welches wiederum Effizienz- und Effektivitätssteigerungspotenziale in<br />
Vertrieb und Fertigung birgt. Diese aus der Kundenintegration per se resultierenden<br />
223<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Kostensenkungspotenziale bezeichnen wir im Folgenden mit “Economies of Integration”.<br />
Sie ergeben sich, wenn ein Unternehmen seine Wertschöpfungsprozesse<br />
besonders gekonnt vollzieht. Die Business-Process-Reengineering-Diskussion setzt<br />
hier ebenso an wie der Lean-Management-Gedanke. Durch eine friktionslose, doppelte<br />
Prozesse und Leerzeiten vermeidende Abwicklung der verschiedenen Schritte der<br />
Wertkette sollen sowohl Kosten gespart als auch der Kundennutzen erhöht werden.<br />
Eine Verbesserung der Informationsbasis der jeweiligen Planungs- und Steuerungsprobleme<br />
ist die Basis für eine Verbesserung der Prozesse selbst. Die direkte<br />
Interaktion zwischen Hersteller und Kunde stellt hierzu im Vergleich zu einer anonymen<br />
Marktfertigung bedeutende Informationspotenziale bereit.<br />
Economies of Integration beruhen auf dem besseren Zugang eines Unternehmens zu<br />
Wissen und Informationen, die ihren Ursprung in der Domäne des Kunden haben, aber<br />
für eine effiziente Leistungserstellung durch das Unternehmen benötigt werden. Diese<br />
Informationen sind, wie wir in Abschnitt 2.4.3.3 diskutiert haben, häufig “sticky”, d. h.<br />
nur mit erheblichen Aufwand und Kosten zu transferieren. Die Integration der Kunden<br />
in die Wertschöpfung erlaubt nun Herstellern, diese Informationen mit erheblich geringerem<br />
Aufwand zu verwenden (wir erinnern noch einmal daran, dass es im Kern nicht<br />
darum geht, diese Information in die Domäne des Herstellers zu transferieren, sondern<br />
nur, diese nutzbar zu machen). Besteht dieser Zugang zu Kundeninformation, folgen<br />
daraus zwei wesentliche Effekte, die neue Kostensenkungen ermöglichen:<br />
die Reduktion von Verschwendung in der Leistungserstellung und -distribution<br />
und<br />
eine erhöhte Effizienz bei der Akquise neuer und bestehender Kunden für<br />
Folgekäufe (Steigerung der Abhängigkeit der Abnehmer und damit potenziell der<br />
Kundenloyalität). Es sei an dieser Stelle bereits betont, dass Economies of<br />
Integration keinen Automatismus, sondern lediglich Potenziale darstellen, die von<br />
einem einzelnen Anbieter umgesetzt und realisiert werden müssen.<br />
Vermeidung von Verschwendung durch besseren “Fit-to-Market”<br />
Wesentliches Ziel von Kundenintegration ist die Gewinnung eines genaueren<br />
Verständnisses des Marktumfeldes, also heutiger wie künftiger Kundenwünsche. Dies<br />
gilt insbesondere dann, wenn diese Information nicht direkt vom Kunden erfragt werden<br />
kann. “Meistens sind die Kunden, selbst im Business-to-Business-Markt, nicht in<br />
der Lage, ihre Bedürfnisse und ihre Erwartungen vollumfänglich zum Ausdruck zu<br />
bringen” (Boutellier / Schuh / Seghezzi 1997: 52). Homburg konnte in einer empirischen<br />
Untersuchung zeigen, dass kundennahe Unternehmen eine bessere Effizienz bei<br />
der Allokation von Forschungs- und Entwicklungsressourcen haben, sie forschen nicht<br />
“am Markt vorbei” (Homburg 1995: 203). Aggregation und Vergleich der<br />
Informationen, die ein Unternehmen über seine verschiedenen Kunden gewonnen hat,<br />
bewirken, dass das Kundenverhalten transparent wird. Dies erlaubt eine zielgerichtete<br />
und effizientere Marktbearbeitung (siehe auch noch mal die sehr ähnliche<br />
Diskussion in Zusammenhang mit Open Innovation in Abschnitt 3.4.3).<br />
Als Folge ergeben sich Kostensenkungen, wenn durch die Kundenintegration früher<br />
bekannt wird, welche Produktspezifikation die Kunden wann benötigen werden.<br />
224
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Dieses Wissen wirkt kostensenkend, wenn die Zulieferkette entsprechend optimiert<br />
und Über- und Unterbestände auf Komponentenebene – d. h. Verschwendung – vermieden<br />
werden können. Eine kundenindividuelle Leistungserstellung kann hier eine<br />
Reihe von Vorteilen verwirklichen, die über Präferenz-/Differenzierungsvorteile hinausgehen<br />
und aus einer gesteigerten Effizienz der Leistungserstellung resultieren. Die<br />
direkte Interaktion zwischen Hersteller und Kunde stellt hierzu im Vergleich zu einer<br />
anonymen Marktfertigung bedeutende Informationspotenziale bereit.<br />
Die “on-demand”-Strategie von Mass Customization vermeidet Fehlprognosen auf<br />
Endproduktebene ebenso wie hohe Distributionslagerkosten. Produktionsseitig kann<br />
sich die Lagerhaltung auf Rohmaterialien und Bauteile beschränken, die zudem teilweise<br />
noch auftragsbezogen beschafft werden können. Der Abbau von Fertigwarenbeständen<br />
kann die Bestandskosten drastisch reduzieren – bei gleichzeitig steigender<br />
Planungssicherheit. Auch entfallen Abschriften auf überschüssige Produkte<br />
durch Modellwechsel. Da ein Mass Customizer keine nur auf Verdacht eines möglichen<br />
Kundeninteresses produzierte Ware auf Lager hält, muss das Kundeninteresse<br />
auch nicht künstlich durch z. T. hohe Preisnachlässe geweckt werden. Betrachtet man<br />
die Tatsache, dass in der Textilindustrie viele Händler lediglich 50 bis 60 Prozent ihrer<br />
Waren zum vollen Preis absetzen können, kann die Abschaffung der daraus folgenden<br />
Preisnachlässe aufgrund der rein kundenindividuellen Produktion für den Rest der<br />
Ware ein wesentlicher Beitrag für höhere Margen sein (siehe dazu die Fallstudie in<br />
Abschnitt 5.5). So können die Preise gesenkt werden, oder es steht ein höherer<br />
Spielraum zur Verfügung, die aus der Individualisierung resultierenden zusätzlichen<br />
Kosten zu decken (Feitzinger / Lee 1997, Schnäbele 1997).<br />
Auch in anderen, dynamischen und von einer heterogenen Nachfrage gekennzeichneten<br />
Märkten herrschen bei einem Angebot vorgefertigter Produkte hohe Anpassungskosten,<br />
die sich beispielsweise in hohen Sicherheitsbeständen, Lieferausfällen aufgrund<br />
von Fehlplanungen, kurzfristigen Produktionsumstellungen oder einer erhöhten<br />
Planungskomplexität äußern. Die Fertigung individueller Leistungsvarianten kann<br />
hier aus einer aggregierten Sicht die Anpassungskosten so weit senken, dass eine eventuelle<br />
Steigerung der Produktions- und Transaktionskosten überkompensiert wird.<br />
Weiterhin kann es zum Abbau von Fixkostenblöcken (Leerkosten) kommen, die<br />
durch die Notwendigkeit einer hohen Leistungs- und Flexibilitätsbereitschaft als<br />
Reaktionsmöglichkeit auf eine schnelle Anpassung an die Markterfordernisse entstanden<br />
sind. Auch diese Erhöhung der Kapazitätsauslastung bzw. Verringerung von<br />
Leerkapazitäten durch die Reduktion von Unsicherheiten trägt zu einer Zunahme der<br />
Effizienz bei.<br />
Hintergrund der Diskussion ist der in vielen Branchen weit verbreitete Ansatz, einen<br />
so genannten Vorfertigungsgrad oder Entkopplungspunkt zu bestimmen. Im Rahmen<br />
einer solchen Postponement-Strategie werden Komponenten und Teile, die in einem<br />
Großteil der Aufträge benötigt werden, vorgefertigt, um aktuelle Kundenaufträge<br />
dann schneller bedienen zu können. Wie bereits in Abschnitt 4.1.3 diskutiert, entstehen<br />
durch die Entkopplung der Wertschöpfungskette in einen auftragsspezifischen und<br />
einen auftragsneutralen Teil Kostenvorteile, wenn wesentliche Wertschöpfungsstufen<br />
erst dann betrieben werden, sobald ein konkreter Kundenauftrag vorliegt, zugleich<br />
225<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
aber eine schnelle Reaktionsfähigkeit durch die Vorfertigung sichergestellt ist (Lee /<br />
Tang 1997; Rudberg / Wikner 2004; Salvador / Forza 2004; Su / Chang / Ferguson 2005).<br />
Ebenso können trotz individueller Endproduktee Skaleneffekte während der Vorproduktion<br />
der standardisierten Komponenten gesichert werden. Die Verzögerung der<br />
endgültigen Spezifikation kann sich dabei auf Auslegungs-, Zeit- und Ortsaspekte<br />
beziehen. Die Potenziale zur Kostensenkung, die sich aus einer Entkopplung der<br />
Wertschöpfungskette ergeben können, stehen in enger Korrelation zur Wahl der<br />
Wertschöpfungsstufe, auf der die Kunden integriert werden. Eine tiefe Integration der<br />
Kunden bis hinein in die Produktentwicklung (“development-to-order”) erlaubt eine<br />
stärkere Entkopplung der Wertschöpfung.<br />
Wesentliche Voraussetzung jedoch, um die potenziellen Vorteile einer Postponement-<br />
Strategie zu verwirklichen, ist die Fähigkeit des Anbieters, die vorzufertigenden<br />
Komponenten in der richtigen Menge und Spezifität bereitzuhalten. Kostensenkungen<br />
können sich nur dann ergeben, wenn Über- und Unterbestände auf Komponentenebene<br />
vermieden werden. Kundenwissen, das während des Konfigurationsvorgangs<br />
gesammelt wird, stellt ein wesentliches Optimierungspotenzial dar. Das<br />
Ergebnis der Kundeninteraktion im Vertrieb wird nicht nur als Input für den auftragsspezifischen<br />
Produktionsprozess genutzt, sondern stellt auch wesentliche Informationen<br />
bereit, die auftragsneutralen Prozesse marktbezogen auszurichten. Eine weitere<br />
Option der Kundenintegration ist, im Rahmen eines modularen Produktaufbaus<br />
auch Wertschöpfungsaktivitäten aus der Produktion auf den Kunden zu übertragen.<br />
Unter dem Begriff “embedded configuration” wird beispielsweise die Entwicklung<br />
von Komponenten beschrieben, die eine eingebaute Flexibilität besitzen. Die Kunden<br />
können damit gewisse Wertschöpfungsschritte selbst übernehmen, indem sie z. B.<br />
Module zur länderspezifischen Anpassung eines Produktes selbst montieren. Diese<br />
Verlagerung von Anpassungs- oder Konfigurationsschritten auf den Kunden sollte zu<br />
weiteren Kostensenkungspotenzialen beim Hersteller führen.<br />
Reduktion der Akquisekosten durch Steigerung der Kundenbindung: Wechselkosten<br />
Die Interaktion mit den Kunden bietet auch Möglichkeiten zur Steigerung der Kundenloyalität.<br />
Geht man davon aus, dass sich Kundenbindung in steigenden Umsätzen pro<br />
Kunde ausdrückt, benötigen Unternehmen mit hohem Bindungsgrad weniger<br />
Abnehmer als Unternehmen mit geringerer Kundennähe, um ein bestimmtes<br />
Umsatzziel zu erreichen (Stotko 2002). Wird die Zahl der Kunden als “Kostentreiber”<br />
im Sinne der Prozesskostenrechnung interpretiert, kann eine hohe Kundenbindung<br />
neben den Transaktionskosten auch die Marketingkosten senken und Streuverluste eliminieren<br />
(Schnäbele 1997; Vandermerwe 1999, 2000). Ein Kunde kann mehrfach für<br />
verschiedene Produkte “genutzt” werden, ohne dass dabei neue Akquisitionskosten<br />
anfallen. Die damit verbundenen Kostensenkungspotenziale tragen ebenfalls zur<br />
Verwirklichung von Economies of Integration bei.<br />
Ansatzpunkt hierzu ist insbesondere die Leistungskonfiguration eines ersten Auftrags.<br />
Die dabei erlangten Informationen über einen Kunden lassen bei einem Wiederholauftrag<br />
sowohl eine schnellere/einfachere als auch eine inhaltlich verbesserte<br />
Leistungsspezifikation zu. Damit wird eine bedeutende Markteintrittsbarriere gegenü-<br />
226
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
ber neuen Wettbewerbern aufgebaut, die diese Informationen nicht besitzen.<br />
Beispielsweise kann ein Hersteller von Maßkonfektion einem Kunden, der bereits<br />
einen Anzug bestellt hat, dazu passende Hemden anbieten. Der größte Kostenblock in<br />
der Kundenbeziehung, der Interaktionsprozess, reduziert sich bei diesem<br />
Wiederholungskauf stark, da die Maße des Kunden bereits weitgehend aus dem<br />
Erstkauf bekannt sind. So können bei Vorliegen der Maßdaten Wiederholungskäufe<br />
einfach z. B. über das Internet abgewickelt werden. Kombiniert mit dem Wissen, was<br />
der Kunde bereits gekauft hat und wo seine Vorlieben liegen, können dabei auch<br />
Vorschläge für weitere Einkäufe unterbreitet werden.<br />
Eine Folge interaktiver Wertschöpfung und Kundenintegration ist der Aufbau von<br />
Wechselhürden, die dazu beitragen können, die Kundenbindung zu erhöhen. Diese<br />
resultieren primär aus Wechselkosten, Opportunitätskosten und “Sunk-Costs”, die<br />
dem Kunden beim Wechsel einer Lieferantenbeziehung entstehen würden (Jackson<br />
1985; Riemer / Totz 2003, Riemer und Totz 2003) sehen eine generelle Erhöhung dieser<br />
Wechselhürden aus Kundensicht durch das Angebot individualisierter Produkte.<br />
Beispielsweise erhöhen sich die “Direct Costs of Switching”, da ein anderer Anbieter<br />
individueller Produkte schwieriger zu finden ist als ein Anbieter von Normteilen. Die<br />
Opportunitätskosten sind bei der Nachfrage nach individualisierten Produkten daher<br />
hoch, da der Kunde Vorteile aus dem Bezug individualisierter Produkte ziehen kann.<br />
“Sunk Costs” aus Sicht des Abnehmers lassen sich nach Jackson (1985) als “investments<br />
in procedures” beschreiben. Derartige “procedures” sind beispielsweise die<br />
Investitionen des Kunden zur Integration in die Wertschöpfungskette des Anbieters<br />
wie Investitionen in Kommunikationswege (z. B. EDI-Verbindungen), der Aufbau von<br />
Qualifikation beim eigenen Personals zum Umgang mit Produktkonfigurationswerkzeugen<br />
eines bestimmten Anbieters oder die Ausrichtung der eigenen Prozessabläufe<br />
(z. B. im Bereich der Fabrikplanung) auf einen speziellen Anbieter.<br />
Kundenintegration kann somit in Verbindung mit dem Angebot individualisierter<br />
Produkte einen wirkungsvollen Hebel bieten, Wechselkosten für den Kunden aufzubauen.<br />
Einerseits trägt die individualisierte Problemlösungskompetenz dazu bei, dass<br />
der Kunde “freiwillig” dem Anbieter treu bleibt, da ihm die individuelle Lösung höheren<br />
Nutzen stiftet. Andererseits erhöht eine individualisierte Leistung die<br />
Abhängigkeit des Abnehmers, da dieser bereits als Folge seiner Integration in die<br />
Leistungserstellung des Anbieters spezifische Investitionen getätigt hat. Mit der persönliche<br />
Interaktion zwischen Hersteller und jedem einzelnen Kunden, die zur<br />
Leistungskonfiguration zwingend notwendig ist und bei einer massenhaften Fertigung<br />
nicht stattfindet, kann der Grundstein einer langfristigen Kundenbeziehung gelegt<br />
werden. Aufgabe des Herstellers ist es, die während der Interaktion gewonnenen<br />
Informationen folgegeschäfts- und gewinnbringend einzusetzen (Kotha 1995; <strong>Piller</strong><br />
1998, 2001; Pine / Peppers / Rogers 1995; Schnäbele 1997). Ein Käufer vermittelt<br />
(“lehrt”) dem Mass Customizer viele Informationen über sich, sei es explizit durch<br />
Angabe seiner Wünsche oder implizit durch die Möglichkeit für den Anbieter, den<br />
Kundenkontakt auszuwerten. Der Anbieter lernt nicht nur die Vorlieben seiner<br />
Kunden kennen, sondern kann dieses Wissen verwenden, um weiteren Kundennutzen<br />
zu stiften. Peppers und Rogers (1997) sprechen deshalb bei dieser Verbindung aus<br />
Mass Customization und individuellem Beziehungsmarketing von “Learning<br />
227<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Relationships”, die im Zeitablauf wachsen, tiefer und intelligenter werden (siehe auch<br />
Pine / Peppers / Rogers 1995; <strong>Piller</strong> 1998).<br />
Learning Relationships entstehen wie folgt (siehe Abbildung 4–8): Je mehr ein Kunde<br />
dem Hersteller während des Integrationsprozesses über seine Vorlieben, Abneigungen<br />
und Spezifikationswünsche erzählt, desto eher kann bereits beim ersten Kauf ein<br />
Produkt gefertigt werden, das den Wünschen des Kunden entspricht. Speichert der<br />
Hersteller nun diese Kundenwünsche, weiß er auch bei zukünftigen Interaktionen, was<br />
der Kunde wünscht und bevorzugt. Diese Informationen bilden dann eine effiziente<br />
Basis für die schnellere und einfachere Vornahme der Integration (im Rahmen der<br />
Konfiguration). Ergänzt das Unternehmen diese Informationen noch um Wissen über<br />
den Kunden, das während des Produktgebrauchs entsteht, kann das Unternehmen bei<br />
einem Wiederholauftrag auf verfeinertes und verbessertes Wissen über den jeweiligen<br />
Kunden zurückgreifen, was sowohl eine schnellere/einfachere als auch eine inhaltlich<br />
verbesserte Formulierung der Leistungsspezifikation zulässt. Bei jedem zusätzlichen<br />
Kauf wird dieses Wissen weiter verfeinert, es kommt zu einem kontinuierlichen “Fine-<br />
Tuning”. Ebenso erlaubt der Aufbau dieses Wissens beispielsweise, dem Abnehmer<br />
nach Ablauf der durchschnittlichen Verbrauchszeit des Produkts automatisch ein<br />
Angebot zum Nachkauf zukommen zu lassen.<br />
Abbildung 4–8: Aufbau von “Learning Relationships” (entnommen aus <strong>Piller</strong> 2006a in<br />
Anlehnung an Hausruckinger / Wunderlich 1997)<br />
228<br />
Wiederholauftrag<br />
Unternehmen u.<br />
Kunde erarbeiten<br />
Leistungsspezifikation<br />
Verbesserung und<br />
Feintuning der<br />
Leistungsspezifikation<br />
permanente<br />
Optimierung<br />
Speicherung<br />
Kundendaten/<br />
Leistungsspezifikation<br />
Kundenfeedback<br />
Reaktionsdaten<br />
Auftragsausführung
Kosteneffizienz von Individualproduktion<br />
Abbildung 4–9: Qualitativer Vergleich der Wertschöpfungsmodelle in Bezug auf wesentliche<br />
Kostenarten (in Anlehnung an <strong>Reichwald</strong> 2004b)<br />
+<br />
konventionelle<br />
variantenreiche<br />
Serienfertigung<br />
Kostenvorteile<br />
basieren<br />
auf<br />
Economies of Scale<br />
Economies of Scope<br />
-<br />
-<br />
+<br />
-<br />
+<br />
+<br />
+<br />
-<br />
-<br />
Kostenvorteil des Wertschöpfungsmodells<br />
bezogen auf jeweilige Kostenart<br />
Wertschöpfungs-<br />
Kostenart modell<br />
(Fehl-) Entwicklungskosten<br />
Kapitalbindung Maschinen<br />
Material-/ Fertigungskosten<br />
Anlauf- und Änderungskosten<br />
Logistikkosten<br />
Kundeninteraktionskosten<br />
Adaptionskosten<br />
Lagerhaltungskosten<br />
Abschreibungen Endprodukte<br />
Kostenart<br />
PPS-Kosten<br />
(Fehl-) Entwicklungskosten<br />
Kapitalbindung Maschinen<br />
Material-/ Fertigungskosten<br />
Anlauf- und Änderungskosten<br />
Logistikkosten<br />
Kundeninteraktionskosten<br />
Adaptionskosten<br />
Lagerhaltungskosten<br />
Abschreibungen Endprodukte<br />
- Kostennachteil des Wertschöpfungsmodells<br />
Produktindividualisierung<br />
durch Mass Customization<br />
+<br />
+<br />
-<br />
+<br />
-<br />
-<br />
-<br />
+<br />
+<br />
Kostenvorteile<br />
insb. durch<br />
„Economies<br />
of<br />
Integration“<br />
bezogen auf jeweilige Kostenart<br />
Vorteil … Nachteil des Wertschöpfungsmodells bezogen auf jeweilige Kostenart<br />
Wertschöpfungs-<br />
Kostenart modell<br />
(Fehl-) Entwicklungskosten<br />
Kapitalbindung Maschinen<br />
Material-/ Fertigungskosten<br />
Anlauf- und Änderungskosten<br />
Logistikkosten<br />
Kundeninteraktionskosten<br />
Adaptionskosten<br />
Lagerhaltungskosten<br />
Abschreibungen Endprodukte<br />
Variantenreiche<br />
Serienfertigung<br />
Variantenreiche<br />
Serienfertigung<br />
klass. individuelle<br />
Einzelfertigung<br />
klass. individuelle<br />
Einzelfertigung<br />
Individualisierung mit<br />
Mass Customization<br />
Individualisierung mit<br />
Mass Customization<br />
229<br />
4.2
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Learning Relationships steigern den Erlös pro Kunde, da sie über den eigentlichen<br />
Produktnutzen hinaus Kaufentscheidung und -prozess vereinfachen und so den<br />
Kunden bei Wiederholungskäufen wieder das Unternehmen wählen lassen. Sie bilden<br />
einen einschneidenden Schutz gegen neue Konkurrenten. Warum sollte ein Kunde zu<br />
einem Wettbewerber wechseln, selbst wenn dieser ein technisch/funktional gleichwertiges<br />
individuelles Produkt liefern kann, wenn ein anderes Unternehmen bereits all das<br />
weiß, was für die Erbringung der Leistung notwendig ist? Ein neuer Anbieter muss<br />
dieses Wissen erst wieder mühsam erfragen. Ebenso hat aber auch der Kunde nun<br />
Erfahrungen und Lernkurveneffekte zur Abwicklung seiner Integration in die Leistungserstellung<br />
gesammelt.<br />
Gesamtsicht der Kosteneffizienz interaktiver Wertschöpfung<br />
Die bisherige Argumentation zusammenfassend strukturiert Abbildung 4–9 die<br />
kostenbezogenen Effekte und vergleicht dabei prototypisch die Ausprägungen der verschiedenen<br />
Kostenarten, die wir in den vorangehenden Abschnitten angesprochen<br />
haben, bei den drei Wertschöpfungsmodellen klassische variantenreiche Serienfertigung<br />
“auf Verdacht” (Vorproduktion der Güter “made-to-stock”), klassische individuelle<br />
Einzelfertigung sowie Produktindividualisierung nach dem Mass-Customization-Prinzip.<br />
4.3 Markteffizienz von Individualproduktion<br />
Das Wesen der Produktindividualisierung, den Idealpunkt der verschiedenen Kunden<br />
möglichst genau zu treffen, ist die Grundlage zur Verwirklichung ihres Differenzierungsvorteils.<br />
Ziel einer Differenzierungsstrategie ist generell, den Kundennutzen<br />
durch eine überlegende Qualität im weitesten Sinne als wettbewerbsentscheidenes<br />
Merkmal einer angebotenen Leistung herauszustellen (siehe auch Abschnitt 2.4.5). Der<br />
Nutzen bezieht sicht dabei meist nicht auf die Leistung als Ganzes, sondern auf eine<br />
Eigenschaft, die alle Abnehmer als wichtig oder besonders bemerkenswert erachten.<br />
Bei einer erfolgreichen Differenzierung darf kein anderer Wettbewerber (in der<br />
Wahrnehmung der Zielgruppe) diese Eigenschaft besser erfüllen als der Anbieter, der<br />
so den Status eines Quasi-Monopolisten erlangt und damit Preiszuschläge erzielen<br />
kann, die über den Grenzkosten zur Erstellung der Leistung liegen. Gutenberg (1984)<br />
bezeichnet diese Fähigkeit eines Unternehmens, besondere Präferenzen der Abnehmer<br />
für bestimmte Produkte zu schaffen, als “akquisitorisches Potenzial”. Daraus folgt für<br />
den Anbieter ein Preissetzungsspielraum, da er den Preis seiner Leistung über den<br />
Preis eines konkurrierenden Produkts setzen kann, ohne sofort jegliche Nachfrage zu<br />
verlieren. Dieser Preiszuschlag entspricht bei einer Produktindividualisierung aus<br />
Sicht des Kunden dem Nutzenzuwachs im Vergleich zum Kauf und Gebrauch eines<br />
massenhaft hergestellten Gutes. Wenn wir diesen Nutzenzuwachs etwas genauer<br />
betrachten, können wir zwei wesentliche Treiber ausmachen (Ihl et al. 2006; <strong>Piller</strong><br />
2006b): eine Steigerung der wahrgenommenen Produktqualität, aber auch Nutzen<br />
durch den Interaktionsprozess beim Bezug des individuellen Gutes selbst, ausgedrückt<br />
als Prozessqualität.<br />
230
4.3.1 Einfluss auf die Produktqualität<br />
Markteffizienz von Individualproduktion<br />
Eine Produktindividualisierung beeinflusst die wahrgenommene Produktqualität<br />
sowohl in Bezug auf die funktionalen Eigenschaften eines Produkts als auch in<br />
Hinblick auf emotionale Faktoren, die ein Nutzer mit einem Produkt verbindet, z. B.<br />
Neuheitswert, Status oder Originalität. Die Literatur spricht in diesem Zusammenhang<br />
von ergonomischen und hedonistischen Eigenschaften eines Produktes (Hassenzahl<br />
2001). Dabei bezieht sich die ergonomische Qualität auf den Gebrauch eines<br />
Produktes und ist eng an die Aufgabe und die mit dem Produkt verbundenen Ziele<br />
geknüpft. Hier setzt der Kernnutzen einer Individualisierung an, der Nutzenzuwachs<br />
durch die bessere Übereinstimmung der Leistung mit spezifischen Bedürfnissen eines<br />
Kunden (Homburg / Giering / Hentschel 1999). Folge ist aus Sicht der Kunden zunächst<br />
die Reduktion der Unsicherheit im Vergleich zu einem vorgefertigten Gut – wie<br />
zu Beginn dieses Kapitels mit dem Idealpunktmodell erklärt (siehe Abschnitt 4.1).<br />
Auch reduzieren sich die Suchkosten, die bei einer klassischen Variantenproduktion<br />
für den Abnehmer aus der Suche nach der richtigen Lösung aus der Menge aller<br />
Angebote resultieren.<br />
Wie in Abschnitt 4.1 erwähnt, kann die ergonomische Produktqualität bei<br />
Individualisierung an den Maßen des Abnehmers (Passform, z. B. Kleidung nach Maß,<br />
Höhe von Apparaturen, Verpackungsgröße), der Funktionalität des Produkts (z. B.<br />
Dämpfung eines Sportschuhs, Bespannung eines Tennisschlägers, Schnittstellen eines<br />
PC) und an der gustativen bzw. visuellen Wahrnehmung (ästhetisches Design,<br />
Farbwahl, Geschmack) ansetzen (<strong>Piller</strong> / Stotko 2003). Kann ein Abnehmer eine oder<br />
mehrere dieser Eigenschaften genau an seine spezifischen Wünsche anpassen, sollten<br />
die wahrgenommene Produktqualität und so die Produktzufriedenheit entsprechend<br />
steigen. Dieser Effekt ist umso größer, je heterogener sich die Wünsche der Kunden in<br />
Bezug auf die Produkteigenschaften verteilen, d. h. je schwieriger es für einen<br />
Hersteller ist, durch wenige Standardvarianten eines Produktes alle gewünschten<br />
Eigenschaftsbündel des angestrebten Marktsegments abzubilden (Broekhuizen /<br />
Alsem 2002). Wie wir in Abschnitt 2.2.3 gesehen haben, scheint dieser Zustand heute<br />
in vielen Märkten immer mehr Norm als Ausnahme zu sein.<br />
Im Gegensatz zur ergonomischen Qualität betreffen hedonistische Aspekte die nichtaufgabenbezogenen<br />
Eigenschaften eines Produkts (Hassenzahl 2001). Individuelle<br />
Produkte könnten hedonistische Attribute wie den Wunsch nach Einmaligkeit<br />
(Opernballeffekt, d. h. kein anderer Kunde soll die gleiche Ausprägung des Produkts<br />
besitzen; siehe auch Tepper / Bearden / Hunter 2001), nach Abwechslung (“Variety-<br />
Seeking”, Kahn 1995) oder nach dem sozialen Status, der mit einem maßgeschneiderten<br />
Produkt verbunden ist, erfüllen und damit zur Zufriedenheit des Kunden beitragen.<br />
Nach ersten empirischen Studien in diesem Bereich (Blaho 2001; Ihl et al. 2006;<br />
<strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004; Schreier 2004) können hedonistische Eigenschaften bei manchen<br />
Konsumgüterbereichen aus Kundensicht ebenso wichtig wie die ergonomischen<br />
Eigenschaften werden. Beispiele sind Imageeffekte durch individuelle Produkte (Snob-<br />
Effekt) gegenüber Mitbürgern, Befriedigung des Umweltbewusstseins durch passende<br />
Produkte und weniger Verschwendung oder die Verfügbarkeit eines originellen<br />
Geschenkartikels. Diese Ansatzpunkte, die ebenfalls zur Differenzierung eines indivi-<br />
231<br />
4.3
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
duellen Angebots von massenhaften Produkten beitragen, gehen eng mit dem<br />
Nutzenzuwachs einher, der durch den Interaktionsvorgang selbst generiert wird.<br />
4.3.2 Einfluss auf die Prozessqualität<br />
Betrachtet man Co-Design-Prozesse im Kontext von Mass Customization genauer,<br />
dann scheint zusätzlich die Frage interessant, ob ein Co-Design-Prozess vom Kunden<br />
nur als notwendiger Vorgang angesehen wird, um ein individuelles Produkt zu erhalten,<br />
oder ob dieser Prozess auch eine differenzierende positive Wirkung hat, weil z. B.<br />
die Gestaltung des individuellen Produktes besonderen Spaß macht. Dieser Aspekt<br />
knüpft an die Diskussion von “hedonic and utilitarian shopping value” nach Babin,<br />
Darden und Griffin (1994) an. Die Aufwandskomponente von Co-Design wird in der<br />
Literatur oft als ein Faktor für die Grenzen der Produktindividualisierung angeführt<br />
(Huffman / Kahn 1998; Zipkin 2001; Dellaert / Stremersch 2005; <strong>Piller</strong> et al. 2005). Mass-<br />
Customization-Käufe können (heute noch) als High-Involvement-Käufe gesehen werden,<br />
bei denen die Kunden relativ viel Zeit und Aufwand investieren müssen. Die mit<br />
diesen Faktoren verbundenen Kosten können als zusätzliche Transaktionskosten eines<br />
Kunden interpretiert werden, der sich auf eine Leistungsindividualisierung einlässt<br />
(siehe Abschnitt 4.2.1).<br />
Jedoch können Einkaufsprozesse neben diesen Kosten auch eine positive (hedonistische)<br />
Erlebniskomponente beinhalten. Die bereits angesprochene positive Wirkung<br />
eines als qualitativ hochwertig wahrgenommenen Co-Design-Prozesses indiziert<br />
bereits die Bedeutung dieser Komponente. Der Co-Design-Prozess könnte von den<br />
Kunden nicht nur als Mittel zum Zweck (individuelles Produkt) gesehen werden, sondern<br />
selbst einen symbolischen Wert besitzen. Schreier (2004) nennt beispielsweise den<br />
“pride-of-authorship”-Effekt. Für die Kunden könnte die Begeisterung, etwas selbst<br />
geschaffen zu haben, schon allein wertstiftend sein. Hinzu kommt das Gefühl, etwas<br />
Einmaliges oder Einzigartiges geschaffen zu haben. Neben dieser Begeisterung könnten<br />
Mass-Customization-Kunden auch den Abschluss des Co-Design-Prozesses als<br />
Erfüllung eines anspruchsvollen und kreativen Schaffensakts ansehen, der schon allein<br />
Nutzen stiftet (Lakhani / Wolf 2005). Diese Faktoren bilden den hedonistischen Wert<br />
der Prozessqualität. Die Berücksichtigung von sowohl aufwandsbezogenen als auch<br />
hedonistischen Eindrücken ist eine wichtige Basis für die Gestaltung der<br />
Interaktionsprozesse für ein Mass-Customization-Angebot (siehe Abschnitt 4.4).<br />
4.3.3 Preispolitische Potenziale<br />
Die Gesamtheit des so wahrgenommenen Nutzens macht die Einmaligkeit von Mass-<br />
Customization aus. In der Theorie kann ein Hersteller, der sich diesen<br />
Handlungsspielraum sichert, ungeachtet eines geltenden Marktpreises den Preis für<br />
sein Produkt weitgehend autonom festlegen, und zwar ausgerichtet am jeweiligen<br />
Nutzen eines Produkts für einen Abnehmer. Grundlegend hat Chamberlin (1962; erste<br />
Auflage 1933) die Wettbewerbswirkungen der Differenzierung untersucht. In seiner<br />
232
Markteffizienz von Individualproduktion<br />
“theory of monopolistic competition” hebt er die Prämisse homogener Güter auf,<br />
womit zwangsläufig Präferenzen auf Seiten der Nachfrager für einzelne Anbieter entstehen.<br />
Damit ist es einem Anbieter möglich, in gewissen Grenzen eine Monopolstellung<br />
zu erlangen, indem er sein Angebot von den Wettbewerbern abhebt (<strong>Frank</strong>e /<br />
<strong>Piller</strong> 2004 weisen diesen Effekt in einer empirischen Studie nach).<br />
Idealvorstellung ist dabei die bereits von Pigou (1920) als “Preisdifferenzierung ersten<br />
Grades” bezeichnete Festlegung eines individuellen Preises für jeden Abnehmer in<br />
dem Maße, dass die gesamte Konsumentenrente dieses Kunden abgeschöpft wird<br />
(unter der Annahme, dass dabei mindestens die variablen Kosten des Unternehmens<br />
erfüllt sind). Die Konsumentenrente entspricht dem Differenzbetrag zwischen der<br />
Zahlungsbereitschaft eines Abnehmers und dem Preis, den dieser für das Produkt<br />
bezahlt. Ziel ist es damit, genau die Zahlungsbereitschaft eines Kunden abzugreifen.<br />
Diese Option wird oft als unrealistisch und “unfair” eingestuft. Wenn eine<br />
Preisdifferenzierung sich aber nicht auf gleiche, sondern unterschiedliche, individuelle<br />
Produkte bezieht, sieht die Situation schon anders aus. Eine Individualisierung der<br />
Preise kann dann eine Individualisierung der Produkte begleiten (Skiera 2003).<br />
Jedoch ist die Wirklichkeit nicht ganz so einfach: Der Kundennutzen ist zwar ein<br />
Indikator für den maximal möglichen Preis – spiegelt aber nicht den optimalen<br />
Absatzpreis wider. Zwar sinkt mit der Individualisierung innerhalb gewisser Grenzen<br />
die Preiselastizität der Nachfrage, aber in der Praxis ist der Preisspielraum oft gering.<br />
Es besteht eine Obergrenze, ab der die potenziellen Abnehmer nicht mehr bereit sind,<br />
den aus der Attraktivität der Leistung resultierenden Mehrpreis zu honorieren, und<br />
auf billigere Konkurrenzprodukte ausweichen, auch wenn diese ihren Anforderungen<br />
nicht genau entsprechen (der Fall entspricht der “doppelt geknickten Preis-Absatz-<br />
Funktion” von Gutenberg 1984: 245-251). Zudem müsste ein Anbieter, der den<br />
Preisspielraum einer individuellen Leistungserstellung entsprechend der Theorie ausnutzen<br />
möchte, nicht nur die Wünsche jedes Kunden erheben und in individuelle<br />
Produkte umsetzen, sondern darüber hinaus den Wert der Individualisierung<br />
(Nutzenzuwachs beim Kunden durch individuelle Leistung) messen können – was die<br />
Kenntnis der Preissensibilität aller Kunden voraussetzt (Mayer 1993). Eine Ausnahme<br />
bieten Informationsgüter und viele “rein virtuellen Produkte” im Internet, wo tatsächlich<br />
eine echte Preisdiskriminierung möglich erscheint (siehe z. B. Smith / Bailey /<br />
Brynjolfsson 2000; Skiera 1998; Skiera / Spann 2000).<br />
Deshalb wird in der Praxis bei einer Leistungsindividualisierung meist kein individueller<br />
Preis pro Abnehmer bestimmt, sondern entweder ein einheitlicher Preis gefordert<br />
oder aber das Entgelt anhand eines klar strukturierten und durchschaubaren<br />
Preisbaukastens an die gelieferte Leistung angepasst. Bei dieser Individualisierung<br />
der Entgeltgestaltung ist der Kunde selbst und bewusst für die Preisbestimmung “verantwortlich”.<br />
Voraussetzung ist, dass es sich um modular aufgebaute Produkte und<br />
Leistungen handelt, deren Module einzelne, verschieden aufwändige (bzw. verschieden<br />
bewertete) Optionen aufweisen, die zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden:<br />
Leder- oder Stoffverkleidung, vergoldete oder Messingstecker, Markenkomponente<br />
oder “No-Name”-Bauteil. Auch kann ein Kunde vor die Wahl gestellt<br />
werden, ob er gegen Preisnachlass bestimmte Serviceleistungen selbst übernehmen<br />
233<br />
4.3
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
will: Bestellung per Internet oder persönliche Beratung durch Verkaufspersonal;<br />
Selbstaufbau oder Installation vor Ort. Computerhersteller nutzen diese Flexibilität<br />
teilweise hervorragend, um in der Werbung relativ günstige Einstiegspreise angeben<br />
zu können, um die damit angezogenen Kunden dann während des Konfigurationsvorganges<br />
zu hochwertigeren Komponenten und Up-grades zu “überreden”.<br />
Wichtig ist abschließend aber noch einmal zu betonen, dass Produktindividualisierung<br />
durch Mass Customization von “vertretbaren” Preisaufschlägen ausgeht, die keinen<br />
Wechsel des Marktsegments im Vergleich zu den Käufern massenhaft hergestellter<br />
Güter zur Folge haben. Ebenfalls glauben wir nicht, dass in mittel- bis langfristiger<br />
Sicht Nachfrager dafür bereit sind, hohe Aufschläge allein für den Zuwachs an hedonistischer<br />
Produkt- und Prozessqualität zu zahlen. Im Vordergrund steht langfristig<br />
der Nutzenzuwachs durch besser an die individuellen Präferenzen angepasste<br />
Produkte. Interaktive Wertschöpfungsmodelle auf Basis einer Produktindividualisierung<br />
gehen hier einher mit den Erkenntnissen aus dem Bereich der<br />
Kundeninnovation: Auch hier ist das wesentliche Motiv für Nutzer, im Rahmen von<br />
Innovationsprozessen selbst aktiv zu werden, der Wunsch nach neuen Produkten, die<br />
besser als die vorhandenen die spezifischen (neuen) Bedürfnisse eines Nutzers befriedigen<br />
(siehe Abschnitt 3.3.2).<br />
4.3.4 Zusammenfassende Betrachtung der Effizienzwirkung<br />
interaktiver Wertschöpfung durch<br />
Produktindividualisierung<br />
Kasten 4–5: Loewe Individual-Fernseher als Alternative für eine Produktion am Standort<br />
Deutschland<br />
(Quelle: Auszug aus dem Bericht “Der Individual-Fernseher soll’s richten “ von Gerhard Hegmann<br />
in der Financial Times Deutschland vom 22. Aug. 2005)<br />
Der Unterhaltungselektronikhersteller Loewe will sich künftig noch stärker auf das Luxusgeschäft<br />
konzentrieren. Das Unternehmen stellt auf der Funkausstellung in Berlin (IFA) Anfang September<br />
2005 erstmals die neue Fernsehgerätereihe “Loewe Individual” vor, ein Flachbildgerät des<br />
Unterhaltungselektronikherstellers Loewe. Damit läutet Loewe das Ende des fertigen Fernsehers<br />
aus dem Regal ein. Um seinen Anspruch als Hochpreisanbieter zu rechtfertigen, kann der Kunde<br />
künftig bei einigen Flachbildgeräten die Farbe, das Aussehen, die Materialien, Aufstellvarianten<br />
sowie die Technikausstattung selbst bestimmen. Loewe-Vorstandschef Rainer Hecker spricht von<br />
einer Strategie der “größtmöglichen Individualisierung”. Loewe bietet ähnlich wie der dänische<br />
Wettbewerber Bang / Olufsen schon seit Jahren die Möglichkeit, für TV-Geräte oder Lautsprecher<br />
verschiedene Farben und Aufstellvarianten auszusuchen. Der deutsche Hersteller geht in dieser<br />
Strategie jetzt noch weiter und schließt technische Varianten mit ein. Allein bei den Farben und<br />
Blenden gibt es mehr als 400 Kombinationsmöglichkeiten.<br />
Loewe hofft, mit maßgeschneiderten Angeboten auch höhere Marktpreise als die Massenanbieter<br />
durchsetzen zu können. Wie drastisch der Preisverfall im TV-Markt ist, zeigt allein das erste<br />
234
Markteffizienz von Individualproduktion<br />
Halbjahr. Großformatige LCD-TV-Geräte waren um rund 40 Prozent billiger als vor einem Jahr.<br />
Finanzvorstand Burkhard Bamberger ist zuversichtlich, dass die Rechnung bei der Individual-Linie<br />
trotz der komplexen Lagerhaltung und Einzelfertigung aufgeht. “Ich erwarte höhere Margen als bei<br />
den Standardprodukten”, sagte er jüngst zu Analysten. Über die genauen Absatzplanungen machte<br />
Loewe allerdings keine Angaben. Zunächst kommen im Herbst europaweit über den<br />
Fachhandel zwei Modelle mit 66 und 80 Zentimeter Bilddiagonale auf den Markt. Die Preisspanne<br />
reicht von etwa 2000 bis 4000 Euro. Die individuellen Geräte sollen spätestens binnen 14 Tagen<br />
geliefert werden. Diese Lieferzeiten seien mit einer Fernostproduktion nicht machbar, heißt es. Die<br />
Individualisierung werde auf weitere Produktlinien ausgebaut.<br />
Das Beispiel von Loewe in Kasten 4–5 liefert einen guten Anhaltspunkt zur<br />
Zusammenfassung der bisherigen Argumentation. Wir haben gesehen, dass Mass<br />
Customization eine Position anstrebt, in der eine Differenzierung durch<br />
Individualisierung zu einer Kostenposition möglich ist, die der Effizienz einer<br />
Massenproduktion entspricht. Auf der anderen Seite führt Mass Customization aber<br />
auch zu zusätzlichen Kosten, die gegen diese Potenziale abgewogen werden müssen.<br />
Abbildung 4–10 gibt einen schematischen Überblick darüber, wo zusätzliche Kosten<br />
zur Implementierung einer Mass Customization-Strategie anfallen und welcher<br />
zusätzliche Nutzen daraus zu erwarten ist.<br />
Abbildung 4–10: Kosten und Nutzen einer Mass-Customization-Strategie aus Sicht des<br />
Anbieters<br />
Ertragspotenziale durch:<br />
• Steigende<br />
Zahlungsbereitschaft<br />
• Erhöhte Kundenzufriedenheit<br />
und Loyalität<br />
• Wiederholungskäufe<br />
• Flexibilität bei<br />
Marktänderungen<br />
• Kostensenkungspotenziale<br />
(“Economies of Integration”)<br />
Mehrkosten durch:<br />
• Investitionen in flexible<br />
Leistungssysteme<br />
• Koordinationsaufwand in<br />
Produktion und Logistik<br />
• Kosten der Produktadaption<br />
• Kosten der Kundeninteraktion<br />
• Aufbau von Vertrauen,<br />
Risikoabbau aus Kundensicht<br />
Auf der Kostenseite ist insbesondere der hohe Aufwand der Kundeninteraktion zu<br />
nennen. Diese zusätzlichen Kosten beruhen auf dem Interaktionsaufwand zur<br />
235<br />
4.3
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Erhebung und Spezifikation der individuellen Kundenpräferenzen. Zusätzlich sind<br />
erhöhte Kosten für vertrauensbildende Maßnahmen zu veranschlagen, die sich beispielsweise<br />
in einem erweiterten Rückgaberecht niederschlagen können. Aber auch die<br />
Transformation der gewonnenen Kundeninformation in eine konkrete Fertigungsinformation<br />
verursacht Kosten, die in diesem Maße bei Massenfertigern nicht zu<br />
erwarten sind. Viele Kunden sind nicht in der Lage sind, ihre Wünsche so zu artikulieren,<br />
dass ein Mass Customizer daraus bereits eine Produktkonfiguration ableiten kann.<br />
Dieses Dilemma, mehr Kundennähe zu bieten als Kunden in der Lage sind zu bewältigen,<br />
führt zu hohen Komplexitätskosten. Diese begründen sich in aufwändigen<br />
Systemen zur Kundeninteraktion und Kosten zur Qualifikation der Mitarbeiter, insbesondere<br />
der Vertriebsmitarbeiter.<br />
Auf der anderen Seite fallen Komplexitätskosten im Bereich der Fertigung an, in der<br />
die individuellen Produkte umgesetzt werden. Der Komplexität in der Fertigung geht<br />
eine erhöhte Komplexität in der Produktentwicklung voraus, in der eine<br />
Produktarchitektur gestaltet wird, die eine Individualisierung bei minimaler produktinhärenter<br />
Komplexität erlaubt. Eine solche Produktarchitektur ist beispielsweise ein<br />
modularer Produktaufbau. Schließlich sind die Logistik- und Distributionskosten bei<br />
einer Individualproduktion in der Regel deutlich höher als bei einem Vertrieb standardisierter<br />
Waren über ein Ladengeschäft. Für jedes einzelne Produkt fällt ein individueller<br />
Transportvorgang an. Wie das Beispiel Loewe zeigt, überwiegen hierbei die<br />
Transportkosten und -zeiten dem Produktionskostenvorteil einer Fertigung in Asien,<br />
so dass es – aus volkswirtschaftlicher Sicht – wieder zu einer Rückverlagerung der<br />
Produktion nahe zu den Kundenmärkten kommen könnte.<br />
Diesen Kosten, die mit der Einführung von Mass Customization anfallen, steht eine<br />
Reihe von Vorteilen gegenüber. Ein Vorteil ist beispielsweise, dass sich ein Mass<br />
Customizer durch die geringe Vergleichbarkeit individueller Produkte in einer Quasi-<br />
Monopolstellung befindet. Dadurch kann er Preiszuschläge erzielen, die über den<br />
Grenzkosten zur Erstellung liegen. Zu diesen Vorteilen auf der Erlösseite (Steigerung<br />
der Absatzeffizienz) kommen weitere hinzu, die sich insbesondere in einer verbesserten<br />
Planungssituation auf einer Informationsbasis begründen, die durch eine enge<br />
Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess geprägt ist. Diese<br />
Kostensenkungspotenziale wurden als Economies of Integration bezeichnet. Durch<br />
die Kenntnis der individuellen Präferenzen einzelner Kunden kann sowohl die allgemeine<br />
Planungssituation als auch die Zielgenauigkeit der Marktbearbeitung verbessert<br />
werden. Gegenüber der Massenfertigung und des begleitenden Massenmarketings<br />
können so die Streuverluste minimiert werden, indem Mittel zur<br />
Kundenakquise und –bindung gezielt dort eingesetzt werden, wo sich das größte<br />
wirtschaftliche Potenzial ergibt. Weiterhin bestehen neue Möglichkeiten zur<br />
Steigerung der Kundenbindung, die eine effizientere Abwicklung weiterer<br />
Interaktionen zwischen einem Anbieter und seinen gebundenen Kunden erlauben.<br />
Auch bestehen hier Erlössteigerungspotenziale, wenn beispielsweise weitere<br />
Produkte oder Dienstleistungen (Cross-selling) an den Kunden oder Produkte mit<br />
einem höheren Deckungsbeitrag (Up-selling) abgesetzt werden können. Ziel ist es, die<br />
zunächst anfallenden höheren Interaktionskosten im Laufe der Kundenbeziehung zu<br />
amortisieren.<br />
236
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Kasten 4–6: Literaturempfehlungen zur Markt- und Kosteneffizienz von Mass<br />
Customization<br />
Baldwin, Carliss / Clark, Kim (1997). Managing in the age of modularity. Harvard Business<br />
Review, 75 (1997) 5: 84-93<br />
Pine, B. Joseph II / Peppers, Don / Rogers, Martha (1995). Do you want to keep your customers<br />
forever? Harvard Business Review, 73 (1995) 2: 103-114<br />
Salvador, Fabrizio / Rungtusanatham, M. Johnney / Forza, Cipriano (2004). Supply-chain configurations<br />
for mass customization. Production Planning & Control, 15 (2004) 4: 380-402<br />
Tseng, Mitchell / Jiao, Jianxin (2001). Mass Customization. In: Gaviel Salvendy (ed.): Handbook<br />
of Industrial Engineering, 3rd edition, New York: Wiley 2001: 684-709<br />
4.4 Phasen und Instrumente der<br />
Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Im vorangehenden Abschnitt haben wir diskutiert, welche Effizienzvorteile eine<br />
Produktindividualisierung durch Mass Customization ermöglichen kann. Zur<br />
Erlangung dieser Vorteile ist allerdings aus Sicht beider Marktparteien ein<br />
Interaktionsakt notwendig, der in diesem Ausmaß bei einer Massenproduktion nicht<br />
anfällt: der Co-Design-Vorgang zur Gestaltung der kundenindividuellen Lösung, der<br />
das Prinzip der Kundenintegration bei Mass Customization konkretisiert. Im<br />
Folgenden betrachten wir deshalb, welche Ansprüche Co-Design an die Kunden stellt<br />
und welche Probleme dabei zu überwinden sind. Aufbauend auf diese Argumentation<br />
betrachten wir, wie ein entsprechendes System zur Kundeninteraktion bei Mass<br />
Customization gestaltet werden kann. Ziel ist es, den Abnehmern ein entsprechendes<br />
Interaktionssystem an die Hand zu geben, um den Co-Design-Vorgang zu vollziehen.<br />
Wir haben bereits in Kapitel 3 eine ähnliche Argumentation in Bezug auf die<br />
Entwicklung von Open-Innovation-Toolkits gesehen. Auch hier geht um weit mehr als<br />
um ein bloßes technisches Tool. Ziel ist die um die proaktive Gestaltung der gesamten<br />
Interaktionsbeziehungen. Die folgende Argumentation konkretisiert die Ausführungen<br />
in Abschnitt 3.5.2 über die Gestaltung von Toolkits für Open Innovation.<br />
Auf die ebenfalls wichtigen Punkte des Aufbau des Produktions- und Logistiksystems<br />
für Mass Customization wollen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen<br />
(siehe dazu weiterführend Anderson 1997, 2003; Brown / Bessant 2003; Höck 1998;<br />
Kolisch 2001; Lopitzsch / Wiendahl 2003; MacCarthy / Brabazon / Bramham 2003; <strong>Piller</strong><br />
1998, 2006a; Reinhart / Schönung / Wagner 2003; Salvador / Rungtusanatham / Forza<br />
2004; Su / Chang / Ferguson 2005). Wichtig ist an dieser Stelle aber noch einmal zu betonen,<br />
dass der im Folgenden beschriebene Interaktionsvorgang nicht vollstänig die idealtypischen<br />
Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung umsetzt, wie wir sie in<br />
Abschnitt 2.4 kennengelernt haben (insbesondere des Modell der “Commons-based<br />
Peer-Production” ist bei Mass Customization in der Regel nicht umgesetzt). Dennoch<br />
kann die Analyse der Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager bei Mass<br />
237<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Customziation wichtige Anhaltspunkte für eine proaktive Gestaltung interaktiver<br />
Wertschöpfungsprozesse in anderen Bereichen (Innovation) geben.<br />
4.4.1 Übersicht und Phasenmodell<br />
Aufbauend auf den Grundlagen der Integration und Interaktion werden in diesem<br />
Kapitel die Anforderungen an eine erfolgreiche Interaktion bei Mass Customization<br />
diskutiert. Diese besteht aus einer Reihe von Phasen, die über die eigentliche<br />
Konfiguration hinausgehen. Eine mögliche Strukturierung dieser Phasen findet sich<br />
bei Blaho (2001) in Anlehnung an die Konsumentenverhaltensforschung. Blaho orientiert<br />
sich an den klassischen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses, Vorkauf-, Kaufund<br />
Nachkaufphase, und beschreibt die für Mass Customization geltenden<br />
Besonderheiten in diesen Phasen. Mass Customization-Kaufentscheidungsprozesse<br />
sind in allen drei Phasen durch eine größere Unsicherheit auf Konsumentenseite<br />
gekennzeichnet. Bereits in der Vorkaufphase herrscht aufgrund der Tatsache, dass nur<br />
ein Leistungspotenzial und kein fertiges Produkt angeboten werden kann, größere<br />
Unsicherheit beim Kunden. Besonders im Konsumgütergeschäft haben die meisten<br />
Kunden noch keine Erfahrung mit dem Kauf individualisierter Güter. In der<br />
Kaufphase ist der Kunde sehr intensiv in die Leistungserstellung integriert und wirkt<br />
mit an der Konfiguration seines individuellen Produktes. Auch hier entsteht möglicherweise<br />
Unsicherheit, wenn der Kunde durch die Vielzahl an Optionen und<br />
Informationen überfordert wird. Kennzeichnend für die Nachkaufphase ist die<br />
Tatsache, dass der Kunde auf sein Produkt zunächst noch warten muss, d. h. er hat die<br />
Kaufentscheidung zwar getroffen, ihm fehlt jedoch noch das Objekt dieser<br />
Entscheidung. Auch diese Situation führt wiederum zu Unsicherheit (Blaho 2001).<br />
Aufbauend auf dieser grundsätzlichen Gliederung wollen wir im Folgenden ein<br />
erweitertes Interaktionsmodell für Mass Customization vorstellen, das als Ergebnis<br />
eigener empirischer Arbeiten entstanden ist (Ihl et al. 2006; <strong>Reichwald</strong> / Müller / <strong>Piller</strong><br />
2005). Es betrachtet den Mass-Customization-Prozess aus Kundensicht. Die<br />
Beobachtung und Befragung von Kunden von individualisierbaren Produkten hat<br />
gezeigt, dass sich der Verkaufsprozess für Mass Customization in sechs Phasen gliedern<br />
kann, die zwar ineinander übergehen, jedoch durch spezifische Aufgaben<br />
gekennzeichnet sind (Abbildung 4–11).<br />
Die erste Phase, in der eine Interaktion von Käufer und Verkäufer stattfinden kann, ist<br />
die Phase der Kommunikation, deren primäres Ziel es ist, die Aufmerksamkeit neuer,<br />
potenzieller Kunden für das Konzept zu gewinnen. Erste grundlegende Informationen<br />
sind gegebenenfalls nötig, die den Kunden an das Konzept und seine Rolle heranführen.<br />
Es folgt die Phase des Exploring, in der sich der Kunde mit den Möglichkeiten, die der<br />
Anbieter offeriert, auseinandersetzt und, in der er vertiefende Informationen erhält.<br />
Die Exploring-Phase geht häufig fließend in die Konfigurationsphase über. Diese steht<br />
im Mittelpunkt jedes Mass Customization-Angebots und dient der Spezifierung der<br />
individuellen Kundenlösung.<br />
238
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Erst nach der Konfiguration findet die Produktion der Kundenlösung statt, weshalb<br />
sich für den Kunden eine Wartezeit bis zur Lieferung oder Abholung seines individuellen<br />
Produktes ergibt.<br />
In der After-Sales-Phase geht es darum, die gesammelten Kundeninformation durch<br />
zusätzliche Informationen über den Kunden zu ergänzen und für eine weiterführende<br />
Kundenbetreuung zu nutzen.<br />
Der Wiederholungskauf soll für den Kunden so einfach wie möglich sein, wobei<br />
wiederum auf bereits gespeicherte Kundendaten zurückgegriffen werden sollte.<br />
Abbildung 4–11: Phasen der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Kommunikation Exploring Konfiguration<br />
Erwecken von<br />
Aufmerksamkeit<br />
beim<br />
Kunden,<br />
Herstellen des<br />
Erstkontakts<br />
Information über<br />
Möglichkeiten<br />
und Optionen<br />
des Mass-<br />
Customization-<br />
Systems<br />
Unterstützung<br />
des Kunden bei<br />
der<br />
Konkretisierung<br />
des individuellen<br />
Produkts<br />
Wartezeit<br />
und<br />
Lieferung<br />
Betreuung des<br />
Kunden während<br />
der Wartezeit<br />
und<br />
Abholung/Liefer<br />
ung der Ware<br />
After-Sales<br />
und<br />
Feedback<br />
Sammlung von<br />
Kunden-<br />
Feedback,<br />
Information über<br />
Service-<br />
Leistungen<br />
Feedback-Loop: Verwendung vorhandenen Wissens<br />
Wiederkauf<br />
Initiierung von<br />
Folgekäufen<br />
unter und<br />
Nutzung der<br />
vorhandenen<br />
Kundendaten<br />
Das Modell gilt sowohl für Online- als auch Offline-(d. h. Ladenbasierte) Interaktionsprozesse<br />
und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass der Interaktionsprozess bei<br />
Mass Customization sowohl im Internet als auch in einem Laden oder als Kombination<br />
beider Kanäle erfolgen kann. Aufgrund der unterschiedlichen Bedarfssituationen und<br />
Präferenzen von Kunden scheint es für viele Anbieter sinnvoll zu sein, sich nicht ausschließlich<br />
auf das virtuelle Angebot zu konzentrieren, sondern Kunden die Wahl zwischen<br />
verschiedenen Kanälen zu bieten. Während Kunden beispielsweise den<br />
Konfigurationsvorgang offline mit ausgebildetem Fachpersonal durchlaufen können,<br />
müssen sie sich bei der Online-Konfiguration intensiver mit dem Konfigurator beschäftigen<br />
und diesen allein bedienen (Schnäbele 1997). Die einzelnen Phasen dieses<br />
Modells werden im Folgenden näher beschrieben werden (in Anlehnung an <strong>Reichwald</strong> /<br />
Müller / <strong>Piller</strong> 2005). Kasten 4–7 bietet ein einführendes Beispiel und kann als<br />
Anschauungsobjekt beim Lesen der folgenden Abschnitte dienen.<br />
Kasten 4–7: Kundenintegration in das Produktdesign am Beispiel des Internet-Toolkits<br />
von Factory 121<br />
Hinweis: Wir empfehlen, das Beispiel von Factory 121 parallel zum Lesen dieses Kapitels im<br />
Internet anzuschauen [www.factory121.com] und dabei darauf zu achten, wie die in diesem Kapitel<br />
beschrieben Phasen bei diesem Anbieter umgesetzt sind. Ein ebenso sehr aufschlussreicher<br />
Selbstversuch ist es, zuvor in einem konventionellen Uhrenladen den Auswahlprozess für eine<br />
239<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Armbanduhr zu durchlaufen (versuchen Sie, ohne größere Betonung eines bestimmten<br />
Markennames aus dem Geamtangebot die Uhr zu finden, die Ihrem persöhnlichen Geschmack am<br />
besten trifft). Wiederholen Sie dann den gleichen Prozess im Konfigurator bei Factory 121.<br />
Factory121 ist ein Internet-Anbieter aus der Schweiz, der die Individualisierung hochwertiger<br />
“swiss made” Herren- und Damenuhren anbietet. Die Individualisierung setzt dabei ausschließlich<br />
an ästhetischen Gesichtspunkten an, an die die Kunden hohe Ansprüche stellen (www.factory121.com).<br />
Durch umfangreiche Individualisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten bietet<br />
Factory121 einen sehr großen Lösungsraum. Auf der Internetseite haben die Kunden zu Beginn<br />
des Interaktionsprozesses die Wahl zwischen 82 Uhrenmodellen. Ausgewählt werden kann aus<br />
einer Palette von klassischen, sportlichen, eleganten und luxuriösen Damen- und Herren-Modellen<br />
– auf Wunsch mit erstklassigen Diamanten und Saphiren besetzt. Durch diese Vorauswahl<br />
(Vorkonfiguration) von Lösungen soll die Komplexität aus Kundensicht gesenkt werden. Mit Hilfe<br />
einer benutzerfreundlichen Konfiguration wählt der Kunde das Gehäuse, das Zifferblattdesign, das<br />
Uhrenband und die jeweiligen Farben aus, die seinem Stil entsprechen. Der schnelle Bildaufbau<br />
regt zum Spiel mit Formen, Farben und Materialien an. Alle Optionen können jederzeit geändert<br />
und verglichen werden. Dies wird in Echtzeit und mit guter 3-D-Bildqualität ausgeführt, welches<br />
den Umstand entschädigt, das Produkt nicht anfassen zu können. Die Visualisierung als wesentliches<br />
Designelement eines Toolkits ist hier gut umgesetzt.<br />
Abbildung: Element des Co-Design Toolkits von Factory121.com<br />
Des Weiteren bietet Factory121 den Kunden die Garantie, dass sie die Uhr im Falle von<br />
Problemen 10 Tage nach der Auslieferung ohne Fragen zu stellen, austauscht oder zurücknimmt,<br />
240
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
sowie eine zweijährige Garantie auf allen Modellen. Wie groß die Zufriedenheit der bisherigen<br />
Kunden ist, belegt eine unabhängige Studie eindrücklich: Über 95 % aller in einer Zufriedenheitsstudie<br />
des Unternehmens befragte Kunden würden wieder eine 121TIME-Uhr bestellen. 93 %<br />
bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis als gut bis sehr gut (eine Uhr kostet zwischen ca. 130 und<br />
600 Euro, je nach Ausstattungsoption und Uhrwerk). Auch kommt es im Verhältnis zu den gekauften<br />
Uhren sehr selten vor, dass eine Uhr zurückgesandt wird. (ca. 1-2 %). Es kommt aber öfter vor,<br />
dass wir Änderungen an der Uhr vornehmen müssen oder die Uhr ganz ausgetauscht wird.<br />
Meistens sind es ästhetische Gründe, dass man sich die Uhr anders vorgestellt hat oder die<br />
gewählte Kombination nicht gefällt.<br />
Nach der Bestellung erfolgt die Montage der Uhr nach Bestellung in einer kleinen Fabrik in der<br />
Schweiz. Der Konfigurator bereitet dabei die Bestellung vor und sendet sie direkt an die<br />
Montagewerkstatt. Nach einer Überprüfung (Kreditcheck) wird der Auftrag zur Fertigung freigegeben.<br />
Die Fertigungsdokumente (Fertigungsauftrag, Proforma-Rechnung, Garantiekarte, Versandscheine)<br />
werden im Lager automatisch ausgedruckt. Die Uhrenkomponenten werden anhand des<br />
Fertigungsauftrages zusammengestellt und zur Fertigung freigegeben. Optionale Elemente wie<br />
z. B. die Gravur auf dem Uhrenboden werden vom Lieferanten innerhalb von 5 Tagen angeliefert<br />
und in den Auftrag integriert. Die Uhr wird auf Ihre Wasserdichtigkeit und Ganggenauigkeit geprüft<br />
und nach erfolgter Endkontrolle zum Versand freigegeben. Der Kunde erhält die Uhr nach höchstens<br />
10 Tagen.<br />
4.4.2 Kommunikationsphase<br />
Was nützen die besten kundenindividuellen Produkte, wenn sie niemand kennt? Die<br />
Differenzierungsvorteile von Mass Customization können den Kunden erst dann<br />
Nutzen stiften, wenn diese auf das Angebot aufmerksam werden. Aufgabe der<br />
Kommunikationsphase ist es deshalb, die potenziellen Kunden über das Angebot kundenindividueller<br />
Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Kommunikationspolitik<br />
umfasst generell alle auf den Markt gerichteten Informationen eines<br />
Unternehmens zum Zweck der Beeinflussung von Meinungen, Einstellungen,<br />
Erwartungen und Verhaltensweisen der Abnehmer im Sinne des Anbieters.<br />
Grundlegend gelten für Mass Customizer damit zunächst dieselben Aspekte wie für<br />
die Anbieter standardisierter Leistungen.<br />
Inhaltlich unterscheiden sich die Maßnahmen zur Verkaufsförderung von kundenindividuellen<br />
Produkten im Vergleich zu Standardprodukten jedoch durch zwei Aspekte:<br />
die Komplexität der Produkte und die besondere Rolle, die der Kunde im Mass-<br />
Customization-Prozess durch seine Integration in die Wertschöpfung spielt. Zusätzlich<br />
besteht – wie bei Dienstleistungen – die Herausforderung, dass zu Beginn des<br />
Leistungserstellungsprozesses kein fertiges Produkt existiert, das dem Kunden in der<br />
Kommunikation gezeigt werden kann. Vorhanden ist nur ein Leistungspotenzial, d. h.<br />
die Fähigkeit und Bereitschaft des Anbieters, die Leistung zusammen mit dem<br />
Abnehmer zu erstellen. Damit ist es für den Kunden schwierig, die Qualität der<br />
Leistung zu bestimmen, was zu einem großen wahrgenommenen Risiko auf der Seite<br />
des Kunden führen kann. Hinzu kommt, dass Kunden derzeit oft noch keine<br />
Erfahrung mit der Gestaltung von individuellen Produkten an sich haben, was ihre<br />
Unsicherheit noch erhöht.<br />
241<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Grundsätzlich spielen Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften von Gütern<br />
eine Rolle bei der Leistungsbeurteilung durch die Kunden (Homburg / Krohmer 2003;<br />
Picot, <strong>Reichwald</strong> / Wigand 2003). Sucheigenschaften, d. h. Eigenschaften von<br />
Leistungen, die vor dem Kauf einfach betrachtet und beurteilt werden können (z. B.<br />
die Eigenschaften eines bereits produzierten Standardschuhs), treten bei Mass<br />
Customization in den Hintergrund. Vertrauenseigenschaften können erst nach dem<br />
Kauf bzw. während des Kaufs durch Ge- und Verbrauch beurteilt werden (z. B. die<br />
Eigenschaften eines individuellen Schuhs, den der Kunde nach dem Kauf nutzt und<br />
anprobiert und erst dann beurteilen kann). Bei Vertrauenseigenschaften ist keine vollständige<br />
Beurteilung möglich – weder vor noch nach dem Kauf des Gutes. Wie wir in<br />
Abschnitt 4.2.1 gesehen haben, bedeuten Mass-Customization-Angebote für Kunden<br />
oft eine bestimmte Unsicherheit. Diese ist durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen<br />
abzubauen. Beispielsweise kann es Sinn machen, detaillierte Informationen<br />
über das Produkt und die Nachfragerrolle zu kommunizieren.<br />
Erfahrungseigenschaften spielen bei Mass-Customization-Gütern ebenfalls eine wichtige<br />
Rolle und sind Grundlage der besonderen Möglichkeiten eines Kundenbindungsmanagement,<br />
das wir in Abschnitt 4.2.2 bereits angesprochen haben. Es lässt sich<br />
nämlich zeigen, dass die Informationen, die im Rahmen der Konfiguration des ersten<br />
Produktes vom Abnehmer an den Hersteller übermittelt wurden, eine wichtige Hürde<br />
gegen einen Anbieterwechsel darstellen.<br />
Dabei sollten die Kommunikationsmaßnahmen je nach Stellung der Kunden – Neuund<br />
Bestandskunden – differenziert werden, denn die Kundengruppen unterscheiden<br />
sich in Informationsstand und Grad des wahrgenommenen Risikos. Bei potenziellen<br />
Neukunden geht es zunächst darum, die Aufmerksamkeit dieser Konsumentengruppe<br />
für das Mass-Customization-Programm zu wecken. Ziel ist es, potenzielle Kunden<br />
über die Möglichkeit einer Individualisierung zu informieren, die Vorteile individueller<br />
Produkte und deren Preisgestaltung zu erläutern und hervorzuheben, wo die<br />
Grenzen liegen. Der Computerhersteller Dell Inc. wirbt beispielsweise mit dem Slogan<br />
“Eines Tages wird es ganz einfach sein, ihren individuellen PC zu finden – Mit Dell ist<br />
eines Tages schon heute”. Der Slogan transportiert die Individualität in einem Satz und<br />
weckt die Aufmerksamkeit der Kunden für das Angebot. Hier können insbesondere<br />
bereits existierende Marken eine wichtige Hilfestellung leisten, da sie dem Kunden<br />
Vertrauen in den Anbieter geben können. Die vom Kunden wahrgenommene<br />
Unsicherheit wird reduziert und das Unternehmen erhält einen Vertrauensvorsprung.<br />
Diese Aufgabe hat aufgrund der in den folgenden Phasen beginnenden Integration des<br />
Kunden eine besondere Bedeutung. Die Kommunikation dient auch der Information<br />
und Qualifizierung des Kunden, damit die Leistungserstellung und -nutzung bestmöglich<br />
erfolgen kann (Gouthier 2003; Hennig-Thurau 1998). Bei Bestandskunden geht<br />
es dagegen darum, sie möglichst personalisiert und mittels Direktmarketing nach<br />
Ablauf eines Verbrauchszyklus oder im Rahmen branchenüblicher saisonaler Zyklen<br />
erneut anzusprechen und ihnen zu vermitteln, dass eine (modifizierte) Nachbestellung<br />
ihres individuellen Gutes viel einfacher möglich ist als bei der Erstbestellung.<br />
Eine aktuelle Strategie ist der Einbezug der Kunden in den Aufbau des<br />
Distributionssystems für ein Mass-Customization-Angebot. Ebenso wie Spreadshirt<br />
in Deutschland (siehe Kasten 2–8) gelten Zazzle und Cafepress als herausragende<br />
242
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Beispiele in den USA, wie Kasten 4–8 beschreibt (in Deutschland arbeit das Unternehmen<br />
Spreadshirt nach einem ähnlichen Prinzip). Hier wird ein Konfigurationstool<br />
für User Co-Design mit einem einfachen Shop wie bei e-Bay kombiniert. Damit wird<br />
eine wesentliche Hürde der Skalierbarkeit eines Mass-Customization-Angebots überwunden:<br />
Hat ein besonders kreativer Kunde einmal eine tolle eigene Kreation geschaffen,<br />
kann er diese an alle anderen Nutzer einfach weiterkaufen, die dafür nicht mehr<br />
der gesamten Komplexität der Leistungskonfiguration gegenüberstehen. Da der<br />
Hersteller aber dennoch durch die Verwendung flexibler Produktionstechniken die<br />
resultierende sehr hohe Variantenvielfalt effizient anbieten kann, entsteht hier ein<br />
neues Geschäftsmodell, das große Chancen aufweist.<br />
Kasten 4–8: Web Sites Offering Personalized Products Catch Fire Among Vcs<br />
(Quelle: Auszug aus dem Artikel “ ‘Your name here’ goes global” von Verne Kopytoff im San<br />
Francisco Chronicle vom 19. Juli 2005 [tinyurl.com/lfhnk])<br />
Customized T-shirts, posters and postage stamps have emerged as the Internet’s latest darlings<br />
among venture capitalists. Zazzle, a Palo Alto company that allows users to buy personalized products,<br />
announced Monday it had received $16 million in funding from two of Google’s early backers,<br />
Kleiner Perkins’ John Doerr and Ram Shriram, of Sherpalo Ventures. Earlier this year, a similar<br />
company, CafePress.com, in San Leandro, received $14 million in a second round of funding<br />
led by Sequoia Capital. These two firms are part of what analysts sometimes call personalized<br />
commerce. The idea is a cross between eBay’s online marketplace and FedEx Kinko’s, the chain<br />
of copying and printing stores. To get started, users create their own designs for products including<br />
T- shirts, posters and greeting cards. The Web sites then handle the printing and shipping. (...)<br />
Many people simply use the Web sites to make gifts for family members and friends. Others earn<br />
royalties by selling their products or designs to shoppers on the sites. “These are tools of self<br />
expression,” said Kent Allen, an analyst for the Research Trust, a market research firm specializing<br />
in online commerce. “They’re allowing people to turn their creativity and passion into a business.”<br />
The idea is more evolutionary than revolutionary. Consumers have been able to get customized<br />
trinkets at flea markets and county fairs for years featuring their names or images. What sets<br />
the online version apart is its potential global reach. Shriram, the investor, said that is in part what<br />
attracted him to Zazzle.<br />
“This is an opportunity to do mass customization,” he said. “The scaling of this has been an interesting<br />
challenge.” Zazzle was founded in 2003 by Robert Beaver, a serial entrepreneur in manufacturing,<br />
and his sons, Jeff and Bobby. Since then, the site has gained only modest traction on a<br />
limited budget. Users can create their own designs with Zazzle. They can also choose from nearly<br />
half a million images that are publicly available, including ones from the Walt Disney Co., the<br />
Library of Congress and the Bancroft Library at UC Berkeley.<br />
CafePress was founded in 1999 by Maheesh Jain and Fred Durham, two former students at<br />
Northwestern University. The company has grown to more than 200 employees, and has been profitable<br />
for several years, according to Durham. (...) As with Zazzle, shoppers on CafePress can use<br />
their own designs on 70 different products. Shoppers can also buy products from the Web site’s<br />
marketplace that are offered by other users. Political novelties, including coffee mugs and buttons,<br />
are widely available. Independent sellers dominate the marketplace, although there are a smattering<br />
of corporate products from StarTrek.com and the television program, “This Old House.”<br />
“There’s a million niches of tribes of 10,” said Durham. “It’s very focused stuff you just can’t find<br />
anyplace else.” Both companies operate by printing products only after they have been ordered. A<br />
243<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
run of items may therefore range anywhere from 1 to 1,000. Earlier this month, CafePress opened<br />
its second printing plant in Kentucky to speed order delivery on the East Coast. The company’s<br />
other production facility is in Hayward. (...)<br />
4.4.3 Exploring-Phase<br />
Die Information über die Möglichkeiten und das Spektrum des Mass-Customization-<br />
Systems gehört neben der Konfiguration zu den wichtigsten Inhalten des<br />
Kundeninteraktionsprozesses. Der Kunde setzt sich im Rahmen des Exploring mit<br />
dem System an sich und dessen Möglichkeiten und Grenzen auseinander. Exploring<br />
heißt, dass sich ein Kunden bereits mit den konkreten Individualisierungsoptionen für<br />
das Produkt auseinandersetzt, dabei aber weniger die konkrete Spezifikation seines<br />
gewünschten Produktes im Auge hat, sondern vielmehr – je nach Geschäftskonzept<br />
allein und/oder mit Hilfe eines Verkäufers – alle Möglichkeiten erforschen kann, die<br />
ihm im Rahmen des Mass-Customization-Angebots geboten werden. Dabei kann das<br />
Exploring sowohl on- als auch offline stattfinden, z. B. mit Hilfe eines Konfigurators<br />
am PC (zu Hause oder am Point of Sale) oder anhand ausliegender Stoffmuster,<br />
Produktmodelle und –komponenten im Geschäft.<br />
Exploring ist nicht nur bei Mass Customization wichtig, sondern auch beim Kauf von<br />
Standardprodukten: Auch hier will der Kunde das Angebot erforschen, es z. B. anfassen<br />
oder ausprobieren. Kennzeichnend für Mass Customization ist allerdings erneut<br />
die höhere Komplexität und Unsicherheit auf der Seite des Kunden, denn der Kunde<br />
hat wahrscheinlich keine Möglichkeit, genau das Produkt, das er kaufen möchte, anzufassen<br />
oder anzuprobieren (Dellaert / Stremersch 2005; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2004; Huffman /<br />
Kahn 1998). Die meisten Kunden sind es nicht gewöhnt, ein Angebot auf<br />
Komponentenebene zu erforschen.<br />
Für Unternehmen ist es deshalb essentiell, die Exploring-Phase zu strukturieren und<br />
die Komplexität aus Kundensicht zu reduzieren. Durch ständige Optimierung der<br />
Auswahl können die Optionen entfernt werden, die nur von einer kleinen Anzahl an<br />
Kunden gewählt werden. Permanent sollte deshalb eine Überprüfung der angebotenen<br />
Auswahl stattfinden. Wichtig ist neben der Anzahl an Optionen auch deren adäquate<br />
Darstellung: Die Kunden sollen überzeugt werden, zur nächsten Phase – der Konfiguration<br />
– voranzuschreiten. Konfiguratoren spielen deshalb bereits in dieser Phase<br />
eine wichtige Rolle, denn sie können helfen, das Produktangebot in einer für Kunden<br />
ansprechenden Art und Weise darzustellen. Beispielsweise bietet DaimlerChrysler den<br />
Interessenten für Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge die Möglichkeit, im Internet die gewünschten<br />
Leistungsmerkmale eines Lkws zusammenzustellen und sich vor dem<br />
Händlerbesuch zu informieren. Je nach individuellem Kundenwunsch ist dies anhand<br />
der Transportaufgabe, anhand von technischen Aspekten oder über eine Branchenlösung<br />
möglich. Auf diese Art und Weise kann jeder Kunde den Exploring-Prozess je<br />
nach seinen individuellen Präferenzen durchführen.<br />
Die Exploring-Phase ist auch für Anbieter erklärungsbedürftiger Produkte eine besondere<br />
Chance, das Leistungsspektrum ihres Angebots zu kommunizieren. Im Gegensatz<br />
244
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
zu einer klassischen Kommunikation ist der Kunde hier in die Wertschöpfung integriert.<br />
Er kann selbst die Kombinationsmöglichkeiten und verschiedenen technischen<br />
oder ästhetischen Optionen beurteilen.<br />
4.4.4 Konfigurationsphase<br />
Im Mittelpunkt des Kundeninteraktionsprozesses bei Mass Customization steht die<br />
Konfigurationsphase. Der Begriff Konfiguration leitet sich vom lateinischen “configuratio”<br />
ab und bedeutet übersetzt Anordnung und/oder Gestaltung. Im Sinne von Mass<br />
Customization ist Konfiguration ein Design- und Schöpfungsprozess innerhalb eines<br />
bestimmten Gestaltungsspielraums (der Lösungsraum). Anordnung verlangt dabei<br />
nach einzelnen Modulen oder Teilen, aus denen ein Objekt zusammengesetzt werden<br />
kann. Dies sind die Bestandteile der modularen Produkt- und Leistungsarchitektur.<br />
Gestaltung bedeutet die Möglichkeit der Abänderung von bereits vorhandenen<br />
Elementen und deren kreative Formung. Als Beispiel für eine Gestaltung können<br />
Abmessungen, eine freie Farbgebung oder die Positionierung gelten (Rogoll / <strong>Piller</strong><br />
2003). Für alle Individualisierungsoptionen muss aus dem angebotenen Komponentenspektrum<br />
jeweils die Ausprägung gewählt werden, die den Kundenwünschen entspricht.<br />
Konfiguration ist so eine (oft computerbasierte) Co-Designaktivität, die dazu<br />
dient, die individuelle Leistung und die Leistungsmerkmale zu gestalten, wobei der<br />
Lösungsraum, d. h. sowohl die einzelnen Komponenten als auch ihre Kombinationsmöglichkeiten,<br />
vorab durchdacht und festgelegt wurden (Dockenfuß 2003; Köhne /<br />
Klein 2004).<br />
Konfiguration ist eine computergestützte Gestaltungsaktivität zur Auswahl oder Spezifikation<br />
von Leistungsmerkmalen, bei der die Menge verfügbarer Komponenten und deren<br />
Kombinationsmöglichkeiten a priori bestimmt sind.<br />
Konfigurationssysteme stellen dabei ein integrales Bindeglied zwischen Produktentwicklung,<br />
Fertigung und Kundenwunsch dar. Ausgestattet mit einer einfachen<br />
Benutzerschnittstelle leiten diese Systeme den Kunden (und ggf. einen Mitarbeiter im<br />
Verkauf) durch die Erhebung der Bedürfnisinformation – und prüfen sogleich die<br />
Konsistenz sowie die Fertigungsfähigkeit der gewünschten Variante (Abbildung 4–12).<br />
Dieser Dialog vollzieht sich innerhalb von Minuten, bei komplexen Produkten vielleicht<br />
innerhalb mehrerer Stunden, auf keinen Fall aber innerhalb von Wochen, wie<br />
dies bei einer klassischen Individualfertigung oft die Regel ist. Schon während dieser<br />
Phase müssen dem Kunden Preis und Lieferzeitpunkt mitgeteilt werden können –<br />
ohne die Abstimmungsprozesse, die sonst bei einer Individualisierung anfallen. Der<br />
Einsatz von Konfigurationssystemen stellt so sowohl hinsichtlich der Effektivität<br />
(Erweiterung des Konfigurationsumfangs) als auch der Effizienz (Kostensenkung)<br />
eines der wichtigsten IuK-technischen Unterstützungspotenziale von Mass Customization<br />
dar (Berger et al. 2005; Dellaert / Stremersch 2005; <strong>Frank</strong>e / <strong>Piller</strong> 2003; Khalid<br />
245<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
/ Helander 2003; Liechty / Ramaswamy / Cohen 2001; Novak / Hoffmann / Yung 2000).<br />
In der Literatur wird der Begriff Konfigurationssystem meist recht technisch verwendet.<br />
Deshalb schlagen <strong>Frank</strong>e und <strong>Piller</strong> (2003) die Verwendung des Ausdrucks<br />
“Toolkit for Customer Co-Design” vor, um zum einen die Verwandtheit zu Toolkits<br />
for User Innovation (siehe Abschnitt 3.5.2), zum anderen die strategische (und nicht<br />
rein technische) Bedeutung dieses Instruments zu betonen. Wir werden in diesem<br />
Kapitel beide Begriffe synonym verwenden.<br />
Abbildung 4–12: Der Konfigurationsprozess (entnommen aus Rogoll / <strong>Piller</strong> 2003)<br />
Bei der Entwicklung und Implementierung eines Konfigurationssystems (Toolkits for<br />
Customer-Co-Design) sollte die dominierende Leitlinie die Reduktion der abnehmerseitig<br />
wahrgenommenen Komplexität sein, was gleichzeitig eine Komplexitätsreduktion<br />
in der Auftragsannahme des Anbieters einschließt. Studien haben ergeben,<br />
dass mehr als 40 Prozent aller Overheadkosten im US-Maschinenbau für Vertrieb und<br />
Marketing anfallen. Während versucht wird, die Fertigungs-, Entwicklungs-,<br />
Verwaltungs- oder Materialflusskosten seit Jahren durch Automatisierung und<br />
Computerisierung zu senken, muss der Vertrieb oft ohne jede informationstechnische<br />
Hilfe zwischen Kunde und Hersteller agieren, wenn es um die Bestellung individueller<br />
Produkte geht. Die Folge sind ständige Rückfragen, Anpassungen und Änderungen.<br />
Nach empirischen Studien wendet der typische US-Maschinenbauer zwei Prozent<br />
seines Bruttoumsatzes nur dafür auf, menschliche Eingabefehler, Misskalkulationen<br />
und andere Mängel während des Konfigurationsvorgangs auszugleichen (McHugh<br />
1996; Ziegler 1997). Eine aktuelle empirische Studie hat für den deutschen Maschinenund<br />
Anlagenbau ähnliche Daten ergeben (Stotko 2005).<br />
246<br />
Auswahl eines<br />
Basisproduktes/ -<br />
Modells<br />
Plausibilitätsprüfung/<br />
Auswahl der<br />
Grundschemata<br />
Modul 01 ... Modul 0X Modul 11 …Modul 1X Modul X1 …Modul XX<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
der Auswahl,<br />
Anpassung der Logik<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
der Auswahl,<br />
Anpassung der Logik<br />
Parallele oder abschließende Stücklistenerstellung (und/oder weitere Prozesse)<br />
Parallele oder abschließende visuelle Produktpräsentation (Visualisierung)<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
der Auswahl<br />
Fertig<br />
konfiguriertes<br />
Produkt
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
Im Gegensatz zu einer klassischen Einzelfertigung basiert die Produktindividualisierung<br />
bei einem Mass-Customization-Konzept auf relativ konkreten Vorgaben<br />
in Form der modularen Produktarchitektur und möglicher Anpassungsschritte. Je<br />
nach Konzeption der Mass Customization stehen hierbei unterschiedlich viele<br />
Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind aber ex ante bereits definiert.<br />
Damit kann eine regelbasierte Beschreibung der Produktkonfiguration geschaffen<br />
werden (selbst, wenn kombinatorisch die Anzahl der möglichen Varianten schnell in<br />
die Millionen geht), was die Voraussetzung für eine weit reichende Vereinfachung,<br />
Automatisierung, und Effizienzsteigerung des Konfigurationsvorgangs bietet.<br />
Aus Sicht des Anbieters muss der Konfigurationsprozess weitgehend automatisiert<br />
werden. Dies ist vor allem im Konsumgütermarkt notwendig, um die zusätzlichen<br />
Kosten der Interaktion zwischen Hersteller und jedem Abnehmer entscheidend zu senken.<br />
Die hier oft übliche Selbstbedienung im Handel ist auf eine Selbstkonfiguration<br />
des Kunden zu übertragen. Ist eine Selbstkonfiguration nicht möglich, muss das<br />
Verkaufspersonal des Anbieters bei der Erhebung der Individualisierungsinformation<br />
so weit wie möglich unterstützt werden. Bei der Gestaltung eines Konfigurationssystems<br />
gibt es eine Vielzahl möglicher Gestaltungsoptionen, die in den folgenden<br />
Abschnitten näher betrachtet werden (Abbildung 4–13). Ungeachtet der Ausprägung<br />
eines Konfigurationssystems muss dieses etlichen wichtigen Ansprüche gerecht werden<br />
(Abbildung 4–14). Die folgende Diskussion (in Anlehnung an Rogoll / <strong>Piller</strong> 2003)<br />
dieser Ansprüche orientiert sich dabei an erster Linie an Konfigurationssystemen im<br />
Internet, ist aber auch auf eine Gestaltung ladengestützter Konfiguratoren übertragbar.<br />
Abbildung 4–13: Einsatzumgebungen von Toolkits für User Co-Design<br />
Konfigurationsaufgabe<br />
Online Konfiguratoren<br />
(Internetbasiert)<br />
Real-Konfiguratoren<br />
(Verkaufsumgebung)<br />
Prozedural<br />
(step by Step)<br />
Unstetig<br />
(freie Abfolge)<br />
Wissensbasiert<br />
(keine Konfigurationsschritte)<br />
Sales Konfigurator<br />
(Unterstuetzung am POS)<br />
„Montage“ Konfigurator<br />
(Selbstmontage im Laden)<br />
247<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Präsentation des Angebots und Auswahl eines Basisprodukts oder -modells: Die<br />
meisten Mass-Customization-Angebote basieren auf einer einheitlichen Plattform bzw.<br />
einem Grundprodukt (Modell, Schnitt etc.), das dann durch Standard- oder kundenindividuelle<br />
Module erweitert bzw. modifiziert wird. Deshalb ist eine der wichtigsten<br />
Aufgaben des Kunden, zu Beginn des Konfigurationsvorgangs ein geeignetes<br />
Basisprodukt auszuwählen. Dieses Basisprodukt beschreibt das zu konfigurierende<br />
Objekt in seinen Grundzügen und legt die einzelnen Module fest, die für das kundenindividuelle<br />
Endprodukt notwendig sind. Durch die geeignete Wahl des Basisproduktes<br />
kann die Komplexität aus Kundensicht stark gesenkt werden.<br />
Abbildung 4–14: Aufgabenumfang eines Produktkonfigurationssystems für Mass<br />
Customization<br />
Unterstützung und Beratung: Eine weitere Aufgabe ist die Beratung und<br />
Unterstützung des Nutzers während des Konfigurationsvorganges. Gerade bei individuell<br />
gefertigten Produkten spielt die Beratung des Kunden häufig eine wichtige Rolle.<br />
Der Abnehmer befindet sich während des Konfigurationsprozesses in einem ständigen<br />
Entscheidungszwang, der zusammen mit eventuellen Unsicherheiten zum Abbruch<br />
der Konfiguration führen kann. Deshalb ist ein Hilfs- und Beratungssystem von hoher<br />
Bedeutung. Hierbei geht es neben technischer oder funktionaler Hilfe vor allem auch<br />
um die Unterstützung zum Erkennen und Formulieren der Bedürfnisse eines Kunden.<br />
Beratungssysteme können von einem einfachen Hilfe-Button, der in der Regel die<br />
Funktionsweise eines Konfigurationsschritts oder die Eigenschaften einer Komponente<br />
erklärt, über automatisch gesteuerte Zusatzinformationen bei bestimmten Verweil-<br />
248<br />
Begleitung bei<br />
Erhebung von<br />
Kundendaten<br />
Visualisierung der<br />
Konfiguration<br />
Vervollständigung<br />
des Produktes<br />
Gewinnung von<br />
aggregiertem<br />
Kundenwissen<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
der Auswahl<br />
Unternehmens- und<br />
Fähigkeitsrepräsentation<br />
Konfigurator<br />
Präsentation des<br />
Angebots<br />
Vermittlung eines<br />
„Flow-Erlebnisses“<br />
Kaufprozess<br />
Auswahl eines<br />
Basisprodukts/ -modells<br />
Unterstützung und<br />
Beratung<br />
Führung durch den<br />
Konfigurationsvorgang
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
dauern bis hin zu einem interaktiven Verkaufsberater reichen, der eine komplette<br />
Stilberatung ersetzt. Zum Aufbau von Vertrauen und zur Reduktion des Risikos von<br />
Mass Customization aus Kundensicht ist eine solche Beratungsfunktion von essentieller<br />
Bedeutung. Neben der Information des Anwenders über die gewählte Leistungsspezifikation<br />
muss ein Konfigurator auch Auskunft über Attribute der einzelnen Komponenten<br />
geben können. Dies sind beispielsweise Beschreibungen und Angaben wie<br />
Preis, Gewicht, Lieferzeit etc. Da diese Attribute die Kaufentscheidung maßgeblich<br />
beeinflussen können, sollten diese Angaben nach jedem Konfigurationsschritt aktualisiert<br />
werden.<br />
Führung durch den Konfigurationsvorgang: Während des Konfigurationsvorganges<br />
werden die Merkmale des kundenindividuellen Produktes durch die Auswahl bzw.<br />
den Austausch von Modulen oder Teilen verändert. Die Differenzierung zwischen<br />
Auswahl und Austausch begründet sich aus der Art des Konfigurationsvorgangs.<br />
Entweder wird nur ein Basismodells abgeändert, das bereits eine vordefinierte<br />
Vollständigkeit hat (Standard-Konfiguration), oder aber es werden alle notwendigen<br />
Konfigurationsschritte mit begleitender Auswahl von Modulen oder Teilen abgearbeitet,<br />
bis eine Vollständigkeit vorhanden ist (aktuelle Forschungsarbeiten lassen darauf<br />
schließen, dass die Zahlungsbereitschaft von Kunden höher ist, wenn ihnen ein vollständig<br />
ausgestattetes Produkt präsentiert wird, das sie anschließend durch Austausch<br />
von Komponenten und/oder Löschen von Kann-Optionen individualisieren – anstatt<br />
das Produkt von Grund aus in allen Stufen zu individualisieren ; siehe Levin et al.<br />
2002). Dabei sollte sich die Prozessunterstützung in erster Linie an den Anwendungsfeldern<br />
des Kunden orientieren und nicht an der grundlegenden Produktstruktur. Viel<br />
zu wenige Konfiguratoren beginnen mit einer Erhebung der eigentlichen Wünsche<br />
und Bedürfnisse des Anwenders, sondern konfrontieren den Nutzer sofort mit der<br />
Auswahl verschiedener Module und Komponenten. Ein Ausweg aus dieser<br />
Problematik ergibt sich beispielsweise durch eine begleitende Stilberatung, die die zur<br />
Verfügung stehenden Variationsmöglichkeiten sukzessive einschränkt. So könnte beispielsweise<br />
ein Konfigurator von Maßkonfektion zuerst den Anlass abfragen, zu dem<br />
ein Kunde ein maßgefertigtes Hemd bestellen möchte. Wählt er “Business look” als<br />
Motivation aus, könnte der Konfigurator Button-Down-Kragen oder auffällige Stoffe<br />
von vorneherein ausschließen. Somit rückt das Kundeninteresse in den Vordergrund.<br />
Aus konzeptioneller Sicht spricht diese Diskussion die Entscheidung zwischen parameterbasierten<br />
und bedürfnisbasierten Konfiguratoren an (Randall / Terwiesch /<br />
Ulrich 2005). Parameterbasierte Konfiguratoren präsentieren dem Kunden (ggf. vorgefiltert)<br />
alle möglichen Auswahloptionen für eine individualisierbare Komponente.<br />
Der Kunde muss dann selbst entscheiden, welche Option seinem Bedürfnis am ehesten<br />
entspricht. Bedürfnisbasierte (“need based”) Konfiguratoren dagegen fragen den<br />
Kunden nach seinem Bedürfnis und ordnen dieses dann selbstständig einer Option<br />
vor. Empirische Studien haben gezeigt, dass letzteres Verfahren häufig zu einer höheren<br />
Kundenzufriedenheit führt. Eine bedürfnisbasierte Konfiguratoren bedeutet aus<br />
Sicht der interaktiven Wertschöpfung aber auch, dass ein Kunde einen geringeren<br />
Integrationsgrad besitzt, da der Anbieter den eigentlichen Problemlösungsprozess<br />
wieder internalisiert.<br />
249<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Vermittlung eines Einkaufserlebnisses: Die Führung durch das Konfigurationssystem<br />
dient neben der eher technischen Unterstützung zur Findung einer passenden<br />
Spezifikation auch zur Vermittlung eines besonderen Einkaufserlebnisses. Empirische<br />
Studien haben ergeben, dass bei Mass Customization die wahrgenommene Produktzufriedenheit<br />
ganz stark mit der erlebten Prozesszufriedenheit korreliert (<strong>Frank</strong>e /<br />
<strong>Piller</strong> 2004). Für viele Kunden ist die Mitwirkung beim Entwurf eines individuellen<br />
Produktes ein besonderes Erlebnis. Der Kunde wird zum eigenen Designer, was<br />
Identifikation und Involvement mit dem Endprodukt deutlich erhöhen kann. Aufgabe<br />
für einen Konfigurator ist so auch die Vermittlung von Begeisterungseigenschaften.<br />
Im Rahmen einer Internet-Konfiguration hat dabei die “Flow-Theorie” eine große<br />
Bedeutung (Bauer / Grether / Borrmann 2001; Csikszentmihalyi 1990; Hoffman / Novak<br />
1996). Diese beschäftigt sich mit Fragen der intrinsischen Motivation (Motivation aus<br />
Eigenantrieb) und den Determinanten, die Aktivitäten so erfreulich machten, dass sie<br />
um ihrer selbst willen ausgeübt werden (siehe auch Abschnitt 3.3.3). Flow bezeichnet<br />
jenen Zustand, bei dem eine Person so in eine Tätigkeit vertieft ist, dass nichts anderes<br />
um sie herum eine Rolle zu spielen scheint. Ein Flow entsteht, wenn beispielsweise ein<br />
Nutzer merkt, dass er bei der Lösung einer als hoch wahrgenommenen<br />
Herausforderung die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um diese zu meistern. Auch<br />
eine unmittelbare Rückmeldung über den Grad der Zielerreichung vermittelt ein Flow-<br />
Erlebnis, ebenso wie das Gefühl von Kontrolle über eine Situation. Hoffman / Novak<br />
(1996) konnten einen statistisch signifikanten positiven Zusammenhang zwischen<br />
Flow und Online-Kauf empirisch nachweisen. Damit liegt die Bedeutung des Flow-<br />
Konstruktes für das Kundennutzungsverhalten von Online-Konfiguratoren auf der<br />
Hand. Ein guter Konfigurator kann dazu beitragen, bei den Kunden ein Flow-Erlebnis<br />
hervorzurufen – mit den angesprochenen positiven Konsequenzen auf das<br />
Kaufverhalten. Bei der Konfiguration sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, um das<br />
Entstehen eines Flow-Erlebnisses zu begünstigen. Mehr noch als in herkömmlichen<br />
Internetanwendungen ist das individuelle Konfigurieren eines Produkts als<br />
Herausforderung anzusehen. Wichtig ist es dabei allerdings, den Kunden nicht zu<br />
überfordern, da sonst Frustration entsteht. In ganz besonderem Maße muss dem<br />
Kunden dabei das Gefühl vermittelt werden, die Kontrolle über die Situation zu haben.<br />
Der Kunde muss sich als sein eigener Designer begreifen können. Dazu ist eine zeitnahe<br />
Visualisierung des Ergebnisses nötig, um dem Nutzer eine Rückmeldung über seine<br />
Tätigkeit geben zu können. Ebenso ist es in dieser Stufe nötig, die durch das Design<br />
beeinflussten Parameter wie Preis oder Liefertermin zu übermitteln.<br />
Plausibilitätsprüfung der Auswahl: Mit jeder Auswahl oder Gestaltung eines Moduls<br />
ergeben sich für die weitere Konfiguration des Produkts auf Grund der Produktlogik<br />
bestimmte Einschränkungen oder zusätzliche Möglichkeiten. Charakteristisch für die<br />
Produktkonfiguration ist, dass die Auswahl bestimmter Module zu einer Belegung<br />
anderer Module führt, die weitere Auswahlmöglichkeiten begünstigen oder einschränken.<br />
Es bestehen also neben den mehrstufigen funktionstechnischen Abhängigkeiten<br />
unter Umständen noch weitere Abhängigkeiten. Um diese je nach aktueller Auswahl<br />
eines Nutzers aufzuzeigen, gibt es verschiedene Ansätze, um die Abhängigkeiten zwischen<br />
einzelnen Konfigurationsschritten zu ermitteln und in so genannten<br />
Konfigurationsregeln zu beschreiben (z. B. prozedurale, entscheidungsregelbasierte<br />
250
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
und wissensbasierte Systeme). Die Realisierung dieser Prüfungen und Regeln ist von<br />
der Funktionsweise der Konfigurationslogik und der dafür eingesetzten Technologie<br />
abhängig.<br />
Vervollständigung des Produkts: Ein Konfigurator sollte in der Lage sein, über die<br />
Beratung hinaus den User bei der Konfiguration soweit zu unterstützen, dass die<br />
Bemühungen auf jeden Fall zu einem sinnvollen Ergebnis führen. Hilfsmittel dazu ist die<br />
Möglichkeit einer Auto-Vervollständigung der Konfiguration, so dass immer ein vollständig<br />
konfiguriertes Produkt aus dem Prozess hervorgeht. Dies reduziert einerseits die<br />
Unsicherheit des Kunden, da ihm nach jedem Schritt ein mögliches Endergebnis mitgeteilt<br />
wird. Andererseits wird das Flow-Erlebnis des Kunden dadurch bestärkt, dass er zu<br />
jedem Stadium des Konfigurationsprozesses ein mögliches Endergebnis seiner Tätigkeit<br />
sieht. So wird seinem Wunsch nach Kontrolle genüge getan.<br />
Darstellung der Konfiguration (Visualisierung): Visualisierung ist ein wesentlicher<br />
Erfolgsfaktor eines guten Konfigurators. Sowohl während als auch am Ende des<br />
Konfigurationsvorgangs muss den Kunden das individuell konfigurierte Produkt<br />
möglichst realistisch präsentiert werden. Die Visualisierung ersetzt das physische<br />
Produkt, das bei kundenindividueller Fertigung zum Zeitpunkt des Kaufabschlusses<br />
noch nicht verfügbar ist. Ziel ist es, den Kunden bei seinen Entscheidungen zu unterstützen,<br />
aber auch, seine Kreativität anzuregen. Technisch ist eine Visualisierung meist<br />
einer der aufwändigsten Teile eines Konfigurators, hinzu kommt das Problem langer<br />
Übertragungszeiten, wenn eine Visualisierung auf einem externen Server individuell<br />
erstellt (“Rendering”) und dann auf den Computer des Anwenders übermittelt wird.<br />
Aus Anbietersicht bedeutet deshalb Visualisierung stets eine Abwägung zwischen dem<br />
technisch Machbaren mit dem zur Komplexitäts- und Risikoreduktion Wünschenswertesten<br />
und einer praktikablen Lösung mit hoher Effizienz.<br />
Begleitung bei der Erhebung von Kundendaten: Studien, die sich mit den Ursachen<br />
eines Abbruchs von Onlineverkäufen beschäftigen, zeigen oft, dass genau dann ein<br />
Kaufvorgang abgebrochen wird, wenn persönliche Angaben vom Nutzer erfragt werden<br />
(Adressdaten, Zahlungsinformation etc.). Dies gilt in einem Mass-Customization-<br />
System in besonderem Maße. Bei kundenindividuellen Produkten sind oft sehr persönliche<br />
Angaben wie Körpermaße, Abmessungen, aber auch Vorlieben oder Angaben<br />
über Hautprobleme nötig. Der Konfigurator muss nicht nur in der Lage sein, die<br />
Ermittlung dieser Angaben zu unterstützen, sondern auch im besonderen Maße “vertrauenswürdig”<br />
sein. Allerdings kann die Investition, die ein Nutzer bereits durch die<br />
Auseinandersetzung mit dem Produkt getätigt hat (in Form von Zeit und Mühe) als<br />
wichtiger Anreiz dienen, einen Kauf abzuschließen. Entsprechend einfach (und intuitiv)<br />
muss dann aber auch der Abschluss der Konfiguration durch den eigentlichen<br />
Kaufvorgang sein.<br />
4.4.5 Wartezeit und Lieferung<br />
Nach der Konfiguration folgt aus Anbietersicht die Produktion der individuellen Güter<br />
“on demand”. Dieses Prinzip der Individualproduktion ist Grundlage der neuen<br />
251<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Kostensenkungspotenziale. Wie wir bereits gesehen haben, können dazu schon bis zu<br />
einem gewissen Grad Aktivitäten vorausschauend stattgefunden haben, d. h. die<br />
Individualproduktion erfolgt nicht (unbedingt) bei der Aufbereitung der Rohstoffe,<br />
sondern kann möglicherweise nur aus der individuellen Montage vorgefertigter Teile<br />
bestehen. Diese Optionen sind von der Festlegung des Vorfertigungsgrades abhängig<br />
(siehe Abschnitt 4.1.3). Aus Kundensicht bedeutet eine Produktion auf Bestellung<br />
jedoch, dass sie bis zur Abholung oder Lieferung des individuellen Produktes warten<br />
müssen. Als Substitut für das Produkt dient aus Kundensicht ein Ausdruck mit den<br />
individuellen Konfigurationsdaten und einer Darstellung des konfigurierten Produktes.<br />
Diese Bestellbestätigung kann zu einem wichtigen Kommunikationsinstrument<br />
werden.<br />
Die Gestaltung der Wartezeit ist ein entscheidender Faktor für die Gesamtzufriedenheit<br />
der Abnehmer (Ihl et al. 2006). Zu berücksichtigen ist dabei die Tatsache, dass Kunden<br />
es bei vielen Produkten gewohnt sind, ihr Produkt sofort mit nach Hause zu nehmen,<br />
d. h. die Wartezeit könnte von den Kunden zunächst als nachteilig empfunden werden.<br />
Umso wichtiger ist es, dem Kunden die Vorteile, die aus dem individuellen Produkt<br />
resultieren, zu vermitteln. Es gilt außerdem, die Wartezeit soweit möglich zu reduzieren.<br />
Eine Möglichkeit ist z. B., den Kunden die Möglichkeit zur Auftragsverfolgung zu<br />
bieten. Nach Anstoß der Fertigung sollte für den Kunden eine Möglichkeit bestehen,<br />
den Status der laufenden Bestellung online zu verfolgen und zu überprüfen<br />
(Ordertracking). Hierzu gehört beispielsweise die Nennung seiner Warteschlangenposition<br />
in der Fertigung oder der Zeitpunkt der Übergabe an den Distributeur.<br />
4.4.6 Feedback und After-sales-Phase<br />
Die direkte Interaktion mit jedem einzelnen Kunden bietet neue Möglichkeiten für den<br />
Aufbau einer intensiven, wissensbasierten Kundenbeziehung im Sinn des Relationship<br />
Management. Unternehmen, die kundenindividuelle Produkte anbieten, haben hier<br />
einen entscheidenden Vorteil gegenüber Anbietern von Massenware, da sie eine<br />
Vielzahl von Informationen über die Kunden während der Kundeninteraktion gesammelt<br />
haben. Entscheidend ist es, das Potenzial dieser Informationen zu nutzen. Eine<br />
individuelle Betreuung der Kunden ist auch nach Übergabe des individualisierten<br />
Produktes wichtig. Beispielsweise sollte der Hersteller bei Kundenanfragen den<br />
Kunden und die gekauften Produkte kennen und individuell auf Kundenwünsche eingehen<br />
können. Vor allem aber sollte unmittelbar nach der Auslieferung durch einen<br />
Feedback-Prozess die Zufriedenheit des Kunden mit dem Produkt und dem<br />
Interaktionsprozess abgefragt werden, um für künftige Käufe des einzelnen Kunden,<br />
aber insbesondere auch für die Optimierung des Gesamtsystems Anregungen zu erhalten.<br />
Ferner sollten Kunden regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt werden,<br />
die optimalerweise entsprechend der Kaufpräferenzen individuell auf jeden einzelnen<br />
Kunden abgestimmt sind.<br />
Eine wichtige Aufgabe an dieser Stelle ist auch die systematische Auswertung der<br />
während des Konfigurationsvorgangs erhobenen Informationen. Denn Vo-<br />
252
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
raussetzung für ein dauerhaft erfolgreiches Mass-Customization-Konzept ist nicht<br />
nur die Fähigkeit, Produkte variabel und kostengünstig zu fertigen, sondern gleichermaßen<br />
der Einsatz des dabei gewonnenen Wissens zum Aufbau einer dauerhaften<br />
Kundenbindung. Durch den Konfigurationsvorgang erhält der Hersteller Zugang zu<br />
implizitem Wissen der Kunden. Dadurch werden die Kosten eingespart, die normalerweise<br />
erforderlich sind, um dieses Kundenwissen zu decodieren (beispielsweise<br />
durch aufwändige Marktforschung), zu verstehen und weiterzugeben. Kundenbedürfnisse<br />
werden somit schneller und vor allem genauer verstanden. Die aggregierte<br />
Auswertung der gewählten wie auch verworfenen Konfigurationen aller Nutzer<br />
kann auch für eine Definition von Varianten für eine standardisierte Variantenproduktion<br />
genutzt werden (bei einem simultanen Angebot individueller und massenhafter<br />
Leistungen) bzw. zur Verbesserung der Produktarchitekturen und angebotenen<br />
Vielfalt einer Mass Customization dienen. Deshalb sollte ein Konfigurator auch<br />
(im begrenzten Maße) Informationen erheben, die für Wiederkäufe oder ein Cross-<br />
/Up-Selling interessant sind (Verwendungszyklen, Anwendungsintensitäten,<br />
Feedback etc.). Ebenso ermöglicht das systematische Auswerten der Log-files, die die<br />
Kundenaktivitäten protokollieren, eine systematische Verbesserung des Konfigurators.<br />
4.4.7 Wiederholungskauf<br />
Sind die Kunden mit der individuellen Leistung zufrieden, kommt es aus<br />
Anbietersicht hoffentlich zu einem Wiederholungskauf. Hierbei sollte wie in der<br />
After-Sales-Phase darauf geachtet werden, dass die bereits vorhandenen<br />
Kundendaten sinnvoll genutzt werden. Diese Daten bilden, wie wir in Abschnitt 4.2.2<br />
bereits diskutiert haben, die Grundlage für Learning Relationships, d. h.<br />
Kundenbeziehungen, die mit jeder Interaktion wachsen, stärker und intensiver werden,<br />
und die immer mehr Kundennutzen stiften (Peppers / Rogers 2004).<br />
Beispielsweise sollte bei jedem weiteren Kauf auf die gespeicherten Kundendaten<br />
zurückgegriffen werden. Der Konfigurationsvorgang kann damit für den Kunden<br />
wesentlich unkomplizierter gestaltet werden, und der Kunde kann sich auf die<br />
wesentlichen Aspekte des Vorgangs, z. B. das Design seines individuellen Schuhs,<br />
konzentrieren. Damit wird es möglich, Aufwand und Komplexität des Kaufs weiter<br />
zu reduzieren. Allerdings darf die Flexibilität, auch auf neue oder geänderte<br />
Kundenbedürfnisse einzugehen, nicht verloren gehen. Optimalerweise sind die<br />
Kundendaten auch direkt online für den Kunden einseh- und änderbar, so dass der<br />
Kunde gegebenenfalls autonom seine Daten anpassen kann.<br />
Abschließend stellt Kasten 4–9 noch ein ausführlicheres Beispiel vor, wie ein großes<br />
Unternehmen, der Spielzeughersteller LEGO, durch die Kombination von Mass<br />
Customization und Open Innovation ein völlig neues Wertschöpfungssystem geschaffen<br />
hat. Ob dieses Bestand hat und tatsächlich eine Alternative zum derzeitigen Modell<br />
klassischer Variantenfertigung auf Basis von Marktforschungsanstrengungen des<br />
Herstellers ist, wird die Zukunft zeigen.<br />
253<br />
4.4
4<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Produktion: Mass Customization<br />
Kasten 4–9: LEGO Factory: Von Mass Customization zu User Innovation<br />
(Quelle: Auszug aus dem Posting “Lego Factory hacked by users - and the company loves it” von<br />
<strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> im Blog MC&OI News [mass-customization.blogs.com] vom 12. Dezember 2005)<br />
Lego, a toy maker based in Billund, Denmark, provides an interesting case of a company combining<br />
mass customization configuration and open innovation. Originally acclaimed for its modular<br />
product architecture, the company provided users since its foundation the possibility to create<br />
almost unlimited designs. However, the relationship between the company and its users was following<br />
the conventional, disconnected transaction marketing approach. Also, all parts and logo kits<br />
were produced in a built-to-stock model. In recent years, Lego faced serious difficulties to forecast<br />
its products. Also, it was in a need to differentiate itself to more “modern” educational toys like children<br />
computers etc.<br />
To get inspiration for new products and connect closer with its users, the company had a great<br />
source of inspiration: Totally independent by the company, a Lego user community called LUGNET<br />
has been built by fanatic adult users of Lego. Lugnet is one of the best examples of a community<br />
where users co-create and co-design based around a manufacturer’s products. Its members do<br />
not only swap parts or share pictures of their individual models, but also developed collaboratively<br />
a design software (open source) to create great expert constructions. Also, a whole number of<br />
small user shops sell unique models and designs. When Lego introduced its Mindstorms Robotic<br />
toys, after several years of development, some users “hacked” the robotic kit and improved the<br />
performance of the construction kit and its processing capabilities by several dimensions in just a<br />
few weeks (this is one of the best documented and fascinating of user innovation). All these user<br />
activities, however, were not facilitated or really utilized by Lego.<br />
But finally, the Lego Company introduced a similar offering combining mass customization and<br />
open innovation: In August 2005, Lego announced the opening of LEGO factory, a very advanced<br />
toolkit for user (children) innovation and co-design. The Lego Factory combines several trends and<br />
developments which were before invented in the user domain, and which are now incorporated into<br />
a business model of the company. At Lego Factory, users can create their own unique Lego models<br />
– using interactive software that helps them to overcome the engineering problem of combining<br />
basic modular elements (Lego bricks) into a new creation. Then, the company manufactures the<br />
bricks necessary for the model and ships them to users so they can assemble their models.<br />
Customers can also buy the bricks necessary to build from other people’s designs, which are<br />
posted on the site. Lego Factory is based on a toolkit for user co-design, called Lego Designer, a<br />
free, downloadable, 3D modeling program that lets users choose from digital collections of bricks<br />
to compose their own unique models.<br />
In addition, the site finally features real open innovation at Lego: It highlights the fact that the company<br />
is now selling Lego sets which are designed by other Lego users. Children can not only create<br />
their own unique designs, and order the corresponding bricks in a customized set with the help<br />
of their father’s credit card, but can also submit these designs to the company. Lego may then produce<br />
an extraordinary design as a mass product for other children as well. This ideas has been<br />
also tested before (in the German Lego catalog, some user designed Lego sets were included<br />
since 2003), but never utilized in large scale.<br />
But the story continues further: Already 15 days after its launch, the Lego Designer software was<br />
hacked. The problem was that Lego used a simple algorithm to assign bricks to a user’s unique<br />
creation. Instead of matching the blueprint with the exact number of the correct bricks, the Lego<br />
assembly center has pre-packed packages of bricks, and matches a user’s designs with these<br />
packages. The result: Users often had to pay for far more pieces than they really needed. At the<br />
same time, they were missing a few others that were integral to the creations, and had to purchase<br />
more packages. That made designing and buying models sometime very costly. While a child<br />
254
Phasen und Instrumente der Kundeninteraktion bei Mass Customization<br />
using her father’s credit card wouldn’t bother with this problem, adult fans of Lego, who adopted<br />
the Lego Factory rapidly, did.<br />
So the adult Lego community became innovative: They collected information about the exact combination<br />
of each brick package (called a palette in Leo Factory language) and compiled this information<br />
in a database that lists which bags must be purchased in order to collect specific bricks. On<br />
top comes an algorithm that optimizes the number of bricks based on a user’s design by making<br />
modifications in the design or at least promoting a warning if a user selects a part that would cause<br />
an additional order of a package of bricks.<br />
In an article* about this user initiative on CNET Networks, the author Daniel Terdiman quotes Dan<br />
Malec, one of the user developers (Malec is a software engineer from Stow, MA): “You’d see a lot<br />
of fan creations [on Lego factory] costing $400 or $500 because fans are not using the bags efficiently.<br />
If you could see it at the bag level (instead of the larger digital palettes offered by Lego),<br />
maybe you might make a different decision. Maybe (instead of buying) that one piece which takes<br />
a whole bag that you’re not going to use, you might choose a different bag.”<br />
So users created a very beneficial addition to the company’s offering, however once that undermines<br />
Lego’s sales opportunities. But most astonishing, Lego’s reaction has been largely positive.<br />
Terdiman quotes a Lego executive that “the adult community found out within a few days (of the<br />
Lego Factory launch) how these bags were mixed together. It was a puzzle to us. They took us<br />
completely by surprise.” But the Lego manager added: “We really encourage and embrace some<br />
modifications of our software.” And while in the moment Lego has not incorporated the development<br />
of the Lego fan community into its proprietary Designer software, it may do so in the future:<br />
“It’s not surprising to us that they’re doing the hacking, because that was the hope, that they would<br />
take the core of what we’re doing and own the system” for themselves, Jacob McKee, Lego’s global<br />
community relations specialist is quoted in the CNET Networks article. “We want to release<br />
more and more content and development tools to help that process along. The hope is that they<br />
really start to take this on and start to do things we haven’t even thought of yet.” This is really an<br />
astonishing remark and could serve as a role model for many other companies who often fight<br />
against user modifications and do not recognize the input from the company.<br />
* Daniel Terdiman: Lego Factory hacked. CNET News.com, September 15, 2005 [http://tinyurl.com<br />
/bnflw]<br />
Kasten 4–10: Literaturempfehlungen zur Gestaltung der Kundeninteraktion bei Mass<br />
Customization<br />
Dellaert, Benedict G.C. / Stremersch, Stefan (2005). Marketing mass customized products:<br />
Striking the balance between utility and complexity. Journal of Marketing Research, 43 (2005)<br />
2 (May): 219-227.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2004). Toolkits for user innovation and design: An exploration<br />
of user interaction and value creation. Journal of Product Innovation Management, 21 (2004)<br />
6 (November): 401-415<br />
Gerschenfield, Neil (2005): Fab: The coming revolution on your desktop — from personal computers<br />
to personal fabrication. New York: Basic Book 2005.<br />
Randall, Taylor / Terwiesch, Christian / Ulrich, Karl T (2005). User design of customized products.<br />
Wharton School Working Paper, 2005 (Forthcoming in: Marketing Science).<br />
255<br />
4.4
5 Fallstudien zur interaktiven<br />
Wertschöpfung<br />
Dieser Fallstudienteil soll die vorangehenden Kapitel praxisbezogen konkretisieren<br />
und Einblick geben, wie Unternehmen heute schon die zuvor dargestellten Wertschöpfungsprinzipien<br />
nutzen. Alle Fallstudien enden mit Diskussionsfragen, die eine<br />
weiterführende Auseinandersetzung erlauben. Auf der Internetseite zum Buch finden<br />
sich laufend weitere neue Fallbeispiele und Aktualisierungen zu den hier vorgestellten<br />
Fällen. Aufgrund des Umsetzungsstands der Interaktiven Wertschöpfung in der<br />
Industrie beziehen sich die meisten dieser Fallstudien auf eine Produktindividualisierung,<br />
da hier besser dokumentierte Beispiele von Unternehmen vorliegen.<br />
5.1 Von Mass Customization zu Open Innovation<br />
bei der Adidas-Salomon AG<br />
Die Adidas-Salomon AG (‘Adidas’ im Folgenden) ist ein Vorreiterunternehmen im Bereich<br />
der interaktiven Wertschöpfung. Bereits in den 1990er Jahren wurde unter dem Namen<br />
‘mi adidas’ ein erfolgreiches Mass-Customization-Programm entwickelt und seit 2000<br />
erfolgreich am Markt platziert. Grundidee von ‘mi adidas’ ist es, Schuhe, die an die individuellen<br />
Bedürfnisse des Trägers angepasst sind, nicht wie bislang nur professionellen<br />
Athleten, sondern allen Kunden anzubieten. Aus den Erfahrungen, die Adidas im<br />
Rahmen der ‘mi adidas’Aktivitäten im Bereich Kundenintegration gewinnen konnte, entstand<br />
die Idee, die Kunden nicht nur im Rahmen eines gegeben Lösungsraumes in die<br />
Wertschöpfung einzubeziehen, sondern sie auch im Sinne von Open Innovation aktiv in<br />
den Innovationsprozess zu integrieren. Zu diesem Zweck wurde ein internet-gestützter<br />
Ideenwettbewerb entwickelt, der auch der Identifikation von Lead Usern dienen kann.<br />
Die folgende Fallstudie beschreibt zunächst das ‘mi adidas’ Programm. Anschließend<br />
wird der Innovationswettbewerb dargestellt. Dieser setzt auf dem ‘mi adidas’ Programm<br />
auf, steht jedoch streng genommen nicht mit der Mass-Customization-Idee in<br />
Verbindung. Allein aus Gründen der einfacheren Pilotierung wurde bei Adidas die Open-<br />
Innovation-Initiative (recht konsequent) auf dem bestehenden Angebot zur Produktindividualisierung<br />
aufgesetzt. In der Zukunft können aber weitere Innovationswettbewerbe<br />
auch in anderen Produktbereichen nach ähnlichem Schema stattfinden. 1<br />
1 Diese Fallstudie wurde von Dominik Walcher und <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> zu Illustrations- und<br />
Lehrzwecken erstellt und kann ein vereinfachtes oder modifiziertes Abbild der Wirklichkeit<br />
darstellen. Sie berichtet nicht wirklichkeitsgetreu über derzeitige und zukünftige Aktivitäten<br />
des dargestellten Unternehmens.<br />
257
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Unternehmensdarstellung<br />
Die Ursprünge der Adidas-Salomon AG gehen bis in das Jahr 1920 zurück, als Adi<br />
Dassler in einer Werkstatt in Herzogenaurach seinen ersten Leinen-Turnschuh fertigte.<br />
In den folgenden Jahren konzentrierte er sich auf die Herstellung von Spezialschuhen<br />
für die Sportarten Fußball und Leichtathletik, wobei er als Erster Schuhe mit Stollen<br />
und Dornen auf den Markt brachte. Bereits 1928 wurden Schuhe von Adi Dassler bei<br />
Olympischen Spielen getragen. 1937 umfasste das Sortiment über 30 verschiedene<br />
Modelle für insgesamt elf Sportarten. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Adi Dassler<br />
1948 mit 47 Mitarbeitern die Schuhproduktion wieder auf. Als Produktnamen wählte<br />
er die beiden ersten Silben seines Vor- und Zunamens. 1949 fand die offizielle<br />
Eintragung des Namens Adidas in das Handelsregister statt. Ebenso wurden im selben<br />
Jahr die drei Streifen als Markenzeichen angemeldet. Nach fast 70 Jahren schied die<br />
Familie Dassler 1989 aus dem Unternehmen aus. Im November 1995 ging das<br />
Unternehmen an die Börse und fusionierte zwei Jahre später mit der Salomon Gruppe<br />
zur Adidas-Salomon AG. Insgesamt umfasst das Portfolio des Unternehmens die<br />
Marken:<br />
Adidas (Sportschuhe, Sportbekleidung und Zubehör),<br />
Salomon (Skier, Bindungen, Inlineskates und Bergstiefel),<br />
TaylorMade (Golfschläger, Golfbälle und Zubehör),<br />
Mavic (Fahrradkomponenten) und<br />
Erima (Sporttextilien).<br />
Im Mai 2005 gab das Unternehmen den Verkauf der Sparte Salomon an den finnischen<br />
Sportartikelhersteller Amer Sports für 485 Mio. Euro bekannt und kündigte wenige<br />
Monate später den Kauf des amerikanischen Konkurrenten Reebok an. Mehr als 110<br />
eigene Tochterunternehmen, Joint Ventures und Lizenznehmer sorgen weltweit für die<br />
Distribution der Produkte in den fünf Regionen Europa/Naher Osten, Afrika,<br />
Nordamerika, Asien/Pazifik und Lateinamerika. Insgesamt arbeiten über 17.000<br />
Menschen für das Unternehmen.<br />
Verkaufte Adidas im Jahre 1990 mehr als 80 Mio. Schuhe und 150 Mio. Kleidungsstücke,<br />
so stieg diese Zahl im Jahre 2004 auf mehr als 110 Mio. Paar Schuhe an. Der<br />
Umsatz im Jahr 2004 betrug 6,5 Mrd. Euro mit einem Jahresüberschuss von 314 Mio.<br />
Euro. Das Unternehmen ist damit Europas größter Sportschuhhersteller. Mit der 3,1<br />
Mrd. Euro teuren Akquisition von Reebok kommt Adidas auf 28 Prozent des weltweiten<br />
Sportschuhmarkts, der ein Volumen von 11,5 Milliarden Dollar hat, und verringert<br />
seinen Abstand zum weltgrößten Sportschuhhersteller Nike, der einen Marktanteil von<br />
31 Prozent besitzt.<br />
Neben Adidas (einschließlich Reebok) wird der internationale Schuhmarkt von den<br />
Unternehmen Nike, Asics und Puma bestimmt. Allen Marken ist gemeinsam, dass sie<br />
die Schuhproduktion seit Jahren ins Ausland (meist Asien) verlagert haben. Die verbliebenen<br />
Kernkompetenzen der Unternehmen liegen in der Erkennung von<br />
Markttrends sowie der Entwicklung neuer Produkte. Mit dem Outsourcing der<br />
258
Produktion verfolgten die Unternehmen das Ziel, durch Kostenoptimierung auf die<br />
schwierige Marktsituation zu reagieren. So machen sich gerade im Schuhbereich einschneidende<br />
gesellschaftliche Veränderungen wie wachsende Individualisierungswünsche,<br />
Konsum-Hedonismus, Erlebnisorientierung und ein Trend zu Lifestyle-<br />
Produkten bemerkbar. Darüber hinaus setzen neue, modische Unternehmen etablierte<br />
Marken wie Adidas unter Druck. Außerdem verlangen immer mehr Konsumenten<br />
hochqualitative Schuhe für weniger Geld, wobei die Bindung der Kunden an ein<br />
Unternehmen stetig nachlässt.<br />
Die Reaktion der Schuhhersteller auf diese Kundenanforderungen lag innerhalb der<br />
letzten Jahre darin, die Zahl der angebotenen Varianten enorm zu erhöhen. Eine<br />
Variantenzunahme hat jedoch eine steigende Prognose- und Planungsunsicherheit zur<br />
Folge. Die Konsequenzen sind kostenintensive Lagerbestände, ein zunehmendes<br />
Moderisiko, eine hohe Komplexität in der Zulieferkette und immer höhere Discounts,<br />
um Überproduktionen abzuverkaufen. Dazu kommen verlorene Umsätze für Schuhe,<br />
die trotz großer Nachfrage nicht in ausreichenden Mengen oder richtigen Größen verfügbar<br />
sind. Die Adidas Führung reagierte Mitte der 1990er Jahre auf diese Situation<br />
mit dem Entschluss, mit Mass Customization eine neue Form der Wertschöpfung zu<br />
verfolgen, um sich den verschärften Marktanforderungen zu stellen.<br />
mi adidas<br />
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
Adidas startete im Jahr 2000, nach einer zweijährigen Vorbereitungsphase, das Mass-<br />
Customization-Projekt ‘mi adidas’. Zunächst wurde die Möglichkeit der<br />
Schuhindividualisierung nur für den Bereich Fußball und Laufen angeboten, eine<br />
Erweiterung des Angebots auf andere Sportarten wie etwa Tennis war aber von Anfang<br />
an geplant.<br />
Kasten 5–1: Die Konkurrenz: Mass Customization bei Nike<br />
Der weltweit größte Sportartikelhersteller Nike praktiziert schon seit Ende des Jahres 1999 eine<br />
Individualisierungsstrategie im Sportschuhbereich unter dem Namen NikeID. Über seine<br />
Internetseite bietet das Unternehmen unterschiedliche Modelle aus den Bereichen Laufen, Fußball<br />
und Basketball zur Online-Konfiguration durch den Kunden an. Die angebotenen Schuhe basieren<br />
dabei auf den normal erhältlichen Serienmodellen und können lediglich in der Farbgebung sowie<br />
durch einen eigenen Schriftzug vom Kunden individualisiert werden. Eine Visualisierung zeigt, wie<br />
der Schuh später aussehen wird. Hat sich der Kunde für eine Farbkombination und einen<br />
Schriftzug, der aus bis zu acht Zeichen bestehen kann, entschieden, kann er noch seine Schuhgröße<br />
angeben und die Bestellung mit der Eingabe seiner Lieferadresse abschließen. Etwa fünf<br />
Wochen später erfolgt die Auslieferung per UPS. Preislich liegt der an die Gestaltungswünsche<br />
des Kunden angepasste Schuh mit zusätzlichen $10 nur geringfügig über dem des Standardmodells.<br />
Im Vergleich zu Nike (Kasten 5–1) geht ‘mi adidas’ insichtlich Produktindividualisierung<br />
noch einen bedeutenden Schritt weiter: Der Kunde kann nicht nur zwischen<br />
verschiedenen Farbgestaltungen und Schriftzügen für den gewünschten Schuh wäh-<br />
259<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
len, sondern auch mit Hilfe von verschiedenen statischen und dynamischen<br />
Messsystemen die exakte Länge und Breite seiner Füße sowie die Besonderheiten seines<br />
Laufstils bestimmen lassen. Ein derartiger Service, bei dem auf die Wünsche des<br />
Kunden hinsichtlich Passform (fit), Funktion (performance) und Aussehen (design)<br />
eingegangen wird, war bislang nur professionellen Athleten vorbehalten.<br />
Die Schuhe werden zu einem Preis angeboten, der etwa 30 bis 50 Prozent über dem des<br />
Standardschuhs liegt. Die Erhebung der Individualisierungsinformationen erfolgt in<br />
den Verkaufsräumen von Sporthäusern an einem mobilen Konfigurationsterminal, der<br />
so genannten ‘mi adidas’ Unit. Diese Units samt Betreuungsteam können von<br />
Sporthändlern für einen Zeitraum von wenigen Tagen bis mehreren Wochen gebucht<br />
werden. Zusätzlich werden die Units auch bei Sportgroßereignissen wie beispielsweise<br />
Marathonläufen aufgebaut. Darüber hinaus plant Adidas die Zahl seiner Concept-<br />
Stores, zu deren Ausstattung eine fest installierte ‘mi adidas’ Unit gehört, weltweit auszubauen.<br />
Allen Terminals ist gemein, dass speziell ausgebildete Produkttrainer die kundenindividuellen<br />
Anforderungen erfassen. Die Termine, an denen eine Unit in einem<br />
Sportgeschäft aufgebaut wird, werden im Vorfeld auf der Adidas-Website und durch<br />
den Sporthändler bekannt gegeben. Das Terminal besteht aus einem statischen<br />
Präzisionsmessgerät, mit Hilfe dessen die Fußlängen und -breiten bestimmt werden,<br />
einer Sensormatte, dem so genannten Footscan-System, mit dem die dynamische<br />
Druckverteilung der Füße ermittelt wird, einem Laptop, der die Informationen sammelt<br />
und verarbeitet sowie einem Regalsystem mit mehreren hundert Probeschuhen.<br />
Die Erhebung der kundenindividuellen Daten wird in mehreren Schritten durchgeführt<br />
(Abbildung 5–1):<br />
Im ersten Schritt erfolgt die Erfassung der genauen Länge und Breite jedes Fußes.<br />
Dies geschieht mit dem Messsystem, auf das sich der Kunde zu Beginn des<br />
Konfigurationsprozesses nach Ausziehen seiner Schuhe stellen muss. Es hat sich<br />
gezeigt, dass bei der Mehrheit aller Kunden die Maße der beiden Füße nicht übereinstimmen.<br />
So wurden zum Teil Abweichungen von bis zu drei Zentimetern in der<br />
Länge gemessen, eine Tatsache, die wiederum das Anbieten individuell angepasster<br />
Schuhe noch sinnvoller erscheinen lässt.<br />
Im nächsten Schritte erfolgt die Untersuchung des Laufverhaltens. Hierzu wird der<br />
Kunde aufgefordert, mehrmals ohne Schuhe so über die Footscan-Matte zu laufen,<br />
wie es seinem gewöhnlichen Stil entspricht. Die durch das dynamische Messsystem<br />
ermittelte Druckverteilung der abrollenden Füße wird dem Produkttrainer am<br />
Computerbildschirm sofort visualisiert und er kann dem Kunden die<br />
Besonderheiten seines Laufstils erläutern.<br />
Anschließend erfolgt das Testen eines Probeschuhs. Ein wesentlicher Bestandteil<br />
der Unit sind die Regale mit den Probeschuhen. Nach Eingabe der Maße und<br />
Bestimmung des Laufverhaltens schlägt der Computer einen Schuh für jeden Fuß<br />
vor, welcher vom Produkttrainer dem Kunden zum Anprobieren zur Verfügung<br />
gestellt wird. Hier hat der Kunde die Möglichkeit, den vom System bestimmten<br />
Schuh auszuprobieren und Änderungswünsche zu äußern.<br />
260
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
Der nächste Schritt besteht aus der Auswahl des individuellen Schuhdesigns. Am<br />
Computerbildschirm wird ein ungestalteter, weißer Basis-Schuh dargestellt, der<br />
sich in alle Richtungen drehen und wenden lässt. Der Kunde kann nun verschiedene<br />
Bereiche des Schuhs wie beispielsweise Zunge, Oberleder, Streifen etc. auswählen<br />
und auf einer Farbpalette eine von 50 verschiedenen Farben wählen. Schließlich<br />
hat er die Möglichkeit. auf jeden Schuh ein Monogram mit maximal acht Zeichen<br />
(Buchstaben oder Zahlen) sticken zu lassen.<br />
Im letzten Schritt erfolgt die Erfassung der persönlichen Daten des Kunden; auch<br />
werden Zahlungs- und Auslieferungsmodalitäten besprochen. Alle erhobenen<br />
Konfigurationsdaten werden an die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach übermittelt,<br />
von wo sie zur Produktion nach Asien weitergeleitet werden.<br />
Abbildung 5–1: Der ‘mi adidas’-Konfigurationsprozess<br />
Nach etwa drei bis vier Wochen erfolgt die Lieferung der individualisierten Schuhe an<br />
den Sporthändler, in dessen Räumen die Konfiguration stattgefunden hat. War der<br />
Sporthändler im Vorfeld der ‘mi adidas’-Aktion für Werbemaßnahmen, Termin-<br />
261<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
vereinbarungen und das Entgegennehmen einer Anzahlung zuständig, so ist er nach<br />
Lieferung der Schuhe dafür verantwortlich, die Kunden zu benachrichtigen und den<br />
Restbetrag bei Abholung der Schuhe entgegenzunehmen. Sollten in der Nachkaufphase<br />
Fragen oder Beanstandungen auftreten, so wird als erstes der Sporthändler kontaktiert.<br />
Bei der ‘mi adidas’-Individualisierungsmethode handelt es sich wie beim NikeID-<br />
System um eine individuelle Modularisierung. Hierbei kann der Kunde aus einer fixen<br />
Anzahl von Modulen unterschiedlicher Ausprägung, die auf einem Basisprodukt aufbauen,<br />
wählen. Beim Laufschuh „Supernova“ erfolgt die kundenindividuelle<br />
Anpassung des Grundmodells beispielsweise durch die Kombination der fünf<br />
Komponenten (1) Länge, (2) Breite, (3) Stützsystem, (4) Farbgebung und frei wählbarer<br />
(5) Schriftzug. Bei der Länge werden 24 verschiedene Ausprägungen, so genannte<br />
Graduierungen, unterschieden, die jeweils um 4,23 Millimeter variieren. In der Breite<br />
hat der Kunde die Wahl zwischen vier Ausprägungen: schmal, mittel, weit und extraweit.<br />
Bezüglich des Laufverhaltens besteht im Falle einer festgestellten Überpronation,<br />
d. h. wenn der Läufer verstärkt über die Innenseite des Fußes abrollt, die Möglichkeit,<br />
ein zusätzliches Stützsystem einarbeiten zu lassen. Das Individualisierungskonzept<br />
von ‘mi adidas’ kann als ein so genanntes match-to-order-System bezeichnet werden.<br />
Die verschiedenen Ausprägungen der Module sind zum größten Teil bereits vorgefertigt.<br />
Sie werden also schon produziert, ohne dass ein spezieller Kundenauftrag vorliegt.<br />
Sobald der Auftrag eingeht, beginnt die Herstellung des Schuhs, indem die<br />
gewünschten Module kombiniert werden. Die Farbgebung und Erstellung der<br />
Stickereien erfolgt durch flexible Fertigungsverfahren. Es wird also nicht für jeden<br />
Kunden ein eigener Leisten entwickelt, wie es bei einer kundenindividuellen<br />
Einzelfertigung (made-to-order) der Fall wäre, sondern der Fuß eines Kunden wird<br />
einem vorhandenen Leisten zugeordnet. Insgesamt hat der Kunde pro Schuh die<br />
Auswahl aus über 192 Kombinationen für die individuellen Anforderungen an<br />
Passform (Fit) und Leistungsverhalten (performance). Addiert man die Möglichkeiten<br />
beim Design hinzu, sind schnell mehrere Millionen Kombinationen erreicht.<br />
Das Open-Innovation-Projekt mi-adidas-und-ich<br />
Dieses mi adidas System wurde ungeachtet einiger Start-Probleme von den Kunden<br />
gut angenommen und ist inzwischen im Unternehmen etabliert. Zwar ist ‘mi adidas’<br />
im Vergleich zu den anderen Produktgruppen noch ein recht kleines Programm (aus<br />
Sicht des Umsatzes), jedoch hat es im Unternehmen eine wichtige Vorreiterfunktion:<br />
Zunächst dient es als Aushängeschild der Marketingabteilung, um die Innovativität<br />
und Fortschrittlichkeit der Marke Adidas herauszustellen. Weiterhin gewinnt Adidas<br />
als Unternehmen durch die direkte Interaktion mit den Kunden wichtige Erfahrungen<br />
für eine kontinuierliche Verbesserung des Produktprogramms. ‘mi adidas’ hat sich<br />
aber vor allem auch als Experimentierplattform für das Unternehmen bewährt, wo<br />
weitergehende Aktivitäten getestet werden. Hierzu gehört ein Programm in Bereich<br />
Customer Relationship Management (CRM), aber auch der Ideenwettbewerb mi-adidas-und-ich,<br />
der im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen dieser Fallstudie steht.<br />
Die Entscheidung der Verantwortlichen, ein Open Innovation-Projekt durchzuführen,<br />
basiert im Wesentlichen auf drei Faktoren:<br />
262
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
1. Kundennähe: Spricht man mit Verantwortlichen bei Adidas, so gelangt man sehr<br />
schnell zu der Erkenntnis, dass es sich bei den zentralen Kunden des Unternehmens<br />
um Großabnehmer wie Karstadt, Footlocker etc. handelt. Das Unternehmen ist beinahe<br />
zu hundert Prozent im B2B-Markt tätig. Der Kontakt zu den Endkunden findet aus<br />
diesem Grund nur sehr begrenzt und fast ausschließlich über Intermediäre statt. Die<br />
kundenindividuellen Konfigurationen bei ‘mi adidas’ basieren jedoch auf der direkten<br />
Interaktion mit dem Konsumenten und stellen somit eine Prozessinnovation innerhalb<br />
des traditionellen Geschäftsmodells dar. Schon zu Beginn der Konzeption von ‘mi adidas’<br />
wurde aufgrund dieser – durch die Integration des Endkunden in den<br />
Leistungserstellungsprozess entstehenden – Kundennähe ebenfalls die Integration des<br />
Kunden in den Innovationsprozess als logische Konsequenz eingeplant.<br />
2. Ausbau der CRM-Aktivitäten: Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der<br />
Schuhmarkt von einem immensen Wettbewerbsdruck sowie einer stetig wachsenden<br />
Käufermacht beherrscht wird, sehen sich gerade die großen Hersteller gezwungen,<br />
trotz ihres traditionellen Schwerpunkts im B2B-Geschäft, verstärkt auf die Bedürfnisse<br />
der Endkonsumenten einzugehen und lang anhaltende Kundenbeziehungen aufzubauen.<br />
Der Ausbau von Aktivitäten innerhalb des Customer Relationship Managements<br />
(CRM) ist deshalb von hoher strategischer Wichtigkeit. CRM kann allgemein<br />
als bereichsübergreifende, meist IT-unterstützte Geschäftsstrategie definiert werden,<br />
die auf den systematischen Aufbau und die Pflege dauerhafter und profitabler<br />
Kundenbeziehungen abzielt. Die im Projekt vorgesehene Entwicklung einer internetbasierten<br />
Interaktionsplattform zur Gewinnung von Kundenfeedbacks stellt ein CRM-<br />
Tool par excellence dar, weshalb das Projekt von Anfang an die Zustimmung aller<br />
Verantwortlichen besaß und mit großem Interesse verfolgt wurde.<br />
3. Entwicklungspotenziale: Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei ‘mi adidas’ um<br />
eine relative junge Initiative handelt (Markteinführung in 2000), ergeben sich zahlreiche<br />
Bereiche, innerhalb derer Verbesserungen bestehender Prozesse sowie komplette<br />
Neuerungen einen echten Mehrwert darstellen und somit sehr willkommen sind. Das<br />
Durchführen eines Open-Innovation-Projekts ist somit nicht nur zum Aufbau von<br />
Kundenbeziehungen wichtig, sondern liefert darüber hinaus auch konkrete Vorschläge<br />
zur Optimierung des betrieblichen Leistungsangebots.<br />
Initiierung und Aufbau des Projektes<br />
Nach einer Abwägung verschiedener Alternativen wurde ein internetbasierter<br />
Ideenwettbewerb als die beste Methode zur Pilotierung einer Integration der Kunden<br />
in die Produktentwicklung ausgewählt. Die Entscheidung, den ‘mi adidas’-Geschäftsbereich<br />
zum Objekt der Innovation zu machen, erlaubt dabei eine weitere Besonderheit:<br />
Der Ideenwettbewerb konnte so gestaltet werden, dass kreative Beiträge zur<br />
Verbesserung bzw. Neuausrichtung des bestehenden Kaufvorgangs einschließlich der<br />
Nachkaufphase eingesendet werden konnten. Der Fokus lag somit auf Dienstleistungsund<br />
nicht auf Produktinnovationen. Gerade im Bereich der Gestaltung innovativer<br />
Dienstleistungen sieht Adidas für die Zukunft große Wachstumsfelder, zugleich ist<br />
hier aber relativ wenig internes Know-how vorhanden (im Vergleich zur technischen<br />
Produktentwicklung).<br />
263<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
mi-adidas-und-ich wurde im Juni 2004 offiziell gestartet und die ersten Kunden zur<br />
Teilnahme eingeladen. Während der Durchführung des Projektes wurde der letzte<br />
Schritt im Konfigurationsprozess durch die Aufklärung des Kunden über das Projekt<br />
ergänzt, wobei unter anderem ein Informationsblatt mit den wichtigsten Details ausgeteilt<br />
wurde. Grundsätzlich wurde dabei folgender organisatorischer Ablauf verfolgt:<br />
Mit dem Projektstart wurde der Kunde am Verkaufsterminal darauf hingewiesen,<br />
dass er in den nächsten Tagen via Email zur Teilnahme am Projekt eingeladen wird.<br />
Die Teilnahme war gemäß den Vorgaben der Adidas-Verantwortlichen ausschließlich<br />
für mi adidas-Kunden im deutschsprachigen Raum für den beschränkten<br />
Zeitraum von sechs Monaten vorgesehen.<br />
Hinsichtlich des Sportschuhtyps wurden keinen Einschränkungen gemacht, so<br />
dass sowohl Käufern von Laufschuhen als auch von Fußballschuhen teilnehmen<br />
konnten.<br />
Um nur den ‘mi adidas’-Kunden den Zugang zu der Plattform zu gewähren, wurden<br />
in der Einladungsmail die persönlichen Zugangsdaten übermittelt. Nahm der<br />
Kunde innerhalb von sieben Tagen nicht teil, so wurde eine einmalige<br />
Erinnerungsmail versandt.<br />
Die Preise für die von einer Adidas-internen Jury ermittelten drei besten Einsendungen<br />
bestanden aus einer Einladung nach Herzogenaurach mit Einkaufsgutscheinen<br />
im Wert von je 250,-€.<br />
Abbildung 5–2: Aufbau der Gestalte-Seite des Ideenwettbewerbs<br />
264
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
Hat sich der Kunde erfolgreich mit den in der Email enthaltenen Zugangsinformationen<br />
angemeldet, so gelangt er auf eine personalisierte Website, auf der er weitere<br />
Informationen zum Projekt erhält und wird schließlich zum Ideenwettbewerb weitergeleitet.<br />
Grundsätzlich ist der Ideenwettbewerb in zwei Bereiche geteilt:<br />
Zum einen gibt es den Bereich Gestalte, bei dem der Kunde seine kreativen<br />
Beiträge systematisch formulieren kann,<br />
zum anderen findet sich der Bereich Bewerte, bei dem der Kunde die Möglichkeit<br />
hat, die Ideen anderer Teilnehmer zu bewerten und fortzuführen.<br />
Die systematische Ideenformulierung im Gestalte-Bereich wird durch eine Visualisierung<br />
der wichtigsten Stationen des Kaufprozesses und Situationen der Nachkaufphase<br />
unterstützt. Abbildung 5–2 zeigt den Aufbau der Gestalte-Seite des<br />
Ideenwettbewerbs.<br />
Um die Ideen der Kunden zu strukturieren, werden zur jeder Phase des ‘mi adidas’-<br />
Interkationsprozesses stichwortartig einige ausgewählte Teilschritte genannt.<br />
Insgesamt werden der Kaufprozess und die Nachkaufphase in zwölf Einzelschritte<br />
aufgeteilt:<br />
Beim ersten Schritt Termin können Beiträge zu Gegebenheiten im Vorfeld des<br />
eigentlichen Kaufprozesses eingesendet werden. Ausgesuchte Stichworte hierzu<br />
sind ‘mi adidas’-Werbeaktivitäten, Websitegestaltung und Terminvereinbarungsmodalitäten.<br />
Gestaltung: Wahrnehmung des Geschäfts, Platzierung des Verkaufsterminals,<br />
Gestaltung des Terminals etc.<br />
Anmeldung: Wahrnehmung des Produkttrainers, Empfang, Wartezeit bis Vermessung,<br />
Registrierung etc.<br />
Scanning: Fußvermessung, Footscan etc.<br />
Fitting: Visualisierung der Fußformen, Erläuterung der Stützsysteme, Identifikation<br />
der Schuhe, Auswahl und Test der Probeschuhe etc.<br />
Design: Beratung am PC, Farbauswahl, Stickerei etc.<br />
Kaufabschluss: Bestellung, Mappe mit Zertifikat, Ende der Individualisierung,<br />
Anzahlung beim Händler etc.<br />
Produktion: Wartezeit, Benachrichtigung durch Händler etc.<br />
Auslieferung: Abholung und Begutachtung der Schuhe etc.<br />
Einsatz: Schuhe im Einsatz, Zufriedenheit mit den Schuhen, Probleme mit den<br />
Schuhen, Abnutzung der Schuhe etc.<br />
After Sale Services: Reorder, Newsletter, Hotline etc.<br />
Advanced Services. Bei diesem letzten Schritt hat der Kunde die Freiheit, weitergehende<br />
Vorschläge, die keiner anderen Situation zuzuordnen sind, einzusenden.<br />
265<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Mit Hilfe einer On-Mouse-Over-Funktion wird dem Kunden beim Überfahren der<br />
Bilder angezeigt, um welche Situation und Teilschritte es sich im Speziellen handelt.<br />
Nach Auswahl einer Station durch Anklicken des Bildes hat der Kunde die<br />
Möglichkeit, in ein Titelfeld eine passende Überschrift für seinen Beitrag zu schreiben<br />
und in einem darunter erscheinendem Freitextfeld seine kreativen Gedanken in beliebiger<br />
Länge auszuformulieren.<br />
Nach Absenden der Idee gelangt der Kunde zurück auf die Startseite, wo er eine weitere<br />
Idee eingeben oder im Bereich Bewerte die Ideen anderer Kunden beurteilen kann.<br />
Der Kunde hat die Möglichkeit, diese Beiträge anhand verschiedener Beurteilungsdimensionen<br />
zu bewerten. Darüber hinaus kann er den Beitrag durch Eintrag in ein<br />
Freitextfeld kommentieren oder fortsetzen. Ursprüngliche Idee, wie auch Bewertung<br />
und Kommentar, sind für alle anderen Kunden einsehbar.<br />
Die Durchführung des mi-adidas-und-ich Projekts stellte für adidas selbst eine radikale<br />
Prozessinnovation dar, die von zahlreichen Unsicherheiten begleitet war. Ziel des<br />
Projekts war es demgemäß, festzustellen, ob die Kunden sich überhaupt an dem<br />
Projekt beteiligen (Teilnahmeverhalten) und ob die beim Ideenwettbewerb eingesandten<br />
Beiträge überhaupt kreativ sind (Leistungsverhalten).<br />
Teilnahmeverhalten<br />
Innerhalb der sechsmonatigen Projektphase wurden an insgesamt 774 Kunden<br />
Einladungen zur Teilnahme versendet. Folgende Auflistung gibt eine Übersicht über<br />
die Beteiligungsquoten:<br />
Beim Ideenwettbewerb wurden insgesamt 103 Beiträge eingesendet, wobei sich<br />
zeigte, dass 82 Beiträge als sinnvoll bezeichnet werden können.<br />
Die 21 ausgeschlossenen Beiträge stellen mehr oder weniger ernst gemeinte<br />
Einträge dar, die vermutlich überwiegend zum Testen des Systems getätigt wurden.<br />
Die 82 verwertbaren Beiträge wurden von insgesamt 57 Personen verfasst. Dies<br />
beruht auf der Tatsche, dass einige Personen mehrere Beiträge eingesandt hatten.<br />
Jeweils eine Idee wurde von 38 Personen, jeweils zwei Ideen wurden von 15<br />
Personen und jeweils 3 Ideen wurden von 3 Personen eingesandt. Eine Person verfasste<br />
sogar fünf kreative Beiträge.<br />
Es zeigte sich, dass die Themen der Einsendungen über alle zwölf Stationen unterschiedlich<br />
verteilt waren: 7 Beiträge für Termin, 4 Beiträge für Gestaltung, 6 Beiträge<br />
für Anmeldung, 8 Beiträge für Scanning, 9 Beiträge für Fitting, 12 Beiträge für<br />
Design, 3 Beiträge für Abschluss, 9 Beiträge für Produktion, 6 Beiträge für Lieferung,<br />
2 Beiträge für Einsatz, 6 Beiträge für After Sale und 10 Beiträge für Advanced<br />
Services. Abbildung 5–3 gibt eine Übersicht der Verteilung der 82 Beiträge auf die<br />
zwölf Stationen:<br />
266
Leistungsverhalten<br />
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
Abbildung 5–3: Verteilung der Ideen auf die unterschiedlichen Phasen<br />
Anzahl Personen<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
7<br />
4<br />
6<br />
8<br />
9<br />
12<br />
Termin Anmeldung<br />
Gestaltung Scanning Fitting Design Abschluss Lieferung After Sale<br />
Produktion Einsatz Advanced<br />
Neben der reinen Feststellung der Beteiligungszahlen muss darüber hinaus auch die<br />
Qualität der eingesandten Ideen – also, ob die Beiträge überhaupt kreativ sind – überprüft<br />
werden. Hierzu bewerteten fünf Adidas-interne Experten die Beiträge an Hand<br />
der vier Dimensionen Originalität, Kundennutzen, Anzahl der Nutznießer und<br />
Ausarbeitungsgrad. Die Beurteilung erfolgte auf einer siebenstufigen Skala, wobei 0<br />
für keine Ausprägung und 6 für eine sehr hohe Ausprägung stand. Der Gesamtscore<br />
ergab sich durch Addition der Einzelscores. Aufgrund der Tatsache, dass fünf Experten<br />
bei vier Dimensionen Werte zwischen null und sechs verteilt hatten, ergab sich ein<br />
Maximalscore von 120 (= 5 Experten x 4 Bewertungsdimensionen x 6 max. Punkte) und<br />
ein Minimalscore von null. Auf Basis dieser Gesamtscores konnten alle 82 Beiträge in<br />
eine Reihenfolge gebracht werden. Da einige Teilnehmer mehrere Ideen eingesandt<br />
hatten, wurde beschlossen, jeweils nur den Beitrag mit dem höchsten Score zu verwenden,<br />
da dies der für die Untersuchung relevanten Maximalleistung des Kunden entsprach.<br />
So wurden die 57 Teilnehmer des ‘mi adidas’-Ideenwettbewerbs gemäß ihrer<br />
Kreativitätsleistung in eine finale Reihenfolge gebracht. Die Auswertung ergab einen<br />
Maximalscore von 107 und einen Minimalscore von 51.<br />
Zur Verdeutlichung wurden alle Einzelscores in Gruppen eingeteilt. Die Einteilung<br />
erfolgte in Fünferschritten, so dass zwölf Gruppen von 50-54 bis 105-109 entstanden. Es<br />
zeigte sich, dass die Scoreverteilung einer Normalverteilungskurve folgte. Anhand dieser<br />
Verteilung konnte eine übergeordnete Einteilung aller Beiträge in die Kategorien<br />
Kommentare, Verbesserungsvorschläge und neue Ideen vorgenommen werden. Es<br />
wurde festgelegt, die fünf von sehr geringer Kreativität geprägten Beiträge unterhalb<br />
der Scoremarke von 65 als Kommentare, die 46 Beiträge mit Leistungsscores zwischen<br />
3<br />
9<br />
6<br />
2<br />
6<br />
10<br />
267<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
65 und 100 als Verbesserungsvorschläge und die sechs Beiträge über der Scoremarke<br />
von 100 als neue Ideen zu bezeichnen (Abbildung 5–4).<br />
Abbildung 5–4: Verteilung des Kreativscores<br />
Number of Participants<br />
Bewertung<br />
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass ca. 10 Prozent der eingesandten Beiträge<br />
als völlig neue Ideen klassifiziert werden konnten, worüber die Adidas-<br />
Verantwortlichen sehr begeistert waren. Parallel zum Ideenwettbewerb wurden die<br />
Teilnehmer innerhalb einer Fragebogenaktion nach ihren Motiven und Eigenschaften<br />
befragt. Es zeigte sich, dass die Kunden der kreativen Spitzengruppe die Merkmale<br />
von Lead Usern aufweisen (Querverweis). Der internetbasierte Ideenwettbewerb ist<br />
demnach nicht nur eine geeignete Open Innovation-Methode zur Integration von<br />
Kunden in den Innovationsprozess (=Sammlung von Ideen), sondern kann vom<br />
Unternehmen auch zur Identifikation von Lead Usern eingesetzt werden. Konkret handelt<br />
es sich bei der Identifikation um eine Abfolge aus einem Selbst- und einem<br />
Fremdselektionsprozess (Abbildung 5–5):<br />
So nimmt nur ein Teil der Personen aus der angesprochenen Grundgesamtheit am<br />
Ideenwettbewerb überhaupt teil (=Teilnahmeselektion). Die Personen entscheiden<br />
eigenständig über ihre Teilnahme, was somit einer Selbstselektion entspricht.<br />
Zum anderen treten aus der Menge dieser Teilnehmer nur einzelne Kunden auf<br />
Grund ihrer besonderen Leistungen hervor (=Leistungsselektion). Diese Hochkreativen<br />
werden von einem Expertengremium ausgewählt, was einer Fremdselektion<br />
gleichkommt.<br />
268<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
1<br />
90% 8<br />
7<br />
7<br />
10%<br />
5<br />
5<br />
2 2<br />
4<br />
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115<br />
Comments (n=5) Improvements (n=46) New Ideas (n=6)<br />
10<br />
4<br />
2<br />
Score
Von Mass Customization zu Open Innovation bei der Adidas-Salomon AG<br />
Als Methoden der Lead User Identifikation wurden bereits das Screening und das<br />
Pyramiding beschrieben (Abschnitt 3.5.1). Aufbauend auf den Ergebnissen des mi-adidas-und-ich<br />
Projekts kann der Ideenwettbewerb mit seinem doppelten Selektionsprozess<br />
als weitere Methode angeführt werden.<br />
Abbildung 5–5: Der Ideenwettbewerb als Methode zur Identifikation von Lead Usern<br />
Beim Ideenwettbewerb findet ein doppelter Selktionsprozess statt. Zum einen nimmt nur ein Teil der Personen aus der<br />
angesprochenen Grundgesamtheit am Ideenwettbewerbteil überhaupt teil (=Selbstselektion). Zum anderen treten aus<br />
der Menge dieser Teilnehmer wiederum nur Einzelne auf Grund ihrer besonderen Leistungen hervor, was wiederum von<br />
einem Expertengremium ermittelt wird (=Fremdselektion).<br />
Teilnahmeselektion<br />
Ideenwettbewerb<br />
Leistungsselektion<br />
Fragen zur Diskussion der Fallstudie<br />
Führen Sie eine Internetrecherche durch und betrachten Sie weitere Angebote zu Mass<br />
Customization im Sportschuhbereich. Wodurch versuchen einzelne Anbieter, einen<br />
Differenzierungsvorteil zu bekommen? Entwickeln Sie eine Klassifikation zur Angrenzung der<br />
verschiedenen Angebote.<br />
Vor welchen besonderen Herausforderungen bei der Markteinführung und Etablierung steht<br />
Adidas mit seinem Produkt zur Individualisierung im Vergleich zu einem rein internetbasierten<br />
System? Welche Vorteile erwachsen aber auch aus dem Adidas-Ansatz?<br />
Welche Beziehungen sehen Sie zwischen ‘mi adidas’ und dem regulären Standard-Sortiment<br />
des Unternehmens? Diskutieren Sie die Vorteile und Gefahren einer engen Integration von ‘mi<br />
adidas’ mit dem Standardsortiment im Vergleich zu einer selbständigen organisatorischen<br />
Verankerung des Programms?<br />
Wie beurteilen Sie den mi-adidas-und-ich Wettbewerb? Welche Alternativen hätte es bei seiner<br />
Gestaltung gegeben? Wie kann Adidas eine Nutzen-Kosten-Abschätzung dieses Projektes<br />
vornehmen?<br />
Welche weiteren Ideenwettbewerbe kennen Sie? Wie können Sie diese klassifizieren?<br />
269<br />
5.1
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Adidas, um den Einbezug der Kunden in den<br />
Innovationsprozess weiter auszubauen? Welche weiteren Instrumente könnten zum Einsatz<br />
kommen?<br />
Was sind die Unterschiede des in der Fallstudie dargestellten Ansatzes zur Identifikation von<br />
Lead Usern im Vergleich zu anderen Methoden?<br />
5.2 Wikipedia als Beispiel einer interaktiven<br />
Wertschöpfung in Nutzer-Communities von<br />
Informationsgütern<br />
Wikipedia ist eine von freiwilligen Autoren verfasste, mehrsprachige, freie Online-<br />
Enzyklopädie. Der Begriff setzt sich aus „Encyclopedia“ und „Wiki“ zusammen, einer<br />
Software, mit der jeder Internetnutzer im Browser Artikel verbessern oder neu anlegen<br />
kann. Bestand hat, was von der Gemeinschaft akzeptiert wird. Bisher haben international<br />
etwa 100.000 angemeldete Benutzer und eine unbekannte Anzahl anonymer<br />
Mitarbeiter zum Projekt beigetragen, über 600 Autoren arbeiten regelmäßig an der<br />
deutschsprachigen Ausgabe mit.[1] 2 Das im Januar 2001 gegründete Projekt bezeichnet<br />
sich als freie Enzyklopädie, weil alle Inhalte unter der GNU-Lizenz für freie<br />
Dokumentation stehen, die jedermann das Recht einräumt, die Inhalte unentgeltlich –<br />
auch kommerziell – zu nutzen, zu verändern und zu verbreiten. Es gilt als die umfangreichste<br />
Sammlung originär freier Inhalte. Betrieben wird das Projekt von der<br />
Wikimedia Foundation, einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in Florida, USA<br />
Geschichte<br />
Die erste belegte Idee, das Internet zur kooperativen Erstellung einer Enzyklopädie zu<br />
verwenden, veröffentlichte Rick Gates am 22. Oktober 1993 im Usenet. Das als<br />
Interpedia diskutierte Projekt, wie auch die 1999 von Richard Stallman, einem der<br />
bekanntesten Vertreter der Freie-Software-Bewegung, angeregte GNUPedia kam über<br />
das Planungsstadium allerdings nicht hinaus (siehe: Vorgänger der Wikipedia). Im<br />
März 2000 startete der Internet-Unternehmer Jimmy Wales seinen Anlauf zu einer<br />
Internet-Enzyklopädie. Er engagierte über die Firma Bomis, deren Teilhaber und<br />
Geschäftsführer Wales damals war, den Philosophiedozenten Larry Sanger und rief<br />
mit ihm als Chefredakteur die Nupedia ins Leben. Der Redaktionsprozess des Projekts<br />
lehnte sich stark an den konventioneller Enzyklopädien an. Autoren mussten sich<br />
bewerben und ihre Texte anschließend einen langwierigen Peer-Review durchlaufen.<br />
Entsprechend langsam entwickelte sich das Projekt. Ende 2000/Anfang 2001 wurden<br />
sowohl Wales als auch Sanger auf das Wiki-Prinzip aufmerksam gemacht – angestoßen<br />
2 Dieser Text ist ohne inhaltliche Editierung der deutschen Version der Online Enzyklopädie<br />
Wikipedia entnommen, die sich hier sozusagen selbst beschreibt [de.wikipedia.org/wiki/<br />
Wikipedia]. Der Text wurde von mehr als 50 verschiedenen Autoren geschrieben oder bearbeitet.<br />
Eine sehr umfangreiche Diskussion gibt darüber hinaus Einblick in die Entstehungsgeschichte<br />
und kontroverse Bereiche dieses Beitrags [http://de.wikipedia.org / wiki /<br />
Diskussion:Wikipedia]).<br />
270
Wikipedia als Beispiel einer interaktiven Wertschöpfung in Nutzer-Communities<br />
durch Sanger ging daraufhin bereits am 10. Januar ein Wiki innerhalb des Nupedia-<br />
Projekts online; nur fünf Tage später, am 15. Januar 2001, war es dann unter der eigenständigen<br />
Adresse wikipedia.com erreichbar. Dies gilt als offizielle Geburtsstunde des<br />
Wikipedia-Projekts.[2]<br />
Ursprünglich sollte Wikipedia als Plattform zur gemeinsamen Erstellung von Artikeln<br />
dienen, die später den Redaktionsprozess der Nupedia durchlaufen sollten. Vor allem<br />
aufgrund seiner Offenheit – das Wiki-Prinzip gestattete die Mitarbeit ohne<br />
Registrierung – entwickelte sich das Projekt so rasant, dass diese Idee immer mehr in<br />
den Hintergrund trat. Am 15. März 2001 kündigte Jimmy Wales auf der<br />
Projektmailingliste an, Versionen auch in anderen Sprachen einzurichten, unter den<br />
ersten waren die französisch- und die deutschsprachige Wikipedia. Ende des Jahres<br />
2001 existierte Wikipedia bereits in 18 verschiedenen Sprachen. Im Februar 2002 entschied<br />
sich Bomis, nicht länger einen Chefredakteur zu beschäftigen und kündigte den<br />
Vertrag mit Larry Sanger. Dieser stellte kurze Zeit später seine Arbeit bei Nupedia und<br />
Wikipedia ein.<br />
Im Februar 2002 musste die Wikipedia erstmals einen spürbaren Rückschlag hinnehmen.<br />
Zahlreiche Autoren der spanischen Wikipedia entschlossen sich zu einem Fork.<br />
Abbildung 5–6: Ausschnitt aus der Hauptseite der deutschsprachigen Wikipedia (Februar<br />
2006)<br />
271<br />
5.2
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Die Gründe für die Abspaltung unter dem Namen Enciclopedia Libre waren Gerüchte<br />
über die mögliche Einblendung von Werbung innerhalb der Wikipedia und das<br />
Unbehagen über mangelnden Einfluss in der englischsprachig dominierten internationalen<br />
Projektkoordination. Um eine weitere Aufspaltung des Projekts zu verhindern,<br />
erklärte Jimmy Wales im gleichen Jahr, dass die Wikipedia auch künftig werbefrei bleiben<br />
solle. Außerdem änderte er die Adresse des Projekts von wikipedia.com auf wikipedia.org<br />
mit der für nicht-kommerzielle Organisationen gedachten Top Level Domain<br />
.org. Am 20. Juni 2003 schließlich verkündete Wales die Gründung der Wikimedia<br />
Foundation und übereignete der Non-Profit-Organisation die Server, auf denen die<br />
Projekte liefen, und die Namensrechte, die bis dato bei Bomis oder ihm persönlich<br />
lagen.<br />
Mittlerweile existiert das Projekt in mehr als 100 Sprachen. Im September 2004 überschritt<br />
der Umfang des Gesamtprojekts die Grenze von einer Million Artikeln. Die<br />
deutschsprachige Wikipedia enthielt im Februar 2006 über 350.000 Artikel, die englische<br />
über 970.000. Das Projekt gewann mehrere Preise, darunter im Mai 2004 einen Prix<br />
Ars Electronica und einen Webby Award, sowie den Grimme Online Award 2005.<br />
Funktionsweise<br />
Wikipedia ist ein Wiki, das heißt eine Website, bei der jeder Benutzer ohne Anmeldung<br />
Autor werden, Beiträge schreiben und bestehende Texte ändern kann. Eine Redaktion<br />
im engeren Sinne gibt es nicht, das Prinzip basiert vielmehr auf der Annahme, dass<br />
sich die Benutzer gegenseitig kontrollieren und korrigieren. Der Inhalt ist als<br />
Hypertext organisiert. Querverweise und Formatierungsanweisungen geben die<br />
Autoren in einer einfachen Syntax ein. So wandelt die Software in eckige Klammern<br />
gesetzte Begriffe ([[Beispiel]]) automatisch in einen Link auf den betreffenden Artikel<br />
um. Existiert dieser noch nicht, erscheint der Link in rot und beim Anklicken öffnet<br />
sich ein Eingabefeld, in dem der Leser einen neuen Artikel verfassen kann. Diese einfache<br />
Verlinkungsmöglichkeit hat dafür gesorgt, dass die Artikel der Wikipedia<br />
wesentlich dichter miteinander vernetzt sind als die der herkömmlichen digitalen<br />
Enzyklopädien. Neben den im Kontext angebrachten Hyperlinks auf andere Artikel<br />
existieren noch weitere Navigationsmöglichkeiten wie Kategorien oder der alphabetische<br />
Index, die jedoch eine untergeordnete Rolle spielen.<br />
Prinzipien<br />
Der vorgegebene Rahmen für die Autoren ist sehr weit gefasst. Die Initiatoren des<br />
Projektes haben nur sehr wenige Richtlinien aufgestellt, die als unumstößlich gelten.<br />
Dazu zählt als erster Grundsatz, dass Wikipedia der Schaffung einer Enzyklopädie<br />
gewidmet ist. Der Grundsatz des neutralen Standpunkts legt die inhaltliche<br />
Ausrichtung der Artikel fest. Die Autoren willigen ferner mit dem Speichern darin ein,<br />
ihre Beiträge unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (GFDL) zu veröffentlichen.<br />
Als Verhaltensvorschrift wird von Mitarbeitern am Projekt gefordert, ihre<br />
Mitautoren zu respektieren und niemanden persönlich anzugreifen.<br />
(1) Wikipedia ist eine Enzyklopädie: Wie andere Enzyklopädien verfolgt auch<br />
Wikipedia das Ziel, die Gesamtheit des Wissens unserer Zeit in lexikalischer Form<br />
anzubieten. Während frühere, gedruckte Enzyklopädien aus wirtschaftlichen und<br />
272
Wikipedia als Beispiel einer interaktiven Wertschöpfung in Nutzer-Communities<br />
technischen Gründen Inhalte und Autorenzahl beschränken mussten, unterliegt die<br />
Wikipedia keinen solchen Einschränkungen: Festplattenplatz ist billig, die Autoren<br />
arbeiten ehrenamtlich. Welche Themen aufgenommen werden und in welcher Form,<br />
entscheidet die Community in einem offenen Redaktionsprozess. Konflikte in der<br />
Wikipedia kreisen in diesem Zusammenhang meist darum, was Wissen darstellt, wo<br />
die Abgrenzung zu reinen Daten und gänzlich Irrelevantem liegt. Abgesehen von groben<br />
Leitlinien, die Wikipedia von anderen Werktypen wie Wörterbuch, Datenbank,<br />
Link- oder Zitatsammlung abgrenzen, gibt es keine allgemeinen Kriterienkataloge<br />
etwa für Biographien, wie sie in traditionellen Enzyklopädien gebräuchlich sind. Im<br />
Zweifel wird über den Einzelfall diskutiert. Empfindet ein Benutzer ein Thema als<br />
ungeeignet oder einen Artikel als dem Thema nicht angemessen, kann er einen so<br />
genannten Löschantrag stellen, der im Folgenden diskutiert wird.<br />
(2) Neutraler Standpunkt: In Wikipedia arbeiten Autoren mit unterschiedlichstem<br />
politischen, religiösen und weltanschaulichen Hintergrund mit, die offene<br />
Enzyklopädie schließt von vorneherein niemand aufgrund seiner Einstellungen aus.<br />
Um dabei unweigerlich aufkommende Kämpfe um Artikel zu verhindern bzw. einen<br />
Ausweg daraus zu schaffen, hat Gründer Jimmy Wales die Richtlinie des neutralen<br />
Standpunkts (NPOV, von englisch neutral point of view) aufgestellt. Danach soll ein<br />
Artikel so geschrieben sein, dass möglichst viele Autoren ihm zustimmen können.<br />
Existieren zu einem Thema mehrere verschiedene Ansichten, so soll sie ein Artikel fair<br />
beschreiben, aber nicht selbst Position beziehen. Der neutrale Standpunkt verlangt<br />
jedoch nicht, dass alle Ansichten gleichwertig präsentiert werden müssen: Die wissenschaftlich<br />
plausiblere Ansicht kann etwa an erster Stelle genannt werden (siehe auch:<br />
Ockhams Rasiermesser). Wie die Eignung einzelner Artikel für eine Enzyklopädie<br />
wird auch die Einhaltung des neutralen Standpunkts durch den sozialen Prozess<br />
gewährleistet und gerade bei kontroversen Themen oft nur in mühevollen<br />
Diskussionen erreicht.<br />
(3) Urheberrecht und Freiheit der Inhalte: Alle Mitarbeiter der Wikipedia erklären<br />
sich mit dem Einstellen oder Bearbeiten von Artikeln damit einverstanden, von ihnen<br />
beigetragene Inhalte unter der GFDL zu veröffentlichen. Diese Lizenz erlaubt es anderen,<br />
die Inhalte nach Belieben zu ändern und auch kommerziell zu verbreiten, sofern<br />
die Bedingungen der Lizenz eingehalten werden und die Inhalte wieder unter der gleichen<br />
Lizenz veröffentlich werden. Die Lizenz macht es damit unmöglich, Wikipedia-<br />
Artikel und auf diesen basierende Texte unter Berufung auf das Urheberrecht exklusiv<br />
zu verwerten (Copyleft-Prinzip). Für viele Autoren ist dieses aus der Freie Software-<br />
Bewegung bekannte Prinzip ein wesentlicher Grund, bei der Wikipedia mitzuarbeiten.<br />
Die Lizenz schreibt ebenfalls vor, Hauptautoren von Artikeln bei Veröffentlichungen<br />
außerhalb der Wikipedia zu nennen. Einige engagierte Autoren, die nicht anonym<br />
arbeiten, werden dadurch zusätzlich motiviert.<br />
(4) Respektvoller Umgang: Auch wenn diese Richtlinie als unnötig angesehen werden<br />
kann, da der respektvolle Umgang mit anderen Menschen als Selbstverständlichkeit<br />
gelten sollte, zeigt die Realität doch, dass diese Richtlinie ihre Existenzberechtigung<br />
hat. Besonders die Offenheit des Projektes und der damit verbundene unkontrollierte<br />
Zustrom neuer Autoren, die rein schriftliche Kommunikation sowie die unterschiedli-<br />
273<br />
5.2
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
che soziale und kulturelle Herkunft der aktiven Benutzer machen es notwendig, sich<br />
von Zeit zu Zeit an diese Richtlinie zu erinnern.<br />
Organisation<br />
Aufbau der Wikipedia: Sowohl die Interpretation der oben aufgeführten Grundsätze<br />
als auch weitere Vorgaben werden von der Gemeinschaft der Autoren festgelegt und<br />
beruhen vor allem auf sozialen Protokollen. Der Betreiber des Projekts, die Wikimedia<br />
Foundation, mischt sich in aller Regel nicht in diesen Prozess ein und vertraut stattdessen<br />
auf die Selbstorganisation der Gemeinschaft. Organisatorisch gliedert sich die<br />
Wikipedia in drei Bereiche, durch Präfixe im Seitennamen unterschiedene so genannte<br />
Namensräume: die eigentliche Enzyklopädie mit den angeschlossenen<br />
Diskussionsseiten, wo an den Artikeln gearbeitet wird, den Benutzernamensraum, in<br />
dem jeder Autor eine persönliche Seite erhält, auf der er sich vorstellen kann, und eine<br />
Nachrichtenseite, auf der andere mit ihm Kontakt aufnehmen können, und dem<br />
Wikipedia-Namensraum zur Verwaltung des Projekts. Im Wikipedia-Namensraum<br />
finden sich Einführungstexte und das Software-Handbuch, Stilregeln und<br />
Formatkonventionen. Dort entscheidet die Autorengemeinschaft, welche Artikel<br />
gelöscht werden, kürt in einem Review-Prozess besonders gute Beiträge zu exzellenten<br />
Artikeln, die auf der Hauptseite vorgestellt werden, und wählt Administratoren, die<br />
erweiterte Software-Funktionen erhalten.<br />
Entscheidungsfindung und Organisationsstruktur: Die Einflussstruktur der<br />
Wikipedia ist komplex und erschließt sich in der Regel erst nach längerer aktiver<br />
Teilnahme am Projekt. Sie vereint Züge von Anarchie, Meritokratie, Demokratie,<br />
Autokratie und Technokratie. Der anarchische Charakter folgt aus dem Wiki-Prinzip,<br />
nach dem jeder, auch anonym, Seiten ändern kann. Soziale Konventionen und größtenteils<br />
informelle Organisationsprozesse erhalten eine interne Organisationsstruktur aufrecht.<br />
Angemeldete Teilnehmer können sich mit ihren Beiträgen in der Community<br />
einen Ruf und Vertrauen erwerben. Neben der Überzeugungskraft ihrer Argumente<br />
bemisst sich danach auch der Einfluss, den Teilnehmer auf laufende Diskussionen<br />
haben. Formalisiert wird der Prozess durch die Ernennung von Administratoren.<br />
Besonders engagierte Teilnehmer wählt oder bestimmt die Autorengemeinschaft zu<br />
Administratoren mit erweiterten Rechten. Bei Entscheidungen über Regeln wird in<br />
Wikipedia traditionell versucht, einen Konsens zu finden. Praktisch ist ein echter<br />
Konsens bei der Vielzahl der Mitarbeiter kaum möglich. Regeln, die über eine ausreichende<br />
Legitimität verfügen sollen, müssen von einer großen qualifizierten Mehrheit<br />
der Benutzer getragen werden. Die meisten Regeln und Prozesse etablieren sich so in<br />
der Praxis dadurch, dass viele Teilnehmer einen Vorschlag aufgreifen und anwenden.<br />
Andere Entscheidungen werden in Meinungsbildern getroffen, die zwischen<br />
Diskussion und Abstimmung anzusiedeln sind.<br />
Die Entwicklung der Software, etwa den Einbau neuer Features, bestimmt das von der<br />
Community unabhängige Team der Programmierer, das sich aber an den Wünschen<br />
der Nutzer orientiert. Den größten persönlichen Einfluss – vor allem in der englischen<br />
Wikipedia, aber auch in manch anderen Sprachversionen – hat der Gründer Jimmy<br />
Wales, der in seiner Rolle als „Benevolent dictator“ lange Zeit Konflikte in der<br />
Community als oberste Autorität schlichtete. Einen Teil seiner Aufgaben übertrug er<br />
274
Wikipedia als Beispiel einer interaktiven Wertschöpfung in Nutzer-Communities<br />
Anfang 2004 in der englischen Wikipedia an ein von den Teilnehmern gewähltes<br />
„Arbitration committee“. Eine diesem Schiedsgericht vergleichbare Institution in anderen<br />
Sprachversionen existiert bis jetzt nur in der französischen Wikipedia. Die<br />
Oberhoheit über Wikipedia hat schließlich die Wikimedia Foundation als<br />
Betreiberorganisation und Finanzier.<br />
Internationale Zusammenarbeit: Obwohl anfangs nicht geplant, entwickelte sich<br />
Wikipedia zu einem mehrsprachigen Projekt. Sobald sich genug Interessierte finden,<br />
wird für eine Sprache ein Wiki angelegt. Über die Grenzziehung zwischen Sprache<br />
und Dialekt entstehen in der Community oft heftige Kontroversen. Die Artikel der<br />
durch Interwiki-Links miteinander verknüpften Sprachversionen sind selten übersetzt,<br />
sondern entstehen meist separat. Bedingt durch die Sprachbarriere, besteht zwischen<br />
den Sprachen in der Regel wenig Austausch, die Communitys organisieren und entwickeln<br />
sich unabhängig voneinander. Einzelne Projekte wie die „Übersetzung der<br />
Woche“ versuchen diese Barriere zu überwinden und für mehr Austausch zu sorgen.<br />
Besonders die Gründung von Wikimedia Commons sorgte für einen Aufschwung in<br />
der internationalen Zusammenarbeit. Auf den mehrsprachig angelegten Commons<br />
arbeiten Wikipedia-Teilnehmer aus allen Sprachversionen am Aufbau eines zentralen<br />
Medien-Repository.<br />
Finanzierung: Die Finanzierung der technischen Infrastruktur und des übertragenen<br />
Datenvolumens, der Miete für Rechenzentren, Domainregistrierung sowie der<br />
Förderung von spezifischen Software-Entwicklungsaufgaben und gelegentlich auch<br />
von Reisekosten erfolgt vollständig durch Spenden.<br />
Kritik und Probleme<br />
Qualität und Verlässlichkeit der Inhalte: Der am häufigsten angeführte Kritikpunkt<br />
an der Wikipedia ist, dass jeder Internetnutzer Artikel verändern kann. Während herkömmliche<br />
Enzyklopädien mit bezahlten Experten und redaktioneller Kontrolle für<br />
die Einhaltung von Qualitätsstandards bürgen, bietet Wikipedia keine Gewähr für die<br />
Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Artikel. Das prominenteste Beispiel eines Hoax-<br />
Eintrags war der Fall des amerikanischen Journalisten John Seigenthaler, dessen falsche<br />
Biographie, in der der Kennedy-Berater u. a. der Verwicklung in den Mordfall<br />
Kennedy verdächtigt wurde, erst nach mehreren Monaten von Seigenthaler selbst entdeckt<br />
und anschließend im November 2005 auf seine Beschwerde hin sofort gelöscht<br />
wurde [3]. Der anonyme Autor bekannte später gegenüber der amerikanischen<br />
Zeitung USA Today, er habe nur einen Scherz gegenüber einem Arbeitskollegen<br />
machen wollen.<br />
Die Betreiber der Wikipedia stellen sich auf den Standpunkt, dass aufgrund der<br />
Einfachheit, Änderungen vorzunehmen, die Hemmschwelle sinkt, Fehler zu korrigieren.<br />
Nach ihrer Ansicht reifen die Artikel somit, da Fehler nach einiger Zeit gefunden<br />
und behoben werden. Durch die Fähigkeit der Software, zu jedem Artikel dessen<br />
Versionsgeschichte aufzurufen und Querverweisen zu folgen, können Leser und<br />
Autoren den Werdegang eines Artikels verfolgen und sich damit ein umfassenderes<br />
Bild machen. Ebenso kann zu jedem Artikel eine Diskussionsseite abgerufen werden,<br />
die nicht in den Artikeltext gehörende Anmerkungen enthält. Die Annahme der<br />
275<br />
5.2
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Betreiber von Wikipedia ist, dass Leser das Gelesene hinterfragen und diese Angebote<br />
annehmen. Anders als in herkömmlichen Enzyklopädien sagen Länge und Umfang<br />
eines Artikels in Wikipedia nichts über seine Bedeutung aus. Während viele Popkulturoder<br />
Computer-Themen in aller Breite dargestellt sind, kann es passieren, dass<br />
Wikipedia zu einem zentralen Begriff der Philosophie nur einen mageren, extrem kurzen<br />
Eintrag enthält. Ein weiteres Problem stellen Interessengruppen dar, die versuchen,<br />
Artikelinhalte in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Artikel zu umstrittenen<br />
Themen wie Sekten oder obskuren esoterischen Theorien entsprechen deshalb oft<br />
nicht dem Neutralitätsgrundsatz. Um besonders umstrittene Artikel zu schützen, ist es<br />
Administratoren jedoch auch möglich, diese vorübergehend für Bearbeitungen zu<br />
sperren.<br />
Urheberrechtsverletzungen: Die offene Natur eines Wiki bietet zunächst keinen<br />
Schutz gegen Urheberrechts- und andere Rechtsverletzungen. Ergibt sich ein Verdacht,<br />
so prüfen aktive Nutzer deshalb neue Artikel darauf, ob sie von anderen Websites<br />
kopiert wurden. Wenn sich der Verdacht bestätigt, werden diese von den<br />
Administratoren nach einer Einspruchsfrist gelöscht. Hundertprozentige Sicherheit<br />
bietet dieses Verfahren jedoch nicht. Der größte bekannte Fall einer Urheberrechtsverletzung<br />
wurde im November 2005 von Mitarbeitern der deutschen Wikipedia entdeckt.<br />
Ein anonymer Autor hatte über zwei Jahre hinweg Beiträge aus Büchern kopiert.<br />
Vor allem hat er dazu alte DDR-Lexika benutzt. Besonders die Abteilung Philosophie,<br />
Wirtschaft und Geschichte waren davon betroffen. Über 1000 Artikel wurden zuerst<br />
unter Quarantäne gestellt und viele davon gelöscht, nachdem sie sich als direkte<br />
Kopien herausstellten. Umgekehrt sind allerdings auch schon einige Fälle bekannt<br />
geworden, in denen Urheberechte der Wikipedia verletzt wurden, häufig, indem<br />
Beiträge ohne Quellenangaben aus Wikipedia kopiert und in fremde Webseiten eingearbeitet<br />
werden.<br />
Wikipedia im Vergleich zu anderen Enzyklopädien<br />
Der erste groß angelegte Vergleich der deutschen Wikipedia mit etablierten digitalen<br />
Nachschlagewerken Microsoft Encarta Professional 2005 und Brockhaus multimedial<br />
2005 Premium erschien im Oktober 2004 in der Computer-Fachzeitschrift c’t (Ausgabe<br />
21 / 04). Wikipedia erzielte dort im Inhaltstest die höchste durchschnittliche Gesamtpunktzahl,<br />
in der Kategorie Multimedia schnitt die freie Enzyklopädie dagegen<br />
schlecht ab, ähnliche Wertungen erzielte die deutsche Wikipedia kurz darauf in einem<br />
Lexikavergleich der Wochenzeitung Die Zeit. Beide Tests basierten auf einer kleinen<br />
Stichprobe von insgesamt 60 bis 70 Artikeln aus verschiedenen Themengebieten.<br />
Dezember 2005 veröffentlichte die Zeitschrift Nature einen Vergleich der englischen<br />
Wikipedia mit der Encyclopædia Britannica [4]. Dazu hatten sie 50 Experten gebeten,<br />
je einen Artikel aus beiden Werken aus ihrem Fachgebiet ausschließlich auf Fehler zu<br />
prüfen. Mit durchschnittlich vier Fehlern pro Artikel lag die Wikipedia nur knapp hinter<br />
der Britannica, in der im Durchschnitt drei Fehler gefunden wurden.<br />
Verbreitung der Wikipedia-Inhalte<br />
Zahlreiche Websites nehmen das Angebot der freien Lizenz wahr und spiegeln<br />
Wikipedia-Inhalte, einige verdienen dabei an der Einblendung von Anzeigen. Daneben<br />
276
entstanden auch mehrere Versionen für PDA. In der Verbreitung offline spielte die<br />
deutschsprachige Wikipedia eine Vorreiterrolle. Mehrere deutsche Wikipedianer stellten<br />
WikiReader zusammen, Artikelsammlungen zu einem Thema, von denen einige in<br />
kleinen Auflagen auch gedruckt erschienen. Im Herbst 2004 veröffentlichte der Berliner<br />
Verlag Directmedia Publishing in Zusammenarbeit mit der Wikipedia-Community<br />
eine CD-Version der Wikipedia, im Frühjahr 2005 folgte eine DVD-Ausgabe, die beide<br />
auch frei im Netz zum Download bereitgestellt wurden. Außerdem ist eine Buchreihe<br />
in Arbeit.<br />
Wissenschaftliche Analyse<br />
Der Erfolg des offenen Enzyklopädiekonzepts weckte das Interesse vieler Forscher;<br />
einen Überblick publizierter Arbeiten gibt die unten verlinkte Bibliographie. Im Projekt<br />
Historyflow analysierte und visualisierte ein Forscherteam von IBM 2003 die Evolution<br />
von Artikeln. Martin Wattenberg und Fernanda B. Viégas stellten dabei fest, dass die<br />
Community Vandalismus erstaunlich schnell, manchmal schon nach drei Minuten,<br />
beseitigte.<br />
Zur Sozialstruktur der Wikipedia-Autoren existieren noch wenige Untersuchungen.<br />
Eine Umfrage Würzburger Psychologen ergab einen hohen Männeranteil (88 Prozent)<br />
und etwa 50 Prozent Singles. 43 Prozent der Befragten arbeiten Vollzeit. Eine große<br />
Gruppe bilden Studenten. Zu ihrer Motivation befragt, bewerteten über 80 Prozent die<br />
Erweiterung des eigenen Wissens als wichtig bis sehr wichtig. In einer Analyse des<br />
Partizipationsverhaltens angemeldeter Teilnehmer stellte Jimmy Wales fest, dass die<br />
Hälfte aller Beiträge von gerade einmal 2,5 Prozent der Nutzer stammte. Wales stützte<br />
damit seine These von der Wikipedia als „community of thoughtful users“, die er einer<br />
Beschreibung der Wikipedia als emergentem Phänomen gegenüberstellte, in dem sich<br />
aus den Beiträgen einer Vielzahl anonymer Internetnutzer eher spontan eine<br />
Enzyklopädie herausbilde.<br />
Schwesterprojekte<br />
Da sich die Wikipedia selbst auf enzyklopädische Artikel beschränkt, sind inzwischen<br />
Ableger entstanden, die sich anderer Textsorten annehmen. Ein wichtiger Ableger ist<br />
Wiktionary, ein Projekt, das das Wiki-Konzept auf Wörterbücher anwendet. Im Juli<br />
2003 wurde mit dem Ziel, freie Lehrbücher zu erstellen, das Wikibooks-Projekt begonnen.<br />
Das Projekt Wikiquote sammelt Zitate, Wikisource ist eine Sammlung freier<br />
Originalquellen. Aus der Community entwickelte sich im Frühjahr 2004 auch ein satirischer<br />
Ableger der Wikipedia, die Kamelopedia. Seit September 2004 gibt es mit den<br />
Wikimedia Commons ein Projekt, das Bilder und andere Medien für alle Wikimedia-<br />
Projekte gemeinsam zugänglich macht. Ein weiteres Schwesterprojekt, Wikinews, das<br />
sich dem Aufbau einer freien Nachrichtenquelle widmet, wurde Anfang November<br />
2004 ins Leben gerufen. Bis auf die Kamelopedia werden alle diese Projekte von der<br />
Wikimedia Foundation betrieben.<br />
Technik<br />
Wikipedia als Beispiel einer interaktiven Wertschöpfung in Nutzer-Communities<br />
Anfangs verwendete Wikipedia als Software das in Perl geschriebene UseModWiki,<br />
das sich jedoch bald den Anforderungen nicht gewachsen zeigte. Im Januar 2002 stell-<br />
277<br />
5.2
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
te Wikipedia auf eine vom deutschen Biologen Magnus Manske geschriebene, MySQLbasierte<br />
PHP-Applikation (Phase II) um, die speziell an die Bedürfnisse der Wikipedia<br />
angepasst war. Nachdem das Projekt sich über ein Jahr die Ressourcen mit dem<br />
Webangebot von Bomis geteilt hatte, zog die englische Wikipedia, später auch die<br />
anderen Sprachversionen, im Juli 2002 auf einen eigenen Server mit einer von Lee<br />
Daniel Crocker überarbeiteten und teils neugeschriebenen Version von Manskes<br />
Software (Phase III) um. Diese erhielt später den Namen MediaWiki.<br />
Abbildung 5–7: Diagramm der Wikimedia-Server-Architektur vom 12. April 2005<br />
Mit steigenden Zugriffszahlen erhöhten sich die Anforderungen an die Hardware.<br />
Waren es im Dezember 2003 noch drei Server, sind zum Betrieb der Wikipedia und<br />
ihrer Schwesterprojekte im Mai 2005 mittlerweile über 70 Server in Florida und<br />
<strong>Frank</strong>reich im Einsatz, die von einem Team ehrenamtlicher Administratoren betreut<br />
werden. Das Prinzip, die Server nach berühmten Enzyklopädisten zu benennen, wurde<br />
2005 aufgegeben. Als Betriebssystem werden verschiedene Linux-Distributionen, überwiegend<br />
Fedora, mit der Server-Software Apache, PHP und der Datenbank MySQL<br />
278<br />
srv5<br />
Internet<br />
browne<br />
srv6<br />
wikimedia<br />
content<br />
srv7<br />
will<br />
squid<br />
cach<br />
albert<br />
NFS Storage<br />
Server<br />
isidore<br />
srv8<br />
srv9<br />
multimedia<br />
files<br />
HTML<br />
email<br />
database dumps<br />
bleuenn<br />
chloe ennael<br />
squid<br />
(France)<br />
srv10<br />
dalembert<br />
multimedia<br />
files<br />
tingxi<br />
load<br />
balancer<br />
apach<br />
web server<br />
zwinger<br />
email<br />
server<br />
avicenna vincent<br />
search<br />
server<br />
search<br />
update<br />
index<br />
database<br />
dumps<br />
ariel<br />
database<br />
slaves<br />
bacon<br />
suda<br />
webster<br />
holbach<br />
master<br />
database<br />
wikitext<br />
2005-04-12
eingesetzt. Vorgeschaltete Squid-Caches versorgen nicht angemeldete Besucher, die<br />
nur lesen wollen, mit vorgenerierten Seiten. Die MySQL-Datenbank läuft auf mehreren<br />
Servern mit Replikation im Master-Slave-Betrieb. Regelmäßig kommt es zu Kapazitätsengpässen,<br />
die dazu führen, dass Seiten nur sehr langsam oder gar nicht geladen<br />
werden. Mehrere Unternehmen und Organisationen boten der Wikimedia Foundation<br />
ihre Unterstützung an. Im April 2005 erklärte sich der Suchmaschinenbetreiber<br />
Yahoo! bereit, 23 Server in seinem Rechenzentrum in Asien für den Betrieb der<br />
Wikipedia abzustellen. Mit Google steht die Wikimedia Foundation ebenfalls in<br />
Verhandlungen.<br />
Referenzen<br />
Mass Customization in der Reisebranche<br />
[1] Erik Zachte: Wikipedia-Statistik, erzeugt am 25. Dezember 2005 aus dem SQL-Dump vom 10.<br />
Dezember 2005<br />
[2] Larry Sanger: E-Mails an die Mailingliste nupedia-l: Let’s make a wiki (10. Januar 2001),<br />
Nupedia’s wiki: try it out (10. Januar 2001), Nupedia’s wiki: try it out (11. Januar 2001; Name<br />
Wikipedia), Wikipedia is up! (17. Januar 2001)<br />
[3] John Seigenthaler: A false Wikipedia „biography“ USA Today, 29.11.2005<br />
[4] Jim Jiles: Internet encyclopaedias go head to head, Nature 14.12.2005<br />
[5] Henriette Fiebig (Hrsg.): Wikipedia – Das Buch. Directmedia Publishing 2005<br />
Fragen zur Diskussion der Fallstudie<br />
Diskutieren Sie am Beispiel Wikipedia, welche Grundprinzipien der interaktiven<br />
Wertschöpfung Sie an diesem Beispiel sehen können. Warum ist dieses Projekt so erfolgreich?<br />
Welche Hürden werden den weiteren Erfolg von Wikipedia behindern? Welche Maßnahmen<br />
kann welcher Akteur dagegen ergreifen?<br />
In welche anderen Bereiche lässt sich das Beispiel Wikipedia gut übertragen? Welche<br />
Modifikationen sind hierzu noch notwendig? Überlegen Sie auch in Hinblick auf eine<br />
Produktion materieller Güter.<br />
5.3 Mass Customization in der Reisebranche –<br />
kundenindividuelles Reisen mit Dynamic<br />
Packaging<br />
Die Reisebranche hat im letzten Jahrzehnt einen nachhaltigen Wandel erfahren.<br />
Konnten Reiseveranstalter und Reiseagenturen in den 1990er Jahren noch gut davon<br />
leben, verschiedene Reiseleistungen (Hotel, Flug etc.) als pauschal geschnürtes Paket<br />
im Reisebüro anzubieten, so hat sich das Kundenverhalten mit aufkommender<br />
Beliebtheit des Internet drastisch verändert. Neue Online-Reiseagenturen, die so<br />
genannten „Reiseportale“, erfreuten sich immer größerer Beliebtheit und offerierten<br />
eine Angebotsvielfalt, mit der ein konventionelles Reisebüro kaum noch konkurrieren<br />
279<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
kann. Die klassische Pauschalreise verliert dagegen immer mehr zugunsten einer<br />
Individualreise an Bedeutung. Damit wird der Mass-Customization-Gedanke auch in<br />
dieser Branche immer aktueller und eine Orientierung des Reiseangebotes an den individuellen<br />
Kundenbedürfnissen erscheint sinnvoll. Die vorliegende Branchenanalyse<br />
untersucht die gegenwärtige Marktdurchdringung und die zukünftigen Erfolgsaussichten<br />
des so genannten „Dynamic Packaging“, d. h. des kundenindividuellen Angebots<br />
von Touristikdienstleistungen für einen (relativ) großen Absatzmarkt. Zu den<br />
„Best-Practice“-Beispielen der Branche können die Angebote der Online-Reiseagenturen<br />
expedia.de (Deutschland) und lastminute.com (England) gezählt werden. Aber<br />
auch kleine Unternehmen wie die Münchner Jacana Tours GmbH bieten erfolgreich<br />
kundenindividuelle Reisen an, konzentrieren sich jedoch häufig auf einen kleineren<br />
Absatzmarkt. Im Fall von Jacana Tours ist das Angebot auf Individualreisen nach<br />
Afrika beschränkt. Die Konzepte der Anbieter expedia.de (lastminute.com bietet ein<br />
identisches Angebot an) und Jacana Tours werden in dieser Fallstudie genauer erläutert,<br />
da sie gewisse Extrempunkte auf dem Mass-Customization-Spektrum der<br />
Reisebranche darstellen. Die Analyse zeigt, wie beide Unternehmensklassen ihr<br />
Angebot weiter verbessern könnten: expedia.de durch ein höheres Maß an<br />
Kundenorientierung und Flexibilität, Jacana Tours durch effizientere Prozesse. Der<br />
Beitrag zeigt so, welche Möglichkeiten Mass Customization für Reiseveranstalter der<br />
unterschiedlichsten Größenklassen bietet. 3<br />
Branchenumfeld<br />
Bereits um 770 v. Chr. verleitete der Beginn der Olympischen Spiele Menschen zu<br />
einem Ortswechsel. Der Grieche Herodot (480 bis 421 v. Chr.) war einer der Ersten, der<br />
sich zum Entdecken neuer Sitten und Gebräuche auf eine Bildungsreise begab. Er<br />
unternahm Fahrten zu Heilzwecken ebenso wie Wallfahrten zu den Göttertempeln –<br />
ein wesentliches Reisemotiv im Mittelalter. Reisen zur Erholung und zum Vergnügen<br />
unternahm man auch im alten Rom. Der Ausbau des Straßennetzes zu militärischen<br />
Zwecken förderte die Reiselust und die Vorlieben für ferne Thermalquellen und Bäder<br />
(Badeverkehr). Erst mit der Zeit der Kreuzzüge und Pilgerfahrten wurde das Reisen<br />
gefährlicher und strapaziöser. Hauptgründe für das „Reisen“ waren jetzt Raubzüge<br />
und Kriege, aber auch Handel, Entdeckung und Geschäftsverkehr. Im 15. und 16.<br />
Jahrhundert begann die Zeit der Weltumseglungen. Seefahrer und Literaten weckten<br />
die Sehnsüchte und die Abenteuerlust der Menschen. Das weitgehend von religiöser<br />
und kriegerischer Intention freie Reisen, so wie wir es heute kennen, erlebte erst im 18.<br />
Jahrhundert wieder einen Aufschwung. Das Reisen damals unterscheidet sich vom<br />
Reisen heute in einem ganz entscheidenden Punkt: dem Personenkreis. Reisen war bis<br />
weit ins 20. Jahrhundert eine Freizeitbeschäftigung, die den Reichen vorbehalten blieb,<br />
d. h. vorwiegend Geschäftsleuten, Adel, Kirche, Besitzbürgertum und später Beamten.<br />
Bedingt durch die Ausweitung des Wohlstands in allen Gesellschaftsschichten und ein<br />
3 Die Fallstudie wurde von Daniel Rögelein, Maribel Rodríguez und Melanie Müller erstellt<br />
und basiert auf einem Ergänzungsbeitrag der Autoren für das Buch „Mass Customization<br />
und Kundenintegration: Neue Wege zum innovativen Produkt“, Düsseldorf: Symposion<br />
Verlag. Diese Fallstudie ist zu Illustrations- und Lehrzwecken erstellt worden und kann ein<br />
vereinfachtes oder modifiziertes Abbild der Wirklichkeit darstellen. Sie berichtet nicht wirklichkeitsgetreu<br />
über derzeitige und zukünftige Aktivitäten des dargestellten Unternehmens.<br />
280
Mehr an freier Zeit entwickelte sich der „Massentourismus“, welcher das Gesicht der<br />
Tourismusbranche im 20. und angehenden 21. Jahrhundert prägt.<br />
Seit dem Jahr 2001 befindet sich die europäische Tourismusindustrie jedoch in einer<br />
schweren Krise. Die ehemals treibende Kraft der Branche, die Pauschalreise, macht in<br />
Deutschland nur noch einen Anteil von ca. 44 Prozent des Gesamtreisevolumens aus<br />
(Deraëd 2003). Einen nachhaltigen Einbruch des Umsatzes von 25 Prozent erfuhr der<br />
Pauschalreisemarkt durch die Anschläge des 11. September, den Irak-Krieg sowie<br />
SARS. Neben den für viele Unternehmen schädigenden Preiswettkämpfen des<br />
Sommers 2002 dämpft überdies die momentane Wirtschaftskrise die Reiselust der<br />
Deutschen. Insbesondere die Reiseagenturen, welche als Vermittler zwischen<br />
Anbietern bzw. Veranstaltern und Kunden fungieren, sehen sich einem harten<br />
Verdrängungswettbewerb gegenüber.<br />
Seitdem viele Anbieter den direkten Kundenkontakt über das Internet suchen, brechen<br />
die Gewinne der Vermittler nachhaltig ein. Für diese Entwicklung werden insbesondere<br />
die so genannten „Billigflieger“ bzw. „No Frills“-Airlines verantwortlich gemacht.<br />
Sie lassen ihren Kunden vielfach aus Rationalisierungsgründen keine andere Wahl, als<br />
die Flugtickets direkt im Internet zu erwerben. Während dies generell dazu führt, dass<br />
klassische Reiseagenturen weniger genutzt werden, erkennen die Touristen auch zusehends,<br />
dass sie durch eine individuelle Zusammenstellung ihrer Reise – vor allem<br />
unter Einbezug von Angeboten dieser Fluggesellschaften – günstiger reisen als bei<br />
Buchung einer vergleichbaren Pauschalreise. Darüber hinaus wird die wirtschaftliche<br />
Situation der Reiseagenturen dadurch belastet, dass die meisten Fluggesellschaften in<br />
2003 ihre Kommissionszahlungen auf 1 Prozent kürzten, um mit den Billigfluggesellschaften<br />
weiter konkurrieren zu können. Neben den Reiseagenturen müssen sich auch<br />
klassische Reisekonzerne dem gewandelten Wettbewerbsumfeld stellen. Der TUI-<br />
Konzern beispielsweise strebt eine Neustrukturierung als voll integrierter Touristik-<br />
Konzern an, der seinen Kunden einen Traumurlaub aus einer Hand anbieten kann.<br />
Reiseveranstalter und Reiseagenturen sehen sich also vor die Herausforderung<br />
gestellt, in diesem vom Individualitätsbedürfnis der Kunden einerseits und<br />
Margendruck andererseits geprägten Wettbewerbsumfeld zukünftig zu bestehen. Als<br />
viel versprechender Ansatz wird das Angebot kundenindividueller Reisen im Internet<br />
gesehen, welches als Dynamic Packaging bezeichnet wird. Beim Dynamic Packaging<br />
kann der Kunde Reisekomponenten aus unterschiedlichen Quellen auswählen, bündeln<br />
und buchen (Rogl 2003). Dynamic Packaging ist die Mass-Customization-<br />
Strategie der Reiseindustrie.<br />
Wichtige Wettbewerber und deren Angebote<br />
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Wie aus Abbildung 5–8 ersichtlich ist, belief sich der Gesamtumsatz der deutschen<br />
Reisebranche im Jahr 2002 auf 33 Mrd. Euro, wozu internetbasierte Angebote zu ca. 10<br />
Prozent beitrugen. Dieser Wert erscheint im EU-weiten Vergleich überdurchschnittlich<br />
hoch – im Mittel erwirtschaften virtuelle Touristikunternehmen ca. drei Prozent des Gesamtumsatzes<br />
der Branche, was erwarteten 10 Mrd. Euro in 2004 entspricht. Betrachtet<br />
man die deutschen Reiseveranstalter isoliert, setzten sie im Jahr 2001 164 Mio. Euro um,<br />
wobei von einem Anstieg auf 2,2 Mrd. Euro bis zum Jahre 2006 ausgegangen wird.<br />
281<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 5–8: Gesamtumsatz und Umsatzentwicklung der deutschen Reisebranche on- und<br />
offline 1999 bis 2006 (entnommen aus Web-Tourismus 2003)<br />
Allgemein wird ein weltweites Wachstum der Reisebranche in Höhe von ca. 10 Prozent<br />
jährlich erwartet. Eine branchenweite Aussage über den Anteil von Dynamic<br />
Packaging basierten Reisen am Gesamtumsatz erscheint schwierig. Beim<br />
Branchenvorreiter lastminute.com betrug dieser Anteil in Q3 / 2003 ca. 8,6 %, im Q1 /<br />
2004 6,1 %.<br />
Der deutsche Markt für Tourismusdienstleistungen wird neben einer Vielzahl kleiner,<br />
vielfach inhabergeführter Unternehmen im Wesentlichen durch zwei große Anbieterkreise<br />
dominiert. Hierzu zählen die „klassischen“ Reiseveranstalter sowie die in den<br />
letzten Jahren hinzugekommenen Online-Reiseagenturen bzw. Reiseportale, z. B. expedia.com<br />
oder lastminute.com. Abbildung 5–9 und Abbildung 5–10 geben einen Überblick<br />
über die namhaftesten Anbieter der Branche. Insbesondere bei den Online-<br />
Reiseagenturen ist festzustellen, dass fast durchgängig Pauschal-, Lastminute-,<br />
Flugreisen sowie Hotels und Mietwagen angeboten werden. Vielfach wird den Kunden<br />
die Möglichkeit an die Hand gegeben, unter Einbezug von Partnerangeboten (zeitlich)<br />
zusammenpassende Reisemodule selbst zu bündeln. Eine voll ausgeprägte<br />
Dynamic Packaging Funktionalität, welche Verfügbarkeit und Abhängigkeiten aller<br />
282<br />
Mrd. EURO<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
1,48<br />
31,04<br />
1,82<br />
33,16<br />
Gesamtbranche offline Gesamtbranche online<br />
2,06 3 4 5,04<br />
31,23<br />
30,14<br />
29,24<br />
28,48<br />
5,98<br />
29,36<br />
6,93<br />
30,01<br />
1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006*<br />
* geschätzt und erweiterte Basis
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Module berücksichtigt, konnte hingegen nur bei sechs der 29 Online-Anbieter vorgefunden<br />
werden (Stand: Oktober 2004). Bei den sechs Anbietern ebookers.de, expedia.de,<br />
flyloco.de, lastminute.com, onlineweg.de und TUI ist es nicht nur möglich,<br />
Verfügbarkeit und Abhängigkeit der Reisekomponenten online zu prüfen, sondern<br />
eine Reise auch direkt zu buchen.<br />
Abbildung 5-9: Wichtige Angebote großer Online-Reiseagenturen im Internet<br />
Online-<br />
Reiseagentur<br />
Pauschalreise<br />
Lastminute<br />
nur Flug<br />
nur Hotel<br />
Bahnreise<br />
Neben diesen Agenturen und Veranstaltern, welche hauptsächlich gebündelte<br />
Reisepakete offerieren (also mindestens Anreise und Unterkunft), tritt eine Reihe von<br />
Anbietern spezieller Leistungen über das Internet in direkten Kontakt mit den Kunden.<br />
Hierzu zählen z. B. Fluglinien wie Hapag-Lloyd (hlx.com, hlf.de) oder Germania<br />
Express (gexx.de). Sie bieten jedoch in der Regel keine (ausgeprägte) Möglichkeit zur<br />
Ferienhäuser<br />
Kreuzfahrten<br />
Städtereisen<br />
Busreisen<br />
Mietwagen<br />
Tickets<br />
Bezeichnung<br />
des Dynamic-<br />
Packaging-<br />
Angebots<br />
www.billigweg.de x x x x x x x –<br />
www.ebookers.de x x x x x x x<br />
Dynamic<br />
Package<br />
www.expedia.de x x x x x Click&Mix<br />
www.ferien.de x x x x x x –<br />
www.flyloco.de x x x x x x Locomat<br />
www.lastminute.com x x x x x x x x e-basket<br />
www.lcc24.com x x x x x x x x –<br />
www.onlineweg.de x x x x x x x x<br />
Urlaubsbaukasten<br />
www.opodo.de x x x x x x –<br />
www.reisen.de x x x x x x x –<br />
www.start.de x x x x x x x x x x –<br />
www.tiscover.de x x x x x x –<br />
www.travel24.com x x x x x –<br />
www.travelchannel.de x x x x x x x –<br />
www.travelocity.de x x x x x x x –<br />
www.traveloverland.de x x x x x x –<br />
283<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Bündelung von Einzelleistungen. Kunden greifen auf diese Angebote jedoch gerne<br />
zurück, wenn sie ihre Reise „von Hand“ zusammenstellen möchten.<br />
Abbildung 5-10: Wichtige Angebote großer, "klassischer" Reiseveranstalter im Internet<br />
Neben den großen Unternehmen existiert eine Vielzahl kleiner und mittelständischer<br />
Anbieter, deren Geschäftsmodell insbesondere auf der Spezialisierung auf einen kleineren<br />
Abnehmerkreis beruht. Ein solcher Anbieter ist die Münchner Jacana Tours<br />
GmbH, der im Folgendem als prototypisches Beispiel solcher Anbieter dargestellt<br />
wird. Dieser Veranstalter bietet individualisierte Reisen in den südlichen Teil Afrikas<br />
mit Hilfe eines über das Internet verfügbaren Konfigurationstools an. Im Gegensatz zu<br />
den großen Reiseportalen und den bekannten „klassischen“ Reiseveranstaltern fokussiert<br />
das Unternehmen damit eine relativ kleine Zielgruppe: Kunden, die sich eine<br />
Individualreise nach Afrika nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen möchten.<br />
Das Unternehmen orientiert sich dabei maßgeblich an den Wünschen und<br />
Vorstellungen der Kunden, was zu einer schier unbegrenzten Anzahl unterschiedlicher<br />
Reisen führt. Damit ermöglicht Jacana Tours mehr Individualität als es die großen<br />
Reiseportale derzeit bieten, dies jedoch nur in Hinblick auf Reisen nach Afrika. Das<br />
284<br />
Reiseveranstalter<br />
Pauschalreise<br />
Lastminute<br />
nur Flug<br />
nur Hotel<br />
Bahnreise<br />
Ferienhäuser<br />
Kreuzfahrten<br />
Städtereisen<br />
Busreisen<br />
Mietwagen<br />
Tickets<br />
Bezeichnung<br />
des Dynamic-<br />
Packaging-<br />
Angebots<br />
www.airtours.de x x x x –<br />
www.alltours.de x x x x x –<br />
www.bucherreisen.de x x x x –<br />
www.dertour.de x x x x –<br />
www.fti.de x x x x –<br />
www.its.de x x x –<br />
www.jahn-reisen.de x x x x –<br />
www.ltur.de (kein Dynamic<br />
Packaging, sondern Filterfunktion<br />
für das Pauschalreiseangebot)<br />
x x x x x –<br />
www.meiers-reisen.de x x x –<br />
www.neckermann-reisen.de x x x x x x –<br />
www.thomascook-reisen.de x X x x –<br />
www.tjaereborg.de x X –<br />
www.tui.de x X x x x x Kombisuche
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Angebot der Jacana Tours GmbH und ähnlicher Anbieter stellt damit eine weitere<br />
spannende Möglichkeit dar, in der Reisebranche auf die kundenindividuellen<br />
Bedürfnisse einzugehen. Aufgrund der Vielzahl kleinerer Anbieter, die sich auf das<br />
Angebot verschiedenster Arten kundenindividueller Reisen spezialisiert haben, ist es<br />
im Rahmen dieser Fallstudie nicht möglich, einen Überblick zu liefern. Die Jacana Tours<br />
GmbH wird aufgrund ihres erfolgversprechenden Konzeptes beispielhaft dargestellt.<br />
Das Mass-Customization-Angebot der Reisebranche<br />
Das kundenindividuelle Angebot von Reiseleistungen ist nicht etwa eine Errungenschaft<br />
des Internet-Zeitalters, sondern wurde bereits vor 150 Jahren praktiziert. Im Jahre<br />
1841 organisierte Thomas Cook unter Zuhilfenahme von Morsetelegraphie eine<br />
Zugreise für 500 Gläubige von Leicester nach Loughborough inklusive Teilnahmemöglichkeit<br />
an einer religiösen Veranstaltung. Dieser individuelle Ansatz wirkte jedoch<br />
nicht nachhaltig – „vorgebündelte“ Pauschalreisen mit starrer Dauer von 7 oder 14<br />
Tagen bestimmten im letzten Jahrzehnt das Bild der Reisebranche. Doch die Regeln des<br />
Wettbewerbs haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Insbesondere die Vermittler<br />
von Reisen sehen sich einer erhöhten Preistransparenz gegenüber, welche die<br />
Abnehmermacht des Kunden stärkt und seine Loyalität zu bestimmten Anbietern<br />
schwächt. Diese Entwicklung wirkt sich ungünstig auf die Gewinnmargen der Anbieter<br />
aus. Zudem werden die Wünsche der Kunden immer individueller, weshalb sich<br />
Anbieter von Pauschalreisen vor die Frage gestellt sehen, nach welchen Maßgaben diese<br />
zu bündeln sind, um die Bedürfnisse einer möglichst großen Menge von Kunden überhaupt<br />
noch zu befriedigen. Als Folge dieses Wandels wurden die Pauschalreiseangebote<br />
notgedrungen wieder entflochten, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, Hotels,<br />
Flüge und Mietwagen individuell zusammenstellen zu können. Dieses Vorgehen prägte<br />
vor allem im Umfeld der Reiseveranstalter den Begriff des „Baukastentourismus“.<br />
Die Online-Reiseagenturen reagierten zunächst pragmatisch und entwarfen immer<br />
aufwändigere Filtermechanismen, um den Kunden die Auswahl aus dem reichhaltigen<br />
Angebot an Pauschalreisen zu vereinfachen. Dieses Prinzip liegt noch heute den meisten<br />
Reiseportalen zugrunde. Die Filterfunktion wird allerdings weder der Definition<br />
von Mass Customization noch der von Dynamic Packaging gerecht, da die Bedürfnisse<br />
des Kunden bei der Bündelung der Einzelleistungen nicht miteinbezogen werden.<br />
Einen neuartigen, an den Kundenbedürfnissen orientierten Ansatz stellt das Dynamic<br />
Packaging dar, welches die Auswahl und Bündelung zusammenpassender<br />
Einzelleistungen durch den Kunden in Echtzeit ermöglicht. Nur wenige Anbieter,<br />
unter ihnen expedia.de und lastminute.com, bieten es bereits heute in einer zur<br />
Pauschalreise konkurrenzfähigen Form an. Ob Dynamic Packaging die Pauschalreise<br />
zukünftig verdrängen wird oder diese nur komplementiert, kann nur schwer vorhergesagt<br />
werden. In England zeichnet sich allerdings bereits ein Rückgang des Anteils<br />
der Pauschalreisen zugunsten des Dynamic Packaging ab.<br />
Vergleich ausgewählter Dynamic-Packaging-Angebote<br />
Die umfangreichsten Ansätze zum Dynamic Packaging bieten (mit Stand Oktober 2004)<br />
die Anbieter expedia.de sowie lastminute.com, England, an (das gegenwärtig in<br />
Deutschland verfügbare Angebot von lastminute.com ist weniger ausgereift als das<br />
285<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Angebot für den englischen Markt.) In Abbildung 5–11 werden diese und weitere wichtige<br />
Dynamic-Packaging-Angebote gegenüberstellend verglichen. Das Angebot des<br />
Anbieters Jacana Tours GmbH wurde ebenfalls in die Betrachtung aufgenommen. Zwar<br />
kann das Unternehmen nicht als klassischer Dynamic-Packaging-Anbieter betrachtet werden,<br />
bietet allerdings ein wesentlich höheres Maß an Individualisierungsmöglichkeiten.<br />
Neben Rundreise, Hotel, Hoteleigenschaften oder ganzen Touren kann der Kunde<br />
Hoteltransfer, Kamelritte und andere Ausflüge wählen. Darüber hinaus können individuelle<br />
Wünsche „manuell“ Berücksichtigung finden, da eine Machbarkeitsprüfung durch<br />
die Jacana Mitarbeiter erfolgt. Jacana kann als eine moderne Interpretation der klassischen<br />
individuellen „Einzelfertigung“ einer Dienstleistung gesehen werden.<br />
Abbildung 5–11: Funktionaler Vergleich wichtiger Dynamic-Packaging-Angebote<br />
Dynamic Packaging aus Anbietersicht<br />
Reiseagenturen aller Größen setzen ein weitgehend einheitliches Modell für die unternehmensinternen<br />
Prozesse der Reisevermittlung ein. In den Prozessen können sich<br />
286<br />
Anbieter<br />
www.ebookers.de –<br />
"Dynamic Package"<br />
www.expedia.de –<br />
"Click&Mix"<br />
www.flyloco.de –<br />
"Locomat"<br />
www.jacana.de –<br />
"Tourdesigner"<br />
lastminute.com (UK)<br />
– "e-basket"<br />
www.lastminute.com<br />
(D) – "e-basket"<br />
www.onlineweg.de –<br />
"Urlaubsbaukasten"<br />
www.tui.de –<br />
"Kombisuche"<br />
Anzahl<br />
Destinationen<br />
Charakteristika des Angebots<br />
Kombination<br />
von<br />
Individualisierungsmöglichk<br />
Zusatzleistungen<br />
99 Flug, Hotel Flug, Hotel –<br />
>> 100<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Eigenschaften<br />
Hotelzimmer,<br />
Mietwagen<br />
Versicherung, Sight<br />
Seeing, Restaurantbesuche<br />
etc.<br />
63 Flug, Hotel Flug, Hotel –<br />
75<br />
>> 100<br />
47<br />
10<br />
>> 100<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Eigenschaften<br />
Hotelzimmer,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Eigenschaften<br />
Hotelzimmer,<br />
Mietwagen<br />
Flug, Hotel,<br />
Mietwagen<br />
Hoteltransfer, Ausflüge<br />
etc. (individuell<br />
abstimmbar)<br />
Versicherung, Sight<br />
Seeing, Restaurantbesuche,<br />
Hoteltransfer...<br />
Versicherung<br />
Versicherung<br />
–
Mass Customization in der Reisebranche<br />
jedoch Unterschiede hinsichtlich der Interaktion mit den Kunden ergeben. Kleine<br />
Reiseagenturen wie die Münchner Jacana Tours GmbH setzen in stärkerem Maße auf<br />
persönlichen Kundenkontakt als beispielsweise große Anbieter wie expedia.de.<br />
Der Prozess der Vermittlung einer Dynamic-Packaging-Reise im Internet wird im<br />
Wesentlichen durch das Zusammenspiel von IT-Systemen der Komponentenanbieter,<br />
Reiseveranstalter, Reiseagenturen und des Kunden realisiert. So veröffentlichen beispielsweise<br />
Anbieter von Flügen oder Hotels ihre freien Kapazitäten in so genannten<br />
„Inventories“ (Datenbanken), auf welche Reiseagenturen mit Hilfe von Computer-<br />
Reservierungs-Systemen zugreifen können. Reiseveranstalter, welche Kontingente der<br />
Anbieter aufkaufen und z. B. zu Pauschalreisen bündeln, veröffentlichen diese Komplettangebote<br />
ebenfalls in entsprechenden Inventories. Der Kunde kommuniziert mit<br />
der Online-Reiseagentur in der Regel über deren Internetpräsenz bzw. „Internet<br />
Booking Engine“ (oder z. B. über ein Callcenter).<br />
Während bei der Vermittlung von Komplett- bzw. Pauschalreisen in der Regel eine Selektion<br />
der Angebote der Reiseveranstalter gemäß der vom Kunden vorgegebenen Kriterien<br />
erfolgt („Filterung“), werden beim Dynamic Packaging sämtliche in Frage kommenden<br />
Komponenten der Reise einzeln und in Echtzeit in den entsprechenden Inventories recherchiert.<br />
Das System hat dabei vor allem die Verfügbarkeit und Abhängigkeit der einzelnen<br />
Komponenten zu berücksichtigen und die Preisbildung durchzuführen.<br />
Abbildung 5–12: Funktionalschema der Reisevermittlung durch Online-Reiseagenturen<br />
Anbieter 1<br />
Anbieter 2<br />
Anbieter L<br />
Anbieter 1<br />
Anbieter 2<br />
Anbieter M<br />
Anbieter<br />
(z.B. Lufthansa)<br />
Reiseveranstalter<br />
1<br />
Reiseveranstalter<br />
N<br />
Veranstalter<br />
(z.B. TUI)<br />
Flüge<br />
Hotels<br />
Komplettreisen<br />
„Inventories“,<br />
„Computer-Reservierungs-Systeme“<br />
(z.B. Amadeus)<br />
Dynamic<br />
Packaging<br />
Logik<br />
Filter- Logik<br />
Internet Booking Engine<br />
Online-Reiseagentur<br />
(z.B. expedia.de)<br />
Kunde<br />
287<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Die Dynamic Packaging Logik sollte auch Zugriff auf verfügbare Pauschalreisen<br />
haben. Dies hat zweierlei Gründe: zum einen erhöht sich hierdurch die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass eine den Wünschen des Kunden entsprechende Reise gefunden und<br />
angeboten werden kann. Zum anderen muss das System Kenntnis von verfügbaren<br />
Pauschalreiseangeboten haben, welche sich mit den Eigenschaften einer vom Kunden<br />
konfigurierten Individualreise decken. Da anzunehmen ist, dass Kunden selbst<br />
Preisvergleiche durchführen, kann der Gesamtpreis der Individualreise so gewählt<br />
werden, dass er den der Pauschalreise nicht oder nur geringfügig übersteigt. Eine<br />
zusammenfassende Darstellung dieses Prozesses ist Abbildung 5–12 zu entnehmen.<br />
Prozessbeschreibung aus Kundensicht<br />
Das im deutschen Raum momentan am fortschrittlichsten und umfangreichsten anmutende<br />
Dynamic-Packaging-Angebot ist „Click&Mix“ von expedia.de. Es wird auf der<br />
Homepage neben Pauschal- und Lastminute-Reisen direkt beworben. Hier kann sich<br />
der Kunde eine Reise zu weit mehr als 100 Destinationen nach individuellen Wünschen<br />
zusammenstellen lassen. Das System kombiniert hierbei Reisekomponenten wie<br />
z. B. Flug, Hotel, Mietwagen oder Theaterbesuche unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten<br />
und Verfügbarkeit. Ausgangspunkt bildet die Auswahl von Reiseziel, -zeitraum<br />
und Anzahl der reisenden Personen bzw. Hotelzimmer (Abbildung 5–13).<br />
Abbildung 5–13: “Click&Mix“-Angebot auf expedia.de<br />
Im nachfolgenden Schritt kann der Kunde aus einer Reihe von Basisvarianten seiner<br />
Reise auswählen, welche den zuvor festgelegten Kriterien entsprechen. Jede Variante<br />
repräsentiert eine Kombination aus Flug, Hotel und Mietwagen und wird zu einem<br />
288
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Gesamtpreis ausgewiesen. Nach Auswahl einer Basisvariante kann der Kunde<br />
Modifikationen hinsichtlich des Fluges (Airline, Zeit), der Zimmerausstattung des<br />
zuvor gewählten Hotels sowie der Beschaffenheit des Mietwagens vornehmen.<br />
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Reiseversicherung<br />
(Abbildung 5–14).<br />
Abbildung 5–14: Individualisierung des Fluges, der Zimmerausstattung, des Mietwagens<br />
sowie Auswahl einer Reiseversicherung<br />
Im Anschluss an die Selektion der Grundkomponenten Flug, Hotel und Mietwagen<br />
kann der Benutzer noch aus einer großen Anzahl zusätzlicher Aktivitäten an der<br />
289<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Destination auswählen. Hierzu gehören z. B. Musicalaufführungen, Besichtigungen<br />
oder Restaurantbesuche. Im Angebot solcher Zusatzleistungen kann ein entscheidender<br />
Differenzierungsvorteil von Dynamic-Packaging-Reisen gegenüber der konventionellen<br />
Pauschalreise gesehen werden, da sie der Reise einen einzigartigen Charakter<br />
geben und somit dem Wunsch der Kunden nach einem einmaligen und exklusiven<br />
Erlebnis entgegenkommen.<br />
Den Abschluss der Buchung bildet die Bestätigung der ausgewählten Optionen sowie<br />
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. Hierzu ist das Anlegen eines<br />
Benutzerkontos erforderlich. Der Konfigurationsvorgang ist insgesamt sehr durchgängig<br />
und übersichtlich, vermittelt jedoch vor allem aufgrund des hohen Textanteils und<br />
der bei der Buchung erforderlichen Aufmerksamkeit kein „Fluss-Erlebnis“, wie es sich<br />
z. B. bei interaktiven, graphisch orientierten Mass-Customization-Konfiguratoren einstellen<br />
kann. Die Darstellung der Preise der einzelnen Komponenten ist für den<br />
Benutzer bewusst intransparent gestaltet, um ein direktes Vergleichen unterschiedlicher<br />
Angebote durch den Kunden zu erschweren. Bei der Individualisierung der<br />
Komponenten werden lediglich preisliche Abweichungen von der Basisvariante ausgewiesen.<br />
Abbildung 5–15: Tourdesigner der Jacana Tours GmbH<br />
290
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Eine andere Vorgehensweise zur Zusammenstellung einer individuellen Reise bietet<br />
der „Tourdesigner“ der Jacana Tours GmbH (www.jacana.de) für das Reiseziel Afrika<br />
an (Abbildung 5–15). Der Vorteil für den Kunden liegt darin, dass er seine eigene Route<br />
zusammenstellen kann. Er „klickt“ sich etappenweise durch das Land seiner Wahl und<br />
erhält zu jeder Stadt die wichtigsten Informationen sowie ausgewählte Unterkünfte<br />
angeboten. Sowohl bei den einzelnen Etappen als auch bei den Unterkünften und<br />
Mietwagen entscheidet er ganz nach seinen Wünschen. Der Tourdesigner vermittelt<br />
einen Einblick in die einzelnen Reiseziele. Der Kunde plant seine Reise aufgrund dieser<br />
Information selbst und sendet seinen Wunsch per E-Mail an den Reiseveranstalter<br />
Jacana Tours GmbH. Darüber hinaus hat der Kunde auch die Möglichkeit, die<br />
Reiseplanung über einen Zeitraum von 14 Tagen auszudehnen, da das System ermöglicht,<br />
den persönlichen Reiseplan unter einem Benutzernamen abzuspeichern und<br />
somit immer wieder aufzurufen. Es ist auch möglich, mehr als einen Plan abzuspeichern.<br />
In Abbildung 5–16 wird der Prozess aus Sicht des Kunden dargestellt.<br />
Abbildung 5–16: Prozess aus Sicht des Kunden<br />
WebSite<br />
OK<br />
?<br />
Korrektur<br />
Nachricht<br />
Gespräch<br />
OK<br />
?<br />
Angebot<br />
OK<br />
?<br />
Vertrag<br />
Optimierung<br />
Der Kunde bekommt ein Angebot zu dem von ihm ausgewählten Reiseplan. Die<br />
Buchung erfolgt letztendlich mit einer Unterzeichnung des zugesandten Angebots.<br />
Sollte der Kunde mit dem Angebot nicht einverstanden sein, bietet die Jacana Tours<br />
GmbH zusätzlich die Möglichkeit, einzelne Reisekomponenten zu verändern, um eine<br />
Einigung zu erreichen. Auch der Prozess bei Jacana ist sehr übersichtlich und einfach<br />
handhabbar gestaltet. Im Gegensatz zu expedia.de kann der Kunde die beabsichtigte<br />
Reise jedoch nicht online buchen, sondern muss auf die Bestätigung durch das<br />
Unternehmen warten. Es handelt sich damit nicht um eine Konfiguration der Leistung<br />
im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eine sehr strukturierte Übermittlung einer<br />
Buchungsanfrage, die anschließend individuell von einem Mitarbeiter des Anbieters<br />
bearbeitet wird. Durch die Vorstrukturierung kann allerdings diese klassische Leistung<br />
eines Reiseanbieters effizienter und schneller erbracht werden. Bei „Click&Mix“ von<br />
Expedia ist dagegen die gesamte Zusammenstellung und Reisebuchung automatisiert.<br />
Preislich liegt Jacana Tours GmbH über den Angeboten der großen Dynamic-<br />
Packaging-Anbieter. Hierfür werden allerdings auch umfassende Individualisierungs-<br />
291<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
optionen und – auf Wunsch – eine individuelle Beratung geboten, die die Zahlungsbereitschaft<br />
erhöhen. Zudem sind die angebotenen Reiseziele eher im gehobenen<br />
Segment und oft exklusiv über diesen Anbieter buchbar.<br />
Veränderung der Kostenstruktur durch Dynamic Packaging<br />
Aus theoretischer Sicht bietet Dynamic Packaging dem Anbieter die Möglichkeit, die<br />
Konsumentenrente der Kunden abzuschöpfen, da den Kunden der Preisvergleich<br />
erschwert oder nicht möglich ist. Hierbei kann der Fokus beispielsweise auf eine komplett<br />
nach den eigenen Bedürfnissen zusammengestellten Reiseroute oder auf<br />
Zusatzleistungen an der Destination gerichtet werden, deren Preisstruktur sich dem<br />
Kunden nicht ohne weiteres erschließt (z. B. Tagesausflüge). Jedoch zeigt sich heute,<br />
dass Dynamic Packaging in der Regel nicht als Instrument zu Preissteigerungen<br />
genutzt werden kann. Wie bereits erläutert, ist die Einführung von Dynamic Packaging<br />
als Antwort auf die branchenweit rückläufigen Umsätze, insbesondere im Pauschalreisemarkt,<br />
zu werten. Aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks auf Anbieterseite und<br />
der Transparenz des Marktes sehen sich die Dynamic-Packaging-Anbieter momentan<br />
vielfach nicht imstande, die Zahlungsbereitschaft der Kunden im Vergleich zur<br />
Pauschalreise zu erhöhen. Ziel ist vielmehr, angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen<br />
Lage mit Hilfe von Dynamic Packaging den jeweiligen Umsatz zu sichern oder<br />
ausbauen zu können. Während Anbieter TUI sein Individualreiseangebot generell<br />
nicht teurer als die pauschalen Angebote gestaltet, stellt expedia.de den „Click&Mix“-<br />
Kunden sogar Preisersparnisse bis zu 30 Prozent im Vergleich zur Buchung von<br />
Einzelleistungen in Aussicht. In einer von der Marktforschungsfirma Ulysses im<br />
Frühjahr 2003 durchgeführten Studie wurden bei Gegenüberstellung vergleichbarer<br />
Individual- und Pauschalreiseangebote Preiszuschläge von 7 % bzw. 1,5 %, aber auch<br />
Preisnachlässe von 3 % bzw. 0,5 % festgestellt.<br />
Die mangelnde Zahlungsbereitschaft ist überdies vor dem Hintergrund zusätzlicher<br />
Kosten durch die Einführung von Dynamic Packaging zu sehen. Insbesondere die<br />
Entwicklung neuer Datenbanken (Inventories) zur Speicherung der komponentenbezogenen<br />
Informationen und deren Betrieb parallel zu den bestehenden Komplettreise-<br />
Inventories stellt eine zusätzliche Kostenbelastung dar. Darüber hinaus müssen<br />
Reiseveranstalter bzw. Reiseagenturen geeignete Dynamic-Packaging-Softwarelösungen<br />
erwerben und in ihre Internet Booking Engines integrieren.<br />
Der zusätzlichen finanziellen Belastung durch Dynamic Packaging stehen jedoch auch<br />
neue Kosteneinsparpotenziale gegenüber. Insbesondere könnten Reiseveranstalter theoretisch<br />
auf den „vorsorglichen“ Aufkauf von Kontingenten der Anbieter verzichten<br />
bzw. diese nur nach tatsächlichem Bedarf der Kunden in Anspruch nehmen. Während<br />
dieser Ansatz auf wenig Gegenliebe der Anbieter stoßen dürfte und daher eher theoretischer<br />
Natur ist, können Reiseveranstalter jedoch durch das Angebot von Dynamic-<br />
Packaging-Reisen viel über die Präferenzstrukturen ihrer Kunden lernen. Hierdurch<br />
ließe sich in einem ersten Schritt das Angebot von Pauschalreisen besser an den<br />
Kundenbedürfnissen ausrichten, was ebenfalls den Anteil aufgekaufter und nicht<br />
genutzter Anbieterkontingente reduzieren könnte. Außerdem können Reiseveranstalter<br />
nicht nur durch die Umwandlung von Pauschalreisen in (günstige) Lastminute-<br />
Reisen versuchen, ihre schwer absetzbaren Komplettreisen zu verkaufen, sondern die<br />
292
Mass Customization in der Reisebranche<br />
Komponenten dieser Reisen separat in entsprechenden Inventories anbieten. Durch die<br />
Einführung von Dynamic Packaging können bei Reiseveranstaltern also vor allem<br />
Risikokosten gesenkt werden. Die Anbieter kommen allerdings um die Einführung<br />
neuer Angebote insgesamt nicht herum, da es im Moment eher darum geht die<br />
Marktposition zu halten und nicht vom Markt zu verschwinden.<br />
Erfolgsfaktoren für die zukünftige Entwicklung von Mass Customization in der<br />
Reisebranche<br />
Branchenintern stehen Anbieter von Dynamic-Packaging-Reisen vor allem in<br />
Konkurrenz zu Pauschalreiseveranstaltern, wobei der Wettbewerb nicht über<br />
Produktdifferenzierung, sondern hauptsächlich über den Preis geführt wird. Es ist<br />
daher wesentlich für die Anbieter von Dynamic-Packaging-Reisen, eine kostengünstige<br />
Reisevermittlung auf Basis stabiler und durchrationalisierter Prozesse zu verwirklichen,<br />
von ihren Kunden zu lernen und diese unter Nutzung dieses Wissens an sich<br />
zu binden.<br />
Ähnlich Pauschalreiseveranstaltern müssen sie ihren Kunden das Gefühl geben, aus<br />
einer großen Angebotsvielfalt wählen zu können und die Reise aus einer Hand sowie<br />
zu einem günstigen Preis zu erhalten. Hierzu ist zum einen ein großes Netz von<br />
Komponentenlieferanten aufzubauen. Zum anderen erscheint ein Auftreten als<br />
Reiseveranstalter trotz der Haftungsproblematik unumgänglich, zumal Anbieter wie<br />
Hotelketten oder Fluglinien ihre günstigen „Tour Operator Preise“ nur Reiseveranstaltern<br />
anbieten. Trotz der Erfordernis einer „kritischen Größe“ muss die Unternehmensstruktur<br />
der Anbieter flexibel genug bleiben, um zukunftsfähige Lösungen<br />
zur Neukundengewinnung und Kundenbindung zu realisieren und auf plötzliche<br />
Veränderungen der Nachfragesituation schnell und nachhaltig reagieren zu können.<br />
Hier können größere Anbieter von den kleineren Unternehmen lernen.<br />
In Kundenorientierung und Flexibilität sind somit die wesentlichen Erfolgsfaktoren für<br />
einen weiteren Bedeutungsgewinn des Dynamic Packaging gegenüber der<br />
Pauschalreise zu sehen. Jedoch bleibt abzuwarten, ob ausschließlich große Unternehmen<br />
mit gut skalierenden Prozessen und hoher, gleichwohl begrenzter Angebotsvielfalt<br />
Gewinner dieses Paradigmenwechsels hin zum individuellen Reisen sein werden.<br />
Gerade kleine Unternehmen könnten durch ihre Fähigkeit, wirklich individuell<br />
auf die Kundenwünsche eingehen zu können und sie nicht auf einen diskreten<br />
Lösungsraum reduzieren zu müssen, im Vorteil sein.<br />
Fragen zur Diskussion der Fallstudie<br />
Stellen Sie die Stärken und Chancen sowie Schwächen und Risiken des Dynamic-Packaging-<br />
Modells in einer SWOT-Analyse gegenüber.<br />
Wodurch unterscheidet sich eine Individualisierung einer Dienstleistung von einer Mass<br />
Customization bei Sachgütern? In welchen anderen Dienstleistungsbranchen sehen Sie noch<br />
große Potenziale für eine Individualisierung?<br />
Wie sieht ein optimales Co-Design-Toolkit (Konfigurator) für die Reisebranche aus?<br />
293<br />
5.3
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Welche Ansätze sehen Sie für einen Einbezug der Kunden in den Innovationsprozess bei<br />
Dienstleistungen?<br />
Wie können Sie das Konzept der Economies of Integration für dieses Beispiel konkretisieren?<br />
5.4 Linel GmbH: Entwurf eines Mass-<br />
Customization-Konzepts für die Wasser- und<br />
Abwasserfiltrationsbranche<br />
Anlagen zur Wasser- und Abwasserfiltration müssen vielen spezifischen Gegebenheiten<br />
ihres Einsatzortes gerecht werden und sind damit in der Regel hoch individuell.<br />
Erstaunlicherweise gibt es in dieser Branche aber noch kein ausgereiftes Mass-Customization-Angebot.<br />
Im Rahmen dieser Fallstudie sollen die Realisierungschancen von<br />
Mass Customization bei einem der führenden Unternehmen dieser Industrie, der Linel<br />
GmbH, evaluiert werden. 4<br />
Die Wasser- und Abwasserbehandlungsbranche<br />
Wasser ist ein wichtiges und lebensnotwendiges Gut. Sowohl als Trinkwasser im täglichen<br />
Leben als auch als Wasch-, Lösungs- und Kühlmittel in der Industrie ist Wasser<br />
unverzichtbar. Dabei sind lediglich 0,3 Prozent des gesamten Wasserreservoirs der<br />
Erde als Trinkwasser nutzbar. Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen unterliegt der<br />
Wasservorrat einem ständigen Kreislauf aus Verdunstung und Niederschlag. Somit<br />
kann sich die Menge an Wasser insgesamt nicht verringern. Allerdings kann sich die<br />
Qualität verschlechtern, beispielsweise dadurch, dass belastende Stoffe in Gewässer<br />
eindringen. Auch andere ökologische Faktoren lassen Wasser als ein zunehmend knappes<br />
Gut erscheinen. So herrscht beispielsweise in Süditalien ein derart großer Süßwassermangel,<br />
dass in vielen Gemeinden täglich nur wenige Stunden fließendes<br />
(„süßes“) Wasser zur Verfügung steht. Der Bedarf an innovativen Lösungen wie<br />
Wasserentsalzungs- oder Trinkwasseraufbereitungsanlagen scheint damit ständig zu<br />
wachsen. Zudem erfordern verschärfte Umweltauflagen auch die Behandlung von<br />
Prozesswasser, zum Beispiel in der Metallverarbeitungsindustrie.<br />
Zur Befriedigung dieser Nachfrage steht ein sehr großes Angebot an Lösungen zur<br />
Verfügung. Genaue Daten über die weltweite Anzahl entsprechender Unternehmen<br />
liegen nicht vor, da es sich oft um recht kleine und lokal spezialisierte Unternehmen<br />
handelt. Einen guten Anhaltspunkt liefern allerdings Daten der weltweiten Leitmesse<br />
für Entsorgungs- und Abfallwirtschaft, die IFAT München: So stellten im Jahre 2002<br />
919 Unternehmen aus den Bereichen Wasser- und Abwasserbehandlung aus. Der spe-<br />
4 Die Fallstudie wurde von Michael Erspamer und Melanie Müller erstellt und basiert auf<br />
einem Ergänzungsbeitrags der Autoren für das Buch „Mass Customization und<br />
Kundenintegration: Neue Wege zum innovativen Produkt“, Düsseldorf: Symposion Verlag.<br />
Diese Fallstudie ist zu Illustrations- und Lehrzwecken erstellt worden und kann ein vereinfachtes<br />
oder modifiziertes Abbild der Wirklichkeit darstellen. Sie berichtet nicht wirklichkeitsgetreu<br />
über derzeitige und zukünftige Aktivitäten des dargestellten Unternehmens.<br />
294
zielle Bereich der Membrananlagenbauer, zu denen auch das in dieser Fallstudie vorgestellte<br />
Unternehmen Linel GmbH gehört, umfasste 81 Anbieter. Im Vergleich zur<br />
Messe im Jahre 1999 waren jedoch rund 40 Prozent der damals teilnehmenden<br />
Unternehmen nicht mehr anwesend. Dies deutet auf einen hart umkämpften Markt<br />
hin, in dem das Überleben für kleinere unabhängige mittelständische Unternehmen<br />
schwer ist und der zunehmend von größeren Unternehmen beherrscht wird.<br />
Linel GmbH: Unternehmen und Produktfeld<br />
Linel GmbH: Entwurf eines Mass-Customization-Konzepts<br />
Die Linel GmbH war ursprünglich ein italienisches Tochterunternehmen der SAG<br />
Energieversorgungslösungen GmbH und ist seit nunmehr 30 Jahren als eigenständiges<br />
Unternehmen vorwiegend auf dem deutsch- und italienischsprachigen Markt tätig.<br />
Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 80 Mitarbeiter.<br />
Neben den ursprünglichen Sparten Netzbau und Gebäudetechnik wurde vor 20 Jahren<br />
die Sparte Depurtec als dritter Geschäftsbereich gegründet. Die Produktpalette reicht<br />
von der Trinkwasser- über die Prozesswasseraufbereitung bis hin zur Meerwasserentsalzung.<br />
Die Kerntechnologie liegt dabei in der Membranfiltration, welche die Mikround<br />
Ultrafiltration sowie die Umkehrosmose umfasst. Der Gesamtumsatz der Sparte<br />
Depurtec beläuft sich auf ca. 9 Mio. €, wobei ca. 5 Mio. € auf das Segment der Mikround<br />
Ultrafiltration zurückgehen und ca. 4 Mio. € durch den Verkauf der<br />
Umkehrosmose-Anlagen (sie liefern voll entsalztes Wasser) erwirtschaftet werden. Das<br />
Unternehmen spricht mit seinen Produkten folgende Zielgruppen an:<br />
Haushalte und Gemeinden: In niederschlagsarmen Regionen wird Süßwasser rund<br />
um die Uhr verfügbar, Kunden sind entweder Privatpersonen oder Gemeinden.<br />
Gastronomie: Durch Entsalzung des Spülwassers können Gläser und Besteck lufttrocknen,<br />
ohne später Flecken aufzuweisen.<br />
Industrie: Abwässer werden unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Auflagen<br />
für die Metallverarbeitungs-, Automobil- und Lebensmittelbranche bearbeitet.<br />
Filtrationsanlagen sind kein Prestigeobjekt wie etwa Autos. Design sowie sichtbare<br />
Merkmale wie Farbe oder Form sind in den Augen des Kunden eher nebensächlich. Der<br />
Bedarf für derartige Anlagen resultiert aus der generellen Knappheit der Ressource<br />
Wasser in bestimmten Regionen sowie aus umweltrechtlichen Bestimmungen, die etwa<br />
bei Lackierereien die Nachbehandlung des Abwassers vorschreiben. Aufgrund der vielfältigen<br />
Anwendungsbereiche sind Filtrationsanlagen ein höchst kompliziertes<br />
Produkt, das individuell auf den einzelnen Abnehmer abgestimmt werden muss.<br />
Die Konfiguration einer Filtrationsanlage wird durch verschiedene Parameter<br />
bestimmt. Wichtigster Einflussfaktor ist das zu behandelnde Wasser selbst. Das<br />
Abwasser muss zunächst genau analysiert und hinsichtlich seiner Zieleigenschaften, z.<br />
B. Trinkwasser, definiert werden. Die Permeatleistung (Resultat des Filtriervorgangs)<br />
pro gegebene Zeiteinheit sowie die qualitative Ausführung der Anlage sind weitere<br />
Parameter, die stark variieren können. Da Filtrationsanlagen in der Regel über viele<br />
Jahre in Dauerbetrieb laufen, sind aus Kundensicht weiterhin Service und Wartung der<br />
Anlage wichtige kaufentscheidene Kriterien. Deshalb müssen auch Nachkaufleistungen<br />
wie Wartungsvereinbarungen individuell definiert werden.<br />
295<br />
5.4
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Ziel des Unternehmens Linel ist es, dem Kunden qualitativ hochwertige Produkte in<br />
„maßgeschneiderter“ Form als Lösung zu präsentieren. Derzeit stehen wenigen standardisierten<br />
Produkten viele Einzelfertigungen für individuelle Abnehmer gegenüber.<br />
Für die Mehrzahl der Aufträge erfolgt eine eigene Planung und Projektierung in<br />
Losgröße eins. Mit wachsendem Kundenstamm und einer zunehmenden Bedeutung<br />
von Anlagen zur Wasseraufbereitung wuchs aber auch die interne Komplexität. Die<br />
Geschäftsleitung stand so vor der Aufgabe, eine neue Strategie zu definieren, mit der<br />
sowohl auf die wachsenden Kundenansprüche als auch auf den sich verschärfenden<br />
Wettbewerbsdruck reagiert werden kann. Durch einen Vortrag auf einer Branchenmesse<br />
auf den Mass-Customization-Gedanken aufmerksam geworden, gründete die<br />
Geschäftsleitung eine interne Arbeitsgruppe, um eine kritische Analyse der Chancen<br />
und Potenziale zu diskutieren. Diese Arbeitsgruppe definierte die im Folgenden dargestellten<br />
Ergebnisse.<br />
Konzeption eines potenziellen Mass Customization-Angebots<br />
In der Wasser- und Abwasserbehandlungsbranche zeichnet sich ein erfolgreiches<br />
Unternehmen durch die Fähigkeit aus, mit dem Kunden im Leistungserstellungsprozess<br />
zu interagieren. Aufgrund der individuellen Eigenschaften des zu behandelnden<br />
Wassers erwartet der Abnehmer, dass sich der Anbieter intensiv mit ihm auseinandersetzt,<br />
um die beste individuelle Lösung zu erhalten. Neben den Kosten für die<br />
Maßfertigung der Anlagen erhöhen damit die für die Kundeninteraktion anfallenden<br />
Kosten den Verkaufspreis einer Anlage wesentlich. Es ist üblich, dass Vertriebsmitarbeiter<br />
und Kunde zunächst für ein intensives Verkaufsgespräch zusammenkommen,<br />
um die beste Lösung für den jeweiligen Kunden zu finden. Nach ca. zwei Wochen<br />
intensiver Planung und Konstruktion beim Hersteller wird dem Kunden ein Angebot<br />
übermittelt; allerdings entspricht dies meist nicht genau dem Kundenbedürfnis.<br />
Kosten- und Zeitintensive Nachbesserungen sind die Regel.<br />
Ein Mass Customization Konzept würde es nun ermöglichen, neben den Produktionskosten<br />
auch die Kosten für die Interaktion mit dem Kunden zu senken. Denkbar ist beispielsweise,<br />
dass der Kunde sich mittels eines Online-Konfigurators sein Produkt auf<br />
einfache Art und Weise selbst zusammenstellt und eine Anfrage an das Unternehmen<br />
sendet. Der Konfigurator ersetzt damit zumindest teilweise den Verkäufer. Dadurch,<br />
dass alle Lösungen im Konfigurator bereits vorab durchdacht wurden, entfallen<br />
zudem zeitraubende Nachbesserungsprozesse. Der Kunde erkennt sofort, wie seine<br />
Wünsche in das Produkt umgesetzt werden. Dadurch reduziert sich auch die Zeit bis<br />
die individuelle Anlage produziert werden kann, die Kosten sinken ebenfalls.<br />
Hebelpunkt des Mass-Customization-Konzepts wäre die Ablösung der klassischen<br />
Einzelfertigung und des Engineer-to-order-Konzepts durch eine Projektierung und<br />
Fertigung aus Baukastenelementen, die sich der Kunde innerhalb bestimmter Grenzen<br />
nach dem individuellen Wünschen selbst zusammenstellt. Möglich wäre dies durch<br />
ein Mass-Customization-Angebot, das auf dem Konzept einer quantitativen Modularisierung<br />
beruht, d. h. der Kunden kann durch Hinzufügen und Variieren eines oder<br />
mehrerer Module den Nutzen des funktionstüchtigen Produkts erhöhen. Beispielsweise<br />
kann einer funktionierenden Abwasserfiltrationsanlage das Modul „Digitale<br />
Steuerung und Datenerfassung mittels Kleincomputer“ hinzugefügt werden.<br />
296
Abbildung 5–17 gibt einen Überblick über mögliche Module einer Filtrationsanlage<br />
sowie ihre Ausprägungen.<br />
Prozessbeschreibung aus der Sicht der Linel GmbH<br />
Linel GmbH: Entwurf eines Mass-Customization-Konzepts<br />
Abbildung 5–17: Mögliche Module einer Filtrationsanlage und ihre Ausprägungen<br />
Verchromt<br />
Tank Steuerung<br />
Pumpe<br />
Edelstahl Verbundwerkstoff Manuell Digital<br />
Mit Druckanzeige Ohne Druckanzeige<br />
Nicht<br />
veredelt<br />
… … Mit Kenn- Ohne Kenn- Mit Ohne<br />
feldanzeigefeldanzeige Display Display<br />
Diese Bestandteile könnten im folgenden Prozess münden: Der Erstellungsprozess<br />
einer Filtrationsanlage beginnt mit der Einreichung einer Wasserprobe zur<br />
Laboranalyse durch den Kunden. Das Abwasser wird untersucht und ein passender<br />
Membrantyp gesucht; dieser ist für Filtrierqualität und ein störungsfreies Funktionieren<br />
der Anlage wesentlich. Anschließend beginnt der eigentliche Konfigurationsprozess<br />
der Anlage. Ein Internet-Konfigurator (Abbildung 5–18) scheint geeignet, die<br />
individuellen Kundenbedürfnisse in Produktmerkmale zu übertragen und dabei<br />
gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Hierbei sollte der Kunde die aus der<br />
Abwasseranalyse gewonnenen Daten hinsichtlich Membranbeschaffenheit sowie<br />
benötigter Permeatleistung pro Zeiteinheit in den Konfigurator eingeben können, worauf<br />
dieser aus einer Bibliothek bereits vorhandener Lösungen ein Basisprodukt zur<br />
Auswahl anbietet. Dieses Basisprodukt beinhaltet bereits die Anzahl notwendiger<br />
Pumpen, die Kapazität des Speichertanks, die Anzahl der notwendigen Membranen,<br />
sowie weitere grundlegende Komponenten. Zudem sollten Preis und weitere wichtige<br />
Daten wie Größe und Gewicht angegeben werden.<br />
Anschließend sollte der Online-Konfigurator dem Kunden die Möglichkeit bieten,<br />
zwischen verschiedenen Optionen wie Material des Tanks (Verbundstoff, INOX,…)<br />
oder Qualität der Pumpen zu wählen,<br />
die Anlage um bestimmte Module wie zusätzliche Regler oder digitale Anzeigen zu<br />
erweitern,<br />
zwischen Finanzierungsoptionen und Servicekonditionen wie Wartungsverträgen,<br />
Garantieleistungen usw. auszuwählen.<br />
Da das Konfigurieren für einen Kunden eventuell komplex ist, sollte jederzeit ein<br />
Berater zu Rate gezogen werden können, beispielsweise via einer Hotline. Nach<br />
Abschluss des Konfigurationsprozesses erhält Linel eine Bestellung bzw. Anfrage.<br />
297<br />
5.4
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 5–18: Darstellung eines Konfigurators für Membranfiltrationsanlagen<br />
Diese wird an das Produktdatenmanagement-(PDM-)System weitergeleitet, das die<br />
Bestellung auf Teileverfügbarkeit überprüft und dann einen Liefertermin berechnet,<br />
der dem Kunden per E-Mail mitgeteilt wird. Erhält das Unternehmen eine Bestätigungsmail<br />
für den Auftrag vom Kunden, wird der Anlage eine Seriennummer zugewiesen<br />
und die Fertigung beginnt. Idealerweise sind die Lieferanten in das<br />
Lagerverwaltungs- und Bestellsystem eingebunden. Im Falle fehlender Teile kann<br />
dadurch eine automatische Bestellung beim Lieferanten erfolgen.<br />
Neben der Einbeziehung des Kunden in den Anlagenentwurf mittels Online-<br />
Konfigurator könnte Linel auch neue Impulse für das Kundenbeziehungsmanagement<br />
bekommen. Ziel ist der Aufbau von Kundenbindung und damit eine bessere Nutzung<br />
von weiteren Geschäftsmöglichkeiten. Bisher bricht der Kontakt zum Kunden nach<br />
dem Verkauf einer Anlage größtenteils ab; eine Ausnahme bilden kostspielige<br />
Reparaturleistungen. Vor allem Erlöse aus dem Verkauf ergänzender und zusätzlicher<br />
Leistungen gehen damit verloren.<br />
Ein weiteres entscheidendes Potenzial liegt so in der Nutzung der bereits vorhandenen<br />
Kundendaten zum Aufbau intensiver Kundenbeziehungen. Informations- und Kom-<br />
298
munikationstechnologien erlauben es seit einigen Jahren, den Kundenkontakt zu vergleichsweise<br />
niedrigen Kosten aufrecht zu erhalten. Beispielsweise könnte ein regelmäßig<br />
erscheinender Newsletter über Produktneuheiten informieren. Denkbar ist außerdem<br />
die Einrichtung eines Internetportals, wo Kunden untereinander und mit Experten<br />
des Unternehmens über Erfahrungen, Probleme und Verbesserungsvorschläge<br />
diskutieren. Zusätzlich können ergänzende Serviceleistungen in modularer Form<br />
angeboten werden (Abbildung 5–19). Auch das Angebot der präventiven Wartung<br />
erscheint lukrativ und auch hier kann der Kunde aktiv eingebunden werden, indem er<br />
selbst die Anlage beobachtet und Erfahrungen mit der Entwicklungsabteilung der<br />
Linel GmbH online austauscht.<br />
Abbildung 5–19: Beispielmodul Wartung & Reparatur<br />
Präventiver<br />
Wartungsvertrag<br />
Kostenlose<br />
Membran<br />
reinigung<br />
Linel GmbH: Entwurf eines Mass-Customization-Konzepts<br />
Wartung & Reparatur<br />
Garantieleistung und<br />
Reparatur bei Schäden<br />
Eine weitere Idee ist die Realisierung eines Leasingkonzepts, bei dem der Kunde seine<br />
Anlage für einen entsprechenden Jahresbeitrag least. Für das Funktionieren der Anlage<br />
ist grundsätzlich der Hersteller verantwortlich; allerdings ist auch der Abnehmer bemüht<br />
(oder vertraglich verpflichtet), Informationen weiterzugeben, da dies der<br />
Einsatzzeit der Anlage und damit seinen Kosten zugute kommt. Damit entsteht eine<br />
partnerschaftliche Beziehung zwischen der Linel GmbH und dem Kunden, denn beide<br />
Seiten profitieren von der engen Kooperation. Zudem steigen die Chancen für den<br />
Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen, da der Abnehmer kein Interesse haben<br />
wird, aus der funktionierenden Partnerschaft auszutreten.<br />
Analyse des Mass-Customization-Prozesses aus Kundensicht<br />
Leasingkonzept<br />
HalbjährlicherRoutinecheck<br />
… …<br />
… …<br />
Produkte im Markt für Wasser- und Abwasserfiltration werden in jeder Preisklasse<br />
angeboten. Allerdings erscheinen Billiganbieter auf der einen Seite oft wenig vertrauenswürdig;<br />
auf der anderen Seite sind die Produkte renommierter Hersteller oft in<br />
299<br />
5.4
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
ihrer Ausführung zu teuer und entsprechen nicht dem einfacheren Verwendungszweck<br />
des Kunden. Aufgrund des vielfältigen Angebots ist es für den Kunden derzeit<br />
äußerst schwierig, das für ihn passende Produkt auf einfache Art und Weise zu finden.<br />
Durch Mass Customization erlebt der Kunde nun zwei wesentliche Vorteile: Er erhält<br />
das Produkt, das am besten zu seinen individuellen Bedürfnissen passt auf vergleichsweise<br />
einfache Art und Weise, und das zu einem für ihn akzeptablen Preis. Wird der<br />
Konfigurationsprozess ins Internet verlagert, kann der Kunde jederzeit zeit- und ortsunabhängig<br />
Informationen über Angebot der Linel GmbH abrufen und sich ein<br />
(Probe-)Produkt zusammenstellen. Der Kunde sieht unmittelbar, wie seine Bedürfnisse<br />
am Produkt umgesetzt werden und kann jederzeit nachbessern. Zudem fühlt er sich<br />
vom Unternehmen als Partner wahrgenommen, da er aktiv an der Produkterstellung<br />
mitarbeitet. Kunden, die Unterstützung benötigen, steht eine kostenlose Hotline zur<br />
Verfügung.<br />
Weitere Vorteile für den Kunden ergeben sich beispielsweise hinsichtlich der Wartezeit<br />
zwischen Anfrage und Angebotserstellung, die mit Hilfe des integrierten Konfigurationssystems<br />
verkürzt wird. Zudem entfällt die Zeit (und die Kosten) für<br />
Nachbesserungen am Produkt, da der Konfigurator von vornherein nur realisierbare<br />
Lösungen enthält. Allerdings sollte bedacht werden, dass ganz spezifische Kundenwünsche<br />
mit dem modularen Angebot eventuell nicht mehr erfüllt werden können. Es<br />
könnten also einige Kunden für das Unternehmen verloren gehen. Jedoch scheinen die<br />
Potenziale, die ein Mass Customization Konzept mit sich bringt, diese Verluste mehr<br />
als aufzuwiegen.<br />
Analyse des Mass-Customization-Prozesses aus Unternehmenssicht<br />
Die Einführung eines auf den Prinzipien der Mass Customization beruhenden Konzepts<br />
bietet ein großes Potenzial zur Kostensenkung. Erster wichtiger Ansatzpunkt ist<br />
die Komplexitätsreduktion in der Fertigung. Allen Anlagen muss eine Modulbauweise<br />
zugrunde gelegt werden. Dadurch können die hohen Rüstzeiten der bisherigen<br />
Einzelfertigung reduziert, Fertigungsprozesse wie das Drehen standardisiert und<br />
somit die effektive Auslastung der Maschinen erhöht werden. Die Produktionskapazität<br />
steigt, was die durchschnittlichen Stückkosten senkt. Zudem kann die<br />
Verwendung von modularisierten Gleichteilen (z. B. Steuerungskästen) Verbundeffekte<br />
hervorrufen. Erfahrungs- und Lerneffekte führen ebenso zu einer Reduktion<br />
der Fertigungskosten.<br />
Auch im Einkauf ergeben sich Einsparungspotenziale. Durch die Modulbauweise werden<br />
größere Mengen eingekauft; die Einkaufspreise sinken grundsätzlich. Zudem werden<br />
die Logistikkosten verringert. Bei einer sinnvollen Konzentration auf möglichst<br />
wenige unterschiedliche Teile, sinken außerdem die Lagerkosten. Planung und<br />
Konstruktion müssen auch nicht mehr für Teile erfolgen, die nur einmalig verwendet<br />
werden können, sondern nur für die mehrfach verwendbaren Module.<br />
Der für eine Implementierung des Mass Customization Konzepts notwendige Konfigurator<br />
bedeutet zunächst eine Kostenerhöhung. Es entstehen einmalige Programmierkosten<br />
zu Beginn sowie laufende Kosten für die Wartung. Doch gerade<br />
durch den Konfigurationsprozess öffnen sich weitere wesentliche Kosteneinsparungs-<br />
300
Linel GmbH: Entwurf eines Mass-Customization-Konzepts<br />
potenziale. Der Kunde stellt sich sein Angebot praktisch selbst zusammen, wodurch<br />
Vertriebskosten in erheblichem Maße eingespart werden. Durch eine kontinuierliche<br />
Auswertung der Konfigurationsdaten erhält Linel zudem Informationen über bevorzugte<br />
Produktvarianten und kann sein Produktangebot dementsprechend weiterentwickeln.<br />
Intensive Kundenbeziehungen beeinflussen zudem das Weiterempfehlungssowie<br />
Wieder- und Zusatzkaufverhalten der Kunden. Außerdem können Marktforschungstests<br />
überflüssig werden, da viele Informationen mit Hilfe des Konfigurators<br />
und aufgrund der intensiven Kundenbeziehung gewonnen werden. So können zum<br />
Beispiel die typischen Konfigurationen der Kunden einer Region als Ausgangspunkt<br />
für eine standardisierte, aber genau passende Lösung für diese Region angeboten werden.<br />
Dies würde Linel ermöglichen, die Umsatzzahlen auch im Bereich der preiswerteren<br />
Lösungen effizient zu bedienen.<br />
Die Stärken und Chancen des Konzepts liegen in den folgenden Aspekten:<br />
Als erster Mass Customizer der Branche würde die Linel GmbH über ein<br />
Alleinstellungsmerkmal verfügen und sich deutlich von der Konkurrenz abgrenzen.<br />
Der Bedarf an Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung ist stark wachsend. Mit dem<br />
Mass Customization Angebot könnte sich Linel in neuen Marktsegmenten schnell<br />
und flexibel etablieren. Vor allem potentielle Massenmärkte wie Meerwasserentsalzungsanlagen<br />
für Haushalte in süßwasserarmen Gebieten könnten durch eine<br />
Produktionssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung besser bedient werden.<br />
Durch den Konfigurationsprozess erstellt sich der Kunde sein individuelles<br />
Produkt auf einfache Art und Weise. Auch das Risiko von Fehlinnovationen und<br />
langwierigen Nachbesserungsprozessen sinkt. Das Unternehmen ist attraktiver für<br />
Kunden, da Kosten und Zeit bis zur Auslieferung des individuellen Produktes sinken.<br />
Ein durchdachter Konfigurationsprozess hilft, die Kosten der Kundeninteraktion<br />
zu senken.<br />
Durch die Darstellung der verschiedenen Optionen wird den Kunden die<br />
Leistungsfähigkeit des Anbieters besser bewusst, der Konfigurator dient gerade bei<br />
technisch anspruchsvollen Produkten wie denen von Linel nicht nur zur Konfiguration<br />
einer individuellen Leistung, sondern auch zur Darstellung des möglichen<br />
Lösungsraumes und der Kompetenz des Anbieters.<br />
Ein integriertes Customer Relationship Management Konzept von der Konfiguration<br />
bis zur Nachkaufbetreuung hat positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit des<br />
Kunden und damit auf dessen Folge- und Zusatzkäufe sowie positive Weiterempfehlungen.<br />
Damit steigt letztendlich der Profit des Unternehmens.<br />
Die Einführung des Mass-Customization-Programms „zwingt“ das Anbieter, die<br />
bestehenden Produktstrukturen zu überdenken und vorhandene Spezialteile und<br />
Sonderanfertigungen auf Gleichteile und standardisierte Module zu überprüfen.<br />
Diese Aufgabe verursacht zwar einmalig größere Kosten und Umstellungsaufwand,<br />
ist aber langfristig die zentrale Ausgangslage für eine effiziente Kostenposition.<br />
301<br />
5.4
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Durch die Modularisierung der Anlagenkomponenten sowie den Einsatz von CIM-<br />
Programmen und Rapid Manufacturing werden Größen- und Verbundvorteile erzielt.<br />
Die Abkehr von Losgröße eins in der Fertigung (Maßfertigung) ermöglicht eine<br />
bessere Auslastung der Maschinen sowie die Verkürzung von Rüstzeiten. Hierdurch<br />
entstehen Kosteneinsparungen im Vergleich zur Konkurrenz.<br />
F&E-Kosten können durch die Einbeziehung des Kunden reduziert werden.<br />
Basierend auf regelmäßigen Auswertungen der Kundenkonfigurationen wird das<br />
Angebot in Hinblick auf die Kundenbedürfnisse optimiert.<br />
Als Gefahren für Linel sind die folgenden Punkte zu nennen:<br />
Das Konzept muss grundlegend durchdacht und neu eingeführt werden; es gibt<br />
keinen Vorreiter. Damit ist großer Implementierungsaufwand zu erwarten.<br />
Es ist mit erheblichen Widerständen im Unternehmen selbst zu rechnen, da viele<br />
der klassischerweise im einzelkundenbezogenen Projektgeschäft tätigen Mitarbeiter<br />
und Entwickler vollkommen umdenken müssen. Ihre Aufgabe ist nicht mehr<br />
die Konkretisierung einer einzelkundenbezogenen Lösung, sondern vielmehr die<br />
langfristige Optimierung der Optionen, der Produktarchitekturen und des<br />
Konfigurationswerkzeugs.<br />
Der Konfigurationsprozess könnte für den Kunden ungewohnt sein. Kunden könnten<br />
ablehnend reagieren, da ihnen die Vorteile nicht sofort ersichtlich werden oder<br />
weil sie auf die persönliche Beratung durch den Verkäufer nicht verzichtet möchten.<br />
Das Mass-Customization-Angebot besitzt Grenzen. Besonders ausgefallene Kundenwünsche<br />
können eventuell nicht mehr befriedigt werden.<br />
Durch die zu Beginn anfallenden Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien,<br />
z. B. den Konfigurator, sowie die Kosten der Umstrukturierung<br />
des Fertigungsablaufs entsteht das Risiko, aus dem hart umkämpften Markt<br />
gedrängt zu werden, sollte sich der Erfolg nicht sofort einstellen.<br />
Ausblick und Entscheidungsfindung<br />
Wasser wird in Zukunft noch wertvoller und knapper werden. Immer neue Gesetze<br />
zwingen Unternehmen, Haushalte und Gemeinden, ihr Abwasser umweltgerecht zu<br />
entsorgen und gegebenenfalls wieder zu verwenden. Der Bedarf nach Lösungen zur<br />
Bewältigung des Problems der Wasserknappheit steht erst am Anfang; der Markt<br />
befindet sich im Wachstum. Die Realisierung eines Mass Customization Konzepts<br />
eröffnet die Chance, sich grundlegend von der Konkurrenz abzuheben. Die anfänglichen<br />
Investitionen könnten sich rasch amortisieren. Das Bedürfnis nach individuellen<br />
Lösungen auf Seite der Kunden wird dabei weiterhin befriedigt, jedoch sind Kosten<br />
und damit Preise niedriger, weshalb dieses Konzept sowohl Anbietern als auch<br />
Abnehmern entscheidende Vorteile bringt. Allerdings bedeutet die Einführung des<br />
Systems auch einen erheblichen Umstellungsaufwand und nicht wenige Risiken während<br />
der Einführungsphase, die ein mittelständisches Unternehmen wie Linel nicht<br />
einfach durch das Gesamtgeschäft ausgleichen kann.<br />
302
Effizienz der interaktiven Wertschöpfung<br />
Fragen zur Diskussion der Fallstudie<br />
Versuchen Sie durch eine Internet-Recherche aktuelle Daten zu Unternehmen und<br />
Wettbewerbern herauszubekommen. Finden Sie Beispiele von Unternehmen, die sich ähnlich<br />
aufgestellt haben wie Linel.<br />
Was ist aus Ihrer Sicht die wesentliche Chance durch die Einführung eines Mass-<br />
Customization-Programms in diesem Unternehmen?<br />
Sehen Sie weitere Risiken als die im Fall genannten? Welches Risiko sehen Sie am nachhaltigsten?<br />
Wie beurteilen Sie den angestrebten Wechsel vom persönlichen Vertrieb zu einem Online-<br />
Verkaufsprozess?<br />
Wie könnte ein kleineres mittelständisches Unternehmen den Einführungsprozess des Mass-<br />
Customization-Angebots am besten gestalten? Wie kann die Geschäftsleitung am besten alle<br />
betroffenen Abteilungen „mit ins Boot holen“?<br />
Wie können Sie das Konzept der Economies of Integration für dieses Unternehmen konkretisieren?<br />
5.5 Effizienz der interaktiven Wertschöpfung –<br />
eine Kalkulation am Beispiel von<br />
Maßkonfektion<br />
Diese Fallstudie soll die Kostensenkungspotenziale einer interaktiven Wertschöpfung<br />
genauer konkretisieren. Sie demonstriert an einem Beispiel, wie sich die Kosten- und<br />
Profitstruktur von Mass Customization gestaltet. Ziel dieses Abschnitts ist, Anregungen<br />
zu geben, diese Kalkulation auch auf andere Branchen zu übertragen. Dazu werden<br />
anhand eines fiktiven Beispiels, aber auf Basis realer Zahlen, die einzelnen Rechenschritte<br />
gegenübergestellt. Beispielindustrie ist die Bekleidungsbranche, die eine<br />
Vorreiterrolle in Hinblick auf die Umsetzung von Mass Customization innehat. 5<br />
Hintergründe zu Mass Customization in der Bekleidungsindustrie<br />
Die Vorteile von Mass Customization im Bekleidungsbereich liegen auf der Hand:<br />
Endlich muss ein Kunde keine Kompromisse mehr zwischen Passform- und<br />
Designvorstellungen eingehen. Obwohl für betuchte Menschen schon immer die<br />
Möglichkeit bestand, sich maßgeschneiderte Anzüge, Kostüme, Hemden und auch<br />
Schuhe anfertigen zu lassen, erfolgt der Großteil der Kleidungskäufe von der Stange.<br />
Mass Customization (oder Maßkonfektion) bietet hier eine Alternative zwischen dem<br />
hoch individuellen und meist handwerklichen Vorgehen eines Schneiders und der<br />
5 Die Fallstudie basiert auf einem Beitrag von Falk-Hayo Sanders, Christof Stotko und <strong>Frank</strong><br />
<strong>Piller</strong> für das Buch „Mass Customization und Kundenintegration: Neue Wege zum innovativen<br />
Produkt“, Düsseldorf: Symposion Verlag. Die Fallstudie ist zu Illustrations- und<br />
Lehrzwecken erstellt worden und kann ein vereinfachtes oder modifiziertes Abbild der<br />
Wirklichkeit darstellen. Sie berichtet nicht wirklichkeitsgetreu über derzeitige und zukünftige<br />
Aktivitäten des dargestellten Unternehmens.<br />
303<br />
5.5
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
standardisierten Kleidung industrieller Herstellung (siehe Kasten 5–2 für einige<br />
Beispiele).<br />
Abbildung 5–20 zeigt die einzelnen Schritte der Erstellung von Maßkonfektion. Die<br />
Wertschöpfungskette beginnt bei der Erhebung von Scannerdaten des Kunden (und<br />
zusätzlicher Informationen zur Ausstattung etc.). Diese Daten werden dann automatisch<br />
in ein Schnittmuster übertragen (oder einer größeren Bibliothek von<br />
Schnittmustern zugeordnet),das dann in der Regel mit einem Lasercutter im<br />
Einzellagenzuschnitt in die passenden Komponenten des gewählten Stoffs überführt<br />
wird, Alle weiteren Schritte sind dann aber weitgehend die gleichen wie bei einer<br />
Standardproduktion.<br />
Abbildung 5–20: Wertschöpfungskette bei Maßkonfektion<br />
3D-<br />
Scanner<br />
Kunde<br />
3D<br />
Mensch<br />
Modell<br />
Messdaten normierte<br />
Körpermaße<br />
Auslieferung<br />
Schnitt-<br />
System<br />
Konstruktionsmaße<br />
Kasten 5–2: Beispiele für Maßkonfektion im Internet<br />
Schnittdaten<br />
Produktions<br />
-Leitsystem<br />
Endkontrolle<br />
Einlagenzuschnitt<br />
Nähplatz<br />
Nähplatz<br />
Bügelplatz<br />
Dolzer GmbH, Deutschland (dolzer.de): Der deutsche Pionier und größte Anbieter<br />
Land’s End (landsend.com): Nutzt die Dienste des Systemintegrators Archetype, um<br />
Maßkonfektion umzusetzen.<br />
MeJeans (mejeans.com) und UJeans (UJeans.com): Individuelle Jeans mit großer Auswahl,<br />
aber sehr komplexe Websites.<br />
304
Kalkulationsbeispiel<br />
Effizienz der interaktiven Wertschöpfung<br />
Polo Ralph Lauren (polo.com): Erste Personalisierungsschritte eines großen Anbieters.<br />
Literaturempfehlungen zur Individualproduktion in der Bekleidungsindustrie<br />
Seidl, Andreas et al. (Hg.) (2001) Zukunft Maßkonfektion. Technik, Markt und Management.<br />
<strong>Frank</strong>furt/M.: Deutscher Fachverlag 2001.<br />
Steffen, Marion (2001). Strategische Netzwerke für komplexe Konsumgüter am Beispiel der<br />
industriellen Maßkonfektion. <strong>Frank</strong>furt am Main: Lang 2001.<br />
Ulrich, Pamela / Anderson-Connell, Lenda Jo / Wu, Weifang (2003). Consumer co-design of<br />
apparel for mass customization. Journal of Fashion Marketing and Management, 7 (2003) 4:<br />
398-412.<br />
Als Beispiel dient Vertrieb und Produktion einer individuellen Damenhose, produziert in<br />
Asien und vertrieben über den stationären Handel in Europa. Sie erzielt im Beispiel einen<br />
Verkaufspreis von 100 Euro. Die zu realisierenden Potenziale ergeben sich aus dem<br />
Vergleich mit den Bedingungen, die herrschen, wenn das Produkt klassisch nach den Prinzipien<br />
der Massenfertigung (Variantenfertigung) hergestellt und vertrieben würde. Als<br />
Übersicht der Effekte dient Abbildung 5–21. Sie gibt schematisch wieder, wie sich die einzelnen<br />
Economies auf den Deckungsbeitrag von Maßkonfektionsware auswirken. Ausgangspunkt<br />
ist dabei eine (heute bereits optimistische) Umsatzrendite von fünf Prozent.<br />
Diese kann sich durch Mass Customization – trotz höherer Kosten – fast verdoppeln (wenn<br />
lediglich eine singuläre Transaktion betrachtet wird, bei Berücksichtigung von Folgekäufen<br />
oder mittelbaren Kostensenkungspotenzialen ist das Ertragssteigerungspotenzial sogar<br />
noch höher, was der „Berichtsposten“ am rechten Rand des Schemas ausdrücken soll).<br />
Abbildung 5–21: Kostenstruktur Maßkonfektionsware (Datenmaterial nach Sanders 2001)<br />
Basis: 100 EUR<br />
5<br />
Deckungsbeitrag<br />
Standard<br />
13<br />
Vermeidung<br />
von Rabatten<br />
und<br />
Discounts<br />
Vermeidung von<br />
Verschwendung<br />
4<br />
Reduktion<br />
der Lagerbestände<br />
(statt 100 nur<br />
5 Tage zu<br />
15% p.a.)<br />
1<br />
Vermeidung<br />
Diebstahlrisiko<br />
Preis-Premium<br />
5<br />
Erhöhte<br />
Preisbereitschaft<br />
Ziel: Reduzierung der zusätzl. Kosten<br />
durch Modularisierung & Stabilität<br />
-9<br />
Erhöhte<br />
Produktionskosten<br />
(+18%<br />
auf Basis 50<br />
EUR)<br />
-3<br />
Erhöhte<br />
Transportkosten<br />
-3<br />
Änderungsaufwand<br />
(10% der<br />
Aufträge)<br />
-4<br />
Berichtsposten:<br />
Profitsteigerung durch Vorteile<br />
bei Kundenbeziehungen,<br />
Vermeidung entgangener<br />
Umsätze durch<br />
Budgetverlagerung etc.<br />
9<br />
Kosten der Deckungs- zzgl. weitere<br />
Kundenbeitrag mgl. Savinginteraktion<br />
Mass potenziale<br />
Customization<br />
x<br />
305<br />
5.5
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Kostensenkungspotenziale<br />
Das Potenzial einer Reduktion von Verschwendung schlägt sich in diesem Fall in drei<br />
großen Blöcken nieder, die im Beispiel eine gesamte Kostensenkung von 18 Euro<br />
bewirken können.<br />
Dies sind im Einzelnen:<br />
die Vermeidung von Discounts,<br />
die Reduktion der Lagerbestände,<br />
die Verringerung des Diebstahlrisikos.<br />
Vermeidung von Discounts: Die Einsparungen durch Vermeidung von Discounts<br />
machen mit 13 Euro den Löwenanteil aus. Diese Rechnung ist in Abbildung 5–22<br />
genauer aufgeschlüsselt. Die Kalkulation geht von der Annahme aus, dass nur 60<br />
Prozent der Massenware zum Listenpreis verkauft werden kann. Die übrigen 40<br />
Prozent sind nur durch zum Teil erhebliche Preisnachlässe im Markt zu positionieren.<br />
Dabei erfahren 20 Prozent der Bestände eine Preisreduktion von 30 Prozent, 15 Prozent<br />
werden um 40 Prozent reduziert und fünf Prozent werden gar mit Rabatten von 60<br />
Abbildung 5–22: Vergleich Abschriften bei Massenkonfektion und Mass Customization<br />
(Datenmaterial nach Sanders 2001)<br />
100%<br />
Erlös bei<br />
unverb.<br />
Preisempfehlung<br />
306<br />
5%<br />
15%<br />
20%<br />
60%<br />
Standardkonfektion Maßkonfektion<br />
Abschriften: 15%<br />
Zu 40%<br />
Zu 60%<br />
Zu 70%<br />
Zu 100%<br />
(1. Katalogpreis)<br />
85%<br />
9% 2%<br />
14%<br />
60%<br />
Tatsächlicher<br />
Bruttoerlös<br />
100% 96,5%<br />
5% Zu 30%<br />
1,5%<br />
10%<br />
Zu 100%<br />
(aber Änderungen,<br />
die ca. 30 % des<br />
VK ausmachen)<br />
10%<br />
85%<br />
13 %<br />
Erlös bei<br />
unverb.<br />
Preisempfehlung<br />
Abschriften: 3,50%<br />
Zu 100%<br />
(1. Katalogpreis)<br />
85%<br />
Tatsächlicher<br />
Bruttoerlös
Effizienz der interaktiven Wertschöpfung<br />
Prozent angeboten. Daraus ergibt sich in der Summe ein Verkaufswert der Bestände an<br />
massenhaft gefertigter Konfektionsware, der nur 85 Prozent dessen ausmacht, was<br />
zum Verkauf bereitgestellt wurde. Diese Annahmen sind für die Bekleidungsindustrie<br />
sehr konservative Einschätzungen, in der Realität ist die Situation oft noch weitaus<br />
drastischer.<br />
Im Gegensatz dazu wird angenommen, dass 85 Prozent der kundenindividuell gefertigten<br />
Hosen zum Listenpreis abgenommen werden. Die übrigen 15 Prozent setzen<br />
sich aus solchen Bestellungen zusammen, die entweder nicht optimal sitzen und geändert<br />
werden müssen (zehn Prozent) oder aus solchen, die der Kunde nicht annehmen<br />
will, beispielsweise weil sie im Design nicht seinen Vorstellungen entsprechen (fünf<br />
Prozent). Für die Änderungen wird angenommen, dass sie mit einem Aufwand von ca.<br />
30 Prozent des Verkaufspreises durchgeführt werden können (dies entspricht den<br />
zusätzlichen Kosten von drei Euro im Schnitt aller verkauften Stücke). Nachdem diese<br />
Änderungen durchgeführt sind, nimmt der Kunde das Produkt zum vollen Preis ab.<br />
Die fünf Prozent der Bestände, deren Annahme der Kunde verweigert, werden mit<br />
einem Preisnachlass von 70 Prozent verkauft (in Factory- oder Second-Hand-Läden).<br />
Insgesamt wird bei Mass Customization ein Verkaufswert von 96,5 Prozent der zum<br />
Verkauf bereitgestellten Waren erreicht. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung um<br />
fast zwölf Prozentpunkte.<br />
Vermeidung von Fehlbeständen: Die Vermeidung von Verschwendung durch eine<br />
Verringerung des Diebstahlrisikos zählt ebenfalls zu den Economies of Decoupling.<br />
Ware, die erst auf Kundenwunsch gefertigt wird, kann nicht ohne weiteres gestohlen<br />
werden. Die im Beispiel angesetzten ein Prozent des Umsatzes sind ebenfalls recht<br />
konservativ geschätzt, viele Untenehmen verbuchen Ausfälle zwischen zwei und drei<br />
Prozent.<br />
Vermeidung von Beständen und Liegezeiten: Die Vermeidung von Discounts hat nur<br />
die Wirkungen niedrigerer Erlöse für abgesetzte Ware berücksichtigt. Hinzu kommen<br />
noch die oft erheblichen Einsparpotenziale durch die Reduktion der Distributions- und<br />
Zwischenlagerhaltung. Im Bereich der Modeindustrie fallen die Lagerkosten der<br />
Rohmaterialien (Stoffe) im Verhältnis zu den gesamten Kosten nicht ganz so stark ins<br />
Gewicht wie beispielsweise in Industrien, die mit sehr teuren Einstandmaterialien<br />
arbeiten (z. B. Computerindustrie). Auch in der Modeindustrie lassen sich die<br />
Lagerzeiten stark verringern (von 100 Tagen auf fünf Tage bei Mass Customization).<br />
Wir haben den Effekt im Beispiel mit vier Prozent Einsparpotenzial angesetzt. Dies entspricht<br />
den reinen Kapitalbindungskosten. Hinzu kommen aber noch die hier nicht<br />
quantifizierten Möglichkeiten zur Reduktion durch Verschwendung durch eine erhöhte<br />
Flexibilität, Übersichtlichkeit und die Vermeidung der Lagerhaltungskosten<br />
(Schwund, Lagerlogistik etc.).<br />
Vermeidung entgangener Umsätze und Reduktion des Moderisikos: Nicht in unserer<br />
Beispielskalkulation aufgeführt sind zwei weitere Wirkungen auf die Kosten- und<br />
Umsatzstruktur. Zum einen vermeidet Mass Customization entgangene Umsätze<br />
durch Kunden, die im Standardsortiment nichts Passendes finden und deshalb ihr<br />
Budget verlagern. In der Modeindustrie besteht hier aus Sicht eines Einzelhändlers ein<br />
großes ungenutztes Umsatzpotenzial, wenn Händler Kunden, die keine gewünschte<br />
307<br />
5.5
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Größe oder Farbe finden, nicht zur Konkurrenz verweisen müssen, sondern ein passendes<br />
Stück nach Maß anbieten können. Der bessere Zugang zu Kunden-Know-how<br />
trägt weiterhin dazu bei, dass das Moderisiko stark gemildert wird. Im Gegensatz zu<br />
einem Massenfertiger ist ein Mass Customizer nicht darauf angewiesen, die<br />
Abnahmemengen verschiedener Kollektionen in Bezug auf Menge und vor allem Stil<br />
und Modell zu prognostizieren. Durch die Integration des Kunden in den<br />
Wertschöpfungsprozess wird die Ware erst dann produziert, wenn der Kunde den<br />
Auftrag dazu gibt. Dadurch werden einerseits die oben bereits angeführten Discounts<br />
für Fehlplanungen vermieden. Zum anderen gewinnt ein Händler aber auch wertvolle<br />
Informationen zur Optimierung des Sortiments und eine bessere Modellpolitik –<br />
wesentliche Voraussetzung für dauerhaft zufriedene und treue Kunden.<br />
Die Höhe dieser zusätzlichen Umsatzpotenziale ist schwer aus einer generellen Sicht<br />
zu quantifizieren. Hierzu sind firmenabhängige Befragungen und Abschätzungen notwendig,<br />
deren Mechanismen an dieser Stelle nicht dargestellt werden können. Nach<br />
unserer Erfahrung lassen sich aber Potenziale von bis zu 30 Prozent des Umsatzes der<br />
Ausgangssituation zusätzlich herausholen. Viel wichtiger als eine genaue Kalkulation<br />
ist aber das bloße Erkennen dieser Möglichkeiten. Sie können als ergänzender Faktor<br />
in eine Kalkulation einfließen, sollten aber nicht deren Basis bilden.<br />
Zusätzliche Preisbereitschaft<br />
In der Kalkulation ist ebenfalls die Möglichkeit dargestellt, einen höheren Preis für das<br />
individuelle Gut zu fordern. Diese Umsatzsteigerung berücksichtigt noch nicht die<br />
Möglichkeit, ein Preis-Premium zu erheben . Die Differenzierungswirkung von Mass<br />
Customization führt zu einer Erhöhung der Preisbereitschaft der Kunden. Diese ist im<br />
Beispiel – sehr konservativ– auf lediglich fünf Euro geschätzt. Hier lassen sich weitaus<br />
höhere Potenziale verwirklichen, wie die Praxis zeigt. Allerdings sollte sich ein Mass-<br />
Customization-Konzept auch ohne Preissteigerungen tragen können, weshalb wir in<br />
unserem Beispiel nur ein geringes Premium ansetzen.<br />
Gegenrechung: Höherer Aufwand durch Mass Customization<br />
Auf der anderen Seite stehen die zusätzlichen Kosten, die bei Produktion und Vertrieb<br />
kundenindividueller Produkte entstehen (vgl. noch einmal Abbildung 5–23). Sie sind<br />
Folge des steigenden Produktions-, Transport und vor allem höheren Interaktionsaufwands.<br />
In unserem Beispiel macht diese Kostensteigerung in der Summe 19 Euro aus.<br />
Die Höhe hängt dabei direkt von der Fähigkeit ab, Synergieeffekte auf der Modulebene<br />
zu realisieren.<br />
Steigende Kosten in der Produktion: Abbildung 5–23 legt schematisch dar, wie sich<br />
die Produktionskosten bei Individualkleidung im Vergleich zur Massenfertigung<br />
ändern (unsere Annahme folgt dabei einer Produktion in Asien). Dabei scheinen sich<br />
insbesondere die entgangenen Skaleneffekte im Zuschnitt des Stoffes niederzuschlagen.<br />
Anstatt wie in der Massenfertigung mehrere Lagen Stoff in einem Arbeitsgang auf<br />
eine standardisierte Konfektionsgröße zuschneiden zu können, muss nun jede Lage<br />
Stoff einzeln mit den individuellen Maßen des Kunden zurechtgeschnitten werden.<br />
Jedoch konkretisiert sich aufgrund des geringen Wertschöpfungsanteils an der gesamten<br />
Wertschöpfungskette auch eine Kostensteigerung von 500 Prozent in nur wenigen<br />
308
Effizienz der interaktiven Wertschöpfung<br />
zusätzlichen Eurocent. An dieser Stelle machen viele Praktiker einen Fehler, indem einzelne<br />
Kostenblöcke herausgehoben werden, ohne die gesamte Wertschöpfungskette zu<br />
betrachten. Entscheidende neue Kostenblöcke fallen durch Umrüstzeiten und vor<br />
allem den steigenden Abwicklungsaufwand zur Integration der Kundeninformationen<br />
in den Fertigungsablauf an. Insgesamt steigen in unserer Rechnung die reinen Produktionskosten<br />
um 18 Prozent (bzw. neun Euro bezogen auf einen Einkaufspreis von ehemals<br />
50 Euro).<br />
Abbildung 5–23: Kostenerhöhung bei individueller Fertigung von Konfektionsware in Asien<br />
(Datenmaterial nach Sanders 2001)<br />
Stoff<br />
Zuschnitt<br />
Verarbeitung<br />
(Nähen, Bügeln,<br />
Handling)<br />
Sonstige<br />
Kosten /<br />
Gewinnanteil<br />
Standardkonfektion Maßkonfektion<br />
50 EUR<br />
11,00 EUR<br />
6,80 EUR<br />
31,90 EUR<br />
0,30 EUR<br />
(45 min<br />
dir. + indir.<br />
bei 9 EUR/h)<br />
Summe:<br />
+ 18%<br />
+ 25% (mehr Abschriften)<br />
(Einzellagen statt Mehrlagen)<br />
+ 500%<br />
+ 25% (erhöhte Umrüstungen)<br />
+ 10% (höhere Abwicklungskosten)<br />
59 EUR<br />
13,70 EUR<br />
1,80 EUR<br />
8,50 EUR<br />
35,00 EUR<br />
Steigende Transportkosten: Erhöhte Transportkosten ergeben sich aus der Tatsache,<br />
dass Transporte nicht, wie im Massenhandel üblich, gebündelt werden können. Die<br />
Höhe der zusätzlichen Transportkosten, im Beispiel mit drei Prozent bzw. sechs Euro<br />
angesetzt, hängt entscheidend vom Produkt, den Standorten und vor allem möglichen<br />
Bündelungseffekten ab. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass der Hersteller<br />
in einem eigenen Luftfrachtcontainer die Waren von der asiatischen Fabrik zum<br />
Ladengeschäft versendet. Dies setzt natürlich genügend große Absatzmengen und eine<br />
Bündelung von Aufträgen voraus (siehe Abbildung 5–24, welche die gesamte mögliche<br />
Durchlaufzeit eines Auftrags bei Fertigung in Asien zeigt). Eine Verzögerung des<br />
Liefertermins, die sich aus einer Bündelung mehrerer Bestellungen ergeben würde,<br />
wird vom Kunden nur in engen Grenzen akzeptiert. Deshalb sollten die angegeben<br />
Liefertermine großzügig berechnet werden, um noch ausreichenden Raum für<br />
Optimierungen zu besitzen.<br />
309<br />
5.5
5<br />
Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung<br />
Abbildung 5–24: Durchlaufzeiten der kundenindividuellen Massenfertigung einer<br />
Damenhose in Asien (Datenmaterial nach Sanders 2001)<br />
Änderungskosten und zusätzlicher Interaktionsaufwand: Wie hoch der zusätzliche<br />
Änderungsaufwand ausfällt, hängt damit zusammen, welches Qualitätsniveau der<br />
Gesamtprozess hat. In unserem Beispiel rechnen wir (wie bereits beschrieben), dass<br />
jeder zehnte Auftrag Änderungskosten von 30 Prozent des Verkaufspreises verursacht<br />
(bzw. in einer Mischkalkulation drei Euro für jedes abgesetzte Kleidungsstück).<br />
Ursachen von Änderungen sind neben den üblichen Fehlerquellen in der Produktion<br />
vor allem Fehler im Interaktionsprozess. Hier ist die Qualität des Verkaufspersonals<br />
und der unterstützenden Prozesse der entscheidende Einflussfaktor. Damit bedingen<br />
sich Änderungskosten und zusätzliche Interaktionskosten (Transaktionskosten) gegenseitig.<br />
Besonders die Abschätzung der zusätzlichen Interaktionskosten ist nicht einfach.<br />
Wir haben uns in unserem Beispiel auf Branchenangaben verlassen und den<br />
zusätzlichen Aufwand (gegenüber den bereits bestehenden Kosten für Verkaufsräume<br />
und -personal) mit vier Euro pro Auftrag berechnet. Diese Rechnung ist jedoch wieder<br />
stark einzelfallabhängig und umfasst in unserem Fall eine Mischkalkulation aus<br />
Erstkauf, bei dem viele Daten erhoben werden müssen, und dem Aufwand für<br />
Wiederholungskäufe, wo auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen werden kann.<br />
Gesamtwirkung einer Transaktion – und zusätzliche Potenziale durch Wiederholungskäufe<br />
Insgesamt ergibt sich aus der Addition der eingesparten Kosten und der zusätzlichen<br />
Preisbereitschaft bei Subtraktion der zusätzlichen Kosten eine mögliche Steigerung des<br />
Deckungsbeitrages von vier Prozent. Dies kann die Gewinnsituation vieler Einzel-<br />
310<br />
GESAMT<br />
Auslieferung an Kunde<br />
Umladen in Versandkartons<br />
Lufttransport<br />
Transport zum Flughafen<br />
Nähen, Bügeln, Verpacken<br />
Zuschnitt (inkl. Vorbereitg.)<br />
Auftragserfassung<br />
(tägliche Auftragsübertragung)<br />
Ablauf der Logistikkette für Masskonfektion aus Asien<br />
per LKW<br />
in kleinen flexiblen Gruppen<br />
Vorbereitung auf CAD, Einzellagencutter<br />
8 – 14 Tage<br />
per UPS, DPD etc.<br />
nahe Flughafen<br />
auf Paletten, in Folie, in Kartons<br />
Zusätzliche Erfassungsmasken und Übertragungssoftware<br />
5 10 15 Kalendertage
Effizienz der interaktiven Wertschöpfung<br />
händler ganz entscheidend verbessern, vorausgesetzt, Mass Customization wird nicht<br />
als reines Add-on zur Imagesteigerung verstanden, sondern als Grundlage einer<br />
durchgreifenden Geschäftsstrategie.<br />
Wichtig ist zu beachten, dass unsere Berechnung nur einen Verkaufsprozess darstellt<br />
und die Transaktion einer Hose umfasst. Hinzu kommen noch Kostensenkungs- und<br />
Umsatzsteigerungspotenziale aufgrund der Möglichkeit von Mass Customization, die<br />
Kundenbindung zu erhöhen (Economies of Relationship). Zum einen kann mit steigender<br />
Bindungsintensität eines Kunden an einen Anbieter die Preisbereitschaft steigen.<br />
Dieser zusätzliche Deckungsbeitrag kann weiter gesteigert werden, wenn die<br />
Beziehung zum Kunden dazu genutzt wird, weitere Produkte abzusetzen (Cross- und<br />
Up-selling). Ebenso werden die Interaktionskosten – wie bereits angeführt – oft bei<br />
Wiederholungskäufen stark sinken. Ebenfalls sind in der Kalkulation die Kostensenkungspotenziale<br />
aus Economies of Integration und Umsatzsteigerungen durch die<br />
Vermeidung von Budgetverlagerungen von Kunden, die kein passendes Standard-<br />
Stück finden, noch nicht enthalten, sondern nur als Berichtsposten in Abbildung 5–21<br />
aufgeführt. Hier ergibt sich noch ein weiteres Potenzial zur Umsatzsteigerung.<br />
Fragen zur Diskussion der Fallstudie<br />
Stellen Sie die Besonderheiten der Modeindustrie heraus, die die Grundlage für die dargestellte<br />
Kostenstruktur sind. In welchen anderen Branchen findet sich eine vergleichbare Situation,<br />
in welchen Branchen sind dagegen die Ausgangsbedingungen ganz anders?<br />
Wie können Sie herausfinden, welche Potenziale durch eine Steigerung der Absatzeffizienz<br />
zusätzlich erreicht werden können?<br />
Welche wichtigen Kosten sind in der dargestellten Kalkulation nicht enthalten? Wie können Sie<br />
diese quantifizieren?<br />
Gruppenaufgabe: Übertragen Sie diese Kalkulation auf ein Unternehmen oder eine Branche<br />
Ihrer Wahl (Hinweis: Auf Branchenebene finden Sie über den jeweiligen Verband der<br />
Produzenten meist einfacheren Zugang zu den Ausgangsdaten). Vergleichen Sie die Ergebnisse.<br />
311<br />
5.5
6 Zusammenfassung und Ausblick<br />
Interaktive Wertschöpfung in der Unternehmenspraxis<br />
Adidas, Amazon, BMW, CafePress, Dell, Factory 121, Flickr, Hyve, Innocentive, LEGO,<br />
Linux, Liquid Paper, Loewe, Muji, Personal Novel, Podcasts, Procter & Gamble, Selve,<br />
Spreadshirt, Swarovski, Threadless, Timbuk2, Wikipedia, Zagat, Zazzle, ZeroPrestige<br />
– all diese Unternehmen oder Initiativen sind Beispiele für die Prinzipien der interaktiven<br />
Wertschöpfung, die wir in diesem Buch vorgestellt haben. Wir warten gespannt<br />
darauf, bis das im Januar 2006 relaunchte OsCar-Projekt (Open-Source-Car) eine ernsthafte<br />
Alternative zu den Automobilen der großen Hersteller bietet. Bei weniger komplexen<br />
Produkten ist genau dies heute schon der Fall. Unser Ziel war es, eine neue<br />
Sichtweise der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung zu diskutieren, die auf der<br />
aktiven Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Kunden bzw.<br />
Nutzern basiert.<br />
Die Evolution der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung<br />
Aus der klassischen industriellen Vorstellung der Wertschöpfung (die aber immer<br />
noch das Denken vieler Manager und Wissenschaftler prägt!) hat sich in einem evolutionären<br />
Prozess ein neues Wertschöpfungsmodell gebildet, das die klassischen<br />
Koordinationsprinzipien Hierarchie und Markt durch neue Prinzipien ergänzt. Es war<br />
das Ziel unserer Ausführungen, einen Bezugsrahmen zu bilden, der verschiedene<br />
Theorie-Bausteine und Prinzipien zusammenfügt, die aus der Organisationsforschung<br />
sowie dem Innovations-, Technologie- und Produktionsmanagement abgeleitet werden.<br />
Interaktive Wertschöpfung ist nicht universell anwendbar und soll keine bewährten<br />
Konzepte ersetzen. Es handelt sich vielmehr um eine Ergänzung bewährter<br />
Ansätze und Instrumente des Innovations- und Produktionsmanagements.<br />
Ausgangspunkt unserer Darstellung war die klassische industrielle Massenproduktion<br />
auf Basis tayloristischer Prinzipien der Arbeitsgestaltung und hierarchischer<br />
Organisationsstrukturen. Dieses konventionelle Wertschöpfungsmodell orientiert sich<br />
streng an den Zielen der “Produktivität” und der “Kostenwirtschaftlichkeit” in der<br />
Produktion, realisiert durch das Streben nach maximalen Skaleneffekten und einer<br />
Zerlegung des Wertschöpfungsprozesses in kleinste Einheiten.<br />
Das Leitbild der vernetzten Wirtschaft<br />
Doch stabile Rahmenbedingungen und langfristig prognostizierbare Absatzmärkte –<br />
die Voraussetzungen für die effiziente Anwendung dieses klassischen Wertschöpfungsmodells<br />
– gibt es heute in immer weniger. Die Globalisierung und der damit einhergehende<br />
Kostendruck und die gleichzeitig steigende Heterogenisierung der<br />
Nachfrage verlangen von Anbietern neue Wettbewerbskonzepte und Ideen für die<br />
Wertschöpfung. Die Potentiale der neuen Informations- und Kommunikations-<br />
313
6<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
technologien bieten einen neuen Lösungsraum: die Abflachung und die Auflösung<br />
hierarchischer Unternehmensstrukturen zugunsten modularer dezentraler Organisationsformen,<br />
Netzwerkorganisationen und elektronische Märkte bilden neue<br />
Plattformen für eine flexible Entwicklung und Produktion auf Kundenbestellung.<br />
Das Leitbild der interaktiven Wertschöpfung<br />
Wir sehen heute, dass Kunden das Ergebnis betrieblicher Wertschöpfung nicht nur<br />
konsumieren, sondern selbst einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Wert leisten.<br />
Dies geschieht dabei nicht nur autonom in der Kundendomäne, sondern auch in<br />
einem interaktiven und kooperativen Prozess mit Herstellern und anderen Nutzern<br />
einer Leistung. Kunden und Nutzer tragen dazu bei, die Kenntnisse, Fähigkeiten und<br />
Ressourcen eines Herstellers zu erweitern. Dieses Konzept einer interaktiven<br />
Wertschöpfung erweitert den Gedanken der Netzwerkorganisation um einen wesentlichen<br />
Schritt: die Nutzung des Wissens von Kunden und Nutzern für die<br />
Wertschöpfung. Das verteilte Potenzial individueller Wissensträger, insbesondere von<br />
Anwendern und Endabnehmern der jeweiligen Produkte, wird für die Wertschöpfung<br />
erschlossen. Die Kunden bringen sich in vormals autonome Wertschöpfungsaktivitäten<br />
des Herstellerunternehmens ein und führen diese teilweise selbst aus, um so ihr<br />
(lokales) Wissen zu artikulieren und zu explizieren.<br />
Die Radikalität des Ansatzes entscheidet über die Rolle der Akteure<br />
Bezugspunkte der interaktiven Wertschöpfung können alle Phasen des Wertschöpfungsprozesses<br />
sein: von der Ideengenerierung bis zur Markteinführung. Entsprechend<br />
verläuft der Intergrationsgrad des Wertschöpfungspartners mehr oder<br />
weniger radikal. Entlang dieser Evolution der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung<br />
ändert sich aber nicht nur die Sichtweise, welche Akteure am Wertschöpfungsprozess<br />
aktiv beteiligt sind, sondern auch die Vorstellung, wie das<br />
Organisationsproblem, d. h. die Koordination und Motivation der einzelnen Akteure,<br />
die die Gesamtaufgabe arbeitsteilig vollziehen, am besten gelöst werden kann. Taylors<br />
Modell setzt vor allem auf die hierarchische Koordination und Motivation durch finanzielle<br />
Anreize in einem geschlossenen Wertschöpfungssystem. Die Netzwerkansätze<br />
erweitern diese Vorstellung um eine Kombination marktlicher und hierarchischer<br />
Koordinationsformen und betonen darüber hinaus auch eine Motivation durch nichtmonetäre<br />
Anreize. Die interaktive Wertschöpfung ergänzt diese beiden klassischen<br />
Koordinationsformen (Hierarchie und Markt) durch einen dritten Weg: das Organisationsprinzip<br />
einer „commons-based-peer-production“. Diese Organisation des<br />
Wertschöpfungsprozesses verlangt eigene Organisationsprinzipien und Kompetenzen<br />
der Akteure. Beispiele bilden die Selbstselektion und Selbstorganisation von Aufgaben<br />
durch (hoch) spezialisierte Akteure, deren Motivation vor allem die (eigene) Nutzung<br />
der kooperativ geschaffenen Leistungen ist. Hinzu kommt jedoch eine Vielzahl weiterer<br />
sozialer, intrinsischer und extrinsischer Motive.<br />
Formen interaktiver Wertschöpfung<br />
Wir haben uns in diesem Buch auf das Innovations- und das Produktionsmanagement<br />
konzentriert. Je nach Ausmaß und Phase des Wertschöpfungsprozesses, in der die<br />
314
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Kundenintegration stattfindet, haben wir zwei wesentliche Formen interaktiver<br />
Wertschöpfung unterschieden:<br />
Open Innovation bezeichnet die systematische Integration von Kundenaktivitäten<br />
und Kundenwissen in einzelne oder (im Extremfall) alle Phasen des Innovationsprozesses.<br />
Auf diese Weise entsteht zwischen einem Unternehmen und seinen<br />
Kunden eine Wertschöpfungspartnerschaft, die durch eine integrierte System- und<br />
Problemlösungskompetenz charakterisiert ist. Kunden werden selbst aktiv und<br />
konkretisieren ihr implizites Wissen über neue Produktideen und Konzepte, unter<br />
Verwendung bestimmter Hilfswerkzeuge des Unternehmens. Dieses Vorgehen ist<br />
deutlich von so genannten “Voice of the Customer”-Verfahren wie QFD abzugrenzen.<br />
Diese Verfahren stellen zwar sehr leistungsfähige Methoden zur Verfügung,<br />
wie Unternehmen die Kundenorientierung im Innovationsprozess verbessern können.<br />
Sie verbleiben jedoch im klassischen Innovationsparadigma und entsprechen<br />
nicht unserer Auffassung von interaktiver Wertschöpfung. Bildhaft vollzieht sich<br />
die Interaktion im Innovationsprozess nach dem Phasenmodell von der<br />
Ideengenerierung über die Konzeptentwicklung bis hin zur Prototypen-Entwicklung<br />
und mündet schließlich aus der Sicht des Kunden in der Phase der Problemlösung.<br />
Der Open-Innovation-Ansatz ist insoweit ein ergänzender Ansatz zum herkömmlichen<br />
Innovationsmanagement. Produkt- und Markttest sowie Markteinführung<br />
werden aus Sicht des Herstellers nicht überflüssig, laufen jedoch wegen<br />
der Kundeninteraktion in den vorherigen Phasen nach einem anderen Muster und<br />
mit einem erheblich geringeren Marktrisiko ab.<br />
Im Produktionsbereich konkretisiert die Produktindividualisierung die interaktive<br />
Wertschöpfung. Jede Erstellung von individuellen Produkten ist durch eine<br />
Integration der Abnehmer in die Leistungserstellung geprägt. Schwerpunkt unserer<br />
Betrachtung war der Mass-Customization-Ansatz, d. h. die Individualisierung<br />
von Gütern und Leistungen für eine relativ große Zahl an Abnehmern unter ähnlichen<br />
Effizienzbedingungen eines vergleichbaren Massenproduktionssystems.<br />
Während die praktische Umsetzung von Open Innovation in vielen Unternehmen<br />
erst ganz am Anfang steht und deshalb hier nur eine recht geringe empirische Basis<br />
zur Ableitung von “promising practices” und Strukturen einer erfolgreichen<br />
Umsetzung besteht, ist die Umsetzung von Mass Customization deutlich weiter<br />
fortgeschritten. Die Analyse von Mass Customization konnte deshalb wichtige<br />
Anhaltspunkte für eine Gestaltung der Interaktionsprozesse und Instrumente für<br />
Open Innovation geben. Dies bezog sich insbesondere auf unsere Aufführungen<br />
zur Gestaltung der Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager.<br />
Allerdings wird nicht jede Art von Open Innovation oder Mass Customization alle<br />
Prinzipien der interaktiven Wertschöpfung, die wir in Kapitel 2 diskutiert haben, vollständig<br />
verwirklichen. Insbesondere das Modell der “Commons-based Peer Production”<br />
als Idealtyp der Organisation arbeitsteiliger Wertschöpfung findet sich heute erst<br />
ansatzweise umgesetzt. Bei den in der betrieblichen Realität heute vorhandenen<br />
Beispielen zu Open Innovation und insbesondere bei Mass Customization vollzieht<br />
sich die Integration von Kundenbeiträgen oft noch im Rahmen hierarchischer<br />
Arrangements – insbesondere, wenn es sich um materielle Güter handelt, bei denen<br />
315<br />
6
6<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
höhere Ansprüche an die Produktionsausstattung zur Erstellung der Produkte gestellt<br />
werden. Auch werden die resultierenden Entwicklungen oft unter den proprietären<br />
Schutz des fokalen Herstellerunternehmens gestellt (mittels klassischer Schutzrechte).<br />
Ziel unserer Ausführungen ist es deshalb, ein realistisches Bild einer interaktiven<br />
Wertschöpfung im Innovationsbereich zu zeichnen, dass mit der heutigen Wirklichkeit<br />
übereinstimmt. Die Fallstudien in Kapitel 5 belegen diese Situation.<br />
Neue Erfolgsfaktoren und Anwendungswissen<br />
Jedoch resultieren in allen Fällen einer interaktiven Wertschöpfung aus der Integration<br />
der Kunden in die Unternehmensaktivitäten innovative Prozessstrukturen, die die<br />
konventionelle Vorstellung von Arbeitsteilung zwischen Anbietern und Abnehmern<br />
aufbrechen. Dies verlangt in der Folge eine Redefinition der Kernkompetenzen, neues<br />
Wissen und neue Formen der Organisation und Koordination. Ein wesentlicher Faktor<br />
in diesem Zusammenhang ist der Aufbau von Interaktionskompetenz sowohl beim<br />
Unternehmen als auch bei den Kunden bzw. Nutzern.<br />
Diese neuen Erfolgsfaktoren umfassen beispielsweise<br />
Maßnahmen und Routinen zur Erschließung des Kundenwissens als Ressource,<br />
die gemeinsame Generierung von Bedürfnisinformationen und Lösungsinformationen,<br />
Reduzierung des Innovationsrisikos durch frühzeitige Integration des Kunden,<br />
Auswahl und Motivation geeigneter Kunden,<br />
die Gestaltung des Innovationsprozesses über die Unternehmensgrenzen hinaus,<br />
die Bereitstellung von Kommunikationsplattformen und Werkzeugen, die die Kundenintegration<br />
in den Wertschöpfungsprozess ermöglichen und für alle Akteure<br />
attraktiv werden lassen,<br />
den Aufbau von Controlling-Systemen, die den Wertbeitrag der Kunden für das<br />
Unternehmen sicht- und steuerbar machen,<br />
die Überwindung interner Barrieren im Herstellerunternehmen und der Aufbau<br />
einer interaktionsförderlichen Unternehmenskultur.<br />
Wir konnten in diesem Buch nur erste Ansatzpunkte zu einer Konkretisierung und<br />
Gestaltung dieser Erfolgsfaktoren geben. Hier bieten sich für weiterführende Arbeiten<br />
noch viele Ansatzpunkte. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Gedanken in der<br />
Praxis wird sich aber in den kommenden Jahren ein reiches Feld für empirische<br />
Arbeiten bieten. Diese müssen auch nähere Erkenntnisse zu den Grenzen und<br />
Anwendungsbedingungen der interaktiven Wertschöpfung ableiten. Auch hier stehen<br />
wir mit unserem Wissen erst ganz am Anfang.<br />
Diffusion der interaktiven Wertschöpfung<br />
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass auch die klassischen Organisationsprinzipien<br />
von Frederik Taylor viele Jahrzehnte gebraucht haben, bis sie in modernen Massen-<br />
316
produktionssystemen perfektioniert wurden. Gleiches gilt für die Umsetzung der<br />
Gedanken grenzenloser bzw. modularer Unternehmen, die trotz ihrer relativ langen<br />
Diskussion heute in vielen Unternehmen erst ansatzweise umgesetzt sind. Genauso<br />
wird es auch noch viele Jahre dauern, bis sich interaktive Wertschöpfung als breites<br />
Phänomen zeigt. Ein Faktor ist dabei jedoch anders:<br />
Anders als bei den klassischen Organisationsformen, die dem Änderungswillen und<br />
Beharrungsvermögen unternehmensinterner Stakeholder ausgesetzt waren, bestimmen<br />
bei der interaktiven Wertschöpfung die Kunden den Wandel und treiben diesen<br />
voran. Die neuen Internettechnologien, aber auch Innovationen in der Produktion, stellen<br />
heute eine Infrastruktur bereit, auf der sich interaktive Wertschöpfung im kleinen<br />
und ohne große Kapitalinvestitionen schnell und einfach entfalten kann – bei gleichzeitig<br />
hoher Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Qualität. Hinzu kommt ein Wandel im<br />
Bewusstsein vieler Kunden und Nutzer, die sich nicht länger als willige Konsumenten,<br />
sondern als Macher (“Maker”) und aktive Akteure sehen. All diese Entwicklungen<br />
werden unserer Meinung dazu führen, dass die Diffusionskurve der interaktiven<br />
Wertschöpfung deutlich steiler sein wird als die ihre Vorgänger in der Evolution<br />
arbeitsteiliger Wertschöpfung.<br />
Das letzte Wort haben unsere Kunden<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Aber das letzte Wort sollen unsere Kunden bzw. Leser haben (aus dem Vorwort): “Für<br />
mich ist diese interaktive Wertschöpfung vor allem eine Vision und ein Anreiz, bestehende<br />
Prinzipien zu überdenken. Ich will in meinem Unternehmen offen werden für<br />
externen Input. Das ist nicht immer einfach, aber ich bin mir sicher, es ist es wert.” “In<br />
einem Unternehmen gibt es ja auch ‘interne Kunden’ – auch hier können die Prinzipien<br />
der interaktiven Wertschöpfung helfen, Abteilungsdenken zu überwinden.”<br />
“Hoffentlich setzen immer mehr Unternehmen in Zukunft diese Prinzipien um – denn<br />
als Kunden habe ich viele gute Ideen, meinen Input einzubringen und all die Dinge zu<br />
ändern, die mich schon immer stören.” (Zitate unserer Leser)<br />
317<br />
6
Quellenverzeichnis<br />
Adams, Marjorie E. / Day, George S. / Dougherty, Deborah (1998). Enhancing new product<br />
development performance: an organizational learning perspective. Journal of<br />
Product Innovation Management, 15 (1998) 5: 403-422.<br />
Agrawal, Mani / Kumaresh, T.V. / Mercer, Glenn A. (2001). The false promise of mass customization.<br />
McKinsey Quarterly, 38 (2001) 3: 62-71.<br />
Akao, Yoji (1992). QFD - Quality Function Deployment: Wie die Japaner Kundenwünsche<br />
in Qualität umsetzen. Landsberg/Lech: Moderne Industrie 1992.<br />
Allen, Robert C. (1983). Collective invention. Journal of Economic Behavior and Organization,<br />
4 (1983) 1 (March): 1-24.<br />
Allen, Thomas (1977). Managing the flow of technology. Cambridge, MA: MIT Press 1977.<br />
Allen, Thomas J. (1966). Studies of the Problem-Solving Process in Engineering Design.<br />
IEEE Transactions on Engineering Management, 13 (1966) 2: 72-83.<br />
Amabile, Teresa M. (1996). Creativity in context. Oxford: Westview Press 1996.<br />
Amit, Raphael / Schoemaker, Paul (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic<br />
Management Journal, 14 (1993) 1: 33-46.<br />
Anderson, David M. (1997). Agile product development for mass customization: how to<br />
develop and deliver products for mass customization, niche markets, JIT, buildto-order,<br />
and flexible manufacturing. Chicago, IL: Productivity Press 1997.<br />
Anderson, David M. (2003). Build-to-order and mass customization. Cambria: CIM Press<br />
2003.<br />
Anderson, W. Thomas Jr. (1972). Convenience orientation and consumption behavior.<br />
Journal of Retailing, 48 (1972) 3: 49-71.<br />
Anderson, William L. / Crocca, William T. (1993). Engineering practice and co-development<br />
of product prototypes. Communications of the ACM, 36 (1993) 4: 49-56.<br />
Anthes, Gary H. (2004). Innovation inside out. Computerworld vom 13. Sep. 2004<br />
[online: www.computerworld.com/printthis/2004/0,4814,95854,00.html].<br />
Armstrong, Arthur / Hagel III, John (1996). The real value of on-line communities.<br />
Harvard Business Review, 74 (1996) 3 (May-June): 134-141.<br />
Arrow, Kenneth J. (1962). Economic welfare and the allocation of resource for invention.<br />
In: Richard Nelson (Hg.): The rate and direction of incentive activity, Princeton,<br />
NJ: Princeton University Press 1962: 609-625.<br />
Babin, Barry J. / Darden, William R. / Griffin, Mitch (1994). Work and/or fun: measuring<br />
hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20<br />
(1994) 4: 644-656.<br />
319
Quellenverzeichnis<br />
Backhaus, Klaus (1999). Investitionsgütermarketing. 6. Auflage, München: Vahlen<br />
1999.<br />
Backhaus, Klaus / Erichson, Bernd / Plinke, Wulff / Weiber, Rolf (2005). Multivariate<br />
Analysemethoden. Berlin / Heidelberg: Springer 2005.<br />
Baethge, Martin / Wilkens, Ingo (Hg.) (2001). Die große Hoffnung für das 21.<br />
Jahrhundert? Perspektiven und Strategien für die Entwicklung der<br />
Dienstleistungsbeschäftigung: Opladen: Westdeutscher Verlag 2001.<br />
Baker, Julie / Parasuraman, Aloysius. / Grewal, Dhru / Voss, Glenn B. (2002). The influence<br />
of multiple store environment cues on perceived merchandise value and<br />
patronage intentions. Journal of Marketing, 66 (2002) 2: 120-141.<br />
Baker, Norman R. / Siegman, Jack / Rubenstein, Albert H. (1967). The effects of perceived<br />
needs and means on the generation of ideas for industrial research and development<br />
projects. IEEE Transactions of Engineering Management, 14 (1967): 156-<br />
163.<br />
Baldwin, Carliss / Clark, Kim (1997). Managing in the age of modularity. Harvard<br />
Business Review, 75 (1997) 5: 84-93.<br />
Bamberger, Ingolf / Wrona, Thomas (1996). Der Ressourcenansatz und seine Bedeutung<br />
für die strategische Unternehmensführung. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche<br />
Forschung (zfbf), 48 (1996) 2: 130-153.<br />
Bandura, Albert (1995). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge, UK: Cambridge<br />
University Press 1995.<br />
Barnard, Chester (1948). Organization and management. Cambridge, MA: Harvard<br />
University Press 1948.<br />
Barnet, Richard / Cavanagh, John (1994). Global dreams: Imperial corporations and the<br />
new world order. New York: Simon & Schuster 1994.<br />
Barney, Jay B. (1986). Strategic factor markets: expectations, luck, and business strategy.<br />
Management Science, 32 (1986) 10: 1231-1241.<br />
Barney, Jay B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of<br />
Management, 17 (1991) 1: 99-120.<br />
Baron, Jonathan (1988). Thinking and deciding. Cambridge, UK: Cambridge University<br />
Press 1988.<br />
Bartl, Michael (2005). Virtuelle Kundenintegration in die Neuproduktentwicklung.<br />
Dissertation, Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU),<br />
Kobelenz 2005.<br />
Bartl, Michael / Ernst, Holger / Füller, Johann (2004). Community based innovation: eine<br />
Methode zur Einbindung von Online Communities in den Innovationsprozess.<br />
In: Cornelius Herstatt / Jan Sanders (Hg.): Produktentwicklung mit virtuellen<br />
Communities, Wiesbaden: Gabler 2004: 141-168.<br />
Bateson, John (1985). Self service consumer: an exploratory study. Journal of Retailing,<br />
61 (1985) 3 (Fall): 49-76.<br />
320
Quellenverzeichnis<br />
Bauer, Hans H. / Grether; Marc / Borrmann, Ulrike (2001). Die Erklärung des Nutzerverhalten<br />
in elektronischen Medien mit Hilfe der Flow-Theorie. Marketing-<br />
Zeitschrift für Forschung und Praxis, 23 (2001) 1: 17-30.<br />
Baumgartner, Hans / Steenkamp, Jan-Benedict (1996). Exploratory consumer search behavior:<br />
Conceptualization and measurement. International Journal of Research in<br />
Marketing, 13 (1996): 121-137.<br />
Beck, Ulrich (1986). Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. <strong>Frank</strong>furt<br />
am Main / New York: Campus 1986.<br />
Becker, Gary S. (1965). A theory of the allocation of time. Economic Journal, 75 (1965)<br />
September: 493-517.<br />
Belbin, Meredith R. (1993). Team roles at work. Oxford: ButterworthHeinemann 1993.<br />
Belk, Russel W. / Coon, Gregory S. (1993). Gift-giving as agapic love: an alternative to the<br />
exchange paradigm based on dating experiences. Journal of Consumer<br />
Behavior, 20 (1993) December: 393-417.<br />
Bell, Daniel (1980). The social framework of the information society. In: Tom Forester<br />
(Hg.): The microelectronics revolution, Oxford: Basil Blackwell 1980: 533-<br />
545.<br />
Bendapudi, Neeli / Leone, Robert (2003). Psychological implications of customer participation<br />
in co-production. Journal of Marketing, 67 (2003) 1 (January): 14-28.<br />
Benkler, Yochai (2002). Coase’s Penguin, or: Linux and the nature of the firm. The Yale<br />
Law Journal, 112 (2002): 369-446 (Online-Publikation unter www.benkler.org/<br />
CoasesPenguin.html).<br />
Berekhoven, Ludwig / Eckert, Werner / Ellenrieder, Peter (2004). Marktforschung: Methodische<br />
Grundlagen und praktische Anwendung. Wiesbaden: Gabler 2004.<br />
Berger, Christoph / Moeslein, Kathrin / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2005). Co-designing<br />
the customer interface for customer-centric strategies: Learning from exploratory<br />
research. European Management Review, 2 (2005) 1: 70-87.<br />
Berry, Leonard L. / Seiders, Kathleen / Grewal, Dhru (2002). Understanding service convenience.<br />
Journal of Marketing, 66 (2002) 3: 1-17.<br />
Bessen, James (2002). Open source software: free provision of complex public goods.<br />
MIT Sloan School of Management Working Paper, Cambridge MA: 2002.<br />
Bessen, James / Maskin, Eric (2000). Sequential innovation, patents and imitation. MIT<br />
Sloan School of Management Working Paper, Cambridge MA: 2000.<br />
Bieberbach, Florian (2001). Die optimale Größe und Struktur von Unternehmen. Wiesbaden:<br />
Gabler 2001.<br />
Bitner, Mary Jo (1992). Servicescape: The impact of physical surroundings on customers<br />
and employees. Journal of Marketing, 56 (1992): 57-71.<br />
Bitner, Mary Jo / Faranda, William T. / Hubbert, Amy R. / Zeithaml, Valarie (1997). Customer<br />
contributions and roles in service delivery. International Journal of Service<br />
Industry Management, 8 (1997) 3: 193-205.<br />
321
Quellenverzeichnis<br />
Bitzer, Marc R. (1991). Zeitbasierte Wettbewerbsstrategien: die Beschleunigung von<br />
Wertschöpfungsprozessen in der Unternehmung. Giessen: Ferber 1991.<br />
Blaho, Robert (2001). Massenindividualisierung: Erstellung integrativer Leistungen auf<br />
Massenmärkten. Dissertation, Universität St. Gallen 2001.<br />
Boutellier, Roman / Schuh, Günther / Seghezzi, Hans D. (1997). Industrielle Produktion<br />
und Kundennähe: Ein Widerspruch?. In: Günther Schuh / Hans Wiendahl (Hg.):<br />
Komplexität und Agilität, Berlin: Springer 1997: 41-63.<br />
Bowen, David (1986). Managing customers as human resources in service organizations.<br />
Human Resource Management, 25 (1986) 3 (Fall): 371-383.<br />
Bowers, Michael / Martin, Charles / Luker, Alan (1990). Trading places: employees as customers,<br />
customers as employees. Journal of Service Marketing, 4 (1990) 2 (Spring): 55-69.<br />
Braunstein, Christine / Hoyer, Wayne / Huber, <strong>Frank</strong> (2000). Der Means-End-Ansatz. In:<br />
Andreas Hermann et al. (Hg.): Kundenorientierte Produktgestaltung,<br />
München: Vahlen 2000: 83-101.<br />
Braun-Thürmann, Holger (2005). Innovation. Bielefeld: transcript 2005.<br />
Brockhoff, Klaus (1989). Schnittstellen-Management: Abstimmungsprobleme zwischen<br />
Marketing und Forschung und Entwicklung. Stuttgart: Schaeffer-Poeschel 1989.<br />
Brockhoff, Klaus (1992). Forschung und Entwicklung. 4. Auflage, München: Vahlen 1992.<br />
Brockhoff, Klaus (1998). Der Kunde im Innovationsprozess. Schriftenreihe der Berichte<br />
aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften,<br />
Göttingen: Vanhoeck & Ruprecht 1998.<br />
Brockhoff, Klaus (1999). Produktpolitik. 4. Auflage, Stuttgart, Lucius & Lucius 1999.<br />
Brockhoff, Klaus (2003). Customers’ perspectives of involvement in new product development.<br />
International Journal of Technology Management (IJTM), 26 (2003)<br />
5/6: 464-481.<br />
Brockhoff, Klaus (2005). Konflikte bei der Einbeziehung von Kunden in die Produktentwicklung.<br />
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 75 (2005) 9: 859-877.<br />
Broekhuizen, Thijs LJ. / Alsem, Karel J. (2002). Success factors for mass customization: A<br />
conceptual model. Journal of Market-Focused Management, 5 (2002) 4: 309-330.<br />
Brown, John Seely / Eisenhardt, Kathleen M. (1995). Product development: past research,<br />
present findings and future directions. Academy of Management Review, 20<br />
(1995) 2: 343-378.<br />
Brown, Steve / Bessant, John (2003). The manufacturing strategy-capabilities links in<br />
mass customisation and agile manufacturing. International Journal of<br />
Productions and Operations Management, 23 (2003) 7: 707-730.<br />
Bruhn, Manfred (2005). Unternehmens- und Marketingkommunikation. Handbuch für<br />
ein integriertes Kommunikationsmanagement. München: Vahlen 2005.<br />
Bruhn, Manfred / Homburg, Christian (2005). Handbuch Kundenbindungsmanagement.<br />
Strategien und Instrumente für ein erfolgreiches CRM. 5. Auflage, Wiesbaden:<br />
Gaber 2005.<br />
322
Quellenverzeichnis<br />
Brynjolfsson, Erik / Smith, Michael D. (2000). Frictionless commerce? A comparison of<br />
internet and conventional retailers. Management Science, 46 (2000) 4: 563-585.<br />
Bullinger, Hans-Jörg (2002). Technologiemanagement. Berlin / Heidelberg: Springer<br />
2002.<br />
Bullinger, Hans-Jörg (Hg.) (1996). Lernende Organisationen: Konzepte, Methoden und<br />
Erfahrungsberichte. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1996.<br />
Bullinger, Hans-Jörg / Warnecke, Hans Jürgen / Westkämper, Engelbert (Hg.) (2002). Neue<br />
Organisationsformen im Unternehmen. 2. Auflage, Berlin u.a.: Springer 2002.<br />
Buss, David (1996). Social adaptation and five major factors of personality. In: Jerry S.<br />
Wiggins (Hg.): The five-factor model of personality: Theoretical perspectives,<br />
New York: Guilford 1996: 180-207.<br />
Busse von Colbe, Walther (1975). Betriebswirtschaftslehre, Band 1, Grundlagen,<br />
Produktions- und Kostentheorie. Heidelberg: Springer 1975.<br />
Butler, Brian / Sproull, Lee / Kiesler, Sara / Kraut, Robert (2002). Community effort in online<br />
groups: who does the work and why?. In: Suzanne Weisband / Leanne Atwater<br />
(Hg.): Leadership at a distance, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Publishers<br />
2002: 123-134.<br />
Büttgen, Marion / Ludwig, Marc (1997). Mass Customization von Dienstleistungen.<br />
Arbeitspapier des Instituts für Markt- und Distributionsforschung der<br />
Universität zu Köln 1997.<br />
Cabral, Luis (2000). Introduction to industrial organization. Cambridge, MA: MIT Press<br />
2000.<br />
Campbell, Colin (1997). Shopping, pleasure and sex war. In: Colin Campbell / Pasi Falk<br />
(Hg.): The Shopping Experience, London: Sage 1997: 166-176.<br />
Chamberlin, Edward H. (1950). Product heterogeneity and public policy. American<br />
Economic Review, 40 (1950) 2: 85-92.<br />
Chamberlin, Edward H. (1962). The theory of monopolistic competition: a re-orientation<br />
of value theory. 8. Auflage, Cambridge, MA: Harvard University Press 1962.<br />
Chandler, Alfred (1977). The visible hand: The managerial revolution in American business.<br />
Cambridge, MA: Harvard University Press 1977.<br />
Chandler, Alfred (1980). Managerial hierarchies: Comparative perspectives on the rise of<br />
the modern industrial enterprise. Cambridge, MA: Harvard University Press<br />
1980.<br />
Chandler, Alfred D. (1990). Scale and scope. Cambridge, MA: Belknap Press 1990.<br />
Chesbrough, Henry (2003a). Open innovation: the new imperative for creating and profiting<br />
from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press 2003.<br />
Chesbrough, Henry (2003b). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review,<br />
44 (2003) 4 (Summer): 35-41.<br />
Childers, Terry L. (1986). Assessment of the psychometric properties of an opinion leadership<br />
scale. Journal of Marketing Research, 23 (1986): 184-188.<br />
323
Quellenverzeichnis<br />
Christensen, Clayton M. (2000). The innovator’s dilemma. New York: Harper Business<br />
2000.<br />
Ciborra, Claudio U. (1991). From thinking to tinkering: the grassroots of strategic information<br />
systems. In: Janice I. DeGross et al. (Hg.): Proceedings of the 12th<br />
International Conference on Information Systems, New York 1991: 283-291.<br />
Coase, Ronald H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4 (1937) November: 386-405.<br />
Coase, Ronald H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3<br />
(1960) 1: 1-44.<br />
Cohen, Wesley M. / Levinthal, Daniel A (1990). Absorptive capacity: A new perspective on<br />
learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35 (1990) 1: 128-152.<br />
Cooper, Alan (1999). Customer knowledge management and mass customization.<br />
Internet Business, 1999, H. 4 (April).<br />
Cooper, Robert G. (1988). Predevelopment activities determine new product success.<br />
Industrial Marketing Management, 17 (1988) 3: 237-247.<br />
Cooper, Robert G. (1993). Winning at new products: accelerating the process from idea<br />
to launch. 2. Auflage, Boston, MA: Perseus Books 1993.<br />
Cooper, Robert G. / Kleinschmidt, Elko J. (1987). Success factors in product innovation.<br />
Industrial Marketing Management, 16 (1987) 3: 215-223.<br />
Cooper, Robert G. / Kleinschmidt, Elko J. (1991). New product processes at leading industrial<br />
firms. Industrial Marketing Management, 20 (1991) 2: 137-147.<br />
Corsten, Hans (1998). Grundlagen der Wettbewerbsstrategie. Stuttgart / Leipzig:<br />
Teubner 1998.<br />
Corsten, Hans (2003). Produktionswirtschaft. Einführung in das industrielle<br />
Produktionsmanagement. 10. Auflage, München: Oldenbourg 2003.<br />
Corsten, Hans / Will, Thomas (1995). Simultaneität von Kostenführerschaft und<br />
Differenzierung durch neuere Produktionskonzepte. In: Hans Corsten (Hg.):<br />
Produktion als Wettbewerbsfaktor, Wiesbaden: Gabler 1995: 235-249.<br />
Cox, Michael / Alm, Richard (1999). The right stuff: America’s move to mass customization.<br />
National Policy Center Association, Policy Report No. 225, June 1999.<br />
Crawford, C. Merle (1987). New product failure rates: A reprise. Research Management,<br />
30 (1987) 4: 20-24.<br />
Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York:<br />
Harper & Row 1990.<br />
Daetz, Doug / Barnard, Bill / Normann, Rick (1995). Customer integration: the Quality<br />
Function Deployment (QFD) leader’s guide for decision making. New York /<br />
Chichester: Wiley 1995.<br />
Dahan, Ely / Hauser, John (2002). The virtual customer. Journal of Product Innovation<br />
Management, 19 (2002) 5: 332-353.<br />
Davis, Stanley (1987). Future perfect. Reading, MA: Addison-Wesley 1987.<br />
324
Quellenverzeichnis<br />
Day, George S (1994). The capabilities of market-driven organization. Journal of<br />
Marketing, 58 (1994) 10 (October): 37-52.<br />
de Brentani, Ulrike (2001). Innovative versus incremental new business services: different<br />
keys for achieving success. Journal of Product Innovation Management, 18<br />
(2001) 3: 169-187.<br />
De Meyer, Arnoud / Dutta, Soumitra / Srivastava, Sandeep (2002). The bright stuff: How<br />
innovative people and technology can make the old economy new. London:<br />
Prentice Hall 2002.<br />
Deci, Edward L. / Koestner, Richard / Ryan, Richard. M. (1999). Meta-analytic review of<br />
experiments: Examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation.<br />
Psychological Bulletin 125 (1999) 3: 627-668.<br />
Dellaert, Benedict / Syam, Niladri (2002). Consumer-product interaction: a strategic<br />
analysis of the market for customized products. Review of Marketing Science,<br />
Working Paper No. 1, Berkeley Electronic Press 2002.<br />
Dellaert, Benedict G.C. / Stremersch, Stefan (2005). Marketing mass customized products:<br />
Striking the balance between utility and complexity. Journal of Marketing<br />
Research, 43 (2005) 2 (May): 219-227.<br />
Deraëd, Pierre (2003). Potenziale in der Tourismus-Krise. Whitepaper, 2003.<br />
Diamantopoulos, Adamantios / Schlegelmilch, Bodo / DuPreez, Johan (1995). Lessons for<br />
Pan-European marketing? The role of consumer preferences in fine-tuning the<br />
product-market fit. International Marketing Review 12 (1995) 2: 38-52.<br />
Dierickx, Ingemar / Cool, Karel (1989). Asset stock accumulation and sustainability of<br />
competitive advantage. Management Science, 35 (1989) 12: 1504-1511.<br />
Dietl, Helmut (1993). Institutionen und Zeit. Tübingen: Mohr Siebeck 1993.<br />
Digman, John M. (1997). Higher-order factors of the Big Five. Journal of Personality and<br />
Social Psychology, 73 (1997): 1246-1256.<br />
Dockenfuß, Rolf (2003). Praxisanwendungen von Toolkits und Konfiguratoren zur<br />
Erschließung taziten Userwissens. In: Cornelius Herstatt / Birgit Verworn<br />
(Hg.): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden: Gabler 2003:<br />
215-232.<br />
Donner, Susanne (2005). Die Brille aus dem Drucker. Spiegel-Online vom 05. Nov. 2005<br />
[online: tinyurl.com /r6lzo].<br />
Doringer, Christian (1991). Kundenindividuelle Fertigung. Dissertation, Wirtschaftsuniversität<br />
Wien 1991.<br />
Drucker, Peter F. (1954). The practice of management. New York: Harper & Row 1954.<br />
Drucker, Peter F. (1998). The discipline of innovation. Drucker Foundation News, 5<br />
(1998) 4 (March).<br />
Du, Xuehong / Tseng, Mitchell M. (1999). Characterizing customer value for product customization.<br />
Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical<br />
Conference; 12.-15-9.1999, Las Vegas: DFM8916-1-11.<br />
325
Quellenverzeichnis<br />
Duray, Rebecca / Ward, Peter T / Milligan, Glenn / Berry, William (2000). Approaches to<br />
mass customization: configurations and empirical validation. Journal of<br />
Operations Management, 18 (2000): 605-625.<br />
Ekeh, Peter (1974). Social exchange theory: The two traditions. Camebridge, MA:<br />
Harvard University Press 1974.<br />
Eliashberg, Jehoshua / Lilien, Gary L. / Rao, Vithala (1997). Minimizing technological oversights:<br />
a marketing research perspective. In: Raghu Garud / Praveen Rattan<br />
Nayyar / Zur B. Shapira (Hg.): Technological innovation: oversights and foresights,<br />
New York: Cambridge University Press 1997: 214-230.<br />
Engelhardt, Werner / Freiling, Jörg (1995). Die integrative Gestaltung von Leistungspotentialen.<br />
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 47 (1995) 10: 899-918.<br />
Engelhardt, Werner / Kleinaltenkamp, Michael / Reckenfelderbäumer, Martin (1993).<br />
Leistungsbündel als Absatzobjekte: Ein Ansatz zur Überwindung der<br />
Dichotomie von Sach- und Dienstleistungen. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche<br />
Forschung (zfbf), 45 (1993) 5: 395-426.<br />
Enos, John L. (1962). Petroleum progress and profits: a history of process innovation.<br />
Cambridge, MA: MIT Press 1962.<br />
Ernst, Holger (2001). Erfolgsfaktoren neuer Produkte: Grundlagen für eine valide<br />
empirische Forschung. Wiesbaden: Gabler 2001.<br />
Ernst, Holger (2002). Success factors of new product development: a review of the empirical<br />
literature. International Journal of Management Reviews, 4 (2002) 1: 1-40.<br />
Ernst, Holger (2004). Virtual customer integration: Maximizing the impact of customer<br />
integration on new product performance. In: Soenke Albers (Hg.): Cross-<br />
Functional Innovation Management, Wiesbaden: Gabler 2004: 191-208.<br />
Fehr, Ernst / Schmidt, Klaus M. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation.<br />
Quarterly Journal of Economics,114 (1999) 3: 817-868.<br />
Feitzinger, Edward / Lee, Hau (1997). Mass customization at Hewlett-Packard: the power<br />
of postponement. Harvard Business Review, 75 (1997) 1: 116-121.<br />
Fiebig, Henriette (Hg.) (2005). Wikipedia: Das Buch. Directmedia Publishing 2005.<br />
Fitzsimmons, James A. (1985). Consumer participation and productivity in service operations.<br />
Interfaces, 15 (1985) 3: 60-67.<br />
Fleck, Andree (1995). Hybride Wettbewerbsstrategien. Wiesbaden: Gabler / DUV 1995.<br />
Fließ, Sabine (2001). Die Steuerung von Kundenintegrationsprozessen: Effizienz in<br />
Dienstleistungsunternehmen. Wiesbaden: Gabler 2001.<br />
Flynn, Leisa R. / Goldsmith, Ronald E. / Eastman, Jacualine K. (1996). Opinion leaders and<br />
opinion seekers: two new measurement scales. Journal of the Academy of<br />
Marketing Science, 24 (1996) 2: 137-147.<br />
Foray, Dominique / Lundvall, Bengt-Ake (1996). The knowledge-based economy: from the<br />
economics of knowledge to the learning economy. OECD, Employment and<br />
Growth in the Knowledge-Based Economy, Paris 1996.<br />
326
Quellenverzeichnis<br />
Ford, Henry (1923). Mein Leben und Werk. Leipzig 1923.<br />
Foss, Nicolai J. / Laursen, Karl / Perdersen, Torben (2005). Organizing to gain from user<br />
interaction: The role of organizational practices for absorptive and innovative<br />
capacities. Arbeitspapier, Copenhagen Business School, Center for Strategic<br />
Management and Globalization, Copenhagen 2005.<br />
Fournier, Guy (1994). Informationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft. Berlin /<br />
Heidelberg: Springer 1994.<br />
Franck, Egon / Jungwirth, Carola (2003). Die Governance von Open-Source-Projekten.<br />
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 73 (2003) Ergänzungsheft 5: 1-21.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus (2003). From mass customization to user driven innovation.<br />
Proceedings of the 2003 World Congress on Mass Customization and<br />
Personalization (MCPC 2003), edited by <strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong>, Mitchell Tseng and<br />
<strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>, Munich: TUM 2003.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2003). Key research issues in user interaction with configuration<br />
toolkits in a mass customization system. International Journal of<br />
Technology Management (IJTM), 26 (2003) 5/6: 578-599.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2004). Toolkits for user innovation and design: An exploration<br />
of user interaction and value creation. Journal of Product Innovation<br />
Management, 21 (2004) 6 (November): 401-415.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / Reisinger, Heribert (2003). Remaining within-cluster variance: a metaanalysis<br />
of the “dark side of cluster analysis. Arbeitspapier, Wirtschaftsuniversität<br />
Wien 2003.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / Schreier, Martin (2002). Entrepreneurial opportunities with toolkits for<br />
user innovation and design. International Journal on Media Management, 4<br />
(2002) 4: 225-234.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / Shah, Sonali (2003). How communities support innovative activities:<br />
an exploration of assistance and sharing among end-users. Research Policy, 32<br />
(2003) 1: 157-178.<br />
<strong>Frank</strong>e, Nikolaus / von Hippel, Eric (2003). Satisfying heterogeneous user needs via innovation<br />
toolkits: the case of Apache security software. Research Policy, 32 (2003)<br />
7: 1199-1215.<br />
Freeman, Christopher (1968). Chemical process plant: innovation and the world market.<br />
National Institute Economic Review, 45 (1968) August: 29-57.<br />
Freeman, Christopher / Soete, Luc (1997). The economics of industrial innovation.<br />
London: Pinter 1997.<br />
Frey, Bruno S. / Meier, Stephan (2002). Pro-social behavior, reciprocity or both?. Arbeitspapier<br />
Nr. 107 am Institut für empirische Wirtschaftsforschung, Universität<br />
Zürich 2002.<br />
Freye, Diethardt (1997). Reihenfolgeplanung in einem variantenreichen Fließfertigungssystem<br />
: ein qualitativer Ansatz aus der Automobilindustrie. Göttingen:<br />
Otto Schwarz & Co 1997.<br />
327
Quellenverzeichnis<br />
Frohlich, Markham T. / Westbrook, Roy (2001). Arcs of integration: an international study<br />
of supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19 (2001) 2: 185-<br />
200.<br />
Frost, Jetta (2005). Märkte in Unternehmen. Wiesbaden: Gabler 2005.<br />
Füller, Johann (2005). Community based innovations: Virtual integration of online consumer<br />
groups into new product development. Dissertation, Leopold-Franzens-<br />
Universität Innsbruck 2005.<br />
Füller, Johann / Bartl, Michael / Ernst, Holger / Mühlbacher, Hans (2004). Community based<br />
innovation: a method to utilize the innovative potential of online communities.<br />
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences<br />
2004, Kona, HA: IEEE 2004.<br />
Füller, Johann / Mühlbacher, Hans / Rieder, Birgit (2003). An die Arbeit, lieber Kunde:<br />
Kunden als Entwickler. Harvard Business Manager, 25 (2003) 5: 36-45.<br />
Garcia, Rosanna / Calantone, Roger (2002). A critical look at technological innovation<br />
typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of<br />
Product Innovation Management, 19 (2002) 2: 110-132.<br />
Gascó-Hernández, Mila / Torres-Coronas, Teresa (2004). Virtual teams and their search for<br />
creativity. In: Susan H. Godar / Sharmila Pixy Ferris (Hg.): Virtual and collaborative<br />
teams, Hershey, PA: Idea Group 2004: 213-231.<br />
Gassmann, Oliver / Enkel, Ellen (2004). Towards a theory of open innovation: Three core<br />
process archetypes. Proceedings of the R&D Management Conference<br />
(RADMA), Lisabon, Portugal, July 6-9, 2004.<br />
Gebhardt, Andreas (2000). Rapid Prototyping: Werkzeuge für die schnelle Produktentwicklung.<br />
München: Hanser 2000.<br />
Gemünden, Hans Georg (1981). Innovationsmarketing. Tübingen: Mohr 1981.<br />
Gerpott, Torsten J. (1999). Strategisches Technologie- und Innovationsmanagement.<br />
Stuttgart: Schaeffer-Poeschel 1999.<br />
Gersch, Martin (1995). Die Standardisierung integrativ erstellter Leistungen. Institut für<br />
Unternehmensführung und Unternehmensforschung, Arbeitsbericht Nr. 57,<br />
Bochum 1995.<br />
Gerschenfield, Neil (2005). Fab: The coming revolution on your desktop – from personal<br />
computers to personal fabrication. New York: Basic Book 2005.<br />
Gerybadze, Alexander (2003). Gruppendynamik und Verstehen in Innovation<br />
Communities. In: Cornelius Herstatt / Birgit Verworn (Hg.): Management der<br />
frühen Innovationsphasen, Wiesbaden: Gabler 2003: 145-160.<br />
Gerybadze, Alexander (2004). Technologie- und Innovationsmanagement. Vahlen:<br />
München 2004.<br />
Ghoshal, Sumantra / Bartlett, Chris (1995). Changing the role of top management: beyond<br />
structure to processes. Harvard Business Review, 73 (1995) 1 (January/<br />
February): 75-87.<br />
328
Quellenverzeichnis<br />
Gibbert, Michael / Leibold, Marius / Probst, Gilbert (2002). Five styles of customer knowledge<br />
management, and how smart companies use them to create value.<br />
European Management Journal, 20 (2002) 5: 459-469.<br />
Gilmore, James H. / Pine, B. Joseph II (1997). The four faces of mass customization.<br />
Harvard Business Review, 75 (1997) 1: 91-101.<br />
Goldman, Ron / Gabriel, Richard P. (2005). Innovation happens elsewhere: Open source<br />
as business strategy. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann 2005.<br />
Gouthier, Matthias (2003). Kundenentwicklung im Dienstleistungsbereich. Wiesbaden:<br />
Gabler / DUV 2003.<br />
Gouthier, Matthias (2004). Customer Empowerment im Internet. In: Klaus-Peter<br />
Wiedmann et al. (Hg.): Konsumentenverhalten im Internet: Konzepte,<br />
Erfahrungen, Methoden, Wiesbaden: Gabler 2004: 227-253.<br />
Gouthier, Matthias / Schmid, Stefan (2001). Kunden und Kundenbeziehungen als<br />
Ressourcen von Dienstleistungsunternehmen. Die Betriebswirtschaft (DBW), 61<br />
(2001) 2: 223-239.<br />
Green, Stephen / Gavin, Mark / Aiman-Smith, Lynda (1995). Assessing a multidimensional<br />
measure of radical technological innovation. IEEE Transactions on<br />
Engineering Management, 42 (1995) 3: 203-214.<br />
Griffin, Abbie (1997). Drivers of NPD success: The 1997 PDMA Report. Chicago, IL:<br />
Product Development and Management Association (PDMA) 1997.<br />
Griffin, Abbie / Hauser, John R. (1993). The voice of the customer. Marketing Science, 12<br />
(1993) 1: 1-27.<br />
Grossman, Sanford / Hart, Oliver (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of<br />
vertical and lateral integration. Journal of Political Economy, 94 (1986): 691-719.<br />
Grün, Oskar / Brunner, Jean-Claude (2002). Der Kunde als Dienstleister: Von der<br />
Selbstbedienung zur Co-Produktion. Wiesbaden: Gabler 2002.<br />
Grün, Oskar / Brunner, Jean-Claude (2003). Wenn der Kunde mit anpackt: Wertschöpfung<br />
durch Co-Produktion. Zeitschrift Führung Organisation (ZFO), 72 (2003) 2: 87-93.<br />
Gruner, Kjell / Homburg, Christian (2000). Does customer interaction enhance new product<br />
success?. Journal of Business Research, 49 (2000) 1: 1-14.<br />
Grupp, Harald / Legler, Georg / Licht, Hariolf (2004). Technologie und Qualifikation für<br />
neue Märkte. Ergänzender Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit<br />
Deutschlands 2003-2004, Berlin.<br />
Gustafsson, Anders / Huber, <strong>Frank</strong> (2000). Das voice-of-the-customer-Konzept. In:<br />
Andreas Herrmann et al. (Hg.): Kundenorientierte Produktgestaltung,<br />
München: Vahlen 2000: 179-194.<br />
Gutenberg, Erich (1951). Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 1: Die Produktion.<br />
Berlin/Heidelberg: Springer 1951.<br />
Gutenberg, Erich (1979). Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 1: Die Produktion.<br />
23. Auflage Berlin/Heidelberg: Springer 1979 [1. Auflage: 1951].<br />
329
Quellenverzeichnis<br />
Gutenberg, Erich (1983). Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 1: Die<br />
Produktion. 24. Auflage, Berlin/Heidelberg: Springer 1983 [1. Auflage: 1951].<br />
Gutenberg, Erich (1984). Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 2: Die Absatz.<br />
17. Auflage, Berlin/Heidelberg: Springer 1984.<br />
Haas, David F. / Deseran, Forrest A. (1981). Trust and symbolic exchange. Social<br />
Psychology Quarterly, 44 (1981) March: 3-13.<br />
Hagel, John / Armstrong, Arthur (1997). Net gain: expanding markets through virtual<br />
communities. Boston, MA: Harvard Business School Press 1997.<br />
Haman, Gerard (1996). Techniques and tools to generate breakthrough products. In:<br />
Milton D. Rosenau (Hg.): PDMA Handbook of New Product Development,<br />
New York: Wiley, pp 167-178.<br />
Hammer, Michael / Champy, James (1993). Reengineering the corporation. New York:<br />
Harper Business 1993.<br />
Hansen, Ursula (1993). Verbraucher, Verbraucherverbände und Verbraucherpolitik. In:<br />
Waldemar Wittmann et al (Hg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre,<br />
4. Auflage, Stuttgart: Schaeffer-Poeschel 1993: 4463-4477.<br />
Hansen, Ursula / Hennig, Thorsten (1995). Der Co-Produzenten-Ansatz im Konsumgütermarketing:<br />
Darstellung und Implikationen einer Neuformulierung der<br />
Konsumentenrolle. In: Ursula Hansen (Hg.): Verbraucher- und umweltorientiertes<br />
Marketing, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1995: 309-332.<br />
Hansen, Ursula / Raabe, Thorsten (1991). Konsumentenbeteiligung an der Produktentwicklung<br />
von Konsumgütern: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.<br />
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 61 (1991) 2: 171-194.<br />
Hansen, Ursula / Schoenheit, Ingo (1985). Verbraucherabteilungen in privaten und<br />
öffentlichen Unternehmen. <strong>Frank</strong>furt am Main / New York: Campus 1985.<br />
Hanson, Ward (2000). Principles of internet marketing. Cincinnati, Ohio: South-West<br />
College Publishing 2000.<br />
Hardin, Garrett (1968). The tragedy of the commons. Science, 162 (1968): 1243-1248.<br />
Harhoff, Dietmar / Henkel, Joachim / von Hippel, Eric (2003). Profiting from voluntary<br />
information spillovers: how users benefit by freely revealing their innovations.<br />
Research Policy, 32 (2003) 10: 1753-1769.<br />
Hars, Alexander / Ou, Shaosong (2002). Working for free? Motivations for participating in<br />
open-source projects. International Journal of Electronic Commerce, 6 (2002) 3<br />
(Spring): 25-39.<br />
Hart, Christopher (1995). Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities<br />
and limits. International Journal of Service Industry Management, 6 (1995) 2: 36-45.<br />
Hart, Oliver / Moore, John (1990). Property rights and the nature of the firm. Journal of<br />
Political Economy, 98 (1990): 1119-1158.<br />
Hassenzahl, Marc (2001). The effect of perceived hedonic quality on product appealingness.<br />
International Journal of Human-Computer Interaction, 13 (2001) 4: 481-499.<br />
330
Quellenverzeichnis<br />
Hauschildt, Jürgen (2004). Innovationsmanagement. 3. Auflage, München: Vahlen 2004.<br />
Hauschildt, Jürgen / Schlaak, Thomas (2001). Zur Messung des Innovationsgrades neuartiger<br />
Produkte. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 71 (2001) 2: 161-182.<br />
Hausruckinger, Gerhard / Wunderlich, Florian (1997). Der Handel wird zum Moderator<br />
der Produktion. BAG Handelsmagazin, 1997, H. 3: 34-40.<br />
Haverty, John L. (1987). A model of household behavior. In: Russel W. Belk / Gerald<br />
Zaltman (Hg.): Proceedings of the AMA Winter Educators’ Conference,<br />
Chicago, IL: AMA 1987: 284-289.<br />
Hayes, Robert H. / Wheelwright, Steven C. (1984). Restoring our competitive edge competing<br />
through manufacturing. New York / Chichester: Wiley 1984.<br />
Hegmann, Gerhard (2005). Der Individual-Fernseher soll’s richten. Financial Times<br />
Deutschland vom 22. Aug. 2005.<br />
Heil, Gary / Parker, Tom / Stephens, Deborah C. (1999). One size fits one: building relationships<br />
one customer and one employee at a time. New York / Chichester: Wiley 1999.<br />
Heinen, Edmund (1959). Betriebswirtschaftliche Kostenlehre. Wiesbaden: Gabler 1959.<br />
Heinen, Edmund (1976). Produktions- und Kostentheorie. Wiesbaden: Gabler 1976.<br />
Heinen, Edmund (1983). Industriebetriebslehre: Entscheidungen im Industriebetrieb. 7.<br />
Auflage, Wiesbaden: Gabler 1983.<br />
Heinen, Edmund (1991). Industriebetriebslehre als entscheidungsorientierte Unternehmensführung.<br />
In: Edmund Heinen (Hg.): Industriebetriebslehre, 9. Auflage,<br />
Wiesbaden: Gabler 1991: 1-71.<br />
Henkel, Joachim (2003). Software development in embedded Linux: Informal collaboration<br />
of competing firms. Proceedings of the 6th Internationalen Tagung<br />
Wirtschaftsinformatik, (WKWI 2003), Dresden, September 2003.<br />
Henkel, Joachim / Sander, Jan (2003). Identifikation innovativer Nutzer in virtuellen<br />
Communities. In: Cornelius Herstatt / Birgit Verworn (Hg.): Management der<br />
frühen Innovationsphasen, Wiesbaden: Gabler 2003: 72-102.<br />
Henkel, Joachim / von Hippel, Eric (2005). Welfare implications of user innovation. Journal<br />
of Technology Transfer, 30 (2005) 1-2 (January): 73-88.<br />
Hennig-Thurau, Thorsten (1998). Konsum-Kompetenz: Eine neue Zielgröße für das<br />
Management von Geschäftsbeziehungen. <strong>Frank</strong>furt am Main: Lang 1998.<br />
Herrmann, Andreas / Hertel, Günter / Virt, Wilfried / Huber, <strong>Frank</strong> (Hg.) (2000). Kundenorientierte<br />
Produktgestaltung. München: Vahlen 2000.<br />
Herrmann, Andreas / Homburg, Christian (2000). Marktforschung: Methoden -<br />
Anwendungen - Praxisbeispiele. 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler 2000.<br />
Herstatt, Cornelius (1991). Anwender als Quelle für die Produktinnovation. Dissertation,<br />
ETH Zürich 1991.<br />
Herstatt, Cornelius / Lüthje, Christian / Lettl, Christopher (2002). Wie fortschrittliche Kunden<br />
zu Innovationen stimulieren. Harvard Business Manager, 24 (2002) 1: 60-68.<br />
331
Quellenverzeichnis<br />
Herstatt, Cornelius / Sander, Jan (Hg.) (2004). Produktentwicklung mit virtuellen<br />
Communities: Kundenwünsche erfahren und Innovationen realisieren.<br />
Wiesbaden: Gabler 2004.<br />
Herstatt, Cornelius / von Hippel, Eric (1992). Developing new product concepts via the<br />
lead user method: a case study in a low tech field. Journal of Product Innovation<br />
Management, 9 (1992) 3: 213-221.<br />
Hertel, Guido / Geister, Susanne / Konradt, Udo (2005). Managing virtual teams: A review<br />
of current empirical research. Human Resource Management Review, 15 (2005)<br />
1: 69-95.<br />
Hess, Charlotte / Ostrom, Elinor (2003). Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a<br />
Common-Pool Resource. Law and Contemporary Problems, 66 (2003) 1-2: 111-146.<br />
Hibbard, Justin (1999). Assembly online. Information Week vom 12.4.1999: 85f.<br />
Hildebrand, Volker (1997). Individualisierung als strategische Option der Marktbearbeitung.<br />
Wiesbaden: Gabler / DUV 1997.<br />
Hill, Kimberly (2003). Customers love/hate customization. Online ezine CRM Daily.com<br />
(April 10, 2003) [online: www.crm-daily.newsfactor.com/story.xhtml? story_id=<br />
21239] April 10, 2003.<br />
Hillery, George A. (1955). Definitions of community: Areas of agreement. Rural<br />
Sociology, 20 (1955): 111-123.<br />
Hirsch-Kreinsen, Hartmut (Hg.) (2004). Innovationsnetzwerke: ein anwendungsorientierter<br />
Leitfaden für das Netzwerkmanagement. VDI-Leitfaden Mai 2004,<br />
Düsseldorf: VDI Verlag 2004.<br />
Hirshleifer, Jack (1971). The provate and social value of information and the reward to<br />
inventive activity. American Economic Review, 61 (1971) 4: 561-574.<br />
Höck, Michael (1998). Produktionsplanung und -steuerung einer flexiblen Fertigung.<br />
Wiesbaden: Gabler / DUV 1998.<br />
Holmström, Bengt / Roberts, John (1998). The boundaries of the firm revisited. Journal of<br />
Economic Perspectives, 12 (1998): 73-97.<br />
Holzner, Steven (2006). How Dell does it. New York: McGraw-Hill 2006.<br />
Homburg, Christian (1995). Kundennähe von Industriegüterunternehmen. Wiesbaden:<br />
Gabler 1995.<br />
Homburg, Christian (2000). Kundennähe von Industriegüterunternehmen. 3. Auflage,<br />
Wiesbaden: Gabler 2000.<br />
Homburg, Christian / Daum, Daniel (1997). Wege aus der Komplexitätsfalle. Zeitschrift<br />
für wirtschaftliche Fertigung, 92 (1997) 7/8: 333-337.<br />
Homburg, Christian / Giering, Annette / Hentschel, Frederike (1999). Der Zusammenhang<br />
zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Die Betriebswirtschaft<br />
(DBW), 59 (1999) 2: 174-195.<br />
Homburg, Christian / Krohmer, Harley (2003). Marketingmanagement: Strategie, Instrumente,<br />
Umsetzung, Unternehmensführung. Wiesbaden: Gabler 2003.<br />
332
Quellenverzeichnis<br />
Homburg, Christian / Weber, Jürgen (1996). Individualisierte Produktion. In: Werner Kern<br />
et al. (Hg.): Handwörterbuch der Produktion, 2. Auflage, Stuttgart: Schaeffer-<br />
Poeschel 1996: 653-663.<br />
Howells, Jeremy (1990). The location and organization of research and development:<br />
New horizons. Research Policy, 19 (1990) 2: 133-146.<br />
Hruschka, Harald (1996). Marketing-Entscheidungen. München: Vahlen 1996.<br />
Huff, Anne Sigismund / Möslein, Kathrin (2004). An agenda for understanding individual<br />
leadership in corporate leadership systems. In: Cary Cooper (Hg.):<br />
Leadership and Management in the 21st Century. Oxford, UK: Oxford<br />
University Press 2004: 248-270.<br />
Huff, Anne S. / Fredberg, Tobias / Moeslein, Kathrin / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2006). Leading open<br />
innovation: creating centripetal innovation capacity. Submission for the 2006<br />
IFSAM Conference, Berlin 2006.<br />
Huffman, Chynthia / Kahn, Barbara (1998). Variety for sale: mass customization or mass<br />
confusion. Journal of Retailing, 74 (1998) 4: 491-513.<br />
Hui, Michael / Bateson, John (1991). Perceived control and the effects of crowding and<br />
consumer choice on the service experience. Journal of Consumer Research, 18<br />
(1991) 2, 174-184.<br />
Ihl, Christoph / Müller, Melanie / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2006). Produkt- und<br />
Prozesszufriedenheit bei Mass Customization: Eine empirische Untersuchung<br />
der Bildung von Zufriedenheitsurteilen von Kunden-Co-Designern. Die<br />
Unternehmung, 59 (2006) 3 (im Erscheinen).<br />
Jackson, Barbara B. (1985). Build customer relationships that last. Harvard Business<br />
Review, 63 (1985) 6: 120-128.<br />
Jacob, <strong>Frank</strong> (1995). Produktindividualisierung: Ein Ansatz zur innovativen<br />
Leistungsgestaltung im Business-to-Business-Bereich. Wiesbaden: Gabler 1995.<br />
Jacob, <strong>Frank</strong> (2003). Kundenintegrations-Kompetenz: Konzeptionalisierung, Operationalisierung<br />
und Erfolgswirkung. Marketing-Zeitschrift für Forschung und<br />
Praxis, 25 (2003) 2: 83-98.<br />
Jendrosch, Thomas (2001). Kundenzentrierte Unternehmensführung. München: Vahlen<br />
2001.<br />
Jenner, Thomas (2004). Kundenorientierung bei Innovationen: Market Driven vs. Market<br />
Driving. Das Wirtschaftsstudium (WISU), 33 (2004) 4: 486-494.<br />
Jeppesen, Lars B. (2005). User toolkits for innovation: Consumers support each other.<br />
Journal of Product Innovation Management, 22 (2005) 4: 347-363.<br />
Jeppesen, Lars B. / Molin, Mans (2003). Consumers as co-developers: Learning and innovation<br />
outside the firm. Technology Analysis and Strategic Management, 15<br />
(2003) 3 (September): 363-383.<br />
Jiao, Jianxin / Tseng, Mitchell (1996). Design for mass customization. Annals of the CIRP,<br />
45 (1996) 1: 153-156.<br />
333
Quellenverzeichnis<br />
Jiles, Jim (2005). Internet encyclopaedias go head to head. Nature, 14.12.2005.<br />
John, Oliver (1990). The “Big Five” factor taxonomy: Dimensions of personality in the<br />
natural language and in questionnaires. In: Lawrence A. Pervin / Oliver P. John<br />
(Hg.): Handbook of personality: Theory and research, New York: Guilford Press<br />
1990: 66-100.<br />
Kahn, Barbara E. (1995). Consumer variety-seeking among goods and services. Journal<br />
of Retailing and Consumer Services, 2 (1995) 3: 139-148.<br />
Kahn, Barbara E. (1998). Dynamic relationships with customers: High-variety strategies.<br />
Journal of the Academy of Marketing Science, 26 (1998) 1: 45-53.<br />
Kahn, Kenneth B. (2001). Market orientation, interdepartmental integration, and product<br />
development performance. Journal of Product Innovation Management, 18<br />
(2001) 5: 314-323.<br />
Kamali, Narges / Loker, Suzanne (2002). Mass customization: On-line consumer involvement<br />
in product design. Journal of Computer-Mediated Communication, 7<br />
(2002) 4 (July).<br />
Kaplan, Leon B. / Szybillo, George J. / Jacoby, Jacob (1974). Components of perceived risk<br />
in product purchase. Journal of Applied Psychology, 59 (1974) 3: 287-291.<br />
Katila, Riitta / Ahuja, Gautam (2002). Something old, something new: a longitudinal<br />
study of search behavior and new product introduction. Academy of Management<br />
Journal, 45 (2002) 6: 1183-1194.<br />
Katz, Ralph / Allen, Thomas (1982). Investigating the Not Invented Here (NIH) syndrome:<br />
A look at the performance, tenure, and communication patterns of 50<br />
R&D projects. R&D Management, 12 (1982): 7-19.<br />
Khalid, Halimahtun M. / Helander, Martin G. (2003). Web-based do-it-yourself product<br />
design. In: Mitchell Tseng / <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> (Hg.): The customer centric enterprise:<br />
Advances in mass customization and personalization, New York / Berlin:<br />
Springer 2003: 247-266.<br />
Khurana, Anil / Rosenthal, Stephen R. (2002). Integrating the fuzzy front end of new product<br />
development. In: Edward Roberts (Hg.): Innovation: Driving product,<br />
process, and market change, San Francisco, CA: Jossey-Bass 2002: 47-86.<br />
Kim, W.Chan / Mauborgne, Renee (2001). Damit die Innovation kein Flop wird. Harvard<br />
Business Manager, 23 (2001) 2: 86-97.<br />
King, Charles W. / Summers, John O. (1970). Overlap of opinion leadership across product<br />
categories. Journal of Marketing Research, 7 (1970) 1: 43-50.<br />
Kirzner, Israel (1978). Wettbewerb und Unternehmertum. Tübingen: Mohr 1978.<br />
Klein, Benjamin / Crawford, Robert G. / Alchian, Armen A. (1978). Vertical integration,<br />
appropriable rents, and the competitive contracting process. Journal of Law &<br />
Economics 21(1976) 2: 297-326.<br />
Kleinaltenkamp, Michael (1995b). Standardisierung und Individualisierung. In: Tietz,<br />
Bruno (Hg.): Handwörterbuch des Marketing, 2. Auflage, Stuttgart: Schäffer-<br />
Poeschel 1995: 2354-2364.<br />
334
Quellenverzeichnis<br />
Kleinaltenkamp, Michael (1996). Customer Integration: Kundenintegration als Leitbild<br />
für das Business-to-Business-Marketing. In: Michael Kleinaltenkamp / Sabine<br />
Fließ / <strong>Frank</strong> Jacob (Hg.): Customer Integration: Von der Kundenorientierung<br />
zur Kundenintegration, Wiesbaden: Gabler 1996: 13-24.<br />
Kleinaltenkamp, Michael (1997a). Integrativität als Kern einer umfassenden<br />
Leistungslehre. In: Klaus Backhaus et al. (Hg.): Marktleistung und Wettbewerb,<br />
Wiesbaden: Gabler 1997: 83-114.<br />
Kleinaltenkamp, Michael (1997). Kundenintegration. Wirtschaftswissenschaftliches<br />
Studium (WiSt), 26 (1997) 7: 350-354.<br />
Kleinaltenkamp, Michael (2002). Customer Integration im Electronic Business. In: Rolf<br />
Weiber (Hg.): Handbuch Electronic Business, 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler<br />
2002: 443-468.<br />
Kleinaltenkamp, Michael / Dahlke, Beate (2001). Der Wert des Kunden als Informant: Auf<br />
dem Weg zu einem „knowledge based customer value“. In: Bernd Günter /<br />
Sabrina Helm (Hg.): Kundenwert, Wiesbaden: Gabler 2001: 189-212.<br />
Kleinaltenkamp, Michael / Fließ, Sabine / Jacob, <strong>Frank</strong> (Hg.) (1996). Customer Integration:<br />
Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration. Wiesbaden: Gabler 1996.<br />
Kleinaltenkamp, Michael / Haase, M. (2000). Externe Faktoren in der Theorie der<br />
Unternehmung. In: Horst Albach et al. (Hg.): Die Theorie der Unternehmung in<br />
Forschung und Praxis, Berlin / Heidelberg: Springer 2000: 167-194.<br />
Kleinaltenkamp, Michael / Marra, Andreas (1995a). Institutionenökonomische Analyse der<br />
‘Customer Integration’. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf),<br />
47 (1995), Sonderheft 35: 101-117.<br />
Knolmayer, Gerhard (1999). Kundenorientierung, Mass Customization und optimale<br />
Variantenvielfalt. In: Rudolf Grünig / Martiel Pasquier (Hg.): Strategisches<br />
Management und Marketing, Bern: Haupt 1999: 67-91.<br />
Knyphausen-Aufsess, Dodo / Achtenhagen, Leona / Müller, Jörg (2003). Die Open-Source-<br />
Softwareentwicklung als Best-Practice-Beispiel eines erfolgreichen Dienstleistungsnetzwerkes.<br />
In: Manfred Bruhn / Bernd Stauss (Hg.): Dienstleistungsnetzwerke,<br />
Jahrbuch Dienstleistungsmanagement 2003, Wiesbaden: Gabler<br />
2003: 613-639.<br />
Knyphausen-Aufsess, Dodo / Ringsletter, Max (1991). Wettbewerbsumfeld, hybride<br />
Strategien und economics of scope. In: Werner Kirsch (Hg.): Beiträge zum<br />
Management Strategischer Programme, München: Kirsch Verlag 1991: 541-557.<br />
Kogut, Bruce / Zander, Ulrich (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities,<br />
and the replication of technology. Organisation Science, 3 (1992) 3: 383-397.<br />
Kohli, Ajay K. / Jaworski, B. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences.<br />
Journal of Marketing, 57 (1993) 3: 53-70.<br />
Köhne, <strong>Frank</strong> / Klein, Stefan (2004). Prosuming in der Telekommunikationsbranche: Konzeptionelle<br />
Grundlagen und Ergebnisse einer Delphi-Studie. Arbeitsberichte<br />
des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Nr. 97, Universität Münster 2004.<br />
335
Quellenverzeichnis<br />
Kolisch, Rainer (2001). Make-to-order assembly management. Berlin / Heidelberg:<br />
Springer 2001.<br />
Koller, Hans / Großmann, Dirk (2004). Open Source: Enklave für Hacker, neue Form der<br />
Produktion oder Herausforderung für die Theorie der Unternehmung.<br />
Arbeitspapier, Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg 2004.<br />
Kollock, Peter / Smith, M.A. (1999). Communities in cyberspace. London: Routledge<br />
1999.<br />
Kopytoff, Verne (2005). ‘Your name here’ goes global. San Francisco Chronicle vom 19.<br />
Juli 2005 [online: tinyurl.com/lfhnk].<br />
Kosiol, Erich (1959). Grundlagen und Methoden der Organisationsforschung. Berlin:<br />
Springer 1959.<br />
Köster, Oliver (1998). Strategische Disposition: Konzept zur Bewältigung des<br />
Spannungsfeldes Kundennähe, Komplexität und Effizienz in Leistungserstellungsprozessen.<br />
Dissertation, Universität St. Gallen 1998.<br />
Kotha, Suresh (1995). Mass customization: implementing the emerging paradigm for<br />
competitive advantage. Strategic Management Journal, 16 (1995), Special Issue<br />
‘Technological transformation and the new competitive landscape’: 21-42.<br />
Kozinets, Robert V. (1999). E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual<br />
Communities on Consumption. European Management Journal, 17 (1999) 3<br />
(June): 252-264.<br />
Krcmar, Helmut /<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Schlichter, Johann / Baumgarten, Uwe (Hg.) (2005).<br />
Community Services: Healthcare. Lohmar/Köln: Eul 2005.<br />
Krieger, Katrin (2005). Customer Relationship Management und Innovationserfolg: Eine<br />
theoretisch-konzeptionelle Fundierung und empirische Analyse. Wiesbaden:<br />
Gabler / DUV 2005.<br />
Kroeber-Riel, W. / Weinberg, P. (1999). Konsumentenverhalten. 7. Auflage, München:<br />
Vahlen 1999.<br />
LaBahn, Douglas W. / Robert E. Krapfel (1999). Early supplier involvement in customer<br />
new product development. Journal of Business Research, 47 (1999) 3 (March):<br />
173-190.<br />
Lacey, Robert (1987). Ford: Eine amerikanische Dynastie. Düsseldorf et al.: Bastei-Lübbe<br />
1987.<br />
Lai-Kow, Chan / Ming-Lu, Wan (2002). Quality function deployment: A literature review.<br />
European Journal of Operational Research, 143 (2002) 3: 463-497.<br />
Lakhani, Karim / von Hippel, Eric (2000). How open source software works: “free” userto-user<br />
assistance. MIT Sloan School of Management Working Paper No. 4117,<br />
Cambridge, MA 2000.<br />
Lakhani, Karim / Wolf, Robert (2005). Why hackers do what they do: Understanding<br />
motivation and effort in free/open source projects. In: Joseph Feller / Brian<br />
Fitzgerald / Scott A. Hissam / Karim R. Lakhani (Hg.): Perspectives on Free and<br />
Open Source Software, Cambridge, MA: MIT Press 2005: 3-21.<br />
336
Quellenverzeichnis<br />
Lampel, Joseph / Mintzberg, Henry (1996). Customizing customization. MIT Sloan Management<br />
Review, 37 (1996) 1 (Fall): 21-30.<br />
Lancaster, Kelvin J. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political<br />
Economy, 74 (1966): 132-157.<br />
Lancaster, Kelvin J. (1979). Variety, equity, and efficiency. New York: Columbia<br />
University Press 1979.<br />
Lang, Alexander (2005). Innovationen aus der zweiten Reihe. Planung&Analyse:<br />
Zeitschrift für Marktforschung und Marketing, 2005, Nr. 5: 2-5.<br />
Langeard, Eric / Bateson, John EG / Lovelock, Christopher H. / Eiglier, Pierre (1981). Services<br />
marketing: new insights from consumers and managers. Marketing Science<br />
Institute Report No. 81-104, Boston, MA: Marketing Science Institute 1981.<br />
Laurent, G.; Kapferer, J.-N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of<br />
Marketing Research, 22 (1985) 2 (February): 41-53.<br />
Laursen, Keld / Salter, Ammon (2004). Open for innovation: The role of openness in<br />
explaining innovation performance among UK manufacturing firms.<br />
Proceedings of the 2004 Meeting of the AOM (TIM Division), New Orleans,<br />
August 2004.<br />
Lea, Stephen EG / Webley, Paul (1997). Pride in economic psychology. Journal of<br />
Economic Psychology, 18 (1997) 2/3: 323-340.<br />
Lee, Hau / Padmanabhan, V. / Whang, Seungjin (1997). The bullwhip effect in supply<br />
chains. MIT Sloan Management Review, 38 (1997) 3 (Spring): 93-102.<br />
Lee, Hau / Tang, Christopher (1997). Modeling the costs and benefits of delayed product<br />
differentiation. Management Science, 43 (1997) 1 (January): 40-53.<br />
Lehner, Franz (2005). Die Zukunft der Arbeit. Wirtschafts- und Sozialpolitische<br />
Zeitschrift des ISW, 28 (2005) 3: 63-83.<br />
Lerner, Joshua / Tirole, John (2002). Some simple economics of open source. Journal of<br />
Industrial Economis, 50 (2002) 2: 197-234.<br />
Lettl, Christopher / Herstatt, Cornelius / Gemünden, Hans Georg (2004). Users as innovation<br />
networkers: a new perspective. Arbeitspapier, Technische Universität Berlin,<br />
Department for Innovation and Technology Management, Berlin 2004.<br />
Levin, Irwin P. / Schreiber, Judy / Lauriola, Marco / Gaeth, Gary J. (2002). A tale of two pizzas:<br />
building up from a basic product versus scaling down from a fully-loaded<br />
product. Marketing Letters, 13 (2002) 4: 335-344.<br />
Levitt, Barbara / March, James G. (1988). Organizational Learning. Annual Review of<br />
Sociology, 14 (1988): 319-334.<br />
Lewis, David / Bridger, Darren (2001). Die neuen Konsumenten: was sie kaufen, warm sie kaufen,<br />
wie man sie als Kunden gewinnt. <strong>Frank</strong>furt am Main / New York: Campus 2001.<br />
Liechty, John / Ramaswamy, Venkatram / Cohen, Steven H. (2001). Choice menus for mass<br />
customization: An experimental approach for analyzing customer demand with<br />
an application to a Web-based information service. Journal of Marketing<br />
Research, 39 (2001) 2 (May): 183-196.<br />
337
Quellenverzeichnis<br />
Lilien, Gary / Morrison, Pam / Searls, Kathleen / Sonnack, Mary / von Hippel, Eric (2002).<br />
Performance assessment of the lead user idea-generation process for new product<br />
development. Management Science, 48 (2002) 8: 1042-1059.<br />
Lindemann, Udo / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (Hg.) (1998). Integriertes Änderungsmanagement.<br />
Berlin u.a.: Spinger 1998.<br />
Lindemann, Udo / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Zäh, Michael (Hg.) (2006). Marktnahe Produktion individualisierter<br />
Produkte: Komplexität beherrschen in Entwicklung und<br />
Produktion. Berlin u.a.: Springer und VDI 2006.<br />
Lindenberg, Siegwart (2001). Intrinsic motivation in a new light. Kyklos, 54 (2001) 2/3:<br />
317-343.<br />
Litzenroth, Heinrich (1997). Dem Verbraucher auf der Spur. Marketing Journal, 30 (1997)<br />
4: 242-244.<br />
Lonsdale, Ronald T. / Noel M. / Stasch, Stanley F. (1996). Classification of sources of new<br />
product ideas. In: Milton D. Rosenau (Hg.): PDMA Handbook of New Product<br />
Development, New York: Wiley 1996: 179-194.<br />
Lopitzsch, Jens R. / Wiendahl, Hans-Peter (2003). Segmented adaptive production control:<br />
Enabling mass customization manufacturing. In: Mitchell Tseng / <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong><br />
(Hg.): The customer centric enterprise: Advances in mass customization and<br />
personalization, New York / Berlin: Springer 2003: 381-394.<br />
Ludwig, Johannes (1998). Zur Ökonomie der Medien: Zwischen Marktversagen und<br />
Querfinanzierung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1998.<br />
Ludwig, Marc Alexandre (2000). Beziehungsmanagement im Internet. Lohmar / Köln:<br />
Eul Verlag 2000.<br />
Lundvall, Bengt-Ake / Johnson, Björn (1994). The Learning Economy. Journal of Industry<br />
Studies 1 (1994) 2 (December): 23-41.<br />
Lüthje, Christian (2000). Kundenorientierung im Innovationsprozess: Eine Untersuchung<br />
der Kunden-Hersteller-Interaktion in Konsumgütermärkten.<br />
Wiesbaden: Gabler 2000.<br />
Lüthje, Christian (2003b). Methoden zur Sicherstellung von Kundenorientierung in den<br />
frühen Phasen des Innovationsprozesses. In: Cornelius Herstatt / Birgit<br />
Verworn (Hg.): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden: Gabler<br />
2003: 34-56.<br />
Lüthje, Christian (2003a). Customers as co-inventors: An empirical analysis of the<br />
antecedents of customer-driven innovations in the field of medical equipment.<br />
Proceedings of the 32th EMAC Conference, Glasgow 2003.<br />
Lüthje, Christian (2004). Characteristics of innovating users in a consumer goods field:<br />
An empirical study of sport-related product consumers. Technovation, 24 (2004)<br />
9: 683-695.<br />
Lüthje, Christian / Herstatt, Cornelius (2004). The lead user method: Theoretical-empirical<br />
foundation and practical implementation. R&D Management, 34 (2004) 5:<br />
549-564.<br />
338
Quellenverzeichnis<br />
Lüthje, Christian / Herstatt, Cornelius / von Hippel, Eric (2005). User-innovators and<br />
“local” information: The case of mountain biking. Research Policy, 34 (2005) 6<br />
(August): 951-965.<br />
MacCarthy, Bart / Brabazon, Philip G / Bramham, Johanna (2003). Fundamental modes of<br />
operation for mass customization. International Journal of Production<br />
Economics, 85 (2003) 3: 289-308.<br />
MacDonald, John / Tobin, Jim (1998). Customer empowerment in the digital economy. In:<br />
Don Tapscott et al. (Hg.): Blueprint to the digital economy, New York: McGraw-<br />
Hill 1998: 202-220.<br />
Maes, Pattie (1994). Agents that reduce work and information overload.<br />
Communications of the ACM, 37 (1994) 7: 31-40, 146.<br />
Mahajan, Vijay / Wind, Jerry (1992). New product models: Practices, shortcomings and<br />
desired improvements. Journal of Product Innovation Management, 9 (1992) 6:<br />
128-139.<br />
Maidique, Modesto (1980). Entrepreneurs, champions, and technological innovation.<br />
MIT Sloan Management Review, 21 (1980) 2 (Winter): 59-76.<br />
Malone, Thomas W. / Yates, Joanne / Bejamin, Robert (1987). Electronic markets and electronic<br />
hierarchies. Communications of the ACM, 30 (1987) 6: 484-497.<br />
Mandeville, Thomas (1996). Understanding novelty: information, technological change,<br />
and the patent system. Norwood, NJ: Ablex 1996.<br />
Mannervik, Ulf (1997). Den socialt formgivna produkten - Spelet mellan olika perspektiv<br />
i produktutvecklingen (The socially designed product - The interaction between<br />
different perspectives in product development). Arkitektur och bebyggelsevård<br />
1997:3, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.<br />
March, James G. / Simon, Herbert A. (1958). Organizations. New York / Chichester: Wiley 1958.<br />
Marples, David L. (1961). The Decisions of Engineering Design. IEEE Transactions on<br />
Engineering Management, 8 (1961) June: 55-71.<br />
Marr, Rainer (1973). Innovation und Kreativität. Wiesbaden: Gabler 1973<br />
Mathwick, Charla (2002). Understanding the online consumer: A typology of online relational<br />
norms and behavior. Journal of Interactive Marketing, 16 (2002) 1: 40-55.<br />
Mayer, Rainer (1993). Strategien erfolgreicher Produktgestaltung: Individualisierung<br />
und Standradisierung. Wiesbaden: Gabler / DUV 1993.<br />
McAdams, Dan P. (1992). The five-factor model in personality. Journal of Personality, 60<br />
(1992): 329-361.<br />
McAlexander, James H. / Schouten, John / Koenig, Harold (2002). Building brand community.<br />
Journal of Marketing, 66 (2002) 1 (January): 38-54.<br />
McHugh, Josh (1996). “Holy cow, no one’s done this!”. Forbes, amerikanische Ausgabe,<br />
Nr. 6 vom 3.6.1996: 54-56.<br />
McKenna, Regis (2002). Total access: Giving customers what they want in an anytime,<br />
anywhere world. Boston, MA: Harvard Business School Press 2002.<br />
339
Quellenverzeichnis<br />
Meffert, Heribert (1998). Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung.<br />
8. Auflage, Wiesbaden: Gabler 1998.<br />
Meffert, Heribert / Bruhn, Manfred (2003). Dienstleistungsmarketing: Grundlagen,<br />
Konzepte, Methoden. Wiesbaden: Gabler 2003.<br />
Meuter, Matthew L. / Ostrom, Amy L. / Roundtree, Robert I. / Bitner, Mary Jo (2000). Selfservice<br />
technologies: Understanding customer satisfaction with technologybased<br />
service encounters. Journal of Marketing, 64 (2000) 3 (July): 50-64.<br />
Meyer, Anton (Hg.) (2004). Dienstleistungsmarketing: Impulse für Forschung und<br />
Management. Wiesbaden: Gabler 2004.<br />
Meyer, Anton / Davidson, J.H. (2000). Offensives Marketing. Gewinnen mit P.O.I.S.E.<br />
München: Haufe 2000.<br />
Meyer, Anton / Blümelhuber, Christian / Pfeiffer, Markus (2000). Der Kunde als Co-Produzent<br />
und Co-Designer. In: Manfred Bruhn / Bernd Stauss (Hg.): Dienstleistungsqualität,<br />
3. Auflage, Wiesbaden: Gabler 2000: 49-70.<br />
Michel, Stefan (2000). Qualitätsunterschiede zwischen Dienstleistungen und Eigenleistungen<br />
(Prosuming) als Herausforderung für Dienstleister. In: Manfred<br />
Bruhn / Bernd Stauss (Hg.): Dienstleistungsqualität, 3. Auflage, Wiesbaden:<br />
Gabler 2000: 71-86.<br />
Mildenberger, Udo (2001). Systemische Kompetenzen und deren Einfluss auf das<br />
Kompetenzentwicklungspotenzial in von Produktionsnetzwerken. Zeitschrift<br />
für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 53 (2001) 11: 705-722.<br />
Milgrom, Paul / Roberts, John (1992). Economics, organization and management. Upper<br />
Saddle River: Prentice Hall 1992.<br />
Miller, George A. (1956). The magic number seven, plus or minus two: some limits on our<br />
capacity for processing information. Psychological Review, 63 (1956) 2: 81-97.<br />
Mintzberg, Henry (1988). Generic strategies: towards a comprehensive framework. In:<br />
Robert Lamb / Paul Shrivasta (Hg.): Advances in Strategic Management, Vol. 5,<br />
Greenwich: JAI Press 1988: 1-67.<br />
Moenaert, Rudy K. / Souder, William E. (1990). An information transfer model for integrating<br />
marketing and R&D personnel in new product development projects.<br />
Journal of Product Innovation Management, 7 (1990) 1: 91-107.<br />
Möslein, Kathrin (2005). Der Markt für Managementwissen. Wiesbaden: Gabler/DUV<br />
2005.<br />
Montoya-Weiss, Mitzi / Calantone, Roger (1994). Determinants of new product performance:<br />
A review and meta analysis. Journal of Product Innovation Management,<br />
11 (1994) 6: 397-417.<br />
Morrison, Pamela / Roberts, John / Midgle, David (2004). The nature of lead users and<br />
measurement of leading edge status. Research Policy, 33 (2004) 2: 351-362.<br />
Morrison, Pamela D. / Roberts, John H. / von Hippel, Eric (2000). Determinants of user<br />
innovation and innovation sharing in a local market. Management Science, 46<br />
(2000) 12: 1513-1527.<br />
340
Quellenverzeichnis<br />
Nambisan, Satish (2002). Designing virtual customer environments for new product<br />
development: towards a theory. Academy of Management Review, 27 (2002) 3:<br />
392-413.<br />
Nelson, Richard (1982). The role of knowledge in R&D efficiency. Quarterly Journal of<br />
Economics, 7 (1982) 3: 453-470.<br />
Nelson, Richard / Winter, Sidney (1982). An evolutionary theory of economic change.<br />
Cambridge, MA: Harvard University Press 1982.<br />
Nemiro, Jill E. (2001). Connection in creative virtual teams. Journal of Behavioral and<br />
Applied Management, 3 (2001) 2 (Winter/Spring): 92-112.<br />
Normann, Richard / Ramirez, Rafael (1993). From value chain to value constellation.<br />
Harvard Business Review, 71 (1993) 4 (July/August): 65-77.<br />
Normann, Richard / Ramirez, Rafael (1998). Designing interactive strategy: from value<br />
chain to value constellation. Revised reprint. New York / Chichester: Wiley 1998<br />
(original edition: 1994).<br />
Novak, Thomas / Hoffmann, Donna / Yung, Yiu-Fai (2000). Measuring the customer experience<br />
in online environments: a structural modeling approach. Marketing<br />
Science, 19 (2000) 1 (Winter): 22-42.<br />
Offe, Claus / Heinze, Rolf G. (1990). Organisierte Eigenarbeit: Das Modell<br />
Kooperationsring. <strong>Frank</strong>furt am Main / New York: Campus 1990.<br />
Ogawa, Susumu (1998). Does sticky information affect the locus of innovation? Evidence<br />
from the Japanese convenience store industry. Research Policy, 26 (1998) 7-8:<br />
777-790.<br />
Ogawa, Susumu /<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> T (2005). Collective Customer Commitment: A new<br />
method to reduce the new product development risk. MIT Sloan School of<br />
Management, MIT User Innovation Working Paper Series, Cambridge, MA<br />
August 2005 (published on userinnovation.mit.edu).<br />
Ogawa, Susumu /<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> T (2006). Reducing the risk of new product development.<br />
MIT Sloan Management Review, 48 (2006) 1 (Winter): 65-72.<br />
Oliver, Richard L. (1993). Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction<br />
response. Journal of Consumer Research, 20 (1993) December: 418-430.<br />
Oon, Bee Yin / Khalid, Halimahtun M. (2003). Usability of design by customer websites.<br />
In: Mitchell Tseng / <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> (Hg.): The customer centric enterprise:<br />
Advances in mass customization and personalization, New York / Berlin:<br />
Springer 2003: 283-300.<br />
Osterloh, Margit / Kuster, Bernhard / Rota, Sandra (2002). Open source software production:<br />
climbing on the shoulders of giants. Arbeitspapier, Lehrstuhl für<br />
Organisation, Universität Zürich 2002.<br />
Osterloh, Margit / Kuster, Bernhard / Rota, Sandra (2004). Open Source Software Produktion:<br />
Ein neues Innovationsmodell?. In: Robert A. Gehring / Bernd Lutterbeck<br />
(Hg.): Open Source Jahrbuch 2004. Zwischen Softwareentwicklung und<br />
Gesellschaftsmodell, Berlin: Lehmanns Media 2004: 121-137.<br />
341
Quellenverzeichnis<br />
Osterloh, Margit / Rota, Sandra / von Wartburg, Marc (2002). Open Source: normbasierte<br />
Kooperation in der Softwareentwicklung. Arbeitspapier, Lehrstuhl für<br />
Organisation, Universität Zürich 2002.<br />
Ozinga, James R. (1999). Altruism. Westport, CT: Praeger 1999.<br />
Park, Whan C./ Jun, Sung Youl / MacInnis, Deborah J. (2000). Choosing what I want versus<br />
rejecting what I do not want: an application of decision framing to product<br />
option choice decisions. Journal of Marketing Research, 37 (2000) 2 (May): 187-<br />
202.<br />
Parolini, Cinzia (1999). The value net: a tool for competitive strategy. New York /<br />
Chichester: Wiley 1999.<br />
Pavitt, Keith (1987). The objectives of technology policy. Science and public policy, 14<br />
(1987) 4: 182-188.<br />
Peppers, Don / Rogers, Martha (1997). Enterprise one to one: Tools for competing in the<br />
interactive age. New York: Doubleday 1997.<br />
Peppers, Don / Rogers, Martha (2004). Managing customer relationships: a strategic<br />
framework. Hoboken, NJ: Wiley 2004.<br />
Pfeffer, Jeffrey / Salancik, Gerald R. (1978). The external control of organizations: a resource<br />
dependence perspective. New York: Harper & Row 1978.<br />
Pfeiffer, Markus (2002). Interactive Branding. München: FGM Verlag 2002.<br />
Picot, Arnold (1982). Transaktionskostenansatz in der Organisationstheorie. Die<br />
Betriebswirtschaft (DBW), 42 (1982) 2: 267-284.<br />
Picot, Arnold (1986). Transaktionskosten im Handel. Betriebs-Berater; Beilage 13 zu H.<br />
12/1986: 2-16.<br />
Picot, Arnold (1999). Organisation. In: Michael Bitz et al. (Hg.): Vahlens Kompendium<br />
der Betriebswirtschaftslehre, 4. Auflage, Bd. 2, München: Vahlen 1999: 107-180.<br />
Picot, Arnold / Dietl, Helmut / Franck, Egon (2005). Organisation: Eine ökonomische<br />
Perspektive. 4. Auflage;, Stuttgart: Schaeffer-Poeschel 2005.<br />
Picot, Arnold / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (1991). Informationswirtschaft. In: Edmund Heinen (Hg.):<br />
Industriebetriebslehre, 9. Auflage, Wiesbaden: Gabler 1991: 241-393.<br />
Picot, Arnold / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (1994). Auflösung der Unternehmung? Vom Einfluss der<br />
IuK-Technik auf Organisationsstrukturen und Kooperationsformen. Zeitschrift<br />
für Betriebswirtschaft, 64 (1994) 5: 547-570.<br />
Picot, Arnold / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Wigand, Rolf (2003). Die grenzenlose Unternehmung. 5.<br />
Auflage, Wiesbaden: Gabler 1998.<br />
Pigout, Arthur C. (1920). The economics of welfare. London: Macmillan 1920.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (1998). Kundenindividuelle Massenproduktion. München / Wien: Hanser<br />
1998.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2003). Von Open Source zu Open Innovation. Harvard Business Manager,<br />
25 (2003) 12: 114.<br />
342
Quellenverzeichnis<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2004). Innovation and value co-creation. Habilitationsschrift an der<br />
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität München,<br />
München 2004.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2005a). An overview of recent mass customization offerings in footwear<br />
and apparel. Mass Customization & Open Innovation News, 7 (2005) 2 [online:<br />
mass-customization.blogs.com].<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2005b). Lego Factory hacked by users – and the company loves it. Mass<br />
Customization & Open Innovation News, 7 (2005) 3 [online: mass-customization.blogs.com].<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2006a). Mass Customization. 4. Auflage, Wiesbaden: Gabler / DUV 2006.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2006b). Kundenintegration im Innovationsprozess als Schlüssel zur<br />
Kundenzufriedenheit. In: Christian Homburg (Hg.): Handbuch Kundenzufriedenheit,<br />
6. Aufl., Wiesbaden: Gabler 2006: 431-460.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Hönigschmid, Florian / Müller, Florian (2002). Individuality and price: An<br />
exploratory study on consumers’ willingness to pay for customized products.<br />
Arbeitsbericht Nr. 28 des Lehrstuhls für Allgemeine und Industrielle Betriebswirtschaftslehre<br />
der Technischen Universität München, März 2002.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Ihl, Christoph (2002). Mass Customization ohne Mythos: Warum viele<br />
Unternehmen trotz der Nutzenpotentiale kundenindividueller Massenproduktion<br />
an der Umsetzung scheitern. IO New Management, 71 (2002) 10: 16-30.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Meier, Roland (2001). Strategien zur effizienten Individualisierung von<br />
Dienstleistungen. Industrie-Management, 17 (2001) 2: 13-17.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Möslein, Kathrin / Stotko, Christof (2004). Does mass customization pay? An<br />
economic approach to evaluate customer integration. Production Planning &<br />
Control, 15 (2004) 4: 435-444.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Schubert, Petra / Koch, Michael / Moeslein, Kathrin (2005). Overcoming mass<br />
confusion: Collaborative customer co-design in online communities. Journal of<br />
Computer-Mediated Communication, 10 (2005) 4.<br />
<strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Stotko, Christof (Hg.) (2003). Mass Customization und Kundenintegration:<br />
Neue Wege zum innovativen Produkt. Düsseldorf: Symposion 2003.<br />
Pine, B. Joseph II (1993). Mass Customization. Boston, MA: Harvard Buisness School<br />
Press 1993.<br />
Pine, B. Joseph II (1998). Mass Customization: Die Wettbewerbsstrategie der Zukunft.<br />
Einleitung zu: <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>: Kundenindividuelle Massenproduktion, München /<br />
Wien: Hanser 1998: 1-32.<br />
Pine, B. Joseph II / Peppers, Don / Rogers, Martha (1995). Do you want to keep your customers<br />
forever?. Harvard Business Review, 73 (1995) 2: 103-114.<br />
Plinke, Wulff (1998). Effizienz und Effektivität im Management von Geschäftsbeziehungen<br />
auf industriellen Märkten. In: Joachim Büschken / Margit Meyer /<br />
Rolf Weiber (Hg.): Entwicklungen des Investitionsgütermarketing, Wiesbaden:<br />
Gabler 1998: 179-199.<br />
343
Quellenverzeichnis<br />
Polanyi, Michael (1958). Personal knowledge: towards a post-critical philosophy.<br />
London: Routledge 1985.<br />
Poolton, Jennifer / Barclay, Ian (1998). New product development from past research to<br />
future applications. Industrial Marketing Management, 27 (1998) 3: 197-212.<br />
Porter, Michael (1980). Competitive strategy. New York: The Free Press 1980.<br />
Porter, Michael (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance.<br />
New York: The Free Press 1985.<br />
Porter, Michael (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79 (2001) 2<br />
(March): 62-78.<br />
Porter, Michael E. (1996). What is strategy?. Harvard Business Review, 74 (1996) 6: 61-78.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Hamel, Gerry (1990). The core competencies of the corporation.<br />
Harvard Business Review, 68 (1990) 3: 79-91.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Ramaswamy, Venkatram (2000). Co-opting customer competence.<br />
Harvard Business Review, 79 (2000) 1 (January/February): 79-87.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Ramaswamy, Venkatram (2002). The co-creation connection.<br />
Strategy + Business, 27 (2002): 50-61.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Ramaswamy, Venkatram (2003). The new frontier of experience<br />
innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (2003) 4 (Summer): 12-18.<br />
Prahalad, Coimbatore (CK) / Ramaswamy, Venkatram (2004). The future of competition: cocreating<br />
unique value with customers. Boston, MA: Harvard Business School<br />
Press 2004.<br />
Pribilla, Peter / <strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Goecke, Robert (1996). Telekommunikation im Management,<br />
Strategien für den globalen Wettbewerb. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1996.<br />
Ragatz, Gary L. / Handfield, Robert B. / Scannell, Thomas V. (1997). Success factors for integrating<br />
suppliers into new product development. Journal of Product Innovation<br />
Management, 14 (1997): 190-202.<br />
Ram Shri / Jung, Hyung-Shik (1994). Innovativeness in product usage: a comparison of<br />
early adopters and early majority. Psychology and Marketing, 11 (1994) 1<br />
(January-February): 57-67.<br />
Ramirez, Rafael (1999). Value co-production: intellectual origins and Implications for<br />
practice and research. Strategic Management Journal, 20 (1999) 1: 49-65.<br />
Randall, Taylor / Terwiesch, Christian / Ulrich, Karl T. (2005). User design of customized<br />
products. Arbeitspapier, The Wharton School, Philadelphia 2005 (erscheint in:<br />
Marketing Science, 2006).<br />
Rangaswamy, Arvind / Lilien, Gary (1997). Software tools for new product development.<br />
Journal of Marketing Research, 34 (1997) 1: 177-184.<br />
Rangaswamy, Arvind / Pal, Nirmal (2003). Gaining business value from personalization<br />
technologies. In: Nirmal Pal / Arvind Rangaswamy (Hg.): The power of one:<br />
gaining business value from personalization technologies, Victoria: Trafford<br />
Publishing 2003: 1-9.<br />
344
Quellenverzeichnis<br />
Ratchford, Brian T. (2001). The economics of consumer knowledge. Journal of Consumer<br />
Research, 27 (2001) 3 (March): 397-411.<br />
Raymond, Eric S. (1999). The cathedral and the bazaar. Sebastopol, CA: O’Reilly 1999.<br />
Reichart, Sybille (2002). Kundenorientierung im Innovationsprozess: Die erfolgreiche<br />
Integration von Kunden in den frühen Phasen der Produktentwicklung.<br />
Wiesbaden: Gabler 2002.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2004a). Organisationsgrenzen. In: Georg Schreyögg / Axel von Werder<br />
(Hg.): Handwörterbuch der Unternehmensführung und Organisation, 4. Aufl.,<br />
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2004: 998-1008.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (2004b). ROI – Neue Pfade zur Wirtschaftlichkeit. In: Udo Lindemann et<br />
al. (Hg.): Tagungsband zum Industriekolloquium des Sonderforschungsbereich<br />
582, Garching: iwb Verlag 2004.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Dietel, Bernd (1991). Produktionswirtschaft. In: Edmund Heinen (Hg.):<br />
Industriebetriebslehre, 9. Auflage, Wiesbaden: Gabler 1991: 395-622.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Müller, Melanie / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2005). Satisfaction of customer co-designers:<br />
process versus product satisfaction. Proceedings of the 34th Conference of<br />
the European Marketing Academy (EMAC 2005), Milan, 24-27 May 2005.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2002). Der Kunde als Wertschöpfungspartner. In: Horst<br />
Albach et al. (Hg.): Wertschöpfungsmanagement als Kernkompetenz, Wiesbaden:<br />
Gabler 2002: 27-52.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2003). Von Massenproduktion zu Co-Produktion: Kunden<br />
als Wertschöpfungspartner. Wirtschaftsinformatik, 45 (2003) 5: 515-519.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> / Meier, Roland (2002). Strategien zur effizienten Individualisierung<br />
von Dienstleistungen. In: Manfred Bruhn / Bernd Stauss (Hg.):<br />
Jahrbuch Dienstleistungsmanagement 2002, Wiesbaden: Gabler 2002: 225-<br />
242.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Seifert, Sascha / Ihl, Christoph (2004). Innovation durch Kundenintegration.<br />
Arbeitsbericht Nr. 40 des Lehrstuhls für Allgemeine und Industrielle<br />
Betriebswirtschaftslehre der Technischen Universität München, Juni 2004,<br />
gekürzt abgedruckt in: Dietmar Frey / Lutz von Rosenstiel / Carl Graf Hoyos<br />
(Hg.): Wirtschaftspsychologie (Angewandte Psychologie, Band 2), Weinheim:<br />
Beltz/PVU 2004.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> (Hg.) (1992). Marktnahe Produktion. Wiesbaden: Gabler 1992.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Baethge, Martin / Brakel, Oliver / Cramer, Jorun / Fischer, Barbara / Paul,<br />
Gerd (2004). Die Neue Welt der Mikrounternehmen: Netzwerke, Telekooperative<br />
Arbeitsformen, Marktchancen. Wiesbaden: Gabler 2004.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Bullinger, Hans-Jörg (Hg.) (2000). Vertriebsmanagement: Organisation,<br />
Technologieeinsatz, Personal. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2000.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Höfer, Claudia / Weichselbaumer, Jürgen (1996). Erfolg von Reorganisationsprozessen,<br />
Stuttgart: Schäffer Poeschel 1996.<br />
345
Quellenverzeichnis<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Koller, Hans (1996). Die Dezentralisierung als Maßnahme zur Förderung<br />
der Lernfähigkeit von Organisationen: Spannungsfelder auf dem Weg<br />
zu neuen Innovationsstrategien. In: Hans-Jörg Bullinger (Hg.): Lernende<br />
Organisationen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1996: 105-153.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Mayer, Anton / Engelmann, Jörg / Walcher, Dominik (2006). Kundenintegration<br />
in Innovationsprozesse. Wiesbaden: Gabler 2006.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Möslein, Kathrin (1999). Management und Technologie. In: Lutz von<br />
Rosenstiel / Erika Regnet / Michel Domsch (Hg.). Führung von Mitarbeitern:<br />
Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement. 4. Auflage, Stuttgart:<br />
Schäffer-Poeschel 1999: 709-728.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Möslein, Kathrin / Sachenbacher, Hans / Englberger, Hermann (2000).<br />
Telekooperation: Verteilte Arbeits- und Organisationsformen. 2. Auflage, Berlin:<br />
Springer 2000.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Möslein, Kathrin / Siebert, Jörg (2005). Leadership Excellence: Learning<br />
from an exploratory study on leadership systems in large multinationals.<br />
Journal of European Industrial Training, 3 (2005): 184-198.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Schmelzer, Hermann (1990). Durchlaufzeiten in der Entwicklung: Praxis<br />
des industriellen F&E-Management. München: Oldenburg 1990.<br />
<strong>Reichwald</strong>, <strong>Ralf</strong> / Siebert, Jörg / Möslein, Kathrin (2004). Leadership Excellence: Führungssysteme<br />
auf dem Prüfstand. Personalführung, 2004, H. 3: 50-56.<br />
Reinhart, Gunther / Schönung, Martin / Wagner, Wolfgang (2003). Marktnahe Produktion<br />
kundenindividueller Produkte in dezentralen Mini-Fabriken. Modularisierungskapitel<br />
zu: <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> / Christof Stotko (Hg.): Mass Customization<br />
und Kundenintegration: Neue Wege zum innovativen Produkt, Düsseldorf:<br />
Symposion 2003.<br />
ReVelle, Jack / Moran, John / Cox, Charles (1998). The QFD handbook. New York /<br />
Chichester: Wiley 1998.<br />
Rheingold, Howard (1994). Virtuelle Gemeinschaft: Soziale Beziehungen im Zeitalter des<br />
Computers. Bonn: Addison-Wesley 1994.<br />
Rice, Ronald / Rogers, Everett M. (1980). Reinvention in the innovation process.<br />
Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 1 (1980) 4 (June): 499-514.<br />
Riemer, Kai / Totz, Carsten (2003). The many faces of personalization: An integrative economic<br />
overview of mass customization and personalization. In: Mitchell Tseng<br />
/ <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> (Hg.): The customer centric enterprise: Advances in mass customization<br />
and personalization, Berlin / New York: Springer 2003: 35-50.<br />
Riggs, William / von Hippel, Eric (1994). Incentives to innovate and the sources of innovation:<br />
The case of scientific instruments. Research Policy, 23 (1994) 4: 459-469.<br />
Ritter, Thomas (1998). Innovationserfolg durch Netzwerk-Kompetenz: effektives<br />
Management von Unternehmensnetzwerken. Wiesbaden: Gabler 1998.<br />
Rogers, Everett M. (1995). The diffusion of innovation. 4. Auflage, New York: The Free<br />
Press 1995.<br />
346
Quellenverzeichnis<br />
Rogl, Dirk (2003). Schwieriges Spiel mit den Bausteinen. FVW 24, 37 (2003) 24: 56-61.<br />
Rogoll, Timm / <strong>Piller</strong>, <strong>Frank</strong> (2003). Marktstudie Produktkonfiguration. München:<br />
Thinkconsult 2003.<br />
Rosenberg, Nathan (1976). Perspectives on technology. Cambridge, UK: Cambridge<br />
University Press 1976.<br />
Rosenberg, Nathan (1982). Inside the black box: technology and economics. New York:<br />
Cambridge University Press 1982.<br />
Roth, Daniel (2005). The amazing rise of the do-it-yourself economy. Fortune Europe,<br />
Nr. 9 / 2005 vom 30. Mai 2005: 24-35.<br />
Rothwell, Roy (1992). Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s.<br />
R&D Management 22 (1993): 221-239.<br />
Roy, Subroto / Sivakumar, Krishnamurti/ Wilkinson, Ian (2004). Innovation generation in<br />
supply chain relationships: A conceptual model and research propositions.<br />
Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (2004) 1: 61-79.<br />
Rudberg, Martin / Wikner, Joakim (2004). Mass customization in terms of the customer<br />
order decoupling point. Production Planning & Control, 15 (2004) 4: 445-458.<br />
Rumelt, Richard P. / Schendel, Dan / Teece, David, (1991). Strategic management and economics.<br />
Strategic Management Journal, 12 (1991) 1: 5-29.<br />
Sahin, Funda (2000). Manufacturing competitiveness: Different systems to achieve the<br />
same results. Production and Inventory Management Journal, 42 (2000) 1 (First<br />
Quarter): 56-65.<br />
Salvador, Fabrizio / Forza, Cipriano (2004). Configuring products to address the customization-responsiveness<br />
squeeze: A survey of management issues and opportunities.<br />
International Journal of Production Economics, 91 (2004) 3 (Oct.): 273-<br />
291.<br />
Salvador, Fabrizio / Rungtusanatham, Johnney M. / Forza, Cipriano (2004). Supply-chain<br />
configurations for mass customization. Production Planning & Control, 15<br />
(2004) 4: 380-402.<br />
Sanders, Falk-Hayo (2001). Financial rewards of mass customization. Proceedings of the<br />
2001 World Congress on Mass Customization and Personalization (MCPC<br />
2001), edited by M. Tseng and F.T. <strong>Piller</strong>, Hong Kong: Hong Kong University of<br />
Science and Technology 2001.<br />
Sanger, Larry (2001). E-Mails an die Mailingliste nupedia-l: Let’s make a Wiki 10. Januar<br />
2001, Nupedia’s wiki: try it out 10. Januar 2001, Nupedia’s wiki: try it out 11.<br />
Januar 2001, Wikipedia is up! 17. Januar 2001.<br />
Sawhney, Mohanbir / Prandelli, Emanuela (2000). Communities of creation: managing distributed<br />
innovation in turbulent markets. California Management Review, 42<br />
(2000) 4: 24-54.<br />
Sawhney, Mohanbir / Verona, Gianmario / Prandelli, Emanuela (2005). Collaborating to create:<br />
The internet as a platform for customer engagement in product innovation.<br />
Journal of Interactive Marketing, 19 (2005) 4 (August): 4-17.<br />
347
Quellenverzeichnis<br />
Schlaak, Thomas (1999). Der Innovationsgrad als Schlüsselvariable: Perspektiven für das<br />
Management von Produktentwicklungen. Wiesbaden: Gabler / DUV 1999.<br />
Schmundt, Hilmar (2005). Ideenbörse für Tüftler. Der Spiegel, Nr. 51 / 2005 vom 19. Dez.<br />
2005: 142.<br />
Schnäbele, Peter (1997). Mass Customized Marketing: Effiziente Individualisierung von<br />
Vermarktungsobjekten und -prozessen. Wiesbaden: Gabler 1997.<br />
Schoder, Detlef / Fischbach, Kai (2002). Die Bedeutung von Peer-to-Peer-Technologien für<br />
das Electronic Business. In: Rolf Weiber (Hg.): Handbuch Electronic Business, 2.<br />
Auflage, Wiesbaden: Gabler 2002: 99-115.<br />
Schoder, Detlef / Fischbach, Kai / Schmitt, Christian (2005). Core concepts in peer-to-peer<br />
networking. In: Ramesh Subramanian / Brian D. Goodman (Hg.): Peer-to-peer<br />
computing: the evolution of a disruptive technology Herseh, PA: Idea Group<br />
Publishing 2005: 1-27.<br />
Schoder, Detlef / Fischbach, Kai / Teichmann, Rene (Hg.) (2002). Peet-to-Peer: Ökonomische,<br />
technologische und juristische Perspektiven. Berlin / Heidelberg: Springer 2002.<br />
Schön, Donald A. (1994). Foreword. In: Richard Normann / Rafael Ramirez (Hg.):<br />
Designing interactive strategy, New York / Chichester: Wiley 1994, p. vii-xi.<br />
Schonfeld, Erick (2005). The economics of peer production. Blog B2day vom 30.<br />
September 2005 [online: tinyurl.com / k9z89].<br />
Schreier, Martin (2004). The value increment of mass-customized products: An empirical<br />
assessment and conceptual analysis of its explanation. Arbeitspapier,<br />
Department for Innovation & Entrepreneurship, Wirtschaftsuniversität Wien<br />
2004 (erscheint in: Journal of Consumer Behaviour, 2006).<br />
Schreier, Martin (2005). Wertzuwachs durch Selbstdesign: Die erhöhte Zahlungsbereitschaft<br />
beim Einsatz von “Toolkits for User Innovation and Design”.<br />
Wiesbaden: Gabler / DUV 2005.<br />
Schubert, Petra / Ginsburg, Mark (2000). Virtual communities of transaction: the role of<br />
personalization in electronic commerce. Electronic Markets Journal, 10 (2000) 1.<br />
Schumpeter, Joseph A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA:<br />
Harvard University Press 1934.<br />
Schumpeter, Joseph A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper 1942.<br />
Schweitzer, Marcell (1994). Industriebetriebslehre. 2. Auflage, München: Vahlen 1994.<br />
Schweitzer, Marcell / Küpper, Hans-Ulrich (1997). Produktions- und Kostentheorie. 2.<br />
Auflage, Wiesbaden: Gabler 1997.<br />
Scitovsky, Tibor (1989). Psychologie des Wohlstands: Die Bedürfnisse des Menschen und<br />
der Bedarf der Verbraucher. <strong>Frank</strong>furt am Main / New York: Campus 1989.<br />
Seigenthaler, John (2005). A false Wikipedia “biography”. USA Today, 29.11.2005.<br />
Seybold, Patricia (2005). What’s really up with Web 2.0: Customer innovation and design<br />
it yourself. Posting vom 17. Nov. 2005 im Blog Outside Innovation [online: outsideinnovation.blogs.com].<br />
348
Quellenverzeichnis<br />
Seybold, Patricia B. / Marshak, Ronni / Lewis, Jeffrey (2001). The customer revolution: how<br />
to thrive when customers are in control. New York: Crown Business 2001.<br />
Shah, Sonali (2000). Sources and patterns of innovation in a consumer products field:<br />
Innovations in sporting equipment. MIT Sloan School of Management Working<br />
Paper No. 4105, Cambridge MA 2000.<br />
Shah, Sonali (2005). Open beyond software. In: Danese Cooper / Chris DiBona / Mark<br />
Stone (Hg.): Open Sources 2, Sebastopol, CA: O’Reilly 2005: 339-360.<br />
Shankar, Venkatesh / Bayus, Barry L. (2003). Network effects and competition: An empirical<br />
analysis of the home video game industry. Strategic Management Journal,<br />
24 (2003) 4 (April): 375-384.<br />
Simon, Herbert A. (1976). Administrative behavior: a study of decision making processes<br />
in administrative organizations. New York: The Free Press 1976.<br />
Skiera, Bernd (1998). Preisdifferenzierung. In: Sönke Albers et al. (Hg.): Marketing mit<br />
interaktiven Medien, <strong>Frank</strong>furt: FAZ Verlag 1998: 283-296.<br />
Skiera, Bernd (2003). Individuelle Preisbildung bei individualisierten Produkten.<br />
Modularisierungskapitel zu: <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong> / Christof Stotko (Hg.): Mass<br />
Customization und Kundenintegration: Neue Wege zum innovativen Produkt,<br />
Düsseldorf: Symposion 2003.<br />
Skiera, Bernd / Spann, Martin (2000). Flexible Preisgestaltung im Electronic Business. In:<br />
Rolf Weiber (Hg.): Handbuch Electronic Business, Wiesbaden: Gabler 2000: 539-558.<br />
Smith, Adam (1776). The wealth of nations: An inquiry into the nature and causes of the<br />
wealth of nations. London: Stratton & Cadell 1776 (reprint from Oxford<br />
University Press, 1976).<br />
Smith, Michael / Bailey, Joseph / Brynjolfsson, Erik (2000). Understanding digital markets:<br />
review and assessment. In: Erik Brynjolfsson / Brian Kahin (Hg.):<br />
Understanding the digital economy, Boston 2000: 99-136.<br />
Specht, Günter / Schmelzer, Hermann J. (1992). Instrumente des Qualitätsmanagements in<br />
der Produktentwicklung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 44 (1992) 2: 531-547.<br />
Spina, Gianluca / Verganti, Roberto / Zotteri, Giulio (2002). Factors influencing co-design<br />
adoption: drivers and internal consistency. International Journal of Operations<br />
& Production Management, 22 (2002) 12: 1354-1366.<br />
Squire, Brian / Readman, Jeff / Brown, Steve / Bessant, John (2004). Mass customisation: The<br />
key to customer value?. Production Planning & Control, 15 (2004) 4: 459-471.<br />
Staud, Erich / Auffermann, Susanne (1999). Der Innovationsprozess im Unternehmen:<br />
eine erste Analyse des derzeitigen Stands der Forschung. Bochum: IAI 1999.<br />
Staudt, Erich / Bock, Jürgen / Mühlemeyer, Peter (1990). Information und Kommunikation<br />
als Erfolgsfaktoren für die betriebliche Forschung und Entwicklung. Die<br />
Betriebswirtschaft (DBW), 50 (1990) 6: 759-773.<br />
Stigler, George / Becker, Gary S. (1977). De gustibus non est disputandum. American<br />
Economic Review, 67 (1977): 76-90.<br />
349
Quellenverzeichnis<br />
Stone, Robert N. / Gronhaug, Kjell (1993). Perceived risk: further considerations for the<br />
marketing discipline. European Journal of Marketing, 27 (1993) 3: 39-50.<br />
Stotko, Christof M. (2002). Das wirtschaftliche Potenzial von Mass Customization als<br />
Maßnahme zur Erhöhung der Kundenbindung. Arbeitsbericht Nr. 30 des<br />
Lehrstuhls für Allgemeine und Industrielle Betriebswirtschaftslehre der<br />
Technischen Universität München, Juli 2002.<br />
Stotko, Christof M. (2005). Vertriebseffizienz durch Kundenintegration. Wiesbaden:<br />
Gabler / DUV 2005.<br />
Stump, Rodney / Athaide, Gerad / Joshi, Ashwin W. (2002). Managing seller-buyer new<br />
product development relationships for customized products: a contingency<br />
model based on transaction cost analysis and empirical test. Journal of Product<br />
Innovation Management, 19 (2002) 6: 439-454.<br />
Su, Jack C. P. / Chang, Yih-Long / Ferguson, Mark (2005). Evaluation of postponement<br />
structures to accommodate mass customization. Journal of Operations<br />
Management, 23 (2005) 3-4 (April): 305-318.<br />
Sydow, Jörg (1992). Strategische Netzwerke. Wiesbaden: Gabler 1992.<br />
Szulanski, Gabriel (2003). Sticky knowledge: Barriers to knowing in the firm. London:<br />
Sage 2003.<br />
Tanner, John F. Jr. (1996). Buyer perceptions of the purchase process and its effects on<br />
consumer satisfaction. Industrial Marketing Management, 25 (1996) 2 : 125-133.<br />
Taylor, Frederik W. (1913). Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung.<br />
München u.a. 1913.<br />
Teichert, Thorsten (2001). Nutzenschätzung in Conjoint-Analysen. Wiesbaden: Gabler /<br />
DUV 2001.<br />
Tepper, Kelly / Bearden, William O. / Hunter, Gary L. (2001). Consumers’ need for uniqueness:<br />
Scale development and validation. Journal of Consumer Research, 28<br />
(2001) 1 (June): 50-66.<br />
Terdiman, Daniel (2005). Lego Factory hacked. CNET News.com, September 15, 2005<br />
[http://tinyurl.com/bnflw].<br />
Thomke, Stefan (2003). Experimentation matters: unlocking the potential of new technologies<br />
for innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press 2003.<br />
Thomke, Stefan / von Hippel, Eric (2002). Customers as innovators: a new way to create<br />
value. Harvard Business Review, 80 (2002) 4 (April): 74-81.<br />
Tirole, Jean (1995). Industrial Economics (Industrieökonomik). München: Oldenbourg<br />
1995.<br />
Toffler, Alvin (1970). Future Shock. New York: Random House 1970.<br />
Toffler, Alvin (1980). The third wave: the classic study of tomorrow. New York: Bantam<br />
Books 1980.<br />
Toubia, Olivier / Hauser, John R. / Simester, Duncan I. (2004). Polyhedral methods for adaptive<br />
choice-based conjoint analysis. Journal of Marketing Research, 41 (2004) 1: 116-131.<br />
350
Quellenverzeichnis<br />
Trommen, Alexander (2002). Mehrstufige Kundenintegration in Wertschöpfungssystemen.<br />
Wiesbaden: Gabler / DUV 2002.<br />
Tsai, Wenpin P. / Ghoshal, Sumantra (1998). Social capital and value creation: the role of<br />
intrafirm networks. Academy of Management Journal, 41 (1998): 462-476.<br />
Tseng, Mitchel / Du, Xuehong (1998). Design by Customers of Mass Customization<br />
Products. Annals of the CIRP, 47 (1998): 103-106.<br />
Tseng, Mitchell / Jiao, Jianxin (2001). Mass Customization. In: Gaviel Salvendy (Hg.):<br />
Handbook of Industrial Engineering, 3rd edition, New York: Wiley 2001: 684-<br />
709.<br />
Tseng, Mitchell / Kjellberg, Torsten / Lu, Stephen (2003). Design in the new e-commerce<br />
era. Annals of the CIRP, 52 (2003) 2: 509-519.<br />
Tyre, Marice / von Hippel, Eric (1997). Locating adaptive learning: the situated nature<br />
of of adaptive learning in organizations. Organization Science, 8 (1997)<br />
1: 71-83.<br />
Udwadia, Firdaus E. / Kumar, Ravi (1991). Impact of customer co-construction in product/service<br />
markets. International Journal of Technological Forecasting and<br />
Social Change, 40 (1991): 261-272.<br />
Ulrich, Karl T. / Eppinger, Steven D. (2000). Product design and development. 2. Auflage,<br />
New York: Irwin McGraw-Hill 2000.<br />
Urban, Glen / Hauser, John (2003). Listening in’ to find unmet customer needs and solutions.<br />
MIT Sloan School of Management Working Paper, Cambridge MA 2003.<br />
Urban, Glen / von Hippel, Eric (1988). Lead user analysis for the development of new<br />
industrial products. Management Science, 34 (1988) 5: 569-582.<br />
Utterback, James (1971). The process of technological innovation within the firm.<br />
Academy of Management Journal, 14 (1971) 1: 75-88.<br />
Utterback, James (1994). Mastering the Dynamics of Innovation. Boston, MA: Harvard<br />
Business School Press 1994.<br />
Van Hoek, Remko I. / Commandeur, Harry R. / Vos, Bart (1998). Reconfiguring logistics systems<br />
through postponement strategies. Journal of Business Logistics, 19 (1998)<br />
1: 33-54.<br />
Vandermerwe, Sandra (1999). Customer capitalism: increasing returns in new market<br />
spaces. London: Nicholas Brealey 1999.<br />
Vandermerwe, Sandra (2000). How increasing value to customers improves business<br />
results. MIT Sloan Management Review, 42 (2000) 1 (Fall): 27-37.<br />
Victor, Bart / Boynton, Andrew C. (1998). Invented here. Boston, MA: Harvard Business<br />
School Press 1998.<br />
Virtel, Martin (2006). Qualität durch Basteln. Financial Times Deutschland vom 24. Feb.<br />
2006 [online: www.ftd.de/rd/51032.html].<br />
von Hayek, Friedrich A./ Kerber,Wolfgang (1996). Die Anmaßung von Wissen. Tübingen:<br />
Mohr Siebeck 1996.<br />
351
Quellenverzeichnis<br />
von Hippel, Eric (1978a). Successful industrial products from customer ideas: presentation<br />
of a new customer-active paradigm with evidence and implications.<br />
Journal of Marketing, 42 (1978) 1 (January): 39-49.<br />
von Hippel, Eric (1978b). A customer active paradigm for industrial product idea generation.<br />
Research Policy, 7 (1978): 240-266.<br />
von Hippel, Eric (1986). Lead users: a source of novel product concepts. Management<br />
Science, 32 (1986) 7: 791-805.<br />
von Hippel, Eric (1988). The sources of innovation. Oxford: Oxford University Press 1988.<br />
von Hippel, Eric (1990). Task partitioning: An innovation process variable. Research<br />
Policy, 19 (1990) 5: 407-418.<br />
von Hippel, Eric (1994). Sticky information and the locus of problem solving.<br />
Management Science, 40 (1994) 4: 429-439.<br />
von Hippel, Eric (1998). Economics of product development by users: the impact of<br />
„sticky“ local information. Management Science, 44 (1998) 5: 629-644.<br />
von Hippel, Eric (2001). Perspective: user toolkits for innovation. Journal of Product<br />
Innovation Management, 18 (2001) 4 (July): 247-257.<br />
von Hippel, Eric (2005). Democratizing innovation. Cambridge, MA: MIT Press 2005.<br />
von Hippel, Eric / Katz, Ralph (2002). Shifting innovation to users via toolkits.<br />
Management Science, 48 (2002) 7 (July): 821-833.<br />
von Hippel, Eric / Thomke, Stefan / Sonnak, Mary (1999). Creating breakthroughs at 3M.<br />
Harvard Business Review, 77 (1999) 5 (September/October): 47-57.<br />
von Hippel, Eric / Tyre, Marcie (1995). How learning is done: problem identification in<br />
novel process equipment. Research Policy, 24 (1995) 1: 1-12.<br />
von Hippel, Eric / von Krogh, Georg (2002). Open source software and the private-collective<br />
innovation model: Issues for organization science. Organization Science, 14<br />
(2002) 2: 209-223.<br />
von Neumann, John (1955). Can we survive technology? Fortune, 91 (1955) 6: 106.<br />
von Rosenstiel, Lutz (1980). Grundlagen der Organisationspsychologie. Stuttgart:<br />
Schaeffer-Poeschel 1980.<br />
Voss, Günter / Rieder, Kerstin (2005). Der arbeitende Kunde: Wenn Konsumenten zu unbezahlten<br />
Mitarbeitern werden. <strong>Frank</strong>furt am Main / New York: Campus 2005.<br />
Wagner, Stephan M. (2003). Intensity and managerial scope of supplier integration.<br />
Journal of Supply Chain Management, 39 (2003) 4 (Fall): 4-15.<br />
Walcher, Dominik (2006). Der Ideenwettbewerb als Methode der aktiven Kundenintegration:<br />
Eine empirische Untersuchung zu Eignung und Kundenverhalten<br />
mit Implikationen für den Innovationsprozess. Dissertation, Technische<br />
Universitaet Muenchen 2006.<br />
Waller, Matthew A. / Dabholkar, Pratibha A. / Gentry, Julie (2000). Postponement, product<br />
customization, and market-oriented supply chain management. Journal of<br />
Business Logistics, 21 (2000) 2: 133-160.<br />
352
Quellenverzeichnis<br />
Wayland, Robert E. / Cole, Paul M. (1997). Customer connections: new strategies for<br />
growth. Boston, MA: Harvard Business School Press 1997.<br />
Weber, Steven (2004). The success of open source. Cambridge, MA: Harvard University<br />
Press 2004.<br />
Web-Tourismus (2003). Gesamtumsatz und Umsatzentwicklung der Reisebranche onund<br />
offline 1999 bis 2006. München: HighText 2006.<br />
Weiber, Rolf / Jacob, <strong>Frank</strong> (2000). Kundenbezogene Informationsgewinnung. In: Martin<br />
Kleinaltenkamp / Wolfgang Plinke (Hg.): Technischer Vertrieb, 2. Auflage,<br />
Berlin / Heidelberg: Springer 2000: 523-612.<br />
Weiber, Rolf / Meyer, Jörg (2002). Virtual Communities. In: Rolf Weiber (Hg.): Handbuch<br />
Electronic Business, 2. Aufl., Wiesbaden: Gabler: 343-361.<br />
Westbrook, Roy / Williamson, Peter (1993). Mass Customization. European Management<br />
Journal, 11 (1993) 1: 38-45.<br />
Wheelwright, Steven C. / Clark, Kim B. (1992). Revolutionizing product development:<br />
quantum leaps in speed, efficiency, and quality. New York: The Free Press 1992.<br />
Wikström, Solveig (1996b). The customer as co-producer. European Journal of<br />
Marketing, 30 (1996) 4: 6-19.<br />
Wikström, Solveig (1996a). Value creation by company-consumer interaction. Journal of<br />
Marketing Management, 12 (1996): 359-374.<br />
Wikström, Sovleig / Normann, Richard (1994). Knowledge and value: The company as a<br />
knowledge processing and value creating system. London: Routledge 1994.<br />
Wildemann, Horst (1999). Produktklinik: Leitfaden zur Steigerung der Lerngeschwindigkeit<br />
und Produktkostensenkung. München: TCW Verlag 1999.<br />
Wildemann, Horst (2004). Entwicklungspartnerschaften in der Automobil- und<br />
Zuliefererindustrie. München: TCW Verlag 2004.<br />
Williams, Ruth L. / Cothrel, Joseph (2000). Four smart ways to run online communities.<br />
MIT Sloan Management Review, 41 (2000) 4: 81-91.<br />
Williamson, Oliver E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications.<br />
New York: The Free Press 1975.<br />
Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets,<br />
relational contracting. New York: The Free Press 1985.<br />
Wind, Yoram (Jerry) / Rangaswamy, Arvind (2001). Customerization: the next revolution<br />
in mass customization. Journal of Interactive Marketing, 15 (2001) 1 (Winter):<br />
13-32.<br />
Witte, Eberhard (1973). Organisation für Innovationsentscheidungen: Das Promotoren-<br />
Modell. Göttingen: Otto Schwarz & Co 1973.<br />
Wöhe, Günther (1960). Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre.<br />
München: Vahlen 1960.<br />
Wolf, Joachim (2003). Organisation, Management, Unternehmensführung. Wiesbaden:<br />
Gabler 2003.<br />
353
Quellenverzeichnis<br />
Wynstra, Finn/ van Weele, Arjan J. / Weggemann, Mathieu (2001). Managing supplier<br />
involvement in product development: Three critical issues. European<br />
Management Journal, 19 (2001) 2: 157-167.<br />
Zachte, Erik (2005). Wikipedia-Statistik. Erzeugt am 25. Dezember 2005 aus dem SQL-<br />
Dump vom 10. Dezember 2005.<br />
Zahn, Erich / Foschiani, Stefan (2002). Wertgenerierung in Netzwerken. In: Horst Albach<br />
et al. (Hg.): Wertschöpfungsmanagement als Kernkompetenz, Wiesbaden:<br />
Gabler 2002: 265-276.<br />
Zahn, Erich / Schmid, Uwe (1996). Produktionswirtschaft: Grundlagen und operatives<br />
Produktionsmanagement Bd.1. Stuttgart: TBW 1996.<br />
Zahra, Shaker A. / George, Gerard (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization,<br />
and extension. Academy of Management Review, 27 (2002) 2: 185-203.<br />
Zaichowsky, Judith L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer<br />
Research, 12 (1985) December: 341-352.<br />
Zäpfel, Günther (1982). Produktionswirtschaft: Operatives Produktionsmanagement.<br />
Berlin / Heidelberg: Springer 1982.<br />
Zäpfel, Günther (1996). Auftragsgetriebene Produktion zur Bewältigung der<br />
Nachfrageungewissheit. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66 (1996) 7: 861-877.<br />
Zerdick, Axel / Picot, Arnold / Schrape, Klaus / Artope, Alexander / Goldhammer, Klaus /<br />
Heger, Dominik K. / Lange, Ulrich T. / Vierkant, Eckart / Lopez- Escobar, Esteban /<br />
Silverstone, Roger (2001). Die Internet-Ökonomie: Strategien für die digitale<br />
Wirtschaft. 3. Auflage, Berlin / Heidelberg: Springer 2001.<br />
Ziegler, Johannes (1997). Information age organizations and success. Dissertation,<br />
Universität Augsburg 1997.<br />
Zipkin, Paul (2001). The limits of mass customization. MIT Sloan Management Review,<br />
42 (2001) 3 (Spring): 81-87.<br />
Zuboff, Shoshana / Maxmin, James (2002). The support economy: why corporations are<br />
failing individuals and the next episode of capitalism. London: Viking Penguin<br />
2002.<br />
354
Personen- und Firmenindex<br />
121TIME VII, 239<br />
Adidas 170, 176, 192, 197, 204, 257<br />
Akao, Yoji 111<br />
Appache Server 180<br />
BAA Food Flavors 168<br />
Barnard, Chester 4<br />
Beckham, Dave 192<br />
Bell, Daniel 22<br />
Benkler, Yoachi 6, 59, 71<br />
BMW 97<br />
BoingBoing Blog 52<br />
Brunner, Jean-Claude 5, 27, 47<br />
Cafe Brotraum VII<br />
Cafepress 25, 242, 243<br />
Chesbrough, Henry 117<br />
Cisco 118<br />
Converse 170<br />
COSMOS/Projekt IX<br />
Creative Commons 127<br />
D.tools 165<br />
Daimler Chrysler 244<br />
Dell 28, 39, 43, 50, 62, 242<br />
Dell, Michael 28<br />
Dolzer 304<br />
Drucker, Peter 22<br />
EBay 97, 243<br />
Eli Lilly 97, 116<br />
eMachineshop.com 25<br />
Encyclopaedia Britannica 64<br />
Engelhardt, Werner 5, 47<br />
EOS 218<br />
EUROSHOE-Projekt IX<br />
Exciting eCommerce Blog 52<br />
Expedia 280, 288<br />
Factory121 239<br />
FC Bayern München 174<br />
Flickr 64, 132, 313<br />
Ford 15, 43, 142, 205<br />
Ford, Henry 15, 205<br />
Free CPU Projekt 184<br />
Gadowski, Lukas V, 52<br />
Gates, Bill 132<br />
General Electric 113<br />
Google 132, 243<br />
Graham, Bette N. 124<br />
Griffith, Saul 141<br />
Grün, Oskar 6, 27, 47<br />
Gutenberg, Erich 18<br />
Gutenberg-Projekt 59<br />
Hansen, Ursula 5<br />
Harley Davidson 210<br />
Heinen, Edmund<br />
Henkel, Joachim 128<br />
i
Hennig, Thorsten 5<br />
Herstatt, Cornelius 97<br />
Hyve 313<br />
IBM 183<br />
Ikea 1<br />
Innocentive 93, 96, 104,115, 117,<br />
171, 175<br />
InnovationNet.com 115<br />
Intellifit 209<br />
Jacana Tours 284, 290<br />
Kite-Surfing 41, 54, 56, 62, 71, 142<br />
Kleinaltenkamp, Michael 5, 46, 47<br />
Klemmer, Scott 165<br />
Krisch, Jochen 52<br />
Land's End 209, 304<br />
LEGO 174, 253<br />
Lindemann, Udo VIII<br />
Linel GmbH 294<br />
Linux 64, 180<br />
Liquid Paper 124<br />
Loewe 234<br />
Lucent 113, 118<br />
Lugnet 254<br />
Lulu.com 25<br />
Lutz, Burkhart 17<br />
MACS-Projekt IX<br />
MAKE Magazine 25<br />
Mathworks 189<br />
MeJeans 304<br />
mi Adidas 170, 192, 204, 257, 259<br />
Microsoft 89, 132<br />
Misterovivh, Pat 141<br />
Muji 188<br />
My Virtual Model (MVM) 209<br />
NASA-Clickworker Projekt 59, 70<br />
Netscape 133<br />
ii<br />
Nike 170, 192, 258, 259<br />
NineSigma 115<br />
Normann, Richard 4, 5, 47<br />
Novell 183<br />
Odeo 141<br />
Open Invention Network 182<br />
Oscar Projekt 184, 313<br />
Ouside Innovation Blog 132<br />
Personalnovel V<br />
Pez MP3 Player 141<br />
Philips 183<br />
Pine, Joseph B. 204<br />
Porter, Michael 5, 12<br />
Prahald, C.K. 5, 47, 81<br />
Pribilla, Peter II<br />
Procter & Gamble 114, 117, 171<br />
Puma 170<br />
Ramaswamy, Venkatram 5, 47<br />
Ramirez, Rafael 4, 5, 47, 71<br />
RAND Corporation 158<br />
Raymonds, Eric 181<br />
Red Hat 183<br />
Reebok 170, 258<br />
Rieder, Kerstin 6, 27<br />
Schonfeld, Eric 63<br />
Schumpeter, Joseph 97,116, 172<br />
Seybold, Patricia 132<br />
Siquid Labs 142<br />
Smith, Adam 172<br />
Sony 183<br />
Spreadshirt V, 51, 52, 56, 62, 87,<br />
105, 242<br />
Stallman, Richard 270<br />
Stata Corp 88<br />
Stiftung Warentest 24<br />
Stotko, Christof 219
Sun Microsystems 64<br />
Swarovski 177<br />
Taylor, Frederick 11<br />
Threadless 2, 43, 62, 71, 88, 105, 189<br />
Timberland 170<br />
Tipp-Ex 124<br />
Toffler, Alvin 4<br />
TU München 174<br />
von Hippel, Eric IX, 6, 47, 54,113,<br />
127, 141<br />
Voß, Günter 6, 27, 46<br />
Wikipedia 43, 59, 64, 70, 88, 132,<br />
184, 270<br />
Wikström, Solveig 4, 47, 71<br />
WINSERV Projekt VIII<br />
Xerox 113<br />
YouEncore 115<br />
Zagat V, 3<br />
Zazzle 242, 243<br />
Zeroprestige.org 42<br />
Zuboff, Shoshana 27<br />
Sachindex<br />
3D-Drucker 218f<br />
Absatzeffizienz 214f, 236, 301<br />
Absorptionsfähigkeit, Absorptive<br />
Capacity 84f, 90<br />
Allokationsproblem 11f, 18, 82<br />
Amateurfunk, User Innovation im VI<br />
Anwendungswissen 83f, 91, 316<br />
Arbeitsteilung, klassische 14, 125,<br />
150, 316<br />
Arbeitsteilung, neue 3, 9, 45, 150<br />
assemble-to-order 210<br />
Austausch, sozialer 1, 45, 72<br />
Baukastensystem 29<br />
Bedürfnisinformation 48, 55ff, 103,<br />
107ff, 119f, 124ff, 152, 214,<br />
316<br />
Bedürfnispyramide 23<br />
Bedürfnisse, Kunden-54, 72, 122,<br />
137, 142, 193, 207, 230<br />
Bedürfnisse, offene 137, 142<br />
Betriebsführung, wissenschaftliche<br />
11, 14<br />
Beziehungsmarketing 4, 155, 201,<br />
227f, 236, 253, 301<br />
Blog 25, 52<br />
Bridging-Strategie 79, 81, 84<br />
build-to-order 210<br />
bundle-to-order 209<br />
Closed Innovation 117,119<br />
Clubgüter 68<br />
Cluster-Analyse 55<br />
Co-Creation 5, 46f, 199<br />
Co-Design 133, 144, 167, 169ff, 198,<br />
199ff, 208, 232, 237, 243, 245<br />
Collective Innovation 73<br />
iii
Commons-based Peer-Production<br />
6,13f, 58f, 63, 73, 87, 90, 134,<br />
177, 180, 314<br />
Communication Rings 178f<br />
Communities for User Innovation<br />
151, 176, 189<br />
Communities of Practice 179<br />
Communities 42, 63, 126, 178<br />
Communities, Basisliteratur 189<br />
Community-Medien VI<br />
Conjoint-Analyse 111, 194<br />
Consesual Assessment Technique<br />
(CAT) 174, 257<br />
Content Trees 178f, 186<br />
Co-Produktion 26, 46, 47<br />
Cost-to-Market 150, 151<br />
Customer Integration 5, 47<br />
Customer Relationship Management<br />
(CRM) 155, 201, 228, 262,<br />
301<br />
Customer-active paradigm (CAP) 6,<br />
42, 106, 120, 122, 123, 128<br />
Customer-Pull-Strategie 212<br />
Decoupling-Punkt 211<br />
Delphi-Methode 157, 158<br />
Demokratisierung von Innovation<br />
127<br />
Design-it-yourself 133, 141, 145<br />
Designwettbewerb 43, 264<br />
Development-to-order 151, 210, 226<br />
Dienstleistungsproduktion 48, 200<br />
Differenzierungsstrategie, -politik 24,<br />
46, 76, 192, 201, 230, 308<br />
Do-it-yourself 133, 141f, 145, 199<br />
Dynamic Packaging 279ff, 285,<br />
287ff<br />
Early-Adopter 138, 148<br />
E-Commerce 52<br />
iv<br />
Economies of Integration 202, 223,<br />
229, 236, 237, 306<br />
Economies of Scale 3, 17, 19f<br />
Economies of Scope 17, 19, 21<br />
Effizienz, operationale 25<br />
Eigenbedarf 6, 54<br />
Einzelfertigung 22, 52, 202ff, 205,<br />
216f, 223, 230, 262, 296<br />
embedded configuration 226<br />
Empowerment 21, 24, 27, 76<br />
engineer-to-order 210, 296<br />
Erfahrungseigenschaften 242<br />
Erfindung, Begriff 98<br />
Ertragsgesetz 10, 19, 67<br />
Exploring-Phase 238, 244<br />
Externalitäten 68, 70f<br />
Faktor, dispositiver 18<br />
Faktor, externer 5, 48, 158<br />
First-Copy-Costs 67, 71, 158<br />
Fit-to-Market 46, 75f, 150ff, 224<br />
Flow-Erlebnis 145, 250f<br />
Fokusgruppen 109<br />
Free Revealing 71f, 124, 136<br />
Frictionless Commerce 39<br />
Fuzzy Front End 55, 103<br />
Gatekeeper 89<br />
Gemeinschaften, virtuelle 178, 183f,<br />
186, 188<br />
Gesellschaft, postindustrielle 22<br />
Granularität 45f, 62f, 73,81, 92<br />
Grenze des Unternehmens 30<br />
Hedonismus 23, 259<br />
Herstellerinnovation 104, 122, 124<br />
Heterogenisierung, Heterogenität 21,<br />
26, 54<br />
Hybrid-Strategie 24, 29<br />
Idealpunkt 193f, 210, 213, 230f, 308
Ideation 103<br />
Ideenbörsen 96<br />
Ideengenerierung 96, 101, 103, 129,<br />
131f, 151, 173, 180, 314f<br />
Ideenwettbewerb 93, 160, 173ff, 257,<br />
262f, 265ff<br />
Individualisierung der Nachfrage 22,<br />
28, 40, 76, 95, 192, 198<br />
Individualisierung von<br />
Dienstleistungen 196<br />
Information Overload 221<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnologie,<br />
neue Möglichkeiten 4, 22, 30,<br />
37, 66, 80, 223<br />
Informationsdienstleister 30<br />
Informationsgüter 65ff, 71, 94, 132,<br />
134, 242, 270<br />
Informationsopportunitätskosten 60<br />
Informationsparadoxon 66f<br />
Informationsproduktion 60, 62, 66f,<br />
70f, 82<br />
Innovation, Arten 101<br />
Innovation, Begriff 97<br />
Innovationsbereitschaft 82, 136, 140,<br />
146<br />
Innovationsfähigkeit 37, 82f, 90, 95f,<br />
135, 137, 140<br />
Innovationsgrad 77, 100ff, 153, 163<br />
Innovationsnetzwerke 91, 114, 116,<br />
117, 119f, 177<br />
Innovationswettbewerb 149, 156,<br />
171f, 188, 257, 263, 265<br />
Institutionenökonomie 33<br />
Integration, vertikale 17, 32, 35, 60<br />
Intellectual Property Rights (IP) 65<br />
Interaktion, Interaktionsprozess 39,<br />
45, 200, 213, 232, 237<br />
Interaktionserlebnis 46, 75<br />
Interaktionskompetenz 46, 63, 71,<br />
79, 81, 84, 90ff, 133, 316<br />
Interaktionskosten 74, 148f, 191,<br />
219, 236, 310<br />
Interaktionsplattform 2, 71, 87, 93,<br />
164f, 177, 200, 263<br />
Involvement 138f, 149, 188, 232,<br />
250<br />
Käufermärkte 7, 24, 29f<br />
Käuferverhalten 30<br />
Kernkompetenz 10, 36, 77f, 84, 118,<br />
258, 316<br />
Kommunikationsphase 241<br />
Kommunikationsstrukturen 85<br />
Komplexität, kognitive 139, 149<br />
Konfiguration, Konfigurator 80, 169,<br />
193, 207, 208, 220, 239, 244,<br />
245, 249ff, 260, 291, 296ff<br />
Konfiguration, Kosten der 220<br />
Konfigurator, Aufgaben des 248<br />
Konsumkompetenz 137<br />
Konsumsoziologie 5<br />
Kontinuierliche Verbesserung 205,<br />
262<br />
Konzeptentwicklung 103<br />
Kooperation 1,4, 6, 31, 32, 34f, 43,<br />
47, 59, 73, 91, 119f, 126f, 131,<br />
140, 147, 299, 313<br />
Koordination bei Commons-based<br />
Peer-Production 88<br />
Koordination durch Märkte 38, 314<br />
Koordination, hierarchische 14, 17,<br />
314<br />
Koordination, hybride 29, 119<br />
Koordinationsproblem 16, 29, 33, 62,<br />
274<br />
Kosteneffizienz 12, 199, 214, 215,<br />
223, 225, 230, 292, 301, 305<br />
Kostenführerschaft 19, 76, 196<br />
v
Kostenoption 202<br />
Kostenwirtschaftlichkeit 7, 18, 35,<br />
202, 214, 313<br />
Kreativität, Bewertung von 174<br />
Kreativitätstechniken 162<br />
Kunde als strategische Ressource 78<br />
Kunde, aktive 25, 26, 40<br />
Kundenaktivismus 25<br />
Kundenbedürfnisse 8, 50, 54, 72,<br />
100, 122, 137, 142, 152, 193,<br />
207, 230, 253, 285<br />
Kundeninnovation 95, 120, 122, 133,<br />
234<br />
Kundenintegration 5, 9, 13, 40, 45ff,<br />
100, 104f, 134, 144, 146, 199,<br />
203, 210, 223<br />
Kundenintegration, Basisliteratur 53<br />
Kundeninteraktion, Basisliteratur 255<br />
Kundeninteraktion, Phasenmodell<br />
239<br />
Kundenorientierung 105, 107, 111,<br />
113<br />
Kundenwissen 49, 56, 78, 84f, 89,<br />
129, 134, 253<br />
Lasersintern 104<br />
Lead User 46, 47, 57, 81, 125, 137,<br />
148, 156, 208<br />
Lead User, Basisliteratur 163<br />
Lead User, Eigenschaften von 137,<br />
149, 159<br />
Lead User, Identifikation von 159,<br />
176, 257, 269<br />
Learning Relationship 228, 230, 253<br />
Leistungspotenzial 48, 49, 146, 238,<br />
241<br />
Leistungstiefe 32<br />
locate-to-order 209<br />
Lösungsinformation 55ff, 108, 107f,<br />
126, 129, 137, 143f<br />
vi<br />
Lösungsraum 45, 49, 100, 124, 166,<br />
199, 203, 208<br />
Low-cost user innovation niche 143<br />
Make-to-order 196, 198, 210, 262<br />
Manufacturer-active paradigm<br />
(MAP) 6, 42, 56, 113, 120,<br />
123, 128, 154<br />
Marken-Communities 185<br />
Markteinführung 79, 102ff, 104, 120,<br />
149ff, 151, 209<br />
Marktforschung 8, 26, 40, 46, 55,<br />
109f, 122, 152, 192<br />
Marktorientierung 29, 40, 76, 122<br />
Markttransparenz 8, 25, 38f, 76, 194<br />
mass confusion 221<br />
Mass Customization 9, 45, 50, 144,<br />
198, 235, 257, 285, 294, 303,<br />
315<br />
Mass Customization, Kosten aus<br />
Kundensicht 221<br />
Mass Customization, Prinzipien 199,<br />
204<br />
Massenproduktion 17, 23, 50, 194,<br />
198, 205, 207ff, 217, 305<br />
Massenproduktion,<br />
kundenindividuelle 198<br />
Maßkonfektion 227, 249, 303<br />
match-to-order 192, 209, 262<br />
Meinungsführerschaft 138<br />
Meinungsplattformen 185<br />
Micro-Merchandising 51<br />
Modularisierung 29, 62, 92, 166, 203<br />
Motivation von Lead Usern 137, 140,<br />
141<br />
Motivation, extrinsische 46, 74, 147<br />
Motivation, intrinsische 46, 75, 145,<br />
250<br />
Motivationsproblem 33, 62<br />
Motive, soziale 146
Move-to-the-Market-Hypothese 38<br />
Need information 55<br />
Netzeffekte 72<br />
Netzwerkökonomie 50, 82<br />
Netzwerkorganisation 27, 30, 105,<br />
114, 314<br />
New-to-Market 153<br />
Not-Invented-Here-Problem 79, 89,<br />
118<br />
Nutzen, extrinsischer 46, 74, 147<br />
Nutzen, intrinsischer 46, 75, 145, 250<br />
Nutzen, Kunden- 46, 72, 135, 144,<br />
179<br />
Nutzerinnovation, User Innovation<br />
95, 122, 128<br />
Offenlegung von Information 65<br />
Öffentliche Güter 68, 78<br />
Open Innovation 9, 45, 50, 77, 95,<br />
102, 106, 113, 129, 132, 208,<br />
257, 268, 315<br />
Open Innovation, Basisliteratur 135,<br />
155<br />
Open Innovation, Kosten und<br />
Grenzen der 154<br />
Open-Source, Motivation von OS-<br />
Programmieren 145<br />
Open-Source-Software 6, 59, 70, 73,<br />
132, 180<br />
Ordertracking 252<br />
Organisationsformen, hybride 35, 36<br />
Organisationsgrenze 30, 31<br />
Organisationsproblem 14, 32<br />
Organisationstheorie 4<br />
Patente 66, 98<br />
Peer-to-Peer-Produktion 60<br />
Phasenmodell des<br />
Innovationsprozess 101<br />
Preisdiskriminierung 38, 202, 230,<br />
233<br />
Preispremium 202, 230, 233, 308<br />
Preiswettbewerb 38, 39, 234<br />
Pride-of-authorship Effekt 145, 232<br />
Principal-Agent-Ansatz 221<br />
Principles of Common Wisdom 17<br />
Problemlösung, verteilte 96<br />
Problemlösungsprozess 116, 151<br />
Produktdatenmanagement (PDM)<br />
298<br />
Produktdifferenzierung 40, 76, 201,<br />
230<br />
Produktindividualisierung 9, 50, 52,<br />
75, 77, 193, 195, 201, 238<br />
Produktindividualisierung,<br />
Ansatzpunkte 202, 215, 315<br />
Produktinnovation 99<br />
Produktions- und Kostenfunktionen<br />
19<br />
Produktionsnetzwerke 31<br />
Produktionstheorie 18<br />
Produktivität 18<br />
Produktqualität 230<br />
Produkt-Service-Bündel 1<br />
Property-Rights-Theorie 33, 34, 63,<br />
65<br />
Prosumer 4, 46<br />
Prototypen 54, 104<br />
Prozessinnovation 90, 99<br />
Prozesszufriedenheit, -qualität 145,<br />
214, 230, 232, 250<br />
Pyramiding 159<br />
Qualität, hedonistische 144<br />
Quality Function Deployment 110,<br />
126, 315<br />
Rapid Manufacturing 217, 218<br />
Rapid Prototyping 104, 217<br />
vii
Rationalitätprinzip 11<br />
Resouce-Dependence-Theorie 78<br />
Ressourcenabhängigkeit, Theorie der<br />
78<br />
Ressourcenorientierter Ansatz 77<br />
Reziprozität 75<br />
Scanner, Körper- 209, 260, 304<br />
Schnittstellenprobleme 29<br />
Schuhindustrie 171<br />
Scientific Management 14, 15<br />
Screening 160<br />
Segment-of-one 54<br />
Selbstbedienung 1, 25, 46<br />
Selbstmotivation 4<br />
Selbstorganisation 40<br />
Selbstselektion 4, 60<br />
Self-Service 41<br />
Simulation 164<br />
Skaleneffekte 17, 60, 67, 217<br />
Social Commerce VI<br />
Soft Customization 209<br />
Solution information 55<br />
Solution Space 45, 49, 166<br />
Spezialisierungseffekte 60<br />
Spezifität 35<br />
Sportartikelbranche 122<br />
Standardisierung 196, 203, 213<br />
Standortfrage 31<br />
Stereolithografie 104<br />
sticky information 56, 57, 69, 129,<br />
143, 164, 208, 214, 224<br />
Structure-Conduct-Performance-<br />
Modell 76<br />
Subsidiaritätsprinzip 90<br />
Sucheigenschaften 242<br />
Supply Chain 37, 192,<br />
Szenario-Analyse 158<br />
viii<br />
Task partitioning 57<br />
Taylorismus 14, 49<br />
Teamkompetenz 139<br />
Telekooperation 30<br />
Time-to-Market 150<br />
Toolkits for Co-Design 144, 163,<br />
167, 170, 207, 237, 245<br />
Toolkits for User Innovation 47, 80,<br />
104, 144, 151, 160, 163, 237,<br />
246<br />
Toolkits zum Ideentransfer 171<br />
Toolkits, Basisliteratur 172<br />
Tragödie der Allmende 69<br />
Transaktionskosten 33, 34, 61, 92,<br />
147, 216, 310<br />
Trendanalyse 157<br />
Trial-and-Error 57, 116, 151, 165<br />
Unternehmen, virtuelle 30<br />
Unternehmertum 33<br />
User Innovation Networks 62<br />
Variantenfertigung 27<br />
Variety-Seeking 24<br />
Verbesserungsinnovation 90, 124,<br />
153<br />
Verbundeffekte 17, 217<br />
Vertrauenseigenschaften 242<br />
Vertriebskooperation 37<br />
Virtual Reality 38<br />
Voice-of-the-customer 105, 108, 122,<br />
129, 315<br />
Vorfertigungsgrad 203, 211<br />
Vorkombination 48, 211, 218<br />
Web 2.0 132<br />
Wertschöpfung 11<br />
Wertschöpfung, Grenzen der<br />
interaktiven 74, 91, 93, 134,<br />
154, 221, 314
Wertschöpfung, interaktive 1, 4, 12,<br />
40, 41, 44, 94, 131, 207, 237,<br />
303, 314<br />
Wertschöpfungskette 12<br />
Wertschöpfungspartnerschaft 40<br />
Wettbewerbsvorteile, Quellen der 76,<br />
149<br />
Wissen, explizites 69<br />
Wissen, implizites 69<br />
Wissen, lokales 45, 55, 69, 90, 117,<br />
208<br />
Wissen, Transformation von 82<br />
Wissensarbeit 23<br />
Wissensaustausch 40<br />
Wissensökonomische Reife 56<br />
Wissensproduktion, verteilte 59, 63<br />
Zahlungsbereitschaft 75, 152<br />
Zwangsarbeiter Kunde, These vom<br />
25<br />
Diese Version bezieht sich auf die erste Auflage des Buchs. Eine aktuelle Version dieser<br />
Datei erhalten Sie unter www.open-innovation.com/iws.<br />
Diese Datei wurde von den Autoren des Buchs zum Download im Internet bereitgestellt. Die<br />
Verwendung und Verbreitung dieses Files ist unter den Bedingungen der Creative<br />
Commons Lizenz "Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 2.5" gestattet. Die<br />
genauen Bedingungen dieser Lizenz können Sie hier lesen:<br />
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/<br />
© Copyright 2006 by <strong>Ralf</strong> <strong>Reichwald</strong> und <strong>Frank</strong> <strong>Piller</strong>.<br />
ix
2. Auflage erschienen<br />
Liebe Leser,<br />
im April 2009 ist endlich die<br />
zweite und deutlich überarbeitete<br />
Auflage unseres Buchs erschienen.<br />
Die Kapitelstruktur und<br />
wesentliche Definitionen wurden<br />
ebenso überarbeitet wie die<br />
Fallstudien aktualisiert.<br />
Auszüge der überarbeiteten 2.<br />
Auflage können Sie wiederum auf<br />
der Website zum Buch,<br />
www.open-innovation.de,<br />
downloaden.
Ihr Feedback<br />
Hat Ihnen dieses Buch gefallen? Würden Sie es weiter<br />
empfehlen? Was würden Sie ergänzen? Was in der<br />
nächsten Aufklage ergänzen oder kürzen?<br />
Bewerten Sie dieses Buch! Schreiben Sie uns Ihre<br />
Meinung zum Buch – und helfen Sie anderen Lesern zu<br />
beurteilen, ob sie dieses Buch lesen und kaufen oder<br />
downloaden sollen.<br />
Senden Sie Ihren Kommentar entweder an<br />
buch@open-innovation.com<br />
oder aber – noch besser – teilen Sie Ihre Meinung als<br />
Leser-Feedback bei Amazon:<br />
http://www.amazon.de/gp/product/3834901067<br />
So können Sie anderen Lesern am besten sagen, ob<br />
dieses Buch lohnt, bis zur letzten Seite gelesen zu<br />
werden.<br />
Wir freuen uns über Ihr ehrliches Feedback !