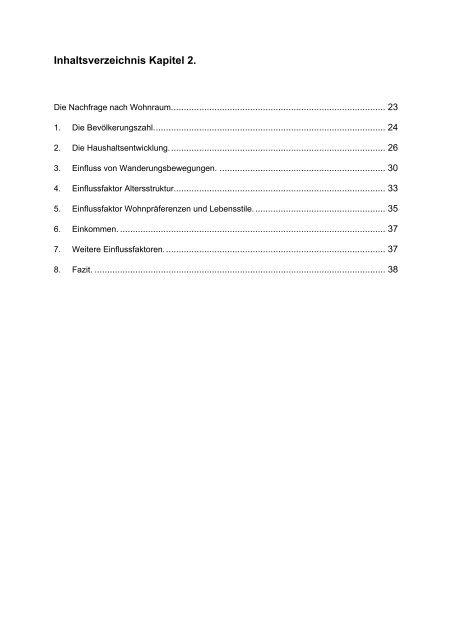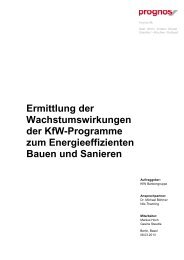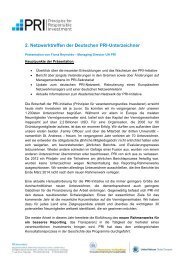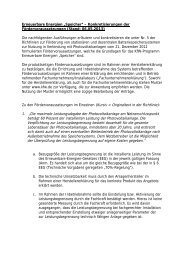Die Nachfrage nach Wohnraum (nicht barrierefrei) (PDF, 386 ... - KfW
Die Nachfrage nach Wohnraum (nicht barrierefrei) (PDF, 386 ... - KfW
Die Nachfrage nach Wohnraum (nicht barrierefrei) (PDF, 386 ... - KfW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichnis Kapitel 2.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong>.................................................................................... 23<br />
1. <strong>Die</strong> Bevölkerungszahl........................................................................................... 24<br />
2. <strong>Die</strong> Haushaltsentwicklung..................................................................................... 26<br />
3. Einfluss von Wanderungsbewegungen. ................................................................. 30<br />
4. Einflussfaktor Altersstruktur................................................................................... 33<br />
5. Einflussfaktor Wohnpräferenzen und Lebensstile.................................................... 35<br />
6. Einkommen. ........................................................................................................ 37<br />
7. Weitere Einflussfaktoren....................................................................................... 37<br />
8. Fazit. .................................................................................................................. 38
Kapitel 2<br />
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong>.<br />
In der Literatur herrschen zwei verschiedene Definitionen der <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong>:<br />
<strong>Die</strong> erste Definition lässt nur die <strong>Nachfrage</strong> bei Wohnungswechsel oder Haushaltsgründungen<br />
als Markt<strong>nach</strong>frage gelten. Eine weitere Definition der Wohnungs<strong>nach</strong>frage bezieht auch<br />
die Haushalte mit ein, die mit <strong>Wohnraum</strong> versorgt sind und sozusagen „befriedigte <strong>Nachfrage</strong>“<br />
darstellen. 1 Zwar kann ein Teil der <strong>Nachfrage</strong> in der letzteren Bedeutung als latente oder<br />
zukünftige <strong>Nachfrage</strong> bezeichnet werden in dem Sinn, dass ein Teil der Mieter, also ein Teil<br />
der befriedigten <strong>Nachfrage</strong>, in der Zukunft einen Wohnungswechsel vornehmen und ein Teil<br />
der Eigentümer ihre Wohnung verkaufen und ein neues Objekt erwerben werden, aber am<br />
Markt agieren nur Haushalte, die tatsächlich eine Wohnung suchen. Insofern empfiehlt es<br />
sich, den Begriff der <strong>Nachfrage</strong> im Einklang mit der engen Definition zu beschränken.<br />
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einflüsse auf die Wohnungs<strong>nach</strong>frage und ihre<br />
Wirkungsmechanismen betrachtet. <strong>Die</strong>se lassen sich in demografische, gesellschaftliche und<br />
ökonomische Einflussfaktoren einteilen.<br />
Demografische Einflussfaktoren:<br />
• Zahl der Haushalte. Davon hängt die Zahl der <strong>nach</strong>gefragten Wohnungen unmittelbar ab.<br />
• Bevölkerungszahl. <strong>Die</strong>se übt den Haupteinfluss auf die Zahl der Haushalte aus.<br />
• Geburten- und Sterbezahl, Altersstruktur, Migrationssaldo. Aus diesen Größen errechnet<br />
sich die Bevölkerungsentwicklung.<br />
• <strong>Die</strong> Alterstruktur der Bevölkerung übt zudem Einfluss auf die Größe und die Art der <strong>nach</strong>gefragten<br />
Wohnungen aus.<br />
Gesellschaftliche Einflussfaktoren:<br />
• Wohnpräferenzen und Lebensstile in der Bevölkerung. Sie beeinflussen die Größe und<br />
die Art der <strong>nach</strong>gefragten Wohnungen.<br />
Ökonomische Einflussfaktoren:<br />
• Einkommensentwicklung<br />
1 Kühne-Büning und Heuer, S. 132 f.
24 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
• gesamtwirtschaftliches Wachstum<br />
• Einkommensverteilung.<br />
• Preisentwicklung und Zinsniveau.<br />
Zu beachten ist bei der Analyse der <strong>Nachfrage</strong>, dass der Wohnungsmarkt stark segmentiert<br />
ist. <strong>Die</strong>s gilt im Hinblick auf die räumliche Dimension, auf die Wohnungsqualität und mit Bezug<br />
auf die anvisierten Nutzer der Wohnung. Letztendlich sind in Bezug auf die <strong>Nachfrage</strong><br />
vor allem die einzelnen Segmente von Interesse. Globale Aussagen für den Gesamtmarkt<br />
können in einzelnen Segmenten unzutreffend oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt sein.<br />
1. <strong>Die</strong> Bevölkerungszahl.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung der Bevölkerungszahl ist langfristig die entscheidende Einflussgröße. Zwei<br />
Tendenzen kennzeichnen die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands in den nächsten Jahrzehnten:<br />
Schrumpfung und Alterung. Beide Tendenzen werden hauptsächlich durch das<br />
Geburtendefizit erzeugt. 2 Der Überschuss der Todesfälle über die Zahl der Lebendgeburten<br />
besteht in Deutschland seit 1972. 3 Dennoch ist die Bevölkerung Deutschlands seit diesem<br />
Zeitpunkt weiter gewachsen – um insgesamt 4,4 % 4 – da ein positiver Wanderungssaldo in<br />
den meisten Jahren das Geburtendefizit überkompensiert hat.<br />
Seit dem Höhepunkt der Zuwanderung im Jahr 1992 ist der Wanderungsgewinn Deutschlands<br />
jedoch zusammengeschmolzen und betrug im Jahr 2006 gerade noch 23.000 Personen<br />
5 – mit der Folge, dass der Wanderungssaldo das Geburtendefizit <strong>nicht</strong> mehr ausgleichen<br />
kann. <strong>Die</strong> Bevölkerung Deutschlands ist 2002 zum letzten Mal angestiegen (und seit damals<br />
kontinuierlich – wenn auch in sehr geringem Ausmaß – zurückgegangen (Tabelle 1)). Der<br />
Bevölkerungsverlust seit 2002 beträgt 222.000 Personen, die Bevölkerung im Jahr 2006 wird<br />
vom Statistischen Bundesamt mit 82,3 Mio. Personen angegeben. 6<br />
2<br />
Eine geringere Rolle spielt auch die Zunahme der Lebenserwartung, vgl. S. 33.<br />
3<br />
Eisenmenger et al. (2006), S. 13.<br />
4<br />
<strong>Die</strong> Zahlen gelten für BRD und DDR, ab 1990 für das wiedervereinigte Deutschland.<br />
5 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilungen Nr. 228 vom 05.06.2007.<br />
6 Statistisches Bundesamt (2007a).
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 25<br />
Tabelle 1: Bevölkerung und Privathaushalte<br />
Bevölkerung 1) Bevölkerung 2) Haushalte<br />
Einpersonenhaushalte<br />
Mehrpersonenhaushalte<br />
Zweipersonenhaushalte<br />
1991 80.274,6 80.152 35.256 11.858 23.398 10.863<br />
1992 80.974,6 80.732 35.700 12.044 23.656 11.156<br />
1993 81.338,1 81.428 36.230 12.379 23.851 11.389<br />
1994 81.538,6 81.763 36.695 12.747 23.948 11.624<br />
1995 81.817,5 81.894 36.938 12.891 24.047 11.858<br />
1996 82.012,2 82.069 37.281 13.191 24.090 12.039<br />
1997 82.057,4 82.235 37.457 13.259 24.198 12.221<br />
1998 82.037,0 82.118 37.532 13.297 24.236 12.389<br />
1999 82.163,5 82.251 37.795 13.485 24.310 12.554<br />
2000 82.259,5 82.473 38.124 13.750 24.374 12.720<br />
2001 82.440,3 82.575 38.456 14.056 24.399 12.904<br />
2002 82.536,7 82.823 38.718 14.224 24.494 13.059<br />
2003 82.531,7 82.892 38.944 14.426 24.518 13.169<br />
2004 82.500,8 82.855 39.122 14.566 24.556 13.335<br />
2005 82.438,0 82.676 39.178 14.695 24.483 13.266<br />
2006 82.314,9<br />
2007 82.502 39.591 15.261 24.331 13.355<br />
2008 82.396 39.741 15.434 24.307 13.456<br />
2009 82.271 39.888 15.608 24.280 13.561<br />
1) Statistisches Bundesamt, Fachsereie 1, Reihe 1.3, Bevölkerungsfortschreibung, Tabelle 1.1.<br />
2) Haushaltsmitglieder. Lange Reihe 5.1: Privathaushalte <strong>nach</strong> Haushaltsgröße und Gebietsstand; ab 2007: eig. Berechnungen<br />
auf der Grundlage der Haushaltsvorausberechnung<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, versch. Publikationen<br />
Möglicherweise ist diese Zahl sehr ungenau, da sie aus der Bevölkerungsfortschreibung<br />
stammt, die ihrerseits auf den letzten Volkszählungen basiert. <strong>Die</strong>se fanden in der BRD zuletzt<br />
1987, in der DDR zum letzten Mal 1981 statt. Je mehr Zeit seit dem letzten Zensus vergangen<br />
ist, desto ungenauer wird die Bevölkerungsfortschreibung. Heute könnte, so schätzt<br />
das Statistische Bundesamt, die Bevölkerung um bis zu 1 Mio. Menschen niedriger sein als<br />
bei der Bevölkerungsfortschreibung berechnet. 7<br />
Das Statistische Bundesamt hat jüngst seine 11. „Bevölkerungsvorausberechnung“ vorgelegt.<br />
8 Darin werden zwei Hauptvarianten unterschieden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen<br />
führen: <strong>Die</strong> „mittlere Bevölkerung, Untergrenze“ und die „mittlere Bevölkerung, Obergrenze“<br />
weisen für das Jahr 2050 eine Bevölkerungszahl von 69 bzw. 74 Mio. aus. 9, 10 Wenn<br />
7<br />
Eisenmenger et al. (2006), S. 9.<br />
8<br />
Eisenmenger et al. (2006), S. 14f.<br />
9<br />
<strong>Die</strong> beiden Hauptvarianten haben die Annahmen konstanter Geburtenhäufigkeit (derzeit 1,4 Kinder<br />
je Frau) und eine um sieben Jahre gestiegene Lebenserwartung gemeinsam und unterscheiden sich<br />
nur durch die Annahme über den Wanderungssaldo (100.000 im Fall der Variante „mittlere Bevölkerung,<br />
Untergrenze“, 200.000 im Fall der Variante „mittlere Bevölkerung, Obergrenze“).<br />
10<br />
Anders als in der 10. Bevölkerungsvorausberechnung gibt es kein „mittleres Szenario“ mehr, sodass<br />
die Unbequemlichkeit entsteht, immer zwei Zahlen beachten zu müssen.
26 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
die Prognose zutreffen sollte, bedeutet dies, dass die Bevölkerung Deutschlands bis zum<br />
Jahr 2050 um 10 bis 17 % schrumpfen wird. 11<br />
<strong>Die</strong> schrumpfende Bevölkerung impliziert bei unveränderten weiteren Bedingungen eine sinkende<br />
<strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> Wohnungen. Allerdings wird dieser Haupteffekt des demografischen<br />
Wandels durch verschiedene sekundäre Wirkungskanäle modifiziert und geschmälert. Betrachten<br />
wir zunächst die Zahl der Haushalte.<br />
2. <strong>Die</strong> Haushaltsentwicklung.<br />
<strong>Die</strong> Bevölkerungsentwicklung wirkt <strong>nicht</strong> unmittelbar auf die Wohnungs<strong>nach</strong>frage. Menschen<br />
leben alleine oder zusammen in Haushalten, von deren Zahl der Bedarf an Wohnungen unmittelbar<br />
abhängt. Von der Größe der Haushalte hängt zudem der <strong>Wohnraum</strong>bedarf ab, also<br />
die Zahl der Wohnräume und etwas weniger direkt die Wohnungsfläche.<br />
82.000<br />
80.000<br />
78.000<br />
76.000<br />
74.000<br />
72.000<br />
70.000<br />
1) Bevölkerungsstand laut Bevölkerungsfortschreibung<br />
2) Bevölkerung in Privathaushalten gemäß Hochrechnung aus Mikrozensus, ab 2007: Schätzungen gemäß Haushaltsfort-<br />
schreibung<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
1) 2)<br />
Bevölkerung Bevölkerung Haushalte<br />
2013<br />
2015<br />
2017<br />
2019<br />
2021<br />
2023<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen<br />
Grafik 1: Bevölkerungs- und Haushaltszahlen 1991–2025 (in Tausend)<br />
41.000<br />
40.000<br />
39.000<br />
38.000<br />
37.000<br />
36.000<br />
2025 35.000<br />
11 Der Rückgang fällt regional verschieden aus: In den alten Ländern erwartet das Statistische Bundesamt<br />
<strong>nach</strong> der Variante „mittlere Bevölkerung, Untergrenze“ einen Bevölkerungsrückgang um 14 %,<br />
in den neuen Ländern könnte er sogar 31 % betragen. (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung<br />
Nr. 210 vom 22.5.2007).
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 27<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Haushalte ist kräftig gestiegen: Während die Bevölkerung von 1991 bis 2005<br />
um 3,1 % 12 gewachsen ist, ist die Zahl der Haushalte im gleichen Zeitraum 13 um 11 % gestiegen<br />
(Tabelle 1, Grafik 1). <strong>Die</strong> kräftige Ausdehnung ist vor allem der starken Zunahme der<br />
Ein- und Zweipersonenhaushalte bei gleichzeitiger Abnahme der Drei- und Mehrpersonenhaushalte<br />
geschuldet (Grafiken 2 und 3). Gleichzeitig ist die durchschnittliche Haushaltsgröße<br />
von 2,27 auf 2,11 (also um 7 %) zurückgegangen.<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
2013<br />
2015<br />
2017<br />
2019<br />
2021<br />
2023<br />
2025<br />
Einpersonenhaushalte Mehrpersonenhaushalte<br />
Grafik 2: Haushaltszahlen 1991–2025 (in Tausend), Struktur<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen<br />
12<br />
<strong>Die</strong> Zahl stammt vom Statistischen Bundesamt aus der "Langen Reihe" 5.1 „Privathaushalte <strong>nach</strong><br />
Haushaltsgröße und Gebietsstand“. Sie unterscheidet sich von der Bevölkerungsstatistik des Statistischen<br />
Bundesamts, die die Bevölkerungszahl für 2005 etwas niedriger ausweist und auch das Bevölkerungswachstum<br />
mit 2,7 % im selben Zeitraum geringer schätzt.<br />
13<br />
Für diesen Zeitraum liegt eine ungebrochene Reihe für das gesamte heutige Bundesgebiet vor.
28 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
1991<br />
1993<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
2013<br />
2015<br />
2017<br />
2019<br />
2021<br />
2023<br />
2025<br />
Zweipersonenhaushalte Dreipersonenhaushalte<br />
Vierpersonenhaushalte Fünf- und mehr-Personenhaushalte<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen<br />
Grafik 3: Struktur der Mehrpersonenhaushalte 1991–2025 (in Tausend)<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung der Haushaltszahlen bis 2025 hat das Statistische Bundesamt in einer kürzlich<br />
erschienenen Studie vorausberechnet. 14 Der Variante 15 „Trend“ gemäß steigen die<br />
Haushaltszahlen noch bis 2021 an. In jenem Jahr wird es 40,5 Mio. Haushalte geben, also<br />
rund 2,4 % mehr als heute; da<strong>nach</strong> setzen sich die sinkenden Bevölkerungszahlen auch bei<br />
den Haushaltszahlen durch. Allerdings kommt die Steigerung der Zahl der Haushalte bereits<br />
ab 2015 mit jährlichen Zuwachsraten von unter 0,1 % praktisch zum Erliegen. Ungebrochen<br />
ist der Wachstumstrend bei den Ein- und Zweipersonenhaushalten; die Zahl der letzteren<br />
wächst sogar noch etwas schneller. <strong>Die</strong> Zahl aller größeren Haushalte sinkt kräftig.<br />
Der Rückgang der Zahl der Haushalte setzt in Ostdeutschland schon früh (2010) ein, in<br />
Westdeutschland dagegen steigt sie ungebrochen auch am Ende des Prognosezeitraums. 16<br />
Insgesamt wird es zu einem weiteren Rückgang der Zahl der Haushaltsmitglieder je Haus-<br />
14 Statistisches Bundesamt (2007b). <strong>Die</strong> folgenden Zahlen beruhen auf der „Variante Trend“.<br />
15<br />
In der Studie werden zwei Varianten unterschieden: <strong>Die</strong> „Status-Quo“-Variante und die „Trend“-<br />
Variante. In der ersteren ergeben sich Veränderungen der Haushaltsstrukturen und -zahlen ausschließlich<br />
aus der Bevölkerungsentwicklung; in der letzteren wird die Entwicklung der Haushaltsstrukturen<br />
zusätzlich aus der Entwicklung der Vergangenheit (wie sie im Mikrozensus erfasst sind) extrapoliert.<br />
Vgl. Statistisches Bundesamt (2007b).<br />
16<br />
<strong>Die</strong> Ergebnisse sind mit einiger Vorsicht zu genießen. Das Statistische Bundesamt weist selbst<br />
darauf hin, dass die Vorausberechnung mit großen Unsicherheiten behaftet ist, da die Haushaltsentwicklung<br />
mehr noch als die Entwicklung der Bevölkerung einer Vielzahl komplexer, sich gegenseitig<br />
beeinflussender demografischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wirkungen unterliegt.
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 29<br />
halt kommen: Bis 2025 werden in einem durchschnittlichen Haushalt nur 1,95 Personen leben.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Haushalte ist – vermittelt durch die Haushaltsgröße – eng mit der Bevölkerungsentwicklung<br />
verbunden. Auf die Haushaltsgröße wirken einerseits demografische Faktoren,<br />
andererseits gesellschaftlich-kulturelle. So führen rückläufige Geburtenhäufigkeit und<br />
die Zunahme der Lebenserwartung zum Rückgang der durchschnittlichen Haushaltsgröße.<br />
Wie verändertes Heiratsverhalten und gewandelte Familiengründungsprozesse die Haushaltsgröße<br />
beeinflussen, ist weniger eindeutig. Zwar verringern weniger Eheschließungen<br />
und eine Zunahme von Scheidungen die Haushaltsgröße tendenziell. Dem steht jedoch die<br />
kompensierende Wirkung der Zunahme <strong>nicht</strong>ehelicher Partnerschaften gegenüber.<br />
Lebten in den 1960er Jahren noch rund 70 % der erwachsenen Männer und etwas über<br />
60 % der erwachsenen Frauen in einer Ehe, so nahmen diese Quoten bis Ende der 1980er<br />
Jahre auf 60 % bzw. 55 % ab. Gleichzeitig nahm aber der Anteil der Männer und Frauen, die<br />
in <strong>nicht</strong>ehelicher Gemeinschaft leben, auf rund 7 % (2004) zu. 17<br />
<strong>Die</strong>se Entwicklung ist allerdings <strong>nicht</strong> gleichmäßig über die Altersstufen gestreut. Lebten in<br />
den 60er Jahren noch rund 40 % der 16- bis 30-jährigen Männer in (ehelicher) Gemeinschaft,<br />
so betrug der kumulierte Anteil der in (ehelicher und <strong>nicht</strong>ehelicher) Gemeinschaft<br />
lebenden Männer derselben Altersstufe 2004 nur noch 20 %. Dagegen ist der Anteil der in<br />
einer Partnerschaft lebenden über 45-jährigen Frauen stark angestiegen. Bei den Männern<br />
dieser Altersstufe hat sich wenig verändert.<br />
Aus diesem Befund lässt sich folgern, dass nur die jüngeren Jahrgänge verstärkt ohne Partner<br />
im Haushalt leben. Vor allem als Folge verlängerter Ausbildungszeiten und beruflicher<br />
Unsicherheiten, so vermuten die Autoren der Studie, gehen die Menschen erst in höherem<br />
Alter verbindliche Partnerschaften ein. <strong>Die</strong> Lebenszeit, die die Menschen in Partnerschaft<br />
verbringen, hat sich jedoch insgesamt nur unwesentlich verändert.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Haushalte hat direkte Auswirkungen auf die Zahl der Wohnungen. Davon zu<br />
unterscheiden ist die Wohnfläche, die einem Haushalt zur Verfügung steht. Bei Haushaltsverkleinerungen<br />
(Auszug der Kinder aus der elterlichen Wohnung, Scheidungen, Trennungen<br />
oder Tod eines Haushaltsmitglieds) kommt es oft <strong>nicht</strong> zu einer Anpassung der Wohnfläche,<br />
sondern die dem vormals größeren Haushalt zur Verfügung stehende Fläche wird<br />
nun auf die verbleibenden Haushaltsmitglieder aufgeteilt. Grund dafür ist die mangelnde Mo-<br />
17<br />
Lengerer und Klein (2007), S. 438. In den 60er-Jahren gab es praktisch keine <strong>nicht</strong>ehelichen Lebensgemeinschaften.
30 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
bilität der verbleibenden Haushaltsmitglieder, die ihrerseits durch die mangelnde Homogenität<br />
des Gutes Wohnung, hohe Transaktionskosten beim Wohnungswechsel, (Miet)Preissteigerungen<br />
bei infrage kommenden alternativen Wohnungen (Mieten werden gewöhnlich<br />
bei Neubezug erhöht) und auch soziale Bindungen im Stadtviertel etc. bedingt ist („Rema-<br />
nenzeffekt“). 18<br />
So lange die Zahl der Haushalte noch steigt, wird auch die <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> Wohnungen weiter<br />
zunehmen. Erst wenn auch die absolute Zahl der Haushalte sinkt, kann es zu einem<br />
Rückgang der <strong>Nachfrage</strong> auf dem Wohnungsmarkt kommen. Bis 2021 wird die Zahl der<br />
Haushalte aber noch um rund eine Mio. zunehmen, d. h. aber auch, dass bis zu diesem Jahr<br />
noch ein Bedarf an einer entsprechend großen Zahl zusätzlicher Wohnungen entstehen wird.<br />
Allerdings wird diese zusätzliche <strong>Nachfrage</strong> vor allem in Wachstumsregionen auftreten.<br />
3. Einfluss von Wanderungsbewegungen.<br />
Bevölkerungs- und Haushaltszahlen verändern sich <strong>nicht</strong> nur durch Geburt, Tod und Lebenserwartung.<br />
Je kleiner der betrachtete Raum, desto stärker ist der Einfluss der Wanderungsbewegungen<br />
auf die Zahl der Einwohner und der Haushalte. Dabei geht es <strong>nicht</strong> nur<br />
um die transnationale Migration, sondern vor allem auch um die Binnenwanderung.<br />
Da vor allem jüngere Menschen mobil sind, gehen von der grenzüberschreitenden Wanderung<br />
im Allgemeinen verjüngende Effekte auf die Bevölkerung aus, sofern der Wanderungssaldo<br />
positiv ist. Allerdings ist die Wirkung in Deutschland gering, da der Wanderungsgewinn<br />
Deutschlands in den letzten Jahren stark geschrumpft ist.<br />
Anders als eine Geburt wirkt die Migration sofort und unmittelbar erhöhend auf die Wohnungs<strong>nach</strong>frage.<br />
<strong>Die</strong> Mehrzahl der Migranten – jedenfalls alle, die <strong>nicht</strong> schon bei der Einwanderung<br />
über feste Arbeitsverhältnisse verfügen – dürfte zunächst mit relativ einfachen<br />
Wohnverhältnissen zufrieden sein und erst <strong>nach</strong> und <strong>nach</strong>, wenn sie ein stabiles Einkommen<br />
erzielen, ihre Wohnansprüche <strong>nach</strong> oben anpassen.<br />
Eine enge Beziehung zwischen der Veränderungsrate der Bevölkerung (und hier insbesondere<br />
dem Wanderungssaldo) und der Zahl der Fertigstellungen ist vom Eduard Pestel Institut<br />
festgestellt worden. 19 Erklärt wird der starke Zusammenhang zwischen Wanderungssaldo<br />
und Wohnungsbau damit, dass die meist erwachsenen Zuwanderer sofort <strong>Nachfrage</strong>relevanz<br />
entwickeln, während der Teil des Bevölkerungszuwachses, der sich durch einen Gebur-<br />
18<br />
Kühne-Büning und Heuer (2005), S. 140ff. Übrigens ist bei Haushaltsvergrößerungen häufig zumindest<br />
temporär das umgekehrte Phänomen zu beobachten: <strong>Die</strong> Wohnfläche pro Haushaltsmitglied geht<br />
dabei im Durchschnitt zurück.<br />
19<br />
Möller und Günther (2001), S. 16f.
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 31<br />
tenüberschuss ergibt, <strong>nicht</strong> sofort <strong>nach</strong>fragewirksam wird. Analog kann geschlossen werden,<br />
dass ein Geburtendefizit die <strong>Nachfrage</strong> erst langfristig sinken lässt.<br />
Während die grenzüberschreitende Migration per Saldo inzwischen sehr gering ist und kaum<br />
noch ins Gewicht fällt, ist die Binnenwanderung für Städte und Regionen von sehr viel größerer<br />
Bedeutung. Auf deren Ebene dürfte sie alle anderen demografischen Einflüsse dominieren.<br />
20 Einen starken Einfluss auf die Binnenwanderung übt die Wachstumskraft einer Region<br />
aus; wachstumsstarke Städte und Regionen verzeichnen eher positive Wanderungssalden,<br />
während ökonomisch schwache Regionen eher Wanderungsverluste verzeichnen<br />
(s. Grafik 4).<br />
Es muss betont werden, dass kleinräumige Prognosen mit großer Vorsicht zu betrachten<br />
sind. Während die Güte demografischer Prognosen für die Bundesrepublik als recht groß<br />
eingeschätzt werden kann, ist bei kleinräumigen Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten<br />
zu rechnen. 21 Nicht nur, dass verschiedene Institute zu verschiedenen Ergebnissen kommen,<br />
auch ein und dasselbe Institut kann innerhalb weniger Jahre seine Prognose vollkommen<br />
revidieren. Bei dieser Feststellung geht es <strong>nicht</strong> darum, den Wert solcher Prognosen in<br />
Abrede zu stellen. Aber es muss festgestellt werden, dass das große Vertrauen, das Bevölkerungsprognosen<br />
(und daraus abgeleitet Haushalts- und Wohnungsprognosen) für die gesamte<br />
Bundesrepublik zu Recht genießen, für Prognosen mit Bezug auf kleine Räume <strong>nicht</strong><br />
ganz gerechtfertigt ist. Ob der von Deutsche Bank Research gewählte Weg, den Mittelwert<br />
aus vier verschiedenen Prognosen für die Bevölkerungsprognose auf Stadt- und Kreisebene<br />
zu wählen, tragfähig ist, kann derzeit noch <strong>nicht</strong> gesagt werden.<br />
20<br />
„Je kleiner die räumliche Einheit ist, desto höher ist der Beitrag der Binnenwanderung zur Bevölkerungsdynamik.“<br />
(Raumordnungsbericht 2005, S. 74).<br />
21<br />
Vgl. dazu z. B. Just (2007), S. 9f.
32 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
Quelle: BBR (2006)<br />
Grafik 4: Veränderung der Bevölkerungszahl (2002 bis 2020, Kreise und kreisfreie Städte)
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 33<br />
4. Einflussfaktor Altersstruktur.<br />
Zu den derzeit wichtigen demografischen Tendenzen gehört auch die Alterung der Bevölkerung,<br />
die selbst wiederum auf zwei Trends fußt: Zum einen wird die Gesellschaft im Durchschnitt<br />
(auch bei konstanter Lebenserwartung) älter, weil es aufgrund der geringen Geburtenrate<br />
immer weniger junge Menschen gibt. Zum anderen altert die Bevölkerung, weil die<br />
Lebenserwartung der Menschen steigt. 22<br />
Wird die bevölkerungserhaltende Fertilitätsrate der Frauen, die bei etwas über zwei Kindern<br />
pro Frau liegt, in einer Gesellschaft anhaltend unterschritten, so kommt es gleichzeitig sowohl<br />
zur Schrumpfung als auch zur Alterung der Bevölkerung. Bei konstanter subreproduktiver<br />
Fertilitätsrate – in Deutschland seit geraumer Zeit ca. 1,3 bis 1,4 Kinder pro Frau 23 – sinkt<br />
die Bevölkerungszahl zwar unaufhaltsam weiter, die Altersstruktur der Bevölkerung strebt<br />
jedoch zu einem neuen Gleichgewicht, sodass sie sich <strong>nach</strong> einer Übergangszeit, in der das<br />
Durchschnittsalter zunimmt, <strong>nicht</strong> weiter ändert. 24<br />
Nach der Variante „mittlere Bevölkerung, Untergrenze“ (s. S. 25) der Bevölkerungsvorausberechnung<br />
des Statistischen Bundesamtes steigt das Durchschnittsalter in der Bundesrepublik,<br />
das 1990 39 Jahre betrug, bis 2050 auf ca. 50 Jahre. Der Anteil der Personen im Erwerbsalter<br />
wird in dieser Variante von 61 % (2005) auf 55 % (2030) und 52 % (2050) sinken.<br />
Stark ansteigen wird der Anteil der Alten (von derzeit 19 % auf 33 %). Der Anteil der Jungen<br />
geht aber <strong>nicht</strong> spiegelbildlich zurück: Von derzeit 20 % sinkt er bis 2030 auf 16 %. Dann ist<br />
der oben erwähnte Zug zu einem neuen Gleichgewicht bereits fast erreicht: Der Anteil der<br />
Jungen sinkt in den folgenden 20 Jahren bis 2050 nur noch um einen Prozentpunkt auf<br />
15 %. 25<br />
Mit steigender Lebenserwartung verschiebt sich die Alterstruktur auch bei ausreichend hoher<br />
Geburtenrate zu Gunsten der Alten. Geht man davon aus, dass die Lebenserwartung der<br />
Menschen <strong>nicht</strong> mehr stark steigen wird (das Statistische Bundesamt rechnet mit einer Zu-<br />
22<br />
Auf die Bevölkerungszahl haben beide Trends entgegengesetzte Effekte: Im ersten Fall altert die<br />
Bevölkerung bei schrumpfender Bevölkerungszahl, im anderen Fall altert sie bei steigender Bevölkerungszahl.<br />
23<br />
Im Jahr 2006 lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 1,33. (Statistisches Bundesamt,<br />
Pressemitteilung Nr. 366 vom 27.8.2007).<br />
24<br />
<strong>Die</strong>s gilt, wenn man von zwei weiteren Faktoren absieht, die den Altersaufbau der Bevölkerung<br />
ebenfalls bestimmen: <strong>Die</strong>s sind die Lebenserwartung und die Altersstruktur der Migranten. <strong>Die</strong>se beiden<br />
Faktoren modifizieren das erste Ergebnis jedoch <strong>nicht</strong> grundlegend, da ihre Wirkung beschränkt<br />
ist.<br />
25<br />
Das Statistische Bundesamt hat keine Prognose für die Zeit <strong>nach</strong> 2050 veröffentlicht. <strong>Die</strong> Anpassung<br />
der Altersstruktur dürfte sich bei konstant niedriger Geburtenrate noch eine Weile fortsetzen,<br />
dann jedoch zum Stillstand kommen. (<strong>Die</strong> Schrumpfung der Bevölkerung geht dagegen ohne Kompensation<br />
z. B. durch Immigration weiter.)
34 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
nahme von ca. sieben Jahren bis 2050), dann ist dieser Effekt auf die Altersstruktur der Bevölkerung<br />
eher gering.<br />
<strong>Die</strong> Zunahme der Lebenserwartung und vor allem aber die bessere Gesundheit im Alter führen<br />
tendenziell zu einer höheren <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> Wohnungen. Zum einen führen gesunde<br />
alte Menschen länger einen eigenen (Ein- oder Zweipersonen-) Haushalt und ziehen erst im<br />
höheren Lebensalter in ein Heim.<br />
Eine alternde Gesellschaft benötigt auch deshalb mehr Wohnungen (bzw. Wohnfläche 26 ),<br />
weil ältere Menschen häufig in ihren großen Wohnungen bleiben, auch wenn <strong>nach</strong> dem Auszug<br />
der Kinder eine kleinere Wohnung ausreichen würde (Remanenzeffekt). Gründe dafür<br />
können die hohen Transaktionskosten des Wohnungswechsels, die Informationskosten in<br />
einem unbekannten Stadtteil, die Verankerung in der Nachbarschaft und generell die Gewöhnung<br />
an eine vertraute Umgebung sein. Bedingung ist, dass das Haushaltsbudget es<br />
erlaubt, die bisherige Wohnung zu behalten.<br />
Zudem richten sich die Wohnbedürfnisse alter Menschen auf andere Wohnungen als in früheren<br />
Lebensphasen. Unter dem Stichwort „altersgerechtes Wohnen“ wird vor allem verstanden,<br />
dass in den Wohnungen keine Barrieren existieren, die die wohnungsinterne Mobilität<br />
einschränken. Dazu kann die Abwesenheit von Treppen, das Vorhandensein von Aufzügen,<br />
das Fehlen von Türschwellen usw. gehören. Viele Wohngebäude sind auf diese Anforderungen<br />
<strong>nicht</strong> ausgerichtet und müssen für die alternde Gesellschaft angepasst werden.<br />
Nach einer Untersuchung des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen<br />
27 beträgt der Anteil altersgerechter Wohnungen in Deutschland nur 1 %, das wären<br />
rund 400.000 Wohnungen. <strong>Die</strong> Studie rechnet mit einem Bedarf von zusätzlichen 800.000<br />
Wohnungen bis zum Jahr 2020. <strong>Die</strong>se Wohnungen müssen entweder aus dem Bestand gewonnen<br />
werden, indem bestehende Wohnungen altersgerecht angepasst werden, oder sie<br />
müssen neu gebaut werden. Bei periodisch fälligen Grundsanierungen ist es oft möglich, die<br />
notwendigen Umbauten vorzunehmen. Jedoch eignen sich <strong>nicht</strong> alle Bestandsimmobilien für<br />
einen altergerechten Umbau.<br />
Wichtig für alte Menschen sind aber auch Qualitäten, die das Wohnumfeld bieten soll. Dazu<br />
gehören nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Einrichtungen, ein altersspezifisches<br />
Angebot von pflegerischen <strong>Die</strong>nstleistungen und Ähnliches.<br />
26<br />
Ein Anstieg der benötigten Wohnfläche kann wegen Unteilbarkeiten im Allgemeinen nur durch einen<br />
Anstieg des Wohnungsangebotes realisiert werden. <strong>Die</strong> Wohnfläche ist in Deutschland von 1999 bis<br />
2006 etwas stärker (6,9 %) als die Zahl der Wohnungen (4,7 %) gestiegen.<br />
27<br />
Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (2007).
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 35<br />
5. Einflussfaktor Wohnpräferenzen und Lebensstile.<br />
Darüber hinaus werden auch von alten Menschen neue Wohnformen ausprobiert (Haus- und<br />
Wohngemeinschaften, andere Formen gemeinschaftlichen Lebens) und <strong>nach</strong>gefragt. <strong>Die</strong>se<br />
Wohnformen hatten bislang keine oder nur geringe <strong>Nachfrage</strong>relevanz, da sie nur von wenigen<br />
Menschen angestrebt wurden.<br />
Nicht nur die Wohnpräferenzen und Lebensstile der alten Menschen ändern sich, auch die<br />
junge Generation und Menschen mittleren Alters leben heute anders als frühere Generationen.<br />
Augenfällig ist der Trend zur Singularisierung: Singlehaushalte machen in den Großstädten<br />
fast die Hälfte aller Haushalte aus, Mehrpersonenhaushalte sind auf dem Rückzug.<br />
Betrug ihr Anteil 1991 noch 66,4 %, so ist er 15 Jahre später auf 62,5 % zurückgegangen (s.<br />
Tabelle 1 auf S. 25). Auch die Struktur der Mehrpersonenhaushalte verändert sich zu Gunsten<br />
der Zweipersonenhaushalte. An den Mehrpersonenhaushalten hatten letztere 1991 noch<br />
einen Anteil von weniger als der Hälfte (46,4 %), 2005 war ihr Anteil schon kräftig geklettert<br />
(54,2 %). Single- und Zweipersonenhaushalte fragen <strong>nicht</strong> mehr die Normwohnungen der<br />
Vergangenheit <strong>nach</strong> (Wohnzimmer, Schlafzimmer, zwei kleinere Kinderzimmer), die auf die<br />
damalige Normalfamilie zugeschnitten waren. 28<br />
Mit zunehmender Verbreitung von Lebensstilen, die bisher nur Minderheiten vorbehalten<br />
waren, kann sich eine Umschichtung in der Wohnungs<strong>nach</strong>frage hin zu Wohnungen ergeben,<br />
die auf diese Lebensstile zugeschnitten sind. Allerdings ist es <strong>nicht</strong> so, dass an die Stelle<br />
des mehr oder weniger allgemeinverbindlichen, dominanten Lebensstils nun ein anderer<br />
tritt. Der Ausdifferenzierung der Lebensstile entspricht die Ausdifferenzierung der Wohnbedürfnisse,<br />
die zu einer Segmentierung der <strong>Nachfrage</strong> führt.<br />
Daher werden für die Standardfamilie zugeschnittene Wohnungen seltener, für die Bedürfnisse<br />
unterschiedlicher Lebensalter und -abschnitte zugeschnittene Wohnungen häufiger<br />
<strong>nach</strong>gefragt werden. Zum Beispiel werden für Wohngemeinschaften und kinderlose Lebenspartnerschaften<br />
geeignete Wohnungen oder Wohnungen in Häusern, die für Hausgemeinschaften<br />
geeignet sind, stärker <strong>nach</strong>gefragt werden.<br />
In Anbetracht eines Wohnungsangebotes, das noch stark auf die herkömmlichen Wohnbedürfnisse<br />
zugeschnitten ist und die Pluralität der Lebensformen erst ansatzweise widerspiegelt<br />
und ermöglicht, und in Ermangelung einer ausreichenden Zahl von altengerechten Wohnungen<br />
ist davon auszugehen, dass die <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> adäquaten Wohnungen vielfach nur<br />
28 Bereits Mitte der 90er-Jahre entsprachen nur noch 8 % der Haushalte dem Typ der Standardfamilie<br />
mit zwei Kindern unter 18 Jahren. „<strong>Die</strong> Normalfamilie wird statistisch zur Ausnahme.“ S. Kühne-<br />
Büning (2005), S. 145.
36 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
durch den (grundlegenden) Umbau von Bestandswohnungen oder sogar nur durch kompletten<br />
Neubau befriedigt werden kann. Letzteres kann auch dann notwendig werden, wenn ein<br />
Umbau teurer ist als ein Neubau.<br />
Vor allem die Anpassung von Bestandswohnungen an die Wohnbedürfnisse alter Menschen<br />
wird <strong>nicht</strong> immer möglich sein. So kann <strong>nicht</strong> in jedes bestehende Haus ein Aufzug eingebaut<br />
werden, sodass ein <strong>barrierefrei</strong>er Zugang zur Wohnung möglich ist. Im Bereich altersgerechten<br />
Wohnens ist der größte Neubaubedarf zu vermuten.<br />
Relativ einfach dagegen ist der Bedarf von Singlehaushalten zu befriedigen. Viele Wohnungen<br />
sind bereits so verkleinert worden, dass sie für allein lebende Menschen geeignet sind.<br />
Im Segment der kinderlosen Paare und der allein erziehenden Mütter und Väter ist ebenfalls<br />
noch ein gewisser Nachholbedarf vorhanden. Allerdings können bestehende Wohnungen<br />
stärker an die Bedürfnisse dieser Gruppen angepasst werden.<br />
Insgesamt werden die veränderten Wohnbedürfnisse die <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> auf die Normalfamilie<br />
zugeschnittenen Wohnungen am stärksten schrumpfen lassen. Auf die Bedürfnisse<br />
anderer Gruppen zugeschnittene Wohnungen werden expandieren. Für das Wohnungsangebot<br />
der Zukunft bedeutet dies, dass ein Teil des Bestandes obsolet wird und die Preise<br />
dieser Wohnungen tendenziell sinken werden. Zudem werden Bestandsumschichtungen und<br />
-umwidmungen in Zukunft eine größere Rolle spielen als in der Vergangenheit.<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen der veränderten Lebensstile auf den Wohnungsmarkt werden auch regionale<br />
Wirkungen entfalten: Da neue Lebensstile eher in Städten als auf dem Land anzutreffen<br />
sind, wird die Veränderung die stärksten Auswirkungen auf städtische Wohnungsmärkte haben.<br />
<strong>Die</strong>s umso mehr, als viele junge Familien mit einem Einkommen, das für den Erwerb von<br />
Wohneigentum ausreicht, <strong>nach</strong> wie vor den Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines<br />
Einfamilienhauses außerhalb der Städte präferieren. Das ist häufig auch eine Kostenfrage,<br />
da Baugrund außerhalb der Städte günstiger ist.<br />
Es ist <strong>nicht</strong> davon auszugehen, dass sich dieser Trend bald umkehrt. Für eine Trendumkehr<br />
bedarf es einer Reihe von Voraussetzungen, die derzeit erst in Ansätzen zu erkennen sind:<br />
Dazu gehören unter anderem ein familienfreundliches Wohnumfeld und familiengerechte<br />
Wohnungen in den Städten. Eine familiengerechte Infrastruktur (Kindergärten, Spielplätze,<br />
gepflegte Grünflächen) gehören ebenso dazu.
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 37<br />
6. Einkommen.<br />
Höhe und Verteilung der Einkommen gehören zu den weiteren Einflussfaktoren, die auf die<br />
Wohnungs<strong>nach</strong>frage einwirken. Generell haben Bezieher höherer Einkommen höhere<br />
Wohnansprüche – dies bezieht sich sowohl auf die Fläche als auch auf die Ausstattung der<br />
Wohnung.<br />
Bei der Betrachtung im Zeitablauf stellt sich heraus: Bislang waren die Bundesbürger stets<br />
bereit, einen überproportionalen Anteil ihres Einkommenszuwachses für Wohnungen aufzuwenden.<br />
<strong>Die</strong> hohe Einkommenselastizität der Wohnungs<strong>nach</strong>frage lässt darauf schließen,<br />
dass auch zukünftige Realeinkommenssteigerungen zu einer überproportionalen Mehr<strong>nach</strong>frage<br />
<strong>nach</strong> besseren und größeren Wohnungen führen werden.<br />
Nicht nur das Individualeinkommen, sondern auch das gesamtwirtschaftliche Einkommen<br />
wirkt auf die Wohnungs<strong>nach</strong>frage. Einkommen entsteht, wo Arbeitsplätze angeboten werden.<br />
Regionale Wachstumszentren verzeichnen <strong>nicht</strong> nur einen Bevölkerungszuzug und<br />
damit einen steigenden Wohnungsbedarf; hier werden zugleich auch die Einkommen erwirtschaftet,<br />
die auf dem Wohnungsmarkt <strong>nach</strong>fragewirksam werden. In Wachstumszentren<br />
kann daher auch in der Zukunft mit steigender Wohnungs<strong>nach</strong>frage gerechnet werden. Zudem<br />
ist in Wachstumszentren auch das Einkommensniveau höher als in stagnierenden oder<br />
schrumpfenden Regionen, sodass auch davon ein zusätzlicher Impuls auf die Wohnungs<strong>nach</strong>frage<br />
ausgeht.<br />
7. Weitere Einflussfaktoren.<br />
Da das Zinsniveau die Kapitalkosten determiniert und diese wegen der langen Kapitalbindung<br />
stark die Gesamtkosten des Wohnungsbaus beeinflussen, könnte vermutet werden,<br />
dass in Hochzinsphasen weniger Wohnungen fertig gestellt werden, und umgekehrt.<br />
Das Eduard Pestel Institut für Systemforschung konnte einen solchen Zusammenhang allerdings<br />
<strong>nicht</strong> finden. 29 Eine empirische Untersuchung der Wohnungsmarktzyklen ergab, dass<br />
zwischen dem nominalen Hypothekenzinsniveau und der Zahl der Wohnungsfertigstellungen<br />
kein signifikanter Zusammenhang besteht. Da die Untersuchung nur den Nominalzins als<br />
Einflussfaktor berücksichtigt, bleibt offen, ob eventuell ein Zusammenhang zum Realzins<br />
besteht. Der Befund wird allerdings durch die anekdotische Evidenz eines Praktikers unterstützt,<br />
der berichtet, dass sich die besten Verkaufszahlen in Zeiten steigender Zinsen erzielen<br />
ließen. 30 Trifft dies zu, so üben eher Zinserwartungen einen Einfluss auf die Wohnungs-<br />
29 Möller und Günther (2001), S. 16f.<br />
30 Martini (2005), S. 239.
38 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
<strong>nach</strong>frage aus. Erwarten die potenziellen Wohnungskäufer eine Zinssteigerung, so werden<br />
sie geplante Käufe oder Bauvorhaben vorziehen; umgekehrt werden sie Käufe eher hinausschieben,<br />
wenn sie sinkende Zinsen erwarten.<br />
8. Fazit.<br />
<strong>Die</strong> Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bis 2050 lässt sich mit zwei Worten beschreiben:<br />
Schrumpfung und Alterung. Das anhaltende Geburtendefizit wird <strong>nicht</strong> durch Einwanderung<br />
ausgeglichen, sodass <strong>nach</strong> der jüngsten Bevölkerungsprognose für das Jahr 2050 eine<br />
Bevölkerungszahl zwischen 69 und 74 Mio. Einwohnern erwartet wird. Als Folge des Bevölkerungsrückgangs<br />
ist ein Sinken der Wohnungs<strong>nach</strong>frage zu erwarten; jedoch wird dieser<br />
Trend gemildert bzw. vorerst noch durch eine Reihe von Effekten kompensiert: <strong>Die</strong> Verringerung<br />
der Haushaltsgröße, die noch bis 2020 die Zahl der Haushalte zunehmen lässt, die weiter<br />
steigende Lebenserwartung, und die (wenn auch zahlenmäßig kaum noch ins Gewicht<br />
fallende) Zuwanderung. In einzelnen Regionen wird der Zuwachs der Zahl der Haushalte in<br />
Folge der Binnenwanderung noch länger anhalten, etwa in Wachstumsregionen mit hohen<br />
Einkommen, jedoch wird sich schließlich überall die Haupttendenz der Schrumpfung der Bevölkerung<br />
durchsetzen.<br />
Während sich die Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung vor allem auf die Zahl der <strong>nach</strong>gefragten<br />
Wohnungen auswirkt, wirkt die Altersstruktur zusätzlich auf die Art der <strong>nach</strong>gefragten<br />
Wohnungen. <strong>Die</strong> zunehmende Zahl alter gesunder Menschen, die selbstständig leben,<br />
erhöht den Bedarf an verhältnismäßig kleinen Wohnungen. <strong>Die</strong> hohen Transaktionskosten<br />
und die Belastungen eines Umzugs, aber auch die Gewöhnung an Stadtteil und Nachbarschaft<br />
wirken dem jedoch entgegen. Dennoch verlangt die Alterung der Gesellschaft <strong>nach</strong><br />
altersgerechten Wohnungen. <strong>Die</strong>s erfordert in der Zukunft den Umbau und wo nötig auch<br />
weiterhin den Neubau von Wohnungen. Ähnlich wirken auch veränderte Lebensstile bzw.<br />
ihre Pluralisierung.<br />
Ebenfalls verlangen neue und veränderte Lebensstile in der Gesellschaft <strong>nach</strong> Wohnungen,<br />
die <strong>nach</strong> Zuschnitt, Qualität und Ausstattung sich von den überwiegend auf die bisherige<br />
Normalfamilie hin konzipierten Wohnungen unterscheiden. Auch von dieser gesellschaftlichen<br />
Tendenz gehen Anstöße aus, bestehende Wohnungen an die jeweiligen Wohnbedürfnisse<br />
anzupassen oder neue Wohnungen zu bauen.<br />
Im Zeitverlauf führen Einkommenssteigerungen bei einkommenselastischer <strong>Nachfrage</strong> zu<br />
überproportionalen <strong>Nachfrage</strong>zuwächsen. Ansonsten sind ökonomische Faktoren vor allem<br />
von Interesse für die kurzfristige <strong>Nachfrage</strong>entwicklung. <strong>Die</strong>se richtet sich eher auf Bestände:<br />
Einkommenssteigerungen führen zu erhöhter <strong>Nachfrage</strong> und (kurzfristig) steigenden Preisen.
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 39<br />
Zudem üben regionale Einkommensentwicklungen einen starken Einfluss auf die Binnenmigration<br />
aus, sodass in Wachstumszentren eine ungebrochene Zunahme der Wohnungs<strong>nach</strong>frage<br />
zu erwarten ist. Weitere Faktoren wie die Kreditzinsen scheinen keinen signifikanten<br />
Einfluss auf die <strong>Nachfrage</strong> auszuüben.<br />
Autor: Dr. Dankwart Plattner (069) 7431-3788
40 Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 40<br />
Literatur.<br />
BBR (2006), Raumordnungsprognose 2020/2050, CD-ROM, Bonn.<br />
Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (2007), Wohnen im Alter:<br />
Eine Zukunftsaufgabe der europäischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Berlin<br />
Eisenmenger, Matthias, Olga Pötzsch, Bettina Sommer (2006), Bevölkerung Deutschlands<br />
bis 2050 – 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statistisches Bundesamt,<br />
Wiesbaden 2006<br />
Just, Tobias (2007), <strong>Nachfrage</strong>trends für die Wohnungsmärkte, in: Wohnungsfinanzierung in<br />
Deutschland: vier Trends, S. 3 – 13 (Deutsche Bank Research, Aktuelle Themen<br />
398)<br />
Kühne-Bühning, Lidwina, Jürgen H. B. Heuer (Hrsg.) (2005), Grundlagen der Wohnungsund<br />
Immobilienwirtschaft, Frankfurt am Main 4 2005.<br />
Lengerer, Andrea, Thomas Klein (2007), Der langfristige Wandel partnerschaftlicher Lebensformen<br />
im Spiegel des Mikrozensus, in: Wirtschaft und Statistik Nr. 4, S. 433 – 447<br />
Martini, Clausjürgen (2005), Immobilienmarketing, in: Schmoll gen. Eisenwerth, Fritz (Hrsg.),<br />
Basiswissen Immobilienwirtschaft, Berlin-Reinickendorf, S. 189-293<br />
Möller, Klaus Peter, Matthias Günther (2001), <strong>Die</strong> Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes<br />
bis zum Jahr 2010. Vo Anbieter- zum Käufermarkt. <strong>Nachfrage</strong>stabilisierung<br />
in Sicht. Hrsg. von der DSL-Bank, Bonn<br />
Raumordnungsbericht 2005, Bundestags-Drucksache 15/5500<br />
Statistisches Bundesamt (2007a), Bevölkerungsstand (am 3.7.2007 gefunden auf<br />
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Stat<br />
istiken/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.psml, Stand:<br />
14.5.2007)<br />
Statistisches Bundesamt (2007b), Entwicklung der Privathaushalte bis 2025, Ergebnisse der<br />
Haushaltsvorausberechnung 2007, Wiesbaden
<strong>Die</strong> <strong>Nachfrage</strong> <strong>nach</strong> <strong>Wohnraum</strong> 41