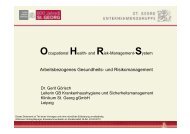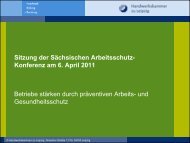pdf,
pdf,
pdf,
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sächsischer Betriebsärztetag 2012<br />
Medizinisch-berufsorientierte Rehabilitation als effizienter Wege zur Reintegration am<br />
Arbeitsplatz - Beispiel Klinik Bavaria (Abb. 1)<br />
Das Thema „Rückkehr in den Beruf bei und nach gesundheitlichen Problemen“ wird zunehmend<br />
häufiger von politischer Seite und von den Sozialversicherungsträgern diskutiert. Damit<br />
rücken die Arbeits-, Sozial- und Rehabilitationsmedizin ins Blickfeld. Was ich Ihnen unter<br />
dem Titel „Medizinisch-berufsorientierte Rehabilitation“ oder „MBO®“ vorstellen will, ist<br />
ein multiprofessioneller Ansatz der Klinik Bavaria, der nach einem Unfall oder einer Erkrankung,<br />
mehr als dies bisher möglich war, zur Wiederherstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit<br />
beiträgt, zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und zur erfolgreichen beruflichen Wiedereingliederung.<br />
Die Deutsche Rentenversicherung, die Berufsgenossenschaften und etliche Krankenversicherungen<br />
fördern und fordern in zunehmendem Maße solche berufsorientierten Rehabilitationskonzepte.<br />
Das liegt unter anderem daran, dass sowohl die Weltgesundheitsorganisation, die<br />
UN-Behindertenrechtskonvention, vor allem aber unser Gesetzgeber in den SGB VI, VII und<br />
IX, heute die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit bereits in der medizinischen Rehabilitationsphase<br />
gleichwertig neben die gesundheitliche Wiederherstellung stellen (Abb. 2).<br />
Wenn man Unternehmer vor Jahren gefragt hätte, welche Leistungen von Rehabilitationskliniken<br />
für sie von Bedeutung sein könnten, hätte die Antwort gelautet „so wenig wie möglich“,<br />
denn Klinik wird mit Krankheit und Krankheit mit Arbeitsunfähigkeit assoziiert. Heute<br />
ist eine differenziertere Betrachtungsweise angezeigt, denn die Betriebe<br />
- erleben seit Jahren das allmähliche Altern ihrer Belegschaften und dessen gesundheitliche<br />
und berufliche Folgen am Arbeitsplatz<br />
- sie tun sich mit der Gestaltung eines betrieblichen Gesundheits-Managements nicht<br />
leicht<br />
- und sie haben erlebt, wie schwierig es sein kann, den Paragraphen 84 des SGB IX umzusetzen,<br />
da ja bei mehr als 6-wöchiger Arbeitsunfähigkeit vom Unternehmer ein betriebliches<br />
Eingliederungsmanagement verlangt, bei dem der Betroffene, die Arbeitgeber-/Arbeitnehmervertretung,<br />
der Werksarzt, ggf. der Schwerbehindertenvertreter,<br />
die gemeinsame Servicestelle oder der Integrationsfachdienst einbezogen werden sollen<br />
und bei dem Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben zu<br />
berücksichtigen sind.<br />
Zur Regelung solcher Aufgaben fehlt vielen Betrieben, vor allem den kleineren, das entsprechende<br />
Fachpersonal und know how. Hat ein Mitarbeiter gesundheitliche Probleme, wird<br />
der Arbeitgeber zunächst einmal Wert legen auf die bestmögliche und zügige gesundheitliche<br />
Wiederherstellung. Dann steht er vor der Entscheidung (Abb. 3)<br />
- ob und mit welchen Hilfen der Mitarbeiter an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann<br />
- ob eine stufenweise Wiedereingliederung, eine innerbetriebliche Umsetzung oder<br />
Teilzeitbeschäftigung notwendig und möglich ist<br />
- oder ob die Weiterbeschäftigung ausscheidet.<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 1 von 10
Seit Ende der 90er Jahre ist es zu einem zentralen Anliegen unserer Kliniken geworden, die<br />
Betriebe bei diesen heiklen Entscheidungen zu unterstützen und in mehr als 10 Jahren wurde<br />
eine Reihe berufsorientierter Diagnostik-, Schulungs- oder Trainingsmodule entwickelt, die<br />
jetzt zur Stabilisierung der beruflichen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden.<br />
Wie gehen wir bei MBO®-Maßnahmen vor ? (Abb. 4)<br />
- Neben den üblichen medizinischen Aufgaben, wird mit geeigneten Assessment-<br />
Instrumenten festgestellt, über welche arbeitsrelevanten Fähigkeiten der Rehabilitand<br />
aktuell verfügt und welche beruflichen Anforderungen diesen Fähigkeiten gegenüber<br />
stehen.<br />
- Wenn sich dabei Fähigkeitsdefizite (Engpässe) zeigen, wird er mit den Problemen<br />
konfrontiert, die ihn bei der Wiedereingliederung an seinem Arbeitsplatz erwarten.<br />
Dabei wird er durch das MBO®-Team betreut, das auch Fachleute mit berufskundlichen<br />
Vorkenntnissen umfasst.<br />
- Dann werden Kompensationsstrategien gesucht, um die Beeinträchtigungen zu überbrücken<br />
und schließlich wird der Rehabilitand, unter möglichst realitätsnahen Bedingungen,<br />
so weit wie möglich an die Anforderungen seines Arbeitsplatzes herangeführt.<br />
- In besonderen Fällen wird ein individueller Fallbetreuer eingeschaltet<br />
- und wir streben die enge Vernetzung aller Reha-Beteiligten an.<br />
Eine wichtige Funktion kommt dem Fallbetreuer (Abb. 5) zu. Er hat den Auftrag, die Zusammenarbeit<br />
zwischen dem MBO®-Team der Klinik und den externen Akteuren, vom<br />
Rehaträger bis zum Arbeitgeber zu intensivieren. Entscheidend ist, dass er den Arbeitgeber<br />
laufend über die Entwicklung seines erkrankten Mitarbeiters unterrichtet, wenn der einverstanden<br />
ist, dass er mit ihm die erforderlichen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, möglichst<br />
vor Ort im Betrieb durchspricht, und es ihm durch dieses persönliche Betreuungsangebot<br />
erleichtert, das Arbeitsverhältnis, wenigstens fürs Erste, aufrechtzuerhalten.<br />
An den MBO®-Teambesprechungen (Abb. 6) zur Klärung der medizinischen und beruflichen<br />
Fragen, nimmt der klinische Facharzt und der Arbeitsmediziner teil, der Arbeitspsychologe,<br />
der MBO®-Therapeut, der Sozialpädagoge, ggf. der Fallbetreuer und natürlich der Rehabilitand<br />
selbst. Seine Ziele und Vorstellung sollen in besonderer Weise berücksichtigt werden.<br />
Grundlage für alle Entscheidungen dieser MBO®-Teams sind, neben den medizinischen Befunden,<br />
Daten über die berufsrelevanten Fähigkeiten des Rehabilitanden einerseits und über<br />
die Anforderungen an seinem Arbeitsplatz andererseits. Deren Vergleich führen wir mit dem<br />
sog. Bavaria-Rehabilitations-Assessment durch. Es verfügt über Spalten, in die zum einen die<br />
vielfältigen Arbeitsanforderungen eingestuft werden und zum anderen die entsprechenden Fähigkeiten<br />
des Patienten. Fähigkeitsdefizite werden sofort erkennbar und farbig markiert.<br />
Solche Fähigkeitsdefizite sind natürlich Hinweise auf Handlungsbedarf (Abb. 8), z. B. im<br />
Sinne einer Anpassung der Arbeitsbedingungen, im Sinne einer innerbetrieblichen Umsetzung<br />
oder einer beruflichen Neuorientierung, oder auch im Sinne eines weiteren berufsorientierten<br />
Schulungs- und Trainingsbedarfes.<br />
Eben an diesem Punkt kommt das Angebot unserer MBO®-Zentren zum Tragen, in denen die<br />
berufsorientierten Leistungen angeboten werden. Um davon eine Vorstellung zu vermitteln,<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 2 von 10
haben wir in unserem MBO®-Demonstrations-Trailer (Abb. 9) einige MBO®-typische Elemente<br />
(Abb. 10) installiert, die wir zu Informationszwecken gerne vorführen.<br />
Wie sehen die Infrastrukturen und Abläufe (Abb. 11) derzeit aus?<br />
MBO® ist ein lernendes System und noch in der Entwicklung. Derzeit wird, über die übliche<br />
patientenbezogene Diagnostik in der Klinik hinaus, vom Arbeitsmediziner im MBO®-<br />
Zentrum eine Arbeitsplatz- und Tätigkeitsbeschreibung und ein berufsbezogenes Anforderungsprofil<br />
erstellt. Neben der üblichen Betreuung in der Klinik, werden im MBO®-Zentrum<br />
die Grundlagen der Ergonomie vermittelt, das Training der berufsrelevanten motorischen und<br />
psychomotorischen Fähigkeiten durchgeführt und es werden arbeitspsychologische Module<br />
angeboten. Bei Bedarf können Tests zur Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit oder<br />
Belastungserprobungen vorgenommen werden. Diesem breiteren Leistungsspektrum entsprechend<br />
ist auch das Reha-Team erweitert worden um Arbeitsmediziner, Berufspädagogen, Ergonomietrainer<br />
und EFL-Therapeuten, die regelmäßig vom Arbeitswissenschaftler (Prof.<br />
Landau, Gesellschaft für gesund Arbeit) fortgebildet und zertifiziert werden. Schließlich<br />
kommen bei besonderen Projekten klinikeigene Fallbetreuer zum Einsatz.<br />
Zur berufsorientierten motorischen Diagnostik (Abb. 12) zählen<br />
- neben den kardiopulmonalen und den Funktions-Untersuchungen der Wirbelsäule und<br />
der großen Gelenke<br />
- EFL-Tests<br />
- und berufsorientierte Belastungserprobungen.<br />
Die Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (Abb. 13) dient zur Feststellung der<br />
berufsbezogenen körperlichen Fähigkeiten. Sie dauert 2 Tage und umfasst 29 standardisierte<br />
Hebe-, Trage-, Bewegungs-, Haltungstests, die motorische Schlüsselaktivitäten des beruflichen<br />
Alltages abbilden. Im Testablauf werden, unter zunehmender Belastung, die Veränderungen<br />
der muskulären Rekrutierungsmuster beobachtet, die Stabilisierungsfähigkeit des<br />
Rumpfes und der peripheren Gelenke, die Koordination und Feinmotorik, die Atmung und<br />
Herzfrequenz und das Verhalten der Testperson. Gemessen werden Lasten, Kräfte, Toleranzdauern,<br />
Wiederholungszahlen. Im EFL-Job match (Abb. 14) wird dokumentiert, welche körperlichen<br />
Aufgaben der Patient in welchem Umfang bewältigen kann und welche nicht. In<br />
Bezug auf die Dauerbelastbarkeit verbleiben gelegentlich Unsicherheiten, die dann durch Belastungserprobungen<br />
geklärt werden.<br />
Solche Belastungserprobungen (Abb. 15) sind in den MBO®-Zentren, je nach Ausstattung,<br />
in verschiedenen Berufsfeldern möglich. Viele Arbeitssituationen lassen sich mit den vorhandenen<br />
Mitteln simulieren. Die Klinikdienste wie Pflege, Küche, Service, Wäscherei etc. werden<br />
in Anspruch genommen, gelegentlich auch regionale Kooperationsbetriebe oder der bisherige<br />
Arbeitgeber. Solche Belastungserprobungen sind besonders dann wichtig, wenn die<br />
Dauerbelastbarkeit des Patienten oder seine Eignung für ein bestimmtes Berufsbild über eine<br />
oder mehrere Wochen eingehend und realitätsnah geprüft werden muss.<br />
Beispiele zu Belastungserprobungen:<br />
- Im Metallbereich (Abb. 16) betreut der Berufspädagoge einen gelernten Schlosser bei<br />
der Vermessung und Verschraubung großer Stahlprofile. Geprüft wird hier, ob nach<br />
Radiusfraktur loco typico und Scaphoidfraktur rechts der Patient wieder in der Lage<br />
ist, z. B. die notwendigen Dreh-/Druckbewegungen auszuführen, oder ob noch ein<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 3 von 10
weiteres Arbeitstraining im MBO®-Zentrum, vor Wiedereingliederung, nötig ist.<br />
- Beim Blick in den Holzbereich (Abb. 17) sehen wir einen Schreiner, der nach ACG-<br />
Luxation Tossy 3 links unter Aufsicht seines Berufspädagogen versucht, den Bandsägeschnitt<br />
für die Verzapfung eines Tischrahmens vorzunehmen. Festgestellt wird, ob<br />
die Arbeitssicherheit, die Genauigkeit, das Arbeitstempo für einen wettbewerbsmäßigen<br />
Einsatz in der Schreinerei bereits wieder ausreicht, oder ob weiter geübt werden<br />
muss.<br />
- Ein Elektromonteur von Siemens bei der Verkabelung einer Aufzugssteuerungsanlage<br />
(Abb. 18). Hier geht es darum, ob nach Verblockungsoperation der LWK 4 – 6, bei<br />
noch bestehenden Beschwerden im OP-Gebiet, solche längeren stehenden Tätigkeiten,<br />
mit Unterstützung einer industriellen Stehhilfe schon möglich sind, oder das Training<br />
fortgeführt werden muss.<br />
Natürlich geht es nicht nur um körperliche Engpässe am Arbeitsplatz, sondern ebenso um<br />
psychische und soziale Probleme, die sich auf die Arbeitsleistung auswirken. Dafür setzen<br />
die Psychologen Inventare ein, die von den Forschungsverbünden empfohlen werden, wie<br />
beispielsweise AVEM, HADS, FABQ, SF36 etc. Anhand der Testergebnisse und den Ergebnissen<br />
aus der psychologischen Exploration wird dann über Art und Umfang der arbeitspsychologischen<br />
Mitbetreuung entschieden.<br />
Neben dieser berufsorientierten Diagnostik werden auch therapeutische-, also Trainings-<br />
und Schulungsmodule (Abb. 20) angeboten, die auf das Arbeitsleben ausgerichtet sind. Dazu<br />
zählen z. B.<br />
- das Ergonomietraining in Gruppen und das individualisierte Arbeitsplatztraining an<br />
den verschiedenen Modellarbeitsplätzen. Vermittelt wird zum einen Arbeitsplatzergonomie,<br />
also das korrekte Anordnen von Arbeitsmitteln, Arbeitsmobiliar und Werkzeugen,<br />
um unnötige Wege und ungünstige Arbeitshaltungen und Bewegungsabläufe zu<br />
vermeiden und zum anderen Verhaltensergonomie, also autoprotektive Bewegungsmuster,<br />
um z. B. beim schweren Heben und Tragen Wirbelsäulenüberlastungen zu<br />
vermeiden, dynamisches Sitzen am Büro- oder Kfz-Arbeitsplatz und v. a. mehr<br />
- die berufsspezifische Ausgleichsgymnastik, mit der beruflich bedingte muskuläre<br />
Dysbalancen und Verspannungen abgebaut und entsprechenden Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
vorgebeugt werden soll<br />
- das berufsspezifische Funktionstraining, bei dem eingeschränkte, aber beruflich notwendige<br />
Arbeitshaltungen und Bewegungsabläufe schrittweise auftrainiert werden<br />
- das berufsorientierte Muskelaufbautraining in der medizinischen Trainingstherapie,<br />
bei dem jene Muskelgruppen besonders trainiert werden, die beruflich vorrangig gefordert<br />
sind<br />
- abschließend kann der Rehabilitand im Arbeitsplatztraining und Work hardening forciert<br />
auf die Arbeitsanforderungen, die ihn in seinem Betrieb erwarten, vorbereitet<br />
werden.<br />
Unverzichtbar in diesem Rahmen sind arbeitspsychologische Therapieangebote. Dafür sind<br />
Einzelgespräche vorgesehen, aber auch Gruppenarbeit, u. a. zu den Themen<br />
- Bio-Feedback am Modellarbeitsplatz<br />
- Schmerz- und Stressbewältigung<br />
- Entspannung im beruflichen Alltag<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 4 von 10
- soziale Kompetenz im Arbeitsleben<br />
- Motivationstraining für den Beruf<br />
und anderes mehr.<br />
Beispiele aus dem Ergonomietraining:<br />
- Wir sehen eine Ergonomietrainerin, die der im kaufmännischen Bereich (Abb. 21) beschäftigen<br />
Patientin erläutert, wie man den Arbeitsstuhl und die Fußstütze ergonomisch<br />
korrekt einstellt, die Arbeitsmittel, also Tastatur, Maus und Vorlagen im engeren<br />
Greifraum auf dem Arbeitstisch anordnet und schließlich den Bildschirm so platziert,<br />
dass störende Lichtreflexe durch die Deckenbeleuchtung und ermüdende Hell-<br />
/Dunkelkontraste durch Aufstellung vor Fenstern vermieden werden<br />
- Am Pflegearbeitsplatz (Abb. 22) demonstriert die Ergonomietrainerin einer Krankenschwester,<br />
die mit Lumbalgien zu uns gekommen ist, wie man den Transfer eines Patienten<br />
vom Bett in den Rollstuhl unter Selbstschutz bewerkstelligt, wenn technische<br />
Hilfen, also Patientenlifter, Gleit- und Drehbretter o. ä. nicht verfügbar sind, wie das<br />
häufig in der ambulanten Pflege der Fall ist.<br />
- Diese Ergonomietrainerin zeigt, wie man am Kaufhauskassen-Arbeitsplatz (Abb. 23)<br />
den ungünstigen Winkel zwischen Kasse, Band und Scanner reduziert und die Ware<br />
beim Transport von einer Hand in die andere weiterreicht. Durch die tägliche mehr<br />
hundertfache einseitige Torsion und Lateralflexion der WS werden zwangsläufig muskuläre<br />
Dysbalancen aufgebaut, die Verspannungsbeschwerden und Arbeitsunfähigkeit<br />
nach sich ziehen können. Hier hat die berufsspezifische Ausgleichsgymnastik einen<br />
besonders hohen Stellenwert.<br />
In Zusammenarbeit mit Prof. Landau haben wir eine Videopräsentation zu dieser berufsspezifischen<br />
Ausgleichsgymnastik zusammengestellt, die den Patienten als CD-Rom kostenlos<br />
zum Trainieren mitgegeben wird. Der Patient hat nun die Möglichkeit, anhand von Schlüsselbegriffen<br />
im Kopf der Maske (Abb. 24) entweder die für seinen Beruf geeigneten Gymnastikformen<br />
auszusuchen oder die für die belastende Tätigkeit oder die beanspruchte Körperregion<br />
passende Entspannungs- und Dehnübung.<br />
Nehmen wir beispielsweise den Betonbauer, der nach längerer vorgeneigter Betoniertätigkeit<br />
über Schulter- und Nackenschmerzen (Abb. 25) klagt: Wird finden dann beispielsweise eine<br />
einfache, in Arbeitspausen auch am Bau durchführbare Dehnungsübung (Abb. 26). Der Bewegungsablauf<br />
und die Wirkzusammenhänge werden in der Maske erklärt. Dann wird die audiovisuelle<br />
Sequenz gestartet (Abb. 27 bis 33). Dieses Programm bietet zahlreiche Übungsvarianten<br />
für viele Tätigkeiten an.<br />
Wann kommen berufsorientierte Module zum Einsatz?<br />
Zunächst einmal können sie, als zusätzliche Leistungen, in die regulären Maßnahmen integriert<br />
werden (Abb. 34).<br />
Zunehmend häufiger allerdings kommen die Patienten schon früh nach akutmedizinischer<br />
Behandlung mit noch erheblichen Einschränkungen zur Rehabilitation und können die<br />
MBO®-Angebote noch nicht in vollem Umfang wahrnehmen. Dann besteht die Möglichkeit,<br />
nach ambulanter Weiterbehandlung draußen, den Patienten später, im Sinne eines geteilten<br />
Verfahrens, wieder einzubestellen und ihn im MBO®-Zentrum auf die Wiedereingliederung<br />
vorzubereiten. Aktuell laufen zwei Projekte der Deutschen Rentenversicherung, bei denen<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 5 von 10
orthopädische und neurologische Patienten, nach einer herkömmlichen dreiwöchigen Reha-<br />
Maßnahme, an einer zusätzlichen vierten MBO®-Kompakt-Woche teilnehmen.<br />
Eine solche MBO®-Kompaktwoche kann folgendermaßen ablaufen:<br />
Nach der Eingangs-Information und der arbeitsmedizinischen Aufnahmeuntersuchung erfolgt<br />
die Arbeitsplatz- und Tätigkeitsbeschreibung mit beruflichem Anforderungsprofil und Dokumentation<br />
der berufsbezogenen Engpässe (Abb. 35). Dem folgt, am 2. Tag, die physiotherapeutische<br />
Aufnahme mit engpassorientiertem EFL-Screening (Abb. 36) und das sozialpädagogische<br />
und arbeitspsychologische Aufnahmegespräch.<br />
Im Aufnahmeteam werden die Rehapläne festgelegt, dann beginnt die Therapie<br />
- vormittags mit Ergonomie-Vermittlung (Abb. 37) an den verschiedenen Modellarbeitsplätzen<br />
in der Gruppe (1½ Stunden)<br />
- stets gefolgt von der berufsspezifischen Ausgleichsgymnastik (Abb. 38)<br />
- am späteren Nachmittag berufsorientiertes Muskelaufbautraining (Abb. 39).<br />
- Nach dem Mittagessen berufsspezifisches Funktionstraining (Abb. 40)<br />
- oder das Arbeitsplatztraining (Abb. 41), das auf die individuelle Arbeitsplatzsituation<br />
ausgerichtet ist<br />
- am späteren Nachmittag dann Ausgleichssport (Abb. 42) (Nordic Walking, Schwimmen,<br />
Radfahren etc.)<br />
- und abschließend psychosoziales Training (Abb. 43) mit Stressbewältigung, Entspannung,<br />
sozialem Kompetenz- und Motivationstraining, etc.<br />
Dieses Projekt umfasst in 7 Tagen 56 Leistungen mit insgesamt 32 Stunden und wird, neben<br />
vier weiteren, von der Deutschen Rentenversicherung gefördert und wissenschaftlich begleitet.<br />
Was können solche Bemühungen in der Rehabilitationspraxis bewirken?<br />
Zu den 3-wöchigen MBO®-Maßnahmen für orthopädische Patienten haben wir eine kontrollierte<br />
Begleitstudie mit Prof. Müller-Fahrnow (Charité) und Prof. Landau durchgeführt mit<br />
über 1.600 Befragten. Dazu einige Ergebnisse:<br />
Zum Entlassungszeitpunkt (Abb. 44)<br />
- war aus Patientensicht, im roten MBO®-Kolletiv, die körperliche und berufliche Leistungsfähigkeit<br />
und die Bereitschaft, auf eine vorzeitige Berentung zu verzichten, höher<br />
als im blauen, herkömmlich behandelten Kontrollkollektiv.<br />
- Weiterhin war der Widerstand gegen Arbeitsbelastungen nach MBO® geringer (Abb.<br />
45): So konvertierten die Risikotypen, d. h. die Workaholics, die sich ständig selbst<br />
überfordern und die Burn-out-Typen, die bereits ausgebrannt sind, nach einer MBO®-<br />
Maßnahme signifikant häufiger zum erwünschten Gesundheitstyp, der Arbeitsengagement<br />
und gesundheitliche Aspekte vernünftig verbindet, während die entsprechenden<br />
Risikopatienten nach herkömmlicher Behandlung häufiger zum Schontyp hin tendieren,<br />
der berufliche (Über-) Anstrengungen eher zu meiden versucht.<br />
½ Jahr nach Reha (Abb. 46)<br />
- war bei MBO®-Patienten der Bedarf an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, also<br />
der Wunsch nach einer stärkeren beruflichen Verankerung, tendenziell höher und<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 6 von 10
der Wunsch nach vorzeitiger Berentung immer noch signifikant geringer als bei herkömmlich<br />
Behandelten.<br />
1 Jahr nach Reha (Abb. 47)<br />
- wurde die körperliche Leistungsfähigkeit von beiden Gesamtkollektiven noch als geringfügig<br />
erhöht eingeschätzt. Die genauere Betrachtung zeigt, dass von dem Subkollektiv<br />
„mit besonderer beruflicher Problemlage“, das etwa 20 % des Gesamtkollektiv<br />
umfasst und das separat ausgewertet wurde, nach MBO® eine signifikante Verbesserung<br />
angegeben wurde, nur eine tendenzielle jedoch nach herkömmlicher Reha.<br />
- Die Arbeitsunfähigkeitszeiten (Abb. 48) waren im Jahr nach, gegenüber dem Jahr vor<br />
der Rehabilitation, in beiden Gesamtkollektiven fast unverändert. Aber auch hier zeigt<br />
die genauere Betrachtung, dass bei dem Subkollektiv „mit besonderer beruflicher<br />
Problemlage“ unter MBO®-Bedingungen eine signifikante Reduzierung der Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
erreicht wurde, keine dagegen in der Kontrollgruppe.<br />
Bei den mehrwöchigen MBO®-Maßnahmen für neurologische Patienten (Abb. 49), mit Einsatz<br />
von Fallbetreuern, wurden folgende Eingliederungsergebnisse erzielt:<br />
Von 1.045 Patienten<br />
- konnten 54 % an ihren Arbeitsplatz zurückkehren,<br />
- wurden 6 % ihrer Behinderung entsprechend innerbetrieblich umgesetzt,<br />
- waren 5 % nur noch Teilzeit-leistungsfähig, konnten aber im Betreib verbleiben.<br />
- Damit wurden über 65 % ihrem Leistungsbild entsprechend beim bisherigen Arbeitgeber<br />
wieder eingegliedert, was bei neurologischen Patienten überdurchschnittlich ist<br />
und nur 0,4 % mussten sich einen neuen Arbeitgeber suchen.<br />
- 34 % waren voll erwerbsgemindert und im Berentungsverfahren.<br />
Die Eingliederungsempfehlungen der Klinik, die häufig von Leistungsanträgen begleitet waren,<br />
haben sich dabei, auch aus betrieblicher Sicht, überwiegend als tragfähig erwiesen.<br />
Von den 381 befragten orthopädischen Rehabilitanden einer MBO®-Kompaktwoche (Abb.<br />
50) gaben ca. 90 % ohne, oder mit gewissen Einschränkungen, an, dass sie besser vorbereitet<br />
und zuversichtlicher wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, berufsorientierte Anregungen<br />
und Tipps dort umgesetzt haben und jetzt mehr Ausgleichsgymnastik und Ausgleichssport<br />
zu Hause oder im Arbeitsumfeld ausüben und ca. 80 % gaben an, dass sie ergonomische<br />
Tipps, ohne oder mit gewissen Einschränkungen an ihre Arbeitskollegen weitergegeben haben.<br />
In einer aktuellen Studie mit der Universität Würzburg haben unsere neurologischen MBO®-<br />
Kompakt-Patienten in der 6-Monats-Katamnese angegeben, dass sie<br />
- zu einer realistischeren Einschätzung ihrer beruflichen Ziele gelangt sind<br />
- jetzt besser mit beruflichen Belastungen umgehend können<br />
- und Zusammenhänge zwischen Beruf und Gesundheit besser verstehen.<br />
Zusammenfassend haben wir damit erste Hinweise, dass, vor allem bei Patienten mit besonderer<br />
beruflicher Problemlage, nach medizinisch-berufsorientierter gegenüber herkömmlicher<br />
Rehabilitation, im Hinblick auf<br />
- die Wiedereingliederung<br />
- die Arbeitsmotivation<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 7 von 10
- das subjektive Leistungsvermögen<br />
- Rentenwünsche<br />
- und Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
mit günstigeren Ergebnissen gerechnet werden darf. Das wird aktuell durch interne und externe<br />
wissenschaftlich begleitete Studien überprüft und bisher bestätigt.<br />
Mittlerweile werden diese MBO®-Leistungen von uns, je nach betrieblicher Situation und<br />
Aufgabenstellung, auch in regionalen Unternehmen (Abb. 52) angeboten.<br />
Klinik Bavaria www.klinik-bavaria.com<br />
Dr. med., Dr.-Ing. Jürgen Knörzer<br />
FA für Arbeitsmedizin<br />
FA für physikalische und rehabilitative Medizin<br />
Sportmedizin, Rehabilitationswesen, Sozialmedizin<br />
Literaturhinweise<br />
- Bethge M, Radoschewski FM: Work Ability und Rehabilitationsbedarf: Ergebnisse des<br />
Sozialmedizinischen Panels für Erwerbspersonen (SPE). Praxis Klein. Verhaltensmed.<br />
Rehab. 86:25-32 (2010)<br />
- Bürger W, Deck R: SIBAR – ein kurzes Screening-Instrument zur Messung des Bedarfs<br />
an berufsbezogenen Behandlungsangeboten in der medizinischen Rehabilitation. Rehabilitation<br />
48:211-221 (2009)<br />
- Bethge M, Herbold D, Trowitzsch L, Jacobi C: Berufliche Wiedereingliederung nach<br />
einer medizinisch-beruflich orientierten orthopädischen Rehabilitation: Eine clusterrandomisierte<br />
Studie. Rehabilitation 49:2-12 (2010)<br />
- Bethge M, Herbold D, Trowitzsch L, Jacobi C: Berufliche Teilhabe durch multimodale<br />
medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Public Health Forum 19:12e11-12.e13<br />
(2011)<br />
- Deutsche Rentenversicherung Bund: Anforderungsprofil zur Durchführung der Medizinisch-beruflich<br />
orientierten Rehabilitation (MBOR) im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung<br />
– Somatische Indikationen (2010)<br />
- Hillert A, Koch S, Hedlund S: Stressbewältigung am Arbeitsplatz. Ein stationäres berufsbezogenes<br />
Gruppenprogramm. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (2007)<br />
- Heitzmann B, Helfert U, Schaarschmidt U: Fit für den Beruf – AVEM-gestütztes Patientenschulungsprogramm<br />
zur beruflichen Orientierung in der Rehabilitation. Arbeiten zur<br />
Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik.<br />
Band 49. Hans Huber, Bern (2008)<br />
- Ilmarinen J: Work ability – a comprehensive concept for occupational health research<br />
and prevention. Scan J Work Environ Health 35:1-5 (2009)<br />
- Knörzer J: Medizinisch-berufsorientierte Rehabilitation (MBO). In: Landau, K., Pressel,<br />
G., (Hrsg.) Lexikon Arbeitsgestaltung, Best Practise im Arbeitsprozess. Stuttgart: Gentner,<br />
818-823 (2007)<br />
- Knörzer J: Instrumente der Integration medizinischer Leistungen und solcher zur Teilhabe<br />
am Arbeitsleben – Beispiel EFL. In: Schönle, P. W. (Hrsg.) Integrierte medizinisch-berufliche<br />
Rehabilitation. Grundlagen, Praxis, Perspektiven. Bad Honnef: Hippocampus,<br />
70-83 (2007)<br />
- Knörzer J: Rehabilitation, medizinisch-beruflich. In: Landau K., Pressel, G. (Hrsg.) Medizinisches<br />
Lexikon der beruflichen Belastungen und Gefährdungen, Definitionen, Vorkommen,<br />
Arbeitsschutz. 2. Auflage, Stuttgart: Gentner (2008)<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 8 von 10
- Knörzer J, Mühler-Fahrnow W, Muraitis A, Landau K, Presl R: Medizinischberufsorientierte<br />
Rehabilitation für orthopädische Patienten – Orientierender Überblick<br />
über Hintergrund, Strukturen, Inhalte und erste Studienergebnisse. In: Arbeitsmedizin,<br />
Sozialmedizin, Umweltmedizin. 43. Jahrgang, Heft 9, 434-440 (2008)<br />
- Landau K, Knörzer J, Brauchler R, Bopp V, Stern H, Presl R: Berufsorientierter Anforderungs-<br />
und Fähigkeitsabgleich mit dem Bavaria-Rehabilitanden-Assessment BRA<br />
sowie Arbeits- und Verhaltensergonomie zur medizinisch-berufsorientierten Rehabilitation<br />
(MBO®). In: Arbeitswissenschaft im Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt. Proceedings<br />
der 48. Frühjahrstagung der Gesellschaft für Arbeitswissenschaften in Linz 2002.<br />
GF A-Press, Dortmund (2002)<br />
- Landau K, Bopp V, Brauchler R, Stern H, Knörzer J: Integration arbeits- und verhaltensergonomischer<br />
Trainingseinheiten in der Rehabilitation auf der Basis berufsorientierter<br />
Anforderungs- und Fähigkeitsanalysen. Vortrag am rehabilitationswissenschaftlichen<br />
Kolloquium des VDR, Rehabilitation im Gesundheitssystem. Bad Kreuznach, 10.<br />
bis 12. März (2003)<br />
- Landau K, Presl R, Stern H, Knörzer J, Kiesel J, Brauchler R, Bopp V: Engpass- und<br />
fallgruppenorientierte Intervention bei orthopädischen Patienten. In: Müller-Fahrnow<br />
W, Hansmeier T, Karoff M (Hrsg.) Wissenschaftliche Grundlagen der medizinischberuflich<br />
orientierten Rehabilitation, Assessments, Interventionen, Ergbnisse. Lengerich:<br />
Pabst, 105-114 (2006)<br />
- Landau K, Brauchler R, Meschke H, Weißert-Hom M, Kiesel J, Knörzer J, Rascher M:<br />
Arbeitsanalyse in der berufsorientierten Rehabilitation: In: Schäfer E, Buch M, Pahls I,<br />
Pfitzmann J (Hrsg.) Arbeitsleben! Arbeitsanalyse-Arbeitsgestaltung-<br />
Kompetenzentwicklung, Kasseler Personalschriften Band 6, Kassel University Press,<br />
Kassel, 59-81 (2007)<br />
- Löffler S, Wolf HD, Neuderth S, Vogel H: Screening-Verfahren in der medizinischen<br />
Rehabilitation. In: Hillert A, Müller-Fahrnow W, Radoschewski FM (Hrsg.) Medizinisch-beruflich<br />
orientierte Rehabilitation. Grundlagen und klinische Praxis. Deutscher<br />
Ärzte-Verlag, Köln, 133-140 (2009)<br />
- Muthny FA, Bullinger M, Kohlmann T: Variablen und Erhebungsinstrumente in der rehabilitationswissenschaftlichen<br />
Forschung – Würdigung und Empfehlungen. In: VDR<br />
(Hrsg.) Förderschwerpunkt „Rehabilitationswissenschaften“. Empfehlungen der Arbeitsgruppen<br />
„Generische Methoden“, „Routinedaten“ und „Reha-Ökonomie“. DRV-<br />
Schriften Band 16. VDR, Frankfurt a. M., 53-80 (1999)<br />
- Müller-Fahrnow W, Radoschewski FM: Grundlagen. In: Hillert A, Müller-Fahrnow W,<br />
Radoschewski FM (Hrsg.) Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Grundlagen<br />
und klinische Praxis. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 1-14 (2009)<br />
- Neuderth S, Gerlich C, Vogel H: Berufsbezogene Therapieangebote in deutschen Rehabilitationskliniken:<br />
aktueller Stand. In: Hillert A, Müller-Fahrnow W, Radoschewski<br />
FM (Hrsg.) Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Grundlagen und klinische<br />
Praxis. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 185-198 (2009)<br />
- Streibelt M: Validität und Reliabilität eines Screening-Instruments zur Erkennung besonderer<br />
beruflicher Problemlagen bei chronischen Krankheiten (SIMBO-C). Rehabilitation<br />
48:135-144 (2009)<br />
- Streibelt M, Thren K, Müller-Fahrnow W: Effektivität FCE-basierter medizinischer Rehabilitation<br />
bei Patienten mit chronischen Muskel-Skelett-Erkrankungen – Ergebnisse<br />
einer randomisierten kontrollierten Studie. Phys Med Rehab Kuror 19:34-41 (2009)<br />
- Tuomi K, Ilmarinen J, Martikainen R, Aalto L, Klockars M: Aging, work, life-style und<br />
work ability among Finnish municipal workers in 1981-1992. Scand J Work Environ<br />
Health 23 Suppl 1:58-65 (1997)<br />
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 9 von 10
Sächsischer Betriebsärztetag 2012 Seite 10 von 10


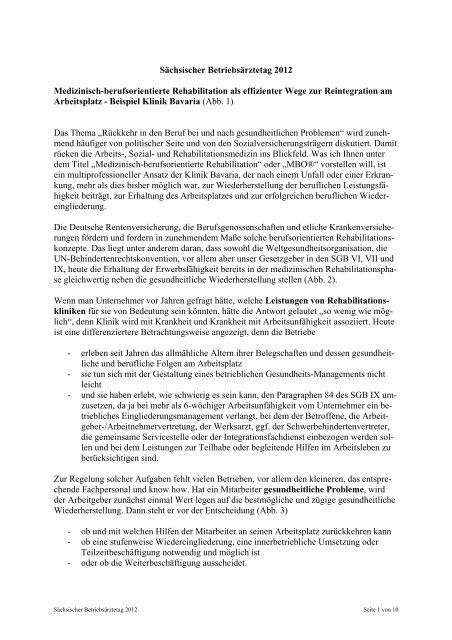
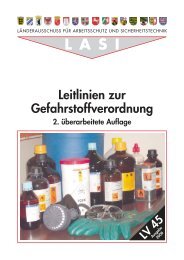





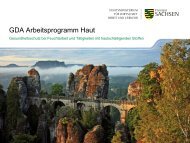



![Pressemitteilung DASP [download *, 05 MB]](https://img.yumpu.com/1931778/1/184x260/pressemitteilung-dasp-download-05-mb.jpg?quality=85)