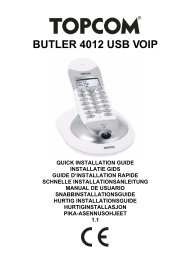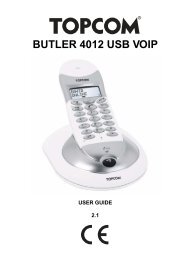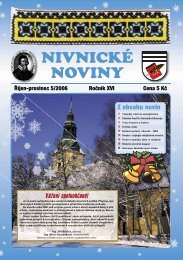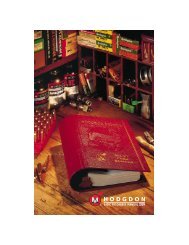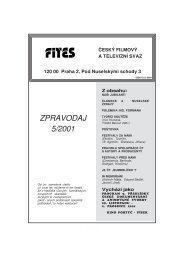Versuch 26 - Chemiestudent.de
Versuch 26 - Chemiestudent.de
Versuch 26 - Chemiestudent.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gruppe 10 05.02.2000<br />
Sandra Altmannshofer, Bernd Neumann<br />
1. Aufgabenstellung<br />
<strong>Versuch</strong>sprotokoll<br />
<strong>Versuch</strong> <strong>26</strong> (Elektronenspinresonanz ESR)<br />
Die Resonanzfrequenz für <strong>de</strong>n Spinübergang <strong>de</strong>s ungepaarten Elektrons in Diphenylpikryl-hydrazyl<br />
(DPPH) in einem Magnetfeld wur<strong>de</strong> gemessen und aus dieser <strong>de</strong>r g-Wert<br />
für <strong>de</strong>n Elektronenspin errechnet.<br />
2. Theoretische Grundlagen<br />
Elektronen besitzen eine Bahndrehimpuls l → und einen Eigendrehimpuls (Spin) s → ,<br />
welche bei<strong>de</strong> gequantelt sind. Diese koppeln zum Gesamtdrehimpuls j → , für welchen<br />
ebenfalls nur gequantelte Zustän<strong>de</strong> erlaubt sind:<br />
l s = s(<br />
s + 1)h<br />
j<br />
= j(<br />
j + 1)h<br />
= l ( l + 1)h<br />
Die Bahndrehimpuls-Quantenzahl l kann hierbei die Werte 0,1,2... annehmen, die Spin-<br />
Quantenzahl s nur <strong>de</strong>n Wert ½.<br />
Die aus <strong>de</strong>n Drehimpulsen <strong>de</strong>r gela<strong>de</strong>nen Elektronen resultieren<strong>de</strong>n magnetischen<br />
Momente μ l und μs addieren sich zum magnetischen Gesamtmoment μg, allerdings tritt<br />
hierbei die „magnetomechanische Anomalie“ auf, <strong>de</strong>r Betrag <strong>de</strong>s magnetischen<br />
Spinmomentes ist gegenüber <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Bahndrehimpulses mit <strong>de</strong>m Faktor ge = 2,0023 (für<br />
freie Elektronen) korrigiert, daher ist das magnetische Gesamtmoment μg nicht mit <strong>de</strong>m<br />
Drehimpuls j kollinear. Es präzediert um die z-Achse, daher wird meist sein Betrag in<br />
dieser Richtung, μj, angegeben:<br />
Bahndrehimpulsquantelung für ein<br />
d-Elektron (l=2..-2)<br />
Spinquantelung Drehmomente und magnetische<br />
Momente
Bei <strong>de</strong>r Wechselwirkung mit einem äußeren Magnetfeld B spalten die sonst energetisch<br />
entarteten Spinzustän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Elektrons mit ΔE=geμBB auf, bei geeigneter Wahl <strong>de</strong>r<br />
Magnetfeldstärke kann eine Anregung zwischen <strong>de</strong>n Spinzustän<strong>de</strong>n durch<br />
elektromagnetische Strahlung dieser Energie (Photonenspin =1!) erfolgen. Die von <strong>de</strong>n<br />
Elektronen aufgenommene Energie wird z.B. einem Schwingkreis entzogen, diese<br />
Resonanz kann beobachtet wer<strong>de</strong>n; allerdings nur bei ungepaarten Elektronen, welche<br />
dann meist einen g-Wert nahe <strong>de</strong>m für freie Elektronen besitzen.<br />
Ein stabiles Radikal ist das im <strong>Versuch</strong> verwen<strong>de</strong>te Diphenyl-pikryl-hydrazyl (DPPH),<br />
<strong>de</strong>ssen g-Faktor bei 2,0036 liegt.<br />
3. <strong>Versuch</strong>saufbau<br />
DPPH<br />
Die DPPH-Probe befin<strong>de</strong>t sich in einem homogenen Magnetfeld, welches durch zwei<br />
Helmholtzspulen erzeugt wird. Die Stärke <strong>de</strong>s Magnetfel<strong>de</strong>s oszilliert um einen<br />
einstellbaren Mittelwert B0, was durch Überlagerung einer Gleichspannung mit einer<br />
sinusförmigen Wechselspannung erreicht wird (zur Darstellung mit <strong>de</strong>m Oszillographen).<br />
Durch einen Oszillator wird <strong>de</strong>r Probe die für <strong>de</strong>n Spinübergang benötigte Energie<br />
zugeführt (Hertz´scher Dipol). Ist die <strong>de</strong>r Photonenenergie hν entsprechen<strong>de</strong><br />
Magnetfeldstärke erreicht, kommt es zur Resonanz, d.h. die Amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Oszillatorschwingung verringert sich. Legt man die Magnetfeldstärke B auf <strong>de</strong>n X-<br />
Eingang und die Oszillatoramplitu<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>n Y-Eingang eines Oszillographen, so kann<br />
man die Resonanz darstellen und die <strong>de</strong>n einzelnen Bo entsprechen<strong>de</strong>n Frequenzen<br />
ermitteln.<br />
4. <strong>Versuch</strong>sdurchführung<br />
Zunächst wird am Oszillographen auf bei<strong>de</strong> Eingänge die Modulationsspannung <strong>de</strong>s B-<br />
Fel<strong>de</strong>s Umod gelegt, die erhaltene Diagonale möglichst groß skaliert und ihr Mittelpunkt<br />
mit <strong>de</strong>m Nullpunkt <strong>de</strong>r Skalierung zur Deckung gebracht, wodurch dieser <strong>de</strong>r Feldstärke<br />
B0 entspricht.<br />
Anschließend wird mit oben beschriebener <strong>Versuch</strong>sanordnung die DPPH-Probe mit EM-<br />
Strahlung unterschiedlicher Frequenz angeregt (zwei verschie<strong>de</strong>ne Spulen für Frequenzen<br />
über und unter 79MHz). und das Magnetfeld so eingestellt, daß Resonanz auftritt.<br />
Die jeweilige Stärke <strong>de</strong>s Magnetfel<strong>de</strong>s kann hierbei nur indirekt bestimmt wer<strong>de</strong>n:<br />
Zunächst wird während <strong>de</strong>s <strong>Versuch</strong>s die Stromstärke in <strong>de</strong>n Helmholtz-Spulen gemessen<br />
und anschließend in einer zweiten Meßreihe die magnetische Flußdichte in <strong>de</strong>n Oszillator-<br />
Spulen bei ausgeschaltetem Oszillator mit einem Magnetfeldmeßgerät (Hall) für die<br />
jeweiligen Stromstärken bestimmt.<br />
Der g-Wert für das ungepaarte Elektron wird mit untenstehen<strong>de</strong>r Formel berechnet.
μB=9,27402•10 -24 J/T h=6,6<strong>26</strong>08•10 -34 Js<br />
n [10 6 s -1 ] I [A] B [10 -4 T] ge<br />
30,7 0,55 9,7 2,<strong>26</strong>3<br />
40,1 0,72 13,1 2,188<br />
50,1 0,90 16,7 2,145<br />
60,1 1,08 20,1 2,138<br />
70,1 1,<strong>26</strong> 23,7 2,115<br />
78,0 1,40 <strong>26</strong>,5 2,104<br />
80,8 1,53 29,0 1,992<br />
90,0 1,63 31,1 2,069<br />
100,2 1,82 34,9 2,053<br />
110,1 2,00 38,6 2,039<br />
120,0 2,17 41,9 2,047<br />
129,7 2,34 45,4 2,042<br />
5. Auswertung /Fehlerbetrachtung<br />
g<br />
e<br />
=<br />
hν<br />
Mit obigen <strong>Versuch</strong>sergebnissen ergibt sich mit <strong>de</strong>r ersten Spule (große Windungszahl N)<br />
ein durchschnittlicher g-Wert von 2,159, mit <strong>de</strong>r zweiten Spule 2,040; gemittelt über alle<br />
<strong>Versuch</strong>sergebnisse ergibt sich ein Wert von 2,100.<br />
Der Betrag <strong>de</strong>s magnetischen Elektron-Spinmomentes beträgt damit μ=geμB(3/4) -½<br />
=1,69•10 -23 J/T<br />
Dies ist eine Abweichung von 4,8% zum Literaturwert von ge=2,0036 (μ=1,61•10 -23 J/T)<br />
für das ungepaarte Elektron im DPPH. Für die einzelnen Spulen ergeben sich<br />
durchschnittliche Abweichungen von 7,8% bzw. 1,8%.<br />
Die zufälligen, durch die Meßtoleranzen <strong>de</strong>r verwen<strong>de</strong>ten Digitalgeräte gegebenen, Fehler<br />
sind bei <strong>de</strong>r <strong>Versuch</strong>sanordnung relativ gering (nicht angegeben, daher nur – 1DGT):<br />
Amperemeter (∝ B) 0,55±0,01: ±1,82% 3,34±0,01: ±0,30%<br />
Oszillator 30,7±0,1: ±0,33% 129,7±0,1: ±0,08%<br />
Magnetfeldmeßgerät 9,7±0,1: ±1,03% 45,4±0,1: ±0,22%<br />
Nach <strong>de</strong>m Gauß´schen Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt sich aus diesen Einzelfehlern<br />
eine Gesamttoleranz von – 2,12% für <strong>de</strong>n ersten und – 0,38% für <strong>de</strong>n letzen ge-Wert, was<br />
obige Abweichungen vom theoretischen Wert nicht völlig erklären kann.<br />
Bemerkenswert ist, daß die Werte für ge sich mit steigen<strong>de</strong>r Frequenz kontinuierlich (bis<br />
auf <strong>de</strong>n 7. Meßwert am Rand <strong>de</strong>s Meßbereichs <strong>de</strong>r 2. Spule, evtl. fehlerhafte Anzeige) an<br />
<strong>de</strong>n Literaturwert annähern (Grafik hinten).<br />
Dies könnte dadurch erklärt wer<strong>de</strong>n, daß die Spule <strong>de</strong>s verwen<strong>de</strong>ten Oszillators nicht<br />
genau senkrecht zu <strong>de</strong>n Helmholtzspulen stand. Zur Erzeugung <strong>de</strong>r EM-Wellen fließen in<br />
dieser hohe Ströme, welche ein Magnetfeld erzeugen, welches das äußere Magnetfeld im<br />
<strong>Versuch</strong> frequenzabhängig (induktiver Wi<strong>de</strong>rstand) schwächt und somit die Messung<br />
verfälscht. („abgeschnittene“ Wechselspannung am Oszillator??)<br />
μ<br />
B<br />
B