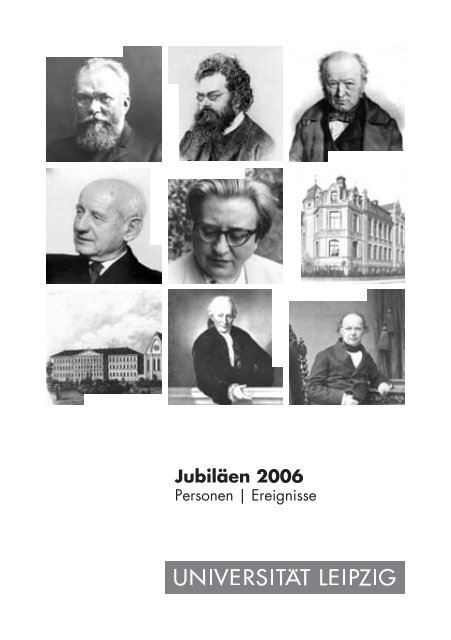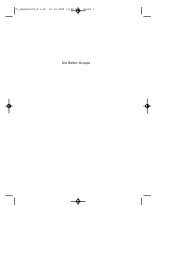Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong><br />
Personen | Ereignisse
<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong><br />
Personen | Ereignisse
Impressum<br />
Herausgeber: Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
Redaktion: Volker Schulte, Pressestelle<br />
Satz: Anja Landsmann, Öffentlichkeitsarbeit<br />
ISBN 3-934178-58-8<br />
Redaktionsschluss: 01.02.<strong>2006</strong><br />
Preis: 2,00 €<br />
Kontakt<br />
Pressestelle<br />
Ritterstraße 26, 04109 <strong>Leipzig</strong><br />
Telefon 0341 97-35020<br />
E-Mail presse@uni-leipzig.de<br />
www.uni-leipzig.de/presse
Inhalt<br />
Geleitwort 7<br />
Erich Kähler 9<br />
Zum 100. Geburtstag am 16. Januar <strong>2006</strong><br />
Hermann Brockhaus 15<br />
Zum 200. Geburtstag am 28. Januar <strong>2006</strong><br />
Eva Lips 21<br />
Zum 100. Geburtstag am 6. Februar <strong>2006</strong><br />
Hans Otto de Boor 27<br />
Zum 50. Todestag am 10. Februar <strong>2006</strong><br />
Karl Lamprecht 31<br />
Zum 150. Geburtstag am 25. Februar <strong>2006</strong><br />
Emil Adolf Roßmäßler 39<br />
Zum 200. Geburtstag am 3. März <strong>2006</strong><br />
Eduard Friedrich Weber 45<br />
Zum 200. Geburtstag am 6. März <strong>2006</strong><br />
Karl-Sudhoff-Institut 49<br />
Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. April <strong>2006</strong><br />
Friedrich Wilhelm Ritschl 55<br />
Zum 200. Geburtstag am 6. April <strong>2006</strong><br />
Albrecht Alt 61<br />
Zum 50. Todestag am 24. April <strong>2006</strong><br />
Institut für Pathologie 67<br />
Zum 100. Jahrestag der Eröffnung am 5. Mai <strong>2006</strong>
Oskar von Gebhardt 73<br />
Zum 100. Todestag am 9. Mai <strong>2006</strong><br />
Karl Ferdinand Hommel 79<br />
Zum 225. Todestag am 16. Mai <strong>2006</strong><br />
Psychiatrische Lehre 83<br />
Vor 200 Jahren begann der kontinuierliche Vorlesungsbetrieb<br />
zur Seelen- und Nervenheilkunde<br />
Paul Drude 89<br />
Zum 100. Todestag am 5. Juli <strong>2006</strong><br />
Robert Schumann 93<br />
Zum 150. Todestag am 29. Juli <strong>2006</strong><br />
Wegbereiter der Chemie 99<br />
Zum 300. Todestag Johann Christian Schambergs am<br />
4. August <strong>2006</strong> und 325. Todestag von Michael Heinrich Horn<br />
am 16. Oktober <strong>2006</strong><br />
Institut für Ausländerstudium 105<br />
Zum 50. Jahrestag der Gündung am 1. September <strong>2006</strong><br />
Johann Friedrich Christ 109<br />
Zum 250. Todestag am 2. September <strong>2006</strong><br />
Ludwig Boltzmann 115<br />
Zum 100. Todestag am 5. September <strong>2006</strong><br />
Johann Christoph Adelung 121<br />
Zum 200. Todestag am 10. September <strong>2006</strong><br />
Johann Christian Gottfried Jörg und<br />
das „Triersche Institut“ 125<br />
Zum 150. Todestag am 20. September <strong>2006</strong> und<br />
zum 200. Jubiläum der Trierschen Stiftung<br />
Christian Samuel Weiss 131<br />
Zum 150. Todestag am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />
Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde 137<br />
Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />
Friedrich Louis Hesse 143<br />
Zum 100. Todestag am 22. Oktober <strong>2006</strong>
Forschungsreise durch Afrika 149<br />
Zum 275. Jahrestag des Beginns der sächsischen Afrika-Expedition<br />
am 30. Oktober <strong>2006</strong><br />
Thomas Müntzer 155<br />
Vor 500 Jahren begann der Theologe sein Studium in <strong>Leipzig</strong><br />
Das Augusteum 161<br />
Zum 175. Jahrestag der Grundsteinlegung für das Hauptgebäude<br />
der <strong>Universität</strong><br />
Academiae Musicus Werner Fabricius 167<br />
Vor 350 Jahren Bestallung des <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>smusikdirektors<br />
Frauenstudium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> 171<br />
Von den Anfängen vor 100 Jahren<br />
Die ersten Promotionen 175<br />
Zum 575. Jahrestag der Verleihung akademischer Grade<br />
an der Medizinischen Fakultät<br />
Autorenverzeichnis 181<br />
Bildnachweise 185
Geleitwort<br />
Nachdem die Broschüren „<strong>Jubiläen</strong> 2004“ und „<strong>Jubiläen</strong> 2005“ eine gute Aufnahme<br />
innerhalb und außerhalb der <strong>Universität</strong> gefunden haben, wünsche ich<br />
Gleiches den „<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong>“, die gegenüber ihren Vorgängerinnen noch einmal<br />
nach Umfang und Vielfalt kräftig zugelegt haben.<br />
Diesmal sind es 31 Kalenderblätter, die den „runden“ <strong>Jubiläen</strong> von bedeutenden<br />
Personen, Einrichtungen und Ereignissen der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> im Jahre <strong>2006</strong><br />
gewidmet sind. Geschrieben sind sie für Mitglieder und Freunde unserer <strong>Universität</strong><br />
und natürlich auch für jenen größeren Kreis von Menschen, die sich für<br />
Themen der <strong>Universität</strong>s- und Wissenschaftsgeschichte interessieren.<br />
Dass sich auch diese Broschüre dem großen Jubiläum von 2009, der Gründung<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> vor 600 Jahren, verdankt und verpflichtet weiß, liegt auf<br />
der Hand. Und es ist zu wünschen, dass in den weiteren Jahren bis dahin jeweils<br />
ein solches oder ähnliches universitätsgeschichtliches Mosaik vorgelegt werden<br />
kann.<br />
Neben Redaktion und Herstellung möchte ich insbesondere den Autoren meinen<br />
Dank sagen, ermöglichen sie doch erst durch ihr Mitdenken und Mittun das Erscheinen<br />
einer solchen Publikation. Möge dieses Engagement erhalten bleiben<br />
und möge auch der Band „<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong>“ eine interessierte Leserschaft finden!<br />
Prof. Dr. iur. Franz Häuser<br />
Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
7
Erich Kähler<br />
Zum 100. Geburtstag am 16. Januar <strong>2006</strong><br />
Erich Kähler wurde 1906 in <strong>Leipzig</strong> geboren und studierte dort Mathematik,<br />
Astronomie und Physik, es folgten die Promotion1928 in <strong>Leipzig</strong> und<br />
die Habilitation 1930 in Hamburg. Er lehrte in Königsberg, Hamburg, <strong>Leipzig</strong><br />
und Berlin. Seine mathematischen Leistungen, die ein ungewöhnliches<br />
breites Feld überdecken, sichern Kähler, der gleicherweise Mathematiker,<br />
Astronom und mathematischer Physiker war, einen Platz in der Geschichte<br />
dieser Wissenschaften.<br />
9
„Mein <strong>Leipzig</strong> lob’ ich mir“, so pries der Dichter Johann Wolfgang Goethe<br />
(1749 – 1832) seinen Studienort, und dass die <strong>Leipzig</strong>er Jahre zu seinen schönsten<br />
und erfolgreichsten gehört haben, bekannte gleichfalls der gebürtige <strong>Leipzig</strong>er<br />
Mathematiker Erich Kähler.<br />
Geboren ist Kähler in <strong>Leipzig</strong> als Sohn eines Telegrapheninspektors, und er hat<br />
die Schule und danach ein Mathematikstudium in seiner Heimatstadt absolviert.<br />
Dabei hat er dank verständiger Lehrer in den letzten Jahren der Oberrealschule<br />
gar nicht mehr am Mathematikunterricht teilgenommen, sondern die ihm vom<br />
Schuldirektor überlassenen Mitschriften Weierstraßscher Mathematikvorlesungen<br />
durchgearbeitet, sodass der Abiturient bereits bestens mit elliptischen und<br />
abelschen Funktionen vertraut war, die seinerzeit noch ein wesentliches mathematisches<br />
Forschungsgebiet ausmachten. Schließlich verfasste der 17-Jährige<br />
eine etwa 50-seitige Abhandlung, die er dem <strong>Leipzig</strong>er Professor Otto Hölder<br />
(1859 – 1937) vorlegte, um damit promoviert zu werden. Kähler wurde darauf<br />
hingewiesen, dass dazu ein Mathematikstudium erforderlich sei, und er studierte<br />
daraufhin sechs Semester in <strong>Leipzig</strong>, insbesondere bei Leon Lichtenstein<br />
(1878 – 1933) und konnte dann 1928 mit dem selbst gestellten Thema „Über die<br />
Existenz von Gleichgewichtsfiguren“ aus der Himmelsmechanik promovieren.<br />
Ein Stipendium der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ermöglichte<br />
ihm zunächst weitere wissenschaftliche Arbeit.<br />
Auf dem Weg in den Urlaub führte er an der <strong>Universität</strong> Hamburg ein folgenreiches<br />
Gespräch mit Emil Artin (1898 – 1962), das in Hamburg zu einer<br />
Assistentenstelle bei Wilhelm Blaschke (1885 – 1962) führte. Bereits 1930<br />
habilitierte sich Kähler mit der Arbeit „Über die Integrale algebraischer Differentialgleichungen“<br />
und wurde Privatdozent in Hamburg, eine Stellung, die er<br />
bis 1935 beibehielt und nur durch einen einjährigen Studienaufenthalt als Rockefellerstipendiat<br />
in Rom (1931 – 1932) unterbrach. In Rom lernte Kähler die<br />
führenden italienischen algebraischen Geometer kennen, aber auch André Weil<br />
(1906 – 1998), mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte.<br />
Blaschke hatte versucht, dem begabten jungen Mathematiker eine Professur zu<br />
verschaffen, wobei ihm im Hinblick auf weitere Kontakte Rostock der geographischen<br />
Nähe wegen besonders geeignet erschien. Aber Kähler war die außerordentlich<br />
anregende Hamburger Atmosphäre, die durch Mathematiker wie Emil<br />
Artin, Wilhelm Blaschke und Erich Hecke (1887 – 1947) sowie durch den Physiker<br />
Wilhelm Lenz (1888 – 1957) und die späteren Nobelpreisträger für Physik<br />
Wolfgang Pauli (1900 – 1958), Otto Stern (1888 – 1969) und Johannes Jensen<br />
(1907 – 1973) geprägt wurde, wichtiger als eine schnelle berufliche Karriere.<br />
10
Zeitweilig studierten auch nachmalig weltbekannte Mathematiker wie Bartel van<br />
der Waerden (1903 – 1996) und Shiing-Shen Chern (geb. 1911) in Hamburg.<br />
Ein Ergebnis zeigte sich bald, nämlich eine bahnbrechende Arbeit über Hermitesche<br />
Metrik (1933), in der eine gewisse metrische Differentialform behandelt<br />
und als alternierende Differentialform geschrieben wurde, von der Geschlossenheit<br />
verlangt wurde. Die hierdurch ausgezeichnete Klasse der Metriken führt zu<br />
dem, was heute als Kählersche Mannigfaltigkeit bezeichnet wird und ein fruchtbarer<br />
Forschungsgegenstand ist. Die Liebe zu dem Kalkül der alternierenden<br />
Differentialformen und die weite Sicht dieser Rechnungsart, die sich schon in<br />
der gerade erwähnten Arbeit zeigte, findet ihren vollen Niederschlag in der eleganten<br />
Behandlung der „Theorie der Systeme von Differentialgleichungen“, eine<br />
Monographie, die letztlich auf eine teilweise mit dem Schöpfer des Differentialkalküls<br />
Elie Cartan (1869 – 1951) zurückgelegte Zugreise Kählers nach Moskau<br />
zurückgeht, wohin ihn Blaschke mitnahm, damit Kähler dort über diesen<br />
Gegenstand vortrage. Cartan hat später die glückliche Bezeichnung der äußeren<br />
Ableitung dω einer Differentialform ω von Kähler übernommen; die sog. Kählermetrik<br />
verlangt Geschlossenheit der Form ω bzw. annuliert ihr Differential.<br />
Die nächsten Jahre bringen Kähler nach Königsberg, wo er zunächst eine Vertretungsprofessur<br />
(1935) und schließlich eine ordentliche Professur (1936) inne<br />
hat. 1938 hat Erich Kähler die Ärztin Luise Günther geheiratet, aber 1939 kurz<br />
nach der Geburt des ersten Sohnes Helmuth (geb. 1939) wurde er als Freiwilliger<br />
zur Marine eingezogen. Das Kriegsende erlebte Kähler an der Atlantikküste, er<br />
war dann zwei Jahre Kriegsgefangener auf der Ile de Ré, wobei die alten wissenschaftlichen<br />
Kontakte dem ehemaligen Offizier einen Sonderstatus verschafften,<br />
der es ihm erlaubte, mathematisch zu arbeiten. Die Familie fand sich bei Hamburg<br />
wieder, und einer kurze Spanne als Diätendozent in Hamburg folgte der Ruf<br />
der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> auf den Lehrstuhl von Paul Koebe (1882 – 1945), der<br />
nach dem Kriegsende gestorben war. Koebe war ein renommierter Funktionentheoretiker<br />
gewesen, dessen Arbeiten den algebraischen Kern der analytischen<br />
Sachverhalte herausschälten, und das entsprach ganz dem Denken Kählers, der<br />
auch in der Funktionentheorie und zwar bereits in den 20er Jahren grundlegende<br />
Ergebnisse erzielt hatte, sodass er in der Tat einen geeigneten Nachfolger Koebes<br />
darstellte und darüber hinaus auch fest in der <strong>Leipzig</strong>er Tradition (etwa bei<br />
den automorphen Funktionen) stand, die letztlich in Felix Klein (1849 – 1925)<br />
wurzelt. Kählers Interessen waren freilich weiter gespannt als die eines reinen<br />
Funktionentheoretikers, bereits in seiner Königsberger Antrittsvorlesung von<br />
1939 hat er sein Verhältnis zur Physik, den Naturwissenschaften und der Philo-<br />
11
sophie klar umrissen, das er in einer Abhandlung anlässlich des 100. Todestages<br />
von Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) vertieft hat.<br />
Die <strong>Leipzig</strong>er Zeit umfasst die wissenschaftlich ertragreichsten Jahre Kählers.<br />
Obwohl der eigenständig Denkende und Handelnde den politischen Spannungen<br />
nicht mehr widerstehen mochte und schließlich 1957 <strong>Leipzig</strong> verließ, um an der<br />
TU Berlin tätig zu sein, wirkte er durch seinen Schülerkreis nachhaltig weiter<br />
in der Messestadt. Relegierte Studenten hatten in seiner Wohnung Privatissima<br />
erhalten, für die Freilassung des inhaftierten Studentenpfarrers Schmutzler hatte<br />
er sich eingesetzt, sodass der Druck auf ihn unerträglich geworden war. 1980<br />
hat er <strong>Leipzig</strong> noch einmal besucht, und in den 90er Jahren im hohen Alter noch<br />
einen beeindruckenden Vortrag im Mathematischen Institut gehalten. In <strong>Leipzig</strong><br />
ist auch sein italienisch geschriebenes Hauptwerk „Geometria aritmetica“ (1958)<br />
entstanden, das viele Jahre im Mittelpunkt seiner Seminare stand und Arithmetik,<br />
algebraische Geometrie und Funktionentheorie verbindet. Schließlich soll<br />
noch erwähnt werden, dass er in <strong>Leipzig</strong> begonnen hatte, Russisch, Sanskrit und<br />
Chinesisch zu erlernen.<br />
An die Berliner Jahre (1958 – 1964) schloss sich eine Lehrtätigkeit als Nachfolger<br />
Artins in Hamburg an; 1974 wurde Kähler in Hamburg emeritiert. In diese<br />
Hamburger Zeit fallen gehäuft Schicksalsschläge, die Kählers Leben veränderten:<br />
Kurz nach dem Wechsel nach Hamburg verunglückte sein zweiter Sohn<br />
Reinhard (1948 – 1966) tödlich, bald danach seine Frau und schließlich einige<br />
Jahre später seine Tochter (1942 – 1988). Solche tragischen Ereignisse ändern<br />
zwangsläufig die Lebensweise, und das persönliche Leid schlug sich zweifelsohne<br />
auch in Kählers philosophischem Denken nieder, dem Plato (427 – 347 v. Chr.),<br />
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) und<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) sehr vertraut waren und das in seinem<br />
Leben stets eine große Rolle gespielt hatte. Er bemühte sich jetzt, Philosophie,<br />
Mathematik und Naturwissenschaften mathematisch – in more geometrico – zu<br />
erfassen. „Welchen naturwissenschaftlichen Sinn haben die in Arithmetik und<br />
Algebra angesammelten Reserven der reinen Mathematik?“, fragte er bereits<br />
1955, und diese Sicht, insbesondere mathematische Deutungsweisen philosophischer<br />
Sachverhalte, zeigen sich immer betonter in den seit 1978 veröffentlichten<br />
Schriften zur Monadologie. Nicht alle sind ihm hier gefolgt.<br />
1974 wurde Kähler emeritiert, zwei Jahre zuvor hat er nochmals geheiratet.<br />
Im Jahr der Emeritierung siedelten die Kählers nach Wedel bei Hamburg um,<br />
aber er nahm am wissenschaftlichen Leben des Instituts weiter teil und lud im<br />
Anschluss an Kolloquia oder Ähnliches gern Gäste in sein Wedeler Heim ein.<br />
12
Der polnische Mathematiker Krzystof Maurin (geb. 1923) berichtete über die<br />
angenehme Atmosphäre im Hause Kählers und insbesondere in dessen großzügigem<br />
Arbeitszimmer, das zahllose Bücher aller Art enthielt und in dem der Hausherr<br />
eine Ecke für große Porträts von Carl Friedrich Gauß und Henri Poincaré<br />
(1854 – 1912) reserviert hatte, auf die er lächelnd mit der Bemerkung hinwies,<br />
dass dies sein liebster Platz mit seinen Ikonen sei.<br />
Am 21. Mai 2000 ist Erich Kähler im Alter von 94 Jahren in Wedel gestorben.<br />
Sein Wirken ist vielfach geehrt worden, er war Mitglied der Sächsischen Akademie<br />
in <strong>Leipzig</strong> (1949), der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin<br />
(1955), der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle (1962)<br />
und der Accademia Nazionale dei Lincei in Rom (1962), der Accademia di<br />
Scienze e Lettere in Mailand (1992). Sein Wirken ist vor allem mit wichtigen<br />
geometrischen Begriffen verbunden (Kählermetrik, Kählermannigfaltigkeiten<br />
und Kählergruppen), die bereits 1932 geprägt wurden. Kählers Bestreben ging<br />
darauf hinaus, Arithmetik, algebraische Geometrie und Funktionentheorie zu<br />
vereinen, ein wirkungsvolles Hilfsmittel war dabei der Kalkül der Differentialformen,<br />
den er maßgeblich mitgestaltet hat. Mathematische Bemühungen<br />
waren für Kähler immer dann unwirksam, „wenn sie die gegenwärtigen mathematischen<br />
Bestrebungen nicht in das Kraftfeld jener Ziele hineinzuziehen versuchen“.<br />
Einen schnellen Überblick über die Breite seines Schaffens ermöglichen<br />
die von Rolf Berndt (geb. 1940) und Oswald Riemenschneider (geb. 1941)<br />
herausgegebenen „Mathematischen Werke“ (2003); es sind dies vor allem die<br />
folgenden Bereiche, die in den 47 Titeln seines Werkverzeichnisses behandelt<br />
werden: das n-Körper-Problem, die Verbindung komplexer Funktionen zur Topologie<br />
und Geometrie, Differentiale, Differentialoperatoren, der Differentialkalkül,<br />
Differentialgleichungen, arithmetische Geometrie sowie Philosophie der<br />
Mathematik. Bekannt ist seine 1941 getroffenen Feststellung: „Die Mathematik<br />
ist ein Organ der Erkenntnis und eine unendliche Verfeinerung der Sprache und<br />
Vorstellungswelt. … Wir können nicht ahnen, in welche Ferne und Tiefe dieses<br />
geistige Auge Mathematik den Menschen noch blicken läßt.“<br />
Rüdiger Thiele<br />
13
Hermann Brockhaus<br />
Zum 200. Geburtstag am 28. Januar <strong>2006</strong><br />
Hermann Brockhaus, geboren am 28. Januar 1806 in Amsterdam, gestorben<br />
am 5. Januar 1877 in <strong>Leipzig</strong>, war einer der herausragenden Indologen<br />
und Orientalisten seiner Generation. 1841 an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
berufen, seit 1848 ordentlicher Professor für „ostasiatische Sprachen“,<br />
lehrte er hier bis zu seinem Tode.<br />
15
Hermann Brockhaus wurde am 28. Januar 1806 in Amsterdam geboren. Sein<br />
Vater, Friedrich Arnold Brockhaus, hatte hier 1805 den berühmten Verlagsbuchhandel<br />
gegründet. 1810 starb die Mutter und der Verlag wurde in Altenburg/<br />
Sachsen neu gegründet. 1817 übersiedelte das Verlagsgeschäft, das einen großen<br />
Aufschwung genommen hatte, nach <strong>Leipzig</strong>, der Metropole des deutschen<br />
Buchhandels. Hermann Brockhaus wurde der Pensions- und Erziehungsanstalt<br />
Wackerbartsruhe bei Dresden als Schüler anvertraut. Ostern 1820 setzte er<br />
seine Ausbildung im Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin fort, das er bis<br />
Michaelis des Jahres 1821 besuchte. Danach war er für kurze Zeit Lehrling im<br />
Verlagsgeschäft. Zu Ostern 1823 wurde er in das renommierte Gymnasium zu<br />
Altenburg aufgenommen. In den folgenden Jahren durchlief er die Selekta und<br />
konnte Ostern 1825 das Studium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> beginnen.<br />
Auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft vollzogen sich damals große Wandlungsprozesse.<br />
1807 erschien in Friedrich von Schlegels Über die Sprache und<br />
Weisheit der Inder zum ersten Mal der Ausdruck „vergleichende Grammatik“.<br />
Bereits 1816 hatte Franz Bopp das erste Werk der modernen Sprachwissenschaft<br />
verfasst: Das Konjugationssystem der Sanskritsprache im Vergleich mit jenem<br />
der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, und 1818<br />
wurde August Wilhelm v. Schlegel an der neu gegründeten <strong>Universität</strong> Bonn als<br />
Professor für Sanskrit berufen.<br />
Die schnell wachsende Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der<br />
Sanskritgrammatik, der vergleichenden Sprachwissenschaft sowie der indischen<br />
Kultur (Bopp übersetzte auch die berühmte Erzählung von Nala und Damayantī<br />
aus dem Epos Mahābhārata, mit der Generationen von Sanskritisten bis zur Gegenwart<br />
ihre Sanskrit-Lektüre beginnen) hatte den deutschen Philologenkreisen<br />
außerordentlich wichtige Anregungen gegeben und ihren Blick auf dieses noch<br />
völlig neue Arbeitsgebiet gerichtet. Auch Hermann Brockhaus fühlte sich zu ihm<br />
hingezogen. Da aber in <strong>Leipzig</strong> noch kein Sanskritstudium angeboten wurde,<br />
wandte er sich zunächst den semitischen Sprachen zu, insbesondere dem Hebräischen.<br />
Zu Ostern 1826 setzte er in Göttingen das Studium der orientalischen<br />
Sprachen fort. Um tiefer in das Sanskrit und ins Persische eindringen zu können,<br />
ging er im Herbst 1827 nach Bonn, wo August Wilhelm v. Schlegel und Christian<br />
Lassen wirkten. Die deutschen <strong>Universität</strong>en hatten damals im Bereich der<br />
Indologie jedoch vergleichsweise wenig anzubieten. Zu Michaelis des Jahres<br />
1828 verließ Brockhaus Bonn für eine mehrjährige Studienreise ins Ausland,<br />
die ihn zuerst nach Kopenhagen (1829 – 1830), dann nach Paris, London und<br />
Oxford führte. In Paris arbeitete er eng mit dem brillanten Eugène Burnouf<br />
zusammen, der ihn in die Zendsprache (die heilige Sprache der zoroastrischen<br />
16
Schriften) einführte. In Oxford entwickelte sich eine enge Beziehung zum Pionier<br />
der europäischen Sanskrit-Studien Horace Hayman Wilson, dem wir das<br />
erste Sanskrit-Englisch-Wörterbuch verdanken. Als Brockhaus 1835 in seine<br />
Heimat zurückkehrte, war ihm kein deutscher Gelehrter an Kenntnissen in der<br />
Sanskrit-Philologie überlegen. Schon damals meinte er, „die wahre Bedeutung<br />
und Würde“ der orientalischen Studien zu erkennen, nämlich: „dem erstarrenden<br />
Morgenlande neues Leben einzuhauchen“ (so sein Schüler Hermann Camillo<br />
Kellner). Damit der Orient nicht bloß eine schale Kopie des Okzidents werde,<br />
müsse er aus seinen Quellen erforscht werden.<br />
Nach einem kurzen Aufenthalt in <strong>Leipzig</strong> ließ sich Brockhaus als Privatgelehrter<br />
in Dresden nieder. Schon in London hatte er die Arbeit an seinem Lebenswerk<br />
begonnen, einer Ausgabe der umfangreichen, 45 000 Strophen umfassenden altindischen<br />
Märchensammlung Kathāsaritsāgra („Der Ozean der Erzählungsströme“)<br />
des kaschmirischen Autors Somadeva (11. Jh.), eine der größten Sammlungen<br />
indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen in Gedichtform. Brockhaus’<br />
erste Veröffentlichung, Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der<br />
Upakosa, beinhaltet die Sanskrit-Erstausgabe und deutsche Übersetzung einer<br />
Episode dieses Werkes. Sie brachte ihm 1838 die philosophische Doktorwürde<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> ein. Die vollständige Ausgabe erfolgte in drei Bänden in<br />
den Jahren 1832 (mit Übersetzung), 1862 und 1866. Gleichzeitig mit seinen Somadeva-Studien<br />
bereitete er die Erstausgabe des originellen allegorisch-philosophischen<br />
Sanskritdramas Prabodhacandrodaya („Mondaufgang der Erkenntnis“)<br />
vor, in welcher personifizierte Begriffe wie die Weisheit, das Ego, die Scheinheiligkeit<br />
usw. als Handelnde auftreten (etwa wie im Everyman von Anonymus).<br />
Im Frühjahr 1836 heiratete Brockhaus Ottilie Wagner (1811 – 1833), die jüngste<br />
der fünf Schwestern Richard Wagners. Zwei Söhne und zwei Töchter gingen aus<br />
dieser Ehe hervor. Der älteste Sohn, Friedrich Clemens, wurde <strong>Universität</strong>slehrer<br />
und Pastor an der Johanniskirche in <strong>Leipzig</strong>, der jüngere wirkte als Professor<br />
der Rechtswissenschaft an der <strong>Universität</strong> Jena.<br />
Im Jahr 1839 wurde Brockhaus als außerordentlicher Professor der orientalischen<br />
Sprachen an die <strong>Universität</strong> Jena berufen. Ab Wintersemester 1840/41<br />
unterrichtete er dort Hebräisch und Sanskrit; er selbst studierte Gälisch und Finnisch.<br />
1841 erhielt er den Ruf an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, wo er 35 Jahre lang, bis<br />
zu seinem Tode, lehrte. Brockhaus war ein beliebter Lehrer. Einer seiner ersten<br />
Schüler war Friedrich Max Müller; ein anderer war Ernst Windisch, der sein<br />
Nachfolger wurde.<br />
17
Zusammen mit seinen Hallenser Kollegen Pott und Rödiger organisierte Brockhaus<br />
1844 das erste gemeinsame Auftreten der deutschen Orientalisten. 1845<br />
folgte die Gründung der „Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“. Von 1846<br />
an und bis in die heutige Zeit erscheint das Organ dieser Gesellschaft mit dem<br />
Titel Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.<br />
Neben Drama und Märchen, die sein besonderes Arbeitsgebiet ausmachten,<br />
hatte Brockhaus auch ein starkes Interesse für die indischen einheimischen<br />
Wissenschaften wie Mathematik, Grammatik, Philosophie und Rechtswissenschaft.<br />
Zwei seiner kleineren Arbeiten beziehen sich auf die indische Arithmetik<br />
und eine auf die Metrik: „Zur Geschichte des indischen Ziffersystems“ (1842),<br />
„Über die Algebra des Bhāskara“ (1852) und „Über die Chandomañjarī (der<br />
Blüthenzweig der Metra) von Gangādāsa“. ˙<br />
In der Abhandlung über die Algebra<br />
Bhāskaras bemerkte er: „Die Zeit des Dilettantismus, der sich ausschließlich an<br />
indischer Poesie ergötzte, ist vorbei, die strenge Wissenschaft macht ihr Recht<br />
geltend …“.<br />
Brockhaus war darüber hinaus im Bereich des Neupersischen tätig. 1845 erschien<br />
seine Übersetzung „Die sieben weisen Meister von Nachschebi“. Gleichzeitig<br />
trieb er seine Zendstudien weiter, als deren Ergebnis er Venidad Sad. Die<br />
heiligen Schriften Zoroasters, Yaçna, Vispered und Venidad. Nach den lithographischen<br />
Ausgaben von Paris und Bombay mit Index und Glossar (<strong>Leipzig</strong> 1850)<br />
publizierte. Auch über die Grammatik der hindustanischen, chinesischen und<br />
armenischen Sprachen hielt er regelmäßig Vorträge. Im Jahr 1846 wurde Brockhaus<br />
zu einem der ersten Mitglieder der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der<br />
Wissenschaften gewählt. 1848 wurde er schließlich zum ordentlichen Professor<br />
der „ostasiatischen Sprachen“ ernannt.<br />
1850, mit 44 Jahren, fing Brockhaus an, Türkisch zu erlernen, um den Kommentar<br />
von Sudi zu den Dichtungen des persischen Mystikers Hafiz lesen zu<br />
können. Drei Bände der kritischen Ausgabe der Lieder von Hafiz mit dem<br />
türkischen Kommentar Sudis erschienen in den Jahren 1854 – 1860. 1853 übernahm<br />
Brockhaus die Redaktion der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen<br />
Gesellschaft, die er bis 1864 führte, 1856 auch die Redaktion der Allgemeinen<br />
Enzyklopädie von Ersch und Gruber. Ab 1860 war er Mitglied der Münchner<br />
Akademie, ab 1868 auch der Berliner Akademie. 1872 wurde er zum Rektor der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> gewählt, und 1873 folgte seine Ernennung zum Geheimen<br />
Hofrat.<br />
18
Hauptpublikationen:<br />
Dissertation: Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der Upakosa.<br />
Fragmente aus dem Katha Sarit Sagara des Somadeva. Sanskrit und Deutsch.<br />
16 + 16 S. <strong>Leipzig</strong>. 1835.<br />
Ausgabe und lateinische Übersetzung: Prabodha Chandrodaya Krishna Misri<br />
Comoedia edidit scholiisque instruxit. 8 + 118 + 136 S. <strong>Leipzig</strong>. 1835 – 1845.<br />
Ausgabe und Übersetzung: Katha Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Sri<br />
Somadeva Bhatta aus Kaschmir. Erstes bis fünftes Buch. 469 + 157 S. <strong>Leipzig</strong><br />
1839 (Übersetzung auch separat, <strong>Leipzig</strong> 1843); Bücher 6 – 18 in AKM 2 & 4,<br />
1862 – 1866 ohne Übersetzung.<br />
Über den Druck sanskritischer Werke mit lateinischen Buchstaben. 92 S. <strong>Leipzig</strong>.<br />
1841.<br />
Ausgabe: Vendidad Sade. 1850; Lieder des Hafis. 1 – 3. 1854 – 1860.<br />
Quellen:<br />
Karttunen, Klaus, Who was Who in Indology. Unveröffenliches Manuskript.<br />
Kellner, Hermann Camillo (1903), „Brockhaus, Hermann“ in Allgemeine Deutsche<br />
Biographie. Siebenundvierzigster Band. Nachträge bis 1899.<br />
Stache-Rosen, Valentina (1990), German Indologists. Biographies of Scholars<br />
in Indian Studies Writing in German. New Delhi.<br />
Windisch, Ernst (1917), Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen<br />
Altertumskunde. Strassburg (S. 211 – 214).<br />
Eliahu Franco<br />
19
Eva Lips<br />
Zum 100. Geburtstag am 6. Februar <strong>2006</strong><br />
Eva Lips geb. Wiegandt, Dr. phil. habil., Professorin für Ethnologie und<br />
Vergleichende Rechtssoziologie (06.02.1906 – 24.06.1988), war Direktorin<br />
des Julius-Lips-Instituts für Ethnologie und Vergleichende Rechtsoziologie<br />
von 1951 bis 1969. Gestützt auf Feldforschungen gemeinsam mit<br />
ihrem Mann Julius Lips in Nordamerika setzte sich Eva Lips nach der Rückkehr<br />
aus der Emigration vorrangig für die Vermittlung eines realistischeren<br />
Indianerbildes ein.<br />
21
Eva Lips geborene Wiegandt wurde am 06.02.1906 als zweites Kind in die Familie<br />
des Verlagsbuchhändlers Dr. h. c. Ernst Wiegandt geboren. Der Vater, einer<br />
der bekanntesten Verleger in der Buch-, Musik- und <strong>Universität</strong>sstadt <strong>Leipzig</strong>,<br />
führte den bereits von seinem Großvater gegründeten Verlag in der Tradition des<br />
bürgerlichen tätigen Liberalismus. Gäste im Hause waren regelmäßig Autoren,<br />
gelegentlich Künstler, seltener auch bekannte Juristen von der <strong>Universität</strong> oder<br />
dem benachbarten Reichsgericht.<br />
Als Schülerin las sie Manuskripte, die ihrem Vater eingereicht wurden, lernte<br />
Korrektur lesen und übte sich im Schreiben eigener Texte. Als erster Titel ihres<br />
Schrifttumsverzeichnisses findet sich, gedruckt am 07.01.1923 im <strong>Leipzig</strong>er Tageblatt,<br />
„Die Seele der Kakteen“, Pflanzen, die sie ihr ganzes Leben lang pflegte,<br />
zog und kaufte. Sie wurden in großer Zahl bis zum hohen Alter zum Schmuck<br />
ihres häuslichen Arbeitszimmers.<br />
1923 schloss sie die höhere Mädchenschule mit der Obersekundarreife ab. Dort<br />
standen Deutsch/Literatur, die musischen Fächer und moderne Fremdsprachen<br />
auf dem Stundenplan. Doch gab es auch „Realienkunde“, zu deren Bestand Zoologie<br />
und nicht zuletzt Botanik gehörten. Von großer Bedeutung wurde später für<br />
sie der Unterricht in Französisch, sie gehörte noch zu einer Generation, in der,<br />
zumindest in den Geisteswissenschaften und der Belletristik, Französisch die<br />
erste Fremdsprache war. Am 15. September 1924 heiratete sie Julius Lips, der<br />
in <strong>Leipzig</strong> Psychologie bei Wilhelm Wundt, Völkerkunde bei Karl Weule und<br />
Rechtswissenschaft u. a. bei Erwin Jacobi studiert hatte. Bei den beiden Erstgenannten<br />
war er zeitweilig Famulus, promovierte 1919 im Fach Psychologie<br />
und 1925 zum Doktor beider Rechte mit einer Arbeit über Hobbes. Es war ein<br />
wissenschaftlicher Einstieg in die Rechtswissenschaft und Soziologie, der auch<br />
für Eva Lips von Bedeutung werden sollte.<br />
Das Paar ließ sich für kurze Zeit in Frankfurt am Main nieder, was beiden die unvergessene<br />
Bekanntschaft von Leo Frobenius einbrachte. Sie siedelten bald nach<br />
Köln über, wo Julius Lips 1926 am Rautenstrauch-Joest-Museum – bei dessen<br />
Direktor Fritz Gräbner er sich bald danach habilitierte – eine Anstellung erhielt.<br />
Er bearbeitete Sammlungen, so zum Beispiel über die Fallensysteme der Naturvölker,<br />
gestaltete Ausstellungen über Masken, vermittelte Wissen über Theater<br />
und szenische Darstellungen in außereuropäischen Kulturen und stellte ein<br />
umfangreiches Material darüber zusammen, wie die weißen Europäer seit dem<br />
17. Jahrhundert mit den Augen der „Farbigen“ gesehen werden. Eva Lips – das<br />
Paar blieb kinderlos – wurde jetzt zur Mitarbeiterin, die fasziniert wurde von der<br />
22
Besonderheit und Außergewöhnlichkeit fremder Kulturen. Die Beschäftigung<br />
damit wurde wesentlicher Teil ihres ganzen Lebens.<br />
1930 wurde Julius Lips in Köln zum Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums<br />
und außerordentlichen Professor für Völkerkunde und Soziologie ernannt.<br />
1933 wurde Julius Lips entlassen. Seit drei Jahren war er Mitglied der SPD und<br />
Jahre vorher aktives Mitglied linksgerichteter studentischer Initiativen gewesen.<br />
Er ging im Februar 1934 nach Frankreich. Seine Frau verfolgte das politische<br />
Geschehen aus der Perspektive ihres <strong>Leipzig</strong>er Elternhauses sowie der Stadt<br />
Köln und folgte ihm bald nach.<br />
Im Mai des gleichen Jahres kam das Schiff mit dem Ehepaar in New York an.<br />
Initiativen französischer Freunde und eigene Bemühungen führten mit der Unterstützung<br />
von Franz Boas zu Lehraufträgen an der Columbia University und<br />
zeitweiliger Anstellung an der New School of Social Research. Bereits 1935 erfolgte<br />
beider erste Feldforschung bei den Montagnais-Naskapi im Süden Labradors.<br />
Eva Lips lernte zum ersten Mal eine nordamerikanische indianische Kultur<br />
kennen, und fortan wurden diese und andere Kulturen eines ihrer wesentlichen<br />
Arbeitsgebiete.<br />
Eine erste Dokumentation in Form von 700 Diapositiven über die Naskapi zeigt<br />
die Art ihres Herangehens. Sie war seitdem auf keiner Reise ohne ihre Leica<br />
unterwegs. Bei den Naskapi fassten Julius und Eva Lips eine große Zuneigung<br />
zu den Bären, „denn bei ihnen ist jeder ein Häuptling, nicht wie bei den anderen<br />
Tieren“. Die längste Feldforschung 1947, die beide zu den Ojibwa-Indianern in<br />
Minnesota führte, wurde die folgenreichste für ihr weiteres Leben.<br />
Eine völlig neue Sphäre erschloss sich ihr, als Julius Lips 1937 – 1939 an der<br />
Howard-University, „der größten Negeruniversität der Welt“, eine Abteilung<br />
für Anthropology übernahm. In der Emigration verfasste Julius Lips „The Origin<br />
of Things – Der Ursprung der Dinge“ – seinen populärwissenschaftlichen<br />
Welterfolg. Das Werk erlebte in zehn Jahren wenigstens zehn Übersetzungen, in<br />
der Erinnerung war ihre Mitarbeit unter anderem als Zeichnerin sehr vieler Gegenstände<br />
immer lebendig. Anknüpfend an die Kölner Museumszeit floss diese<br />
Arbeit in ihre spätere Lehrtätigkeit ein.<br />
In den ersten Jahren der Emigration erwarben Julius und Eva Lips die amerikanische<br />
Staatsbürgerschaft. Er nahm teil an der Tätigkeit von Emigrantenorganisationen<br />
und war Mitbegründer des Council for a Democratic Germany. In diesem<br />
23
Umfeld entwickelte Eva Lips ein ganz eigenständiges Profil. 1938 erschien „Savage<br />
Symphony, A Personal Record of the Third Reich“. Die englische Ausgabe<br />
hat den Titel „What Hitler Did to Us“. 1942 folgte „Rebirth in Liberty“. Wird<br />
in dem ersten Buch das Geschehen nach Hitlers Machtergreifung in der Kölner<br />
Umgebung beschrieben, wird in dem zweiten das neue Leben in Amerika geschildert.<br />
Beide Bücher werden nie in die deutsche Sprache übertragen. Es sind<br />
Schilderungen ganz für den US-amerikanischen Leser in der Ära Roosevelt und<br />
verdeutlichen im Nachhinein die Problematik einer spezifischen Emigrantenliteratur.<br />
Eva Lips hielt auch Vorträge über das Hitlerregime vor zivilen Hörern und<br />
US-amerikanischen Soldaten.<br />
Die Emigration führte unter anderem zu Bekanntschaften mit Heinrich und Thomas<br />
Mann, deren unterschiedliche Persönlichkeiten prononciert wahrgenommen<br />
wurden. Eva Lips wechselte Briefe mit ihnen bis zu deren Todesjahren und hielt<br />
später in <strong>Leipzig</strong> Vorträge, gespeist aus persönlichen Erinnerungen an beide.<br />
1948 kehrte Eva Lips an der Seite ihres Ehemannes, der die Berufung auf den<br />
Lehrstuhl für Ethnologie erhielt, nach <strong>Leipzig</strong> zurück. Ihr Vater war während des<br />
Krieges gestorben, die Mutter wurde Opfer eines Bombenangriffes, der Bruder<br />
fiel an der Front.<br />
Im Jahre 1949 wurde Julius Lips zum Rektor der <strong>Universität</strong> gewählt und trat<br />
im Oktober sein Amt an. Am 21. Januar 1950 erlag er plötzlich und unerwartet<br />
einem schweren Leiden.<br />
Eva Lips suchte und fand Unterstützung bei der Leitung der <strong>Universität</strong> für die<br />
Fortsetzung seiner und ihrer Arbeit. Nach Unterbreitung der Unterlagen über ihren<br />
bisherigen Bildungsweg genehmigte die zuständige Fakultät die Promotion,<br />
und sie wurde mit der Geschäftsführung des Ethnologischen Instituts betraut,<br />
dessen Leitung für kurze Zeit der in Jena lehrende Ferdinand Hestermann wahrnahm.<br />
Eva Lips promovierte am 3. März 1951 mit der Dissertation „Wanderungen<br />
und Wirtschaftsformen der Ojibwa-Indianer“, die in der Wissenschaftlichen<br />
Zeitschrift der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> veröffentlicht wurde. Im Mai des gleichen<br />
Jahres wurde sie zum kommissarischen Direktor des Instituts ernannt. Ihre Lehrtätigkeit<br />
begann noch vor der Promotion mit der Vorlesung zu Wirtschaft und<br />
Recht, die sie von Julius Lips übernahm.<br />
Sehr bald wurde es notwendig, außer ihren jungen Assistenten ausgewiesene<br />
Wissenschaftler in die Ausbildung einzubeziehen. So hielten Hans Damm (Ozeanien)<br />
und Paul Platen (Geographie/Länderkunde) einige Male Vorlesungszy-<br />
24
klen, die jeweils drei Semester umfassten. Hans Grimm vertrat die physische<br />
Anthropologie. Sie selbst hielt die Vorlesungen Wirtschaft und Recht; Magie,<br />
Mythos und Religion der Naturvölker; Ethnologie der Indianer Nordamerikas<br />
und Ethnologie der Indianer Südamerikas außer der Andenregion. Es waren<br />
Überblicke, die in einigen Gebieten Vertiefungen erfuhren. Über mehrere<br />
Semester lief ein Rechtsseminar, in dem Studierende eine große Anzahl von<br />
Rechtsfällen aus der Literatur über einige nordamerikanische Indianerstämme<br />
und die Ureinwohner Australiens sammelten. Doch kam es zu keiner Auswertung<br />
und Bearbeitung. Die Einleitung in die Wissenschaft und die Geschichte<br />
der Völkerkunde, die über zwei Semester hinweg lief, enthielt viele Angaben<br />
zur Entdeckungsgeschichte, einiges wurde zur Ethnologie des 19. Jahrhunderts<br />
vermittelt. Theoretische Auffassungen und Ansichten von Ethnologen aus den<br />
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden nur ansatzweise oder nicht vorgetragen.<br />
1954 erfolgte die Habilitation, Eva Lips erhielt 1955 die Dozentur und wurde<br />
Direktorin des Instituts. Ihre 1956 erschienene Habilitationsschrift hat den Titel<br />
„Die Reisernte der Ojibwa-Indianer. Wirtschaft und Recht eines Erntevolkes“.<br />
Sie unterbreitete damit die Ergebnisse der Feldforschung von 1947, die Julius<br />
Lips bearbeiten und publizieren wollte. Die Arbeit sollte ein Beitrag zur Erntevölkertheorie<br />
sein, deren Begründung Julius Lips als wesentliches Anliegen gesehen<br />
hatte. Das Stadium der Erntevölker folgt historisch dem der Sammler und<br />
Jäger. Die Sesshaftigkeit der Erntevölker ist die Voraussetzung für den Anbau<br />
von Pflanzen. In Anlehnung und Präzisierung der von Julius Lips gefundenen<br />
Formulierung definiert Eva Lips: „Ihre Nahrungsbeschaffung beruht auf dem<br />
systematischen Einernten einer oder weniger Wildpflanzen, die saisongebunden<br />
vorkommen. Durch die Menge ihres Vorhandenseins regen sie zur Konservierung<br />
an und führen zu einer relativen Sesshaftigkeit ihrer Nutzer.“ Neu bei ihr<br />
ist der Gedanke des tierischen Erntegutes, der aber nicht viel weiter entwickelt<br />
wurde.<br />
Drei Jahre nach der Habilitation erhielt Eva Lips die Professur und 1960 die Professur<br />
mit vollem Lehrauftrag. Der Lehrstuhl wurde ihr zu Beginn der 60er Jahre<br />
verweigert. Sie erhielt ihn erst 1966 vor der Emeritierung.<br />
In <strong>Leipzig</strong> war Eva Lips seit ihrer Promotion eine stadtbekannte Persönlichkeit.<br />
Dazu trugen eigene Vorträge, aber vor allem eine Vortragsreihe bei, für die sie<br />
in jedem Winterhalbjahr interessante Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland<br />
einlud. Der Hörsaal war fast immer überfüllt.<br />
25
Ein wesentliches Anliegen, das sie von Beginn an verfolgte, waren der Erhalt<br />
und Ausbau der nunmehr als Julius Lips-Institut für Ethnologie und Vergleichende<br />
Rechtssoziologie benannten Einrichtung für die Ausbildung im Hauptfach.<br />
Ein solches Unterfangen war keineswegs selbstverständlich, gab es doch<br />
an der Humboldt-<strong>Universität</strong> eine entsprechende Neugründung, und in Jena war<br />
über die Fortführung der Ethnologie noch nicht entschieden. Ende der 50er Jahre<br />
und zu Beginn der 60er Jahre stellte sie sich vehement dagegen, am Julius Lips-<br />
Institut auch die Deutsche Volkskunde unter der gemeinsamen Bezeichnung<br />
Ethnologie oder Ethnographie zu etablieren – was auch die gemeinsame oder<br />
alternierende Leitung durch einen Professor der Volkskunde bedeutet hätte.<br />
Mit der Entkolonialisierung und Bildung neuer Staaten gewannen auch „farbige“<br />
ethnische Minderheiten, die keinen eigenen Staat hatten, an kultureller, sozialer<br />
und politischer Bedeutung. Eva Lips fand und suchte dazu kaum einen Zugang.<br />
Nach eigenem Zeugnis sah Eva Lips seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre ihre<br />
Aufgabe darin, den Menschen ein realistischeres Indianerbild zu vermitteln. Das<br />
von Karl May gezeichnete sollte gelöscht werden. Alle ihre Bücher über die Indianer,<br />
auch die in zweiter Auflage erschienenen, fanden schnellen Absatz. Das<br />
reale Leben in einer US-amerikanischen Indianerreservation – die ethnische,<br />
soziale und kulturelle Problematik – war aber nicht Gegenstand ihrer Darstellungen.<br />
Mit der Realisierung der dritten Hochschulreform zu Beginn der 70er Jahre fühlte<br />
sich Eva Lips noch einmal außerordentlich gefordert. In enger Zusammenarbeit<br />
mit Dietrich Treide gelang es ihr, die Bibliothek, das Dia-Archiv und andere<br />
Materialien des Julius Lips-Instituts vor der Auflösung und Liquidierung zu bewahren.<br />
Diese Bestände gehören heute zum Fundus des Instituts für Ethnologie<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Mit ihrem Werk über Julius Lips „Zwischen Lehrstuhl<br />
und Indianerzelt“ (1965 und 1986) wollte sie, wie es in den persönlichen Widmungen<br />
heißt, erreichen, dass er nie vergessen wird.<br />
Die Darstellung des Wirkens von Julius Lips seit dem Beginn der 30er Jahre<br />
durch Eva Lips war vor Überhöhung seiner Persönlichkeit nicht frei und verband<br />
sich durchaus mit eigener Selbstdarstellung. Dies führte früher und in der<br />
jüngeren Vergangenheit zu kritischen Äußerungen, die aber beider Leben und<br />
Lebenswerk nicht beeinträchtigen. Eva Lips wurde an der Seite ihres Mannes auf<br />
dem Südfriedhof im „Professoreneck“ bestattet. Beider Grabstein wird von zwei<br />
Bärenköpfen im Profil eingerahmt.<br />
Wolfgang Liedtke<br />
26
Hans Otto de Boor<br />
Zum 50. Todestag am 10. Februar <strong>2006</strong><br />
Der Rechtswissenschaftler Hans Otto de Boor, der von 1935 bis 1950<br />
an der <strong>Leipzig</strong>er Juristenfakultät wirkte, ist als einer der bedeutendsten<br />
Zivilprozess- und Urheberrechtler des 20. Jahrhunderts anzusehen. Seine<br />
Bedeutung wäre sicherlich noch größer, wenn er nicht wertvolle Schaffensjahre<br />
unter politischen Systemen hätte zubringen müssen, die seinen<br />
liberalen Vorstellungen diametral gegenüberstanden.<br />
27
Hans Otto de Boor kam am 9. September 1886 in Schleswig zur Welt. Seine<br />
Mutter entstammte der Familie Mommsen. In seiner Geburtsstadt erfuhr er auch<br />
die übliche Schulausbildung. 1904 verließ er das Domgymnasium mit dem Reifezeugnis.<br />
De Boor studierte zunächst mehrere Semester Geschichte und Kunstgeschichte,<br />
bevor er sich 1907 dem Studium der Rechtswissenschaft zuwandte. Die erste<br />
Staatsprüfung legte er 1910 in Berlin ab. Im selben Jahr wurde er in Heidelberg<br />
promoviert. Nach kurzem Kriegsdienst legte er 1915 das zweite Staatsexamen<br />
ab.<br />
Im Anschluss daran trat de Boor in den Justizdienst ein, habilitierte sich aber<br />
bereits im Wintersemester 1916/17 in Greifswald mit einer urheberrechtlichen<br />
Arbeit. Im selben Semester nahm er als Privatdozent seine Vorlesungstätigkeit<br />
auf. Parallel dazu las er auch in Göttingen.<br />
Zum Wintersemester 1921/22 wurde de Boor nach Frankfurt am Main auf einen<br />
Lehrstuhl für Römisches und Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Urheberrecht<br />
berufen. In Frankfurt widmete er sich zunächst schwerpunktmäßig dem<br />
Zivilprozessrecht. Im Vorlesungsbetrieb vertrat er aber auch die historischen<br />
Fächer.<br />
1933 war de Boor der letzte gewählte Dekan der Frankfurter Fakultät. Er setzte<br />
sich nachhaltig für die verfolgten Kollegen ein. So gewährte er beispielsweise<br />
dem auf Betreiben von Franz Beyerle aus der Schutzhaft entlassenen Kurt<br />
Rheindorfer in seinem Feriendomizil im Schwarzwald Unterkunft. 1934 wurde<br />
de Boor – obwohl er in einigen NS-Untergliederungen Mitglied war – mit anderen<br />
nicht regimekonformen Hochschullehrern vorübergehend von Frankfurt<br />
nach Marburg versetzt.<br />
1935 erhielt de Boor einen Ruf an die Juristenfakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>,<br />
den er zum 1. Oktober annahm. Seine Lehrstuhlbeschreibung enthielt neben dem<br />
Bürgerlichen Recht das Zivilprozessrecht, die Rechtsvergleichung und das Urheberrecht.<br />
Den Schwerpunkt seiner Vorlesungstätigkeit bildeten das Urheber-<br />
und das Zivilprozessrecht. Von seinen Studenten wurde er – seines vornehmzurückhaltenden<br />
Vortragsstils und seiner gepflegten Erscheinung wegen – nur<br />
der „müde Lord“ genannt. Sein <strong>Leipzig</strong>er und Göttinger Fakultätskollege Karl<br />
Michaelis bestätigte, dass sein Vortrag „nichts Hinreißendes“ hatte.<br />
28
Schriftstellerisch wandte er sich in der <strong>Leipzig</strong>er Zeit insbesondere dem Zivilprozessrecht<br />
zu, ohne das Urheberrecht zu vernachlässigen. Zeitweilig übte er das<br />
Amt des Direktors des Juristischen Seminars aus.<br />
Da de Boor nie der NSDAP beigetreten war, konnte er auch nach 1945 in der<br />
Juristenfakultät lehren. Da die Fakultät personell schwach besetzt war, widmete<br />
er sich verstärkt dem Bürgerlichen Recht. In der Wiederaufbauphase der Fakultät<br />
übte er von 1945 bis 1947 das Amt des Dekans und von 1947 bis 1950 das des<br />
Prodekans aus. Als konservativ bürgerlicher Professor unterstützte er tatkräftig<br />
den ersten Nachkriegsrektor Bernhard Schweitzer als sein Hauptberater. Im<br />
Senat zählte er zu den entschiedenen Gegnern der Einrichtung einer Gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Fakultät, deren Gründung er für politisch, nicht aber<br />
wissenschaftlich bedingt ansah. 1947 beteiligte er sich an den Marburger Hochschulgesprächen.<br />
Schon zu dieser Zeit äußerte er sich sehr hoffnungslos über<br />
die <strong>Leipzig</strong>er Verhältnisse. Da sich in ihm immer stärker das Bewusstsein der<br />
politischen Ausweglosigkeit festsetzte, verließ er 1950 <strong>Leipzig</strong>.<br />
Schon im Wintersemester 1950/51 nahm er seine Vorlesungstätigkeit in Göttingen<br />
auf, das in dieser Zeit vielen ehemaligen <strong>Leipzig</strong>er Professoren eine Zuflucht bot.<br />
Im April 1955 wurde er emeritiert, vertrat aber seinen Lehrstuhl bis zu seinem<br />
Tode. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit am 10. Februar 1956. In Göttingen<br />
trat wieder die Beschäftigung mit dem Urheberrecht in den Vordergrund.<br />
Seit 1951 gehörte er dem Urheberrechtsausschuss des Bundesjustizministeriums<br />
an, in dem er an dem Referentenentwurf von 1954 mitwirkte, den er wesentlich<br />
mitgestaltete und der noch 1965 das neue Urheberrechtsgesetz maßgeblich beeinflusste.<br />
De Boors wissenschaftliche Bedeutung liegt auf den Gebieten des Zivilprozessrechts<br />
und mehr noch des Urheberrechts. Im Urheberrecht fand er weit über die<br />
Grenzen Deutschlands hinaus Anerkennung.<br />
Diesem Rechtsgebiet entnahm er schon das Thema seiner Habilitationsschrift<br />
„Urheber- und Verlagsrecht“ (1917). Der erste Teil der Arbeit untersucht die<br />
Frage nach dem Charakter des Urheberrechts: Vermögensrecht oder Persönlichkeitsrecht?<br />
De Boor kommt mit der vordringenden Meinung seiner Zeit zu dem<br />
Ergebnis, dass es sich allein um ein Vermögensrecht handele. Das gelte auch<br />
für das Verlagsrecht. Der selben Problematik nahm sich de Boor 1932 nochmals<br />
an, als er den Entwurf des Reichsjustizministeriums für ein Urhebergesetz<br />
seiner Kritik unterzog. Mit dem Entwurf erkannte er nunmehr allerdings das<br />
Urheberpersönlichkeitsrecht an. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang noch<br />
29
seine Lettres d‘Allemagne, die er in den Jahren 1929 bis 1955 für die Schweizer<br />
Zeitschrift „Le droit d‘auteur“ verfasste, um über die Entwicklung des Urheberrechts<br />
in Deutschland zu berichten.<br />
Auch mit seinen prozessrechtlichen Veröffentlichungen griff de Boor zunächst<br />
in die Reformdebatte ein. 1924 schrieb er einen „Beitrag zur Lehre von der<br />
Schriftlichkeit im neuen Zivilprozeß“, dessen Haupttitel „Die Entscheidung nach<br />
Lage der Akten“ lautete. 1938 äußerte er sich zur „Reform des Zivilprozesses.<br />
Vom Sinn staatlicher und ständischer Gerichtsbarkeit.“ 1939 behandelte de Boor<br />
„Die Auflockerung des Zivilprozesses. Ein Beitrag zur Prozessreform“. Auch<br />
seine zivilprozessualen Aufsätze galten überwiegend der Prozessrechtsreform.<br />
Abermals ein Jahr später veröffentlichte er sein erstes Lehrbuch unter dem Titel<br />
„Rechtsstreit einschließlich Zwangsvollstreckung“. Das Werk erschien nach dem<br />
2. Weltkrieg unter einem anderen Titel (Zivilprozeßrecht, 1951) in 2. Auflage.<br />
Einige Aufsatztitel deuten eine Annäherung an das nationalsozialistische Rechtsdenken<br />
an: „Die Funktion des Zivilprozesses in der völkischen Rechtsordnung“<br />
und „Funktion des Zivilrechtes in der völkischen Rechtsordnung“ (beide 1938).<br />
Das bedeutet aber keinesfalls, dass de Boor nicht kritische Distanz gegenüber<br />
dem Nationalsozialismus gehalten hätte. Auch sein Lehrbuch zum Zivilprozess<br />
nimmt die Fachbezeichnung auf, die die Studienreform von 1935 mit sich gebracht<br />
hatte (Rechtsstreit einschließlich Zwangsvollstreckung). Dennoch versucht<br />
de Boor gerade hier, aber nicht nur hier, unter Anerkennung der politischen<br />
Gegebenheiten („Lebensordnung des Volkes“) möglichst viele liberale Verfahrensgrundsätze<br />
zu bewahren. Insbesondere verteidigt er energisch die richterliche<br />
Unabhängigkeit gegen das Führerprinzip: „Wenn auch die völlig gleichmäßige<br />
Anwendung“ des Rechts „ein unerreichbares Ziel ist, …, so dürfte doch die<br />
Rechtsprechung unabhängiger Gerichte die bestmögliche Annäherung an dieses<br />
Ziel schaffen. So gesehen ist also die sog. Unabhängigkeit der Gerichte, die ja<br />
zugleich strenge Bindung an die Rechtsordnung ist, das der Rechtspflege angemessene<br />
Mittel, dem Willen der politischen Führung Geltung zu verschaffen.“<br />
Bernd-Rüdiger Kern<br />
30
Karl Lamprecht<br />
Zum 150. Geburtstag am 25. Februar <strong>2006</strong><br />
Karl Lamprecht, der von 1891 bis zu seinem Tod 1915 in <strong>Leipzig</strong> lehrte,<br />
war einer der profiliertesten deutschen Kulturhistoriker und begründete mit<br />
seinem 1909 eröffneten Institut für Kultur- und Universalgeschichte eine auf<br />
Interdisziplinarität und internationale Kooperation setzende Tradition der<br />
Weltgeschichtsforschung in <strong>Leipzig</strong>. Als Rektor entwickelte er zahlreiche<br />
Initiativen zur Hochschulreform am Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />
31
Die hochschulpolitischen Umstände, unter denen der 1856 in Jessen an der Elster<br />
geborene Pfarrerssohn Karl Lamprecht als Professor zurück in seine Studienstadt<br />
<strong>Leipzig</strong> kam, waren durchaus ungewöhnlich. Nach einer Dissertation in mittelalterlicher<br />
Geschichte 1878 in <strong>Leipzig</strong> hatte er sich der vergleichenden Sozial- und<br />
Wirtschaftsgeschichte im Grenzraum zwischen Frankreich und Deutschland zugewandt.<br />
Doch die erfolgreiche Habilitation 1883 in Bonn brachte ihm zunächst<br />
nicht den ersehnten Ruf auf einen Lehrstuhl, sodass er mit dem Angebot des<br />
Kölner Industriellen und Mäzenaten Gustav Mevissen vorlieb nehmen musste,<br />
sich für einige Jahre in die Geschichte der Rheinprovinz einzuarbeiten und eine<br />
Geschichte des deutschen Wirtschaftslebens im Mittelalter zu verfassen, deren<br />
erster Band 1885 erschien.<br />
Während er kaum Unterstützung bei seinen Kollegen fand, hatte die lenkende<br />
Hand der preußischen Kultusbehörde, Friedrich Althoff, den ehrgeizigen und mit<br />
reichlich Organisationstalent ausgestatteten Lamprecht fest für die Erneuerung<br />
der deutschen Hochschullandschaft eingeplant. Ihm verdankte Lamprecht 1889<br />
ein Extraordinariat mit festem Gehalt in Bonn und die reguläre Lehrtätigkeit in<br />
Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. 1890 bot sich dem Ministerialdirektor eine<br />
Gelegenheit, Lamprecht nach Marburg zu lenken, aber bevor er noch den Lehrstuhl<br />
einnehmen konnte, folgte eine ebenfalls von Althoff empfohlene Berufung<br />
nach <strong>Leipzig</strong>.<br />
Lamprechts Dienstantritt erfolgte zu einem Zeitpunkt, da die <strong>Leipzig</strong>er Alma<br />
mater rasch wuchs, wenn auch nicht mehr so schnell wie in den 1870er Jahren,<br />
als selbst Berlin von ihr überflügelt wurde. Franz Eulenburg drückt in seiner<br />
Untersuchung der studentischen Nachfrage das Gefühl der Krise aus, nachdem<br />
der zweite Platz unter den deutschen <strong>Universität</strong>en eben an München verloren<br />
gegangen war: „Es [<strong>Leipzig</strong>] muß sich mit dem dritten Platze begnügen und<br />
nimmt nicht mehr mit dem Wachstum der Gesamtheit zu: <strong>Leipzig</strong> scheint in ein<br />
Stadium der Stagnation eingetreten.“ Gleichzeitig sprachen umfangreiche Neubauten<br />
und zahlreiche exzellente Berufungen für ein Vertrauen in die Zukunft,<br />
dem der neu bestallte Professor für mittlere und neuere Geschichte durch besondere<br />
Dynamik gerecht zu werden suchte.<br />
Rasch gelang es ihm durch nachhaltige Intervention beim Dresdener Ministerium,<br />
den Bücheretat des Historischen Seminars aufstocken zu lassen und den<br />
Ausbau der Räumlichkeiten zu erreichen. Auf weniger Gegenliebe bei seinen<br />
Kollegen traf dagegen das Bemühen, durch öffentliche und durchaus polemische<br />
Diskussionsveranstaltungen den Studenten die Attraktivität des Faches<br />
deutlich zu machen. Die enge Kooperation mit Vertretern anderer Disziplinen<br />
32
entfremdete Lamprecht seinen Kollegen bald noch mehr, die mit Sorge seinen<br />
Unternehmergeist und die methodologischen Streitigkeiten sahen, in die er sich<br />
nicht ohne Vergnügen stürzte.<br />
Etwa Mitte der 1890er Jahre hatte Lamprecht seinen Einfluss auf die strategische<br />
Ausrichtung des Historischen Seminars ausgedehnt, wozu der Erfolg des von<br />
ihm orchestrierten 2. Historikertages 1894 in der Messestadt nicht unerheblich<br />
beitrug. Eines der Ergebnisse dieses ersten veritablen Treffens der maßgeblichen<br />
Vertreter des Faches im deutschsprachigen Raum (mit Ausnahme der Berliner<br />
Geschichtswissenschaft, die sich vorläufig noch vornehm abseits hielt) war die<br />
Gründung einer koordinierenden Arbeitsgemeinschaft der landesgeschichtlichen<br />
Forschungsinstitute. Diese diente Lamprecht wiederum als Argument für den<br />
Ausbau eines solchen Institutes in Sachsen, das die bis dahin vor allem vereinsförmig<br />
organisierte Befassung mit der Landesgeschichte professionalisieren<br />
sollte. Mit königlicher Unterstützung und dem Einverständnis der Dresdener<br />
Archivverwalter schuf er 1896 die Historische Kommission der Sächsischen<br />
Akademie und machte sie rasch zu einem Ort weit ausgreifender Forschungs-<br />
und Editionsprojekte, von denen einige bis auf die heutige Zeit ihren Abschluss<br />
suchen.<br />
Doch er begnügte sich nicht mit einer außeruniversitären Forschungsstelle, sondern<br />
unternahm rasch die nächsten Schritte für die Verankerung in der <strong>Universität</strong><br />
selbst. Über die Zwischenstufe eines Historisch-Geographischen Seminars, in<br />
dessen Kartographierungsunternehmen Rudolf Kötzschke als Hilfsbibliothekar<br />
seine ersten Sporen verdiente und Zeit für die nötige Habilitation gewann, wurde<br />
das Seminar für sächsische Landesgeschichte ins Auge gefasst, das 1906 aus<br />
der Taufe gehoben werden konnte. Methodisch grundlegend für diese regionalgeschichtlichen<br />
Aktivitäten war Lamprechts Idee, durch die systematische<br />
Erfassung siedlungsgeschichtlicher Befunde (von der Anlage der Dörfer bis<br />
zur Verteilung der Eigennamen) und deren Darstellung in Karten ließen sich<br />
geschichtliche Regelmäßigkeiten ermitteln, die einer Verwissenschaftlichung<br />
der Aussagen als Basis dienen würden. Auch dies brachte ihn in heftige Auseinandersetzungen<br />
mit seinen Kollegen, unter denen vor allem der inzwischen nach<br />
<strong>Leipzig</strong> berufene Mediävist Gerhard Seeliger nicht zögerte, seine Einwände<br />
öffentlich zu machen.<br />
Damit zerfiel auch mehr und mehr die Grundlage für eine gemeinsame Politik<br />
bei der Herausgabe der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ und einer zugeordneten<br />
Buchreihe, mit der das <strong>Leipzig</strong>er Historische Seminar seine Stellung<br />
auf einem expandierenden Markt historischer Publikationen behaupten wollte,<br />
33
nachdem Lamprechts Versuch, die renommierte „Historische Zeitschrift“ zu<br />
übernehmen, am Einspruch Friedrich Meineckes bei der Verlegerfamilie gescheitert<br />
war.<br />
Spätestens seit der Jahrhundertwende war das Klima im Historischen Seminar<br />
selbst frostig geworden. Dies hatte neben minderen Ursachen vor Ort vor allem<br />
mit einer jahrelangen Kontroverse zu tun, die sich an Lamprechts Hauptwerk,<br />
der 12-bändigen „Deutschen Geschichte“, entzündete. Die einen meinten dabei,<br />
ein vernichtendes Urteil über die fachliche Integrität des Autors und seine methodischen<br />
Vorannahmen gefällt zu haben, für die anderen wurde Lamprecht<br />
zum schulebildenden Vorreiter einer neuen Art Geschichte zu schreiben, dessen<br />
Wirkungen international größer als in seinem Heimatland waren. Während die<br />
letzteren auf die Ansprüche verwiesen, die er seinem riesigen Manuskript (das<br />
im übrigen ein Bestseller wurde und bald trotz – oder wegen – seines Umfangs<br />
in vielen bildungsbürgerlichen Haushalten als Prunkstück im Wohnzimmer<br />
aufgereiht stand) zugrunde gelegt hatte, betonten die ersteren eine fehlerhafte<br />
Durchführung, mit der sich auch die überzogenen Ambitionen erledigt hätten. Im<br />
Kern ging es um die Frage, ob es die Vielgestaltigkeit des historischen Verlaufes<br />
ermöglichen würde, Regelhaftigkeiten zu erkennen, die schließlich einem Vergleich<br />
geschichtlicher Pfade zugrunde gelegt werden könnten. Dies hing unmittelbar<br />
mit der Frage zusammen, ob der Gegenstand der Geschichtswissenschaft<br />
allein die Betrachtung des Staates und der Politik im engeren Sinne sein sollte, wo<br />
die subjektive Intention und Handlungsweise der großen Akteure vorzugsweise<br />
Individuelles hervorbrachte, dem sich der Historiker in einfühlend-erzählender<br />
Weise zu nähern habe, oder ob kulturelle und soziale Phänomene sowie deren<br />
wirtschaftliche Verankerung in der Verfügung über Ressourcen und technologische<br />
Kenntnisse gleichfalls in den Kanon des Faches aufzunehmen seien. Hatte<br />
sich Lamprecht zunächst mit seinen siedlungsgeschichtlichen Analysen und mit<br />
der Untersuchung der wirtschaftlichen Verflechtungen vor allem auf die sozialen<br />
Strukturen konzentriert, so vollzog er mit der „Deutschen Geschichte“ einen<br />
Schwenk hin zu den kulturellen (oder „sozialpsychologischen“) Ausdrucksformen<br />
als zentralem Beobachtungsgegenstand, an dem er das Entwicklungsstadium<br />
einer Gesellschaft ablesen zu können glaubte. Dies hinderte seine Gegner,<br />
die reflexartig auf die Idee von Regelhaftigkeiten mit dem exkommunizierenden<br />
Vorwurf der Nähe zum Marxismus reagierten, nicht, ihm ökonomischen Determinismus<br />
zu unterstellen. Die Schwachstelle des Lamprechtschen Versuchs lag<br />
dagegen viel weniger in einer naiven Verabsolutierung eines einzelnen Faktors<br />
im Gestrüpp gesellschaftlicher Wirkungsbedingungen – gerade dieses Problem<br />
hoffte er mit der Fokussierung auf die kulturellen Ausdrucksformen zu bewältigen<br />
–, sondern in der geringen Erfahrung mit der Serialisierung von Quellen in<br />
34
der Kulturgeschichte. Alle Disziplinen, die seinem Vorhaben hätten zuliefern<br />
können, steckten noch in den Kinderschuhen, die Anthropologie ebenso wie<br />
die Soziolinguistik und die Kunstgeschichte der populären kulturellen Hervorbringungen.<br />
So experimentierte Lamprecht, der sich einmal auf das Verfassen<br />
einer umfassenden Kulturgeschichte seiner eigenen Gesellschaft eingelassen<br />
hatte, an manchen Stellen mit durchaus noch ungesicherten Ergebnissen der<br />
Nachbarfächer (so etwa mit der Interpretation massenhaft zusammengetragener<br />
Kinderzeichnungen aus verschiedenen Kulturkreisen). An anderen setzte<br />
er intuitiv-hermeneutische Verfahren der Interpretation von epochemachenden<br />
Kunstwerken an die Stelle der eigentlich notwendigen zeitaufwendigeren quantifizierenden<br />
Auswertungen kultureller Artefakte, und in vielen Passagen zog er<br />
sich auf konventionelle Darstellungsformen zurück.<br />
Befeuert durch die heftigen Anwürfe seiner Gegner, die die Auseinandersetzung<br />
schon bald als einen Vernichtungsfeldzug gegen ein gefährliches Paradigma<br />
verstanden, verlies Lamprecht bald die Ebene der Einzelkritik und konzentrierte<br />
sich auf die manifestartige Ausarbeitung einer „neuen Geschichtswissenschaft“,<br />
die er der traditionellen Politikzentriertheit entgegenhielt. Historiker in West-<br />
und Osteuropa, Nordamerika und selbst in Japan und China, die sich in ähnlicher<br />
Weise für eine Erneuerung der Geschichtswissenschaft einsetzten, verwiesen<br />
auf Lamprecht als einen erfolgreichen, wenn auch angefeindeten Verbündeten;<br />
<strong>Leipzig</strong> entwickelte sich nach der Jahrhundertwende dank des Lamprechtschen<br />
Engagements zu einem symbolischen Ort der internationalen Reformbewegung<br />
in der Historiographie.<br />
Und Lamprecht wusste diese Unterstützung zu nutzen, um der drohenden Isolation<br />
in der deutschen Geschichtswissenschaft zu entgehen. Zunächst konnte er<br />
sich auf eine breite Front von Kollegen aus benachbarten Fächern stützen, die<br />
seinem Ansatz interdisziplinären Rückhalt boten: Neben den Geographen Ratzel<br />
und Berger waren dies vor allem der Ökonom Roscher, der Psychologe Wundt,<br />
der Chemiker Ostwald und der Zeitungswissenschaftler Bücher. Mit ihnen bildete<br />
Lamprecht das auch außerhalb <strong>Leipzig</strong>s bemerkte Positivistenkränzchen, das<br />
der sächsischen Landesuniversität eine intellektuelle Öffnung nach Westeuropa<br />
verschaffte, die sie klar unterscheidbar machte von den eher individualistischhermeneutisch<br />
verankerten Methoden vieler Zentren deutscher Geisteswissenschaft<br />
und auch von Max Webers Begründung einer historischen Soziologie.<br />
Hatte ihn zunächst die Landesgeschichte, später die Nationalgeschichte zu innovativen<br />
Deutungsversuchen gereizt, so erklärte Lamprecht dies nun zu Vorstufen<br />
einer neuartigen Komparatistik, die ihn nach der Rolle von Internationalisierung<br />
35
und kulturellen Kontakten fragen ließ. Eine Reise zur Weltausstellung nach<br />
St. Louis und durch den Mittleren Westen der USA inspirierten ihn, ein Programm<br />
auszuarbeiten, das er zuerst den Studierenden der Columbia University<br />
während einer Serie von Gastvorlesungen darbot: Der künftige Wettbewerb der<br />
Staaten werde nicht mehr vorrangig mit militärischen Waffen, sondern mit der<br />
kulturellen Fähigkeit geführt, sich die besten Ideen anderer Gesellschaften produktiv<br />
anzueignen. Im Zeitalter zunehmender globaler Verflechtungen hatte die<br />
von Lamprecht hartnäckig vertretene Kulturgeschichte damit als Weltgeschichte<br />
wieder eine patriotische Aufgabe gewonnen, die das Engagement der Vorgängergeneration<br />
für die nationale Einigung ablösen würde.<br />
Wiederum setzte der <strong>Leipzig</strong>er Ordinarius sein Organisationstalent dafür ein,<br />
dem neu gewonnenen Ansatz günstige Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen:<br />
Als er mit seinen Kollegen Brandenburg und Seeliger nicht einig werden konnte<br />
über die radikale Gegenstandserweiterung der Geschichtswissenschaft, betrieb er<br />
die Trennung seines Instituts vom Historischen Seminar und stützte sich vorrangig<br />
auf die Kooperation mit Kollegen aus anderen Disziplinen, vorzugsweise den<br />
Spezialisten der verschiedenen Weltregionen in Sinologie, Japanologie, Afrikanistik<br />
und Nordeuropakunde, Völkerkunde und Geographie. Den Internationalen<br />
Historikerkongress 1908 in Berlin machte er zur Bühne seiner Pläne, und nur ein<br />
Jahr später folgte die Gründung des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte<br />
mit einer (u. a. aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds) reich ausgestatteten<br />
Bibliothek und Forschungsmöglichkeiten für Nachwuchswissenschaftler. Mit<br />
seinem systematisch modularisierten Lehrbetrieb zog es schon bald über 300<br />
Studierende an und trug damit tatsächlich dazu bei, die Nachfrage nach historischem<br />
Wissen in <strong>Leipzig</strong> gegenüber den 1890er Jahren zu vervielfachen.<br />
Lamprecht wusste insbesondere <strong>Leipzig</strong>s Verleger zu begeistern, und mit deren<br />
Spenden machte er sich während seines Rektorates 1910/11 an die Gründung<br />
der König-Friedrich-August-Stiftung, die in wichtigen Punkten in direkter Gegenüberstellung<br />
zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konzipiert war: Statt einer<br />
utilitaristischen Ausrichtung auf industrielle Verwertbarkeit der Naturwissenschaften<br />
hatten hier die Geistes- und Sozialwissenschaften den zentralen Platz;<br />
statt einer Abtrennung der Forschung von der <strong>Universität</strong> verblieben die Forschungsinstitute<br />
der Stiftung direkt bei der Hochschule (und Lamprecht träumte<br />
gar von einem gemeinsamen Campus für Lehre und Forschung in Probstheida).<br />
Mit Geschick wusste der rastlose Antreiber das sächsische Selbstbewusstsein<br />
in Monarchie und Parlament sowie bei den Mäzenaten für die Planungen einer<br />
drittmittelgestützten <strong>Universität</strong>sentwicklung zu mobilisieren und die vielfachen<br />
internationalen Kontakte einzusetzen.<br />
36
Der Erste Weltkrieg und die Zurückhaltung der Kollegen, die das eingeworbene<br />
Geld für patriotische Zwecke zu spenden beabsichtigten, warfen den Plan weit<br />
zurück, und erst nach Kriegsende konnte das Vorhaben wieder aufgegriffen<br />
werden.<br />
Dies erlebte allerdings Lamprecht nicht mehr. Er starb nach einem Truppenbesuch<br />
in Belgien, den er aufgrund völliger Erschöpfung abbrechen musste, am<br />
10. Mai 1915 in <strong>Leipzig</strong> und wurde in Schulpforta beigesetzt, wo er 1874 sein<br />
Abitur abgelegt hatte.<br />
Matthias Middell<br />
37
Emil Adolf Roßmäßler<br />
Zum 200. Geburtstag am 3. März <strong>2006</strong><br />
Emil Adolf Roßmäßler gehört zu den bedeutenden Persönlichkeiten der<br />
Stadt <strong>Leipzig</strong>. Sein kurzes Studium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> vertiefte er als<br />
Autodidakt, kam an der Königlichen Sächsischen Akademie für Forst- und<br />
Landwirte in Tharandt als Professor für Zoologie zu akademischen Ehren,<br />
wurde 1848 in das erste deutsche Parlament gewählt und war als Volksschriftsteller<br />
und Pädagoge überzeugt, dass die Freiheit aller Stände durch<br />
naturwissenschaftliche Bildung erreicht werden könnte.<br />
39
Angeregt von seinem Vater, dem Kupferstecher Johann Adolf Roßmäßler, entwickelte<br />
der am 3. März 1806 in <strong>Leipzig</strong> als zweites Kind geborene Emil Adolf<br />
schon im Knabenalter großes Interesse an der Natur. Auch seine Begabung, Naturgegenstände<br />
zeichnerisch exakt abzubilden, zeigte sich schon frühzeitig. Die<br />
gymnasialen Lehrinhalte der Nicolai-Schule prägten bei dem jungen Roßmäßler<br />
ein humanistisches Weltbild, das ihm zeitlebens Maßstab, Kraftquell und auch<br />
Trostanker blieb. Seine Neigung zur Naturgeschichte fand in einem kleinen<br />
Kreis gleichgesinnter Mitschüler vielseitige Anregung. Besonders sein Freund<br />
Theodor Klatt, Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes, lieferte dazu die neueste<br />
Literatur und mit seinen Sammlungen das notwendige Anschauungsmaterial.<br />
Das 1. Heft der “Iconographia botanica“ von Reichenbach löste bei den Jünglingen<br />
begeisterte botanische Exkursionen, Pfeiffers 1. Band “Systematische<br />
Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und Wasserschnecken“ Sammelleidenschaften<br />
aus.<br />
Nach dem Verlust der Eltern war Roßmäßler von den finanziellen Möglichkeiten<br />
seines Oheims abhängig und schrieb sich deshalb, sein Wunschfach Arzneikunde<br />
zurückstellend, Ostern 1825 an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> für das wesentlich<br />
billigere Studienfach Theologie ein. Die beiden einzigen von ihm besuchten<br />
Kollegien, Kirchengeschichte und Dogmengeschichte, hielt er dazu angetan, die<br />
Theologie einem jungen Mann zu verleiden, der „… zunächst zu nichts anderem<br />
Beruf und Neigung fühlte, als selbständig zu denken und zu urtheilen, …“. Auch<br />
eine Vorlesung Philosophie hielt er für ungenießbar: „... und nach Verlauf eines<br />
Monats war ich für mein ganzes Leben zum letztenmale in einer philosophischen<br />
Vorlesung gewesen.“ Regelmäßiger besuchte er die Vorlesungen Medizinische<br />
Botanik und Kryptogamische Gewächse, für die ihm Gustav Kunze die Gebühren<br />
erlassen hatte. Auch berichtet er in seiner Selbstbiographie, dass ihm für ein<br />
Jahr der botanische Unterricht für die Apothekerlehrlinge ganz <strong>Leipzig</strong>s übertragen<br />
worden sei, den er als Exkursionen durchführte, der aber wenig Erfolg<br />
brachte.<br />
Als er nach zwei Jahren die <strong>Universität</strong> verließ und sich 1827 um die Lehrerstelle<br />
an einer Schola collecta in dem kleinen thüringischen Städtchen Weida bewarb<br />
und diese erhielt, gestand er sich ein: „Freilich hatte ich hierauf schon deshalb<br />
keinen Anspruch, weil ich seit der Abgangsprüfung [Abitur; St.] keinerlei <strong>Universität</strong>sprüfung<br />
gemacht, und in keinem Fach die vorgeschriebenen, bei den<br />
Prüfungen zu belegenden Vorlesungen vollständig gehört hatte.“ In dieser Situation<br />
wurde zum ersten Mal sein etwas trotziges Pflichtgefühl deutlich. Er begann<br />
mit Feuereifer ein Selbststudium, das bei seiner Begabung schnell zu Erfolgen<br />
als Lehrer und auch in der wissenschaftlichen Botanik führte.<br />
40
1929 wurde Roßmäßler von der Anregung überrascht, sich um die vakante Professur<br />
für Zoologie an der Königlichen Sächsischen Akademie für Forst- und<br />
Landwirte zu bewerben. Der Vorschlag kommt von Hofrat Prof. Reichenbach<br />
in Dresden, dem er mehrfach Herbarmaterial relativ seltener Pflanzen geschickt<br />
hatte. Sinngemäß habe ihm sein Förderer, annehmend, er sei inzwischen promoviert,<br />
geschrieben: „…ich weiß recht wol, dass Sie nicht Zoolog sind; wer<br />
sich aber so gründlich und so wissenschaftlich mit der Botanik beschäftigt hat,<br />
der arbeitet sich schnell so weit in die Zoologie hinein, als es für den Unterricht<br />
auf der Anstalt erforderlich ist.“ Bei der Vorstellung in Dresden verweigerte<br />
der zuständige Minister, Graf Einsiedel, in Anbetracht des ausstehenden Hochschulabschlusses<br />
und der fehlenden Promotion vorerst den Titel Professor und<br />
reduzierte die bisherige Besoldung der Stelle erheblich. Aber Roßmäßler nahm<br />
die Einschränkungen in Kauf, die Berufung an die Akademie erreichte ihn kurz<br />
vor Ostern 1830 in Weida, anschließend verlobte er sich in <strong>Leipzig</strong> mit Emilie<br />
Neubert, seiner späteren Frau, und trat Mitte Juni 1830 sein neues Amt in Tharandt<br />
an.<br />
Da einschlägige Fachliteratur für Studierende der Forst- und Landwirtschaft damals<br />
fast vollständig fehlte, erarbeitete er, gefördert von dem Gründer und ersten<br />
Direktor der Akademie, Oberforstrat Heinrich Cotta, zunächst Lehrmaterialien<br />
für seine Vorlesungen. Schon 1832 erschien das Lehrbuch „Systematische Übersicht<br />
des Thierreichs“ mit 12 selbstgezeichneten Atlastafeln. 1834 folgte das<br />
Fachbuch „Forstinsekten, Naturgeschichte derjenigen Insekten, welche den bei<br />
uns angebauten Holzarten am meisten schädlich werden“. Die Übernahme der<br />
pflanzenphysiologischen Vorlesungen gab die Anregung für das Kompendium<br />
„Das Wichtigste vom Bau und Leben der Gewächse, für den praktischen Landwirt<br />
faßlich dargestellt“ mit 4 Steindrucktafeln (1843) und schließlich das forstwirtschaftlich<br />
orientierte Buch „Charakteristik des Holzkörpers der wichtigeren<br />
deutschen Bäume und Sträucher“ (1847).<br />
Aber all diese Publikationen berührten nicht eigentlich sein zoologisches Hauptinteresse,<br />
die Mollusken. Erst während einer 7-wöchigen Reise nach Wien<br />
(1832), wo er die großen Conchyliensammlungen von Ziegler und Mühlfeldt und<br />
mit Hilfe von Partsch die Bestände des Hofnaturalienkabinetts sichten konnte<br />
und wo er neue und besonders interessante Arten zeichnete, wurde die Begeisterung<br />
für die Malakozoologie zur Faszination. Nun musste er seine Vision von einem<br />
großen Tafelwerk realisieren. Das 1. Heft der „Iconographie der Land- und<br />
Süßwasser-Mollusken, mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen,<br />
noch nicht abgebildeten Arten“ erschien im Großquart-Format im April 1835.<br />
Schon mit der letzten Tafel des Heftes wurde deutlich, dass er seine Zeichnungen<br />
41
auch selbst lithographieren will. Bei der Steinzeichnung erreichte er schließlich<br />
eine Perfektion, die sein Werk in die Reihe der schönsten einschlägigen Fachbücher<br />
stellt. Bis 1840 publizierte er jährlich 2 Hefte mit jeweils 5 Tafeln, dann<br />
sporadisch die Hefte 11 – 16, und 1859 schloss er mit den Heften 17 und 18 den<br />
3. Band ab. In einigen Heften spiegelt sich seine Sammeltätigkeit im Ausland<br />
wider, so z. B. die Ausbeute der dreimonatigen Studienreise im südlichen Spanien<br />
im 13. und 14. Heft. Nach Roßmäßler bemühten sich W. Kobelt und viele<br />
weitere Malakologen um die Fortsetzung des Werkes.<br />
Der so erfolgreiche, inzwischen mit zahlreichen Gelehrten korrespondierende<br />
Roßmäßler konnte sich aber trotz aller Erfolge etwa ab 1840 mit den akademischen<br />
Aufgaben allein nicht mehr abfinden. Auch mag er um diese Zeit erkannt<br />
haben, dass die wissenschaftlichen Fortschritte in den von ihm vertretenen Disziplinen<br />
wohl im schulischen, aber nicht mehr im akademischen Bereich von einer<br />
einzelnen Person vermittelt werden können. In dieser Situation drängt ihn sein<br />
Gewissen, sich in den Dienst des sozialen Fortschritts zu stellen. Auch will er<br />
nicht mehr „… einer Kirche … äußerlich angehören, von der er innerlich längst<br />
abgefallen war“ und schloss sich 1846 mit seiner Frau der Deutsch-katholischen<br />
Religionsgemeinschaft an. Nach der Märzrevolution 1848 wurde er zu einer<br />
Bewerbung um einen Sitz in der Frankfurter Nationalversammlung gedrängt<br />
und am 15. Mai zum Abgeordneten des 22. sächsischen Wahlbezirkes (Pirna)<br />
gewählt. Schon am 20. Mai traf er in der Frankfurter Paulskirche ein, wurde in<br />
der 34. Sitzung des Parlaments dem Schulausschuss zugeordnet und hielt am<br />
18. September 1848 eine leidenschaftliche Rede, die mit dem Aufruf endete:<br />
„Ich bitte Sie, meine Herren, nehmen Sie sich der Volksbildung an, nehmen Sie<br />
sich der Volkslehrer an. Wenn Sie dies nicht tun, begehen Sie einen Verrat an<br />
der Zukunft Deutschlands.“<br />
Nach dem Zerfall der Nationalversammlung ging er mit dem Rumpfparlament<br />
am 06.06.1849 nach Stuttgart, „… wo die Erhebung zur Freiheit in 12 Tagen ihr<br />
trauriges Ende fand“. Schon im August kehrte er allein nach Tharandt zurück,<br />
wurde suspendiert und des Hochverrats angeklagt. In allen Instanzen freigesprochen,<br />
beantragte er seine Entpflichtung und verließ, mit weniger als der Hälfte<br />
seiner Bezüge abgetan, Tharandt. Im März 1850 zog die Familie Roßmäßler nach<br />
<strong>Leipzig</strong>. Für die Volksschriftstellerei ohne saft- und kraftlose Naturschwärmerei<br />
hatte er sich schon vordem entschieden. 1850 bis 1867 schrieb er 15 Bücher,<br />
viele davon mehrbändig, die meisten sehr gut illustriert; nur einige können hier<br />
erwähnt werden: „Der Mensch im Spiegel der Natur“ (1850 – 1853), 5 kleine<br />
Bände, in denen Roßmäßler seine naturphilosophischen, pädagogischen und politischen<br />
Überzeugungen verdeutlicht; „Das Süßwasser-Aquarium“ (1857), eine<br />
42
elativ kleine Publikation, die den Namen Roßmäßler bei den Naturfreunden bis<br />
heute lebendig erhalten hat. Der dem Namen oft nachgestellte Satz: “Vater der<br />
Aquaristik“ kann wohl für Deutschland gelten, bedingt aber auch, dass seine<br />
großen Leistungen für die Pädagogik, die Malakologie, den Landschafts- und<br />
Naturschutz übersehen werden. Einige weitere Titel: „Das Wasser“ (1858), ein<br />
Meisterwerk, das sich auf seine Studien in der Schweiz stützt, 2. Auflage 1860,<br />
außerdem Übersetzungen ins Holländische und Russische; „Der Wald“ (1862),<br />
eine noch heute interessante Monographie, in der die botanischen und forstwirtschaftlichen<br />
Aspekte von Wald und Forst erschöpfend behandelt werden; Nachauflagen<br />
1870 und 1881, ergänzt und verbessert von M. Willkomm; „Die Tiere<br />
des Waldes“ (1867), mit E. A. Brehm ediertes zweibändiges Fachbuch, im 1.<br />
Bd. die Wirbeltiere von Brehm, im 2. Bd. die wirbellosen Tiere von Roßmäßler;<br />
„Mein Leben und Streben im Verkehr mit der Natur und dem Volke“ (1874),<br />
posthum von K. Ruß herausgegebene Selbstbiographie.<br />
Ungewöhnlich vielseitig waren aber auch Roßmäßlers Aktivitäten für Zeitschriften.<br />
In der Wochenzeitung „Die Natur“ erschienen 1852 bis 58 etwa 22<br />
Beiträge. In seinem eigenen, von E. A. Brehm unterstützten, vor allem auf<br />
die Bildung der einfachen Stände orientierten Volksblatt „Aus der Heimat“<br />
(1859 – 1866) schrieb er die meisten Beiträge selbst. Auch für das Familienblatt<br />
„Die Gartenlaube“ lieferte er Artikel, von denen „Der See im Glase“ bis heute<br />
als Vorläufer des Buches „Das Süßwasser-Aquarium“ erwähnt wird. Insgesamt<br />
sind Roßmäßlers populärwissenschaftliche Schriften eine großartige pädagogische<br />
Leistung. Niemand hat dies besser verdeutlicht als Gustav Schneider mit<br />
seiner Dissertation: „Emil Adolf Roßmäßler als Pädagog“, eingereicht 1902<br />
an der philosophischen Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Schneider stellt Roßmäßler<br />
in die Reihe der großen deutschen Pädagogen, die bemüht waren, die<br />
Anregung des Bildungsreformators J.H. Pestalozzi (1746 – 1827) im deutschen<br />
Schulwesen zu verwirklichen. Roßmäßler forderte dazu, ähnlich wie F. A. W.<br />
Diesterweg (1790 – 1866), eine einheitliche Schulorganisation und Lehrerbildung<br />
sowie die staatliche Fachaufsicht statt kirchlicher Schulaufsicht. Im Gegensatz<br />
zu Diesterweg versteifte er sich jedoch auf die Vorstellung, dass bei der<br />
Förderung der Volksbildung die naturgeschichtliche Bildung eine Schlüsselrolle<br />
einnehmen müsse, eine Forderung, die in seiner Zeit utopisch erscheinen musste.<br />
Aber auch dort, wo Bereitschaft zur Unterstützung seiner Vorstellungen gegeben<br />
war, haben seine öfter auffallend polemischen Äußerungen und auch seine politischen<br />
Aktivitäten kritischer Distanz bis rigoroser Ablehnung Vorschub geleistet.<br />
Noch verstehen könnte man seine abwertenden Äußerungen über die Lehre und<br />
Bildung an den Hochschulen, schließlich hatte er selbst schlechte Erfahrungen<br />
gemacht, auch seine unsachlichen Bemerkungen über die Naturphilosophie<br />
43
von L. Oken (1779 – 1851) kann man überlesen, völlig unverständlich bleiben<br />
jedoch seine abfälligen Bemerkungen über den Chemiker Justus Freiherr von<br />
Liebig (1808 – 1873). Auch ist kaum zu verstehen, dass er, wieder in <strong>Leipzig</strong><br />
wohnend, kaum Kontakte zu Fachkollegen der <strong>Universität</strong> pflegte.<br />
Politisch war Roßmäßler ein unbeugsamer Demokrat des linken Spektrums.<br />
Wegen Aktivitäten in bürgerlich-demokratischen und Arbeiter-Vereinen stand<br />
er zeitweise unter polizeilicher Überwachung. Seine Vorträge wurden in einigen<br />
Städten untersagt, er selbst ausgewiesen. Ein ausführliches Aktenstück der<br />
Königlichen Kreisdirektion <strong>Leipzig</strong> des Innenministeriums über seine strafbaren<br />
Handlungen befindet sich im sächsischen Staatsarchiv. Franz Mehring schrieb<br />
in seiner „Geschichte der Sozialdemokratie“: „Er … hatte viel echtere Begriffe<br />
von Volksbildung als die sogenannte gebildete Bourgeoisie, war auch politisch<br />
radikaler als das banale Fortschrittlertum, blieb aber bei alledem in bürgerlichen<br />
Anschauungen befangen“. Dem Gedankengut von Karl Marx konnte Roßmäßler<br />
nicht folgen und äußerte sich dazu warnend gegenüber August Bebel.<br />
Emil Adolf Roßmäßler starb nach längerem Nieren- und Blasenleiden am<br />
8. April 1867 in <strong>Leipzig</strong>. Auf seinem letzten Weg zum neuen Johannisfriedhof<br />
begleiteten ihn in Liebe, Verehrung und Dankbarkeit hunderte <strong>Leipzig</strong>er Bürger.<br />
Viele seiner visionären Ziele sind heute Wirklichkeit, z. B. die Emanzipation der<br />
Arbeiter und Frauen, andere noch immer Probleme der internationalen Politik.<br />
Das nachfolgende Zitat von 1853 ist ein Beispiel dafür:<br />
44<br />
Die Behandlung der Waldungen schließt eine furchtbare Verantwortlichkeit<br />
in sich. Sie kann zum allergrößten Verbrechen an den kommenden<br />
Geschlechtern werden; denn sie kann diesen das Leben unmöglich machen.<br />
Günther H. W. Sterba
Eduard Friedrich Weber<br />
Zum 200. Geburtstag am 6. März <strong>2006</strong><br />
Eduard Friedrich Weber (1806 – 1871), einer der berühmten drei Weber-<br />
Brüder, war von 1836 bis zu seinem Tode Prosektor an der von seinem<br />
Bruder Ernst Heinrich Weber (1795 – 1878) geleiteten Anatomischen<br />
Anstalt der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>.<br />
45
Eduard Friedrich Wilhelm Weber erblickte am 6. März 1806 in Wittenberg<br />
als Sohn des Theologieprofessors Michael Weber und seiner Frau Christiane,<br />
geb. Lippold, das Licht der Welt. Von den 13 Kindern des Ehepaares Weber<br />
wurden später die drei Söhne Ernst Heinrich (1795 – 1878), Wilhelm Eduard<br />
(1804 – 1891) und Eduard Friedrich Wilhelm bedeutende Gelehrte.<br />
Eduard Weber studierte Naturwissenschaften und Medizin zuerst in <strong>Leipzig</strong><br />
und dann in Halle, wo er 1829 zum Doktor der Medizin promoviert wurde und<br />
nach Ablegen der Staatsprüfung ein Jahr als Assistent an der Klinischen Anstalt<br />
arbeitete. In Göttingen und Halle bereitete er sich darauf vor, Lehraufgaben in<br />
Anatomie und Physiologie übernehmen zu können. Das königlich-preußische<br />
Ministerium sicherte ihm aufgrund seiner wissenschaftlichen Befähigung und<br />
Strebsamkeit sogar ein jährliches Salär zu, wenn er in Halle die Venia legendi<br />
für Anatomie erwerben würde. Eduard Weber ließ daraufhin seine Habilitationsschrift<br />
„Quaestiones physiologicae de phaenomenis galvano-magneticis in<br />
corpore humano observatis“ drucken, ging aber dann doch vor Aufnahme einer<br />
Vorlesungstätigkeit in Halle 1836 als Prosektor an die Anatomische Anstalt der<br />
<strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>.<br />
In <strong>Leipzig</strong> hatte sein Bruder Ernst Heinrich im Jahr 1821, noch nicht 26 Jahre alt,<br />
in der Nachfolge von Johann Christian Rosenmüller die ordentliche Professur<br />
für Anatomie übernommen. Mit seinem Bruder Wilhelm, der später als einer der<br />
„Göttinger Sieben“ seinen Physik-Lehrstuhl verlieren sollte, hatte Ernst Heinrich<br />
bereits seine „Wellenlehre, auf Experimente gegründet oder über die Wellen<br />
tropfbarer Flüssigkeiten mit Anwendung auf die Schall- und Lichtwellen“ (<strong>Leipzig</strong><br />
1825) verfasst, in weiteren Arbeiten funktionelle Anatomie und Physiologie<br />
verbunden und als einer der ersten kausalanalytisches Denken und experimentelles<br />
Forschen an der <strong>Leipzig</strong>er Medizinischen Fakultät eingeführt.<br />
1833 starb der Prosektor Carl Bock sen., und nachdem verschiedene Bewerber<br />
um die Stelle eines Prosektors den Ansprüchen nicht genügt hatten bzw. durch<br />
Krankheit ausfielen, empfahl die Fakultät, dem Vorschlag von Ernst Heinrich<br />
Weber folgend, dessen Bruder Eduard einzustellen. Die bei dem Vorschlag<br />
ausgesprochene Hoffnung, dass aus diesem Zusammenwirken „Vorteil für die<br />
anatomische Anstalt und die Wissenschaft“ erwachsen würde, sollte sich auf<br />
hervorragende Weise erfüllen.<br />
Am 30. Mai 1836 wurde Eduard Friedrich Weber mit einem Jahresgehalt von<br />
200 Talern nebst einer persönlichen Zulage von 50 Talern zunächst für drei Jahre<br />
zum Prosektor an der Anatomischen Anstalt ernannt. 1839 und 1842 erneuerte<br />
46
man den Vertrag, wonach die Anstellung dauerhaft blieb, und 1846 wurde Eduard<br />
Friedrich Weber zum außerordentlichen Professor ernannt. In dieser Stellung<br />
blieb er bis zu seinem Tode am 18. Mai 1871.<br />
Sofort nach dem Dienstantritt in <strong>Leipzig</strong> übernahm Eduard Friedrich Weber<br />
einen Teil der Lehraufgaben; so leitete er gemeinsam mit seinem Bruder die<br />
Sezierübungen der Studenten, las im Winter über Knochen und Bänder und<br />
im Sommer über Anatomie und Physiologie des Nervensystems. Das war eine<br />
höchst erwünschte Entlastung für seinen Bruder Ernst Heinrich, der neben dem<br />
Direktorat der Anatomischen Anstalt und zusätzlichem Engagement als Kommunalpolitiker<br />
sowie als einer der Gründer der Polytechnischen Gesellschaft,<br />
der Gesellschaft der Wissenschaften und des sogenannten Professoriums im Jahr<br />
1840 zusätzlich noch den Lehrstuhl für Physiologie ohne Honorar übernommen<br />
hatte. Es ist auch davon auszugehen, dass beide Brüder gemeinsam die Pläne<br />
zum dringend nötigen Umbau bzw. des seit 1830 diskutierten Neubaus eines<br />
Anatomischen Institutes besprachen, wobei letzterer erst unter Webers Nachfolger<br />
Wilhelm His sen. realisiert wurde.<br />
Die Zusammenarbeit der Weber-Brüder wurde besonders fruchtbar, als Wilhelm<br />
Eduard Weber, berühmt durch seine Forschungen zur Akustik sowie die mit Carl<br />
Friedrich Gauß realisierte erste elektrische Telegrafen-Verbindung der Welt,<br />
im Jahr 1843 in <strong>Leipzig</strong> die Nachfolge des Physikprofessors Gustav Theodor<br />
Fechner antrat. Bereits 1836 hatte er gemeinsam mit Eduard eine Abhandlung<br />
über die „Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge“ verfasst, in der die Autoren<br />
mit einfachen physikalischen Mitteln, nämlich Tertienuhr und Fernrohr,<br />
die physiologischen Bewegungsabläufe beim Gehen und Laufen des Menschen<br />
registrierten und analysierten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bereicherten<br />
sowohl die Anatomie als auch die Kunst, und das „Lebensrad“, mit dem eine<br />
schnelle Folge von Phasenbildern eine Bewegung simulieren konnte, war eines<br />
der Grundelemente für die spätere Kinematographie. Die Idee des „Stemm- und<br />
Pendelbeins“ ist im wesentlichen bis heute gültig, wenn wir auch von „Stütz-<br />
und Spielbein“ sprechen.<br />
Wilhelm regte Eduard auch an, einen „magnetelektrischen Rotationsapparat“<br />
für die Versuche zur Muskelreizung zu verwenden. In seiner 1846 entworfenen<br />
„Muskelmechanik“ stellte Eduard fest, dass sich die Muskeln bei Reizung bis auf<br />
vier Fünftel ihrer Länge verkürzen. Der „magnetelektrische Rotationsapparat“<br />
diente den Anatomen-Brüdern Ernst Heinrich und Eduard Friedrich auch bei<br />
Untersuchungen zur Nervenphysiologie. Den Ruf als Pioniere einer „physikalischen<br />
Physiologie“ erwarben sich die Brüder aber vor allem auf der italienischen<br />
47
Naturforscherversammlung im Jahr 1845, als sie ihre Ergebnisse zur Steuerung<br />
der Herzaktion vortrugen, was damals als sensationell aufgenommen wurde.<br />
In einem Porträt von J. Kayser (der 1850 auch Ernst Heinrich Weber zeichnete)<br />
ist die Persönlichkeit von Eduard Friedrich Weber sehr schön erfasst. Der damals<br />
44-jährige Anatom ähnelt mit gelocktem Haar, Backenbart und modischer Halsbinde<br />
eher einem Künstler, und mit seinem wissenden, leicht amüsierten Lächeln<br />
hat er nichts gemein mit einer trockenen Gelehrtennatur. So tritt er uns auch auf<br />
der hier gezeigten Abbildung entgegen.<br />
Ingrid Kästner<br />
48
Karl-Sudhoff-Institut<br />
Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. April <strong>2006</strong><br />
Das 1906 aus privaten Stiftungsmitteln gegründete und 1938 nach seinem<br />
Gründer benannte Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der<br />
Naturwissenschaften ist das älteste medizinhistorische Institut der Welt.<br />
Es ist an der Medizinischen Fakultät angesiedelt und vermittelt dort den<br />
Studierenden die geisteswissenschaftlichen Aspekte der Medizin (medical<br />
humanities).<br />
49
Die Geschichte des <strong>Leipzig</strong>er Instituts für Geschichte der Medizin beginnt<br />
mit dem Nachlass Marie Caroline Cäcilie Puschmanns (1845 – 1901), der<br />
wohlhabenden Witwe des Wiener Medizinhistorikers Theodor Puschmann<br />
(1849 – 1899). Nach einem längeren Rechtsstreit mit der Familie der Erblasserin<br />
fielen im Mai 1903 schließlich 500.000 Mark an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, und<br />
zwar speziell zur „Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete der<br />
Geschichte der Medizin“. Durch einiges universitätsinternes Hin und Her bezüglich<br />
der Frage, an welcher Fakultät die Medizingeschichte verankert werden<br />
sollte, dauerte es über ein Jahr, bis am 21. Dezember 1904 vom akademischen<br />
Senat die relativ allgemein gehaltenen „Vorschriften für die Puschmann-Stiftung<br />
bei der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>“ beschlossen wurden: Ein interdisziplinäres Kuratorium<br />
sollte die Zinsen aus dem Stiftungskapital zweckgebunden verwalten. Nunmehr<br />
ergriff die Medizinische Fakultät die Initiative. Der amtierende Dekan, der<br />
Internist Heinrich Curschmann (1846 – 1910), nahm im Frühjahr 1905 zunächst<br />
inoffiziellen Kontakt mit Karl Sudhoff (1853 – 1938) auf, dem damals renommiertesten<br />
Medizinhistoriker.<br />
Sudhoff war zu dieser Zeit erfolgreich als niedergelassener Arzt in Hochdahl bei<br />
Düsseldorf tätig und erledigte seine medizinhistorischen Forschungen „nebenbei“<br />
in den frühen Morgenstunden. Er war ausgewiesener Paracelsus-Spezialist<br />
und hatte neben einer ansehnlichen Fachbibliothek auch eine umfangreiche<br />
private Sammlung von medizinischen Handschriften und Frühdrucken zusammengetragen.<br />
Obwohl die Professur mit erheblichen finanziellen Einbußen<br />
verbunden war, ergriff Sudhoff die Gelegenheit, die Medizingeschichte zu<br />
seinem Beruf zu machen und höchstpersönlich an der <strong>Universität</strong> zu etablieren;<br />
er begann im April 1906 seine Tätigkeit als „etatmäßiger außerordentlicher Professor“<br />
und erhielt erst 1919 das ersehnte Ordinariat. Sudhoffs medizinhistorische<br />
Forschungen in seinen <strong>Leipzig</strong>er Jahren waren philologisch orientiert, mit<br />
einem Schwerpunkt auf Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit. Er setzte auch<br />
nach seiner Emeritierung 1925 unermüdlich seine Arbeit fort, übernahm sogar<br />
1932 – 1934 noch einmal interimistisch die Leitung des Instituts. Außerdem begann<br />
Sudhoff mit dem Aufbau einer medizinhistorischen Sammlung, die bis heute<br />
ein besonderer Schatz des Instituts ist. Die Stiftungsmittel ermöglichten ferner<br />
den systematischen Ankauf der gesamten einschlägigen Fachliteratur, sodass in<br />
der Bibliothek auch relativ seltene ältere Titel zu finden sind.<br />
Sudhoffs Nachfolger war Henry Ernest Sigerist (1891 – 1957), ein polyglotter<br />
und weltgewandter Schweizer, der sich mit einem ihm von Sudhoff überlassenen<br />
Thema in Zürich habilitiert hatte. Er interessierte sich besonders für den<br />
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext der Medizin und öffnete das Institut<br />
50
für interdisziplinäre Veranstaltungen, die ein großes Publikum anzogen. Nach<br />
mehreren Umzügen standen seit 1916 in der Talstraße 38 ansehnliche Räumlichkeiten<br />
zur Verfügung, die sich nunmehr mit akademischem Leben füllten.<br />
Eine Studienreise in die USA 1931/32 führte Sigerist auch an das Institute of the<br />
History of Medicine an der Johns Hopkins University in Baltimore, wo er einen<br />
so positiven Eindruck hinterließ, dass ihn die dortige Fakultät einstimmig als<br />
Nachfolger des damals bereits 82-jährigen William H. Welch vorschlug. Sigerist<br />
erkannte das Wetterleuchten der sich ändernden politischen Verhältnisse in<br />
Deutschland und nahm den ehrenvollen Ruf nach Amerika an.<br />
Nach einem zweijährigen Vakuum, in dem die Verwaltungsaufgaben nahezu<br />
unerledigt geblieben waren, wurde im Oktober 1934 Walter von Brunn<br />
(1876 – 1952) auf den Lehrstuhl für Medizingeschichte berufen. Von Brunn hatte<br />
nach einer Armamputation im Ersten Weltkrieg seinen Beruf als Chirurg aufgeben<br />
müssen, sich der Medizingeschichte zugewandt und sich 1919 unter der<br />
Anleitung Sudhoffs gründlich in die Materie eingearbeitet; als „Brotberuf“ bis<br />
zur Berufung nach <strong>Leipzig</strong> diente ihm eine Stelle als Stadtschularzt in Rostock.<br />
Zunächst musste von Brunn die chaotischen Verhältnisse im Institut ordnen,<br />
1936 einen Umzug (in die Talstraße 33) organisieren und trotz gesundheitlicher<br />
Probleme und materieller Einschränkungen den Lehr- und Forschungsbetrieb<br />
neu aufbauen und unterhalten. 1938 wurde das Institut für Geschichte der<br />
Medizin nach seinem Gründer benannt, gedacht als Ehrung Sudhoffs zu seinem<br />
85. Geburtstag, den er allerdings nicht mehr erlebte. Der Zusatz „und der<br />
Naturwissenschaften“ sollte in Sudhoffs (und auch in Sigerists) Sinn die enge<br />
Verknüpfung von Medizin- und Wissenschaftsgeschichte signalisieren. Während<br />
der verheerende Luftangriff vom 4. Dezember 1943 das Institutsgebäude<br />
fast unversehrt gelassen hatte, gingen die nach Schloss Mutzschen ausgelagerten<br />
wertvollsten Bestände, darunter das durch von Brunn vorbildlich geordnete Archiv<br />
der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, in den Nachkriegswirren<br />
verloren. Es gelang von Brunn jedoch unter großem persönlichem Einsatz bis<br />
zu seiner Emeritierung 1950 (also mit 74 Jahren!), das Institut erfolgreich durch<br />
die schwierige Zeit zu lotsen und seinen nationalen und internationalen Ruf zu<br />
festigen.<br />
Nachfolger wurde der Direktor des Medizinisch-Poliklinischen Instituts, Felix<br />
Boenheim (1890 – 1960), der die Leitung zunächst für fünf Jahre kommissarisch<br />
innehatte und dann von 1955 – 1957 das Direktorat übernahm. Auf seine<br />
Initiative geht die Etablierung regelmäßiger Kolloquien zu wissenschaftshistorischen<br />
und -theoretischen Themen zurück, die dem internen Gedankenaustausch<br />
dienen, aber auch das Institut für Kontakte nach außen öffnen sollten, außerdem<br />
51
egann die Arbeit an einem neuen Lehrbuch zur Geschichte der Medizin. Der<br />
1. März 1957 bedeutete in der Institutsgeschichte insofern einen Einschnitt, als<br />
es seitdem zwei Abteilungen unter einem Dach gab, eine für Geschichte der Medizin<br />
und eine für Geschichte der Naturwissenschaften. Diese Umstrukturierung<br />
ging im Wesentlichen auf Gerhard Harig (1899 – 1966) zurück, der – 1951 bis<br />
1957 als Staatssekretär für Hochschulwesen beurlaubt – von 1957 bis 1966 die<br />
Leitung des Instituts innehatte.<br />
In den folgenden Jahrzehnten erwarb sich das Sudhoff-Institut internationales<br />
Ansehen durch seine fast schon legendäre Organisation von Arbeitskreisen,<br />
Kolloquien und Tagungen, durch wissenschaftliche Schriftenreihen (z. B. die<br />
‚Biografien bedeutender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner‘) und<br />
zahlreiche Lehrbücher (so zur Geschichte der Mathematik, Physik und Chemie)<br />
sowie durch die maßgebliche Beteiligung an der Herausgabe der wissenschaftshistorischen<br />
Zeitschrift ‚Naturwissenschaft, Technik und Medizin‘ (NTM). Mit<br />
Hans Wußing (geb. 1927, Institutsdirektor 1977 – 1982), der die Abteilung für<br />
Geschichte der Naturwissenschaften von 1969 – 1992 leitete, wurde vor allem<br />
die Mathematikgeschichte als Forschungsschwerpunkt ausgebaut. In der medizinhistorischen<br />
Abteilung, der von 1977 – 1996 Achim Thom (geb. 1935,<br />
Institutsdirektor 1982 – 1996) vorstand, wurde den Gebieten Geschichte der<br />
Arbeitsmedizin, Geschichte der Psychiatrie und Medizin im Nationalsozialismus<br />
besondere Beachtung geschenkt. Die Aufgaben in der Lehre waren – der<br />
gesellschaftlich-politischen Rolle der Geisteswissenschaften in der DDR<br />
entsprechend – vielfältig: Größtenteils als Pflichtveranstaltungen wurden Geschichte<br />
der Medizin und Zahnmedizin sowie Geschichte der Biologie, Chemie,<br />
Physik und Mathematik gelesen.<br />
In den letzten Jahren verschwand die traditionsreiche <strong>Leipzig</strong>er Wissenschaftsgeschichte<br />
nach und nach, nur ein Mathematikhistoriker ist von der ehemals<br />
großen Abteilung am Sudhoff-Institut übrig geblieben. In der Medizingeschichte<br />
sind in den letzten Jahren die Lehraufgaben gewachsen: Neben dem Terminologie-Kurs<br />
für Human-, Zahn- und Veterinärmedizin sind noch Geschichte der<br />
Veterinärmedizin sowie die Medizinethik dazu gekommen. Die Forschungthemen<br />
haben sich auf Fakultätsgeschichte, Gender Studies und mittelalterliche<br />
Medizin verlagert; die Schriftleitung der Zeitschrift ‚Das Mittelalter‘ hat hier<br />
ihren Sitz. Außerdem läuft ein erfolgreiches DFG-Projekt zu deutsch-russischen<br />
Wissenschaftsbeziehungen im 18. und 19. Jahrhundert. Nachdem die medizinhistorische<br />
Sammlung bereits 2003 mit einer umfangreichen Präsentation zum<br />
150. Geburtstag von Karl Sudhoff an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> in Erscheinung<br />
52
trat, ist für das vierte Quartal <strong>2006</strong> eine Ausstellung zur Institutsgeschichte in der<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek Albertina geplant.<br />
Ortrun Riha<br />
53
Friedrich Wilhelm Ritschl<br />
Zum 200. Geburtstag am 6. April <strong>2006</strong><br />
Der Klassische Philologe Friedrich Ritschl wirkte nach seinem Studium in<br />
<strong>Leipzig</strong> und Halle und nach Professuren in Breslau und Bonn in seinem<br />
letzten Lebensjahrzehnt (1865 – 1876) als Ordinarius an der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Leipzig</strong>. Seine Studien zu dem römischen Komödiendichter Plautus und<br />
zum Altlatein sichern ihm einen dauerhaften Platz in der Geschichte der<br />
Klassischen Philologie. Darüber hinaus war Ritschl der wohl einflussreichste<br />
akademische Lehrer seines Fachs im 19. Jahrhundert.<br />
55
56<br />
Was mit ihm, abgesehen von allem persönlichen Verluste, überhaupt verloren<br />
gegangen ist, ob nicht in ihm der letzte große Philologe zu Grabe<br />
getragen wurde – das weiß ich nicht mit Sicherheit zu beantworten. Aber<br />
ob die Antwort so oder ganz anders ausfalle – daß in seinen Schülern eine<br />
nie erhörte Fruchtbarkeit seiner Wissenschaft verbürgt sei –, jede Antwort<br />
fällt zu seiner Ehre aus: es ist ein gleich großer Ruhm, der letzte der<br />
Großen oder der Vater einer ganzen großen Periode zu heißen.<br />
Mit diesen Worten gedenkt Friedrich Nietzsche seines am 9. November 1876 in<br />
<strong>Leipzig</strong> verstorbenen Lehrers Friedrich Ritschl in einem Brief an dessen Witwe<br />
Sophie vom Januar 1877.<br />
Geboren wurde Friedrich Ritschl am 6. April 1806 im thüringischen Groß-Vargula<br />
bei Erfurt als Sohn eines Pfarrers. Er studierte Philologie in <strong>Leipzig</strong> bei<br />
Gottfried Hermann und in Halle bei Karl Christian Reisig, wo er sich 1829 als<br />
Vierundzwanzigjähriger habilitierte und 1832 zum Extraordinarius ernannt wurde.<br />
1833 folgte er einem Ruf an die <strong>Universität</strong> Breslau. Dort heiratete er 1838<br />
Sophie Guttentag; die beiden hatten zwei Töchter und einen Sohn. Im Jahr 1839<br />
wechselte Ritschl an die <strong>Universität</strong> Bonn, wo er bis 1865 als Ordinarius wirkte.<br />
Nach Konflikten mit seinem dortigen Kollegen Otto Jahn folgte er 1865 einem<br />
Ruf nach <strong>Leipzig</strong>. Dort lehrte Ritschl bis zu seinem Tod am 9. November 1876.<br />
Obwohl Ritschls wissenschaftlicher Ruhm vor allem auf seinen Forschungen<br />
in der lateinischen Philologie, insbesondere zu Plautus und zum Altlateinischen<br />
beruht, sind seine frühesten wissenschaftlichen Arbeiten dem Griechischen gewidmet:<br />
Bis heute nicht ersetzt ist Ritschls Ausgabe der Ecloga vocum Atticarum<br />
des Thomas Magister (Halle 1832), eines attizistischen Lexikons aus dem frühen<br />
14. Jahrhundert. 1838 erschien dann in Breslau seine Arbeit über „Die Alexandrinischen<br />
Bibliotheken und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch<br />
Pisistratus“, die Karl Lehrs, einer der besten Kenner der antiken Homerphilologie<br />
im 19. Jahrhundert, als „goldenes Büchlein“ gepriesen hat. Ausgangspunkt<br />
ist ein neues Zeugnis zur antiken Philologiegeschichte, welches Ritschl in dieser<br />
Arbeit erstmals vollständig aus einer römischen Handschrift mitteilte und welches<br />
ihn veranlasste, auf die Geschichte der Bibliothek von Alexandria und das<br />
Zustandekommen des Homertextes einzugehen.<br />
Seit der Bonner Zeit steht jedoch der altlateinische Komödiendichter Plautus<br />
(ca. 250 – 180 v. Chr.) im Zentrum von Ritschls wissenschaftlichem Schaffen.<br />
Den entscheidenden Impuls zu einer lebenslangen Beschäftigung mit diesem<br />
Dichter hatte eine Italienreise in den Jahren 1836 bis 1837 gegeben: In Mailand
kollationierte Ritschl die umfangreichen Reste einer bislang für die Forschung<br />
nur höchst unzureichend erschlossenen antiken Plautushandschrift, die zu einem<br />
späteren Zeitpunkt palimpsestiert, d. h. mit einem anderen Text überschrieben<br />
worden war. Ritschl erkannte sofort, dass der Text des Mailänder Palimpsests<br />
für die Überlieferung des Plautus den gleichen Wert besaß wie die gesamte<br />
übrige Überlieferung des Mittelalters und dass die vielen neuen Lesarten dieser<br />
Handschrift eine grundsätzlich kritischere, strenge metrische Gesetzmäßigkeit<br />
voraussetzende Konstitution des Komödientextes erforderlich machte. Der Vorbereitung<br />
dieser Ausgabe galt fortan die ganze Kraft des Forschers Ritschl: 1845<br />
erschienen als wichtigste Vorarbeit seine ‚Parerga Plautina et Terentiana‘, die<br />
bis heute nichts von ihrer Frische eingebüßt haben und noch 1965 nachgedruckt<br />
worden sind. Ihre literatur- und überlieferungsgeschichtlichen Ergebnisse sind<br />
längst Allgemeingut der Latinistik geworden. 1848 veröffentlichte Ritschl als<br />
erste plautinische Komödie den Trinummus mit den berühmten ‚Prolegomena‘,<br />
einem 330 Seiten umfassenden editorischen Vorwort: Zum ersten Mal ist<br />
in dieser Ausgabe mit der Jahrhunderte alten Vulgata gebrochen und der Text<br />
auf der methodisch einzig statthaften Grundlage, nämlich dem exakt erfassten<br />
Zeugnis der relevanten handschriftlichen Überlieferung, errichtet. Auf den<br />
Trinummus folgten bis 1858 acht weitere Komödien; nach einer längeren Unterbrechung<br />
setzte Ritschl die Gesamtausgabe 1871 mit drei <strong>Leipzig</strong>er Schülern,<br />
Georg Goetz, Gustav Löwe und Friedrich Schöll, fort, welche diese 1894 zum<br />
Abschluss brachten. In der Zwischenzeit hatte Ritschl versucht, seinen Plautusstudien<br />
eine noch breitere Grundlage zu geben, indem er zur Sicherung der plautinischen<br />
Sprache weitere Zeugnisse des Altlateins heranzog. Auch wenn sich<br />
der Gewinn für Plautus im Nachhinein als geringer erweisen sollte, als Ritschl<br />
gehofft hatte, bedeutete die Erschließung des altlateinischen Sprachmaterials<br />
durch Ritschls Sammlung der lateinischen Inschriften aus republikanischer Zeit<br />
in seinem monumentalen, 1862 erschienenen und 1968 nachgedruckten Werk<br />
‚Priscae latinitatis monumenta epigraphica‘ einen Meilenstein für die lateinische<br />
Epigraphik und die Erforschung der lateinischen Sprachgeschichte. Zwar hat<br />
Ritschl den Abschluss seiner großen Plautus-Ausgabe nicht mehr erlebt; der Ehrentitel<br />
des ‚sospitator Plauti‘, des „Retters des Plautus“, den ihm seine ‚Parerga‘<br />
einbrachten, steht ihm dennoch zu: Seine Arbeiten haben dazu geführt, dass in<br />
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Plautus im Zentrum der lateinischen<br />
Philologie gestanden hat. Dank der weiteren Arbeiten seiner Schüler ebenso<br />
wie seiner Gegner war um 1900 ein Kenntnisstand der plautinischen Metrik und<br />
Sprache erreicht, über den das 20. Jahrhundert nur wenig hinausgelangt ist.<br />
Noch wirkungsreicher als seine Forschung und seine Publikationen ist Ritschls<br />
Tätigkeit als akademischer Lehrer gewesen, der er im übrigen auch selbst die<br />
57
größere Bedeutung zugewiesen hat: „In erster Linie steht, für Schule wie für<br />
<strong>Universität</strong>, daß einer Lehrer sei, erst in zweiter, daß Gelehrter.“ Der Einfluss<br />
seiner Lehre liegt wenigstens teilweise in Ritschls wissenschaftlicher Methode<br />
begründet, die nicht nur seine Publikationen, sondern auch seine Seminare prägte<br />
und später als „Bonner Schule“ bekannt geworden ist. Ritschls Methode fußt<br />
auf einer sorgfältigen Feststellung und kritischen Prüfung der Überlieferung,<br />
zieht im Gegensatz zu bloßer Wortphilologie immer auch inschriftliches Material<br />
und archäologische Funde heran und zielt letztlich auf eine „Reproduction des<br />
classischen Alterthums durch Anschauung und Erkenntniß aller seiner Aeußerungen“.<br />
Diese Gesamtsicht der antiken Zeugnisse vermittelte Ritschl jedoch in<br />
seinen Publikationen und Seminaren nicht bloß als ein Ergebnis, sondern er war<br />
stets bemüht, seine Leser und Zuhörer gleichsam seinen eigenen Erkenntnisweg<br />
nachschreiten zu lassen und sie dadurch zur eigenen, kritischen Analyse anzuregen.<br />
Zu dieser Lehrmethode, die für die Studenten in den Vorlesungen und mehr<br />
noch in den berühmten Seminaren Forschung erlebbar und lebendig machte, trat<br />
das große Charisma des Philologen hinzu, das auf seine Schüler geradezu elektrisierend<br />
wirkte und das seinen wohl bekanntesten Schüler, Friedrich Nietzsche, in<br />
Ecce homo zu der Aussage veranlasste, Ritschl sei „der einzige geniale Gelehrte,<br />
den ich bis heute zu Gesicht bekommen habe“.<br />
Ritschl verstand es jedoch nicht nur, „den eigenen Geistesfunken auf andere zu<br />
übertragen“ (so die Beschreibung seines Schülers Otto Ribbeck, dem wir eine<br />
bis heute grundlegende zweibändige Ritschl-Biographie verdanken), sondern<br />
es gelang ihm auch, früh die Neigungen und Fähigkeiten seiner Studenten zu<br />
erkennen, zu lenken und zu fördern. Mit großer Umsicht und gutem Gespür<br />
setzte er sie auf besondere Desiderata der Wissenschaft an, so z. B. Vahlen auf<br />
die Fragmente des Ennius, Ribbeck auf die Fragmente des frühen römischen<br />
Dramas, Schöll auf das 12-Tafel-Gesetz, Wilmanns auf die grammatischen Fragmente<br />
Varros und Reifferscheid auf die Reste der verlorenen Schriften Suetons.<br />
Die daraus hervorgegangenen Arbeiten waren lange Standardwerke der Klassischen<br />
Philologie, und einige von ihnen sind sogar bis heute nicht ersetzt (so<br />
z. B. die Ausgaben Ribbecks und Reifferscheids). Dank der großen Zahl seiner<br />
Schüler – an den Symbola Philologorum Bonnensium (1864), einer Festschrift<br />
zu Ehren der 25jährigen Lehrtätigkeit Ritschls in Bonn, waren schon 43 ehemalige<br />
Schüler, in der Mehrzahl <strong>Universität</strong>sprofessoren, beteiligt! – wurde Ritschl<br />
automatisch zu einem der wichtigsten Wissenschaftsorganisatoren des 19. Jahrhunderts<br />
in Deutschland. Diese Rolle spielte er auch außerhalb seines Schülerkreises,<br />
indem er mehrere altertumswissenschaftliche Großprojekte anstieß oder<br />
förderte. Als Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften setzte sich<br />
Ritschl zusammen mit Theodor Mommsen erfolgreich für die Veröffentlichung<br />
58
der lateinischen Inschriften im Corpus Inscriptionum Latinarum ein, einem bis<br />
heute weitergeführten Standardwerk der gesamten Altertumswissenschaft. Ähnliche<br />
Verdienste erwarb sich Ritschl um das Wiener Corpus der Kirchenväter<br />
und um die in <strong>Leipzig</strong> angesiedelte Reihe der Bibliotheca Scriptorum Graecorum<br />
et Romanorum Teubneriana.<br />
Marcus Deufert, Jan Felix Gaertner<br />
59
Albrecht Alt<br />
Zum 50. Todestag am 24. April <strong>2006</strong><br />
Albrecht Alt (1883 – 1956) war ein bedeutender Alttestamentler und Orientalist,<br />
der von 1923 bis zu seinem Tode an der <strong>Leipzig</strong>er Theologischen<br />
Fakultät lehrte. Er war Ehrendoktor mehrerer Fakultäten, Mitglied des<br />
Deutschen Archäologischen Instituts und Ehrenmitglied der amerikanischen<br />
Society of Biblical Literature and Exegesis. Durch die Einführung der territorialgeschichtlichen<br />
Betrachtungsweise in die Palästinakunde hat er wesentliche<br />
Beiträge zum Verständnis der Geschichte Israels geleistet.<br />
61
Der 50. Todestag von Albrecht Alt (20. September 1883 – 24. April 1956) gibt<br />
Gelegenheit, eines Mannes zu gedenken, der zu den prägenden Gestalten der<br />
alttestamentlichen Wissenschaft des 20. Jahrhunderts in Deutschland gehörte<br />
und weit über die Grenzen seines Faches und Heimatlandes als Lehrer und Wissenschaftler<br />
geachtet und verehrt wurde. In den 33 Jahren seines Wirkens an der<br />
<strong>Leipzig</strong>er Theologischen Fakultät war er ein Magnet, der viele Studierende in die<br />
Hörsäle lockte. In seinen letzten Lebensjahren opferte er seine Semesterferien<br />
und las viermal ein volles Semesterprogramm in Tübingen, zweimal außerdem<br />
noch in Göttingen und Heidelberg, indem er in der Woche mit der Bahn hin- und<br />
zurückfuhr. Nicht nur Studierende der Theologie und Orientalistik füllten die<br />
Bänke, sondern auch Kollegen und Freunde, „um ihn zu hören, wie er es sagte“<br />
(S. Herrmann). Die Faszination, die von seiner Person ausging, wird von seinen<br />
Schülern und Kollegen eindrücklich beschrieben. Persönlich anspruchslos, war<br />
er ein Mann von „unbedingter Lauterkeit und Wahrhaftigkeit“, der „gerecht<br />
und fair“ (R. Smend) urteilte und dessen Verhältnis zur Lehre und Forschung<br />
mit dem Wort „Hingabe“ (W. F. Albright) charakterisiert werden kann. Für die<br />
Lehre bedeutete das zunächst, dass er ein hohes Maß an Lehrveranstaltungen<br />
wahrnahm. Er hielt regelmäßig zwei vierstündige Hauptvorlesungen, oft auch<br />
noch eine Spezialvorlesung zu einem Thema außerhalb des Curriculums, dazu<br />
ein Hauptseminar und eine Übung an der biblisch-archäologischen Sammlung.<br />
Von 1941 – 1947 musste er die alttestamentliche Wissenschaft einschließlich<br />
des Hebräischunterrichts allein vertreten und hat durchschnittlich 20, nach eigenen<br />
Angaben gelegentlich sogar 29 Wochenstunden gehalten. Sowohl sein<br />
jüngerer Kollege, der Extraordinarius Joachim Begrich, als auch sein Assistent<br />
Werner Müller waren zum Heeresdienst eingezogen worden. Beide sind gefallen,<br />
und erst zum Sommersemester 1948 erhielt Alt mit Hans Bardtke wieder<br />
Unterstützung. Eindrucksvoll war aber auch die Art, wie Alt lehrte. Er „las“ nicht<br />
nur, sondern gestaltete die Vorlesungen mit vollem stimmlichem Einsatz und<br />
einem gewissen schauspielerischen Talent. Für Rat und Hilfe stand er stets zur<br />
Verfügung. Zu seinem 70. Geburtstag lohnten die Studenten sein Engagement<br />
mit einem Fackelzug, während Kollegen und Schüler in Ost und West den Wissenschaftler<br />
mit zwei Festschriften ehrten.<br />
Die außerordentlichen Lehrerfolge Alts wären ohne seine Hingabe an die Forschung<br />
undenkbar gewesen. Alt entsagte aller Ablenkung und widmete sich<br />
einem Thema, das man mit Fug und Recht als sein Thema bezeichnen kann: die<br />
Palästinawissenschaft in umfassendem Sinn, aber nicht um ihrer selbst willen,<br />
sondern in steter Beziehung auf das Alte Testament. Für dieses Thema war er,<br />
als er 1923 seine Lehrtätigkeit in <strong>Leipzig</strong> begann, glänzend vorbereitet. Der in<br />
Stübach in Mittelfranken geborene Pfarrerssohn hatte eine solide humanistische<br />
62
Ausbildung am Progymnasium in Neustadt an der Aisch und am Gymnasium in<br />
Ansbach erhalten und anschließend von 1902 – 1906 in Erlangen und <strong>Leipzig</strong><br />
evangelische Theologie und orientalische Philologie studiert. Danach besuchte<br />
er von 1906 – 1908 das Predigerseminar in München. Als Stipendiat seiner<br />
bayrischen Landeskirche wurde der Predigtamtskandidat 1908 für fünf Monate<br />
zu einem Lehrkurs des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft<br />
des Heiligen Landes in Jerusalem entsandt. Die Grunderfahrung des<br />
Landes Palästina sollte ihn hinfort nicht mehr loslassen. Der dort unter Leitung<br />
von Gustaf Dalman empfangene Anschauungsunterricht über Aufgaben und<br />
Methoden der Erforschung des Alten Orients wurde für sein weiteres Leben<br />
entscheidend. Er beschloss, sich „ganz der wissenschaftlichen Arbeit am Alten<br />
Testament und an den orientalischen Nachbarfächern (besonders Ägyptologie,<br />
Assyriologie und altorientalische Archäologie) zu widmen“ (Alt).<br />
Der Entschluss fiel in eine Zeit, in der die noch junge Assyriologie beachtliche<br />
Erfolge erzielte und der Streit um die Abhängigkeit des Alten Testaments von<br />
der literarischen Hinterlassenschaft des Zweistromlandes (sog. Babel-Bibel-<br />
Streit) voll entbrannte. Dieser Streit stieß Alt ab. Er ging daher nach seiner<br />
Rückkehr aus Palästina, wo er auch Arabisch gelernt hatte, und nachdem er eine<br />
Anstellung als Inspektor des Theologischen Studienhauses in Greifswald angetreten<br />
hatte, sogleich an die Ausarbeitung einer Promotionsschrift, die sich den<br />
politischen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten widmete. 1909 erwarb<br />
er mit dieser Dissertation, die ihn auch als kundigen Ägyptologen auswies, die<br />
theologische Licentiatenwürde der <strong>Universität</strong> Greifswald. Zugleich habilitierte<br />
er sich dort als Privatdozent. 1912 wurde er zum planmäßigen außerordentlichen<br />
Professor ernannt. Im Winter 1912 – 1913 weilte er – nunmehr als Mitarbeiter<br />
Dalmans – wieder am Jerusalemer Institut. 1914 verlieh ihm die Greifswalder<br />
Fakultät den theologischen Ehrendoktor. Im gleichen Jahr erfolgte seine Berufung<br />
als ordentlicher Professor nach Basel. Die Baseler haben ihn aber sogleich<br />
wieder entbehren müssen, da er als deutscher Staatsbürger von 1914 – 1918 zum<br />
Kriegsdienst eingezogen wurde, zunächst ein Jahr lang in der Heimat als Sanitätsunteroffizier,<br />
dann 1916 – 1918 bei den der türkischen Armee unterstellten<br />
deutschen Truppen in Syrien und Palästina, wo er zuletzt in Nazareth als wissenschaftlicher<br />
Beamter für kartographische Arbeiten zuständig war. 1921 erreichte<br />
ihn in Basel ein Ruf als Ordinarius an die Theologische Fakultät in Halle (Saale),<br />
die ihn aber nur im Sommersemester 1921 sah, denn in demselben Jahr erhielt er<br />
auch die Berufung nach <strong>Leipzig</strong>, die er annahm, da ihm die <strong>Leipzig</strong>er Orientalistik<br />
ein günstiger Rahmen für die eigene Arbeit zu sein schien.<br />
63
Alt trat die <strong>Leipzig</strong>er Professur jedoch nicht sofort an, sondern ließ sich zunächst<br />
von 1921 – 1923 nach Jerusalem beurlauben, um dort als Direktor des Deutschen<br />
Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes und als<br />
Propst der deutschen evangelischen Gemeinde der Erlöserkirche die deutschen<br />
kirchlichen und wissenschaftlichen Beziehungen auszubauen. Damit war das<br />
Fundament für die äußerst fruchtbare Verbindung von Lehre und Forschung<br />
gelegt, die seine Tätigkeit ab 1923 in <strong>Leipzig</strong> auszeichnen sollte. Jeweils in den<br />
Sommerferien veranstaltete Alt von 1924 bis 1933 Lehrkurse des Jerusalemer<br />
Instituts, über die er im Palästinajahrbuch zu berichten pflegte, und trieb eigene<br />
territorialgeschichtliche und topographische Studien. Seine Lehrkurse genossen<br />
legendären Ruf. Vorwiegend jüngere deutsche Gelehrte, aber auch solche aus der<br />
Schweiz, den Niederlanden, aus Dänemark, Finnland und Amerika wurden von<br />
ihm in die Palästinawissenschaft eingeführt. Die Vielseitigkeit der Institutsarbeit<br />
war wiederum Gewinn aus einem Verzicht. Alt hat selbst keine Ausgrabungen<br />
vorgenommen oder sich daran beteiligt. Die archäologische Arbeit beschränkte<br />
sich auf die Oberflächenforschung in Form der Auswertung der Keramik. Seit<br />
1925 war Alt Vorsitzender des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas<br />
und von 1927 bis 1941 Herausgeber des Palästinajahrbuches. Die deutschen Verhältnisse<br />
seit 1934 verhinderten die Fortsetzung der Lehrkurse. Nur 1935 weilte<br />
Alt noch einmal zu einer Forschungsaufgabe in Palästina, danach bis zu seinem<br />
Tode nicht mehr. Aber auch als der Weg nach Palästina verschlossen blieb, hat<br />
er, nun auf literarische Art, an der Palästinaforschung weiterhin maßgeblich<br />
teilgehabt.<br />
In das Jahrzehnt nach seinem Beginn in <strong>Leipzig</strong> fallen die wichtigsten und<br />
grundlegendsten Arbeiten Alts. Es sind zum ganz überwiegenden Teil Arbeiten<br />
zur Geschichte Israels. In ihnen gelangte er zu fundamentalen Thesen über die<br />
Entstehung und Struktur des alten Israel und seines Rechts. Religionsgeschichtliche<br />
Arbeiten sind in der Minderzahl, aber auch dort hat er eine Diskussion<br />
angestoßen, die bis heute fortdauert. Alt war in erster Linie Historiker, freilich<br />
„theologischer Historiker“, wie er sich gern selbst genannt haben soll, denn<br />
er blieb immer auch Exeget des Alten Testaments. Zwei seiner wichtigsten<br />
Arbeiten analysieren Prophetentexte (Jesaja 8,23-9,6 und Hosea 5,8-6,6) und<br />
versuchen, sie von einem möglichen historischen Hintergrund her zu verstehen.<br />
Er arbeitete mit an der dritten Auflage der „Biblia Hebraica“ von Rudolf<br />
Kittel, einer textkritischen Ausgabe des Alten Testaments, und deren weiteren<br />
Auflagen. Zu Recht gilt Alt aber als Klassiker der Geschichte des Volkes Israel<br />
und seiner Nachbarn, ohne freilich je ein zusammenfassendes Werk dieses Titels<br />
geschrieben zu haben. Es gibt keine dickleibigen Bücher aus seiner Feder. Er bevorzugte<br />
die kleine Form des Aufsatzes, war „seinem Wesen nach Essayist“ (M.<br />
64
Weippert). Ein häufig überliefertes Bonmot von ihm lautet: „Was man nicht auf<br />
hundert Seiten sagen kann, läßt sich überhaupt nicht sagen!“ (S. Herrmann) Seine<br />
Publikationsform war daher nicht auf eine breite Öffentlichkeit ausgerichtet:<br />
Reformationsprogramme der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, Akademieberichte, Beiträge<br />
in Festschriften und Fachzeitschriften. Erst spät entschloss er sich, eine Auswahl<br />
seiner wichtigsten Aufsätze in einer dreibändigen Ausgabe („Kleine Schriften<br />
zur Geschichte des Volkes Israel“, 1953 – 1959), deren dritter Band erst nach<br />
seinem Tode erschien, einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen.<br />
Wenn seine Gedanken und mit Phantasie entwickelten Hypothesen dennoch nicht<br />
nur einem engen Kreis von Fachgelehrten bekannt wurden, so liegt das wohl daran,<br />
dass er seine Studenten und Assistenten an der Entwicklung seiner Gedanken<br />
teilhaben ließ. Vor allem durch seine hervorragende Kenntnis der Landschaft<br />
gelang es ihm, das Land sprechen zu lassen. Seine „territorialgeschichtliche<br />
Betrachtungsweise“ ging davon aus, dass „die einmal geschaffenen territorialen<br />
Ordnungen in aller Welt sehr zäh an ihrem Boden zu haften pflegen und in der<br />
Regel auch bei scheinbar tiefgreifenden Umgestaltungen sozusagen unter der<br />
Decke noch fortbestehen“ (Kleine Schriften II, 440). Die Gesamtdarstellungen<br />
der Geschichte Israels schrieben seine Schüler Martin Noth, Siegfried Herrmann<br />
und Herbert Donner, eine Theologie der Überlieferungen Israels Gerhard von<br />
Rad. Beim Ausbau der Thesen Alts zeigte es sich, dass nicht alles der Kritik<br />
gewachsener Kenntnisse standhalten konnte. Alt war sich der „engen Grenzen<br />
des wissenschaftlich Erreichbaren“ durchaus bewusst. Doch seine Arbeiten sind<br />
von bleibendem heuristischem Wert und Musterbeispiele für den sorgfältigen<br />
Umgang mit den Quellen geblieben. Das Wegweisende dieser Arbeiten zeigt<br />
sich nicht zuletzt darin, dass zwei philosophische (<strong>Leipzig</strong>, Tübingen) und eine<br />
juristische Fakultät (Frankfurt/Main) ihn zu ihrem Ehrendoktor machten.<br />
Dietmar Mathias<br />
65
Institut für Pathologie<br />
Zum 100. Jahrestag der Eröffnung am 5. Mai <strong>2006</strong><br />
Das Pathologische Institut der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> an der Ecke Liebigstraße/<br />
Johannisallee begeht <strong>2006</strong> das Jubiläum seines 100-jährigen Bestehens.<br />
Das Jugendstilgebäude gehört funktionell und architektonisch zu den bedeutenden<br />
Einrichtungen im <strong>Leipzig</strong>er Medizinischen Viertel.<br />
67
Was geht uns durch den Kopf, wenn wir das Wort Pathologie hören? Dem<br />
Begriff haftet etwas unbestimmt Gruseliges an, verbunden mit Krankheit, Tod,<br />
Endgültigkeit. Daran werden viele Menschen nicht gern erinnert. Dennoch ist<br />
die Pathologie, abgeleitet von Pathos und Logos, als Lehre von den Krankheiten<br />
aus unserem Leben nicht wegzudenken. Sie nimmt zu Recht einen hohen Stellenwert<br />
innerhalb der medizinischen Wissenschaft ein.<br />
Das erste Pathologische Institut wurde 1871, zeitgleich mit der Eröffnung des<br />
neuen „Städtischen Krankenhauses zu St. Jakob“ an der Waisenhausstraße, der<br />
heutigen Liebigstraße, eingeweiht. Die als gemeinsame Einrichtung von Stadt<br />
und <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> betriebene sogenannte „Anlage im Barackenstil“ bildete<br />
den Ausgangspunkt für den Hauptstandort der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>smedizin.<br />
Zum Jakobshospital gehörten ein Zentralgebäude, in dem die Verwaltung und<br />
die Privatstationen untergebracht waren, und die eigentlichen Baracken, in denen<br />
sich die Stationen für Innere Medizin und Chirurgie befanden. Diese waren untereinander<br />
und mit dem Zentralgebäude durch ein überdachtes Korridorsystem<br />
verbunden und gruppierten sich um eine Gartenanlage. Unter funktionellen Aspekten<br />
war das weitläufige Barackensystem zur damaligen Zeit höchst sinnvoll.<br />
Wenn man bedenkt, dass die von dem ungarischen Arzt Ignatz Semmelweis<br />
(1818 – 1865) eingeführte Methode des Händewaschens vor chirurgischen<br />
bzw. geburtshilflichen Eingriffen erst seit 1847 Verbreitung fand und dass das<br />
Carbol-Spray erstmals 1868 durch Joseph Lister (1827 – 1912) in Glasgow zur<br />
Anwendung gebracht wurde, lässt sich leicht schlussfolgern, dass Antisepsis und<br />
erst recht Asepsis zum Zeitpunkt der Erbauung des neuen Jakobshospitals kaum<br />
bzw. noch gar nicht bekannt waren und sich erst in der Folgezeit durchsetzten.<br />
Die Ansteckungsgefahr versuchte man zu verringern, indem man Patienten mit<br />
verschiedenen Krankheitsbildern durch separate Unterbringung voneinander<br />
trennte. Da der Luftbehandlung ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen<br />
wurde, führte von jeder Baracke eine Veranda in den Park. Als zentraler Punkt<br />
des Parks und als Schnittpunkt der Hauptwege wurde der noch heute existierende<br />
Springbrunnen angelegt. Wirtschaftsgebäude wie die Wäscherei, die Schlosserei<br />
und das Heizhaus ergänzten die Anlage.<br />
In unmittelbarer Nachbarschaft des Jakobshospitals befanden sich an der Liebigstraße<br />
außerdem bereits die Physiologische Anstalt (1869 eröffnet), das nicht zur<br />
Medizinischen Fakultät gehörende Chemische Institut (ebenfalls 1869 eröffnet)<br />
und das bereits erwähnte Pathologische Institut. Den Baugrund, auf dem das<br />
zweistöckige Gebäude errichtet worden war, hatte die Stadt <strong>Leipzig</strong> unentgeltlich<br />
zur Verfügung gestellt. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 36.380 Taler<br />
(etwa 110.000 Mark). Nur wenige Jahre nach seiner Einweihung wurde das<br />
68
Gebäude mehrfach umgebaut. Die größte Veränderung betraf den Aufbau eines<br />
weiteren Stockwerkes, der das 1878 neu gegründete Hygieneinstitut aufnahm,<br />
sowie den Anbau eines großen Hörsaals an der Rückfront des Gebäudes. Da<br />
beide Institute qualitativ und quantitativ immer mehr Aufgaben zu bewältigen<br />
hatten, erwiesen sich die Umbauten jedoch als unzureichend. Forderungen nach<br />
räumlicher Trennung von Pathologie und Hygiene wurden an der Wende vom<br />
19. zum 20. Jahrhundert deshalb immer dringlicher. Unter Berücksichtigung der<br />
konkreten Vorschläge des seit 1900 im Amt befindlichen Direktors des Pathologischen<br />
Instituts Felix Marchand (1846 – 1928), dessen Büste noch heute im<br />
Treppenhaus des Instituts steht, bewilligte das Königliche Ministerium in Dresden<br />
im Mai 1903 schließlich die Mittel für den Neubau eines Pathologischen Instituts.<br />
Das bisherige Gebäude wurde durch das Hygieneinstitut genutzt. Für den<br />
Neubau des Pathologischen Instituts stellte die Stadt <strong>Leipzig</strong> das Grundstück an<br />
der Ecke Johannisallee/Liebigstraße gegen eine jährliche Abfindung von 3.000<br />
Mark zur Verfügung. Die Baukosten wurden auf 800.000 Mark festgesetzt. Nach<br />
den Bauzeichnungen des <strong>Leipzig</strong>er Architekten Theodor Kösser (1854 – 1926),<br />
von dem u. a. auch das Messehaus Mädlerpassage stammt, entstand in kurzer<br />
Zeit ein moderner und formschöner Jugendstilbau. Dieser wurde etappenweise<br />
in Betrieb genommen.<br />
Das Richtfest fand am 20.07.1904 statt. Die Sektionsräume und die beiden<br />
Hörsäle konnten am 01.11.1905 zur Benutzung freigegeben werden. Der erste<br />
Hörsaal, in dem die Vorlesungen für pathologische Anatomie abgehalten wurden,<br />
befand sich im Ostflügel des Instituts und reichte bis ins Dachgeschoss.<br />
Der zweite Hörsaal lag im Mittelbau des Instituts und diente zur Durchführung<br />
klinischer Demonstrationskurse. Die feierliche Einweihung des gesamtem Gebäudes<br />
fand am 5. Mai 1906 statt. Neben den Funktions- und Unterrichtsräumen<br />
konnten nun auch die wertvolle Sammlung und die Bibliothek sachgerecht<br />
untergebracht und deren Bestände in ansprechenden Räumen aufgestellt werden.<br />
Weiterhin gab es einen großen Mikroskopiersaal, Arbeitszimmer für die<br />
Mitarbeiter, verschiedene Tierställe sowie Vorrats-, Wirtschafts- und Wohnräume.<br />
In den Neubau des Instituts für Pathologie sollte eigentlich auch das 1900<br />
gegründete Institut für Gerichtsmedizin als gleichberechtigter Untermieter mit<br />
einziehen. Aus Kostengründen erhielt es zunächst aber nur einige Zimmer im<br />
Erdgeschoss des Westflügels. Für die spätere Erweiterung wurde eine Baulücke<br />
an der Johannisallee frei gelassen. Die endgültige Fertigstellung des Gebäudekomplexes<br />
Pathologie/Gerichtsmedizin gelang erst 1934.<br />
Was geschah nun in dem neu erbauten Institut? Marchand umschrieb die<br />
Aufgaben folgendermaßen: „Das pathologische Institut hat verschiedenen<br />
69
Zwecken zu dienen: 1. als Anstalt der <strong>Universität</strong>, zum Unterricht und zur<br />
Forschung in der pathologischen Anatomie und der allgemeinen Pathologie;<br />
2. als Leichenschauhaus für das städtische Krankenhaus …“<br />
Hinter dieser sachlich nüchternen Beschreibung zu einem nach wie vor sensiblen<br />
Thema verbirgt sich allerdings ein sehr komplexes Tätigkeitsfeld. Zu den Hauptaufgaben<br />
gehört eben nicht nur die Klärung der Todesursache durch Obduktion,<br />
sondern, in enger Zusammenarbeit mit der klinischen Medizin, auch die Prüfung<br />
von Organveränderungen durch Gewebe- und Blutuntersuchungen. Die Analyse<br />
makroskopischer und mikroskopischer Befunde dient in jedem Fall dazu, krankhafte<br />
Veränderungen zu erkennen, die gestörte Funktion zu verstehen und ein<br />
fundiertes Verständnis klinischer Krankheitsbilder zu ermöglichen.<br />
Die für Außenstehende nicht vermutete Nähe der Pathologie zur klinischen<br />
Medizin zeigte sich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vor allem in<br />
den vielfältigen Beziehungen zu anderen medizinischen Fachgebieten. Um 1900<br />
hatten sich aus den klassischen Fachgebieten Anatomie, Physiologie, Pathologie,<br />
Innere Medizin, Chirurgie und Entbindungskunst weitere Lehrgebiete entwickelt.<br />
Als Folge davon siedelten sich innerhalb kürzester Zeit weitere Instituts- und<br />
Klinikneubauten an der Liebigstraße an. Bis 1912 eröffneten das Anatomische<br />
Institut (1875), der Klinische Hörsaal (1879), die Augenklinik (1883), das Pharmakologische<br />
Institut und die Medizinischen und Chirurgischen Polikliniken<br />
(1883), das Rote Haus, als Medizinische Klinik genutzt (1889), die alte Frauenklinik<br />
(1892), die Chirurgische Klinik (1900), die Zahnklinik (1910) und die<br />
HNO-Klinik (1912). In dieser Zeit entstand der Name <strong>Leipzig</strong>er Medizinisches<br />
Viertel. Er wurde als Hinweis auf die Funktion des Stadtteils geprägt, bezog sich<br />
aber auch auf die beachtliche Anzahl weltbekannter Ärzte und Wissenschaftler,<br />
die in den Instituten und Kliniken arbeiteten. An der Wende vom 19. zum<br />
20. Jahrhundert erlebte die <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>smedizin ihre Blütezeit.<br />
Das Medizinische Viertel wurde im Zweiten Weltkrieg, vor allem bei dem<br />
schweren Bombenangriff in der Nacht des 4. Dezember 1943, schwer zerstört.<br />
Auch das Pathologische Institut blieb davon nicht verschont. Der Hörsaal im<br />
Ostflügel und das Dachgeschoss der Institute für Pathologie und für Gerichtsmedizin<br />
brannten vollständig aus. Die wertvolle Präparatesammlung und die<br />
Bibliothek des Pathologischen Instituts konnten glücklicherweise zum überwiegenden<br />
Teil gerettet werden. Auch der im Mittelbau gelegene Hörsaal für die<br />
klinischen Demonstrationskurse blieb unversehrt. Mit seinen amphitheatralisch<br />
angeordneten Sitzplätzen bietet er ausgezeichnete Sichtverhältnisse und wird<br />
deshalb noch immer für den Unterricht genutzt.<br />
70
Die Schäden am Pathologischen Institut wurden nach 1945 mit bescheidenen<br />
Mitteln zunächst provisorisch beseitigt. In den Jahren 1952/53 wurden zudem<br />
erste Pläne zum weitreichenden Umbau und zur Erweiterung des Institutes erarbeitet.<br />
In mehreren Bauabschnitten sollte zunächst der ausgebrannte theoretische<br />
Hörsaal abgerissen, der Ostflügel verlängert und der Gebäudekomplex durch einen<br />
rechtwinklig zur Johannisallee verlaufenden Querriegel geschlossen werden.<br />
Anschließend sollte ein von Klinikern und Theoretikern gemeinsam nutzbarer<br />
neuer großer Hörsaal als Verbindungsbau zwischen dem Institut für Pathologie<br />
und der Medizinischen Klinik entstehen. Die Ausführungen wurden jedoch<br />
mehrfach verschoben und schließlich nicht realisiert. Die Kriegsfolgen sind am<br />
Institut für Pathologie deshalb teilweise bis in die Gegenwart sichtbar geblieben.<br />
Dies betrifft vor allem das vollkommen verändert aufgebaute Dachgeschoss<br />
und den Ostflügel. Dieser konnte erst 2000 durch Sanierung und Umbau wieder<br />
vollständig genutzt werden, verlor dabei aber seine Zuordnung zum Institut für<br />
Pathologie. Er beherbergt nun das Medizinisch-Experimentelle Zentrum und<br />
bildet mit dem Neubau des Max-Bürger-Forschungszentrums eine funktionale<br />
Einheit. Optisch reizvoll ist dabei die Einbindung zeitgenössischer Architektur<br />
in die historische Bausubstanz.<br />
Bis zum Jahr 2010 sollen das Institut für Pathologie und das Institut für Rechtsmedizin<br />
grundlegend rekonstruiert und modernisiert werden. Seit August 2005<br />
werden Hörsaal- und Sektionstrakt bereits umgebaut. Die Arbeiten gehen<br />
während dieser Zeit in einem eigens dafür errichteten Interimsgebäude weiter.<br />
In einem weiteren Bauabschnitt wird das Institut für Rechtsmedizin saniert.<br />
Anschließend sollen die Arbeitsräume und Forschungslabore des Instituts für<br />
Pathologie und der selbstständigen Abteilung für Neuropathologie funktionell<br />
neu geordnet und mit moderner Technik ausgestattet werden. Die äußere Fassadenstruktur<br />
und die derzeitige Dachkonstruktion bleiben bei der Rekonstruktion<br />
aber erhalten und erinnern auch weiterhin an die wechselvolle Geschichte des<br />
Gebäudes.<br />
Cornelia Becker<br />
71
Oskar von Gebhardt<br />
Zum 100. Todestag am 9. Mai <strong>2006</strong><br />
Am 9. Mai 1906 verstarb Oskar von Gebhardt, der erste Direktor der<br />
<strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>sbibliothek in ihrem neuen Gebäude in der Beethovenstraße.<br />
Gebhardt war aber nicht nur ein fachlich versierter Bibliothekar,<br />
sondern – von Hause aus Theologe – auch ein gelehrter Editor antiker<br />
christlicher Texte.<br />
73
„Gebhardts Leben floß wie ein breiter, stiller, von Bäumen beschatteter Strom<br />
dahin.“ Diese Charakterisierung, nicht etwa in einem Nachruf, sondern in einem<br />
kurz nach Gebhardts Tod über ihn verfassten Artikel in der „Protestantischen<br />
Realenzyklopädie für Theologie und Kirche“ zu finden, ist typisch für die Sicht<br />
der Zeitgenossen. Sie sagten ihm das „Gewissen eines Herrnhuters“, die „Ausdauer<br />
einer Maschine“, den Habitus eines „trocknen und nüchternen Gelehrten“,<br />
„Zurückhaltung“ oder „Vornehmheit der Denkart, gepaart mit einer großen persönlichen<br />
Anspruchslosigkeit“ nach und nannten ihn „gemessen und kühl“. Sein<br />
Freund Adolf von Harnack allerdings wusste auch von Gebhardts Phantasie,<br />
seinem Humor und seiner künstlerischen Natur zu berichten.<br />
Im Blick auf die <strong>Universität</strong>sgeschichte ist an Oskar von Gebhardt zu erinnern,<br />
weil er von 1893 bis zu seinem Tod im Jahre 1906 Leiter der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
war (zuerst mit dem Titel eines Oberbibliothekars, dann eines Direktors).<br />
1891 war die Bibliothek in ihr neues Domizil in der Beethovenstraße umgezogen,<br />
und offensichtlich war Gebhardt nicht nur ein zurückgezogener Gelehrter,<br />
sondern auch ein guter Organisator, der die Bibliotheksverwaltung neu und<br />
benutzerfreundlich ordnete und sich überdies um die Katalogisierung der Handschriftenbestände<br />
kümmerte. Für seine Aufgabe war er durch eine stetige Karriere<br />
hervorragend qualifiziert. 1875 hatte er seine bibliothekarische Tätigkeit als<br />
Volontär an der Straßburger <strong>Universität</strong>sbibliothek begonnen, 1875/76 hatte er<br />
als Bibliotheksassistent an der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>sbibliothek gearbeitet. Die<br />
weiteren Stationen waren Halle (als Kustos und Unterbibliothekar von 1876 bis<br />
1880), Göttingen (als Unterbibliothekar von 1880 bis 1884) und Berlin (als Bibliothekar<br />
und Direktor der Druckschriftenabteilung von 1884 bis 1893).<br />
Die Berufung nach <strong>Leipzig</strong> verlief dennoch nicht reibungslos, wofür ein im <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
zu findender kurzer Briefwechsel zwischen dem Kultusministerium<br />
in Dresden und der Philosophischen Fakultät aus der Zeit vom Dezember<br />
1892 bis zum März 1893 zeugt. Das Amt des Leiters der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
war zu dieser Zeit mit einer Honorarprofessur verbunden, und auch Gebhardt<br />
sollte auf eine solche ernannt werden. Die Stellungnahme der Philosophischen<br />
Fakultät fiel anders aus, als vom Ministerium erwartet. Die Fakultät verweigerte<br />
sich: „Soweit der Facultät bekannt ist, gehören die wissenschaftlichen Studien,<br />
die Herr von Gebhardt bisher neben seiner wesentlich ein reines Verwaltungsamt<br />
bildenden Bibliothekarsstellung privatim verfolgt hat, dem theologischen<br />
Gebiete an.“ Nach Rücksprache mit Gebhardt umschrieb das Ministerium das<br />
ins Auge gefasste Fachgebiet dann mit „Buch- und Schriftwesen“. Gebhardt<br />
teilte im Zuge der Verhandlungen mit, er gehe davon aus, „daß es sich bei seiner<br />
Ernennung zum Honorarprofessor nicht sowohl um eine Verpflichtung, als<br />
74
vielmehr die Berechtigung zum Halten von Vorlesungen handle“. Er war mit<br />
dem Bibliothekswesen vertraut genug, um zu ermessen, dass er, wie er ebenfalls<br />
dem Ministerium mitgeteilt hatte, wenigstens in den ersten Semestern nicht dazu<br />
kommen werde, Vorlesungen zu halten. Trotz dieses Entgegenkommens sperrte<br />
sich die Philosophische Fakultät aber immer noch; letztlich wurde sie vom<br />
Ministerium vor vollendete Tatsachen gestellt. Tatsächlich lehrte Gebhardt nie<br />
und konzentrierte sich ganz auf seine Verpflichtungen an der Bibliothek und auf<br />
seine wissenschaftlichen Interessen. 1896 wurde er in die Sächsische Akademie<br />
der Wissenschaften gewählt.<br />
Abgesehen von der <strong>Universität</strong>sgeschichte, ist Gebhardts Bedeutung für die<br />
Wissenschaftsgeschichte hervorzuheben. Sein Name findet sich über einer ansehnlichen<br />
Zahl gelegentlich noch heute in Gebrauch befindlicher Ausgaben<br />
christlicher Texte der Antike. Seine großen Leistungen liegen auf dem Gebiet<br />
der „Patristik“, die zu seiner Zeit die Königsdisziplin innerhalb des Faches war,<br />
das Gebhardt auch studiert hatte, der Theologie nämlich. Jene Disziplin widmete<br />
und widmet sich bis heute nicht nur den „Kirchenvätern“; vielmehr haben<br />
Gebhardt, Harnack und andere ohne Rücksicht auf die theologiegeschichtliche<br />
Bedeutung christliche antike Quellen ediert und untersucht und damit auf in der<br />
Rezeption eher randständige, aber in ihrer Entstehungszeit viel gelesene Texte<br />
hingewiesen. Gebhardt veröffentlichte zum Beispiel das Evangelium und die<br />
Apokalypse des Petrus, Schriften also, die fälschlich unter dem Namen dieses<br />
Apostels umliefen, ebenso einen Roman über Paulus und seine angebliche Gefährtin<br />
Thekla, der in der Spätantike populär war. Zwar lag manches schon in<br />
älteren Ausgaben vor (etwa die altkirchlichen Märtyrerakten und die Schriften<br />
der „Apostolischen Väter“ aus dem 2. Jahrhundert), doch war die Handschriftenbasis<br />
dieser Ausgaben schmal und die ihnen zugrundeliegende editorische<br />
Technik unzureichend.<br />
Seine editorische Tätigkeit hatte Gebhardt 1875 mit der Ausgabe einer griechischen<br />
Handschrift des Alten Testamentes aus der Bibliothek von San Marco in<br />
Venedig begonnen, und das dahinter stehende Interesse, nämlich die Erforschung<br />
der Geschichte von Bibelhandschriften, prägte seine Arbeit neben seinen patristischen<br />
Interessen nachhaltig. Das Interesse am Bibeltext hatten schon zu seinen<br />
Studienzeiten die <strong>Leipzig</strong>er Professoren Franz Delitzsch (im Blick auf das Alte<br />
Testament) und Konstantin von Tischendorf (im Blick auf das Neue Testament)<br />
bei ihm geweckt. Gebhardt machte sich denn auch um den Text des Neuen Testamentes<br />
verdient und bemühte sich um eine Verbesserung schon vorliegender<br />
Ausgaben, darunter auch der seines <strong>Leipzig</strong>er Lehrers Tischendorf.<br />
75
Der Gebhardt nachgesagte Habitus und sein Arbeitsstil bezogen sich also auf<br />
seine philologische Gelehrsamkeit, die sich mit einem kritischen historischen<br />
Bewusstsein paarte. Beides hatte er mit seinem Freund Adolf von Harnack gemeinsam,<br />
und beides machte die Exzellenz der Kirchengeschichtswissenschaft<br />
und der Evangelischen Theologie dieser Zeit aus. Anders als Harnack wendete<br />
Gebhardt das Bewusstsein des historischen Gewordenseins aller Dinge aber<br />
nicht in eine Kritik am Umgang der Evangelischen Kirche mit der christlichen<br />
Tradition.<br />
Herkunft und Lebensweg hätten Gebhardt eigentlich in eine Tätigkeit innerhalb<br />
der Kirche oder einer Theologischen Fakultät führen müssen. Am 22. Juni 1844<br />
in Wesenberg (heute: Rakvere) in Estland geboren und schon mit vier Jahren<br />
zum Vollwaisen geworden, wuchs er bei seinem Onkel, einem Pastor, auf. 1862<br />
nahm er das Studium der Theologie in Dorpat auf und setzte seine Studien dann,<br />
wie es üblich war, in Deutschland fort. 1867 ging er nach Tübingen, später studierte<br />
er in Erlangen, Göttingen und <strong>Leipzig</strong>. In <strong>Leipzig</strong>, wo er sich von 1872<br />
bis 1876 (mit einer kurzen Unterbrechung durch seine Straßburger Zeit) aufhielt,<br />
lernte er schon im ersten Jahr den um sieben Jahre jüngeren Adolf von Harnack<br />
kennen, gleich ihm aus einer deutschbaltischen Familie stammend. Dass Gebhardt<br />
die Theologie weder auf der Kanzel noch auf dem Katheder zur Profession<br />
machte, sondern sich dem Bibliothekswesen verschrieb, wurde von den Zeitgenossen<br />
mit seinem Streben nach Unabhängigkeit und mit seinen wissenschaftlichen<br />
Vorlieben erklärt. Zugleich wurde betont, Gebhardt sei der Kirche immer<br />
eng verbunden geblieben.<br />
Die Freundschaft mit Adolf von Harnack war überaus produktiv. Die „Texte<br />
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur“, eine bis heute<br />
erscheinende Reihe für Editionen und literaturgeschichtliche Untersuchungen,<br />
wurden von beiden seit 1882 herausgegeben. Durch seine Editionen konnte Gebhardt<br />
seine bibliothekarischen Interessen mit den philologischen und – rechnet<br />
man die Edition christlich-antiker Quellen zur unabdingbaren Grundlagenforschung<br />
in seinem Studienfach – den theologischen verbinden. Die Auffindung<br />
von Handschriften erforderte bibliotheks- und kirchengeschichtliche Kenntnisse,<br />
die textgeschichtliche Zuordnung und Datierung verlangte nach fundiertem paläographischem<br />
Wissen. Gebhardt war ein intimer Kenner der Geschichte des<br />
italienischen Bibliothekswesens. Ein besonderer Fund gelang ihm 1879 zusammen<br />
mit Adolf von Harnack im kalabrischen Rossano, wo die beiden wissenschaftlichen<br />
Gefährten eine Handschrift des Matthäus- und des Markusevangeliums<br />
aus dem 6. Jahrhundert mit aufwendigen Illustrationen entdeckten. Durch<br />
die Publikation der Bildtafeln leisteten sie auch einen Beitrag zu der in dieser<br />
76
Zeit aufblühenden Christlichen Archäologie und Kunstgeschichte. Gleiches gilt<br />
für die Wiedergabe der Abbildungen aus dem so genannten Ashburnham-Pentateuch.<br />
In der Einführung zur Beschreibung des „Codex Rossanensis Purpureus“<br />
zeigt sich Gebhardt, der auf der Suche nach Handschriften viel reiste, auch einmal<br />
nicht nur als Gelehrter, sondern in seiner Beschreibung der Landschaft mit<br />
ihren „eichwaldgleichen Olivenpflanzungen“ zugleich als Liebhaber Italiens.<br />
Oskar von Gebhardt wurde 61 Jahre alt und verstarb nach längerer, schwerer<br />
Krankheit. Er hinterließ eine 24 Jahre jüngere Witwe (Jenny) und zwei Kinder,<br />
von denen der Sohn Peter dem Bibliothekswesen verbunden blieb. Der von seiner<br />
Witwe an die Königliche Bibliothek zu Berlin verkaufte Nachlass zeugt von<br />
der Vielzahl von Projekten, an deren Vollendung er noch arbeitete.<br />
Klaus Fitschen<br />
77
Karl Ferdinand Hommel<br />
Zum 225. Todestag am 16. Mai <strong>2006</strong><br />
Der <strong>Leipzig</strong>er Rechtslehrer Karl Ferdinand Hommel (1722 – 1781) gilt als<br />
erster bedeutender Strafrechtsreformer. Im Sinne der Humanisierung des<br />
Strafrechts sprach er sich gegen die Todesstrafe, Folter und Landesverweisung<br />
aus.<br />
79
Hommel wurde am 6. Januar 1722 in <strong>Leipzig</strong> als zweiter Sohn des Professors<br />
und Appellationsgerichtsrats Ferdinand August Hommel (1697 – 1765) geboren.<br />
Nach dem Besuch der Nikolaischule wechselte er 1738 an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>,<br />
um hier die freien Künste zu studieren. In diesen Jahren zählte Gottsched zu<br />
seinen Lehrern in der Poesie.<br />
Hommels Wunsch, Medizin zu studieren, ließ sich nicht realisieren. Vielmehr<br />
bestimmte ihn sein Vater zum Jurastudium in seiner Heimatstadt. 1743 schloss<br />
er das Studium in Halle ab. Zu seinen Lehrern gehörte neben seinem Vater auch<br />
Johann Jacob Schmauss, beides Thomasiusschüler. Indirekt wurde so auch der<br />
jüngere Hommel Schüler von Thomasius, den er sein Leben lang verehrte. Äußeres<br />
Zeichen dafür war ein Denkmal, das Hommel zu Ehren von Thomasius in<br />
seinem Garten errichtete.<br />
Am 24. April 1744 wurde Hommel in <strong>Leipzig</strong> zum Doktor beider Rechte promoviert.<br />
Im selben Jahr erlangte er das Baccalaureat der Jurisprudenz, wurde<br />
Lizentiat, Advokat am <strong>Leipzig</strong>er Oberhofgericht und Magister der Philosophie.<br />
Nach Abschluss seiner Studien wollte Hommel sich der Philosophie zuwenden,<br />
jedoch blieb seinen Vorlesungen der Erfolg verwehrt. Demzufolge wandte er<br />
sich mit erheblich größerem Anklang der juristischen Lehre zu. Schnell durchlief<br />
er die üblichen Stationen eines <strong>Leipzig</strong>er juristischen Professors seiner Zeit.<br />
Seine <strong>Universität</strong>slaufbahn begann 1750 mit der außerordentlichen Professur für<br />
Staatsrecht. 1752 wurde er zum Professor für Lehnrecht ernannt. 1756 erlangte<br />
er den ersten wichtigen zivilistischen Lehrstuhl, den der Institutionen (Römische<br />
Rechtsgeschichte). 1763 gelang ihm dann der Sprung auf den vornehmsten Lehrstuhl<br />
der Juristenfakultät, den für Kirchenrecht (Dekretalen), der mit dem Ordinariat<br />
verbunden war. Die Zwischenstation einer Professur für Pandekten konnte<br />
er auslassen, weil sein Vater zu seinen Gunsten auf das Ordinariat verzichtet<br />
hatte. Noch im selben Jahr wurde er zum Rektor gewählt.<br />
In sein Ordinariat fällt der Kampf um den Erhalt des angestammten Grundstücks<br />
der Juristenfakultät und die Errichtung eines Neubaus (Petrinum), den er ohne<br />
Erlaubnis der zuständigen Behörden auf Kosten der Fakultät errichten ließ. Erst<br />
nachdem 1773 das Petrinum seiner Bestimmung übergeben worden war, erfolgte<br />
die Genehmigung des Dresdner Ober-Konsistoriums.<br />
Während seiner Zugehörigkeit zur Juristenfakultät war Hommel immer auch mit<br />
deren Spruchtätigkeit befasst. Als Ordinarius war er vielfach in die Rechtsprechung<br />
des <strong>Universität</strong>sgerichts eingebunden. Zudem wurde er 1760 zum Beisit-<br />
80
zer am <strong>Leipzig</strong>er Oberhofgericht ernannt. Hier wurde er 1763 erster Beisitzer der<br />
Gelehrtenbank.<br />
Hommel starb hochgeehrt am 16. Mai 1781 in seiner Vaterstadt und wurde in der<br />
Paulinerkirche beigesetzt.<br />
Hommel ist als erster bedeutender deutscher Strafrechtsreformer bekannt geworden<br />
und zehrt bis auf den heutigen Tag von seinem Ruf als „deutscher Beccaria“.<br />
Das wird aber der vollen Breite seines Wirkens nicht gerecht, das alle Themenbereiche<br />
umfasst, über die er auch Vorlesungen gehalten hat. In der Tradition<br />
seines Vorbilds Thomasius betonte er die Eigenständigkeit des deutschen<br />
gegenüber dem römischen Recht. Er forderte zudem, über deutschrechtliche<br />
Institute wie Erbverträge, Einkindschaft, Gerade und Hergewete, Leibgedinge<br />
und Gütergemeinschaft allein nach den Grundsätzen des unverfälscht deutschen<br />
Rechts zu entscheiden.<br />
Gleichfalls in Übereinstimmung mit Thomasius räumte er dem Naturrecht keinerlei<br />
praktische Bedeutung ein und arbeitete vielmehr in starkem Maße mit<br />
historischem Material. Lediglich im Strafrecht diente ihm das Naturrecht zur<br />
Abgrenzung von Recht und Moral. Insoweit gehört Hommel zu den frühen Utilitaristen.<br />
Seine Grundregel lautet: „Strebe soviel du vermagst, nach eigenem<br />
Nutzen, ohne dennoch dem anderen zu schaden; sondern nütze ihm, wenn du<br />
es ohne eigenen Schaden zu tun vermagst.“ Das Strafrecht sollte erst einsetzen<br />
dürfen, wenn der einzelne durch das Streben nach dem eigenen Nutzen andere<br />
Individuen schädigte. Hingegen ließ sich die angemessene Strafe nicht naturrechtlich<br />
ermitteln.<br />
Grundgedanken einer Strafrechtsreform entwickelte er erstmals 1765 in seiner<br />
Rede „Principis cura leges“ vor dem sächsischen Thronfolger Friedrich August<br />
III. (I.) und weiteren Angehörigen des regierenden Hauses. Bei diesem Werk<br />
handelt es sich letztlich um einen späten Fürstenspiegel der Aufklärungszeit,<br />
eine Gesetzgebungslehre. In dieser Rede nahm er schon Gedanken Beccarias<br />
vorweg, indem er sich gegen die Todesstrafe, die Gefängnisstrafe und die Landesverweisung<br />
aussprach.<br />
Seit 1766 veröffentlichte er in unregelmäßiger Folge seine „Rhapsodia quaestionum<br />
in foro quotidie obvenientium neque tamen legibus decisarum“, um seine<br />
Reformvorstellungen gegenüber der noch herrschenden „Practica nova Imperialis<br />
Saxonica rerum criminalium“ (1635, zuletzt 1652) des Benedikt Carpzov<br />
durchzusetzen. Im Jahre 1770 erschien unter dem Pseudonym Alexander v. Joch<br />
81
sein strafrechtsphilosophisches Hauptwerk „Über Belohnung und Strafe nach<br />
türkischen Gesetzen“. Unter der durchaus zeittypischen Verkleidung eines in<br />
den vorderen Orient verlegten Schauplatzes entwickelte Hommel die erste streng<br />
deterministische Begründung eines Strafrechtssystems.<br />
Die größte Bedeutung für die Verbreitung moderner, humaner Gedanken im<br />
Strafrecht kommt aber seiner Herausgabe der Übersetzung Phillip Jacob Flades<br />
von Cesare Bonesano de Beccarias „Dei delitti e delle pene“ unter dem Titel<br />
„Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk über Verbrechen und<br />
Strafen“ zu, die durch eigene Anmerkungen ergänzt ohne Jahresangabe 1778<br />
veröffentlicht wurde. 1784 stellte sein Schüler und Schwiegersohn Karl Gottlieb<br />
Rössig seine Schriften zur Strafrechtsreform in systematischem Zusammenhang<br />
dar und ließ sie drucken.<br />
Die kursächsische Strafrechtsreform der Jahre 1770/80, die die Folter sowie<br />
die Strafe der Landesverweisung abschaffte und die Zuchthausstrafe einführte,<br />
beruht nicht zuletzt auf Hommels Einfluss. Die Erfolge Hommels dürfen allerdings<br />
nicht darüber hinwegtäuschen, dass er letztlich keine zusammenhängende<br />
Strafrechtstheorie zu schaffen vermochte. Auch änderte er seine Anschauungen<br />
im Laufe seines Lebens häufig. In jüngster Zeit hat Hommel stärkere Kritik<br />
erfahren, die ihm eine unsystematische, zusammenhanglose und oberflächliche<br />
Arbeitsweise vorwirft.<br />
Von Bedeutung sind auch seine Ausführungen zu dem Verhältnis der Konfessionen<br />
vor dem Hintergrund eines evangelischen Landes, das von einem katholischen<br />
Herrscherhaus regiert wurde. In seiner schon genannten Rede „Principis<br />
cura leges“ forderte er die strikte Trennung von Staat und Kirche, einen Gedanken,<br />
den er 1768 in seiner Schrift „Epitome juris canonici“ näher begründete. In<br />
diesem Sinne wirkte er auch in der <strong>Universität</strong>. Unter seinem Vorsitz fanden in<br />
<strong>Leipzig</strong> die ersten Promotionen und Disputationen von Katholiken und Reformierten<br />
statt, ohne dass eine besondere Erlaubnis dazu eingeholt worden war.<br />
Gerühmt wurde Hommel für seinen Stil, der dazu führte, ihn als Vertreter<br />
der sogenannten „eleganten Jurisprudenz“ anzusehen. Zur Verbesserung des<br />
juristischen Stils in den deutschen Gerichten verfasste er mehrere literarische<br />
Werke. In diesem Zusammenhang ist vor allem sein „Teutscher Flavius, d. i.<br />
hinlängliche Anleitung sowohl bei bürgerlichen als peinlichen Fällen Urthel abzufassen“<br />
von 1763 zu nennen.<br />
Bernd-Rüdiger Kern<br />
82
Psychiatrische Lehre<br />
Vor 200 Jahren begann der kontinuierliche Vorlesungsbetrieb<br />
zur Seelen- und Nervenheilkunde<br />
Früh um 7:00 Uhr am 20. Mai 1806 trat Johann Christian August Heinroth<br />
im Keller der Pleißenburg zu seiner ersten Vorlesung an. Von da an wird<br />
der fünfeinhalb Jahre später an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> weltweit erste akademisch<br />
bestallte Professor für ein seelen- und nervenheilkundliches Fach in<br />
persona für über 37 Jahre psychiatrisch-psychotherapeutische Lehrveranstaltungen<br />
bürgen. Damit legte er den entscheidenden Grundstein für 200<br />
Jahre regelmäßige Kollegien in diesem Fach.<br />
83
Nachdem schon in den vorhergehenden Semestern immer wieder Lehrveranstaltungen<br />
über ‚Nerven‘, die Struktur der Nervenzellen, über die ‚Sittenlehre der<br />
Vernunft‘ oder die ‚Krankheiten von Gelehrten‘ abgehalten worden waren, kann<br />
in den <strong>Universität</strong>s-Verzeichnissen der zu haltenden Vorlesungen oder in den<br />
‚<strong>Leipzig</strong>er gelehrten Tagebüchern‘ mit den Lehrangeboten von Christian Friedrich<br />
Ludwig (1751 – 1823) und Ernst Gottlob Bose (1723 – 1788) eine gewisse<br />
Regelmäßigkeit von psychiatrischen oder neurologischen Themen ausgemacht<br />
werden. Der erste bietet zum Beispiel im Wintersemester 1784/85 ‚Die Lehre<br />
von den nervösen Krankheitszuständen nach Cullen(ius)‘, der zweite im Sommersemester<br />
1786 die ‚Therapie der die Nerven angreifenden Krankheiten‘ an. In<br />
den folgenden Semestern lesen vor allem Johannes Gottlob Haase (1739 – 1801)<br />
neurologische und Karl Friedrich Burdach (1776 – 1847) mit ‚Psychische Diätetik‘,<br />
‚Über Geisteskrankheiten‘ oder ‚Zur Pathologie der menschlichen Seele‘<br />
immer wieder psychiatrische Themen. Diese <strong>Leipzig</strong>er Vorlesungen zählen mit<br />
zu den ersten Lehrveranstaltungen auf dem Gebiete der Psycho- und Neurofächer<br />
im deutschsprachigen Raum überhaupt.<br />
Ab dem Sommersemester 1806 nimmt sich besonders Johann Christian August<br />
Heinroth (1773 – 1843) Fragen seelischer Gesundheit und Krankheit an. Bereits<br />
sein erstes Kolleg ‚Ueber das Bedürfnis des Studiums der medicinischen Anthropologie<br />
und ueber den Begriff dieser Wissenschaft‘ weist darauf hin, wenn man<br />
beachtet, dass den in <strong>Leipzig</strong> am 17. Januar 1773 Geborenen die medizinische Anthropologie<br />
in ihrer Anwendung auf die Seelenheilkunde interessiert hat. Genau<br />
dies legte er in seinem ersten akademischen Unterrichtszyklus dar, der früh um<br />
7:00 Uhr am 20. Mai 1806 begann und allem Anschein nach an vier aufeinander<br />
folgenden Tagen stattfand – und zwar im Auditorium des Professors für Chemie<br />
Christian Gotthold Eschenbach (1753 – 1831). Was tatsächlich heißt: in dem<br />
zwei Jahre zuvor im Keller der Pleißenburg aus Räumen einer Speisewirtschaft<br />
hergerichteten, feuchten, dunklen und meist nicht zu beheizenden chemischen<br />
Laboratorium. Es kann angenommen werden, dass auch die für das Sommerhalbjahr<br />
1807 angekündigte Vorlesung ‚Einleitung in die Heilung des Gemüths‘<br />
trotz des Einmarsches der napoleonischen Truppen 1806 in <strong>Leipzig</strong> zustande<br />
kam, denn Heinroth äußerste dies selbst, und die akademischen Lehrkataloge<br />
wiesen auch während der Zeit der Besatzung ungebrochen Lehrveranstaltungen<br />
aus. Wenngleich generell die ungünstigen äußeren Umstände sich der Förderung<br />
der Karriere des ehemaligen Nikolaischülers und Medizinstudenten der Alma<br />
mater Lipsiensis sicherlich als wenig zuträglich erwiesen. Obgleich er wenigstens<br />
1806/07 und 1813 in der Stadt in französischen Militärlazaretten Dienst<br />
tat, kam er von seinem eigentlichen Interesse an seelenheilkundlichen Fragen<br />
nicht ab. Schon während seines Studiums war er unter den Einfluss des Ersten<br />
84
Ordentlichen Professors der Medizinischen Fakultät und ständigen Dekans,<br />
des Physiologen und Philosophen Ernst Platner (1744 – 1818), geraten, und so<br />
wird er mit ihm die Schrift ‚De melancholia senili occvlta observatio‘ erarbeitet<br />
haben. Endgültig legte er sich spätestens mit seinem Büchlein ‚Beyträge zur<br />
Krankheitslehre‘ und seiner Entscheidung für ein psychiatrisches Thema seiner<br />
Antrittsvorlesung zur außerordentlichen Professur auf die Seelenheilkunde<br />
als Hauptarbeitsgebiet fest. Diese Professur, die noch ohne Lehrgebiet ausgeschrieben<br />
war, hatte ihm, dem Doktor der Medizin und Philosophie und auf dem<br />
Gebiet der Medizin Habilitierten, auf Antrag der sächsische König bewilligt.<br />
Weil er also besonders dazu prädestiniert schien und weil im sozial-ökonomisch<br />
vorangehenden Sachsen durch die Errichtung von Irrenanstalten rasch Bedarf<br />
an speziell für psychische Heilkunde ausgebildeten Ärzten entstand, wurde ihm<br />
im Zuge einer allgemeinen <strong>Universität</strong>sreform auf Weisung Friedrich August I.<br />
(1750 – 1827) 1811 eine außerordentliche Professur für ‚Psychische Therapie‘<br />
übertragen. War es doch die Bestimmung außerordentlicher Professoren ohne<br />
Lehramt, bei Bedarf und besonderer Befähigung entsprechend eingesetzt zu<br />
werden.<br />
Dieser Lehrstuhl an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> ist tatsächlich der erste eigens für<br />
ein seelenheilkundliches Fach eingerichtete und Heinroth der erste akademische<br />
Lehrer, der eigens für ein psychiatrisches Gebiet berufen worden ist. Gilt dies<br />
mit Gewissheit für das Abendland, besteht dieser Anspruch aber wohl auch<br />
angesichts von Definitionsproblemen im Vergleich mit den frühen islamischen<br />
Lehranstalten.<br />
Jedoch muss definitiv festgestellt werden, dass dieser Lehrstuhl trotz Heinroths<br />
ernsthaften Bemühungen zu seinen Lebzeiten nie in einen ordentlichen umgewandelt<br />
worden ist, die ‚Psychische Therapie‘ außerordentliches Lehrgebiet<br />
blieb, wenngleich er selbst als Hochschullehrer 1819 den Status eines ordentlichen<br />
Professors der Medizin erhielt.<br />
1813 gelangte Heinroth durch die Fürsprache der Medizinischen Fakultät zusätzlich<br />
in die Stellung als Hausarzt am Waisen-, Zucht- und Versorgungshaus<br />
St. Georg. In diese 1212 gegründete städtische Pflege- und Krankenanstalt sind<br />
zwar auch psychisch Kranke eingeliefert worden, aber doch längst nicht in der<br />
Anzahl und Verweildauer, als dass Heinroth hier unbeschränkt der Zugang zu<br />
seelenkranken Patienten ermöglicht worden wäre. So blieb er als psychiatrischer<br />
Arzt weitgehend Theoretiker, denn über eine eigene psychiatrische <strong>Universität</strong>sklinik<br />
konnte er schon gar nicht verfügen.<br />
85
Heinroth war von seiner ganzen Persönlichkeit her ein eminent stark vom<br />
protestantischen Christentum beeinflusster Mensch. Auch sein psychiatrisches<br />
Gesundheits- und Krankheitskonzept ist in hohem Maße davon geprägt. Die<br />
Ursache der Seelenstörungen – worunter er im engeren Sinne nur die endogenen<br />
Störungen begriff – sah er in einer vom Kranken selbst zu verantwortenden<br />
Schuld. Diese beruhe auf „Sünde“, darunter verstand er zum einen zwar auch im<br />
wortwörtlichen Sinne eine Abkehr von Gott, zum anderen vielmehr aber noch<br />
ein den christlich-ethischen Geboten widersprechendes Leben. Also sollte in<br />
seinem Sinne darunter ein insgesamt ‚falscher‘ Lebensstil des Menschen verstanden<br />
werden, nämlich wenn dessen Begierden überwiegend auf die Befriedigung<br />
irdischer Lebensbedürfnisse und Leidenschaften gerichtet seien. Gebe der<br />
Mensch diesen nach – und im Laufe der Zeit würden sie zwangsläufig stärker,<br />
bestimmender – führe dieser Befriedigungstrieb zur psychischen Krankheit.<br />
Grundsätzlich besitze der Mensch die Freiheit, sich für einen Lebensweg zu<br />
entscheiden, und damit letztendlich auch die Gewalt über die eigene Gesundheit<br />
oder Krankheit. Es wäre zu diskutieren, inwieweit für Heinroth bereits die auf<br />
die eigene Person gestützte Selbstverwirklichung eine Übertretung der christlichen<br />
Gebote darstellte.<br />
Diese Sünden- bzw. Eigenschuldtheorie legte Heinroth, zu dessen Oeuvre auch<br />
ein poetisches Schaffenswerk gehört und der vorübergehend auch mit Johann<br />
Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) in Kontakt stand, in zahlreichen, einem<br />
sehr romantisch-verschlungenen Duktus folgenden Büchern nieder. Das berühmteste<br />
dürfte das 1818 erschienene zweibändige ‚Lehrbuch der Störungen<br />
des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung‘ sein. Von<br />
Vertretern biologisch orientierter Konzepte wurde Heinroth im Nachhinein vorgeworfen,<br />
er habe die Entwicklung der Seelenheilkunde als medizinisches Fach<br />
behindert und sie in die Nähe mittelalterlich-neuzeitlicher Teufelsaustreibung<br />
geführt. In Wahrheit jedoch unterschied sich die von ihm theoretisch dargestellte<br />
„indirect-psychische Methode“ in keiner Weise von Therapieoptionen, die seine<br />
zeitgenössischen Kollegen in ihren Irrenanstalten viel ausgedehnter anwenden<br />
konnten und die uns erst in zunehmender Erkenntnis mit ihren mechanischen,<br />
pharmakologischen, Zwangs- oder mitunter sogar chirurgischen Erregungs- und<br />
Erschöpfungsmethoden martialisch und unwissenschaftlich anmuten. Heinroth<br />
propagiert sie immer erst als Mittel der zweiten Wahl. Und gerade sein vielschichtiger<br />
Begriff der ‚Person‘ weist weit über somatisch Beschränktes hinaus,<br />
auf heute moderne medizinische Denkhaltungen: „Die Person ist mehr als der<br />
bloße Körper, auch mehr als die bloße Seele: sie ist der ganze Mensch“. Insofern<br />
betont Heinroths Ansatz eben sehr wohl etwas Neues, Anderes, wenn er nämlich<br />
sein Augenmerk weniger auf die bloße Beseitigung von Krankheitssymptomen<br />
86
legt, als vielmehr auf den ganzen Menschen und er dessen gesamte Lebensumstände<br />
in die psychiatrische Therapie einbezieht. Somit gleichen seine Ideen zu<br />
einer „direct-psychischen Methode“, die er nämlich als sein Mittel der ersten<br />
Wahl anempfiehlt, Vorannahmen des heutigen Begriffs der Psychotherapie. Im<br />
Übrigen führte Heinroth auch den Begriff des „Psychosomatischen“ in die medizinische<br />
Weltliteratur ein und wird sogar als Schöpfer dieser gesamten Disziplin<br />
betrachtet. Zweifelsfrei darf bei all dem natürlich nicht übersehen werden, dass<br />
sich seine irrenärztliche Kunst ganz wesentlich auf prophylaktische Lebensratschläge<br />
verlegen muss und diese, genau wie sein verhaltenstherapeutischer<br />
Behandlungskatalog, auf theologischen, philosophischen, psychagogischen und<br />
ärztlich-patriarchalischen Überlegungen beruhen.<br />
Lehrveranstaltungen, die eben vornehmlich rein theoretische Lektionen gewesen<br />
sein müssen, wird Heinroth bis zu seinem Tode 1843 anbieten. Die Anzahl pro<br />
Semester schwankt, oft sind es zwei, manchmal drei oder eine. Die Themen variieren<br />
ebenfalls, meist wartet er mit zwei verschiedenen Wissenschaftsbereichen<br />
auf: zur Psychischen Heilkunde mit Semiotik, Pathologie, Therapie und Theorie,<br />
des Öfteren darüber hinaus Medizinische Anthropologie oder Kriminal-Psychologie<br />
bzw. Forensik. Gerade auch dem letzteren Gebiet wandte er sich zu, denn<br />
einige Jahre versah er zugleich das Amt des Arztes des <strong>Leipzig</strong>er Stockhauses.<br />
Als Gutachter der Medizinischen Fakultät während des berühmten Prozesses<br />
gegen Johann Christian Woyzeck (1780 – 1824) 1821 – 1824 wurde er entgegen<br />
verbreiteter Darstellung jedoch nicht bestellt, denn erst 1830 musste er gegen<br />
seinen Widerstand in die Fakultät eintreten, der er als Dekan turnusgemäß einmal,<br />
1842, vorstand. Immerhin lassen aber die Titel einiger seiner Kollegien das<br />
wirklich ernsthafte Bemühen erkennen, seine Tätigkeit als Hochschullehrer und<br />
sein Amt als Hausarzt zu verbinden, um den Medizinstudenten im Georgenhaus<br />
auch klinische Demonstrationen an Kranken ermöglichen zu können.<br />
Bereits am Tage nach Heinroths Ableben am 26. Oktober 1843 zeigt der Dekan<br />
der Medizinischen Fakultät, der viel gerühmte Anatom Ernst Heinrich Weber<br />
(1795 – 1878), dem vorgesetzten Ministerium für Cultus und öffentlichen Unterricht<br />
an, dass die Fakultät keinen Wert darauf lege, dass ein eigenständiger<br />
seelenheilkundlicher Lehrstuhl weiter bestehen bleibe und man vielmehr diesen<br />
mit anderen zusammenzulegen wünsche. Ohne Umschweife begründet man dies<br />
mit einer Erhöhung der Einkünfte der Professorenschaft. Und ebenfalls mit Hilfe<br />
einer deutlichen Gehaltsaufbesserung seinerseits kann dann tatsächlich der außerordentliche<br />
Professor für Hygiene und Allgemeine Pathologie Justus Radius<br />
(1797 – 1884) für einen psychiatrischen ‚Teillehrstuhl‘ und die Fortführung des<br />
Unterrichts in psychischer Heilkunde interessiert werden. Ab dem Winterse-<br />
87
mester 1844/45 ist es neben anderen vor allem er, der dann seelenheilkundliche<br />
Themen liest. Im Gegensatz zu den Lehrveranstaltungen, die wirklich fortgeführt<br />
werden, wird in den 1850er und 60er Jahren im Konglomerat der Verpflichtungen<br />
Radius‘, die immer wieder hin und her geschoben worden sind, bald keine<br />
bestimmte Rede mehr von einem psychiatrischen Lehrstuhl sein, er verschwindet<br />
im Laufe der Jahre stillschweigend ohne formellen Akt.<br />
An die Heinrothsche psychiatrische Professur wird sich erst wieder Mitte der<br />
1870er Jahre mangels vakanter anatomischer oder physiologischer Lehrkanzeln<br />
erinnert, als es vor allem Carl Ludwig (1816 – 1895) umtreibt, für seinen hirnforschenden<br />
Schützling und noch außerordentlichen Professor ohne Lehrzuweisung<br />
Paul Flechsig (1847 – 1929) ein gesichertes Unterkommen an der eigenen<br />
<strong>Universität</strong> zu finden. Flechsig wird für 1878 schließlich die außerordentliche<br />
Professur für Psychiatrie zugesprochen, und er erhält die Anwartschaft auf das<br />
Direktorat einer noch zu erbauenden <strong>Universität</strong>sirrenklinik. 1884 wird er dann<br />
die erste ordentliche Professur für Psychiatrie an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> erhalten.<br />
Hauptsächlich Flechsig, der seit dem Wintersemester 1874 noch ausschließlich<br />
mikroskopisch-anatomische und hirnanatomische Vorlesungen offeriert<br />
hatte, wird ab dem Sommersemester 1880, in dem er mit der ‚Speciellen Psycho-<br />
Pathologie mit klinischen Demonstrationen‘ psychiatrisches Lehrgebiet betritt,<br />
bis zu seiner Emeritierung 1920 die von Heinroth als Kontinuität begründete<br />
Tradition fortsetzen.<br />
Holger Steinberg<br />
88
Paul Drude<br />
Zum 100. Todestag am 5. Juli <strong>2006</strong><br />
Die Anfänge der Theoretischen Physik in Deutschland sind eng mit dem<br />
Namen von Paul Drude verbunden. In seinem Lebenswerk spiegelte sich,<br />
wie Max Planck schreibt, „die Geschichte der Physikalischen Optik seiner<br />
Zeit“ wider. Von seiner frühen Tätigkeit in <strong>Leipzig</strong>, 1894 – 1900, ist er als<br />
außergewöhnlich guter akademischer Lehrer bekannt. In Berlin leitete Drude<br />
ein Physikalisches Institut, das einst von Hermann Helmholtz begründet<br />
worden ist.<br />
89
Im Jahre 1894 erhielt das Physikalische Institut der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, in dem<br />
man sich vorrangig mit dem physikalischen Experiment als Grundlage des Faches<br />
befasste, eine Abteilung für theoretische Physik, die das Experiment mathematisch<br />
formulierte, ehe es erprobt wurde. 35 Jahre später erlangte sie – inzwischen<br />
ein selbstständiges Institut – Weltgeltung durch die Entwicklung<br />
der Quantenmechanik und ihre Anwendung auf die Struktur der Materie, die<br />
mit der Berufung Werner Heisenbergs auf den <strong>Leipzig</strong>er Lehrstuhl für theoretische<br />
Physik verbunden war.<br />
Bereits im Februar 1894 hatte die Philosophische Fakultät dem Kultusministerium<br />
dargelegt, „wie wichtig die Errichtung einer außerordentlichen Professur<br />
der theoretischen Physik für die Ausbildung der Studierenden der Physik“ sei.<br />
Das Ministerium schloss sich dieser Meinung an und berief Hermann Ebert,<br />
der aber nach nur wenigen Monaten einem Ruf an die Tierärztliche Hochschule<br />
in Hannover folgte.<br />
Über dem „Goldenen Zeitalter der Atomphysik“, wie Heisenberg die ersten<br />
Jahre seiner <strong>Leipzig</strong>er Tätigkeit genannt hat, kann jener hochbegabte Physiker<br />
in Vergessenheit geraten, mit dem das <strong>Leipzig</strong>er theoretisch-physikalische Institut<br />
eigentlich seinen Anfang nahm, Paul Drude. Er lehrte theoretische Physik<br />
vom Wintersemester 1894 an bis zu seinem Weggang nach Gießen im Jahre<br />
1900. Dem damaligen Rang seiner Abteilung gemäß, hatte er nur eine außerordentliche<br />
Professur inne und gehörte der Königlich Sächsischen Gesellschaft<br />
der Wissenschaften nur als außerordentliches Mitglied an, was besagt, dass er<br />
in der mathematisch-physischen Klasse zwar Vorträge halten und sie in den<br />
Akademieschriften publizieren durfte, bei Wahlen aber nicht stimmberechtigt<br />
war. Er stand in <strong>Leipzig</strong> immer im zweiten Glied und musste dem Aufstieg<br />
anderer zusehen, ohne selbst aufzurücken – ein Opfer der Prinzipienreiterei des<br />
damaligen Sächsischen Kultusministers, der jede Beförderung am Ort ablehnte<br />
und damit die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> einer hervorragenden Kraft beraubte.<br />
1900 wurde Drude ordentlicher Professor der Physik in Gießen, 1905 ging er als<br />
Nachfolger von Hermann Helmholtz, August Kundt und Emil Warburg nach Berlin.<br />
Diesen Vorbildern wollte er nachstreben und sich an ihnen messen lassen.<br />
Am 28. Juni 1906 hielt er nach seiner Wahl zum ordentlichen Mitglied vor der<br />
Berliner Akademie seine Antrittsrede, dankbar für die Ehre und voller Zuversicht<br />
im Blick auf künftige wissenschaftliche Pläne, aber auch in Sorge, „dass<br />
die eigene Fähigkeit und Arbeitskraft“ nicht ausreichen könnte für die gestellten<br />
Aufgaben. Am 5. Juli 1906 setzte er, 43-jährig, seinem Leben ein Ende. Sein<br />
Tod erschütterte die gesamte physikalische Welt. Die ausführlichste und ergrei-<br />
90
fendste Gedächtnisrede hielt ihm Max Planck vor der Deutschen Physikalischen<br />
Gesellschaft, deren Zeitschrift, die Annalen der Physik, Paul Drude von 1900<br />
bis zu seinem Tode als Redakteur betreut hatte, unbestechlich und mit klarem<br />
Blick für neue, zukunftsweisende Gedanken.<br />
Postum wurden Stimmen laut, Drude wäre nicht so tragisch geendet, hätte<br />
er in <strong>Leipzig</strong> bleiben und kontinuierlich weiterarbeiten können. Oskar Drude,<br />
Professor der Botanik und drei Jahrzehnte lang Direktor des Dresdner Botanischen<br />
Gartens, bestätigte den Bruch im Leben seines Halbbruders, den der<br />
Wegzug aus <strong>Leipzig</strong> mit sich gebracht habe.<br />
Paul Drude hinterließ seine Frau Emilie, geb. Regelsberger, die fortan mit den<br />
Kindern Gisela (geb. 1900), Gerthe (1901) und Burkhard (1903) in Göttingen<br />
lebte. Burkhard studierte später Physik und gehörte zu den Göttinger Studienfreunden<br />
von Werner Heisenberg.<br />
Noch ein zweites Mal hatte Paul Drude auf der Vorschlagsliste der Philosophischen<br />
Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> gestanden, 1902 in Nachfolge von Ludwig<br />
Boltzmann, an zweiter Stelle hinter Willy Wien. Beide lehnten ab. Drude blieb<br />
aus Pflichtgefühl in Gießen, wie er später aus Pflichtgefühl den größten deutschen<br />
Lehrstuhl für theoretische Physik in Berlin annahm. Zuvor hatte er ehrenvolle<br />
Rufe nach Marburg, Tübingen und Breslau abgelehnt. Welch hohen Stellenwert<br />
die theoretische Physik 1902 in <strong>Leipzig</strong> einnahm, bezeugt ein Gutachten von<br />
Heinrich Bruns (Mathematik, Astronomie), Otto Wiener (Physik) und Wilhelm<br />
Ostwald (Physikalische Chemie) für das Kultusministerium in Dresden: „Die<br />
Unterzeichneten fühlen sich zu persönlicher Anteilnahme verpflichtet; dass die<br />
Erziehung der Studierenden der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer in<br />
entscheidender Weise durch den Vertreter der theoretischen Physik beeinflusst<br />
wird, und dass daher vitale Interessen der ihnen anvertrauten Unterrichtsgebiete<br />
in Frage stehen“, falls das Fach unbesetzt bliebe.<br />
Dennoch waren die Fachkollegen einhellig der Ansicht, dass Paul Drude auf der<br />
Höhe seines Wirkens stand und mit Plänen aller Art für die nahe und fernere Zukunft<br />
beschäftigt war, als er seinem Leben plötzlich ein Ende setzte. Betrachtet<br />
man sein wissenschaftliches Werk als ein Ganzes, so kann man sagen, dass sich<br />
in ihm die Geschichte der physikalischen Optik seiner Zeit widerspiegelt. Drude<br />
begann mit theoretischen und anschließend experimentellen Untersuchungen<br />
über die Reflexion des Lichtes und wandte sich dann unter dem Eindruck der<br />
Entdeckungen von Heinrich Hertz den Eigenschaften des elektromagnetischen<br />
Feldes und ihrem Zusammenhang mit optischen Erscheinungen zu. Aus diesen<br />
91
Bemühungen entstand 1894 sein bekanntestes Werk, „Die Physik des Äthers<br />
auf elektromagnetischer Grundlage“, das den neuen Anschauungen den Weg<br />
bereitet hat. Neue von Drude entwickelte Ansätze, er stellte sogar die Annahme<br />
eines Äthers infrage, beeinflussten Einsteins spätere Arbeit zur speziellen Relativitätstheorie.<br />
Einen besonderen Ansporn für seine Arbeit über elektrische<br />
Wellen gaben Drude die technischen Aufgaben der drahtlosen Telegraphie,<br />
deren physikalische Seite ja in ganz enger Beziehung mit seinem Fachgebiet<br />
steht. Eben diesen und anderen Fragen wollte er in Zukunft all seine Kraft<br />
zuwenden. „Im Mittelpunkt seines Strebens“, schreibt Max (von) Laue, „stand<br />
die Optik.“ Die Hauptresultate seiner optischen Untersuchungen hat Drude 1900<br />
in seinem Lehrbuch der Optik vereinigt, das durch die klare und lebendige Sprache<br />
zur Einführung in das Studium der Optik wie kein zweites geeignet war. In<br />
seinem Todesjahr erschien bereits die zweite Auflage, und 1912 kam die 3. Auflage<br />
heraus. Seinen Namen trägt das sogenannte Drude-Sommerfeld-Modell<br />
zu Elektronentheorie der Metalle. Es wurde 1900 von Drude entwickelt und<br />
1933 auf der Grundlage von Debyes Quantentheorie der spezifischen Wärme<br />
von Sommerfeld und Hans Bethe vervollständigt. Eine weitere Ehrung folgte<br />
viele Jahrzehnte später: Seit 1992 heißt das Berliner Institut für Festkörper-<br />
elektronik „Paul-Drude-Institut“.<br />
Im Jahre 1900 hat Paul Drude <strong>Leipzig</strong> verlassen. Jede Geschichte der <strong>Leipzig</strong>er<br />
Physik wird ihn als genialen Theoretiker und exakten Experimentator nennen.<br />
Gerald Wiemers<br />
92
Robert Schumann<br />
Zum 150. Todestag am 29. Juli <strong>2006</strong><br />
Vor 150 Jahren, am 29. Juli 1856, ist Robert Schumann in Endenich bei<br />
Bonn gestorben. Der Mutter zuliebe hatte er sich in <strong>Leipzig</strong> zunächst an<br />
der Juristenfakultät eingeschrieben, bevor er sich ganz der Musik ergab. In<br />
<strong>Leipzig</strong> lebte er mit Unterbrechungen von 1828 bis 1844, hier fand er seine<br />
Bestimmung als Komponist und schuf viele seiner wichtigsten Werke.<br />
93
Am 29. Juli 1856 ist Robert Schumann in Endenich bei Bonn in einer Heilanstalt<br />
verstorben. Über zwei Jahre lang hatte er nach seinem Zusammenbruch<br />
im Februar 1854 in einer Heilanstalt unter der Aufsicht von Dr. Franz Richarz,<br />
ihrem Gründer und Leiter, leben müssen, zeitweise in geschlossenem Vollzug.<br />
Legenden spinnen sich um das traurige Schicksal des berühmten Komponisten<br />
und seine geheimnisvolle Krankheit. Clara Schumann, seit 1840 mit Robert verheiratet<br />
und Mutter acht gemeinsamer Kinder, besuchte ihren Gatten auf Anraten<br />
des Arztes nicht, erst zu seinem Tod wurde sie herbeigerufen. Aber Johannes<br />
Brahms und Joseph Joachim empfing Robert Schumann, auch Bettina Brentano<br />
(verheiratete von Arnim), die Clara ausdrücklich um die Erlaubnis gebeten hatte,<br />
den Kranken aufsuchen zu dürfen. Doch Bettina fand Robert anscheinend in<br />
einem günstigen Augenblick recht ausgeglichen vor und machte Clara anschließend<br />
heftige Vorwürfe wegen der Unterbringung in der elenden Irrenanstalt:<br />
Robert habe lediglich einen nervösen Anfall erlitten, der wahre Kranke sei sein<br />
Arzt, Dr. Richarz. Später kamen noch schlimmere Gerüchte auf, zumal der junge<br />
Johannes Brahms sich im selben Haus wie Clara in Düsseldorf einquartiert und<br />
ihr in der schweren Zeit beigestanden hatte. Sollte die berühmte Pianistin ihren<br />
zunehmend unfähigen Mann zugunsten eines vielversprechenden jungen Genies<br />
abserviert haben? War nicht Claras letztes Kind im Juni 1854 geboren worden,<br />
als Robert schon in der Heilanstalt eingesperrt war?<br />
Erst im Jahre 1994 wurden die Aufzeichnungen von Schumanns Arzt bekannt,<br />
Richarz hatte Schumanns Krankenakte in seinen persönlichen Besitz übernommen.<br />
Sie war im Familienbesitz geblieben und stets als tiefes Geheimnis bewahrt<br />
worden, bis Aribert Reimann sie der Akademie der Künste zu Berlin übergeben<br />
und bekannt gemacht hat. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Schumann<br />
mit Syphilis infiziert war und an progressiver Paralyse litt. Nichts ist wahr an<br />
den Verdächtigungen der Verschwörung und Intrige, sie belegen nur die Sensationsgier<br />
der Öffentlichkeit an einem hochberühmten Künstlerehepaar, dessen<br />
Verbindung in einem dramatischen Prozess erkämpft werden musste.<br />
Robert Schumann kam aus einem kunstsinnigen Haus in Zwickau: Sein Vater<br />
betätigte sich als Schriftsteller und betrieb erfolgreich einen Verlag, seine Mutter<br />
war musikalisch veranlagt und förderte sehr erfolgreich Roberts Begabungen.<br />
Dabei erwies sich der Knabe als außerordentlich talentiert für die Künste, er<br />
zeigte ausgezeichnete schriftstellerische Fähigkeiten und begeisterte sich für die<br />
Dichtkunst. Doch fesselte ihn die Musik nicht weniger, er bildete sich während<br />
seiner Schulzeit weiter, verzichtete aber auf Anraten der Mutter zunächst auf<br />
eine musikalische Laufbahn und ging 1828 zum Jurastudium nach <strong>Leipzig</strong>.<br />
Heimlich aber begann er eine musikalische Ausbildung, ein Studienaufenthalt in<br />
94
Heidelberg vertiefte Schumanns Überzeugung, die Musik zum Beruf zu wählen,<br />
zurück in <strong>Leipzig</strong> setzte er den Unterricht bei dem bekannten Lehrer Friedrich<br />
Wieck fort, der mit dem Lehrerfolg an seiner Tochter Clara zu überzeugen wusste.<br />
Bereits mit 9 Jahren gab Clara Wieck unter Anleitung ihres Vaters öffentliche<br />
Konzerte (1828) und unternahm seit 1831/1832 erfolgreich Konzertreisen durch<br />
ganz Europa. Friedrich Wieck schien der rechte Lehrer, auch Robert Schumann<br />
zum Klaviervirtuosen heranzubilden. Endlich gab die Mutter ihre Einwilligung,<br />
aber obwohl Robert sogar in das Haus seines Lehrers einzog und sich ernsthaft<br />
den Übungen unterwarf, wurde der pianistische Durchbruch nicht erreicht. Vor<br />
allem blieb Robert hinter den Fähigkeiten der neun Jahre jüngeren Clara zurück,<br />
die pianistische Aufgaben schneller und leichter bewältigte als Robert. Mit Fingerdehnungsapparaten<br />
suchte Robert den Erfolg zu erzwingen, aber er zog sich<br />
eine »Erlahmung« der rechten Hand zu, die sich seit Oktober 1831 bemerkbar<br />
und seine Absicht von einer Virtuosenkarriere zunichte machte. Nun warf er sich<br />
mit Macht auf das Komponieren, das er bislang zwar breit in allen Gattungen,<br />
aber eher nebenher, halbherzig betrieben hatte, und komponierte eine Symphonie<br />
g-Moll, auch »Jugendsymphonie« oder »Zwickauer« genannt. Der erste Satz<br />
der Symphonie wurde tatsächlich aufgeführt, er erklang am 18. November 1832<br />
im Saal des Gewandhauses zu Zwickau, eine zweite und dritte Fassung am 12.<br />
oder 18. Februar 1833 in Schneeberg und am 29. April 1833 in <strong>Leipzig</strong>. Doch<br />
auch hier gelang kein Durchbruch, der mangelnde Erfolg und die Kritik, etwa<br />
auch Friedrich Wiecks Anmerkung, die Symphonie sei „zu mager instrumentiert“,<br />
ließ Schumann an seiner Bestimmung als Komponist zweifeln. Ernüchtert<br />
wandte er sich seit Mitte 1833 verstärkt der Aufgabe eines Musikschriftstellers<br />
zu und hatte endlich Erfolg: 1834 gründete er die „Neue Zeitschrift für Musik“,<br />
sie erscheint bis heute.<br />
Wenn Schumann in der folgenden Zeit komponierte, so offenbar nicht zufällig<br />
und mit Absicht vor allem für das Klavier (andere Kompositionspläne wurden<br />
nicht fertig). Die ersten 23 seiner mit Opuszahlen versehenen Werke sind ausschließlich<br />
Klavierwerke, erst mit op. 24, dem Liederkreis nach Heinrich Heine<br />
für eine Singstimme und Klavier, durchbrach er die Selbstbeschränkung. Nun<br />
aber mit Macht: Es war das Jahr 1840, das als Schumanns „Liederjahr“ berühmt<br />
wurde. Allein die Menge der Liedkompositionen ist beeindruckend. Es entstanden<br />
in diesem Jahr: op. 25 Myrthen (26 Lieder), op. 30 Drei Gedichte nach Emanuel<br />
Geibel, op. 31 Drei Gesänge nach Adelbert von Chamisso, op. 35 Zwölf Lieder<br />
(Justinus Kerner), op. 36 Sechs Gedichte aus Robert Reinicks »Lieder eines<br />
Malers«, op. 39 Liederkreis nach Joseph Freiherrn von Eichendorff, op. 40 Fünf<br />
Lieder (vier nach Hans Christian Andersen), op. 42 Frauenliebe und Leben (acht<br />
Lieder nach Adelbert von Chamisso), op. 45 und 49 Romanzen und Balladen für<br />
95
eine Singstimme und Klavier, Heft I und II (sechs Lieder), op. 48 Dichterliebe.<br />
Liederkreis aus Heinrich Heines »Buch der Lieder« (16 Lieder) und noch zehn<br />
weitere Opuszahlen. Die Schaffensexplosion Schumanns wird sehr glaubhaft mit<br />
der großen Liebe zu Clara und der Eheschließung am 12. September 1840 in der<br />
Dorfkirche zu Schönefeld bei <strong>Leipzig</strong> in Verbindung gesetzt, und dies war eine<br />
wirklich hart erstrittene Familiengründung. Seit 1834 fühlte sich Robert unwiderstehlich<br />
zu Clara hingezogen, die seine Zuneigung erwiderte. Nach einem<br />
heimlichen Treffen hinter dem Rücken des Vaters kam es 1836 zum offenen<br />
Bruch mit Friedrich Wieck, der künftig mit allen Mitteln die Verbindung zu verhindern<br />
suchte. Er schickte Clara auf Konzertreisen und verbot brieflichen Verkehr,<br />
er schirmte Clara in <strong>Leipzig</strong> systematisch vor Robert ab und verunsicherte<br />
ihn durch Simulation anderer ernsthafter Bewerber um Clara. Doch der Kontakt<br />
riss nie ganz ab, fand vielmehr Ausdruck in „Brautbriefen“, die ob ihrer Innigkeit<br />
berühmt geworden sind. Wegen der Weigerung, der Hochzeit zuzustimmen und<br />
aufgrund der öffentlichen Verleumdung Roberts reichte das seit August 1837<br />
heimlich verlobte Paar 1839 eine Klage gegen Friedrich Wieck beim <strong>Leipzig</strong>er<br />
Appellationsgericht ein. Es wurde von zahlreichen Freunden und Verwandten<br />
unterstützt, natürlich erregte der Vorgang öffentliches Aufsehen. Der Ausgang<br />
war glücklich für das Paar, Friedrich Wieck wurde sogar wegen übler Nachrede<br />
zu 18 Tagen Gefängnis verurteilt.<br />
Eine glückliche Zeit begann, Robert Schumann etablierte sich als Komponist,<br />
indem er sein Schaffenspotential systematisch ausweitete: Auf das „Liederjahr“<br />
1840 folgten 1841 das „sinfonische Jahr“, 1842 das „kammermusikalische Jahr“,<br />
1843 das „Oratorienjahr“. Schumann schuf in dieser Zeit einige seiner bekanntesten<br />
Werke: 1841 op. 38 Symphonie Nr. 1 B-Dur (»Frühlingssymphonie«),<br />
op. 52 Ouvertüre, Scherzo und Finale für Orchester und den ersten Satz des<br />
Klavierkonzerts a-Moll op. 54; 1842 op. 41 Drei Streichquartette, op. 44 Klavierquintett<br />
Es-Dur und op. 47 Klavierquartett Es-Dur; 1843 op. 50 Das Paradies<br />
und die Peri. Dichtung aus »Lalla Rookh« von Thomas Moore für Soli, Chor<br />
und Orchester, ein „Oratorium, aber nicht für den Betsaal – sondern für heitre<br />
Menschen“, Schumanns Annäherung an die Oper. 1844 greift er zu Goethes<br />
„Faust“, aber eine große Krise holt ihn ein, die Krankheit wirft Robert nieder.<br />
Umstritten ist, inwieweit das Zusammenleben der zwei großen Künstler trotz<br />
der engen Verbundenheit durch äußere Umstände belastet wird, zumal Claras<br />
öffentliche Erfolge den Ruhm Roberts überstrahlen. Das Paar übersiedelt zur<br />
Genesung nach Dresden, aber trotz schöner Erfolge und wachsender Anerkennung<br />
bleibt Schumann ohne feste Anstellung, bis er 1850 als Musikdirektor zum<br />
Nachfolger seines Freundes Ferdinand Hiller nach Düsseldorf berufen wird. Wie<br />
exotisch dieser Schritt für den Sachsen war, geht aus seiner Bemerkung hervor,<br />
96
Düsseldorf liege doch etwas abseits vom Weg der Reisenden. Nach anfänglichen<br />
Erfolgen holte Schumann aber auch in Düsseldorf seine Krankheit wieder ein,<br />
so dass es zu dem endgültigen Zusammenbruch kam: Am Rosenmontag, dem<br />
27. Februar 1854, geht Schumann im Schlafrock mit Filzschuhen auf die nahe<br />
Rheinbrücke, wirft seinen Ehering ins Wasser und springt hinterher.<br />
Selbst in seinem verzweifelten Irrsinn entspricht Robert Schumann noch dem<br />
Ideal des romantischen Künstlers, bei dem Genie und Wahnsinn ineinander übergehen.<br />
Und welchen Stoff gibt die romantische Liebesgeschichte mit Clara ab!<br />
Vor allem seine frühen Kompositionen wurden fester Bestandteil des klassischromantischen<br />
Musikrepertoires. Sie vereinen nahezu alles, was als musikalische<br />
Romantik bezeichnet werden darf: kleine, poetische Klavierstücke an Stelle<br />
der klassischen großen Sonate, literarische Sujets phantastischer, exotischer<br />
oder folkloristischer Provenienz, subjektive Emphase großer Ausdrucksstärke,<br />
harmonische Experimente als Ausweitung des Klangspektrums, formale Gestaltung<br />
in der Spannung von Auflösung und Einfachheit, all dies ist in Schumanns<br />
frühen Werken zu finden. Problematisch wurde lange Zeit seine weitere kompositorische<br />
Entwicklung eingeschätzt: „Schumann hat sich vom Genie zum<br />
Talent heruntergearbeitet“, so lautete ein böses Wort von Felix Draeseke. Es war<br />
die Auseinandersetzung mit Schumanns Krankheit, die Vorbehalte provozierte,<br />
selbst bei Clara, Johannes Brahms und Joseph Joachim. Heute diagnostizieren<br />
Musikwissenschaftler im Spätwerk Schumanns eine Tendenz zum Realismus im<br />
Zusammenhang mit den revolutionären Bewegungen der Zeit um 1848. Aber so<br />
etwas Prosaisches läuft der Vorstellung vom idealen Romantiker natürlich direkt<br />
zuwider …<br />
Helmut Loos<br />
97
Wegbereiter der Chemie<br />
Zum 300. Todestag Johann Christian Schambergs am<br />
4. August <strong>2006</strong> und 325. Todestag von Michael Heinrich<br />
Horn am 16. Oktober <strong>2006</strong><br />
Am 4. August 1706 – vor 300 Jahren – starb Johann Christian Schamberg<br />
(Abb.). Der zweite Extraordinarius für Chymie war Professor für Anatomie,<br />
Chirurgie und Physiologie, Rektor 1702 und 1706, ein Wegbereiter<br />
der Chemie an der <strong>Universität</strong> und Erbauer des Anatomischen Theaters<br />
(1704). Er folgte Michael Heinrich Horn, dem ersten Chemieprofessor an<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, an dessen 325. Todestag zu erinnern ist.<br />
99
Die Chemie hat sich an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> im Schoße der Medizinischen Fakultät<br />
vor mehr als 300 Jahren entwickelt. Einer der ersten, der in <strong>Leipzig</strong> nachhaltig<br />
die Chymie beförderte, war Johann Christian Schamberg (1667 – 1706).<br />
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zeit davor und gedenken Michael<br />
Heinrich Horns (1623 – 1681).<br />
In Johann Heinrich Zedlers Grosses Vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften<br />
und Künste (1735, 12. Band, S. 875) finden wir über ihn: Horn (Michael<br />
Henrich) aus Thüringen / war Philos. und Medicinae Doctor, Pathologiae<br />
Ordinarius und Chymiae Extraordinarius, Professor zu <strong>Leipzig</strong> /der Academiae<br />
Decemuir, wie auch des Churfürsten zu Sachsen / und Ertz-Bischoffs zu Magdeburg<br />
Leibmedicus, starb an 1681, den 16. Oct. im 58. Jahre / und hat verschiedene<br />
Disputationes Medicus gehalten. Michael Heinrich Horn, im Jahre 1668 zum<br />
Chymiae Extraordinarius ernannt, war begütert und einflussreich. Davon zeugt,<br />
dass er schon im Jahre 1659 das damalige Dorf „Gohlis“ und 1669 das Dorf<br />
„Möckern“ mit dem Sattelhof in Form eines Ritterguts erwarb (Stadtlexikon<br />
<strong>Leipzig</strong>, 2005) und das Erblehensrecht in Großlehna besaß. Auch die Errichtung<br />
eines großen Epitaphs in der Paulinerkirche für ihn, der im Jahre 1677 Rektor<br />
war, geschaffen 1686 von Johann Caspar Sandtmann (1642 – 1695), spricht<br />
dafür. Die originale Bildnisbüste Horns ist in der Kustodie, eine Replik davon<br />
seit 1999 im Neubau der Fakultät für Chemie und Mineralogie zu sehen. Sein<br />
Vorgänger im Ordinariat der Pathologie – eine der vier Professuren alter Stiftung<br />
der Medizin neben Chirurgie/Anatomie, Physiologie und Therapie – war Sigismund<br />
Rupert Sultzberger. Horn folgte ihm 1675 auf die Pathologie-Professur.<br />
Nach Horns Ableben im Jahre 1681 wurde Martin Friedrich Friese (Amtszeit<br />
1682 – 1700) darauf berufen. Darüber existiert im <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong> eine interessante<br />
Acta mit einem Brief des Kurfürsten Johann Georg (Repert I./VIII.<br />
No. 20) und des Inhalts, dass das sowohl von Friese wie auch von Johann Bohn<br />
(1640 – 1718), einem der gelehrtesten Ärzte des 17. Jahrhunderts (1668 Professor<br />
für Anatomie und Chirurgie; Rektor 1693/94; Begründer der Medicina<br />
forensis), beanspruchte Hornsche Pathologie-Ordinariat an M. F. Friese mit der<br />
Auflage gegeben wird, sozusagen als Ausgleich an J. Bohn, den man besonders<br />
auch seiner Anatomie-Kunst und der Beliebtheit unter den Studenten wegen bei<br />
seiner bisherigen professio halten wollte, jährlich 40 Gulden aus den Einkünften<br />
der Collegiatur zu zahlen. Zur Nachfolge Horns bezüglich der Chemieprofessur<br />
ist darin nichts erwähnt. Im Zusammenhang mit den Pionieren der Chymie in<br />
<strong>Leipzig</strong> im 17. Jahrhundert sei auch Michael Ettmüller (1644 – 1683) genannt,<br />
der als Vertreter der Chemiatrie versuchte, deren Grundsätze auf Physiologie<br />
und Pathologie anzuwenden. Das von ihm verfasste Werk Chemia experimen-<br />
100
talis atque rationalis curiosa war über längere Zeit hinweg ein beachtetes Lehrbuch<br />
der Chemie und Pharmazie.<br />
Schamberg (Johann Christian). Ein Medicus, gebohren zu <strong>Leipzig</strong> 1667, den<br />
21. April, studirte daselbst, lernte hernach die Probir-Kunst zu Freyberg, gieng<br />
nach Altorff und Leiden, worauf er 1689 Doctor der Medicin wurde, und sich<br />
nachgehends, sonderlich durch seine Geschicklichkeit, die er bey harten Geburten<br />
gezeiget, berühmt machte. Im Jahre 1693 wurde er Assesor in der Medicinischen<br />
Facultät, hernach außerordentlicher Professor der Chymie, weiter<br />
ordentlicher Professor der Physiologie und endlich der Anatomie; schrieb 1) Lineamenta<br />
prima pharmaciae chymiae <strong>Leipzig</strong>; 2) Dissertationes de gustu; 3) de<br />
remediis stochachicis; 4) de respirationae laesa; trug viel dazu bey, dass das<br />
schöne Anatomische Theater zu <strong>Leipzig</strong> erbauet wurde, sammelte auch ein schön<br />
Cabinet von raren physicalischen Sachen, und that sich durch Experimental-Collegia<br />
herfür, starb endlich, als er zum andernmal Rector Magnificus war, 1706,<br />
den 4. Augusti im 40. Jahre, und war also der dritte, welcher in dieser Würde<br />
zu <strong>Leipzig</strong> verstorben. So aussagekräftig ist die Biografie von Johann Christian<br />
Schamberg im 34. Band von Johann Heinrich Zedlers Universal-Lexicon, Anno<br />
1742, vermerkt. Zusätzlich kann man in Allgemeine Deutsche Biographie, 30.<br />
Band, <strong>Leipzig</strong> 1890 (S. 570) über ihn finden, dass er sich ganz besonders mit<br />
Geburtshülfe, prakt. Medicin und naturwissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt<br />
hat, und – in unserem Kontext wesentlich: S. war auch ein tüchtiger Chemiker.<br />
Naturwissenschaftlich interessierte Studenten haben sich zu jener Zeit gern in die<br />
Medizin begeben, weil sich dort, durch die Iatrochemie befördert, Möglichkeiten<br />
boten, ein Betätigungsfeld für experimentelle Neigungen zu finden. So ist folgerichtig,<br />
dass Johann Christian Schamberg in Freiberg anfangs Probier-Kunde<br />
studierte, worunter man damals die Vorprobenuntersuchung von Mineralien und<br />
Erzen verstand. Die Anwendung mineralischer Stoffe in der Medizin erlebte mit<br />
den der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> eng verbundenen Georgius Agricola (1494 – 1555)<br />
und Johannes Agricola (1590 – 1668) sowie mit Paracelsus (1493 – 1541) eine<br />
Renaissance. Sehr interessant ist, dass sich Schamberg dann zunächst an die<br />
<strong>Universität</strong> Altdorf bei Nürnberg begab. Wir wissen zwar (noch) nicht, welche<br />
Collegs er belegt hat. Fest steht aber, dass im Jahre 1683 dort ein Chemisches<br />
Laboratorium mit der Eröffnungsrede De necessitate et utilitate chemiae des<br />
Medizinprofessors Moritz Hoffmann (1621 – 1698) eingeweiht worden war,<br />
das unter der Leitung seines Sohnes und ab demselben Jahr tätigen ersten Chemieprofessors<br />
Johann Moritz Hoffmann (1653 – 1727) als exemplarisch und<br />
vorbildlich für die Frühzeit der universitär betriebenen Chemie in Deutschland<br />
angesehen werden kann. Es war vorzüglich mit Gerätschaften ausgestattet. Auf<br />
101
einem Medaillon stand geschrieben: Wer du auch seiest, der diesen Ort betritt,<br />
wisse, dass er arbeitsreiche Wonne, nicht faule Ruhe nährt …“. Beim Eintritt in<br />
das Labor „ist in der Mitte des Zimmers eine lange Tafel benebst einer Cathedra<br />
zu sehen, welche zu Dozierung und Anhörung der, von dem Herrn Chemiae<br />
Doctore vorhabenden Doctrin, worinnen er die Theoriam mit der Praxi zugleich<br />
zeiget“.<br />
Das alles war wohl eindrucksvoll für den jungen Studenten Schamberg, der dann<br />
an der bereits 1575 gegründeten, weitbekannten <strong>Universität</strong> Leiden seine Studien<br />
fortsetzte und schließlich zurück in seiner Geburtstadt <strong>Leipzig</strong> im Jahre 1689<br />
als Medicinae Baccal. seine Magister(Doktor)arbeit „Über den Geschmack“, betitelt<br />
DE GUSTU ex recentiorum philosophorum hypothesis einreichte und verteidigte.<br />
Diese Arbeit ist mit Datum 11. September 1689 gedruckt worden und<br />
besteht aus 18 Seiten mit 42 Thesen in lateinischer Sprache (<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
<strong>Leipzig</strong>, Phil. Fac. C2, 1689, Nr. 19). Das terminbedingt zugegeben flüchtige<br />
Studium erhellt, dass Schamberg versucht, chemische Sachverhalte (§ 25: Säuren,<br />
Alkalien, gesättigte Salze, Mischungen …) mit dem „Geschmack“ (bitter,<br />
süß, …) in Beziehung zu setzen, und es werden u. a. Eigenschaften von Stoffen<br />
charakterisiert (§ 38: Vitriolum representabat rhomboideces figuras …, Sale marino<br />
in aqua simple dissolute …, Sal ammoniacum ramusculos arborum irregularibus<br />
foliis …). Natürlich hat Schamberg in diesen Jahren seine medizinischen<br />
Kenntnisse und Fertigkeiten vervollkommnet, denn sonst wäre wohl kaum sein<br />
akademischer Aufstieg im Jahre 1693 zum Assessor an der Medizinischen Fakultät<br />
erfolgt. Der Orientierung auf chemische Sachverhalte galt sein besonderes<br />
Interesse, was aus der im Jahre 1699 erfolgten Berufung auf das seit Michael<br />
Heinrich Horns Ableben vakante Extraordinariat für Chymie zu folgern ist.<br />
Immerhin blieb diese Stelle – im Gegensatz zur o. g. Pathologie-Professur – 18<br />
Jahre lang unbesetzt. Die Berufung bzw. Ernennung dazu in der Urkunde des<br />
Von Gottes gnaden, Friedrich August König in Pohlen & Hertzog zu Sachßen,<br />
Julich, Clev Berg, Engern und Westphalen Churfürst, datiert Dressden am 19.ten<br />
May ad 1699 und unterzeichnet von Gottfried Hermann von Bruhlingen, lautet<br />
(<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong> <strong>Leipzig</strong>, Mediz. Fak. A IV.4, S. 1 – 2):<br />
102<br />
Hochgelehrte und lieben getreuer, Demnach die Professio extraordinaria<br />
Chymia, welche hirbei von Dr. Michael Heinrich Hornen aufgetragen gewesen,<br />
Zeitherr erlediget gewesen und Wiro der nothdurfft befinden solche<br />
vorirzo wiederumb ersezen zulassen, auch solche D. Johann Christian<br />
Schambergern auff dessen Geschehens unterthänigste ansuchen und ohne<br />
einzige Besoldung auffzutragen entschlossen, gestalt Wiro in Krafft dieß<br />
dazu confirmiren und bestetigen. Daß ist hiermit unser Begehren ihr wol-
let ihm bewilte Professionem extraordinariam, wie dieselbe obbesagter<br />
Doct. Horn vormahls gehabt gebührend anweisen nach ernennung Daran<br />
gescheht Unserer meinung.<br />
So wurde J. S. Schamberg im jugendlichen Alter von 32 Jahren Professor der<br />
Chemie. Kurz darauf folgten noch die Ordinariate für Physiologie und schließlich<br />
Anatomie. Mit seiner Wahl zum Rektor im Sommersemester 1702 und der<br />
Errichtung des Anatomischen Theaters im Jahre 1704 unter seiner Leitung hatte<br />
er in kurzer zeitlicher Abfolge eine bedeutende Stellung in der <strong>Universität</strong>shierarchie<br />
eingenommen, die mit der zweiten Wahl zum Rector Magnificus am 23.<br />
April 1706 kulminierte. Der Tod beendete jäh am 4. August 1706 nach gerade<br />
3 Monaten im Amt diese hoffnungsvolle Karriere im 39. Lebensjahr. Johann<br />
Christian Schamberg ist es, wenn man aus gehörigem zeitlichem Abstand sein<br />
Wirken für die Chemie einschätzt, wesentlich zu verdanken, dass sich diese<br />
Wissenschaft an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> in der Medizinischen Fakultät etablierte<br />
und sie über sein Ableben hinaus ununterbrochen in Form von Chemieprofessuren<br />
erhalten blieb. Im Jahre 1707 wurde das Extraordinariat für Chymie mit<br />
Martin Naboth (1675 – 1721; Funktionszeit bis zu seinem Lebensende) besetzt.<br />
Bereits 1710 berief man auf die erste ordentliche Professur für Chemie Johann<br />
Christoph Scheider (1681 – 1713), der aber wegen der Widerstände, die sich<br />
ihm bei der Errichtung eines Chemischen Laboratoriums stellten, schon nach<br />
zwei Jahren entnervt die <strong>Universität</strong> verließ. Auf M. Naboth folgten (Amtszeiten<br />
in Klammern) als ordentliche Professoren für Chemie Adam Friedrich Petzold<br />
(1722 – 1761), Anton Riediger (1762 – 1783) und schließlich Christian Gotthold<br />
Eschenbach (1784 – 1830). Letzerem gelang es, das erste Chemische <strong>Universität</strong>slaboratorium<br />
im Jahre 1805 in der Pleißenburg einzurichten.<br />
Glücklichen Umständen verdankt es die <strong>Universität</strong>, dass trotz des Verlustes<br />
eines wertvollen Porträtbildnisses Schambergs von David Hoyer (1670 – 1728)<br />
durch die Zerstörung des Augusteums am 3. Dezember 1943 ein danach angefertigter<br />
Kupferstich des Künstlers Martin Bernigeroth (1670 – 1733) erhalten<br />
geblieben ist. Das hier abgebildete Gemälde aus der Werkstatt von David Hoyer<br />
zeigt Johann Christian Schamberg mit dem Rektormantel, einem purpurfarbenen<br />
Umhang mit teilweisem Hermelinbesatz. Es gehört zum historischen Besitz der<br />
<strong>Universität</strong> und befindet sich im Anatomischen Institut.<br />
Lothar Beyer<br />
103
Institut für Ausländerstudium<br />
Zum 50. Jahrestag der Gündung am 1. September <strong>2006</strong><br />
Als 1956 das Institut für Ausländerstudium als Vorläufer des Herder-Instituts<br />
per Ministerbeschluss gegründet wurde, waren im Rahmen der Arbeiter-<br />
und Bauernfakultät seit 1951 bereits über tausend Studentinnen und Studenten<br />
aus 24 Ländern sprachlich und fachlich auf ein Studium in der DDR<br />
vorbereitet worden. Am Herder-Institut sollten es dann bis 1989 jährlich bis<br />
zu 500 Studierende sein.<br />
105
Der eigentliche Beginn des Ausländerunterrichts in <strong>Leipzig</strong> wird – fast schon legendenhaft<br />
– mit elf Nigerianern in Verbindung gebracht. Die noch junge DDR<br />
hatte sich mit Erfolg für den Sommer 1951 um die Ausrichtung der III. Weltfestspiele<br />
der Jugend und Studenten in Berlin /Ost beim Weltbund der demokratischen<br />
Jugend beworben. Die Idee, den Nigerianern ein kostenloses Studium<br />
an der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> zu ermöglichen, sollte als Akt der Solidarität mit<br />
nigerianischen Bergarbeitern gewertet werden, deren Aufstand 1949 in Enugu<br />
durch die britische Kolonialmacht niedergeschlagen worden war. Es war Signal<br />
dafür, dass ein internationales Projekt einem wirtschaftlich schwachen Land<br />
Bildungshilfe gewährt. Die elf nigerianischen Studenten, zehn Männer und eine<br />
Frau im Alter von 13/14 bis 28 Jahren, wurden in der damaligen Arbeiter- und<br />
Bauernfakultät (ABF) <strong>Leipzig</strong> eingeschrieben. Wegen der äußerst unterschiedlichen<br />
Bildungsvoraussetzungen war der Nachweis eines deutschen Abiturs<br />
Zulassungsvoraussetzung. Ein „Sonderlehrgang zur Erlernung der deutschen<br />
Sprache“ wurde eingerichtet. Die Ausbildung umfasste zwei Jahre. Zu diesen elf<br />
Nigerianern kamen 1951 noch vier bulgarische Studenten dazu. Im Studienjahr<br />
1952/1953 entsandte die Koreanische Volksdemokratische Republik, schon auf<br />
der Grundlage eines Regierungsabkommens, 102 Studenten. Es war die Zeit des<br />
Krieges in Korea. Weitere ausländische Studenten folgten.<br />
Die Gründung des Instituts für Ausländerstudium am 1. September 1956 war<br />
lediglich ein Verwaltungsakt, dem gewachsenen Ansehen geschuldet. Die Abteilung<br />
Ausländerstudium wurde aus der ABF herausgenommen. Amtierender<br />
Direktor blieb noch bis 1958 Paul Leonhardt.<br />
1958 übernahm eine Frau das Direktorenamt: Katharina Harig. Sie wurde mit<br />
einer Professur für Erziehungswissenschaft an das Institut berufen. Mit ihr begann<br />
das besondere pädagogische Bemühen im Unterrichtsprozess der sprachlichen<br />
und fachlichen Vorbereitung auf ein Hoch- bzw. Fachschulstudium in<br />
der DDR, die Entwicklung von Lehrmaterialien und Lehrmethoden und die<br />
Anleitung der Sprachabteilungen der <strong>Universität</strong>en, die schon seit 1954 studienbegleitenden<br />
Deutschunterricht erteilten. Der Deutsch- und Fachunterricht für<br />
Ausländer war in den Anfangsjahren für die Lehrenden Neuland. Nicht nur die<br />
deutsche Sprache war an Ausländer zu vermitteln, sondern auch ein natur- und<br />
geisteswissenschaftlicher, biologischer und medizinischer Fachwortschatz. Die<br />
moderne Fremdsprachenvermittlung steckte noch in den Kinderschuhen. Auch<br />
Russischlehrer, oft selbst gerade als Neulehrer mit der Ausbildung fertig geworden,<br />
nahmen das in die Hand. Das erste „Lehrbuch der deutschen Sprache für<br />
Ausländer“ (Teil 1 – 4) von Wolfgang Böttcher, Gertraud Hennlich, Karl-Heinz<br />
Nentwig erschien 1954.<br />
106
Ab 1960 hatte das Institut schon eine beachtliche internationale Bekanntheit erreicht.<br />
Ein neuer Name sollte der Unterscheidung vom Goethe-Institut München<br />
dienen. Die Wahl fiel auf den „Prediger der Humanität“, den Schriftsteller und<br />
Philosophen der Weimarer Klassik Johann Gottfried Herder. Ein Brief an den<br />
Rektor der damaligen Karl-Marx-<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> vom 21.02.1961 hob zur<br />
Begründung der Wahl, entgegen anderen Behauptungen, hervor: „Es waren vor<br />
allen Dingen Herders humanistisches Ideengut […], seine Theorien über die<br />
Sprache und sein großes Verständnis für die Literatur anderer Völker, die uns zu<br />
dem vorgenannten Vorschlag führten“.<br />
Der neue Name entsprach neuen Aufgaben und Plänen des Instituts: „Herder-<br />
Institut-Vorstudienanstalt für ausländische Studierende in der DDR und Stätte<br />
zur Förderung deutscher Sprachkenntnisse im Ausland“.<br />
Auf Antrag der Direktorin an den Oberbürgermeister der Stadt <strong>Leipzig</strong> wurde<br />
eine Änderung der Anschrift vorgenommen. Die Döllnitzer Straße im Stadtteil<br />
Gohlis erhielt den Namen Lumumbastraße. Aller Welt sollte deutlich gemacht<br />
werden, dass die weltberühmte Messestadt und die Karl-Marx-<strong>Universität</strong> den<br />
Freiheitshelden Afrikas Patrice Lumumba ehrten. Am 12. Juni 1961 fand der<br />
Gründungsakt des Herder-Instituts statt. Mit neuer außenpolitischer Orientierung<br />
der DDR auf weltweite diplomatische Anerkennung erfuhr das Herder-Institut in<br />
den sechziger Jahre eine beträchtliche Ausweitung seiner Wirkung.<br />
Im Jahre 1964 wurde der neue Direktor des Herder-Instituts, Johannes Rößler,<br />
vormals Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Ökonomie Berlin, in sein<br />
Amt berufen. Die neue Leitungsstruktur mit drei funktional abgegrenzten Stellvertreterposten<br />
für Unterricht und Erziehung, für Kader und Studienangelegenheiten<br />
und für Forschung wurde bis 1990 beibehalten. Die Studienvorbereitung<br />
umfasste drei Bereiche: die einjährige Vorbereitung für naturwissenschaftlichtechnische,<br />
für medizinisch-landwirtschaftliche und für gesellschaftswissenschaftliche<br />
Fachrichtungen. Hinzu kam eine zweijährige Vorbereitung für Studierende,<br />
die nach einem Jahr das Ausbildungsziel nicht erreicht hatten, sowie<br />
eine Vorbereitung von Aspiranten. Eine Arbeitsgruppe für den landeskundlichen<br />
Unterricht und für den studienbegleitenden Unterricht der ausländischen Germanistikstudenten<br />
ergänzten das Programm. Zunehmend verlangte das Ministerium<br />
für Hoch- und Fachschulwesen Lektoren für einen mehrjährigen Einsatz im<br />
Ausland. Eine „Leitstelle“ koordinierte die Vorbereitung der Lektoren für die<br />
nun jährlich stattfindenden Lektorentagungen.<br />
107
Ständig steigende Lehrverpflichtungen und knappes Personal auch infolge der<br />
Auslandsverpflichtungen führten häufig zu einer angespannten Situation.<br />
Die Forschungsarbeit am Herder-Institut begann Mitte der sechziger Jahre mit<br />
zunächst zwei Mitarbeitern in der Fremdsprachenmethodik. Einen Aufschwung<br />
erlebte die Forschungsabteilung im Jahre 1969, als der Linguist und Grammatiker<br />
Gerhard Helbig den ersten Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache im<br />
gesamten deutschsprachigen Raum erhielt. Mit seiner Berufung beginnt in der<br />
DaF-Forschung die linguistische Durchdringung der Wissenschaftsdisziplin und<br />
die Anwendung der Ergebnisse auf die Unterrichtspraxis. In der Folge wurde<br />
Forschungsarbeit für das Fach Deutsch als Fremdsprache in der Linguistik<br />
(insbesondere Grammatik und Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache<br />
mit konfrontativ-kontrastiven Untersuchungen), in der Fremdsprachendidaktik<br />
und der Methodik des Deutschen als Fremdsprache, in der Phonologie und Phonetik<br />
des Deutschen (auch in Konfrontation zu anderen Sprachen), später in der<br />
Fremdsprachenpsychologie sowie beim Einsatz von Computern und modernen<br />
Medien im Fremdsprachenunterricht und in der Arbeit mit Literatur im Fremdsprachenunterricht<br />
sowie der Landeskunde DDR geleistet. Veröffentlichungen<br />
der Forschungsabteilung haben das Herder-Institut in der Welt bekannt gemacht.<br />
Margit Ebersbach<br />
108
Johann Friedrich Christ<br />
Zum 250. Todestag am 2. September <strong>2006</strong><br />
Als vielseitiger Historiker und Philologe machte Johann Friedrich Christ<br />
(1701 – 1756) an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> erstmals antike Kunstwerke<br />
zum Gegenstand der akademischen Lehre. Er gilt damit als Begründer<br />
des Studiums der antiken Kunst an deutschsprachigen Hochschulen und<br />
Wegbereiter bei der Herausbildung der Klassischen Archäologie zu einem<br />
selbstständigen Lehr- und Forschungsgebiet.<br />
109
Johann Friedrich Christ wurde am 26. (?) April 1701 in Coburg geboren. Er<br />
stammte aus einer begüterten und angesehenen Familie des höheren Beamtentums,<br />
die ihm eine für seinen Stand typische und vielseitige Ausbildung ermöglichte.<br />
Da er seinem Vater in den Staatsdienst folgen sollte, begann Christ 1720<br />
in Jena Recht und Philosophie zu studieren. Seine Vorliebe für antiquarische<br />
Studien und die bildende Kunst weckten in ihm jedoch den Wunsch, eine akademische<br />
Laufbahn einzuschlagen. Doch erhielt er 1726 zunächst eine Anstellung<br />
als Hofmeister und begleitete die beiden jüngeren Söhne des Staats- und Premierministers<br />
von Sachsen-Coburg-Meinigen, Johann Christoph von Wolzogen,<br />
als „Instruktor“ an die <strong>Universität</strong> Halle. Obwohl Christ noch keinen akademischen<br />
Titel besaß, erhielt er dort mit Zustimmung der Philosophischen Fakultät<br />
die Erlaubnis, privat Vorlesungen zu halten.<br />
Erste wissenschaftliche Abhandlungen und der große Zuspruch, den seine Vorlesungen<br />
fanden, verschafften Christ in akademischen Kreisen schnell einen<br />
guten Namen. Sein Ruf drang in das benachbarte <strong>Leipzig</strong>, wo ihm die Philosophische<br />
Fakultät aufgrund seines Ansehens (propter viri famam) Anfang 1728<br />
in Abwesenheit die Magisterwürde erteilte. Zur Ostermesse 1729 siedelte Christ<br />
nach <strong>Leipzig</strong> über und nahm zur Erziehung des zweiten Sohnes des kurfürstlichsächsischen<br />
und königlich-polnischen Kanzlers Graf Heinrich von Bünau erneut<br />
die Stelle eines Hofmeisters an. Nachdem er am 8. Juni 1729 promoviert worden<br />
war und am 26. August des darauf folgenden Jahres sich zum Privatdozenten<br />
habilitiert hatte, erhielt Christ am 11. April 1731 eine von August dem Starken<br />
neu eingerichtete und mit einem kleinen Jahresgehalt versehene außerordentliche<br />
Professur für Geschichte. Im Frühjahr 1733 unterbrach er seine akademische<br />
Tätigkeit, um seinen Zögling, den jungen Adligen Rudolf von Bünau, auf dessen<br />
standesgemäßer Reise an die europäischen Höfe zu begleiten. Die grand tour<br />
führte sie durch Deutschland, Holland und England bis nach Oberitalien.<br />
Im Mai 1735 setzte Christ seine Lehrtätigkeit in <strong>Leipzig</strong> fort und rückte am 11.<br />
März 1739 in der Artistenfakultät in eine ordentliche Professur für Dichtkunst<br />
auf. Während seines langjährigen Wirkens an der <strong>Universität</strong> zeichnete er sich<br />
als ein vielseitiger Akademiker und bei den Studenten beliebter <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
aus, der über die gesamten Gebiete der Altertumswissenschaften hinaus<br />
eine breite Kenntnis in der neueren Kunstgeschichte hatte, selbst Gedichte<br />
verfasste und als Radierer ausgebildet war. Da die Disziplinen der insgesamt<br />
neun Professuren an der Artistenfakultät in der Tradition scholastischer Gelehrsamkeit<br />
nicht scharf abgegrenzt waren, behandelte Christ in seinen Vorlesungen<br />
die unterschiedlichsten Gegenstände. Er gab Stilübungen in Latein, hielt Vorlesungen<br />
zur Literatur, über Universalgeschichte und zum Natur- und Völkerrecht<br />
110
und interpretierte epigraphisches Material. Entsprechend vielseitig waren auch<br />
seine zahlreichen Veröffentlichungen. Er schrieb über die Doktrin Machiavellis,<br />
forschte über antike Gemmen, die Geschichte der Langobarden, die deutsche<br />
Graphik und Malerei und verfasste eine Monogrammkunde. Mehrfach bekleidete<br />
Christ akademische Ämter, darunter viermal das Amt des Rektors (1744,<br />
1748, 1752, 1756), in das ihn die Bayerische Nation wählte. Außerdem besaß<br />
er eine umfangreiche Bücher- und Handschriftensammlung, ein Kabinett von<br />
Münzen, Gemmen, Vasen, antikem Hausgerät und Antiquitäten aller Art sowie<br />
wertvolle Kupferstiche. Den Grundstock hierfür legte er auf seiner Reise durch<br />
Europa, auf der er als gebildeter Liebhaber antike und neuere Kunstwerke nicht<br />
nur eingehend studieren, sondern dank des väterlichen Vermögens erwerben<br />
konnte. Am 2. September 1756 starb Christ infolge eines Lungenleidens. Sein<br />
Leichnam wurde in die Paulinerkirche überführt und dort beigesetzt.<br />
Christ hinterließ kein größeres Werk, das Erfolg und breite Wirkung gehabt hätte.<br />
In Erinnerung geblieben ist er vor allem als Lehrer Gotthold Ephraim Lessings<br />
(1729 – 1781) und Mitbegründer des von Johann August Ernesti (1707 – 1781)<br />
und dessen Schülern in <strong>Leipzig</strong> ausgegangenen Neuhumanismus. Sein Verdienst<br />
für die Altertumswissenschaften besteht darin, dass er die Klassische Archäologie<br />
zum <strong>Universität</strong>slehrfach erhob, lange bevor es andernorts in Deutschland<br />
und in <strong>Leipzig</strong> selbst zu einer institutionellen Organisation kam. Ab dem Sommersemester<br />
1735 las Christ in den unter res litteraria angekündigten Vorlesungen<br />
erstmals in Deutschland über antike Kunstwerke. Als bisher unbeachtete<br />
Gegenstände der Wissenschaft sollten sie nicht nur aus ästhetischem Vergnügen<br />
oder in Hinblick auf die antiken Autoren behandelt, sondern auf der Grundlage<br />
systematischer Beschreibung besprochen und erklärt werden. Einer Denkschrift<br />
für Christ zufolge gehörten dazu „viel Uebung des Auges, große antiquarische<br />
Gelehrsamkeit, einige technische Fertigkeit, wenigstens im Zeichnen, endlich<br />
eine unermüdliche Beharrlichkeit im Beschauen und Wiederbeschauen der<br />
Kunstwerke“. Da dies anhand graphischer Reproduktionen nur eingeschränkt<br />
möglich war, erkannte Christ die Notwendigkeit der direkten Anschauung antiker<br />
Kunstwerke im akademischen Unterricht. Seine in städtisch-bürgerlichem<br />
Kontext aus privater Leidenschaft und als Privileg der Oberschicht zusammengetragene<br />
Sammlung führte er daher einer neuen Bestimmung zu. Sie diente ihm<br />
nicht mehr nur der Repräsentation, dem persönlichen Kunstgenuss und eigenen<br />
wissenschaftlichen Studien Vielmehr stellte er sie in der <strong>Universität</strong>slehre für<br />
jene zur Verfügung, die antike Originale nicht wie er selbst auf Reisen durch<br />
Europa sehen konnten. Indem Christ antike Sachzeugnisse in die Lehre einbezog,<br />
bot er seinen Schülern zugleich eine neue, lebendige Art von Unterricht.<br />
Aus Büchern übernommene Urteile konnten durch Autopsie der Denkmäler auf<br />
111
der Stelle diskutiert, berichtigt und verbessert werden. Dies brachte eine dem<br />
Seminar ähnliche Unterrichtsform hervor, die eine unmittelbarere Beziehung<br />
zwischen Studierenden und Lehrenden herstellte.<br />
Durch seine archäologischen Vorlesungen bereitete Christ als einer der Vorläufer<br />
Johann Joachim Winckelmanns (1717 – 1768) eine neue Sicht auf die<br />
Antike vor. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Beschäftigung mit der<br />
bildenden Kunst des Altertums vernachlässigt worden oder gänzlich unbekannt<br />
gewesen. Es gab zwar viele Schriften antiquarischen Inhalts, aber noch keine<br />
wissenschaftliche Beschäftigung mit der Kunst der Antike. Ihre Kenntnis war<br />
auf das beschränkt, was zum unmittelbaren Verständnis der Schriftdenkmäler<br />
des Altertums erforderlich war. Antike Kunstwerke galten hierin, anderen Sachaltertümern<br />
gleichgestellt, als antiquarische Belege zur Erläuterung philologischer,<br />
technischer oder ästhetischer Standpunkte, nicht als eigenständige, auf<br />
ihre künstlerische Form hin zu untersuchende Denkmäler. Vor der Mitte des<br />
18. Jahrhunderts begannen Anne Claude Philippe de Tubières, Comte de Caylus<br />
(1692 – 1765), Johann Friedrich Christ und andere Gelehrte, die bildende Kunst<br />
der Antike innerhalb der antiquarisch-philologischen Studien als selbstständigen<br />
Gegenstand der Betrachtung abzugrenzen. Dabei handelte es sich noch nicht um<br />
Archäologie im heutigen Sinne. Die Bemühungen können aber als Ausgangspunkte<br />
dafür angesehen werden, die antiquarisch-philologische Betrachtungsweise<br />
zu überwinden und antiken Kunstwerken einen eigenen Wert beizumessen.<br />
Die Grundlagen für eine Wissenschaft von der antiken Kunst waren gelegt<br />
und innerhalb der Altertumskunde die Verselbstständigung der „Archäologie der<br />
Kunst“ als Forschungs- und Lehrgebiet eingeleitet. Das Verdienst, die künstlerische<br />
Form zum Gegenstand wissenschaftlicher Kunstbetrachtung gemacht und<br />
auf ihrer Grundlage ein chronologisches Gerüst für die Entwicklung der griechischen<br />
Plastik entworfen zu haben, gebührt Winckelmann, dessen „Geschichte<br />
der Kunst des Alterthums“ wenige Jahre nach Christs Tod erschien.<br />
Die Manuskripte seiner archäologischen Vorlesungen hat Christ nie veröffentlicht.<br />
Es existierten jedoch Mitschriften, die 1776 posthum unter dem Titel „Supra<br />
re litteraria. Abhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke vornehmlich<br />
des Alterthums“ in einer stark überarbeiteten Redaktion von Johann Karl Zeune<br />
(1736 – 1788) erschienen. Zu sehr noch dem antiquarischen Standpunkt der<br />
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verhaftet, war diese Schrift durch die Veröffentlichungen<br />
Winckelmanns im Grunde bereits überholt. Christs Verdienst<br />
bleibt aber, mit seinen Vorlesungen viele Gelehrte während ihres Studiums zu<br />
einer intensiven Beschäftigung mit der antiken Kunst hingeführt zu haben. Neben<br />
Lessing zählte der Altphilologe und Archäologe Christian Gottlob Heyne<br />
112
(1729 – 1812) zu seinen wichtigsten Schülern. Er führte die neue Wissenschaft<br />
in Göttingen ein und hielt dort als eigentlicher Begründer der Archäologie an<br />
deutschen <strong>Universität</strong>en regelmäßig archäologische Vorlesungen. Heyne war es<br />
auch, der über die antiken Originale hinaus die Bedeutung von Gipsabgüssen<br />
als Anschauungsmittel für den akademischen Unterricht erkannte und 1767 in<br />
Göttingen den Grundstock der weltweit ältesten universitären Abgusssammlung<br />
legte, die Vorbild vieler späterer <strong>Universität</strong>ssammlungen wurde.<br />
Von Christs Antikenkabinett und dessen Schicksal ist kein klares Bild mehr zu<br />
gewinnen. Auch gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es in <strong>Universität</strong>sbesitz<br />
übergegangen wäre und die Keimzelle des heutigen Antikenmuseums gebildet<br />
hätte. Indes besaß nicht jeder Gelehrte, der nach Christ in <strong>Leipzig</strong> Archäologie<br />
lehrte, eine private Sammlung, um den Studierenden antike Denkmäler vor Augen<br />
zu führen. So lässt sich eine universitätseigene Kunstsammlung erstmals zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts nachweisen. Bei dem in der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
untergebrachten „Kabinett für Archäologie und Kunst“ dürfte es sich allerdings<br />
eher um ein „Raritätenkabinett“ gehandelt haben, das ohne einheitlichen Plan<br />
angelegt wurde. Als sich an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> die archäologische Lehrtätigkeit<br />
immer mehr spezialisierte, wurde die Gründung einer tatsächlich dem<br />
Studium dienenden Antikensammlung umso dringlicher. Nach der Bereitstellung<br />
erster Gelder und eines Ortes zur Aufstellung von Gipsabgüssen und antiken<br />
Originalen im Mittelpaulinum begann ab 1840 der systematische Aufbau<br />
einer schnell wachsenden Lehr- und Studiensammlung.<br />
Die institutionelle Organisation der Klassischen Archäologie als akademische<br />
Lehreinrichtung und ihre fachspezifische Abgrenzung von anderen <strong>Universität</strong>sinstituten<br />
erfolgten in <strong>Leipzig</strong> erst viel später. Im Jahre 1874 ging aus einer<br />
älteren und im Wesentlichen aus privaten Mitteln der <strong>Leipzig</strong>er Bürgerschaft<br />
bestrittenen „antiquarischen Gesellschaft“ das Archäologische Seminar bzw. Institut<br />
der <strong>Universität</strong> hervor. Der erste Lehrstuhlinhaber, zu dessen Lehraufgaben<br />
die Archäologie innerhalb dieses Seminars ausdrücklich gehörte, war Johannes<br />
Overbeck (1826 – 1895). Als nunmehr offizielle Einrichtung wurde es vom<br />
sächsischen Kultusministerium mit finanziellen Mitteln nicht nur für Stipendien,<br />
sondern auch zur „Vervollständigung des Interpretations-Apparates“ ausgestattet.<br />
Sie waren die Voraussetzung dafür, dass am Ende des 19. und zu Beginn des<br />
20. Jahrhunderts das <strong>Leipzig</strong>er Archäologische Institut und das ihm angeschlossene<br />
Antikenmuseum mit Unterstützung privater Stiftungen <strong>Leipzig</strong>er Bürger<br />
und durch Schenkungen auswärtiger Mäzene planmäßig und großzügig ausgebaut<br />
werden konnten. Nach wechselvoller Geschichte ist das Antikenmuseum<br />
seit 1994 im historischen Gebäude der Alten Nikolaischule untergebracht. Was<br />
113
Christ aus gelehrter Liebhaberei und mit seiner privaten Kunstsammlung begonnen<br />
hat, findet hier auf zeitgemäßem Niveau seine Fortsetzung: den Studierenden<br />
der Klassischen Archäologie eine direkte Anschauung und einen ausreichenden<br />
Überblick von der antiken Kunst des Mittelmeergebietes zu ermöglichen und<br />
ihnen die Gelegenheit zu geben, anhand von Originalwerken und Gipsabgüssen<br />
die Grundlagen des Faches zu erlernen und zu üben.<br />
Hans-Peter Müller
Ludwig Boltzmann<br />
Zum 100. Todestag am 5. September <strong>2006</strong><br />
Ludwig Boltzmann ist einer der bedeutendsten Physiker des 19. Jahrhunderts<br />
und Hauptvertreter der mechanischen Wärmetheorie, die Wärmephänomene<br />
durch die ungeordnete Bewegung von Atomen erklärt. Herauszuheben<br />
ist seine atomistische Begründung des Entropiebegriffs und sind seine<br />
Ideen, wie irreversible, d. h. nur in eine Richtung ablaufende,Vorgänge<br />
aus reversiblen, d. h. zeitumkehrinvarianten Naturgesetzen entstehen.<br />
115
Geboren am 20. Februar 1844 in Wien, war Boltzmann zeit seines Lebens auf<br />
Wanderschaft: nach seiner Promotion 1866 an der <strong>Universität</strong> Wien und der<br />
Habilitation 1867 dort Assistent, 1869 Ordinarius für Mathematische Physik<br />
in Graz, 1873 für Mathematik in Wien, 1876 für Experimentalphysik in Graz,<br />
dann für Theoretische Physik ab 1889 in München, ab 1894 in Wien, ab 1900 in<br />
<strong>Leipzig</strong>, ab1902 wieder in Wien.<br />
Boltzmann war ein sehr vielseitiger Wissenschaftler, unter anderem auch ein<br />
hervorragender Experimentator. Zum Zeitpunkt seiner Berufung nach <strong>Leipzig</strong><br />
war Boltzmann der führende theoretische Physiker im deutschen Sprachraum,<br />
und der Lehrstuhl für Theoretische Physik wurde auf Initiative Ostwalds eigens<br />
für ihn geschaffen. Obwohl Ostwald wissenschaftlich die Energetik, einen zu<br />
Boltzmanns Ideen völlig gegensätzlichen (und falschen) Ansatz vertrat, war das<br />
persönliche Klima in <strong>Leipzig</strong> gut. Boltzmanns Aufenthalt in <strong>Leipzig</strong> stand aber<br />
bereits unter dem Schatten seiner wachsenden Selbstzweifel und Depressionen,<br />
die schließlich dazu führten, dass er sich 1906 das Leben nahm.<br />
Nachdem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannt worden war, dass<br />
Wärme kein unzerstörbarer Stoff, sondern eine Form der Energie ist, also insbesondere<br />
mechanische Arbeit in Wärme umgewandelt werden kann, versuchten<br />
die Atomisten, die Wärmeerscheinungen durch die ungeordnete Bewegung<br />
der Atome zu erklären. Arbeiten von Clausius 1857/58 folgend, führte Maxwell<br />
1860 den Begriff der Verteilungsfunktion für die Geschwindigkeiten von<br />
Gasteilchen ein und leitete für ein räumlich homogenes Gas aus allgemeinen<br />
Symmetrieüberlegungen deren Form im thermodynamischen Gleichgewicht<br />
ab – die Maxwellverteilung. Boltzmann verallgemeinerte sie 1871 auf Situationen,<br />
in denen die Verteilung auch vom Ort abhängt. Sein Resultat, die Maxwell-Boltzmann-Verteilung,<br />
gibt ihr auch die physikalisch natürliche Form: Die<br />
Verteilungsfunktion nimmt mit der Energie des Zustandes exponentiell ab. Die<br />
wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung durch die Verteilungsfunktion<br />
war eine wesentliche Wende in den Grundkonzepten.<br />
1872 leitete Boltzmann die nach ihm benannte Transportgleichung für die zeitliche<br />
Entwicklung der Verteilungsfunktion eines verdünnten Gases abseits des<br />
Gleichgewichts, aus der Mechanik ab. Er zeigte, dass ihre einzige zeitunabhängige<br />
Lösung die Maxwell-Boltzmann-Verteilung ist und dass unter der durch die<br />
Boltzmanngleichung gegebenen Zeitentwicklung eine von ihm definierte Funktion<br />
H niemals zunimmt (H-Theorem), sodass S = – H als Entropie interpretiert<br />
werden kann. Die H-Funktion Boltzmanns ist (bis auf das Vorzeichen) nichts<br />
anderes als die der Verteilungsfunktion zugeordnete Informationsentropie (die<br />
116
unter diesem Namen allerdings erst etwa 70 Jahre später von Shannon eingeführt<br />
wurde). Damit schien der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der Satz von<br />
der Zunahme der Entropie, mechanisch begründet.<br />
Boltzmanns Freund Josef Loschmidt brachte jedoch 1876 den schwerwiegenden<br />
Umkehreinwand gegen die Gültigkeit der Boltzmanngleichung vor: Die Gesetze<br />
der Mechanik sind reversibel, d. h. die Umkehrung der Bahnen von Teilchen sind<br />
ebenfalls Lösung der Newtonschen Gleichungen (ein Film über Bewegung der<br />
Planeten um die Sonne zeigt auch, wenn er rückwärts läuft, mechanisch erlaubte<br />
Planetenbahnen). Gibt man jedoch einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser, so<br />
breitet sie sich aus, bis sie gleichmäßig verteilt ist. Wenn dieser Vorgang, wie<br />
von Boltzmann behauptet, ebenfalls aus der Newtonschen Mechanik erklärbar<br />
sein sollte, wäre der umgekehrte Vorgang der spontanen Entmischung ebenfalls<br />
möglich, wird aber nie beobachtet. Boltzmanns Antwort ist einfach: Die Entmischung<br />
ist tatsächlich möglich, aber nur dann, wenn die Anfangsbedingung für<br />
die Orte und Geschwindigkeiten der einzelnen Tintenpartikel perfekt eingestellt<br />
wird. Dies ist aber nicht machbar, und die geringste Abweichung von der perfekten<br />
Einstellung führt bereits nicht mehr zu einer Entmischung. – Ein späterer<br />
Einwand von Zermelo basiert auf dem Wiederkehrsatz Poincarés: Die mechanische<br />
Bewegung im endlichen Volumen ist quasiperiodisch und kommt somit<br />
jeder Anfangsbedingung nach ausreichend langer Zeit wieder beliebig nahe.<br />
Demnach müssten sich Wasser und Tinte nach der Wiederkehrzeit von selbst<br />
wieder entmischen. Boltzmann argumentierte dagegen, indem er eine Schätzung<br />
für die Wiederkehrzeit gab – für den Tintentropfen im Wasserglas wäre diese<br />
Zeit um Größenordnungen länger als das Alter des Universums.<br />
Diese Einwände führten dazu, dass Boltzmann sich wieder mit der Entropie<br />
beschäftigte. 1877 zeigte er, dass die Entropie S eines thermodynamischen<br />
Gleichgewichtszustands mit seiner thermodynamischen Wahrscheinlichkeit W<br />
anwächst. Dies gibt dem Gesetz der Zunahme der Entropie die einfache Bedeutung,<br />
dass thermodynamische Prozesse in ihrer überwiegenden Mehrheit in<br />
Richtung eines wahrscheinlicheren Endzustands verlaufen. In ihrer Kombination<br />
aus Prägnanz und Bedeutung ist Boltzmanns Formel S = k log W vergleichbar<br />
mit Einsteins E = m c 2 . Boltzmann betonte danach in seinen Arbeiten immer wieder,<br />
dass der zweite Hauptsatz ein Wahrscheinlichkeitssatz ist: Eine Abnahme<br />
der Entropie ist möglich, aber für Systeme sehr vieler Teilchen sehr unwahrscheinlich,<br />
ebenso wie die spontane Entmischung von Tinte und Wasser prinzipiell<br />
möglich, aber extrem unwahrscheinlich ist. Für kleinere Teilchenzahlen<br />
sind Schwankungen beobachtbar, und Boltzmann erwähnte bereits 1896, dass sie<br />
117
die Brownschen Bewegung erklären. Er führte diese Idee jedoch nie quantitativ<br />
durch; dies tat erst Einstein im Jahr 1905.<br />
Heute sind Boltzmanns Resultate und Ideen ein zentraler Teil des Lehrgebäudes<br />
der Physik. Zu seiner Zeit waren sie vor allem in Deutschland äußerst kontrovers.<br />
Der zweite Hauptsatz galt als Grundgesetz der Physik, und im 19. Jahrhundert<br />
schien es undenkbar, dass ein solches nur im probabilistischen Sinn gelten<br />
könnte. Dazu kamen die Gegner des Atomismus insgesamt, an ihrer Spitze Ernst<br />
Mach, nach dessen positivistischer Auffassung Atome – da (damals) unbeobachtbar<br />
– in der Begriffsbildung der Naturwissenschaft keinen Platz hatten. Aus<br />
heutiger Sicht mag dieser Einwand lächerlich erscheinen, damals jedoch erlaubte<br />
er den Gegnern der Atomistik die unkritische Ablehnung der kinetischen Theorie<br />
insgesamt.<br />
Dazu kam, dass Boltzmanns Argumente zwar intuitiv überzeugend, aber technisch<br />
gesehen nicht immer streng waren. Seine Erwiderungen auf die oben<br />
genannten ernsthaften Einwände ließen z. B. offen, welchen Status seine „Ableitung“<br />
des H-Theorems aus dem Jahr 1872 hatte. Die British Association for<br />
the Advancement of Science hielt 1894 eine Konferenz mit dem Zweck ab, das<br />
H-Theorem besser zu verstehen. Boltzmann wurde eingeladen und beteiligte<br />
sich an der Diskussion, und seine daraus resultierende Arbeit 1895 ist eine seiner<br />
klarsten zur Entropie und zum H-Theorem. Im Laufe der Konferenz erklärte<br />
Bryan, dass die Ableitung der Boltzmanngleichung aus der Mechanik eine zusätzliche<br />
Annahme (den Stoßzahlansatz) enthält, die die Zeitumkehrinvarianz<br />
der mechanischen Gleichungen verletzt. Obwohl dieser Ansatz im Kontext, in<br />
dem Boltzmann ihn verwendete, in der Tat beinahe selbverständlich erscheint,<br />
ist seine strenge Rechtfertigung ein sehr schwieriges, großteils offenes Problem.<br />
Erst 1976 bewies Lanford die Gültigkeit der Boltzmanngleichung auf einer gewissen<br />
Zeitskala für typische Anfangsbedingungen; für lange Zeitskalen ist das<br />
Problem mathematisch offen.<br />
Trotz seines berühmten Ausspruchs „Eleganz ist für Schneider und Schuster“<br />
zum Thema Eleganz wissenschaftlicher Argumente hatte Boltzmann eine Neigung<br />
zur Ästhetik, spielte selbst gut Klavier und liebte Theater und Literatur.<br />
Er war bekannt für seinen Humor, seine Menschenfreundlichkeit und Offenheit.<br />
Auch mit Größen wie Clausius ging er ohne falschen Respekt um. Ebenso behandelte<br />
er seine Studenten immer als gleichberechtigte Kollegen. Er war ein<br />
hervorragender Lehrer. Lise Meitner, die Boltzmann 1902 – 1905 als Dozenten<br />
erlebte, schreibt:<br />
118
Er war ein guter Vortragender, in meiner Erinnerung sind seine Vorlesungen<br />
die schönsten und anregendsten, die ich jemals gehört habe. […] Er<br />
war selbst von allem, was er uns lehrte, so begeistert, dass man aus jeder<br />
Vorlesung mit dem Gefühl wegging, es werde einem eine ganz neue und<br />
wunderbare Welt eröffnet.<br />
Die scharfe Kritik an seinen Ideen, die er als feindselig empfand, machte ihm<br />
sehr zu schaffen. Ob dies wirklich der Hauptgrund für seine Depression und sein<br />
tragisches Ende war, wird unklar bleiben.<br />
Boltzmanns Einfluss auf nachfolgende Generationen war groß. Max Planck verwendete<br />
seine Methode, den Phasenraum in Zellen zu unterteilen und die wahrscheinlichste<br />
Verteilung zu suchen, zur Ableitung der Strahlungsformel, die am<br />
Anfang der Quantentheorie stand. Seine Einsichten zur Frage, wie Irreversibilität<br />
aus reversiblen Grundgesetzen entsteht, sind weit über die klassische Mechanik<br />
hinaus von Bedeutung, und die Beschreibung von deterministischem, aber<br />
chaotischem Verhalten mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Konzepten und<br />
Methoden, begonnen von Maxwell und Boltzmann, ist heute in der Theorie der<br />
dynamischen Systeme selbstverständlich. Boltzmanns Ideen haben die Physik<br />
geprägt, und sie bleiben bis heute faszinierend und fruchtbar für die physikalische,<br />
mathematische und philosophische Forschung.<br />
Manfred Salmhofer<br />
119
Johann Christoph Adelung<br />
Zum 200. Todestag am 10. September <strong>2006</strong><br />
Wann beginnt die moderne Sprachwissenschaft? Mit den Brüdern Grimm<br />
um 1850? Mit den sogenannten „Junggrammatikern“ um 1900? Oder gar<br />
erst mit den Strukturalisten des 20. Jahrhunderts? Es spricht einiges dafür,<br />
dass das Datum weiter vorzuverlegen ist. Denn von 1774 bis 1786 erschien<br />
in <strong>Leipzig</strong> in fünf Bänden der Versuch eines vollständig-kritischen Wörterbuchs<br />
der hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der oberdeutschen.<br />
Der Name des Verfassers – Johann Christoph Adelung.<br />
121
Wer war Johann Christoph Adelung, der Verfasser dieses lexikographischen<br />
Monumentalwerks? Der Pfarrerssohn wurde am 8. August 1732 in dem Ort<br />
Spantekow bei Anklam in Pommern geboren, besuchte Schulen in Anklam und<br />
Klosterbergen bei Magdeburg, studierte von 1752 bis 1758 Theologie in Halle<br />
und war danach (1759) als Gymnasiallehrer in Erfurt und herzoglicher Bibliothekar<br />
in Gotha (1762) tätig. 1765 zog er nach <strong>Leipzig</strong> und entfaltete hier vielfältige<br />
Aktivitäten als Schriftsteller, Übersetzer, Journalist (von 1769 bis 1787 hatte er<br />
die Schriftleitung bei den „<strong>Leipzig</strong>er Zeitungen“ inne), Korrektor, Historiker,<br />
Privatgelehrter und Lexikograph. 1787 avancierte er zum Hofrat und Kurfürstlichen<br />
Oberbibliothekar in Dresden, wo er bis zu seinem Tode am 10. September<br />
1806 tätig blieb.<br />
Adelungs wissenschaftliche Interessen und publizistische Aktivitäten waren<br />
vielfältig. Heraus ragen allerdings seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten, die<br />
das Fundament bildeten für nachfolgende Generationen von Gelehrten. Wichtige<br />
Werke neben dem erwähnten groß angelegten Wörterbuch waren die Deutsche<br />
Sprachlehre. Zum Gebrauch der Schulen in den Königlichen Preußischen Landen,<br />
Berlin 1781 (mit 14 Neuauflagen bis 1828 und sogar Übersetzungen ins Lateinische,<br />
Französische und Englische) und eine Art Kurzversion mit dem Titel<br />
Auszug aus der Deutschen Sprachlehre für Schulen, Berlin 1781, die es bis 1818<br />
auf immerhin acht Neuauflagen brachte. Adelungs zweites Monumentalwerk<br />
neben dem Wörterbuch ist das 1782 in <strong>Leipzig</strong> erschienene zweibändige Umständliche<br />
Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen<br />
Sprachlehre für Schulen. Das Wort umständlich bedeutet im Sprachgebrauch<br />
der Zeit ‚ausführlich‘, nicht etwa ‚kompliziert und langatmig‘. Dieses Werk<br />
ist so etwas wie eine erweiterte wissenschaftliche Version der erwähnten Deutschen<br />
Sprachlehre. Für die Praxis verfasst ist die Vollständige Anweisung zur<br />
Deutschen Orthographie nebst einem kleinen Wörterbuche für die Aussprache,<br />
Orthographie, Biegung und Ableitung, <strong>Leipzig</strong> 1788 (mit 13 Neuauflagen bis<br />
1838).<br />
Worin besteht nun das Novum in Adelungs Arbeiten? Seine praktischen Schriften,<br />
also die Sprachlehre und die Orthographie, gehen weit über bisherige<br />
traditionelle Versuche zahlreicher Schulmeister hinaus, die überkommene Lateingrammatik<br />
auf das Deutsche zu applizieren. Adelung begibt sich z. B. nicht<br />
auf die (vergebliche) Suche nach dem deutschen Ablativ, sondern erkennt in den<br />
vier Kasus des Deutschen ein eigenständiges, voll funktionsfähiges und nicht gegenüber<br />
den sechs Kasus des Lateinischen defizitäres Inventar. Er differenziert<br />
zwischen Tempus und Modus als grammatischen Kategorien und Gegenwart/<br />
Vergangenheit/Zukunft bzw. Faktizität/Möglichkeit/Irrealität als semantischen<br />
122
Aussagewerten und erkennt damit die Deckungsungleichheit von morphologischer<br />
Kategorie und außersprachlicher Referenz. Parallel dazu ist bei Adelung<br />
in Ansätzen auch schon die Vorstellung vom semantischen Kasus ausgeprägt,<br />
denn er formuliert bereits die Einsicht, dass jeder morphologische Kasus, also<br />
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, ganz unterschiedliche inhaltliche Relationen<br />
auszudrücken vermag. Die Orthographie reflektiert bereits das phonetische,<br />
morphologische und etymologische Prinzip, also inkongruente orthographierelevante<br />
Aspekte, die in der deutschen Rechtschreibung teils zusammen-, teils<br />
gegeneinander wirken (und in unserer heute gültigen reformierten Orthographie<br />
vielleicht nicht immer glücklich aufeinander bezogen und gegeneinander abgewogen<br />
worden sind).<br />
Im 18. Jahrhundert begann nicht nur die Sprachwissenschaft sich als junge Wissenschaftsdisziplin<br />
herauszubilden. Es war auch eine entscheidende Etappe auf<br />
dem Weg zur Etablierung einer überregionalen und überkonfessionellen deutschen<br />
Standard- und Literatursprache. Anders als in Frankreich und England gab<br />
es in Deutschland kein höfisches Machtzentrum, das gleichzeitig als kulturelles<br />
Prestigezentrum anerkannt gewesen wäre. Dementsprechend wurde die gelehrte<br />
Debatte darüber, was „grundrichtiges“ und „kunstrichtiges“ Deutsch sei, von<br />
regionalen, häufig auch konfessionellen Standpunkten aus geführt. Im Vergleich<br />
zu manchen Zeitgenossen (wie etwa dem ostmitteldeutsch-meißnischen Hardliner<br />
Gottsched) vertrat Adelung in seinem „Lehrgebäude“ eine tolerante Auffassung:<br />
Der Sprachlehrer sei, so schreibt er, nicht Gesetzgeber der Nation, sondern<br />
nur Sammler und Herausgeber der von ihr gemachten Gesetze, ihr Sprecher und<br />
der Dollmetscher ihrer Gesinnungen. Er entscheidet nie, sondern sammelt nur<br />
die entscheidenden Stimmen der meisten. Nie läßt er sich durch Vorurtheil oder<br />
Eigenliebe verleiten, die Gesetze der Nation zu verfälschen, oder ihr seine Meinungen<br />
unterzuschieben. Ausschlaggebend bei der Entscheidung, welcher von<br />
mehreren konkurrierenden Formen- oder Aussprachevarianten im Zweifelsfalle<br />
der Vorzug zu geben sei, war für Adelung demnach also das Majoritätskriterium,<br />
wenn man so will also ein demokratisches Prinzip. Natürlich stand für den Bildungsbürger<br />
des 18. Jahrhunderts außer Frage, dass nur diejenigen Varietäten,<br />
die eine höhere Gesellschaftssprache repräsentierten, überhaupt den Anspruch<br />
erheben durften, als Grundlage für eine künftige einheitliche deutsche Nationalsprache<br />
in Betracht zu kommen.<br />
Ein abschließender Blick auf den exemplarisch ausgewählten Wortartikel Abtritt<br />
aus dem vollständig-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mag das<br />
Gesagte verdeutlichen.<br />
123
Dem graphisch herausgehobenen Stichwort folgen grammatische Angaben,<br />
und zwar in alter schulgrammatischer Tradition, so wie man es heute noch<br />
im Lateinunterricht lernt, Genitiv Singular und Nominativ Plural. Es werden<br />
Bedeutungen und Unterbedeutungen differenziert. Unter einer Hauptbedeutung<br />
Die Handlung des Abtretens subsumiert Adelung 1. Die Einkehr auf der<br />
Reise, 2. Die Verfügung an einen sehr nahe gelegenen Ort, 3. Die Begebung<br />
eines Rechtes, 4. Die Verlassung einer Parthey oder Sache, am meisten in<br />
Oberdeutschland. Dieser letztgenannte Gliederungspunkt dokumentiert die im<br />
Werkstitel angekündigte Rücksicht auf oberdeutsche Wortverwendungen. Von<br />
dieser an 1 gesetzten abstrakten Verwendungsweise werden unter 2 bis 4 drei<br />
weitere – konkrete – Bedeutungen dokumentiert: 2. Ein Ort, an welchem man<br />
von einem höhern niedertritt, Absatz, 3. Ein Ort, an welchem man sich bey Seite<br />
begiebt, 4. Dasjenige, was abgetreten worden. Diese letzte Bedeutung ist fach-,<br />
genauer gesagt jägersprachlich, ebenso wie Bedeutung 3 (1), die eine bergmannsprachliche<br />
Verwendungsweise dokumentiert. Zu allen Bedeutungen werden<br />
Beispiele gegeben, die Adelung entweder selbst formuliert (so in 2: Falle nicht,<br />
hier ist ein Abtritt) oder literarischen Werken entnommen hat. Stilistisch-pragmatische,<br />
sachbezogene Ausführungen und Angaben von Synonymen vermischen<br />
sich in 3 (2): Im gemeinen Leben, ein abgesonderter Ort zur Erleichterung<br />
des Leibes. Da es der Wohlstand nothwendig gemacht hat, manche Dinge nicht<br />
bey ihrem rechten Namen zu nennen, so hat auch diesem Orte schon in den mittleren<br />
Zeiten verschiedene theils allgemeine, theils mildere Namen gegeben, den<br />
damit verbundenen schmutzigen Begriff zu verstecken. So nannte man ihn z. B.<br />
ehedem das Läublein, von Laube, den Gang, Ausgang, das Sprachhaus u. s. f.<br />
Dann formuliert Adelung eine geradezu moderne sprachwandeltheoretische<br />
Einsicht, nämlich die, dass das Wort Abtritt … durch den immer gemeiner gewordenen<br />
Gebrauch auch schon niedrig zu werden anfängt, daher man sich statt<br />
derselben lieber des Ausdruckes heimliches Gemach bedienet. Die Erkenntnis,<br />
dass ursprünglich höher bewertete Begriffe durch häufigen Gebrauch ohne (oder<br />
sogar gegen) die Absicht der Sprecher „pejorisiert“ werden, ist vor nicht allzu<br />
langer Zeit zur Theorie der „Unsichtbaren Hand“ ausgebaut worden. Gewusst<br />
hat’s freilich schon Adelung!<br />
Hans Ulrich Schmid<br />
124
Johann Christian Gottfried Jörg und das<br />
„Triersche Institut“<br />
Zum 150. Todestag am 20. September <strong>2006</strong> und zum<br />
200. Jubiläum der Trierschen Stiftung<br />
<strong>2006</strong> jährt sich der Todestag von Johann Christian Gottfried Jörg zum 150.<br />
Mal. Jörg war der erste Ordinarius für Frauenheilkunde an der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Leipzig</strong> und der erste Direktor des „Trierschen Instituts“. 1806 erfolgte die<br />
testamentarische Stiftung der Familie Trier, auf deren Grundlage die <strong>Universität</strong><br />
ein Grundstück zur Errichtung eines Hebammeninstituts erhielt. So<br />
kann <strong>2006</strong> das 200. Jubiläum dieser Ereignisse begangen werden.<br />
125
Johann Christoph Gottfried Jörg wurde am 24.12.1779 in Predel bei Zeitz<br />
geboren. 1800 begann er ein Studium der Naturwissenschaft in <strong>Leipzig</strong> und<br />
wandte sich dann der praktischen Medizin zu. 1802 erhielt er bei dem <strong>Leipzig</strong>er<br />
Geburtshelfer Dr. Carl Christian Friedrich Menz eine Assistentenstelle, die<br />
ihm Gelegenheit bot, sich in der Geburtshilfe auszubilden. Bei Menz konnte er<br />
viele geburtshilfliche Operationen ausführen, aber keine einzige normale Geburt<br />
beobachten. 1804 ging er für sechs Monate nach Wien zu Johann Lukas Boer<br />
(1751 – 1835), einem konservativen Geburtshelfer, der der Natur in allem den<br />
Vorrang ließ und jede chirurgische Maßnahme in seinem Fach nach Möglichkeit<br />
vermied. Boer hatte auf Jörg großen Einfluss. Wieder in <strong>Leipzig</strong>, wurde Jörg am<br />
23.12.1804 zum Dr. phil. promoviert, am 23.08.1805 zum Doktor der Medizin<br />
und Chirurgie.<br />
1810 erhielt Jörg als erster Ordinarius den Lehrstuhl für Geburtshilfe und übernahm<br />
die Leitung der Entbindungsschule in <strong>Leipzig</strong>. Dafür hatte er einen Ruf<br />
nach Königsberg abgelehnt.<br />
Bevor im Jahre 1806 die Grundsteinlegung für eine Entbindungsschule erfolgte,<br />
hatte es verschiedene Versuche zur Schaffung einer Spezialeinrichtung für werdende<br />
Mütter gegeben. Geburtshilfe wurde in <strong>Leipzig</strong> durch C. Chr. F. Menz,<br />
einen bei der Stadt angestellten Accoucheur, betrieben, das Fach Geburtshilfe an<br />
der <strong>Universität</strong> von verschiedenen Professoren gelesen, da es noch kein Ordinariat<br />
für Geburtshilfe gab. 1803 bewilligte der Landrat ein Hebammeninstitut, das<br />
auf einem Gartengrundstück errichtet werden sollte. Vorgeschlagen waren ein<br />
Anbau an das vorhandene Jacobs-Hospital im Rosental, die Anmietung von Zimmern<br />
bei der <strong>Universität</strong> oder der Ankauf des Winklerschen Gartens für 150.000<br />
Taler. 1803 starb der Buchhändler und Gutsbesitzer Christian Andreas Leich<br />
und hinterließ für das zu gründende Institut 20.000 Taler. Schon 1799 waren<br />
von Hofrat und Prokonsul Johann Wilhelm Richter 1.333 Taler für das Institut<br />
vererbt worden, sodass eine Summe von 21.333 Talern bereitstand.<br />
Großen Anteil an der Gründung des Hebammeninstituts hatte Prof. Dr. Johann<br />
Carl Gehler (1732 – 1796), ordentlicher Professor und von 1789 bis 1796 Dekan<br />
der Medizinischen Fakultät, der seine kinderlosen Verwandten, Appellationsrat<br />
Dr. Carl Friedrich Trier (gest. 1794) und seine Frau, für eine Anstalt zum<br />
praktischen Unterricht für Ärzte und Hebammen begeistern konnte. Rahel<br />
Amalia Auguste Trier (1731 – 1806) vermachte im gemeinsamen Testament<br />
der Eheleute ihren Garten „vor dem Petersthore am Ende des Glitschergäßchens<br />
sub No: 804 an der alten Pleiße“ der <strong>Universität</strong> zur Errichtung einer Geburtshilfeschule.<br />
Dabei handelte es sich um einen ca. 11 ha großen Acker zwischen<br />
126
der heutigen Karl-Tauchnitz- und Beethovenstraße mit einem Gartenhaus, das<br />
sich an Schwägrichens Garten anschloss. Bis 1909 entstanden an dieser Stelle<br />
das Reichsgerichtsgebäude, die <strong>Universität</strong>sbibliothek, das Konservatorium, die<br />
Kunstakademie, eine Gewerbeschule und Privatvillen.<br />
Testamentarisch legte Auguste Trier fest, dass die <strong>Universität</strong> mit ihrem Vermächtnis<br />
ein von der Medizinischen Fakultät zu entwerfendes und unter besonderer<br />
Aufsicht der Fakultät stehendes Hebammeninstitut schaffen sollte, in dem<br />
„schickliche und fleißige Weiber“ unentgeltlichen Unterricht in „Allem, was<br />
ihnen bei einer natürlich erfolgenden Geburt und Entbindung einer kreißenden<br />
Person zu thun“ sei, erhalten sollten. Dazu gehöre auch die Versorgung der<br />
Wöchnerinnen und des Kindes. Auch junge Ärzte und „Chyrurgi“, die sich der<br />
Geburtshilfe zuwenden wollten, sollten angeleitet werden und praktische Kenntnisse<br />
erwerben. Das Institut solle „das Triersche Institut“ benannt werden. Am<br />
22.05.1806, drei Wochen nach dem Tod der Stifterin, erfolgte die Übergabe des<br />
Grundstücks an die <strong>Universität</strong>.<br />
Ernst Platner (1744 – 1818), als Nachfolger von Gehler von 1796 bis 1810 Dekan<br />
der Medizinischen Fakultät, hatte präzise Vorstellungen zur Tätigkeit eines<br />
Hebammeninstituts, das gleichermaßen für die Ausbildung der Hebammen als<br />
auch der Geburtshelfer zuständig sein sollte. Schwangere in allen Phasen der<br />
Schwangerschaft konnten sich einfinden, der Unterricht sollte durch einen Professor<br />
der Entbindungskunst und durch einen Unterlehrer versehen werden. Die<br />
Ausbildung der Hebammen war in halbjährigem Zyklus vorgesehen. Ziel war<br />
es, Kenntnisse bei der Behandlung der natürlichen und der unnatürlichen Geburt<br />
zu erwerben. Der Unterricht der Studenten sollte ganzjährig erfolgen, und zwar<br />
sowohl als Vermittlung von theoretischem Wissen als auch zum Erlernen praktischer<br />
Fähigkeiten. Vorgesehen waren überdies Übungen am Phantom und die<br />
selbstständige Leitung von Geburten.<br />
1810 forderte Landesfürst Friedrich August I. eine „Obergeburtshelferstelle“<br />
an der Entbindungsanstalt. Der Stelleninhaber sollte der Medizinischen Fakultät<br />
als Professor ordinarius angehören. Vorgeschlagen und mit dieser Aufgabe<br />
betraut wurde Johann Christoph Gottfried Jörg. Als die Entbindungsanstalt am<br />
07.10.1810 eröffnet wurde, hatte sie eine Kapazität von sechs Betten. Am 08.10.<br />
erfolgte die feierliche Einweihung des „Trierschen Instituts“ in den Räumen am<br />
Peterstor an der alten Pleiße. Das erste Kind wurde am 10.10.1810 geboren.<br />
Eine erste Verlegung der Trierschen Instituts erfolgte 1828, da der Garten, in<br />
dem das Gebäude stand, sumpfig war und nach damaligen Vorstellungen Aus-<br />
127
dünstungen als Ursache für Erkrankungen galten. Im September 1828 konnte<br />
das „zweite Triersche Institut“ in einem Gebäude am Grimmaischen Steinweg<br />
No. 1294, in dem sich vorher Privatwohnungen befanden, eröffnet werden. Im<br />
Erdgeschoss waren ein Auditorium und die Wohnung für den Hausmeister<br />
eingerichtet; in der ersten Etage befanden sich Betten für Wöchnerinnen und<br />
Schwangere, die Wohnung der Hebamme, die Küche und die Speisekammer.<br />
Die zweite Etage war als Wohnung des Direktors hergerichtet. In der dritten<br />
Etage gab es Wohnungen für die Lehrtöchter, Zimmer für wohlhabende zahlende<br />
Schwangere und Wöchnerinnen, die nicht für den Unterricht zur Verfügung<br />
standen, und eine kleine Wohnung für den Assistenzarzt. Insgesamt standen nun<br />
12 Betten zur Verfügung. Laut Jörg konnten in der Anstalt die Wöchnerinnen<br />
vor dem Eindringen des Puerperalfiebers geschützt werden, die Verluste waren<br />
wesentlich geringer als im Dresdner Gebärhaus. Am 28.10.1828 wurde der Hörsaal<br />
eingeweiht.<br />
Mit der Zunahme der Bevölkerung in <strong>Leipzig</strong> stieg auch die Anzahl der Schwangeren,<br />
die wegen Raummangel nicht alle aufgenommen werden konnten. So<br />
plante man einen Anbau. Es entstanden ein Quergebäude mit der Front zur Johannisgasse<br />
und ein Hörsaal; beide Gebäudeteile wurden am 01.08.1853 eröffnet.<br />
Die Bettenzahl hatte sich verdoppelt. Vom 29.12.1853 bis zum 29.06.1854<br />
zählte man 134 aufgenommene und behandelte Mütter. Von Vorteil war auch,<br />
dass nun das Jacobsspital seine Einrichtung zur Aufnahme und Behandlung von<br />
Schwangeren aufheben konnte. Dort wurden nur noch kranke Schwangere bis<br />
zur Geburt betreut, gesunde Schwangere konnten gleich an das Hebammeninstitut<br />
verwiesen werden.<br />
Jörg vertrat als Schüler Boers eine abwartende, genau nach Indikationen vorgehende<br />
Geburtshilfe. Unter seiner Leitung trennte man die Entbindungsschule<br />
von der Hebammenschule. In letzterer wurden „Hebammen in dem unterrichtet,<br />
was sie als solche zu wissen und zu thun nötig haben“. Ein Arzt aber musste<br />
größere Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen. In der Geburtshilfeschule erfuhren<br />
junge Ärzte alles über die Natur des Weibes und des Kindes im Allgemeinen und<br />
über die Funktionen des Schwangerseins und Gebärens im Besonderen.<br />
Hebammen und Ärzte erhielten „wissenschaftlichen, technischen und moralischen“<br />
Unterricht. Die Hebammenausbildung umfasste wöchentlich 4 Stunden<br />
Unterricht in Hebammenkunst, 24 Stunden lang Aufsicht in den Zimmern der<br />
Schwangeren und Wöchnerinnen, einmal in der Woche Untersuchung von<br />
schwangeren Frauen, Anwesenheit und Pflege der Kinder und Wöchnerinnen<br />
und Gebärenden. 1820 gab Jörg für die Ausbildung der Hebammen ein „Lehr-<br />
128
uch der Hebammenkunst“ heraus, in dem er den regelmäßigen und regelwidrigen<br />
Verlauf der Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett und die jeweilige<br />
Behandlung der Wöchnerinnen durch die Hebamme sowie die Pflichten der Hebamme<br />
in kirchlichen (Nottaufe und Taufe zur regulären Zeit) und gerichtlichen<br />
Angelegenheiten (Feststellung einer Schwangerschaft, die Fähigkeit zu erkennen,<br />
ob eine Frau vor kurzem ein Kind geboren hat) abhandelte. Hebammen waren<br />
verpflichtet, unehelich Schwangere sowie Frauen, die eine Schwangerschaft<br />
verbargen, anzuzeigen.<br />
Der Unterricht der Studenten fand im Auditorium, im Zimmer der Schwangeren,<br />
am Geburts- und Wochenbett und bei Sektionen von Frauen- und Kinderleichen<br />
statt. Studenten mussten Übungen an verstorbenen Frauen und Kindern, an<br />
Phantomen und an lebenden Personen durchführen. Zur Ausbildung gehörte<br />
auch das Vorführen von Präparaten, von Wachsnachbildungen und von Instrumenten.<br />
Einmal pro Woche erfolgten 4 Stunden Vorlesung, wobei die Vorstellung<br />
von Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen und die<br />
Verwendung von Phantomen, Leichen, Trocken-, Feucht- und Wachspräparaten,<br />
Kupferstichen und Holzschnitten den theoretischen Stoff illustrierten. Auch geburtshilfliche<br />
und chirurgische Instrumente wurden vorgestellt und ihr Einsatz<br />
erklärt. Bei geburtshilflichen Operationen sah Jörg zwei Arten: vorbereitende<br />
Eingriffe wie die Wendung und Operationen, die zur Herausbeförderung des<br />
Kindes gedacht waren wie Kaiserschnitt, Benutzung der Zange und des Perforatoriums.<br />
Um 1850 war die geburtshilfliche Ausbildung in den Studienablauf integriert.<br />
Die Vorlesung fand im 6. Semester statt, im 8. Semester folgten Auskultieren<br />
und Übungen in der medizinischen, chirurgischen und geburtshilflichen Klinik<br />
sowie Vorlesungen über „Weiberkrankheiten“. Weitere klinische Praktika lagen<br />
im 9. Semester. Um als Geburtshelfer tätig sein zu können, musste die Ausbildung<br />
in einer mit einem Entbindungsinstitut verbundenen, unter öffentlicher<br />
Autorität bestehenden Lehranstalt nachgewiesen werden.<br />
In den Jahren 1841/42, 1849/50 und 1852/53 wirkte Jörg als Dekan der Medizinischen<br />
Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Er starb am 20.09.1856 kurz vor seiner<br />
Emeritierung.<br />
Zu seinen bedeutenden Schülern zählen Carl Gustav Carus (1789 – 1869), Professor<br />
der Entbindungskunst an der medizinisch-chirurgischen Akademie und<br />
Direktor der königlichen Hebammenschule in Dresden, Friedrich Ludwig Meissner<br />
(1795 – 1860), der eine geburtshilfliche Poliklinik in <strong>Leipzig</strong> errichtete;<br />
129
Woldemar Ludwig Grensner (1812 – 1872), Professor an der medizinisch-chirurgischen<br />
Akademie und Direktor des Entbindungsinstituts in Dresden, sowie<br />
Carl Hennig (1825 – 1911), Leiter der pädiatrischen Poliklinik und Direktor der<br />
von ihm gegründeten Kinderheilanstalt, die mit einer gynäkologischen Privatklinik<br />
in <strong>Leipzig</strong> verbunden war.<br />
Jörg machte sich nicht nur als Geburtshelfer einen Namen, sondern befasste<br />
sich auch mit Kinderheilkunde und setzte sich für die Verselbstständigung der<br />
Orthopädie ein. Davon zeugt nicht zuletzt seine umfangreiche publizistische<br />
Tätigkeit.<br />
Sabine Fahrenbach<br />
130
Christian Samuel Weiss<br />
Zum 150. Todestag am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />
Christian Samuel Weiss studierte an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> von<br />
1796 – 1800. Hier habilitierte er sich auch und war von 1808 – 1810<br />
Inhaber einer Professur für Physik. Er gilt als ein Begründer der modernen<br />
mathematisch fundierten Kristallographie und der kristallographischen<br />
Lehre und Forschung in Deutschland. Die hier abgebildete Medaille wurde<br />
anlässlich seines 200. Geburtstages am 26. Februar 1980 von der Vereinigung<br />
für Kristallographie gestiftet.<br />
131
Christian Samuel Weiss wurde am 26. Februar 1780 in <strong>Leipzig</strong> als Sohn des Archidiakonus<br />
an der Nikolaikirche geboren. Bereits mit 16 Jahren begann Weiss<br />
an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> zunächst Medizin zu studieren, wandte sich jedoch<br />
bald naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Mineralogie und Mathematik<br />
zu. Speziell die Physik gewann zu dieser Zeit enorm an Wertschätzung<br />
und Eigenständigkeit als Wissenschaftsdisziplin. Bereits 1785 hatte man im<br />
„Paulinum“ ehemalige Klosterzellen in ein universitätseigenes Physikalisches<br />
Kabinett umgestaltet, wodurch es möglich geworden war, das Experiment als<br />
neues didaktisches Mittel in die Ausbildung einzubeziehen. Die Durchführung<br />
eigener Versuche und die anschließende Auswertung der Ergebnisse konnten<br />
eine völlig neue Lehrmethode begründen und von der bis dahin praktizierten<br />
bloßen Interpretation physikalischer Texte aus der Literatur wegführen.<br />
1800 erwarb Weiss den Magistergrad der Philosophischen Fakultät, der dem<br />
heutigen Dr. phil. entspricht und habilitierte sich bereits ein Jahr später am<br />
23.09.1801 im Fach Physik. In seiner Habilitationsschrift, in der die Wurzeln für<br />
seine eigenen Ideen zur dynamischen Theorie der Kristallisation und zur Klassifikation<br />
der Kristalle nach Haupt- und Nebenachsen zu suchen sind, beschäftigte<br />
er sich mit den Begriffen des festen und des kristallinen Zustands, die in der damaligen<br />
Zeit sehr umstrittenen waren. Dadurch erkannte Weiss sein eigentliches<br />
für künftige Jahre wichtiges Interessengebiet.<br />
1801/02 weilte Weiss an der 1770 durch Friedrich II. gegründeten Bergakademie<br />
Berlin, um seine naturwissenschaftlichen Studien bei dem berühmten Chemiker<br />
Heinrich Klaproth, dem Geologen Leopold von Buch und dem Mineralogen<br />
Dietrich L. G. Karsten zu vervollkommnen. Von Buch und Karsten waren<br />
Schüler Abraham Gottlob Werners an der Bergakademie Freiberg gewesen und<br />
machten Weiss mit Mineralogie und Geologie unter dem Aspekt der praktischen<br />
Bedürfnisse des Bergbaus vertraut. Karsten erkannte sehr bald die Begabung<br />
von Weiss für mineralogische und kristallographische Probleme und beauftragte<br />
ihn mit der Übersetzung von René Just Haüys Lehrbuch der Mineralogie aus<br />
dem Französischen. Während der mehrjährigen Übersetzungsarbeiten studierte<br />
Weiss auf Anraten von Buchs 1802/03 in Freiberg bei Abraham Gottlob Werner<br />
Mineralogie.<br />
In Werner und von Buch hatte Weiss zwei Vertreter gegensätzlicher Theorien<br />
über die Gesteinsentstehung kennen gelernt: Die Neptunisten mit Werner als<br />
Hauptvertreter, zu denen sich auch Goethe bekannte, glaubten, dass die Gesteine<br />
überwiegend aus dem Wasser entstehen. Hingegen vertraten die Plutonisten,<br />
deren berühmtester deutscher Vertreter von Buch war, die Meinung, dass deren<br />
132
Abscheidung überwiegend aus dem magmatischen Schmelzfluss erfolgt. Weiss,<br />
der sich bei späteren Studienreisen in die Vulkangegend der Auvergne von der<br />
Unhaltbarkeit des Neptunismus überzeugen musste, hat sich aber zu dieser Zeit<br />
nie öffentlich zu diesem Streit geäußert. Die Freundschaft zu Werner, der ihn<br />
selbst als seinen besten Schüler bezeichnet hatte, hat ihn offenbar davon abgehalten,<br />
was später dazu geführt hat, dass man Weiss vorgehalten hat, Werners Lehre<br />
unkritisch an die Studenten weiterzugeben.<br />
Der damals ungelöste Streit zwischen Neptunisten und Plutonisten mag auch<br />
einer von vielen Gründen gewesen sein, dass sich Weiss lieber kristallographischen<br />
Problemen zugewandt hat. Die Wernersche Lehre von den Kristallformen<br />
als äußeres Kennzeichen der Minerale war hierbei ein wesentlicher Ansatzpunkt.<br />
Ein weiterer ergab sich aus seiner Übersetzungstätigkeit von Haüys Lehrbuch<br />
der Mineralogie, durch die er sich nicht nur profunde Kenntnisse in Mineralogie<br />
und Kristallographie aneignete, sondern auch bis dahin bestehende Unstimmigkeiten<br />
in Haüys Kristallstrukturlehre erkannte. Von Ostern 1803 bis zum Herbst<br />
1805 hielt Weiss als Privatdozent an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> Vorlesungen über<br />
Mineralogie, Geologie, Chemie und Physik. Bereits hier entwickelte er seine<br />
kristallographische Grundauffassung, die er Haüys Kristallstrukturlehre entgegensetzte<br />
und 1804 in seiner Schrift „Dynamische Ansicht der Krystallisation“<br />
als Anhang zur deutschen Übersetzung des ersten Bandes von Haüys Lehrbuch<br />
der Mineralogie veröffentlichte.<br />
Im Herbst 1805 ließ sich Weiss für eine längere Studienreise von der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Leipzig</strong> beurlauben und wandte sich zunächst nach Berlin, 1806 dann nach Wien.<br />
Von da an erhielt er auf ein Gesuch hin vom Sächsischen Kurfürsten Friedrich<br />
August III. 200 Taler pro Jahr Unterstützung, um seine geplanten Reiseziele<br />
Steiermark, Salzburg, Bayern, Tirol, Oberitalien, die Schweiz und Frankreich<br />
realisieren zu können. Als Gegenleistung forderte der Kurfürst einen Bericht<br />
über alle neuartigen Geräte, Vorrichtungen und Versuche, die Weiss auf seiner<br />
Reise an wissenschaftlichen Einrichtungen kennenlernte. Während dieser Reise<br />
machte sich Weiss eingehend mit den geologischen Verhältnissen der besuchten<br />
Länder vertraut und besichtigte die bereits damals bedeutenden Mineraliensammlungen<br />
in Wien und Paris. Hier traf Weiss auch auf Haüy, der dem jungen<br />
Gelehrten zunächst sehr zugetan war, sein Interesse aber in schroffe Abneigung<br />
wandelte, als er von den entgegengesetzten Ansichten seines Gesprächspartners<br />
über die Kristallisation erfuhr.<br />
Am 01.08.1808 wurde der noch in Paris weilende Weiss auf eine ordentliche<br />
Professur für Physik an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> berufen. Am 08.03.1809 hielt<br />
133
er seine Antrittsvorlesung. In dieser und in einer drei Tage später vorgetragenen<br />
Dissertation gab er einen Überblick über seine dynamische Theorie zur Kristallisation<br />
und vorliegende kristallographische Beobachtungen an Mineralen.<br />
Weiss blieb jedoch nicht lange in <strong>Leipzig</strong>. Die neu gegründete <strong>Universität</strong><br />
Berlin machte talentierten Wissenschaftlern der alten <strong>Universität</strong>en günstige<br />
Angebote, und es verwundert nicht, dass Weiss unter ihnen war. Am Ende des<br />
Sommersemesters 1810 verließ Weiss seine Heimatstadt, um einem Ruf nach<br />
Berlin als ordentlicher Professor für Mineralogie, Aufseher des Königlichen<br />
Mineralienkabinetts und Assessor in der Bergbau-Direktion zu folgen. An der<br />
Berliner <strong>Universität</strong>, der Weiss zeit seines Lebens die Treue hielt, zählte er bald<br />
zu den angesehensten Professoren, was sich unter anderem darin äußerte, dass<br />
er fünfmal zum Dekan der philosophischen Fakultät und zweimal zum Rektor<br />
gewählt wurde. Seine Leistungen wurden auch durch zahlreiche Mitgliedschaften<br />
in wissenschaftlichen Vereinigungen gewürdigt. So war Weiss bereits 1803<br />
Mitglied der Münchener Akademie der Wissenschaften geworden, weil er deren<br />
Preisaufgabe gelöst hatte. 1815 wurde er Mitglied der Königlichen Akademie<br />
der Wissenschaften in Berlin und 1816 ordentliches Mitglied der Gesellschaft<br />
der naturforschenden Freunde zu Berlin.<br />
Weiss gilt als Begründer der modernen mathematisch fundierten Kristallographie.<br />
Er entdeckte bereits 1804, dass die am Kristall auftretenden Flächen im<br />
Zonenverband vorliegen. In einer Zone liegende Flächen sind dadurch charakterisiert,<br />
dass sie parallel zueinander verlaufende Kanten besitzen. Aus drei<br />
Flächen, die nicht in einer Zone liegen, leitete Weiss als erster sämtliche am<br />
Kristall möglichen Flächen ab (Zonenverbandsgesetz). Zur mathematischen<br />
Beschreibung der Flächen führte Weiss kristallographische Achsensysteme ein<br />
und charakterisierte die räumliche Lage einer Kristallfläche durch ihre Achsenabschnitte.<br />
Er erkannte weiterhin, dass am Kristall nur solche Flächen auftreten<br />
können, deren Achsenabschnitte rationale Vielfache der Achsenabschnitte einer<br />
Grundfläche verkörpern (Rationalitätsgesetz). Bei der Aufstellung der kristallographischen<br />
Achsensysteme unterschied Weiss nur fünf verschiedene Fälle, weil<br />
er die schiefwinkligen (monoklin und triklin) noch nicht berücksichtigte. Dies<br />
korrigierte 1822 sein Schüler Friedrich Mohs. Mit diesen Erkenntnissen war es<br />
Weiss möglich, eine mathematisch fundierte Theorie der Kristallmorphologie<br />
auszuarbeiten, die lehrbar, erlernbar und praktisch anwendbar war. Er schuf<br />
damit wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung der Kristallographie zu<br />
einer selbstständigen naturwissenschaftlichen Disziplin. Die Jahre, die Christian<br />
Samuel Weiss an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> verbrachte, setzten dafür wichtige Meilensteine:<br />
Hier bekam er eine breite naturwissenschaftliche Grundausbildung<br />
134
geboten, hier konnte er sich zielstrebig und schnell zum Hochschullehrer entwickeln,<br />
und der geistige Austausch mit hiesigen und während seiner Studienreisen<br />
an anderen Hochschulen besuchten Wissenschaftlern lieferte den Nährboden für<br />
seine hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Kristallographie.<br />
Weiss war bis in seine letzten Lebensjahre rüstig und gesund. Er starb am<br />
01.10.1856 während einer Bade- und Erholungsreise in Eger, wo er auch seine<br />
letzte Ruhestätte fand.<br />
Hans-Joachim Höbler<br />
135
Seminar für Landesgeschichte und<br />
Siedlungskunde<br />
Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />
Das 1906 begründete „Seminar für Landesgeschichte und Siedelungskunde“<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> war das erste landesgeschichtliche Forschungsinstitut<br />
in Deutschland. Mit der Bestellung Rudolf Kötzschkes (Abb.) zum<br />
Direktor dieser Einrichtung am 1. Oktober 1906 begann eine mehrere<br />
Jahrzehnte währende fruchtbare Phase der <strong>Leipzig</strong>er Landesgeschichte in<br />
Forschung und Lehre.<br />
137
Kötzschke, am 8. Juli 1867 in Dresden geboren, hatte in <strong>Leipzig</strong> die Hauptfächer<br />
Latein und Geschichte und die Nebenfächer Deutsch, Geographie und<br />
Griechisch studiert. Nichts deutete in seinem Studium darauf hin, dass er zu<br />
einem der innovativsten Historiker des beginnenden 20. Jahrhunderts werden<br />
sollte, dessen Name bis heute Fachleuten auch außerhalb Sachsens geläufig ist.<br />
Wesentliche Impulse hat Kötzschke allerdings auch nicht von der damaligen<br />
Geschichtswissenschaft erhalten, die vorrangig an der großen Politikgeschichte<br />
interessiert war.<br />
Nach Staatsprüfung und Promotion 1890 war Kötzschke zunächst als Lehrer an<br />
einer Dresdner Privatschule tätig, bis ihn 1894 der Historiker Karl Lamprecht<br />
(1856 – 1915) nach <strong>Leipzig</strong> holte. Dessen Betonung der Kulturgeschichte im<br />
weitesten Sinne zielte auf eine konzeptionelle Neuausrichtung der Geschichtswissenschaft.<br />
Lamprecht hatte sich durch sein bahnbrechendes Buch „Deutsches<br />
Wirtschaftsleben im Mittelalter“ über die Entwicklung der materiellen Kultur<br />
des Mosellandes (1885/1886) einen Namen gemacht. Diese Forschungen gedachte<br />
er in <strong>Leipzig</strong> fortzusetzen und gewann Kötzschke für die Herausgabe der<br />
Urbare der Abtei Werden an der Ruhr. Mit Studien zur Verwaltungsgeschichte<br />
dieser Grundherrschaft hat sich Kötzschke 1899 in <strong>Leipzig</strong> für „mittlere und neuere<br />
Geschichte, im besonderen für sächsische Landesgeschichte“ habilitiert. Die<br />
Beschäftigung mit wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Quellen hat Kötzschke<br />
den Zugang zur allgemeinen Wirtschaftsgeschichte eröffnet, die zeitlebens ein<br />
wichtiges Arbeitsfeld bleiben sollte, wie an seinen großen Handbuchdarstellungen<br />
der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters (1908, 1924) ablesbar ist.<br />
Ein Schüler Lamprechts im eigentlichen Sinne ist Kötzschke zwar nicht gewesen,<br />
doch ließ er sich von ihm für landesgeschichtliche Forschungen gewinnen,<br />
für die mit der Sächsischen Kommission für Geschichte 1896 ein erster organisatorischer<br />
Rahmen geschaffen worden war. Mit Hilfe Kötzschkes gelang<br />
es Lamprecht, die Landesgeschichte an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> zu etablieren.<br />
Allerdings gestaltete sich die akademische Laufbahn Kötzschkes angesichts<br />
des sogenannten „Methodenstreits“, der in <strong>Leipzig</strong> um Lamprecht entbrannt<br />
war, schwierig. 1905 wurde Kötzschke Extraordinarius, seit 1917 Inhaber einer<br />
Professur für sächsische Geschichte, doch erst 1930 sollte er ein persönliches<br />
Ordinariat erhalten.<br />
Ein Meilenstein auf dem Weg zur Institutionalisierung des Faches war das<br />
1906 begründete Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde, nach<br />
dessen Vorbild später an weiteren <strong>Universität</strong>en landesgeschichtliche Institute<br />
gegründet worden sind. Schon an der Bezeichnung ist der prägende Einfluss der<br />
138
Geographie ablesbar. Für Lamprecht und Kötzschke war nämlich in <strong>Leipzig</strong> die<br />
Begegnung mit Friedrich Ratzel (1844 – 1904) von Bedeutung geworden, der<br />
zu den Begründern einer modernen Geographie gehörte. Sowohl die von Ratzel<br />
entwickelten Ansätze der Anthropogeographie, die auf die Wechselwirkungen<br />
zwischen Mensch und Erdoberfläche zielten, als auch die damit verbundene<br />
politische Geographie sind prägend für die <strong>Leipzig</strong>er Landesgeschichte gewesen.<br />
Ratzels programmatisches Diktum „Im Raum lesen wir die Zeit“ wurde<br />
von Kötzschke aufgegriffen und führte zu methodischen Neuansätzen, die weit<br />
über Sachsen hinaus gewirkt haben. Bereits 1898 war es auf Anregung Ratzels<br />
im Geographischen Seminar zur Gründung eines Historisch-geographischen<br />
Instituts gekommen. Aus der von Karl Lamprecht geleiteten Abteilung für historische<br />
Geographie mittlerer und neuerer Zeiten, an der Kötzschke als Assistent<br />
beschäftigt war, ist das Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde hervorgegangen.<br />
Hier entwickelte Rudolf Kötzschke die methodischen Neuansätze und Arbeitsvorhaben,<br />
die ihn zeitlebens beschäftigen sollten. Wenn für Kötzschke seit etwa<br />
1900 Landesgeschichte ganz wesentlich zur Siedlungsgeschichte wurde, dann<br />
ist dafür allerdings nicht nur der allgemeine Einfluss von Ratzel verantwortlich<br />
gewesen. Entscheidende methodische Anstöße hatte er auch August Meitzens<br />
Buch „Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten,<br />
Römer, Finnen und Slawen“ (1895) und der darin angewandten kartographischen<br />
Methodik zu verdanken. Siedlungsgeschichte im Sinne Kötzschkes zielte<br />
auf größere Zusammenhänge der Agrar-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte.<br />
Die Kartographie wurde durch ihn zu einer konsequent angewendeten<br />
historischen Methodik und mündete in zwei große landesgeschichtliche Arbeitsvorhaben<br />
ein: Den „Atlas typischer Flurkarten zur Geschichte der Agrarverfassung“<br />
konnte Kötzschke zwar fertigstellen, doch verbrannten bei einem Luftangriff<br />
auf <strong>Leipzig</strong> 1943 alle Vorarbeiten. Weniger weit gediehen waren damals<br />
die Arbeiten am „Historischen Atlas von Sachsen“, der aber seit 1998 als „Atlas<br />
zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen“ unter der Herausgeberschaft des<br />
Kötzschke-Schülers Karlheinz Blaschke veröffentlicht wird.<br />
Sowohl auf dem Gebiet der Siedlungsgeschichte als auch der Landesgeschichte<br />
hat Kötzschke schulebildend gewirkt. In seinem Seminar sind von 1906 bis zu<br />
seiner Emeritierung 1935 über 100 Dissertationen zu Themen der allgemeinen<br />
Siedlungs- und Agrargeschichte wie auch zur sächsischen Landesgeschichte<br />
entstanden. Als seine bedeutendsten Schüler sind Karlheinz Blaschke, Heinz<br />
Quirin, Herbert Helbig und Walter Schlesinger zu nennen. Schlesinger hat als<br />
Ordinarius in Berlin, Frankfurt und Marburg die westdeutsche Mittelalterfor-<br />
139
schung der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre maßgeblich geprägt und ihr<br />
durch die Verbindung von mittelalterlicher Verfassungs- und Landesgeschichte<br />
nachhaltige Impulse gegeben.<br />
Kötzschkes innovativer Paradigmenwechsel hatte sich allerdings schon seit den<br />
20er Jahren mit völkischen Vorstellungen verbunden. Die Schockerfahrung des<br />
Ersten Weltkrieges und Grenzverschiebungen im Osten lenkten den Blick auf<br />
„deutsches Land und deutsches Volkstum“ jenseits der Reichsgrenze und damit<br />
auf die Erforschung der deutschen Ostsiedlung des Mittelalters. Die neuen<br />
landesgeschichtlichen Ansätze mündeten in den 30er Jahren in die sogenannte<br />
Volks- und Kulturbodenforschung, als deren maßgeblicher Vertreter neben<br />
Kötzschke der Bonner Landeshistoriker Hermann Aubin (1885 – 1969) zu nennen<br />
ist. Wie in Bonn resultierte daraus in <strong>Leipzig</strong> eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
mit der Sprachgeschichte und Volkskunde, die sich in dem Werk<br />
„Kulturräume und Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten“ (1936) manifestierte.<br />
Gemeinsam mit seinem Schüler Wolfgang Ebert veröffentlichte Kötzschke<br />
1937 eine „Geschichte der ostdeutschen Kolonisation“, die erste umfassende<br />
Synthese dieses für Sachsen und Mitteldeutschland wie für den gesamten<br />
ostdeutschen und ostmitteleuropäischen Raum bedeutenden Umbruchprozesses.<br />
1935, im Jahr seiner Emeritierung, hat Kötzschke gemeinsam mit dem Dresdner<br />
Archivar Hellmut Kretzschmar die „Geschichte Sachsens“ veröffentlicht. Das<br />
Buch stellt eine bis heute unübertroffene Synthese dar, die durch die vorbildliche<br />
Berücksichtigung der Wirtschafts-, Sozial-, Verfassungs- und Kulturgeschichte<br />
im Kontext der Landes- und Reichsgeschichte noch immer besticht.<br />
Als Nachfolger Kötzschkes wurde 1935 der Österreicher Adolf Helbok berufen,<br />
der durch Arbeiten zur Siedlungsgeschichte für die Fortführung der<br />
<strong>Leipzig</strong>er Neuansätze in der Landesgeschichte geeignet erschien. Allerdings<br />
hatte sich Helbok nicht nur frühzeitig der Volksgeschichte zugewandt, sondern<br />
gefordert, die „Rassekunde“ als neue geschichtswissenschaftliche Methodik zu<br />
berücksichtigen, während sich Kötzschke schon 1927 gegen die Verwendung<br />
des Begriffs „Rasse“ in der Geschichtswissenschaft verwahrt hatte. Nach der<br />
Machtergreifung Hitlers 1933 enthalten zwar manche Veröffentlichungen<br />
Kötzschkes regimekonforme Äußerungen, doch bleibt festzuhalten, dass er sich<br />
langfristig weder weltanschaulich angepasst noch für die NS-Bewegung engagiert<br />
hat. Zu den Protagonisten einer nationalsozialistisch geprägten Volks- und<br />
Kulturraumforschung hat er nicht gehört. Ganz anders sein Nachfolger Adolf<br />
Helbok, dessen <strong>Leipzig</strong>er Antrittsvorlesung über „Die Aufgaben der deutschen<br />
Landes- und Volkstumsgeschichte“ 1935 deutlich machte, dass mit seiner Berufung<br />
eine Neuausrichtung der Landesgeschichte und damit auch des Seminars<br />
140
für Landesgeschichte und Siedlungskunde verbunden war, das in Institut für<br />
Deutsche Landes- und Volksgeschichte umbenannt wurde. Die Kötzschke-<br />
Schüler Schlesinger und Helbig schieden im Streit aus dem Institut aus, weil<br />
sie wie ihr Lehrer Helboks Volkstumsgeschichte auf rassischer Grundlage als<br />
unwissenschaftlich ablehnten. Hinzu kam der berechtigte Vorwurf, dass Helbok<br />
an Fragen der sächsischen Geschichte uninteressiert war; entsprechend erfolglos<br />
blieb er als akademischer Lehrer in <strong>Leipzig</strong>. Zum 1. Mai 1941 ist Adolf Helbok<br />
deshalb einem Ruf an die <strong>Universität</strong> Innsbruck gefolgt. Währenddessen liefen<br />
mit tätiger Förderung Kötzschkes schon Bemühungen, seinen 1940 habilitierten<br />
Schüler Walter Schlesinger als Professor für Landesgeschichte nach <strong>Leipzig</strong> zu<br />
berufen. Schlesinger konnte allerdings erst im Juli 1944, nach einer schweren<br />
Kriegsverwundung, seine Tätigkeit in <strong>Leipzig</strong> aufnehmen. Das landesgeschichtliche<br />
Institut war bereits im Dezember 1943 durch einen Luftangriff total zerstört<br />
worden.<br />
Die landesgeschichtliche Arbeit in <strong>Leipzig</strong> musste deshalb nach Kriegsende aus<br />
dem Nichts wiederbegründet werden. Schlesinger war, obschon nie NS-Aktivist,<br />
aufgrund seiner formellen NSDAP-Mitgliedschaft 1945 entlassen worden. Deshalb<br />
wurde der hochbetagte Kötzschke neuerlich mit der Leitung des früheren<br />
Seminars, des Instituts für deutsche Landes- und Volksgeschichte betraut, das<br />
am 7. Oktober 1946 wiedereröffnet wurde. Kötzschke hat noch bis kurz vor<br />
seinem Tod am 3. August 1949 an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> gelehrt und sich<br />
um den Wiederaufbau der vernichteten Seminarbibliothek bemüht. Kötzschkes<br />
Institut für Deutsche Landes- und Volksgeschichte wurde 1951 als Abteilung<br />
Landesgeschichte dem Institut für Deutsche Geschichte der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
angegliedert. Unter den wissenschaftlichen Rahmenbedingungen der DDR war<br />
es der <strong>Leipzig</strong>er Landesgeschichte nicht mehr möglich, ihre frühere Bedeutung<br />
zurückzuerlangen, zumal die Professur für sächsische Landesgeschichte nicht<br />
wieder besetzt wurde. Seit den 50er Jahren hat Karlheinz Blaschke zunächst als<br />
Archivar im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden, nach seinem erzwungenen<br />
Ausscheiden aus dem Staatsdienst 1968 als Dozent am außeruniversitären Theologischen<br />
Seminar in <strong>Leipzig</strong> die Ansätze seines Lehrers Kötzschke fortgeführt<br />
und nach der Wiedervereinigung Deutschlands als Professor für Landesgeschichte<br />
an der TU Dresden auch an eine jüngere Historikergeneration weitergegeben.<br />
Die interdisziplinäre Siedlungsforschung Kötzschkes ist bis in die Gegenwart<br />
im Rahmen der deutsch-slavischen Namenforschung in <strong>Leipzig</strong> (Ernst Eichler,<br />
Hans Walther) von großer Bedeutung. Die landesgeschichtliche Arbeit an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> konnte hingegen als „marxistische Regionalgeschichte“ unter<br />
den schwierigen ideologischen Rahmenbedingungen seit den 60er Jahren zunächst<br />
von Karl Czok, dann von Helmut Bräuer mit neuen Ansätzen fortgesetzt<br />
141
werden. Nach der Wiedervereinigung erhielt 1992 Wieland Held (1939 – 2003)<br />
die Professur für sächsische Landesgeschichte. Dabei hat Held ebenso wie sein<br />
2001 berufener Nachfolger eigene thematische Akzente gesetzt.<br />
Das 1906 begründete Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde<br />
markiert im Rückblick eine wichtige Etappe auf dem Weg der Verwissenschaftlichung<br />
der Landesgeschichte. Die von Rudolf Kötzschke entwickelten<br />
siedlungsgeschichtlichen Methoden sind keineswegs überholt, doch gehört die<br />
Siedlungsgeschichte heute nicht mehr zu den vorherrschenden Arbeitsfeldern<br />
der Landesgeschichte. Wichtig und zukunftsweisend bleibt jedoch ein anderes<br />
methodisches Grundanliegen Kötzschkes, nämlich seine Forderung, Landesgeschichte<br />
im allgemeinhistorischen Rahmen und in vergleichender Perspektive<br />
zu erforschen. Dieses Verständnis von Landesgeschichte hat bis heute nichts an<br />
Aktualität eingebüßt.<br />
Enno Bünz<br />
142
Friedrich Louis Hesse<br />
Zum 100. Todestag am 22. Oktober <strong>2006</strong><br />
Friedrich Louis Hesse (1849 – 1906) wurde zum Wegbereiter der wissenschaftlichen<br />
und sozial ausgerichteten Zahnheilkunde und Gründer<br />
des 1884 eröffneten <strong>Leipzig</strong>er Zahnärztlichen Instituts, das zu Jahresbeginn<br />
1898 von der <strong>Universität</strong> übernommen wurde. Bleibende Verdienste<br />
erwarb er sich auch durch seinen letztlich erfolgreichen Einsatz für<br />
eine – theoretisch wie praktisch – optimale Ausbildung der Studierenden<br />
und für die Gleichstellung der Zahnheilkunde mit der übrigen Medizin.<br />
143
Der aus dem sächsischen Bischofswerda stammende Friedrich Louis Hesse, am<br />
07.12.1849 in einer Arztfamilie geboren, begann Ostern 1868 nach Beendigung<br />
des Gymnasiums in <strong>Leipzig</strong> Medizin zu studieren. Während des Deutsch-Französischen<br />
Krieges 1870, in seinem 5. Semester, unterbrach er das Studium und<br />
meldete sich als Einjährig-Freiwilliger zum Waffendienst. In Frankreich wurde<br />
er auf Bemühen seines Vaters zum Sanitätsdienst kommandiert. Danach nahm<br />
er sein unterbrochenes Studium in <strong>Leipzig</strong> wieder auf. 1873 approbiert, promovierte<br />
er bei dem Anatomen Professor Wilhelm His. Am neuen Anatomischen<br />
Institut erhielt er 1875 die erste Assistenz mit 600 Talern jährlich und freier<br />
Wohnung, und hier erfolgte seine Ernennung zum Prosektor.<br />
Beim Besuch seines in den Vereinigten Staaten von Amerika als Arzt tätigen<br />
Bruders Richard in den Sommerferien 1879 verbrachte er so manche Stunde bei<br />
dessen Zahnarzt, Dr. Shapmann. In Brooklyn besuchte er das seinerzeit unvergleichlich<br />
reichhaltig ausgestattete Medical Department der Pennsylvanischen<br />
<strong>Universität</strong>, wobei ihn besonders das Dental College interessierte. Er gewann<br />
immer größeres Interesse an der Zahnheilkunde, die zu diesem Zeitpunkt im<br />
wesentlichen in Deutschland noch von Medizinern ohne spezielle fachliche<br />
Qualifikation ausgeübt wurde.<br />
In einem Gespräch mit His erklärte dieser ihm, dass er seine Zukunft eher in der<br />
Chirurgie sähe als in der Anatomie. Hesse jedoch äußerte den Wunsch, in den<br />
Vereinigten Staaten Zahnheilkunde zu studieren, um später eine Unterrichtsanstalt<br />
in Deutschland aufzubauen. His unterstützte ihn in seinen Bemühungen um<br />
die Einführung des wissenschaftlichen Zahnheilkundeunterrichts. Von Professor<br />
Carl Ludwig erhielt er den Rat, der Fakultät anzuzeigen, dass er nach einem<br />
zweijährigen Urlaub die Zahnheilkunde in Deutschland zu vertreten wünsche.<br />
Ludwig wollte auch seinen Einfluss beim Ministerium geltend machen, Hesse<br />
die Leitung eines Zahnärztlichen Instituts in <strong>Leipzig</strong> zu übertragen.<br />
So reiste er 1880 ein zweites Mal nach den Vereinigten Staaten und schrieb sich<br />
am New Yorker Dental College ein, wo er im Oktober 1881 sein Examen ablegte.<br />
Auch wenn sein Gesuch nach Einrichtung eines Zahnärztlichen Instituts vom<br />
sächsischen Kultusministerium abgelehnt wurde, kehrte er nach Deutschland<br />
zurück und eröffnete im Februar 1882 in <strong>Leipzig</strong> seine bald sehr erfolgreiche<br />
Praxis. In einem Schreiben der Medizinischen Fakultät vom 21. Juli 1882 an das<br />
Kultusministerium in Dresden wird darauf hingewiesen, dass für das zu gründende<br />
<strong>Leipzig</strong>er Zahnärztliche Institut ein Direktor gesucht werden müsse, der<br />
„an den Fortschritten der Zahnheilkunde wissenschaftlich und technisch beteiligt<br />
ist und dadurch die Bürgschaft gibt für die Vollständigkeit eines immer auf<br />
144
der Höhe bleibenden Unterrichts“. Im Mai 1884 erhielt Hesse vom königlichen<br />
Ministerium den Auftrag, für die Errichtung des Zahnärztlichen Instituts an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> Status und Etat auszuarbeiten. Dabei sollte Berücksichtigung<br />
finden, dass sich das Institut teilweise finanziell selbst zu tragen habe, wie es in<br />
den Vereinigten Staaten üblich war.<br />
Im April 1884 wurde Hesse auf einer Sitzung der Medizinischen Fakultät einstimmig<br />
zum Extraordinarius vorgeschlagen. Kurze Zeit später erhielt er die<br />
Erlaubnis, in <strong>Leipzig</strong> im universitätseigenen Gebäude Goethestraße 5 ein solches<br />
Institut zu errichten. Letzten Anstoß dazu gab das Testament des Pfarrers<br />
Friedrich Adolph Huth, der dafür eine Summe von 15 000 Mark bestimmte. Mit<br />
der Eröffnung am 16. Oktober 1884 wurde Hesse zum außerordentlichen Professor<br />
mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde berufen und zum Leiter des Instituts<br />
ernannt. Da der Staat nur eine Subvention zahlte, besaß dieses keinen staatlichen<br />
Charakter. Die Zahl der Studierenden betrug im ersten Semester nur 7. So reichte<br />
Hesse mit seinem amerikanischen Assistenten Frederic Joung zunächst aus.<br />
1885 folgten wegen steigender Studentenzahlen zwei weitere Assistenten und<br />
die Erweiterung auf das zweite Stockwerk.<br />
Anlässlich eines Besuchs König Alberts von Sachsen im Zahnärztlichen Institut<br />
hielt Hesse einen Vortrag über dessen Entwicklung, Aufgaben und Fortschritte,<br />
fertigte einen Abdruck vom Bilde des Königs von einem Geldstück und führte<br />
die neu angeschafften Bohrmaschinen und die elektrische Stuhlbeleuchtung vor.<br />
Eine Wertschätzung, die auch heute kein Klinikdirektor ausschlüge!<br />
Die Patienten waren vorwiegend Arbeiter und Gewerbetreibende, die bereit<br />
waren, den Studierenden für geringes Entgelt bzw. kostenfrei zur Verfügung zu<br />
stehen. Hesse bot diesen Schichten erstmalig die Gelegenheit, erkrankte Zähne<br />
zu erhalten. Er hat damit den für die Zahnheilkunde wichtigen Wandel von der<br />
reinen Extraktionstherapie hin zur Zahnerhaltung wesentlich mit unterstützt.<br />
Diese Form einer sozialen Zahnheilkunde brachte ihn in Widerspruch zur angestrebten<br />
Eigenerwirtschaftung, vielmehr verstärkte er seine Bemühungen um<br />
die Übernahme der Finanzierung durch die <strong>Universität</strong>. Hesse führte als erster in<br />
Deutschland die konservierende Tätigkeit für Mitglieder der Ortskrankenkasse<br />
ein. So orientierte er sich stärker auf die praktische Ausbildung in dieser Zeit,<br />
wodurch Forschungsaufgaben in seinen Aufzeichnungen keine Erwähnung finden.<br />
1898 führte er, nachdem er Unterricht bei einem Goldschmied genommen<br />
hatte, die Metalltechnik ein, er erlernte die Methode der Herstellung von Porzellanfüllungen<br />
bei Jenkins in Dresden und lehrte bald auch diese. Ab 1. Januar<br />
1898 wurde das Institut endlich auf <strong>Universität</strong>srechnung übernommen.<br />
145
All diese Aufgaben und die rege Teilnahme Hesses an der Standespolitik, so war<br />
er von 1892 bis 1900 Vorsitzender des „Zentralvereins Deutscher Zahnärzte“,<br />
die doppelte Zeit Vorsitzender des „Zahnärztlichen Vereins für das Königreich<br />
Sachsen“, auch wurde er Mitglied des Exekutivkommittees der Féderation Dentaire<br />
Internationale, führten zu Raubbau an seiner Gesundheit. So schreibt er in<br />
seinem Tagebuch: „Ich bin 47 Jahre alt. Meine Arbeitskraft beginnt abzunehmen<br />
und so ist es eine üble Aussicht, dass die Anforderungen an mich wachsen<br />
sollen.“ In diesen Jahren verschlechterte sich sein Gesundheitszustand immer<br />
weiter, die Sehkraft ließ nach, schwere Ermüdungserscheinungen traten auf.<br />
Seine letzten Lebensjahre wurden vom Kampf im Interesse der Zahnärzte um<br />
die Anerkennung ihres Standes belastet. Im Gerichtsstreit mit den sogenannten<br />
Spezialärzten für Zahn- und Mundkrankheiten ohne spezielle Ausbildung und<br />
Approbation bekam er seitens des Kultusministeriums keine Unterstützung. Hesse<br />
sah seine jahrelangen Bemühungen um die Gleichstellung der Zahnheilkunde<br />
mit der übrigen Medizin dadurch in Frage gestellt.<br />
Diese sechsjährige Auseinandersetzung setzte ihm so zu, dass er sich von seinen<br />
Verpflichtungen entbinden ließ, seine Privatpraxis aufgab und im Heilbad<br />
Suderode Entspannung suchte. Nach seiner Rückkehr litt er jedoch erneut unter<br />
schweren depressiven Zuständen. Er glaubte als Arzt zu erkennen, dass seine<br />
Energie nicht ausreiche, dieser Veranlagung zu widerstehen. So beschloss er, aus<br />
dem Leben zu scheiden. Am 22.10.1906 wurde er von einem Polizeibeamten im<br />
<strong>Leipzig</strong>er Rosental tot aufgefunden.<br />
Bedauerlicherweise konnte Hesse die gleich nach seinem Tode einsetzende<br />
Verwirklichung seiner Ziele nicht mehr erleben. 1909 wurde im Rahmen einer<br />
neuen Prüfungsordnung das Abitur als Vorbedingung für die Aufnahme des<br />
Zahnheilkundestudiums eingeführt, womit die von ihm so leidenschaftlich erstrittene<br />
Aufwertung des Faches eingeleitet wurde. Ebenso konnten Zahnärzte<br />
sich ab 1919 zum Dr. med. dent. promovieren. Vier Jahre nach seinem Tod<br />
erhielt <strong>Leipzig</strong> ein geräumiges, großzügig angelegtes Zahnärztliches Institut<br />
in der Nürnberger Straße. Dafür wurde die für die damalige Zeit ungeheure<br />
Summe von fast einer halben Million Reichsmark bewilligt. So entstand ein für<br />
Deutschland einmaliges Institut, das sowohl dem modernen Unterricht als auch<br />
der wissenschaftlichen Forschung genügte.<br />
Hannelore Schwann hebt in ihrem Versuch der kritischen Würdigung von Hesses<br />
Verdiensten hervor, dass er sein Augenmerk vorrangig auf den praktischen<br />
zahnärztlichen Unterricht konzentrierte, dabei der wissenschaftlichen Arbeit<br />
weniger Bedeutung zumaß. Dies war dem Umstand geschuldet, dass er der For-<br />
146
derung der Wirtschaftlichkeit nachkommen musste. Er nutzte die vielfältigen<br />
Kontakte durch seine Vereinstätigkeit zur weiteren Verbreitung des Gedankens<br />
der Zahnerhaltung und der Kariesprophylaxe mit organisatorischem und rhetorischem<br />
Talent. Das tragische Ende Hesses sei ihrer Meinung nach nicht allein auf<br />
seinen Gesundheitszustand zurückzuführen, sondern auch auf seine heute kaum<br />
nachzuempfindenden Vorstellungen einer „Standesehre“, für die er so lange erfolglos<br />
vor Gericht kämpfte.<br />
Sein Lebensziel, die Gründung eines Zahnärztlichen Instituts, die optimale<br />
Ausbildung der Studierenden und eine bestmögliche Versorgung aller Bevölkerungsschichten<br />
erreichte er, und es hat durch seine Nachfolger eine Fortsetzung<br />
erfahren. Das neue Institutsgebäude bot seinerzeit weltweit einmalige Ausbildungs-<br />
und Forschungsmöglichkeiten und zog eine große Zahl von Studierenden<br />
der Zahnheilkunde aus dem In- und Ausland an. Erstmalig in Deutschland wurden<br />
bereits 1909 Vorlesungen und Praktika zur Werkstoffkunde gehalten und<br />
entsprechendes Fachpersonal eingestellt, was den wissenschaftlichen Ruf der<br />
Ausbildungsstätte unterstrich. Die Einrichtung einer Bettenstation für Kiefer-<br />
und Gesichtsversehrte in Folge des Ersten Weltkrieges beförderte nicht nur die<br />
Entwicklung der Kiefer-, Gesichts- und plastischen Chirurgie sondern begründete<br />
auch die die <strong>Leipzig</strong>er Klinik auszeichnende Tradition der Versorgung von<br />
fehlenden Gesichtsteilen, der sogenannten Epithetik.<br />
Die von Hesse angestrebte Verknüpfung von wissenschaftlicher Lehre und<br />
Forschung darf heute als erfolgreich verwirklicht angesehen werden, auch<br />
wenn erneut durch den Zwiespalt zwischen Zwang zur Eigenerwirtschaftung<br />
von Mitteln und der Notwendigkeit zur Absicherung der Lehre trotz unzureichender<br />
Personalstärke bei steigenden Studentenzahlen die wissenschaftlichen<br />
Erfolge gegenwärtig noch nicht den gewünschten Stand erreichen können. Die in<br />
Aussicht stehende neue Approbationsordnung Zahnmedizin beinhaltet in ihren<br />
Grundzügen die von Hesse geforderte Verknüpfung der Zahn- und Allgemeinmedizin<br />
im Sinne einer Gleichstellung und Aufwertung allgemeinmedizinischer<br />
Anteile im Zahnmedizinstudium.<br />
Ehren wir Hesse künftig durch geschickte Umsetzung dieser Grundlage eines<br />
modernen Zahnmedizinstudiums, die hoffentlich bald ihren Weg durch die administrativen<br />
Gremien geschafft haben wird, vergessen dabei aber nicht, dass<br />
der Beruf des Zahnarztes trotz modernster Technologien eine manuell praktisch<br />
geprägte Tätigkeit bleibt, wie bereits Hesse seinen Studenten aufgrund seiner<br />
großen Fingerfertigkeit und handwerklichen Begabung demonstrieren konnte!<br />
147
Nicht zuletzt wird der Name Hesse durch das von der Poliklinik für Konservierende<br />
Zahnheilkunde unter seinem Direktor Professor Knut Merte 1994 ins Leben<br />
gerufene, aller zwei Jahre stattfindende wissenschaftliche Hesse-Symposion<br />
für Studenten und junge Wissenschaftler nicht in Vergessenheit geraten.<br />
Klaus Kroszewsky<br />
148
Forschungsreise durch Afrika<br />
Zum 275. Jahrestag des Beginns der sächsischen Afrika-<br />
Expedition am 30. Oktober <strong>2006</strong><br />
Algier um 1730<br />
1731 begann eine Gruppe <strong>Leipzig</strong>er Wissenschaftler mit einer Forschungsreise,<br />
die durch verschiedene Gebiete Afrikas führen sollte. Die Reisenden<br />
konnten nur einige Territorien Nordafrikas durchqueren, gleichwohl ist ihre<br />
Expedition als wichtigster Beitrag des 18. Jahrhunderts zur Erforschung<br />
des Maghreb zu werten.<br />
149
Über die Jahrhunderte hinweg haben an der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> Persönlichkeiten<br />
gewirkt, die als Forschungsreisende zu Ruhm gelangten. Die Hochschule<br />
selbst hat allerdings kaum Anteil an diesen Unternehmungen genommen. Der<br />
Brasilienreisende Georg Marggraf, der Rußland- und Persienreisende Adam<br />
Olearius, der Südamerikaforscher Eduard Pöppig, der Afrikakenner Hans Meyer,<br />
um nur einige Beispiele aus dem 17. bis 20. Jahrhundert zu nennen, führten ihre<br />
Expeditionen durch, bevor sie Angehörige der Alma mater Lipsiensis wurden<br />
oder nachdem sie diese wieder verlassen hatten. Dagegen ist es hin und wieder<br />
zu Reisen gekommen, die von <strong>Leipzig</strong>er Gelehrten im Auftrag nichtuniversitärer<br />
Geldgeber organisiert und durchgeführt wurden. Man griff sozusagen auf die<br />
intellektuellen Kapazitäten zurück, die die Hochschule bot. So wurde beispielsweise<br />
Carl Chun, Professor der Zoologie, mit der Leitung der bedeutenden,<br />
vom Deutschen Reich finanzierten „Valdivia-Expedition“ zur Erforschung der<br />
Tiefsee (1898/99) beauftragt. Ein weit früheres Forschungsunternehmen dieses<br />
Charakters ist die sächsische Afrikaexpedition der Jahre 1731 bis 1733, deren<br />
Beginn sich <strong>2006</strong> zum 275. Male jährt.<br />
Der Anteil deutscher Forscher an der Erkundung Nord- und Zentralafrikas ist<br />
auffallend hoch. Es genügt der Hinweis auf Namen wie Heinrich Barth, Gustav<br />
Nachtigal, Gerhard Rohlfs und Eduard Vogel. Das sind freilich Namen des 19.<br />
Jahrhunderts, in dem in ganz Europa das Interesse an dem „dunklen Kontinent“<br />
stetig anwuchs. Im 18. Jahrhundert lag Afrika eher am Rand der geographischen<br />
Erschließung. Nordafrika galt im übrigen als Land der Barbareskenstaaten, deren<br />
Seeräubereien in ganz Europa gefürchtet wurden. Reisebeschreibungen dieser<br />
Gegenden mit wissenschaftlichem Gehalt sind aus jener Zeit daher selten. Eine<br />
Ausnahme bildet die von <strong>Leipzig</strong>er Wissenschaftlern durchgeführte Reise durch<br />
das Gebiet, das heute mit dem Namen Maghreb bezeichnet wird, damals aber unter<br />
der Bezeichnung „Barbarei“ bekannt war. Über den Ursprung der Idee, eine<br />
wissenschaftliche Reise nach Afrika durchzuführen, ist nichts Sicheres bekannt.<br />
Wahrscheinlich stammt sie vom Kurfürsten und König Friedrich August I. (II).<br />
selbst, der auf diesem Wege seine naturwissenschaftlichen Sammlungen erweitern<br />
und exotische Tiere für seine Menagerie direkt am Ort, in Afrika, erwerben<br />
wollte. Als Leiter einer solchen Expedition wurde ihm der junge Johann Ernst<br />
Hebenstreit empfohlen, der soeben in <strong>Leipzig</strong> zum Dr. med. promoviert worden<br />
war. Hebenstreit entwickelte alsbald ehrgeizige Ziele: Afrika sei der bisher am<br />
wenigsten erforschte Kontinent, der jedoch viele Reichtümer berge, deren Erkundung<br />
alle Mühen wert wäre. Vor allem die Tier- und Pflanzenwelt verspreche die<br />
mannigfachsten Entdekungen. Die Reiseinstruktion legte schließlich fest, dass<br />
die Expedition nach Afrika gehen solle, um dort für die „Cabinettes und Menagerie“<br />
des Fürsten „Thiere, Vögel, Kräuter, Blumen, Gewächse, Steine, nebst<br />
150
vielen anderen Dingen … zu colligiren.“ Man solle sich zuerst in die „Barbarey“<br />
einschiffen, um dann Guinea und schließlich das Kap der Guten Hoffnung zu<br />
bereisen. Auch dann sollte die Reise noch weiter fortgesetzt werden, allerdings<br />
bestanden wohl noch keine klaren Vorstellungen über die konkreten Ziele. Die<br />
Expeditionsgruppe bestand aus sechs Teilnehmern. Die beiden wichtigsten<br />
waren Hebenstreit als Leiter und Christian Gottlieb Ludwig als Botaniker. Zur<br />
Gruppe gehörte auch ein Maler und Zeichner.<br />
Der Aufbruch zur großen Reise erfolgte am 30. Oktober 1731 in <strong>Leipzig</strong>. Am 27.<br />
November erreichte man Genf, am 17. Dezember Marseille. Am 24. Januar 1732<br />
ging die Gesellschaft auf einem englischen Schiff unter Segel und erreichte nach<br />
einer sehr stürmischen Überfahrt am 12. Februar den Hafen von Algier. Hebenstreit<br />
war mit den verschiedensten Empfehlungsschreiben ausgestattet worden<br />
und konnte so die Unterstützung der englischen, französischen und holländischen<br />
Konsuln gewinnen, vor allem aber den Schutz des Deys von Algier. Nur<br />
unter diesen Voraussetzungen war es möglich, eine nicht ungefährliche Reise<br />
in das Innere des Landes anzutreten. Da man bei der Rückkehr nach Algier die<br />
Stadt in Furcht vor einem spanischen Angriff vorfand, ging die Reise sogleich<br />
ostwärts weiter, und nach mehreren Zwischenaufenthalten traf die Expedition<br />
in Tunis ein. Da der dortige Dey eine Erforschung des Landes mit dem Argument<br />
verweigerte, er könne den Schutz der Reisenden nicht garantieren, teilte<br />
Hebenstreit die Gruppe und reiste mit drei Teilnehmern nach Tripolis. Von dort<br />
aus kann man mehrere Vorstöße in die Wüste unternehmen, um gegen Ende des<br />
Jahres wieder nach Tunis zurückzukehren. Dort schließt sich Ludwig, der inzwischen<br />
eigene Erkundungen in der Gegend um Tunis vorgenommen hatte, der Expedition<br />
wieder an. Während der gesamten Reise werden intensive Forschungen<br />
betrieben: Anlegen von Herbarien, geographische Beschreibungen, Zeichnungen<br />
der Flora und Fauna, aber auch von Land und Leuten. Ein besonderes Interesse<br />
gilt den Zeugnissen der einstigen Herrschaft Roms über jene Gebiete. Zahlreiche<br />
Inschriften werden kopiert, die zu einem guten Teil heute nicht mehr vorhanden<br />
sind. Natürlich werden auch auftragsgemäß Tiere und Samen exotischer Pflanzen<br />
erworben.<br />
Am 17. April 1733 erfolgt die Abreise nach Marseille. Der weitere Plan sah vor,<br />
einen westeuropäischen Hafen aufzusuchen, um von dort aus zur Mündung des<br />
Senegals zu segeln. Leider war es Hebenstreit und den Seinen nicht beschieden,<br />
dieses Ziel zu erreichen. Am 1. Februar 1733 starb August der Starke, und wenige<br />
Wochen später erging die Anweisung, die Reise sofort abzubrechen und<br />
nach Sachsen zurückzukehren. Hebenstreit richtete an den neuen Kurfürsten und<br />
an den Grafen Brühl inständige Bitten, die Reise fortsetzen zu dürfen. Ludwig,<br />
151
der während der Reise ständig mit Krankheiten zu kämpfen hatte, war schon<br />
vor jener kurfürstlichen Anordnung zusammen mit den erworbenen Tieren und<br />
verschiedenem Sammlungsgut in die Heimat zurückgereist. Am 15. Mai 1733<br />
berichtete Hebenstreit aus Marseille an Ludwig: „Nach dem Tode des Königs<br />
hat es dem ErbPrintzen gefallen uns zurückzuberuffen, wobey mir gemeldet<br />
worden, daß ich Professor Physiologiae ordinarius … worden. … darauf hab ich<br />
mich nicht zubeklagen, inzwischen habe doch an den Printzen supplicirt, daß<br />
mir erlaubt seyn möchte die Reise zu vollführen, ich weiß nicht was darauf erfolgen<br />
wird. Dem Befehl zufolgen gehe ich durch Holland zurücke und kan mich<br />
allemahl im Fall andrer ordre einschiffen.“ In Sachsen war man jedoch ganz auf<br />
die bevorstehenden Auseinandersetzungen um den Erwerb der polnischen Krone<br />
fixiert; Hebenstreits Ersuchen wurde abgeschlagen. Die gesamte Reise hatte<br />
Kosten in Höhe von knapp 15 000 Talern erfordert, eine vergleichsweise geringe<br />
Summe; manches Fest am Dresdner Hof dürfte mehr Geld verschlungen haben.<br />
Trotzdem bemängelte das „Ober-Rechnungs-Collegium“ diese und jene „unnötige“<br />
Ausgabe, so den Loskauf zweier Sklaven mit 728 Talern.<br />
Die gesamte materielle Ausbeute der Expedition ist in den Wirren des Dresdner<br />
Maiaufstandes des Jahres 1849 vernichtet worden. Die einzigen erhaltenen Zeugnisse<br />
bilden schriftliche Aufzeichnungen der Expeditionsteilnemer. Unter diesen<br />
nimmt das Reisetagebuch Ludwigs einen hervorragenden Platz ein. Wahrscheinlich<br />
gelangte es bereits nach seinem Tod in den Besitz der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>sbibliothek,<br />
wo es erst vor gut 100 Jahren entdeckt wurde. Derjenige, der auf<br />
diesen Fund stieß und darüber publizierte (Martin Grosse), urteilte damals, ihm<br />
sei es damit gelungen, einen „Mann in die Reihe der wissenschaftlichen Reisebeschreiber<br />
Afrikas“ zu stellen, „von dessen handschriftlichen Reiseberichten<br />
sogar unter seinen Zeitgenossen nur wenige Freunde Kenntnis hatten“.<br />
Bei der Kenntnisnahme ist es bis heute geblieben. Die Edition des Textes bildet<br />
immer noch ein Desiderat der Forschung. Angesichts ihrer Bedeutung seien<br />
dieser Quelle noch einige Zeilen gewidmet. Das Tagebuch enthält minutiöse Beschreibungen<br />
des Reiseverlaufs, umfangreiche Aufzeichnungen zur Geographie<br />
und zur Pflanzenwelt Nordafrikas, insbesondere aber reichhaltige Beobachtungen<br />
zum Leben und zu den Sitten der Bewohner in den bereisten Gegenden. Ethnologen<br />
und Historiker werden den hohen Wert dieser Mitteilungen einschätzen<br />
können. Interessant ist aber auch ein anderer Aspekt: Ludwig zeigt sich in seinen<br />
Notizen ganz als ein Vertreter der Aufklärung, die gerade in <strong>Leipzig</strong> eines ihrer<br />
Zentren besaß. Das Gesehene wird danach beurteilt, inwieweit es den Vernunftprinzipien<br />
und Nützlichkeitserwägungen des aufgeklärten Europäers entspricht.<br />
Das Ergebnis bildet oft harsche Kritik. Die Menschen jener Gegenden, urteilt<br />
152
Ludwig zusammenfassend in einem lange nach der Reise vor dem Kurfürsten gehaltenen<br />
Vortrag, lebten „in dem elendesten Zustande“, woran die „dumme Religion<br />
der Türken“ und eine „sclavische Regierung“ die Schuld trage. „Wieviel<br />
glücklicher sind wir nicht, wir, die wir eine bessere Religion, Liebe zum Wissenschaften<br />
und weise Regenten haben.“ Auch im Tagebuch stoßen wir immer wieder<br />
auf entsprechende Reflexionen. Einen Wissenschaftler interessiert natürlich<br />
das Bildungswesen der bereisten Landschaften. Das Ergebnis ist enttäuschend:<br />
„Man kan gemeiniglich schon zehn Häuser davor hören wo eine Schule ist, weil<br />
sie laut und ofters alle zusammen mit großem Gepläre lesen … so viel ich mich<br />
bemühet habe etwas von der Gelehrsamkeit dieser Völcker zu erfahren, so habe<br />
doch endlich gesehen daß derjenige unter ihnen schon gelehrt zu nennen sey<br />
welcher sich im Schreiben und Lesen gut geübt hat.“ Grund zur Klage bietet dem<br />
am praktischen Wirken orientierten Beobachter auch mangelnder Arbeitseifer:<br />
Zwar gäbe es viele Gärten, „nur ist schade daß das Volck so nachläßig ist und<br />
nicht mehr arbeitet als zu einem elenden Unterhalte des Lebens nöthig ist“; so<br />
befänden sie sich in einem schlechten Zustand.<br />
Ludwig ist unter allen Teilnehmern derjenige, der sich am intensivsten mit den<br />
antiken Überresten Nordafrikas beschäftigt. So besucht er die Ruinen des alten<br />
Karthago, entdeckt aber auch dort einen in die Vergangenheit zurückprojizierten<br />
Gegensatz zwischen der Tüchtigkeit des „Europäers“ und der Bequemlichkeit<br />
des „Orientalen“: „Jetzo ist nicht das geringste Merckwürdigste mehr übrig, und<br />
ich wundere mich auch hierüber nicht, weil ich glaube daß sich die Karthaginenser<br />
nicht so viele Mühe gaben als die Römer, welche die größten Quader<br />
Stücke aus andern Länder schlepten, um nur kostbahre Gebäude auf zurichten.“<br />
Andererseits gelangt im Tagebuch auch der deistische Standpunkt vieler Aufklärer<br />
zum Ausdruck, wonach es genügt, an die Existenz eines höchsten Wesens<br />
zu glauben. Hier kann unser Reisender von positiven Beobachtungen berichten:<br />
„Und dieses muß ich von diesen Leuthen rühmen wenn sie auch noch so schlecht<br />
erfahren sind, so werden sie doch von der Einigkeit und von den vollkommenheiten<br />
Gottes so gut zu reden wissen als wir Christen, ja manchmahl noch besser.“<br />
Die Teilnahme an der Afrika-Expedition hat für Ludwig übrigens keine karrierefördernde<br />
Bedeutung. Drückende Armut verfolgte ihn, erst 1738 wurde ihm<br />
eine Pension gewährt, 1748 erlangt er schließlich eine Professur an der Medizinischen<br />
Fakultät. Bekannt ist, daß Goethe während seines Studiums zeitweilig<br />
Ludwigs Tischgast war. Ob bei den Mahlzeiten auch über Afrika gesprochen<br />
wurde, ist uns freilich nicht überliefert.<br />
Detlef Döring<br />
153
Thomas Müntzer<br />
Vor 500 Jahren begann der Theologe sein Studium in <strong>Leipzig</strong><br />
Thomas Müntzer war Theologe, begann sein Studium 1506 in <strong>Leipzig</strong> und<br />
öffnete sich der Wittenberger Reformation. Er wirkte als Prediger, kritisierte<br />
den Verfall in Kirche und Gesellschaft und erwartete, dass Gott die Gottlosen<br />
vernichtet und eine Reform der Christenheit, ja der Welt herbeiführt. Im Glauben,<br />
Gott werde dies durch aufständische Bauern bewirken, schloss er sich<br />
ihnen an. Die im 19. Jh. einsetzende Müntzer-Verherrlichung hat zu einer<br />
internationalen Erforschung seiner Person und Umwelt herausgefordert.<br />
155
„Thomaß Munczer de quedilburck“ wurde als 118. und letzter des Wintersemesters<br />
1506/07 in die <strong>Leipzig</strong>er Matrikel eingetragen. Da über sein Alter nichts<br />
bekannt ist und die zeitgenössischen Studenten im Durchschnitt ihr Studium im<br />
17. Lebensjahr aufnahmen, wird aufgrund dieses Eintrages sein Geburtsjahr „um<br />
1489“ angenommen. Er war zwar in Stolberg/Harz geboren, kam aber von der<br />
Lateinschule in Quedlinburg an die <strong>Universität</strong>. Hinter seinem Namen wurde<br />
vermerkt, dass er die übliche Einschreibgebühr von 6 gr. bezahlte. Er nahm also<br />
keine Gebührenminderung in Anspruch. Die zeitweise aufgestellte Behauptung,<br />
Müntzer sei mittellos gewesen und habe infolge seiner Armut revolutionäre<br />
Ideen entwickelt, wird dadurch und durch sein späteres soziales Umfeld widerlegt.<br />
Zum Wintersemester 1512/13 ließ er sich in die Matrikel der <strong>Universität</strong><br />
Frankfurt/Oder einschreiben. Vermutlich erwarb er hier die Titel Magister artium<br />
und Magister theologiae.<br />
Nachdem er in der Diözese Halberstadt zum Priester ordiniert worden war,<br />
erhielt er am 6. Mai 1514 ein Lehen am Marienaltar der St. Michaeliskirche in<br />
Braunschweig, wo er mit der besitzenden Oberschicht Verbindung pflegte. Bald<br />
danach hatte er das Amt des Propstes und Leiters der Schule des Kanonissenstifts<br />
Frose bei Aschersleben inne. 1517 setzte er sein Studium fort, mindestens teilweise<br />
auch in Wittenberg. An allen drei <strong>Universität</strong>en, die Müntzer aufsuchte,<br />
wurden humanistische Studien getrieben. Diese richteten sich besonders auf die<br />
Sprachen Latein, Griechisch und auch Hebräisch, auf antike Autoren, auf die<br />
Heilige Schrift und auf Kirchenväter. Damit war eine entschlossene, mit Polemik<br />
und auch Spott einhergehende Abkehr von der scholastischen Philosophie und<br />
Theologie sowie Kritik an der spätmittelalterlichen Kirche verbunden. Die mittelalterliche<br />
Mystik fand neue Aufmerksamkeit. Alle diese Bestrebungen nahm<br />
Müntzer auf.<br />
Als der Lutherschüler Franz Günther infolge seiner reformatorischen Predigt<br />
in Jüterbog mit den Franziskanern in Streit geriet, ließ er sich um Ostern 1519<br />
von Müntzer vertreten, der mit seiner Kirchenkritik ebenfalls Gegnerschaft auf<br />
sich zog. Er fand Zuflucht als Beichtvater im Zisterzienserinnenkloster Beuditz<br />
bei Weißenfels. Während Martin Luther und Andreas Bodenstein aus Karlstadt<br />
im Sommer 1519 in <strong>Leipzig</strong> auf der Pleißenburg mit Johann Eck disputierten,<br />
war Müntzer vermutlich in der Stadt. Von Luther vermittelt übernahm Müntzer<br />
im Mai 1520 in Zwickau an der Marienkirche die Vertretung des Predigers<br />
Johannes Egranus. Danach übertrug der Rat Müntzer die Predigerstelle an der<br />
Katharinenkirche. Müntzer geriet erst mit den Franziskanern, dann aber auch<br />
mit Egranus und Anhängern Luthers so in Streit, dass er im April 1521 entlassen<br />
wurde. Müntzer hatte die Überzeugung gewonnen, dass nach dem Tod der Apos-<br />
156
tel ein von den Geistlichen verschuldeter Verfall der Kirche begonnen habe, der<br />
zu ihrer schrecklichen Verwüstung geführt habe. Gott werde nun „in der letzten<br />
Zeit“ eine umfassende Reformation der Christenheit mit mehr Gerechtigkeit für<br />
das Volk vornehmen. Er bezeichnete sich als den, der „für die Wahrheit kämpft“,<br />
und hielt Umschau nach dem Werkzeug, dessen sich Gott bedienen will. Sein<br />
erster Blick fiel auf die Hussiten, die sich vom Papst getrennt hatten.<br />
Müntzer zog nach Prag, wo er als Vertreter der Wittenberger freundlich aufgenommen<br />
wurde, dann aber durch seine apokalyptischen Vorstellungen Ablehnung<br />
erfuhr. Die Böhmen versagten ihm die Gefolgschaft. Er verließ Prag, hielt<br />
sich an mehreren Orten auf und richtete seine Kritik nun auch gegen die Wittenberger<br />
Reformatoren. Im April 1523 erhielt er die Pfarrstelle an der Johanneskirche<br />
in dem kursächsischen Ackerbürgerstädtchen Allstedt. Hier heiratete er<br />
die Nonne Otilie von Gersen, die ihm einen Sohn gebar. Er führte eine Reform<br />
der kirchlichen Ordnungen – einschließlich Taufe, Trauung und Bestattung – ein<br />
und schuf eine für alle verständliche, deutschsprachige Liturgie. Er gewann die<br />
Zustimmung des Rates, seines Amtskollegen und des Amtmanns auf dem<br />
Schloss Allstedt. Aus umliegenden Orten strömten Gemeindeglieder zu seiner<br />
Predigt. Als Graf Ernst von Mansfeld diesen Predigtbesuch unterbinden wollte,<br />
griff ihn Müntzer am 22. September 1523 in einem Brief an, den er mit „Thomas<br />
Muntzer, eyn verstorer [Zerstörer] der unglaubigen“ unterschrieb. Der Kampf<br />
gegen die Gottlosen prägte sein Denken. Am 13. Juli 1524 forderte er in einer<br />
Predigt auf dem Schloss Allstedt die anwesenden kursächsischen Fürsten auf,<br />
ihre Macht diesem Kampf zur Verfügung zu stellen. Diese entschieden sich aber,<br />
diejenigen zu bestrafen, die am 24. März 1524 die Mallerbacher Kapelle des<br />
Nonnenklosters Naundorf in Brand gesteckt hatten, den Verteidigungsbund aufzulösen,<br />
den Müntzer angesichts der Bedrohung von Seiten umliegender Fürsten<br />
organisiert hatte, und die Druckerei zu schließen, die für Müntzer druckte. Da die<br />
Allstedter Müntzer nicht gegen diese Maßnahmen unterstützten, verließ Müntzer<br />
im August 1524 seine bedeutendste Wirkungsstätte.<br />
Er betätigte sich nun als Prediger an der Marien- und Nikolaikirche in der<br />
Reichsstadt Mühlhausen, in der seit 1522 reformatorisch gepredigt wurde. Er beteiligte<br />
sich an der Ausarbeitung der „Elf Artikel“, die ein neues, an Gottes Wort<br />
orientiertes Stadtregiment forderten. Mit Hilfe in die Stadt gerufener Bauern<br />
setzten sich aber konservative Kräfte durch. Müntzer wurde am 26. September<br />
1524 ausgewiesen. Er zog über Nürnberg bis in die Schweiz und begegnete auf<br />
seiner Rückreise im Klettgau und Hegau aufständischen Bauern. Er gewann die<br />
Überzeugung, dass sie das von Gott auserwählte Werkzeug seien, „die große<br />
Reformation“ der Welt heraufzuführen.<br />
157
Im Februar 1525 kehrte Müntzer nach Mühlhausen zurück, wo sich inzwischen<br />
die Reformation durchgesetzt hatte. Er erhielt die Predigerstelle an der Marienkirche.<br />
Eine Auseinandersetzung zwischen dem Rat und den Predigern endete<br />
mit der Neuwahl eines „Ewigen Rates“. Seit Mitte April ergriff die Bauernerhebung<br />
auch Thüringen. Ein Mühlhäuser Aufgebot von 10 000 Mann zog unter<br />
einer von Müntzer mit einem Regenbogen gestalteten Fahne auf das Eichsfeld,<br />
nicht gegen Graf Ernst von Mansfeld, wie es Müntzer wünschte. Für eine Unterstützung<br />
des Frankenhäuser Haufens konnte er nur 300 Mann gewinnen. Bei<br />
ihm angekommen, versuchte er vergeblich, Verstärkung des Bauernheeres zu<br />
gewinnen. Durch Briefe an Fürsten, deren Heer die Bauern einschlossen, trat<br />
er als Wortführer in Erscheinung. Im Vertrauen, dass Gott selbst den Kampf<br />
gegen die Gottlosen zum Sieg führen würde, bewegte er die Bauern, auf weitere<br />
Verhandlungen zu verzichten und sich dem Kampf zu stellen. Am 15. Mai 1525<br />
unterlagen die Bauern sehr schnell dem angreifenden Fürstenheer und suchten<br />
ihr Heil in der Flucht hinter die Mauern von Frankenhausen. Sie wurden aber<br />
von der nachdrängenden Reiterei niedergestochen, so dass um 6 000 ihr Leben<br />
verloren. Müntzer gelang die Flucht in die Stadt, wo er aber entdeckt, gefangengenommen<br />
und seinem Feind Ernst von Mansfeld in Heldrungen übergeben<br />
wurde. Für Müntzer kam diese Katastrophe völlig überraschend. Er hat sie damit<br />
erklärt, „daß ein jeder seinen Eigennutz mehr gesucht als die Rechtfertigung<br />
[Verteidigung] der Christenheit“. Nach einem Verhör, bei dem man auch die<br />
Folter anwendete, wurde er zusammen mit seinem Mühlhäuser Amtskollegen<br />
Heinrich Pfeiffer am 27. Mai 1525 im Heerlager Görmar – östlich vor den Toren<br />
von Mühlhausen – hingerichtet.<br />
Müntzer hat außer seinen liturgischen Schriften nur sechs Flugschriften veröffentlicht,<br />
wovon bei einer Schrift von 500 Exemplaren 400 und einer weiteren<br />
alle in der Druckerei beschlagnahmt wurden. Eine herausragende Bedeutung<br />
erlangte er erst durch den Irrtum einiger Reformatoren – unter ihnen Luther und<br />
Philipp Melanchthon –, Müntzer sei der Urheber der 1524 begonnenen Bauernerhebung<br />
gewesen. Sie wussten zwar um Müntzers Forderung, die Gottlosen zu<br />
vernichten, nahmen aber die davon unabhängigen Sozialkämpfe nicht als solche<br />
wahr. Mit ihren Schriften machten sie Müntzer als Bauernführer publik. Er wurde<br />
zum Inbegriff eines Aufrührers. Sowohl in Flugschriften als auch im fürstlichen<br />
Briefverkehr wurden Unruhen auf den „müntzerischen Geist“ zurückgeführt.<br />
Die sozialistische Bewegung des 19. Jahrhunderts entdeckte den von den Reformatoren<br />
gezeichneten Müntzer als Symbolfigur für eigene Bestrebungen,<br />
indem sie in dem „Aufrührer“ einen vorbildlichen Revolutionär sah. Diese Sicht<br />
hatte nach dem Ersten Weltkrieg, besonders aber in den Anfangsjahren der<br />
158
DDR, starken Einfluss auf die Bewertung der Reformation. Die Folge war eine<br />
weltweite Forschung, die sich dem historischen Müntzer und seinem sozialen<br />
Umfeld zuwendete. Die <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> hat sich mit ihren Kirchenhistorikern<br />
durch Heinrich Boehmer seit 1922 und nach dem Zweiten Weltkrieg mit<br />
ihren Historikern durch Max Steinmetz und von ihm angeregte marxistische<br />
Forscher daran beteiligt. Diese Forschung führte zur Erschließung der Quellen<br />
und zur Überwindung der von den Reformatoren geförderten „Müntzerlegende“.<br />
Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu <strong>Leipzig</strong> bringt seit 2004 unter<br />
Mitarbeit von Angehörigen der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> eine dreibändige Thomas-<br />
Müntzer-Ausgabe heraus.<br />
Helmar Junghans<br />
159
Das Augusteum<br />
Zum 175. Jahrestag der Grundsteinlegung für das Haupt-<br />
gebäude der <strong>Universität</strong><br />
Vor 175 Jahren wurde an der Stelle des alten Zwingergebäudes im Paulinum<br />
der Grundstein für das erste Hauptgebäude der sächsischen Landesuniversität<br />
gelegt, das, 1836 unter dem Namen Augusteum geweiht, die<br />
Entstehung und den Charakter des Augustusplatzes prägte.<br />
161
Am Stiftungstag der <strong>Universität</strong>, der 1831 am Sonntag, dem 4. Dezember, gefeiert<br />
wurde, versammelte man sich nach uraltem akademischem Brauch in der<br />
Sakristei der Nikolaikirche zum Festzug. Doch als sich dieser unter festlichem<br />
Glockengeläut um 11:00 Uhr in Bewegung setzte, zeigte er eine ungewohnte<br />
Ordnung und hatte die halbe Stadt auf die Beine gebracht. Sein Ziel war diesmal<br />
nicht die Paulinerkirche, sondern das südlich davon gelegene Areal des alten, inzwischen<br />
weitgehend niedergelegten Paulinums, wo der Grundstein für ein neues<br />
Hauptgebäude der <strong>Universität</strong> gelegt werden sollte. Aus Adolf Hasses anlässlich<br />
der feierlichen Übergabe des Augusteums 1836 erschienenen Denkschrift,<br />
die auch eine ausführliche Beschreibung des Bauwerks enthält, erfahren wir von<br />
einer öffentlichen Anteilnahme, die uns Heutige angesichts der in dieser Hinsicht<br />
doch recht bescheiden ausgefallenen Grundsteinlegung im Juli 2005 geradezu<br />
neidisch stimmen könnte: Eine Abteilung der Communalgarde leitete den Zug<br />
durch ein von Musikkapellen durchsetztes Ehrenspalier der Communalgarde und<br />
militärischer Garnisonen. Als Hauptpersonen folgten ihr der <strong>Universität</strong>sbaumeister<br />
und Stadtbaudirektor Albrecht Geutebrück, der <strong>Universität</strong>srentmeister<br />
und die Mauerer und Zimmerleute. Ein Zug Studenten führte die „Stadtverordneten,<br />
Kramermeister, Handlungs- und Buchhandlungs-Deputirten, das Stadtgericht<br />
und (den) Rath, die königlichen Beamten, die Consuln der fremden Mächte,<br />
das … Oberpostamt, … Schöppenstuhl, … Consistorium und Oberhofgericht,<br />
die Officiere der königlichen Truppen … mit den Mitgliedern des hiesigen<br />
Communalgarden-Ausschusses …, die Rectoren, Directoren und Lehrer der öffentlichen<br />
Schulen und Institute; … die Geistlichen aller Confessionen …“. Erst<br />
danach kamen die Vertreter des durch Prinz Johann von Sachsen repräsentierten<br />
Königshauses mit Albert von Langenn an der Spitze, der damalige Rektor Karl<br />
Klien und Bürgermeister Deutrich, begleitet von den Trägern der Gedächtnistafel,<br />
der Denkschriften und Gedenkmünzen. Nun erst folgte die <strong>Universität</strong> in der<br />
Ordnung ihrer von den jeweiligen Dekanen angeführten Fakultäten.<br />
Ungewöhnlich wie der zur Grundsteinlegung betriebene Aufwand ist auch die<br />
Vorgeschichte des Bauwerks. Anfang Mai 1827 war Friedrich August III. nach<br />
fast 59-jähriger Regierungszeit verstorben. Hatte er die von den Landständen<br />
anlässlich seines 50-jährigen Regierungsjubiläums vorgeschlagene Errichtung<br />
eines öffentlichen Denkmals zu Lebzeiten abgelehnt, so gründete sich nun in<br />
Dresden ein Verein, der zu freiwilligen Spenden für ein öffentlich aufzustellendes<br />
Denkmal des Königs aufrief. Obwohl man im engeren Kreise davon überzeugt<br />
war, dass es sich um ein bildnerisches Werk handeln müsse und mit dem<br />
von Daniel Rauch empfohlenen Ernst Rietschel auch schon ein Bildhauer mit<br />
entsprechenden Entwürfen beauftragt worden war, legte man die demokratisch<br />
gewollte Entscheidung über die Denkmalsidee im Juni 1828 in die Hände der<br />
162
Kreisstände. Nach fast zweijähriger Diskussion kam man „um der Würde des<br />
Gegenstandes … zu entsprechen, und die … nicht allgemein gleichen Ansichten<br />
über die größere Vorzüglichkeit eines bildlichen Denkmals, oder einer gemeinnützigen<br />
Stiftung zu vereinigen“, überein, dass es das Beste sei, „wenn ein doppeltes<br />
Denkmal, nämlich eine Statue des höchstseligen Königs Friedrich August<br />
aus Erz gegossen und in Dresden aufgestellt, so wie ein für die Landesuniversität<br />
zu <strong>Leipzig</strong> zu erbauendes, großartiges, für öffentlich wissenschaftliche<br />
Zwecke, insonderheit zu einem großen Hörsaale für öffentliche Feierlichkeiten,<br />
einer namhaften Anzahl von Hörsälen für akademische Lehrer, zur Aufstellung<br />
der ganzen <strong>Universität</strong>s-Bibliothek und des physikalischen Apparates einzurichtendes,<br />
mit dem Namen Augusteum zu belegendes Gebäude, welches die Stelle<br />
des abzubrechenden Hintergebäudes des Pauliner Collegiums am Stadtzwinger<br />
einnehmen möge, die verehrungsvollen und dankbaren Gesinnungen der sächsischen<br />
Nation gegen ihren verewigten König … bezeuge.“ (nach Hasse)<br />
Ein solches Gebäude schien bitter nötig. Nicht nur die ohnehin überalterten und<br />
feuchten Gebäude über dem Stadtgraben waren durch die Folgen der Völkerschlacht<br />
zum Teil gänzlich unbrauchbar geworden. Die weitgehend aus eigenen<br />
Mitteln finanzierten Baumaßnahmen der <strong>Universität</strong> konnten unter äußerster<br />
Geldnot als Sanierungsversuche nur Stückwerk leisten. Auch als nach der Reorganisation<br />
der Landesuniversität verstärkt staatliche Finanzmittel zu ersten<br />
Neubauten flossen (1829 Senatsgebäude), fehlte es auch weiterhin vor allem an<br />
Hörsälen. So sollte ein ursprünglicher Bauplan des <strong>Universität</strong>sbaumeisters Geutebrück<br />
für die beiden südlich an die Paulinerkirche stoßenden Zwingergebäude<br />
unter Beibehaltung der einnahmeträchtigen Mietwohnungen für Professoren und<br />
Studenten vor allem zusätzlichen Platz für Hörsäle schaffen. „Allein der von den<br />
Ständen beantragte großartige Charakter eines Gebäudes, das kein Wohnhaus,<br />
sondern ganz zu <strong>Universität</strong>szwecken in wissenschaftlichem Sinne bestimmt<br />
und als solches zugleich ein Denkmal für den verewigten König Friedrich August<br />
werden sollte, machte eine Erweiterung und Umbildung des ursprünglichen<br />
Entwurfs nöthig.“ (ebd.)<br />
Die Königliche Bau-Commission bat nun Karl Friedrich Schinkel in Berlin als<br />
den seinerzeit berühmtesten Baumeister um einen entsprechenden Entwurf. Der<br />
in enger Zusammenarbeit mit Geutebrück entstandene neue Bauplan basierte auf<br />
einem völlig veränderten Konzept. Auf dem von bestehenden Gebäuden stark<br />
eingeengten Baugrund sollte nun ein „Tempel der Wissenschaft“ entstehen, der<br />
die repräsentativen und zentralen wissenschaftlichen Funktionen der <strong>Universität</strong><br />
unter einem Dach vereinte. Als dessen Kernstück sah der Plan eine große zweigeschossige<br />
Aula vor, welche als „Haupttheil des Gebäudes dessen Mitte einneh-<br />
163
men musste, und in der Hauptfacade hervortretend, sowohl eine reichere … und<br />
der inneren Decoration des Saales entsprechende Architectur“ (ebd.) aufwies.<br />
An die Aula schlossen sich als die symbolischen Hauptorte wissenschaftlichen<br />
Lebens <strong>Universität</strong>sbibliothek, Hörsäle und wissenschaftliche Sammlungen an.<br />
Ein figurengeschmückter Dreiecksgiebel und ein in seinen klassischen Proportionen,<br />
seinem anspruchsvollen Bildprogramm und seiner Größe beeindruckendes<br />
Pilasterportal am Mittelrisalit vermittelten nach außen die Idee des<br />
„Bildungstempels“.<br />
Obwohl durch die Anlage von drei Eingängen auf der schmucklosen Hofseite<br />
dem traditionell üblichen Verkehrsstrom im alten Paulinum Rechnung getragen<br />
wurde, war die Schaufassade mit ihrem breitgelagerten Dreiecksgiebel und dem<br />
Hauptportal auf den Augustusplatz gerichtet. Städtebaulich war dies eine höchst<br />
wichtige Entscheidung. Denn das neue Hauptgebäude bildete nicht nur den<br />
eigentlichen Anfang für jenes moderne bürgerliche „Bildungsforum“, als der<br />
sich in den nächsten Jahren der Augustusplatz entwickeln sollte, sondern formulierte<br />
auch den ästhetischen Anspruch an die öffentlichen Nachfolgebauten<br />
(1836 – 1838 Post, 1855 – 1858 Bildermuseum, 1864 – 1868 Neues Theater).<br />
Mit der „äußere(n) Ausschmückung des Augusteums, welches die Ständeversammlung<br />
als das Charakteristische eines Denkmals ansah“ (Hasse), wurde der<br />
bereits für das Dresdener Denkmal in Anspruch genommene, inzwischen an der<br />
dortigen Kunstakademie lehrende Bildhauer Ernst Rietschel beauftragt. Für das<br />
Hauptportal (1832 – 1835) stand ihm Schinkels Entwurf mit seinem reichen, auf<br />
den Ursprung der Wissenschaft bezogenen Bildprogramm zur Verfügung (als<br />
„Schinkel-Portal“ nach 1891 dreizügig erweitert und frei aufgestellt). In üppigen<br />
Blätter- und Früchteschmuck eingebundene Genien der Kunst und Wissenschaft<br />
auf den Pilastern wiesen zusammen mit den geflügelten Genien von Ruhm und<br />
Unsterblichkeit auf dem Gebälk und den frei darüber stehenden Musen als Verkörperungen<br />
von Vernunft und Erfahrung der lernbegierigen Jugend den Weg in<br />
das „Heiligthum der Weisheit“ (C. F. Günther). Der Giebel (1833 – 1835) vereinte<br />
die vier Fakultäten, jeweils als ein Paar aus weisem Lehrer und lernendem<br />
Jüngling begriffen und unter den Fiat-lux-Gestus des in der Mitte heranschwebenden<br />
Genius gestellt, zu einem neuartigen Abbild der <strong>Universität</strong>, das ganz<br />
Rietschels Intention entsprang. Ihm verdankte auch die Aula ihren wichtigsten<br />
bildnerischen Schmuck: den in zwölf großen Reliefs (1836 – 1839) unter dem<br />
Deckengesims angeordneten, in seiner engen Parallele zu Hegels Geschichtsphilosophie<br />
hochinteressanten Zyklus zur Kulturgeschichte der Menschheit. Für<br />
die verbliebenen Mittel sollte Rietschel, getreu dem Konzept der Verbundenheit<br />
164
von Königshaus und <strong>Universität</strong>, Büsten der sächsischen Könige Anton und<br />
Friedrich August II. und der sächsischen Prinzen Maximilian und Johann und<br />
zwölf Büsten von um die <strong>Universität</strong> besonders verdienten Gelehrten und Staatsmännern<br />
schaffen, die zur Aufstellung auf Konsolen an den Seitenwänden und<br />
zwischen den Fenstern der Aula bestimmt waren. Das Büstenkonzept konnte<br />
jedoch, da die Mittel denn doch nicht ganz reichten, mit Ausnahme der Wettiner-<br />
Büsten und der 1845 geschaffenen Büste Gottfried Hermanns erst im Laufe des<br />
19. Jahrhunderts und durch andere Bildhauer realisiert werden.<br />
Im September 1833 wurde Richtfest gefeiert, Ostern 1835 begann der Lehrbetrieb,<br />
Bibliothek und Sammlungen zogen ein, und am 3. August 1836 erfolgte<br />
die offizielle Einweihung. Eine Lithografie Straßbergers zeigt „Die Studirenden<br />
zu <strong>Leipzig</strong> bei der Einweihung des Augusteums am 3ten August 1836 in<br />
der Aula“ vor Rietschels Modell der Sitzstatue zum Dresdener Denkmal für<br />
Friedrich August III., das dort für einige Jahre die ursprüngliche Denkmalsidee<br />
demonstrierte. Auch die zum Denkmal gehörenden weiblichen Allegorien der<br />
vier Regententugenden fanden hier Aufstellung, indem sie die mit den Jahren<br />
wechselnden Herrscherstatuen an den Schmalseiten der Aula flankierten.<br />
Als ein halbes Jahrhundert später Geutebrücks Augusteum dem repräsentativen<br />
größeren Neubau Rossbachs weichen musste, lehnte man sich eng an das geistige<br />
Konzept des Vorgängerbaus an und integrierte respektvoll dessen Baukunst.<br />
Die Stuckfiguren des Giebels wurden für das etwas größere Format des neuen<br />
Giebels in Stein kopiert, das Schinkeltor dreizügig erweitert und frei neben dem<br />
Neubau aufgestellt. In der wiederum zweigeschossigen Aula bewahrten die<br />
Reliefs zur Kulturgeschichte und die umlaufend aufgestellten Büsten den historischen<br />
Kontext. Nur der Aspekt der Verbundenheit von <strong>Universität</strong> und Krone<br />
wurde in der Wandelhalle unter Einbeziehung der vier Regententugenden neu<br />
konzipiert.<br />
Im 2. Weltkrieg gingen die von Rietschel geschaffenen Büsten verloren. Einige<br />
der Reliefs zur Kulturgeschichte überdauerten in der 1943 ausgebrannten Aula.<br />
Wie auch der nahezu unbeschädigt erhaltene Giebel wurden sie 1968 mit dem<br />
in weiten Teilen erhalten gebliebenen <strong>Universität</strong>skomplex gesprengt. Die heute<br />
zum Teil stark restaurierungsbedürftigen Regententugenden wurden zuvor geborgen<br />
und harren, wie das partiell bereits in den Neubau der 1970iger Jahre<br />
integrierte Schinkel-Tor, ihrer Neuaufstellung.<br />
Cornelia Junge<br />
165
Academiae Musicus Werner Fabricius<br />
Vor 350 Jahren Bestallung des <strong>Leipzig</strong>er<br />
<strong>Universität</strong>smusikdirektors<br />
Mit dem Jubiläum des Musikdirektorats verhält es sich wie mit dem von<br />
Stadtgründungen: gefeiert wird mangels genauer Gründungsdaten die<br />
Ersterwähnung. Im Falle des ersten „Academiae Musicus“ gilt ein im Sommer<br />
1657 für das vakante Thomaskantorat verfasstes Bewerbungsschreiben<br />
von Werner Fabricius als „Gründungsurkunde“, in dem es heißt, dass<br />
er „numehro fast in die 2 Jahr von einer Hochlöbl. <strong>Universität</strong> allhier“ als<br />
Leiter der Musikaufführungen in der Paulinerkirche bestallt worden sei.<br />
167
Was bedeutete das Amt, und wie war es in den Jahren zuvor ohne einen eigens<br />
ernannten Musikdirektor ausgefüllt worden? Musik erklang in der Paulinerkirche<br />
damals regulär zu den stattfindenden Quartalsorationen an den drei hohen<br />
Festtagen des Kirchenjahres und zu außerordentlichen landespolitischen und<br />
kirchengeschichtlichen Ereignissen. Die vierteljährlich stattfindenden Feierstunden<br />
waren lediglich vom Motettengesang der Thomaner ausgestaltet worden, an<br />
den hohen Festtagen wurde indessen „figural“, also mit Instrumentalbegleitung,<br />
musiziert. Die Leitung dieser Aufführungen oblag traditionell dem städtischen<br />
Musikdirektor, dem Thomaskantor, der dafür mit einem kleinen Salär entlohnt<br />
wurde. Dass man 1655/56 beschloss, diese Praxis aufzugeben, hatte seine Vorgeschichte<br />
in dem seit Jahren schlechten Gesundheitszustand des Thomaskantors<br />
Tobias Michael (gest. 1657). Die Gicht fesselte diesen oft monatelang ans Bett,<br />
und so mussten Mittel und Wege gefunden werden, um seinen Aufgabenbereich<br />
als Director Chori Musici überschaubar zu gestalten und ihm junge talentierte<br />
Gehilfen zur Seite zu stellen. Als Michaels designierter Nachfolger war deshalb<br />
schon 1653 der Vogtländer Johann Rosenmüller ausgewählt worden. Und um<br />
dieses schon damals weitberühmte Talent bis zum Tod Michaels an <strong>Leipzig</strong> zu<br />
binden – das Thomaskantorat ist schließlich ein Amt auf Lebenszeit – hatte man<br />
Rosenmüller bereits ab 1651 den Organistendienst an der Nikolaikirche übertragen.<br />
Ebenso betätigte sich dieser schon seit Ende der 1640er Jahre – offenbar<br />
in Absprache mit dem Thomaskantor – als ehrenamtlicher Komponist und<br />
Leiter der Kirchenmusiken in der Paulinerkirche. Was davon noch an Noten<br />
erhalten ist, zeigt, dass die Musikpflege an der <strong>Universität</strong> in jenen Jahren zu<br />
der fortschrittlichsten im gesamten protestantischen deutschen Sprachraum gehörte.<br />
Rosenmüller wusste hier – wie Jahrzehnte zuvor sein Förderer Heinrich<br />
Schütz – die „Madrigalismen“ italienischer Musik, die er während eines Italienaufenthaltes<br />
kennengelernt hatte, mit der Gravität deutscher Satztechnik auf eine<br />
zuvor nie gehörte Art zu verbinden. Bis zu 48-stimmige Festmusiken wurden<br />
unter seiner Ägide in der <strong>Universität</strong>skirche aufgeführt. Für die mehrchörige<br />
Realisation dieser vielstimmigen Werke kann der kleine „Schülerchor“ kaum<br />
ausgereicht haben, weshalb davon auszugehen ist, dass ebenso im Kirchenschiff<br />
und womöglich auch im Altarraum musiziert wurde.<br />
Rosenmüller musste im Mai 1655 aus <strong>Leipzig</strong> fliehen. Ihm drohte ein Prozess<br />
wegen „Sodomiterey“, da man ihn verdächtigte, mit einigen Thomanern Unzucht<br />
getrieben zu haben. Nun bestand für die <strong>Universität</strong> Handlungsbedarf.<br />
Schließlich hatte man sich in dem Glanz der Rosenmüllerschen Musikaufführungen<br />
gesonnt und es genossen, dass man in den Jahren zuvor mit der glanzvollsten<br />
Kirchenmusik innerhalb <strong>Leipzig</strong>s aufwarten konnte. Die 1650er Jahre hatten<br />
zudem „florierende“ studentische Collegii musici hervorgebracht, die weiterhin<br />
168
auch an den Musikaufführungen in der Paulinerkirche teilnehmen wollten. In<br />
diesem Zusammenhang ist Fabricius’ Berufung zum ersten offiziellen <strong>Universität</strong>smusikdirektor<br />
zu sehen. Man benötigte eine Person, die – wie Rosenmüller<br />
zuvor – weiterhin in der Lage war, die verschiedenen studentischen Kräfte zu<br />
bündeln und die Leitung der Aufführungen zu übernehmen. Als Antrittsstück in<br />
diesem Amt ist seine anlässlich des 100. Jahrestages des Augsburger Religionsfriedens<br />
(25. September 1655) verfasste Festmusik „Jauchzet ihr Himmel“ zu<br />
sehen. Das neue Amt behielt Fabricius bis zu seinem Tode im Jahr 1679.<br />
Wer war nun jener Werner Fabricius? Im Gefüge der vielen um 1650 in <strong>Leipzig</strong><br />
lebenden musikalischen Studenten dürfte er als Norddeutscher ein Exot gewesen<br />
sein. 1650 war der in Itzehoe (Holstein) Geborene 17-jährig nach <strong>Leipzig</strong><br />
gekommen, um hier Jurisprudenz und Mathematik zu studieren. Zuvor hatte<br />
er seine musikalische Ausbildung in Hamburg bei Thomas Selle und Heinrich<br />
Scheidemann erfahren.<br />
In <strong>Leipzig</strong> etablierte er sich schnell als Verfasser von textlich noch heute vorliegenden<br />
Huldigungsmusiken und als Initiator eines studentischen Collegium<br />
musicum. Nach seiner Berufung zum <strong>Universität</strong>smusikdirektor wurde er ab<br />
1658 außerdem Organist an der Nikolaikirche – vermutlich, weil der <strong>Universität</strong>sposten<br />
finanziell gesehen mehr Titel als Amt gewesen ist. Versuche, 1657<br />
Thomaskantor und 1663 Musikdirektor in Hamburg zu werden, schlugen fehl.<br />
Für Fabricius’ Wirken als Komponist in der Paulinerkirche liegen vor allem aus<br />
der Anfangszeit „hörbare“ Zeugnisse vor. Sie zeigen, dass er an die großartigen<br />
Musikaufführungen unter Rosenmüller anzuknüpfen suchte. Am deutlichsten<br />
sichtbar wird dies in einer 1662 gedruckten Sammlung von Geistlichen Arien,<br />
Dialogen und Concerten. Die Stücke dokumentieren das in seinen ersten fünf<br />
Jahren als <strong>Universität</strong>smusikdirektor aufgeführte Repertoire für die hohen Festtage:<br />
zwei Weihnachtsarien, zwei dialogisch vorgetragene Osterstücke und zwei<br />
klanggewaltige Pfingstkonzerte. Kein Geringerer als Heinrich Schütz betätigte<br />
sich als Vorredner in diesem seinerzeit vielfach verkauften Druck.<br />
Es ist merkwürdig: Nach dieser anfänglich dokumentierten Produktivität wird<br />
es um Fabricius’ Wirken als „Academiae Musicus“ still. Nachweislich aus der<br />
Zeit nach 1662 stammt lediglich eine Motette. Die zeitgenössischen Äußerungen<br />
betreffen denn auch überwiegend den „weitberühmten Organisten Wernern“, der<br />
großes Ansehen als Orgelsachverständiger genoss und „nebenher“ als Notarius<br />
publicus Caesareus wirkte. Es ist daher fraglich, ob Fabricius tatsächlich bis zum<br />
Ende seines Leben stets als Leiter der musikalischen Aufführungen in der Pau-<br />
169
linerkirche wirkte oder ob mit dem Antritt des neuen Thomaskantors Sebastian<br />
Knüpfer (ab 1657) gelegentlich wieder die von Alters her gängige Praxis Einzug<br />
hielt und Fabricius dann lediglich die Orgel während des Gottesdienstes bespielte.<br />
Nach Fabricius’ Tod wurde das Amt jedenfalls vorerst nicht wieder besetzt.<br />
Immerhin stellte aber der Pastor Valentin Thilo in der Leichenpredigt auf Werner<br />
Fabricius gerade dessen Bedeutung und Fähigkeit als Vokalkomponist heraus.<br />
Bewundernd heißt es in diesem zentralen Nachruf:<br />
170<br />
Manchen schönen Text hat er seinem Gott zu Ehren komponiert! Wie<br />
herrliche Instrumenta, Orgelwerk, Positive, Psalter und Harfen hat der<br />
dazu gebraucht! Wie eine gravitätische Manier hat er auch dabei angewendet<br />
und sowohl seine eigene Herzensandacht dadurch zu erkennen<br />
gegeben, als auch die Zuhörer dazu angereizet. Man betrachte seine<br />
herrlichen Concerten, Motetten und Leichgesänge: was für ein sonderbar<br />
Geist der Andacht und Herzbewegung ereignet sich doch darinne!<br />
Da wird man ja nichts Liederliches, nichts Unbescheidentliches darinne<br />
finden, sondern was ehrbar ist, was wohl lautet, was gerecht, was keusch,<br />
was lieblich ist; ist etwa eine Tugend, so hat er solche in seiner Musik mit<br />
herrlichen Inventionen zu exprimieren nachgedacht.<br />
Erst mit der Einrichtung des „neuen“ – also wöchentlich stattfindenden – Gottesdienstes<br />
in der Paulinerkirche kam es 1716 zur festen Anstellung eines<br />
<strong>Universität</strong>smusikdirektors. Anfänglich war aber noch immer unklar, wie die<br />
Kompetenzen zwischen ihm und dem Thomaskantor aufgeteilt waren, bzw.<br />
was alles zum Aufgabenbereich eines UMD gehörte. Gleich zu Beginn seiner<br />
<strong>Leipzig</strong>er Jahre sah sich Johann Sebastian Bach deshalb genötigt, die Frage, wer<br />
denn eigentlich in der Paulinerkirche musizieren darf – und vor allem, wer dafür<br />
kassiert! – von den Dresdner Hofbehörden klären zu lassen. Es sollte dennoch<br />
lange Zeit andauern, bis sich ein festes Tätigkeitsfeld für das Amt des „Jubilars“<br />
herauskristallisierte.<br />
Michael Maul
Frauenstudium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
Von den Anfängen vor 100 Jahren<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts öffnete sich das Wilhelminische Kaiserreich<br />
dem Thema „Frauenstudium“. Nahezu eintausend Semester mussten seit<br />
der Gründung der Alma mater Lipsiensis vergehen, ehe Frauen im Sommersemester<br />
1906 die reguläre Zulassung zum Studium erhielten und damit<br />
die Möglichkeit, einen akademischen Berufsabschluss zu erwerben. 27<br />
Frauen nutzten diese Chance und schrieben sich in zwei der vier Fakultäten,<br />
der philosophischen und der medizinischen, ein.<br />
171
Dies geschah zu einem Zeitpunkt, da in vielen europäischen Ländern, darunter<br />
Russland 1860, Frankreich 1863, Schweiz 1864, England 1870, Niederlande<br />
1875, Italien 1876, Österreich 1897, Frauen nicht nur bereits studiert, sondern<br />
auch promoviert haben. Als 1906 in Sachsen Frauen zum Studium zugelassen<br />
wurden, hatte Marie Curie bereits ihre ordentliche Professur an der Pariser Sorbonne-<strong>Universität</strong><br />
inne.<br />
Worin bestanden nun die Bedingungen und Besonderheiten der Etablierung des<br />
Frauenstudiums in <strong>Leipzig</strong>?<br />
Das Höhere Mädchenschulwesen war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ein<br />
Sammelsurium aus unterschiedlichen Bildungsangeboten ohne festen Lehrplan.<br />
Es sah eine Schulbildung und Berufsausbildung über die Konfirmation hinaus in<br />
der Regel nicht vor. Für die Mädchen der Höheren Stände schlossen sich häufig<br />
noch zwei Jahre Privatunterricht an, der auf Konversations-, Klavier-, Gesangs-<br />
und Malunterricht ausgerichtet war. Die bildungsmäßigen Voraussetzungen für<br />
ein universitäres Studium waren damit nicht gegeben.<br />
Vor 140 Jahren wurde im Oktober 1865 in <strong>Leipzig</strong> der Allgemeine Deutsche<br />
Frauenverein (ADF) gegründet. Es war dies der organisatorische Beginn der<br />
bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland. Die Auftaktveranstaltung, zu der<br />
300 Frauen aus allen deutschen Ländern nach <strong>Leipzig</strong> kamen, fand in der Deutschen<br />
Buchhändlerbörse, Ritterstr. 12 – heute: Gästehaus der <strong>Universität</strong> – statt.<br />
Ziel des ADF war es, zur Verbesserung der Bildungs- und Berufsausbildungsmöglichkeiten<br />
für Frauen beizutragen und den Zugang zu den <strong>Universität</strong>en zu<br />
eröffnen. Ab 1869 wurden dazu zahlreiche Petitionen an die Regierungen der<br />
deutschen Länder gerichtet. 1879 wurde vom ADF eigens ein Stipendienfonds<br />
für <strong>Universität</strong>sstudien der Frauen ins Leben gerufen.<br />
An der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> waren Frauen seit 1870/71 bereits als Gasthörerinnen<br />
zugelassen, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollen Immatrikulation.<br />
Gasthörerinnen war es allerdings untersagt, Prüfungen abzulegen. Neben der<br />
<strong>Universität</strong> Heidelberg, die die Gasthörerschaft für Frauen schon ab 1869 ermöglichte,<br />
nahm die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> eine Pionierrolle unter den deutschen<br />
<strong>Universität</strong>en ein.<br />
1894 gründete der ADF „Realgymnasialkurse für Mädchen“ in <strong>Leipzig</strong>. Nach<br />
Karlsruhe (1893) und Berlin (1893) war dies deutschlandweit die dritte Möglichkeit<br />
für Frauen, das Abitur abzulegen, eine elementare Voraussetzung für die<br />
Zulassung zum <strong>Universität</strong>sstudium. Um 1900 gab es die ersten Abiturientinnen,<br />
172
und damit erhöhte sich der Druck auf die Regierungen, Frauen nunmehr den<br />
Zugang zu den <strong>Universität</strong>en nicht länger zu verweigern. 1900 folgte schließlich<br />
auch der ministerielle Erlass, wonach Promotionen für Frauen nun regulär möglich<br />
wurden.<br />
Eine repräsentative Umfrage zum Frauenstudium aus dem Jahre 1897 unter 122<br />
deutschen <strong>Universität</strong>sprofessoren ergab, dass ca. die Hälfte der Befragten keinerlei<br />
stichhaltige Gründe für den Ausschluss der Frauen vom Studium sahen.<br />
Befürworter, Förderer und Gegner hielten sich die Waage. Für das Studium der<br />
Frauen im Einzelfall und bei einer den Männern gleichen Vorbildung sprachen<br />
sich beispielsweise die <strong>Leipzig</strong>er Professoren der Medizin Wilhelm His (Anatomie),<br />
Victor Birch-Hirschfeld (Pathologie) und der Chemie Friedrich Strohmann,<br />
Friedrich Trendelenburg, der Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald und der<br />
Professor der experimentellen Psychlogie Wilhelm Wundt aus. Wilhelm Wundt<br />
(1832 – 1920) formulierte: „Ich meine: die Frau, die nach bestimmten Richtungen<br />
hin die gleichen Fähigkeiten hat wie der Mann, ist genau ebenso wie dieser<br />
an und für sich berechtigt, diese Fähigkeiten auszubilden und anzuwenden. Das<br />
so oft gehörte Argument: es seien schon in allen Gebieten die Angebote männlicher<br />
Bewerber zahlreich genug, es bestehe daher kein Bedürfnis auch nach weiblicher<br />
Konkurrenz und dergleichen, – dieses Argument erscheint mir lediglich<br />
als der Ausdruck eines brutalen Geschlechtsegoismus, der nicht besser ist als<br />
irgend ein Klassenegoismus, der Vorrechte für sich in Anspruch nimmt.“<br />
Zahlreiche der ersten 27 Studentinnen, die sich im April 1906 an der <strong>Leipzig</strong>er<br />
<strong>Universität</strong> immatrikulierten, waren, wie sich anhand der Matrikel nachweisen<br />
lässt, Absolventinnen der Realgymnasialkurse des ADF. Geleitet wurden diese<br />
Kurse von Dr. Käthe Windscheid, Tochter des renommierten <strong>Leipzig</strong>er Professors<br />
der Rechtswissenschaften Bernhard Windscheid, der die erste Kommission<br />
zur Erarbeitung des BGB im Jahre 1874 leitete und damit federführend an dessen<br />
Abfassung beteiligt war. Anfangs unterrichtete sie die ersten 10 Schülerinnen im<br />
Studierzimmer ihres Vaters (Parkstr. 1, heute: Richard-Wagner-Str.).<br />
Diese ersten Studentinnen entstammten bildungsbürgerlichen Schichten, dem<br />
Besitzbürgertum und dem Adel. Ihre Väter waren Kaufleute, Professoren, Lehrer,<br />
Fabrik- und Rittergutsbesitzer, Pastoren und Rechtsanwälte. Die Studentinnengeneration<br />
von 1906 zeichnet sich durch das hohe Immatrikulationsalter von<br />
durchschnittlich 26,2 Jahren aus und lag damit deutlich über dem der gesamten<br />
Matrikel. Die Ursachen dafür gründen in der späten Chance für das Frauenstudium<br />
in Deutschland, viele von ihnen hatten sich jahrelang mit der Gasthörerschaft<br />
begnügen müssen, und im längeren Bildungsweg der Frauen. Von den<br />
173
eruflichen Abschlüssen, die sie anstrebten, waren es vor allem zwei: Einerseits<br />
drängten an die philosophische Fakultät Frauen, die sich für das wissenschaftliche<br />
Lehramt qualifizieren wollten. Lehrerinnen, die in Volksschulen tätig waren,<br />
gab es bereits, das höher angesehene öffentliche Schulwesen blieb den Frauen<br />
aber bislang verwehrt. Andererseits stieg angesichts des ethisch-moralischen<br />
Grundkonsenses der bürgerlichen Gesellschaft die Nachfrage nach weiblichen<br />
Ärzten insbesondere für Frauenheilkunde, die nicht länger ignoriert werden<br />
konnte. Denn als Hebammen waren Frauen längst etabliert. Beide Berufsfelder,<br />
das der Lehrerin und das der Ärztin, ließen sich auch am ehesten mit den traditionellen<br />
Rollenzuschreibungen von Frauen in der Gesellschaft vereinbaren. Die<br />
erzieherischen Fähigkeiten der Frauen in der Familie und deren Engagement zu<br />
wohltätigen Zwecken waren anerkannt und unbestritten. Es lag nahe, dann auch<br />
der Professionalisierung derselben aufgeschlossen gegenüber zu stehen. Die<br />
Konzentration der Frauen auf die philosophische und die medizinische Fakultät<br />
korrespondiert mit der an den anderen deutschen <strong>Universität</strong>en und war keineswegs<br />
zufällig. Mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren finden wir 1908<br />
die erste Studentin an der juristischen Fakultät, und es dauerte weitere zwei Jahre,<br />
bis 1910 die erste Studentin an der theologischen Fakultät anzutreffen ist. Es<br />
sind dies Professionen, die mit sehr viel Einfluss und Prestige verbunden sind.<br />
Von daher hielten sich hier die Vorurteile am hartnäckigsten. Darüber hinaus<br />
machten die herrschenden Weiblichkeitsbilder und die bestehenden gesetzlichen<br />
Regelungen den Berufseinstieg für Frauen in diese Professionen außerordentlich<br />
schwierig bzw. gar unmöglich.<br />
In den Folgejahren bis zum 1. Weltkrieg entwickelte sich das Frauenstudium mit<br />
nur langsam steigender Tendenz. 1914/15 waren insgesamt 200 Studentinnen<br />
an der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> immatrikuliert, das entsprach einem Anteil von<br />
4,85 Prozent.<br />
Astrid Franzke<br />
174
Die ersten Promotionen<br />
Zum 575. Jahrestag der Verleihung akademischer Grade an<br />
der Medizinischen Fakultät<br />
Das Siegel der Juristenfakultät nach 1452 veranschaulicht eine europaweit<br />
einmalige Symbolwahl: Es zeigt den Promotionsakt als wichtigstes Fundament<br />
der Fakultät. Papst (links) und Kaiser (rechts), die Vertreter des kanonischen<br />
und weltlichen Rechts, verleihen einem knienden Promovenden den<br />
Doktorhut als Zeichen erworbener Gelehrsamkeit. Erst mit der Verleihung<br />
von akademischen Graden in den höheren Fakultäten nach 1431 konstituierte<br />
sich die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> nach außen als Volluniversität.<br />
175
Das <strong>Universität</strong>sjahr 1409 in Prag war kein gutes Jahr – es war geprägt von politischen<br />
Spannungen und konfessioneller Unruhe wegen der Lehren von Johannes<br />
Hus. Zunächst sah es so aus, als würden sich die Auseinandersetzungen von<br />
1384 wiederholen. Als damals der <strong>Universität</strong>skanzler und Erzbischof von Prag<br />
in die Rechte der nichtböhmischen Nationen eingreifen wollte, wehrten sie sich<br />
gegen diese Zumutung mit der Einstellung der Lehrveranstaltungen und einem<br />
Boykott aller akademischen Graduierungen.<br />
Der Streit eskalierte jedoch im Frühjahr 1409 in ungeahnter Weise: Der König<br />
und die Stadtbürger mischten sich zugunsten der böhmischen Nation ein, es<br />
kam zu Gewalttätigkeiten und Blutvergießen – nun entschieden sich die drei<br />
nichtböhmischen Nationen, die Stadt Prag zu verlassen und den Lehrbetrieb in<br />
der Fremde fortzusetzen. Das erzwungene Exil einer ganzen <strong>Universität</strong>, heute<br />
kaum vorstellbar, war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Beispiele dafür finden<br />
sich reichlich, so Paris 1229 (Ausweichorte Orleans, Angers), 1209 Oxford<br />
(Ausweichort Cambridge), 1316 Orleans (Ausweichort Nevers). Nicht immer<br />
kehrten die Ausgezogenen zu ihren früheren Quartieren zurück, fast immer aber<br />
entstanden an den neuen Orten wieder <strong>Universität</strong>en, die den Selbstständigkeits-<br />
und Unabhängigkeitswillen der Vorgängereinrichtung erbten.<br />
Wichtigstes Ziel der Exilanten war die Sicherung ihrer Rechtsgüter in der<br />
Fremde – dank der zumeist wohlwollenden päpstlichen Universalgewalt war das<br />
in der Regel kein allzu großes Problem. Dabei kristallisiert sich das Promotionsrecht<br />
als Hauptmerkmal bei der Konstituierung von neuen <strong>Universität</strong>en heraus.<br />
Die verliehenen Grade verbanden nicht nur die einzeln existierenden Hohen<br />
Schulen miteinander, sondern begründeten daneben innerhalb der christlichen<br />
Gemeinschaft des Abendlandes eine neue soziale Schicht – den Gelehrtenstand.<br />
Die Gleichartigkeit und Vergleichbarkeit der Grade sorgten einerseits für eine<br />
soziale Einordnung des Trägers in der akademischen und nichtakademischen<br />
Welt und andererseits bewirkten sie ein Gemeinschaftsgefühl der Gelehrten<br />
(unabhängig von ihrem Fach, ihrem Alter oder ihrer Herkunft). Mit der päpstlichen<br />
oder kaiserlichen Privilegierung des Promotionsaktes erfolgte zugleich<br />
die sozial hochrangige Einordnung der Titelträger in die Stände-Hierarchie der<br />
Gesellschaft. Aus jedem gradus wurde ein status, der seinem Inhaber gewisse<br />
Vorrechte zusicherte.<br />
Um den Anspruch auf Gleichberechtigung mit den schon bestehenden <strong>Universität</strong>en<br />
zu bekräftigen und um die innere Lebensfähigkeit der Fakultäten zu<br />
demonstrieren, war ein baldiger Beginn des normalen Lehrbetriebs in <strong>Leipzig</strong><br />
nötig. Diesen Anspruch nach außen zu dokumentieren, dazu war nichts besser<br />
176
geeignet als die Verleihung akademischer Grade. Noch im Wintersemester<br />
1409, im schnellen Anschluss an die Gründung der Fakultäten, vollzog die neue<br />
universitas die ersten, von den Voraussetzungen her noch in Prag erworbenen<br />
Graduierungen. Auf die Nachricht hin, dass Papst Alexander V. die Gründung<br />
privilegiert habe, konstituierte sich am 24.10.1409 die Artistenfakultät durch die<br />
Wahl des Dekans. Gut einen Monat später, nachdem die päpstliche Bulle am 13.<br />
November eingetroffen war, wurden am 30. November die Examinatoren für die<br />
Prüfungen der Baccalaren gewählt. Eine der ersten Verkündigungen der feierlich<br />
eröffneten neuen <strong>Universität</strong> war dann die Zusage, dass die in Prag erworbenen<br />
Grade ohne weitere Prüfungen oder Gebühren anerkannt werden und alle bereits<br />
in Prag erbrachten Vorleistungen für akademische Graduierungen voll gültig<br />
sein sollten. Die ersten Promotionen an der neu gegründeten <strong>Universität</strong> finden<br />
1409 zunächst in der Artistenfakultät statt.<br />
Über das Leben an den höheren Fakultäten (Theologie, Jura und Medizin) sind<br />
wir für die nächsten Jahre durch fehlende Dokumente nicht informiert. Vermutlich<br />
sind es nur wenige Fakultätsangehörige und Studenten, die sich in <strong>Leipzig</strong><br />
aufhalten. Promotionen in einem der drei Fächer gelten noch zum Ende des<br />
15. Jahrhunderts als eine Seltenheit. In den Jahren um 1470 gelangt von den jährlich<br />
ca. 250 Immatrikulierten fast die Hälfte bis zum ersten akademischen Grad<br />
in der Artistenfakultät (Baccalaureat). Lediglich eine kleine Schar studiert danach<br />
noch weiter und erlangt auch das Magisterium in der Artistenfakultät – etwa<br />
4 – 7 Prozent. Doch erst mit dem Besitz des Magister artium ist das Studium<br />
in einer der drei höheren Fakultäten möglich – für die Erlangung eines Grades in<br />
den höheren Fakultäten ist es gar notwendige Voraussetzung. Im 15. Jahrhundert<br />
halten sich daher in <strong>Leipzig</strong> durchschnittlich nicht mehr als 30 – 50 Magister<br />
auf, die in der Artistenfakultät Vorlesungen halten und zugleich in einer höheren<br />
Fakultät studieren. In diesen drei Fakultäten wiederum dürften zusammen kaum<br />
mehr als 10 Doktoren Lehrveranstaltungen angeboten haben.<br />
Für diese drastische Auslese sind vor allem zwei Faktoren zuständig: Zeit und<br />
Geld. Zunächst muss während des Studiums der Lebensunterhalt gesichert<br />
sein – die Studienzeiten waren nicht viel kürzer als heute. Die Promotionsordnungen<br />
in den einzelnen Fakultäten bildeten dabei ein ineinander greifendes<br />
System. Für die Zulassung zum Baccalaureatsexamen in der Artistenfakultät<br />
musste der Student 17 Jahre alt, legitimer Geburt, eidfähig und guten Rufes<br />
sein, die Mindeststudienzeit in der Fakultät lag bei anderthalb Jahren. In einem<br />
Prüfungsverfahren vor dem Dekan mussten notwendige Kenntnisse in Latein<br />
nachgewiesen und mehrere Eide abgelegt werden. Vielfach scheint es in der Fakultät<br />
zu Vergehen und Betrügereien bei den Examen gekommen zu sein, so dass<br />
177
dafür wiederholt Regelungen in den Statuten getroffen wurden – u. a. mussten<br />
die Kandidaten schwören, sich nicht an den Prüfern zu rächen oder bewaffnet die<br />
Wohnung des Dekans aufzusuchen. Erst nach zwei weiteren Jahren des Lernens<br />
und Lehrens an der Fakultät konnte der Baccalar um den nächst höheren Grad<br />
nachsuchen. Für die Bewerbung um das Magisterium war ein Mindestalter von<br />
21 Lebensjahren, die eheliche Geburt und rechtliche Unbescholtenheit nachzuweisen.<br />
Waren die Prüfungen erfolgreich bestanden, hatte der frisch promovierte<br />
Magister weitere Eide zu schwören. Damit verpflichtete er sich, wenigstens noch<br />
zwei Jahre lang in <strong>Leipzig</strong> zu bleiben und zu disputieren, den Grad nicht an einer<br />
weiteren Hochschule erneut zu erwerben, die Statuten zu achten und das Wohl<br />
der <strong>Universität</strong> nach Kräften zu fördern. Nun erst konnte man, sofern das nötige<br />
Geld vorhanden war, an eine weitere Graduierung denken. Für den niedrigsten<br />
akademischen Grad in der Theologischen Fakultät musste der Magister sieben<br />
Jahre als Magister artium oder fünf Jahre als Doktor der Medizin bzw. Doktor<br />
der Rechte die vorgeschriebenen Vorlesungen der Fakultät besuchen, ehe er den<br />
Baccalaurus theologiae cursor erwerben konnte. Weitere zwei Jahre waren dann<br />
nötig bis zum Baccalaurus theologiae formatus. Erst mit diesem Grad und nach<br />
vier weiteren Jahren des Studiums an der Fakultät konnte der Doktortitel bei den<br />
Theologen erworben werden.<br />
Bei der Juristenfakultät musste der Bewerber vier Jahre das kanonische und<br />
bürgerliche Recht an der Fakultät gehört haben, um zum Baccalaureatsexamen<br />
zugelassen zu werden. Erst mit dem Baccalaureat und einem darauf folgenden<br />
weiteren dreijährigem Fachstudium an der Fakultät wurde er zur Doktorprüfung<br />
angenommen.<br />
Für das medizinische Baccalaureat benötigte man den Magister artium und musste<br />
einen dreijährigen Vorlesungsbesuch und eine zweijährige Praxistätigkeit bei<br />
einem der medizinischen Doktoren nachweisen. Bis zum Doktorat musste der<br />
Bewerber weitere zwei Jahre Vorlesungen hören und zugleich mit einem Doktor<br />
der Fakultät „… auf die Praxis …“ gehen.<br />
So ergaben sich theoretisch folgende Mindestalterstufen bei den Graduierten:<br />
Baccalaureat 2. Graduierung<br />
Artisten 17 21 (magister<br />
Medizin 24 26 (doctor)<br />
Recht 25 28 (doctor)<br />
Theologie 28 32 (licentiat)<br />
178
Mit diesem System der Abstufungen und Mindestvoraussetzungen passen die<br />
Aufzeichnungen über die ersten Promotionen in den höheren Fakultäten gut<br />
zusammen. Erst zum Ende der 1420er Jahre dürften die ersten Bewerber von<br />
der Qualifizierung her im Stande gewesen sein, um eines der Doktorate nachzusuchen.<br />
Tatsächlich erfolgen Aufzeichnungen über Doktorpromotionen an den<br />
höheren Fakultäten erst 22 Jahre nach der <strong>Universität</strong>sgründung: in der Medizin<br />
1431, in der Theologie 1432 (Lizentiat), und bei den Juristen sind Aufzeichnungen<br />
zwar vorhanden, aber erst nach 1479 datierbar.<br />
Bevor man aber Doktorhut und -tracht anlegen konnte, galt es noch eine zweite<br />
Hürde zu nehmen – mittelalterliche Graduierungen waren extrem kostspielig.<br />
Die Einnahmen, die die Fakultäten durch die Graduierungen erzielten, entstanden<br />
sowohl durch die Gebühren für den Besuch vorgeschriebener Lehrveranstaltungen<br />
als auch durch direkte Prüfungsgebühren und Sachleistungen. Überschlägt<br />
man die Einnahmen, die der <strong>Universität</strong> aus solchen Gebühren zuflossen,<br />
so zeigt sich, dass sie ein bedeutender Teil der mittelalterlichen <strong>Universität</strong>sfinanzen<br />
gewesen sind. Vergleicht man sie mit den Besoldungen der neun landesherrlichen<br />
Stiftungsprofessuren – dann hätten allein durch die Promotionsgebühren<br />
drei weitere Professorenstellen fest besoldet werden können. So ist es<br />
kein Wunder, dass die Verteilung dieser Gelder immer wieder Eifersüchteleien<br />
erzeugte. Bereits 1446 versuchten die 16 Magister in der Artistenfakultät, die im<br />
beschlussfassenden Consilium saßen, die anderen Magister von der Verteilung<br />
der Promotionsgebühren auszuschließen. Diese „Reform“ der Fakultätsordnung<br />
misslang jedoch. Rund 240 Jahre später, 1685, sorgte der Landesherr dann selbst<br />
für die entsprechende Änderung. Statt der bisherigen Verwaltung der Fakultätsgeschäfte<br />
durch gewählte Magister aus den 4 Nationen waren von nun an nur<br />
noch die 9 Professuren alter Stiftung dazu berechtigt. Am Ende des 18. Jahrhunderts<br />
werden nur noch die Professoren alter Stiftung als empfangsberechtigte<br />
Fakultätsmitglieder betrachtet.<br />
Nach der Reformation kamen auf zukünftige Doktoren noch weitere Auslagen<br />
zu. Mit dem weltlichen Lebensstand der meisten Fakultätsangehörigen wurden<br />
Kosten für die Haushaltsführung der Familienangehörigen fällig. Besonders mit<br />
Bezug auf die Juristen wird berichtet (in der Festschrift von 1909), dass zwar<br />
die Ausgaben der Doktoren für Luxus und Prunk nicht überdurchschnittlich waren<br />
– für ihre weiblichen Familienangehörigen habe das aber nicht im gleichen<br />
Maße zugetroffen: „Selbst die Beschränkungen, welche die Kleiderordnung von<br />
1612 den Doktorenfrauen und -töchtern auferlegte, sind doch immer noch derart,<br />
daß sie heute als unerhörter Aufwand gebrandmarkt werden würden, und wenn<br />
eine Doktorenfrau, der Damastkleider und Sammetschürzen gar nicht zu geden-<br />
179
ken, Halsgeschmeide bis zu 200 Gulden Wert und einen Kopfputz bis zu 50<br />
Gulden tragen durfte – und da sie es durfte, wird sie es auch wohl getan haben –,<br />
so schleppte sie eben an ihrem Leibe den ganzen Jahresgehalt des gelehrten Gemahls<br />
umher, der eben dann durch private Vorlesungen und Disputationen sowie<br />
durch Praxis die Ebbe seiner Kasse ausgleichen mußte.“<br />
Auch zwischen den Fakultäten erzeugte das Promotionsrecht so manchen Zwist<br />
über die interne Hierarchie. 1526 kam es zu einem bewaffneten Zusammenstoß<br />
der baccalarei juris mit den Magistern der Artistenfakultät, als die Juristen den<br />
Vorrang beim Fronleichnamsfest beanspruchten. Die nachfolgenden Schlichtungsbemühungen<br />
des Rektors erkannten die Juristen nicht an, da sie nur ihren<br />
eigenen Dekan als Oberhaupt akzeptieren wollten. Erst dem Spruch des Landesherrn<br />
beugten sie sich. Im Jahre 1642 erwirkten die Juristen ein landesherrliches<br />
Reskript, dass die juristischen Doktoren denen der Medizin im Rang vorgehen<br />
sollten. Noch 1776 geriet die Juristenfakultät in einen Streit mit den Theologen<br />
über das Anschlagsrecht an Kirchentüren, das allein juristischen Doktoren seit<br />
altersher zustehen würde.<br />
Für die Akzeptanz der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> als einer universellen Ausbildungsstätte<br />
für alle tradierten Fächer war jedoch das Graduierungswesen der höheren<br />
Fakultäten ein entscheidender und stabilisierender Faktor. Die Möglichkeit, in<br />
den scientia lucrativa zu einem akademischen Grad zu gelangen und dadurch in<br />
der sozialen Hierarchie zu steigen und zu materiellem Wohlstand zu gelangen,<br />
bewirkte eine anhaltende Attraktivität der <strong>Universität</strong>. Das Graduierungswesen<br />
der höheren Fakultäten sorgte für den notwendigen Zulauf an Studierenden,<br />
garantierte einen erheblichen Zuwachs an Gebühreneinnahmen und beinhaltete<br />
eine weitere Steigerung der wissenschaftlichen Reputation. Mit der ersten<br />
datierbaren medizinischen Promotion im Jahre 1431 bekräftigte die <strong>Leipzig</strong>er<br />
<strong>Universität</strong> ihren Anspruch, insbesondere gegenüber der Mutteruniversität Prag,<br />
wie auch gegenüber den älteren <strong>Universität</strong>en, als beständige und gleichrangige<br />
Bildungsstätte zu gelten.<br />
Jens Blecher<br />
180
Autorenverzeichnis<br />
Cornelia Becker<br />
Öffentlichkeitsarbeit der Medizinischen Fakultät<br />
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Lothar Beyer<br />
Professor für Anorganische Chemie (Koordinationschemie), Institut für<br />
Anorganische Chemie<br />
Jens Blecher<br />
Mitarbeiter des <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong>s<br />
Prof. Dr. Enno Bünz<br />
Professor für Sächsische Landesgeschichte am Historischen Seminar<br />
Prof. Dr. Marcus Deufert<br />
Professor für Klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik am<br />
Institut für Klassische Philologie und Komparatistik<br />
Prof. Dr. Dr. Detlef Döring<br />
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu <strong>Leipzig</strong><br />
Dr. Margit Ebersbach<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Herder-Institut der Philologischen<br />
Fakultät<br />
Dr. Sabine Fahrenbach<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der<br />
Medizin und der Naturwissenschaften<br />
Prof. Dr. Klaus Fitschen<br />
Professor für Kirchengeschichte unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Neueren und Neuesten Kirchengeschichte am Institut für Kirchen-<br />
geschichte<br />
181
Prof. Dr. Eliahu Franco<br />
Professor für Indologie am Institut für Indologie und Zentralasienwissenschaften<br />
Dr. Astrid Franzke<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen-<br />
und Geschlechterforschung der HAWK/FH Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen und der Stiftung <strong>Universität</strong> Hildesheim<br />
Dr. Jan Felix Gaertner<br />
Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Klassische Philologie und Komparatistik<br />
Dr. Hans-Joachim Höbler<br />
Kustos der Mineralogisch-Petrographischen Sammlung am Institut für<br />
Mineralogie, Kristallographie und Materialwissenschaft<br />
Cornelia Junge<br />
Sammlungskonservatorin der Kustodie<br />
Prof. em. Dr. Helmar Junghans<br />
Institut für Kirchengeschichte<br />
Prof. Dr. Ingrid Kästner<br />
Professorin am Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der<br />
Naturwissenschaften<br />
Prof. Dr. Bernd-Rüdiger Kern<br />
Professor für Bürgerliches Recht, Rechtsgeschichte und Arztrecht an der<br />
Juristenfakultät<br />
Dr. Klaus Kroszewsky (†)<br />
Hochschuldozent an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde<br />
Dr. Wolfgang Liedtke<br />
Ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethnologie<br />
182
Prof. Dr. Helmut Loos<br />
Professor für Historische Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft<br />
Prof. em. Dr. Dietmar Mathias<br />
Institut für Alttestamentliche Wissenschaft<br />
Michael Maul<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv <strong>Leipzig</strong><br />
PD Dr. Matthias Middell<br />
Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Zentrums für Höhere Studien<br />
(ZHS) an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
Dr. Hans-Peter Müller<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Klassische Archäologie<br />
Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha<br />
Professorin für Geschichte der Medizin, Direktorin des Karl-Sudhoff-Instituts<br />
für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften<br />
Prof. Dr. Manfred Salmhofer<br />
Professor für Theoretische Physik/Statistische Physik am Institut für Theoretische<br />
Physik<br />
Prof. Dr. Hans Ulrich Schmid<br />
Professor für Historische deutsche Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik<br />
PD Dr. Holger Steinberg<br />
Projektkoordinator und Historiker des Archivs für <strong>Leipzig</strong>er Psychiatriegeschichte<br />
an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie<br />
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Günther H. W. Sterba<br />
Ehemaliger Direktor des Zoologischen Instituts<br />
183
Dr. Rüdiger Thiele<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der<br />
Medizin und der Naturwissenschaften und Privatdozent an der Fakultät<br />
für Mathematik und Informatik<br />
Prof. Dr. Gerald Wiemers<br />
Direktor des <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong>s<br />
184
Bildnachweise<br />
S. 9: Erich Kähler (1906 – 2000), Fotoquelle: Prof. Dr. R. Berndt,<br />
Hamburg<br />
S. 15: Hermann Brockhaus (1806 – 1877), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 21: Eva Lips (1906 – 1988), Institut für Ethnologie<br />
S. 27: Hans Otto de Boor (1886 – 1956), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 31: Karl Lamprecht (1856 – 1915), Fotosammlung, <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 39: Emil Adolf Roßmäßler (1806 – 1867), Naturkundemuseum<br />
<strong>Leipzig</strong><br />
S. 45: Eduard Friedrich Weber (1806 – 1871), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 49: Karl Sudhoff (1853 – 1938), rechts im Bild mit einem Mitarbeiter,<br />
etwa 1914, Quelle: Bildersammlung des Karl-Sudhoff-Instituts,<br />
Nr. 6403<br />
S. 55: Friedrich Wilhelm Ritschl (1806 – 1876), Fotosammlung, <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong>,<br />
Aus: Imaginas Philologorum, hrsg. von Alfred Gudemann,<br />
<strong>Leipzig</strong>, Berlin, 1911<br />
S. 61: Albrecht Alt (1883 – 1956), Fotoarchiv des Instituts für Alttestamentliche<br />
Wissenschaft<br />
S. 67: Das Pathologische Institut, Ansicht von der Ecke Liebigstraße/<br />
Johannisallee, Aufnahme von 1909, Aus: Festschrift zur Feier des<br />
500-jährigen Bestehens der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, hrsg. von Rektor<br />
und Senat. <strong>Leipzig</strong>, 1909, Taf. V<br />
S. 73: Oskar von Gebhardt (1844 – 1906), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 79: Karl Ferdinand Hommel (1722 – 1781), Gemälde von Ernst<br />
Gottlob, 1781, aus der Ordinariengalerie der Juristenfakultät,<br />
Kunstbesitz der <strong>Universität</strong><br />
S. 83: Johann Christian August Heinroth (1773 – 1843), Lithographie<br />
von G. Schlick, Aus dem Nachlass Heinroth, <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
185
S. 89: Paul Drude (1863 – 1906), Fotosammlung, <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 93: Robert Schumann (1810 – 1856), Wien 1839; Lithographie<br />
von Josef Kriehuber, Robert-Schumann-Haus Zwickau; Archiv-Nr.<br />
7494-B2<br />
S. 99: Johann Christian Schamberg (1667 – 1706), Bildnis Öl/<br />
Leinwand (Ausschnitt), geschaffen um 1702/1706 von David<br />
Hoyer für die Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>.<br />
Kunstbesitz der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Foto: Kustodie der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Leipzig</strong>, Fotoarchiv<br />
S. 105: Das Herder-Institut in der Lumumbastraße mit Denkmal für den<br />
Namensgeber der Straße, Patrice Lumumba, Aufnahme von<br />
1961, Fotosammlung, <strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 109: Johann Friedrich Christ (1701 – 1756), Kupferstich von J. C.<br />
Sysang nach einem Gemälde von E. G. Haußmann. Aus: J. F.<br />
Christ, Abhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke vornehmlich<br />
des Altertums, durchgesehen und Anmerkungen begleitet<br />
von J. K. Zeune, <strong>Leipzig</strong> 1776, Foto: Antikenmuseum<br />
S. 115: Luwig Boltzmann (1844 – 1906), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 121: Johann Christoph Adelung (1732 – 1806), Radierung von Christian<br />
Gottlieb Geyser nach einem Gemälde von Anton Graff,<br />
Stadtgeschichtliches Museum <strong>Leipzig</strong>, Inv.-Nr.: G VI/2<br />
S. 125: Johann Christian Gottfried Jörg (1779 – 1856), Aus: Zweifel,<br />
Paul: Rückblick über die Gründung und wissenschaftliche Thätigkeit<br />
unter den ersten beiden Directoren. In: Festschrift zur Jahrhundertfeier<br />
des Trier´schen Institutes oder <strong>Universität</strong>s-Frauenklinik<br />
in <strong>Leipzig</strong> am 29. Oktober 1910, Berlin: Schumacher, o. J.<br />
S. 131: Medaille, gestiftet anlässlich des 200. Geburtstages von Christian<br />
Samuel Weiss (1780 – 1856) am 26. Februar 1980 von der<br />
Vereinigung für Kristallographie der DDR<br />
S. 137: Rudolf Kötzschke (1867 – 1949), Aus: Rudolf Kötzschke und das<br />
Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde an der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Leipzig</strong>, Sax-Verlag Beucha, 1999<br />
S. 143: Friedrich Louis Hesse (1849 – 1906), Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
186
S. 149: Stadtansicht von Algier, Kupferstich, <strong>Universität</strong>sbibliothek,<br />
Handschriftenabteilung<br />
S. 155: Thomas Müntzer (1489 – 1525), Xylographie, um 1870, Stadtgeschichtliches<br />
Museum <strong>Leipzig</strong>, Inventar-Nr. Porträt U 90<br />
S. 161: Das Augusteum, Umdruckpapier (gespiegelt) für Porzellan,<br />
um 1840, Kunstbesitz der <strong>Universität</strong><br />
S. 167: Werner Fabricius (1633 – 1679), Kupferstich von Philipp Kilian<br />
nach einem Gemälde von Samuel Bottschild, 1671, <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
S. 171: Studenten und Studentinnen in einem medizinischen Hörsaal um<br />
1920. Das chirurgische Seminar leitete Prof. Erwin Payr, Fotosammlung,<br />
<strong><strong>Universität</strong>sarchiv</strong><br />
S. 175: Das Siegel der Juristenfakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
187