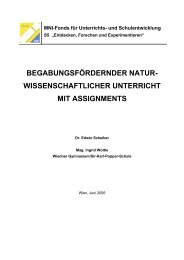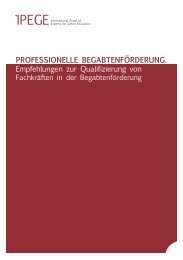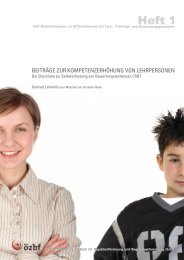Zusammenfassung und Ergebnisse - ÖZBF
Zusammenfassung und Ergebnisse - ÖZBF
Zusammenfassung und Ergebnisse - ÖZBF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anne Sliwka (Universität Trier) stellte hierzu mit Lernverträgen, Portfolios <strong>und</strong> Kompetenzrastern<br />
Instrumente alternativer Leistungsentwicklung <strong>und</strong> -bewertung vor, die in<br />
der pädagogischen Arbeit mit Begabten von Nutzen sind.<br />
Eine Optimierung des Beurteilungsverhaltens von Lehrkräften verfolgte Gerhard Lehwald<br />
(Zentrum für Potentialanalyse <strong>und</strong> Begabtenförderung, Leipzig), der sich davon eine Verbesserung<br />
der Lernmotivation der Schüler erwartet.<br />
Lehrer/innen wie Eltern werden in ihren bewertenden Leistungsrückmeldungen vielfach<br />
von unbewussten Überzeugungen geleitet. So können ungünstige Ursachenzuschreibungen<br />
für Erfolg oder Misserfolg – wie zum Beispiel „Glück“, „mangelnde Begabung“, „zu<br />
leichte / zu schwere Aufgaben“ – die Motivation, Anstrengungsbereitschaft <strong>und</strong> Lernfreude<br />
nachhaltig beeinträchtigen, wie Birgit Hartel (Charlotte-Bühler-Institut für praxisorientierte<br />
Kleinkindforschung) darlegte. Auch Robert Grassinger (Universität Wien) befasste<br />
sich mit der Frage, wie Feedback lernförderlich einzusetzen ist, hier im Kontext der Eltern-Kind<br />
Beziehung in den ersten Lebensjahren.<br />
Kooperation Schule – Eltern / Gesellschaft / Universität<br />
Aspekte der Beziehung des Systems Schule zu den Eltern, zu anderen Bildungseinrichtungen,<br />
zur Wirtschaft <strong>und</strong> zu Institutionen des Umfelds wurden in zahlreichen Beiträgen<br />
diskutiert.<br />
Dietrich Arnold <strong>und</strong> Iris Großgasteiger (Begabungspsychologische Beratungsstelle der<br />
Ludwig-Maximilians-Universität München) erläuterten, wie wichtig die Zusammenarbeit<br />
der Schule mit den Eltern für eine passgenaue Förderung ist. Dabei gelte es, Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Haltungen, häufig auch Vorurteile hinsichtlich spezieller Fördermaßnahmen zu<br />
berücksichtigen: Maßnahmen der inneren Differenzierung würden beispielsweise positiver<br />
eingeschätzt als solche der äußeren Differenzierung.<br />
Werner Sacher (Universität Erlangen-Nürnberg) bemängelte, dass der Kooperation von<br />
Schule <strong>und</strong> Eltern häufig kein hinreichend differenziertes Konzept zugr<strong>und</strong>e liege, dabei<br />
seien die Eltern für den Schulerfolg ihrer Kinder wichtiger als die Schule. Durch eine geschickte<br />
schulische Elternarbeit könne die Breitenförderung von Begabungen <strong>und</strong> damit<br />
auch die Förderung hochbegabter Kinder optimiert werden. Im gleichen Sinne äußerte<br />
sich Dr. Roswitha Bergsmann (Otto Wagner Spital, Wien), die es für unerlässlich hält,<br />
dass „positive Kommunikation <strong>und</strong> konstruktive Interaktion zwischen Elternhaus <strong>und</strong><br />
Schule einen fixen Platz im Netzwerk Begabtenförderung erhalten.“<br />
Wie so etwas konkret aussehen kann, zeigte Zdislava Röhsner (Poppervein, Wien) am<br />
Beispiel der Sir-Karl-Popper-Schule <strong>und</strong> des Wiedner Gymnasiums, wo die Eltern zu einer<br />
aktiven Mitgestaltung des Schullebens ermutigt werden, indem sie ihre Kompetenzen <strong>und</strong><br />
Berufserfahrung einbringen, ein Mitspracherecht erhalten <strong>und</strong> auch an finanziellen Entscheidungen<br />
beteiligt werden.<br />
Unterschiedliche Sichtweisen von Lehrern <strong>und</strong> Eltern auf das Kind sind häufig Ursachen<br />
für Konflikte. Ian Kwietniewski <strong>und</strong> Mitra Anne Sen (Beratungsstelle besondere Begabungen,<br />
Hamburg) erarbeiteten Empfehlungen, wie Eltern <strong>und</strong> Lehrkräfte erfolgreich miteinander<br />
kommunizieren können – zum Wohle der Kinder.<br />
Wie Schulen von einer Partnerschaft mit Unternehmen <strong>und</strong> Gemeinden profitieren können,<br />
demonstrierten mehrere Beiträge. Maria Schumm-Tschauder (Siemens AG, München)<br />
berichtete über Initiativen im Rahmen des Bildungsprogramms „Siemens Generation21“,<br />
mit dem Kinder <strong>und</strong> Jugendliche für Naturwissenschaften <strong>und</strong> Technik begeistert<br />
werden sollen <strong>und</strong> begabte Studierende unterstützt <strong>und</strong> gefördert werden.<br />
Für Shell International ist die Suche nach brillanten Köpfen, die innovative Lösungen für<br />
unsere drängendsten Probleme – Energieversorgung, Klimawechsel, Bevölkerungswachstum<br />
– finden, ein strategisches Ziel, so Hans van der Loo (Shell International). Eine Initi-<br />
5