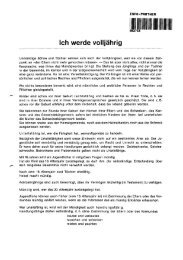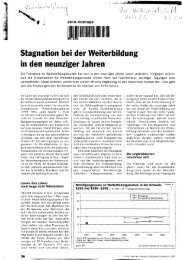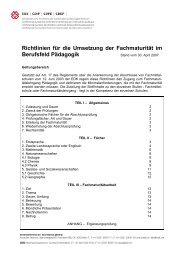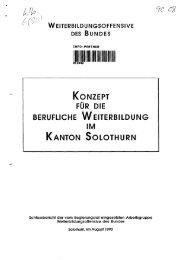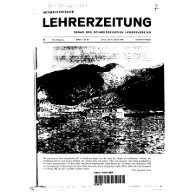Handbuch der Lernortkooperation - Theorieband
Handbuch der Lernortkooperation - Theorieband
Handbuch der Lernortkooperation - Theorieband
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dieter Euler<br />
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
1.1. Ausgangspunkte<br />
Das Problem des Zusammenhangs <strong>der</strong> Lernorte ist jedem Bildungsgang immanent,<br />
<strong>der</strong> sich in seinem Aufbau auf mehrere Institutionen stützt. Eine Variante<br />
dieses Problems findet sich in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland in Form des dualen<br />
Systems <strong>der</strong> beruflichen Erstausbildung. Der Begriff des „dualen Systems“<br />
konnotiert, dass zwei Subsysteme im Interesse eines übergeordneten Ganzen<br />
zusammenwirken. Für die beiden Lernorte Schule und Betrieb wird aus dieser<br />
Dualität weitgehend selbstverständlich die Notwendigkeit einer möglichst engen<br />
Kooperation abgeleitet. Dabei stellt die Kooperation nur eine <strong>der</strong> möglichen<br />
Ausprägungen einer Beziehung unterschiedlicher Lernorte dar. Wie Grüner<br />
(1976) darlegte, bestand bis in die 50er Jahre hinein das Bestreben <strong>der</strong> Berufsschule<br />
weniger in <strong>der</strong> kooperativen Anbindung an die betriebliche Ausbildung,<br />
son<strong>der</strong>n primär in dem Streben nach Abgrenzung, Autonomie und Souveränität,<br />
denn nur so glaubte man sich als <strong>der</strong> weniger angesehene Teil <strong>der</strong> Ausbildung<br />
behaupten und einer vollständigen Vereinnahmung entziehen zu können. Erst in<br />
den 60er Jahren wurde <strong>der</strong> Systemcharakter des dualen Systems stärker betont,<br />
und die Berufsschule wurde zumindest formal zu einem „vollwertigen“ Bestandteil<br />
des Systems. In diesem Sinne wurde das Kooperationspostulat in dem Gutachten<br />
des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen<br />
(1964) in hervorgehobener Weise formuliert: „Der Erfolg des dualen Ausbildungssystems<br />
hängt davon ab, daß seine Träger, die Ausbildungsbetriebe und<br />
die beruflichen Schulen, zusammenwirken. Ein Gegeneinan<strong>der</strong> gefährdet die<br />
gemeinsame Sache. Auch ein Nebeneinan<strong>der</strong>, in dem je<strong>der</strong> sich damit begnügt,<br />
dem an<strong>der</strong>en seinen Zeitanteil an <strong>der</strong> Ausbildung zuzuerkennen, reicht nicht<br />
aus. Die Partner müssen – gestützt auf neue vertragliche, auch gesetzliche Rege-<br />
12
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
lungen – auf allen Ebenen zusammenarbeiten“ (Deutscher Ausschuss, 1966,<br />
S. 503).<br />
Auch wenn das Verhältnis <strong>der</strong> Lernorte Betrieb und Berufsschule im Berufsbildungsgesetz<br />
1969 weitgehend offen blieb, 1 so vollzieht sich seit dieser Zeit die<br />
Diskussion über den Zusammenhang <strong>der</strong> Lernorte unter dem Begriff <strong>der</strong> „<strong>Lernortkooperation</strong>“.<br />
In gewissem Sinne spannt sich eine „unendliche Geschichte“<br />
auf, die im roten Faden folgenden Handlungsablauf besitzt: Sobald bestimmte<br />
Problemlagen in <strong>der</strong> Berufsbildung diagnostiziert o<strong>der</strong> Reformvorstellungen verfolgt<br />
werden, wird auf einer programmatischen Ebene eine verbesserte <strong>Lernortkooperation</strong><br />
angemahnt. Auch wenn sich im Laufe <strong>der</strong> Zeit die Problembezüge<br />
gewandelt und die Zahl <strong>der</strong> Lernorte erhöht haben, so stellt die For<strong>der</strong>ung nach<br />
einer besseren <strong>Lernortkooperation</strong> eine berufsbildungspolitische Konstante dar.<br />
Und da die For<strong>der</strong>ungen über die Zeit nicht versiegen, ist bislang davon auszugehen,<br />
dass zwar immer wie<strong>der</strong> positive Einzelbeispiele einer gelungenen <strong>Lernortkooperation</strong><br />
aufgezeigt werden können, im Grundsatz aber keine nachhaltigen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen stattfinden.<br />
1.2. Notwendige Differenzierungen<br />
„<strong>Lernortkooperation</strong>“ ist in seinen beiden Konstituenten „Lernort“ und „Kooperation“<br />
eine gewisse Unschärfe zu attestieren. „Lernort“ wird üblicherweise in<br />
einem institutionellen Sinne verstanden, auch wenn dies nicht <strong>der</strong> ursprünglich<br />
intendierten Auffassung bei <strong>der</strong> Einführung des Begriffes entspricht (Schwiedrzik,<br />
1980, S. 7, 13). 2<br />
Entgegen <strong>der</strong> Umgangssprache ist festzuhalten, dass die<br />
„Lernorte“ Betrieb und Schule über mehrere „Orte“ verfügen können, an denen<br />
gelernt wird (z. B. Arbeitsplatz, Lehrwerkstatt, Lernbüro, Übungsfirma), weshalb<br />
1<br />
Im BBiG heißt es in § 1 Abs. 5 lediglich: „Berufsbildung wird durchgeführt in Betrieben <strong>der</strong> Wirtschaft,<br />
in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb <strong>der</strong> Wirtschaft, insbeson<strong>der</strong>e des öffentlichen<br />
Dienstes, <strong>der</strong> Angehörigen freier Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbildung) sowie in<br />
berufsbildenden Schulen und sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb <strong>der</strong> schulischen<br />
und betrieblichen Berufsbildung.“<br />
2<br />
„Unter Lernort ist eine im Rahmen des öffentlichen Bildungswesens anerkannte Einrichtung zu<br />
verstehen, die Lernangebote organisiert. Der Ausdruck ‚Ort’ besagt zunächst, dass das Lernen<br />
nicht nur zeitlich ..., son<strong>der</strong>n auch lokal geglie<strong>der</strong>t ist. Es handelt sich aber nicht allein um räumlich<br />
verschiedene, son<strong>der</strong>n in ihrer pädagogischen Funktion unterscheidbare Orte“ (Deutscher<br />
Bildungsrat, 1974, S. 69).<br />
13
Dieter Euler<br />
Schmiel (1976) auch von „Lernortbereichen“ spricht. 3 In vergleichbarer Systematisierungsabsicht<br />
wurde beispielsweise anstelle des Lernorts Betrieb eine „Typologie<br />
des Lernortes Arbeitsplatz nach dem Grade <strong>der</strong> Pädagogisierung“ vorgenommen<br />
(Münch et al., 1981). Dabei kann die Einbeziehung pädagogischer<br />
Sinnelemente in den Lernortbegriff als durchaus kontrovers beurteilt werden. So<br />
erkannte etwa Dörschel in <strong>der</strong> Verwendung des Begriffs „Lernort“ eine „pädagogische<br />
Sinnverarmung“ und die „Neutralisierung des Pädagogischen“ (Dörschel,<br />
1974, S. 25). Demgegenüber schlagen Kell und Kutscha die Ersetzung des Lernortbegriffs<br />
durch den des „Lernfeldes“ vor, „um die mit dem Ausdruck Lernort<br />
attribuierte Reduktion auf eine verengte räumliche o<strong>der</strong> organisatorische Betrachtungsweise<br />
zu vermeiden“ (Kell & Kutscha, 1983, S. 197).<br />
Ungeachtet dessen sei auf die Kritik von Beck am Lernortkonzept hingewiesen,<br />
<strong>der</strong> anführt, <strong>der</strong> allein interessierende „Ort des Lernens“ sei <strong>der</strong> Schüler/<br />
Auszubildende und daher müsse besser von Lehrortbereichen gesprochen werden,<br />
um überhaupt das duale System auf <strong>der</strong> didaktischen Ebene erfassen zu<br />
können (Beck, 1984, S. 258 f.).<br />
Ähnlich vielfältig sind die Bedeutungsgehalte des Begriffs „Kooperation“.<br />
Buschfeld (1994, S. 118–128, insb. S. 124) arbeitet unter Bezugnahme auf die<br />
betriebswirtschaftliche Organisationstheorie den Unterschied zwischen „Kooperation“<br />
(als „Zusammenarbeit mehrerer ‚Mitglie<strong>der</strong>’ auf Zeit in Erfüllung einer<br />
Aufgabe“) und „Koordination“ (als „das ‚Nebeneinan<strong>der</strong>-Arbeiten’ i. S. eines<br />
‚zerteilten Ganzen’ auf Dauer“) heraus. In diesem Sinne bedeutet Koordination<br />
die Ausrichtung von Einzelaufgaben auf ein übergeordnetes Gesamtziel in einem<br />
arbeitsteiligen System. Sie ermöglicht ein geordnetes Nebeneinan<strong>der</strong>arbeiten<br />
in beiden Teilsystemen, d. h., die verschiedenartigen Aufgaben sind aufeinan<strong>der</strong><br />
abgestimmt, werden aber im Prinzip isoliert nebeneinan<strong>der</strong> realisiert<br />
(Czycholl, 1998, S. 411). Auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Unterscheidung wären viele<br />
<strong>der</strong> unter <strong>Lernortkooperation</strong> gefassten Aufgaben und Probleme (z. B. Abstimmung<br />
<strong>der</strong> Ausbildungsinhalte) eigentlich Koordinationsaufgaben.<br />
Trotz seiner Unschärfen soll im Folgenden aus Gründen <strong>der</strong> alltagssprachlichen<br />
Verbreitung weiter mit dem Begriff <strong>der</strong> „<strong>Lernortkooperation</strong>“ gearbeitet<br />
werden. Kooperation kann unterschiedliche Ziele, Inhalte und in <strong>der</strong> Folge auch<br />
eine unterschiedliche Intensität besitzen. In <strong>der</strong> Literatur werden in diesem Zusammenhang<br />
unterschiedliche Begriffsdifferenzierungen vorgeschlagen.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Intensität von <strong>Lernortkooperation</strong> unterscheiden Buschfeld<br />
und Euler (1994, S. 10) die Stufen des Informierens, Abstimmens und Zusammenwirkens,<br />
wobei die zweite Stufe dem o. g. Koordinations-, die dritte Stufe<br />
hingegen dem Kooperationsverständnis (i. e. S.) entsprechen würde.<br />
3<br />
Die Frage <strong>der</strong> Dualität verweist so auf Pluralität (Münch, 1982, S. 82).<br />
14
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
• Auf <strong>der</strong> Ebene des Informierens tauschen Lehrer und Ausbil<strong>der</strong> Informationen<br />
aus, sie informieren sich gegenseitig über ihre Erwartungen, Erfahrungen<br />
und Probleme im Ausbildungsalltag. Informieren bedeutet dabei zweierlei:<br />
Informationen geben und Informationen wahr- und aufnehmen. Es ist<br />
nicht selbstverständlich, dass beispielsweise Rundschreiben <strong>der</strong> Berufsschule<br />
in Betrieben gelesen werden bzw. die eigentlichen Ausbildungsverantwortlichen<br />
(rechtzeitig) erreichen.<br />
• Auf <strong>der</strong> Ebene des Abstimmens vereinbaren und entwickeln Lehrer und Ausbil<strong>der</strong><br />
Maßnahmen, die sie arbeitsteilig und eigenverantwortlich unter den<br />
jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen umsetzen. Auch sich abzustimmen<br />
impliziert zweierlei: zum einen die Bereitschaft, sich an die getroffenen<br />
Vereinbarungen zu halten und damit den Konsens zu dokumentieren;<br />
zum an<strong>der</strong>en die Fähigkeit, auch Konflikte „auszuhalten“, etwa dann, wenn<br />
Absprachen nicht eingehalten werden konnten bzw. unterschiedliche Auffassungen<br />
getrennte Vorgehensweisen notwendig erscheinen lassen.<br />
• Auf <strong>der</strong> Ebene des Zusammenwirkens verfolgen Lehrer und Ausbil<strong>der</strong> im<br />
Rahmen einer unmittelbaren Zusammenarbeit gemeinsam vereinbarte Vorhaben.<br />
Sie richten ihr Handeln auf die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lernprozesse des Auszubildenden<br />
aus, z. B. wenn Ausbildungsthemen gemeinsam vorbereitet<br />
und in Betrieb und/o<strong>der</strong> Schule bearbeitet werden o<strong>der</strong> Lehrer und Ausbil<strong>der</strong><br />
gemeinsam ein Weiterbildungsseminar zur Vorbereitung eines gemeinsamen<br />
Projektes besuchen.<br />
Pätzold (1995, S. 150 f.) unterscheidet vier handlungsleitende Kooperationsverständnisse<br />
4 :<br />
• Beim pragmatisch-formalen Kooperationsverständnis gehen Kooperationsaktivitäten<br />
ausschließlich auf formale Veranlassung zurück, d. h., es wird<br />
kooperiert, weil es „von oben“ o<strong>der</strong> von außen vorgeschrieben wird.<br />
• Beim pragmatisch-utilitaristischen Kooperationsverständnis stützen sich die<br />
Kooperationsaktivitäten auf einen einseitig erfahrenen Bedarf, <strong>der</strong> über<br />
kooperatives Handeln befriedigt werden kann. Initiativen zur Lernortkoope-<br />
4<br />
In einer späteren Veröffentlichung wird deutlich, dass die vier unterschiedenen Verständnisse<br />
nicht nur deskriptiven Klassifikationszwecken dienen, son<strong>der</strong>n auch normative Präferenzen zum<br />
Ausdruck bringen. So werden die beiden erstgenannten Klassen weitgehend zur Beschreibung<br />
des Ist-Zustandes, die beiden letztgenannten zur Vorschreibung eines Soll-Zustandes aufgenommen.<br />
Dabei wird das Verständnis von <strong>Lernortkooperation</strong> <strong>der</strong> Erreichung eines angestrebten<br />
Bildungsziels untergeordnet, das im Einzelnen theoretisch expliziert wird. Vgl. im Einzelnen<br />
Pätzold, Drees & Thiele, 1998, S. 151 ff. (Kooperationsverständnis) sowie S. 82, 135, 166 (exemplarisch<br />
zur Verdeutlichung des verfolgten Bildungsverständnisses).<br />
15
Dieter Euler<br />
ration werden wahrgenommen, weil dadurch ein institutioneller und/o<strong>der</strong><br />
persönlicher Nutzen zu erwarten ist.<br />
• Das didaktisch-methodisch begründete Kooperationsverständnis stützt sich<br />
auf Entscheidungen und Einsichten, Konzepte beruflichen Lernens sinnvollerweise<br />
durch kooperatives Handeln verfolgen zu sollen.<br />
• Das bildungstheoretisch begründete Kooperationsverständnis nimmt das<br />
didaktisch-methodisch begründete Kooperationsverständnis in sich auf und<br />
stützt sich zusätzlich auf eine umfassende Bildungstheorie, aus <strong>der</strong> entsprechende<br />
Zielperspektiven für das gesellschaftliche Handeln abgeleitet werden.<br />
Neben den begrifflichen sind die substanziellen Kritikpunkte am Konzept <strong>der</strong><br />
<strong>Lernortkooperation</strong> von Bedeutung. So wird insbeson<strong>der</strong>e die Dualität als konstitutives<br />
Merkmal des Systems vielerorts in Frage gestellt, wenn behauptet<br />
wird, es handle sich bei den Lernorten Betrieb und Schule um Institutionen, die<br />
ihren eigenen Logiken verpflichtet seien. 5<br />
Zabeck spricht daher auch nicht von<br />
einem „dualen“, son<strong>der</strong>n von einem „dualistischen System“ und kennzeichnet<br />
dieses nicht über ein Miteinan<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n über ein Neben- bzw. Gegeneinan<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Lernorte: „Deshalb ist auch das Attribut „dual“ in Verbindung mit dem<br />
Substantiv „System“ fehl am Platze, denn es rekurriert auf „Dualität“, also das<br />
Prinzip <strong>der</strong> Zweiheit innerhalb eines im Einklang mit sich selbst befindlichen<br />
Ganzen, während es sich in Wirklichkeit hier um einen „Dualismus“ im Sinne einer<br />
mehr o<strong>der</strong> min<strong>der</strong> schroff auseinan<strong>der</strong>fallenden Zweiheit handelt“ (Zabeck,<br />
1996, S. 74; vgl. auch Deißinger, 1998, S. 95 ff.). Es ist dabei nicht zweifelsfrei,<br />
inwieweit Zabeck diese Aussage deskriptiv o<strong>der</strong> präskriptiv versteht. Kutscha<br />
vertritt in diesem Zusammenhang die These, dass die Entwicklungsfähigkeit des<br />
beruflichen Ausbildungssystems in Deutschland auf <strong>der</strong> Tatsache beruht, „daß<br />
das als Markenzeichen verwendete Merkmal <strong>der</strong> Dualität schon längst seine systemkonstituierende<br />
Qualität verloren hat ... Die Preisgabe <strong>der</strong> Dualität ist jenseits<br />
aller bildungspolitischen Beteuerungen geradezu die Voraussetzung dafür, daß<br />
sich das berufliche Ausbildungssystem unter sich verän<strong>der</strong>nden Umweltbedingungen<br />
dynamisch entfalten kann. Das gilt sowohl für die Ebene <strong>der</strong> Steuerung<br />
dieses Systems wie auch für die Organisation und didaktische Gestaltung<br />
<strong>der</strong> Lernorte“ (Kutscha, 1992, S. 10).<br />
5<br />
Stratenwerth hat schon 1959 auf die grundlegend unterschiedlichen normativen Anbindungen<br />
von schulischer und betrieblicher Ausbildung hingewiesen. Während die „schulgebundene Berufserziehung“<br />
dadurch bestimmt sei, „daß sie sich innerhalb eines pädagogischen Zweckgebildes<br />
vollzieht“, ereigne sich die „betriebsgebundene Erziehung“ in einem „Gebilde, dessen Zweck<br />
das Wirtschaften ist“ (Stratenwerth, 1959, S. 812).<br />
16
1.3. <strong>Lernortkooperation</strong> in historischer Betrachtung<br />
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
Bis Mitte <strong>der</strong> 60er Jahre wurde noch davon ausgegangen, dass sich die schulische<br />
und betriebliche Ausbildung im Rahmen eines „Gleichlauf-Curriculums“<br />
(Lipsmeier, 1987, S. 57 f.) miteinan<strong>der</strong> verbinden ließen, indem die Ausbildungsinhalte<br />
im Sinne einer „didaktischen Parallelität“ sowohl didaktisch als auch<br />
lehrmethodisch getrennt und den beiden Lernorten Betrieb (für die Praxis) und<br />
Berufsschule (für die Theorie) eindeutig inhaltlich und zeitlich zugeordnet würden.<br />
Diese Prämisse wurde weitgehend aufgegeben, wenngleich auch heute<br />
noch gelegentlich auf diese Vorstellungen Bezug genommen wird. Die traditionellen<br />
Ansätze einer <strong>Lernortkooperation</strong> konzentrierten sich in diesem Sinne im<br />
Wesentlichen auf Versuche, Formen <strong>der</strong> inhaltlichen Abstimmung zwischen <strong>der</strong><br />
betrieblichen und schulischen Ausbildung zu finden.<br />
Erste Ansätze einer systematischen Kooperation gab es Ende <strong>der</strong> 60er Jahre<br />
mit dem Modell des „Betriebsbezogenen Phasenunterrichts“ bei Siemens in<br />
München für die Ausbildung von Industriekaufleuten (Zedler, 1996, S. 113 f.).<br />
Dabei wurden die Lehrangebote von Betrieb und Schule in Blockform aufeinan<strong>der</strong><br />
abgestimmt. Die gesamte Ausbildungszeit wurde in fünf Phasen aufgeteilt,<br />
die den Grundfunktionen des Industriebetriebes entsprechen: Material-, Produktions-,<br />
Absatzwirtschaft, Kostenrechnung und Rechnungslegung. In jedem Ausbildungsabschnitt<br />
wurden den angehenden Industriekaufleuten zuerst die theoretischen<br />
Grundlagen, danach die entsprechende Berufspraxis vermittelt, nach<br />
einem Block des Vollzeitunterrichts in <strong>der</strong> Berufsschule folgte ein Block <strong>der</strong> Vollzeitunterweisung<br />
im Betrieb. Ein ähnliches Modell wurde später in Frankfurt erprobt<br />
(Kruse & Nahm, 1979).<br />
Über diese eher koordinativ ausgerichteten Ansätze hinaus beinhaltete ein<br />
Modellversuch in <strong>der</strong> Bauwirtschaft auch kooperative Elemente. Die Neuordnung<br />
<strong>der</strong> Ausbildungsberufe in <strong>der</strong> Bauwirtschaft führte 1974 mit <strong>der</strong> Einführung<br />
einer Stufenausbildung, <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong> Grundausbildung durch Berufsschule<br />
und überbetriebliche Ausbildungsstätte sowie <strong>der</strong> Einführung eines<br />
Blocksystems zu einem verän<strong>der</strong>ten Lernortgefüge, das eine Verständigung zwischen<br />
den Beteiligten als unumgänglich erscheinen ließ. Über die Einrichtung einer<br />
curricularen Arbeitsgruppe sowie einer integrierten Kontaktgruppe wurde<br />
<strong>der</strong> Rahmen geschaffen, um Inhalte abstimmen und ausbildungsbezogene Medien<br />
entwickeln zu können. Die Kooperationserfahrungen wurden während <strong>der</strong><br />
Laufzeit des Modellversuchs als „erfolgreich“ beurteilt. „Dennoch haben, trotz<br />
des guten Willens <strong>der</strong> Beteiligten und trotz aller Bemühungen um Verstetigung<br />
<strong>der</strong> Kooperation, nicht alle guten Vorsätze sich auf Dauer in kooperatives Handeln<br />
umsetzen lassen“ (Schwiedrzik, 1990, S. 26 f.). Ähnlich ernüchternd waren<br />
die Ergebnisse aus den beiden Modellversuchen „Curriculum Elektroinstallateur<br />
17
Dieter Euler<br />
im Handwerk“ und „Curriculum Bankkaufmann“, die zwischen 1973 und 1981<br />
durchgeführt wurden (Dauenhauer, 1975, 1978).<br />
Schon in einer 1979 veröffentlichten BIBB-Untersuchung wurden einige<br />
Grundaussagen deutlich, die in Folgeuntersuchungen bestätigt werden sollten:<br />
Zwar stellte keiner <strong>der</strong> befragten Ausbildenden die Nützlichkeit einer engeren<br />
Zusammenarbeit von Berufsschulen und Betrieben in Abrede, doch zeigte sich<br />
zum einen mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Befragten über den Berufsschulunterricht ihrer<br />
Auszubildenden unzureichend informiert, zum an<strong>der</strong>en bemühten sie sich<br />
nicht aktiv um den Erhalt entsprechen<strong>der</strong> Informationen (Franke & Kleinschmitt,<br />
1979, S. 40 ff.). „Ausbil<strong>der</strong> und Berufsschullehrer wissen vielfach zu wenig voneinan<strong>der</strong><br />
bzw. von den Bedingungen, unter denen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e seine Arbeit tut ...<br />
Lehrer und Ausbil<strong>der</strong> bedienen sich einer unterschiedlichen Sprache und entwickeln,<br />
bedingt durch die daraus resultierenden Verständigungsschwierigkeiten,<br />
sogar Ressentiments gegeneinan<strong>der</strong> ... Initiativen einzelner, die darauf abzielen,<br />
den Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Lernorten in Gang zu<br />
setzen, versickern, weil Konzepte fehlen, die in überschaubaren Zeiträumen zu<br />
sichtbaren und meßbaren Erfolgen führen“ (Schwiedrzik, 1980, S. 9 f.). Diese<br />
Ergebnisse werden empirisch gestützt durch inhaltsanalytische Auswertungen<br />
von Ausbildungsnachweisen durch Bunk et al. Für einzelne Ausbildungsberufe<br />
(z. B. den Fleischerberuf) dokumentieren die Analysen in nahezu drastischer<br />
Weise, dass sich die Auszubildenden in zwei Welten bewegen, die inhaltlich<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger zusammenhanglos nebeneinan<strong>der</strong> stehen (Bunk et al., 1989,<br />
S. 325 ff.). 6 Als „Abhilfe“ wurden seinerzeit beispielsweise Formen <strong>der</strong> aufeinan<strong>der</strong><br />
bezogenen Aus- und Weiterbildung vorgeschlagen sowie die Aufbereitung<br />
von Materialien, <strong>der</strong>en Nutzeffekte für die Ausbil<strong>der</strong> und Lehrkräfte offenbar<br />
sind (Schwiedrzik, 1980, S. 10 f.).<br />
Aus dem uneingelösten Ideal eines „Gleichlaufcurriculums“ wurde nur in<br />
Einzelfällen (zumeist im Kontext von Großbetrieben mit vollständigen Berufsschulklassen)<br />
ein „Abstimmungscurriculum“, eher traf <strong>der</strong> Begriff des „Autonomiecurriculums“<br />
die Realität des inhaltlichen Zusammenhangs zwischen den<br />
Lernorten. Die theoretischen Perspektiven konzentrierten sich auf Versuche, die<br />
spezifischen Leistungsvorteile einzelner Lernorte herauszuarbeiten, um daraus<br />
Hinweise und Kriterien für eine „optimale“ Zuweisung von Ausbildungsinhalten<br />
und -zielen auf die jeweils geeignetsten Lernorte zu erhalten (Deutscher Bildungsrat,<br />
1974, S. 69 f.; Münch, 1977; Lipsmeier, 1978.). Die mangelnde Überzeugungskraft<br />
<strong>der</strong> vorgeschlagenen Ansätze resultierte möglicherweise daraus,<br />
dass die Ausbildungsbedingungen in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen,<br />
6<br />
Weiter gehend heben die Autoren hervor, dass auch die Abstimmung innerhalb <strong>der</strong> Berufsschule<br />
zwischen den einzelnen Fächern bzw. Fachlehrern häufig ebenfalls zufällig und sporadisch<br />
verläuft.<br />
18
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
-branchen und Wirtschaftsbereichen nicht hinreichend berücksichtigt wurden<br />
und die entstandenen Theorien als zu undifferenziert im Hinblick auf die Ausbildungswirklichkeit<br />
wahrgenommen wurden. 7<br />
Rückblickend konstatiert Schwiedrzik für diese Zeit einen Gegensatz „zwischen<br />
dem allgemeinen Bekenntnis zur Nützlichkeit und Wünschbarkeit, ja Notwendigkeit<br />
<strong>der</strong> Kooperation zwischen den Lernorten des dualen Systems und<br />
<strong>der</strong> tatsächlichen Unverbundenheit <strong>der</strong> Ausbildung in <strong>der</strong> Berufsschule und in<br />
den Betrieben“ (Schwiedrzik, 1990, S. 17).<br />
1.4. <strong>Lernortkooperation</strong> in aktueller Betrachtung<br />
In den vergangenen Jahren erschien eine Vielzahl von Beiträgen, die Fragen <strong>der</strong><br />
<strong>Lernortkooperation</strong> an die übergreifenden Überlegungen zur Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
des dualen Systems angebunden haben. „Die Kooperation <strong>der</strong> Lernorte ist eine<br />
wesentliche Voraussetzung für die Steigerung <strong>der</strong> Leistungsfähigkeit des dualen<br />
Systems“ (KMK, 1997, S. 8). Solche o<strong>der</strong> ähnlich formulierte Aussagen finden<br />
wir seit etwa einem Jahrzehnt in vielen programmatischen Beiträgen über das<br />
duale System. Und sie finden eine große und breite Zustimmung – solange die<br />
Überlegungen im Grundsatz verharren und die zugrunde liegenden Ziele ungeklärt<br />
bleiben. Auch wenn es vor<strong>der</strong>gründig häufig den Anschein hat, dass <strong>Lernortkooperation</strong><br />
ein Selbstzweck ist, so ist doch weithin unbestritten, dass sie nur<br />
eine instrumentelle Funktion zur Erreichung weiter gehen<strong>der</strong> Ziele wahrnehmen<br />
kann.<br />
Viele Beiträge bleiben hinsichtlich ihrer Zielausweisung eher allgemein. Unter<br />
systematischen Kriterien können dabei berufsbildungspolitische und didaktische<br />
Zielanbindungen unterschieden werden.<br />
Berufsbildungspolitische Zielanbindungen verlaufen <strong>der</strong>zeit in drei Richtungen:<br />
• In einer Ausrichtung wird <strong>Lernortkooperation</strong> als eine Voraussetzung zur<br />
Rationalisierung des dualen Systems verstanden: Über eine verbesserte Abstimmung<br />
<strong>der</strong> Ausbildungsinhalte in den Lernorten sollen Dubletten vermieden,<br />
sachliche und personelle Ausbildungsressourcen effektiver genutzt, die<br />
7<br />
Der Gedanke <strong>der</strong> Aufteilung von Ausbildungsinhalten auf den jeweils „geeignetsten“ Lernort<br />
wird auch heute wie<strong>der</strong> vorgetragen, wenngleich die Aufteilung nicht bundesweit nach theoretischen<br />
Kriterien, son<strong>der</strong>n regional aufgrund von diskursiven Abstimmungen in regionalen<br />
Netzwerken erfolgen soll.<br />
19
Dieter Euler<br />
Lernprozesse konzentriert und beschleunigt und die Ausbildungszeit auf<br />
diese Weise insgesamt verkürzt werden.<br />
• Eine an<strong>der</strong>e Ausrichtung versteht <strong>Lernortkooperation</strong> als eine Bedingung<br />
zur Deregulierung des dualen Systems sowie einer stärkeren Verlagerung<br />
<strong>der</strong> Entscheidungskompetenzen und Verantwortung auf regionale Netzwerke<br />
und Absprachen vor Ort. Dahinter steht die Feststellung, dass die<br />
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne in immer kürzeren Zeiträumen<br />
revisionsbedürftig sind, sowie die Vorstellung, dass die bislang starren<br />
Ordnungsvorgaben verstärkt flexibel disponierbare Teile besitzen sollten, die<br />
etwa im Rahmen eines zu entwickelnden regionalen bzw. kommunalen Berufsbildungsdialogs<br />
konkretisiert werden.<br />
• Schließlich wird <strong>Lernortkooperation</strong> in Zeiten des Ausbildungsstellenmangels<br />
als ein Instrument gesehen, die betrieblichen Ausbildungsressourcen<br />
vor Ort im Rahmen eines regionalen Ausbildungsmanagements besser auszuschöpfen<br />
und auf diese Weise zur Erhöhung des Ausbildungsstellenangebots<br />
beizutragen.<br />
Im Rahmen einer didaktischen Zielanbindung wird <strong>Lernortkooperation</strong> als ein<br />
Mittel zur effektiven Gestaltung von handlungs- und transferorientierten Lehr-<br />
Lern-Prozessen in Schule und Betrieb verstanden. Ausgehend von <strong>der</strong> Prämisse,<br />
dass im Rahmen einer handlungsorientierten Didaktik sowohl in <strong>der</strong> schulischen<br />
als auch in <strong>der</strong> betrieblichen Ausbildung Theorie- und Praxisanteile miteinan<strong>der</strong><br />
zu verzahnen sind, ergibt sich ein Koordinationsbedarf im Hinblick auf die Frage,<br />
auf welche inhaltlichen Aufgaben- und Problemstellungen die Ausbildungsschwerpunkte<br />
innerhalb und zwischen den Lernorten bezogen werden sollen.<br />
Und unter <strong>der</strong> Zielsetzung, dass die Ausbildungsinhalte an authentischen Praxisproblemen<br />
ausgerichtet sein sollen, begründet sich insbeson<strong>der</strong>e für die Berufsschule<br />
ein erhöhter Koordinationsbedarf, um den Praxisbezug über die Betriebe<br />
zu erschließen und zu sichern.<br />
Die aktuelle berufsbildungspolitische Bedeutung <strong>der</strong> <strong>Lernortkooperation</strong> ist<br />
nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass für den Zeitraum von 1999 bis 2003<br />
von <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
(BLK) ein Modellversuchsprogramm „Kooperation <strong>der</strong> Lernorte in <strong>der</strong> beruflichen<br />
Bildung (KOLIBRI)“ aufgelegt wurde. In diesem Programm werden insgesamt<br />
27 Modellversuche geför<strong>der</strong>t und wissenschaftlich begleitet. Grundlage für<br />
das Modellversuchsprogramm waren fünf Maßnahmenbereiche, <strong>der</strong>en Profilierung<br />
sich auf eine umfangreiche Auswertung von Modellversuchen stützt, die<br />
zwischen 1990 und 1997 zu Fragen <strong>der</strong> <strong>Lernortkooperation</strong> durchgeführt worden<br />
sind (Euler et al., 1999). Als Maßnahmenbereiche mit einem beson<strong>der</strong>s großen<br />
Untersuchungsbedarf wurden die folgenden Fel<strong>der</strong> herausgearbeitet:<br />
20
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
1. Entwicklung von kooperativen Konzepten zur Curriculumpräzisierung „vor<br />
Ort“ sowie von Instrumenten zur ausbildungsprozessbegleitenden Beurteilung<br />
von Methoden- und Sozialkompetenzen.<br />
2. Entwicklung von ordnungspolitisch kompatiblen Modulkonzepten mit Verbindungen<br />
zur beruflichen Weiterbildung.<br />
3. Integration und didaktische Gestaltung von Praxisbezügen in vollzeitschulischen<br />
Ausbildungsgängen.<br />
4. Lernortübergreifende Entwicklung von För<strong>der</strong>ansätzen zur Sicherung des<br />
Ausbildungserfolgs von beson<strong>der</strong>en Zielgruppen.<br />
5. Entwicklung <strong>der</strong> institutionellen und personellen Bedingungen zur Intensivierung<br />
und Verstetigung von <strong>Lernortkooperation</strong>.<br />
Das Programm führte nicht nur zu neuen Gestaltungsimpulsen zur Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> <strong>Lernortkooperation</strong>, son<strong>der</strong>n auch zu neuen empirischen Befunden.<br />
Viele <strong>der</strong> in diesem Programm entstandenen Untersuchungen werden in<br />
einzelnen Kapiteln dieses <strong>Handbuch</strong>s aufgenommen und dargestellt. Inwieweit<br />
die „unendliche Geschichte“ damit nur eine neue Fortsetzungsfolge bekommen<br />
hat o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Start in eine neue Qualität eingeläutet werden konnte – dies wird<br />
erst einige Zeit nach dem Ende des Programms zu beurteilen sein!<br />
1.5. Literaturverzeichnis<br />
Beck, K. (1984). Zur Kritik des Lernortkonzeptes – Ein Plädoyer für die Verabschiedung<br />
einer untauglichen pädagogischen Idee. In W. Georg (Hrsg.),<br />
Schule und Berufsausbildung. Gustav Grüner zum 60. Geburtstag<br />
(S. 247–262). Bielefeld.<br />
BMBF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie<br />
(Hrsg.) (1997). Reformprojekt Berufliche Bildung (April). Bonn.<br />
Bunk, G. u. a. (1989). Organisationsformen beruflicher Anfangsausbildung im<br />
Vergleich. Mainz.<br />
Buschfeld, D. (1994). Kooperation an kaufmännischen Berufsschulen – eine wirtschaftspädagogische<br />
Studie. Köln.<br />
Buschfeld, D. & Euler, D. (1994). Antworten, die eigentlich Fragen sind – Überlegungen<br />
zur Kooperation <strong>der</strong> Lernorte. In Berufsbildung in Wissenschaft<br />
und Praxis. Heft 2, S. 9–13.<br />
21
Dieter Euler<br />
Czycholl, R. (1998). Kritische Anmerkungen zum Postulat <strong>der</strong> <strong>Lernortkooperation</strong><br />
in <strong>der</strong> Lehrerbildung für berufliche Schulen. In D. Euler (Hrsg.), Berufliches<br />
Lernen im Wandel – Konsequenzen für die Lernorte?, BeitrAB 214<br />
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung <strong>der</strong> Bundesanstalt für<br />
Arbeit (S. 405–414). Nürnberg.<br />
Dauenhauer, E. (1975). Curriculum Elektroinstallateur im Handwerk. Ein empirischer<br />
Entwurf zur Erprobung an den Lernorten Schule, Betrieb und überbetriebliche<br />
Lehrwerkstatt, Kultusministerium Rheinland-Pfalz, Berichte<br />
und Materialien. Bd. 8. Mainz.<br />
Dauenhauer, E. (1978). Curriculum Bankkaufmann. Ein empirisches Lehr-Lern-<br />
System für die Erprobung in <strong>der</strong> Sekundarstufe II, Kultusministerium<br />
Rheinland-Pfalz, Berichte und Materialien. Bd. 18. Mainz.<br />
Deißinger, T. (1998). Beruflichkeit als „organisierendes Prinzip“ <strong>der</strong> deutschen<br />
Berufsausbildung. Markt Schwaben.<br />
Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (1966). Gutachten<br />
über das berufliche Ausbildungs- und Schulwesen v. 10. Juli 1964. In<br />
Deutscher Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen, Empfehlungen<br />
und Gutachten, 1953–1965, zusammengestellt von H. Bohnenkamp,<br />
W. Dirks & D. Knab (S. 413–515). Stuttgart.<br />
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.) (1974). Gutachten und Studien <strong>der</strong> Bildungskommission,<br />
Bd. 38: Die Bedeutung verschiedener Lernorte in <strong>der</strong> beruflichen<br />
Bildung. Stuttgart.<br />
Döring, O. & Stahl, T. (1998). Innovation durch <strong>Lernortkooperation</strong>. Bielefeld.<br />
Dörschel, A. (1974). Bemerkungen zur politischen Dimension einer berufspädagogischen<br />
Reform. In Zeitschrift für Berufsbildungsforschung. Heft 3,<br />
S. 25–26.<br />
Euler, D. (1996). <strong>Lernortkooperation</strong> als Mittel zur För<strong>der</strong>ung von Transferkompetenz<br />
– Ansichten, Absichten und Aussichten. In Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
(Hrsg.), <strong>Lernortkooperation</strong> und Abgrenzung <strong>der</strong> Funktionen<br />
von Betrieb und Berufsschule (S. 183–205). Bielefeld.<br />
Euler, D. (1998). Mo<strong>der</strong>nisierung des dualen Systems – Problembereiche,<br />
Reformvorschläge, Konsens- und Dissenslinien −, Untersuchung im Auftrag<br />
<strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför<strong>der</strong>ung.<br />
Nürnberg 1998.<br />
Euler, D. & Berger, K. et al. (1999). Kooperation <strong>der</strong> Lernorte im dualen System<br />
<strong>der</strong> Berufsausbildung, Bericht über eine Auswertung von Modellversu-<br />
22
1. <strong>Lernortkooperation</strong> – eine unendliche Geschichte?<br />
chen für die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und<br />
Forschung. Nürnberg, Berlin, Bonn.<br />
Euler, D. & Twardy, M. (1991). Duales System o<strong>der</strong> Systemdualität – Überlegungen<br />
zu einer Intensivierung <strong>der</strong> <strong>Lernortkooperation</strong>. In M. Twardy (Hrsg.),<br />
Duales System zwischen Tradition und Innovation (S. 197–221). Köln.<br />
Franke, G. & Kleinschmitt, M. (1979). Das Blocksystem in <strong>der</strong> dualen Berufsausbildung,<br />
Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 19. Berlin.<br />
Grüner, G. (1976). Koordination betrieblicher und schulischer Ausbildung als<br />
Hauptproblem <strong>der</strong> Curricula <strong>der</strong> Teilzeit-Berufsschule. In Die berufsbildende<br />
Schule. Heft 1, S. 14−22.<br />
Kell, A. & Kutscha, G. (1983). Integration durch Differenzierung <strong>der</strong> „Lernorte“?<br />
– Theoretische und praktische Aspekte <strong>der</strong> Lernortproblematik im Modellversuch<br />
Kollegschule Nordrhein-Westfalen. In H. J. Ruhland et al.<br />
(Hrsg.), Berufliche Sozialisation in <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit verschiedenen<br />
Lernorten (S. 192–231). Krefeld.<br />
KMK – Kultusministerkonferenz (1997). Weiterentwicklung des dualen Systems<br />
<strong>der</strong> Berufsausbildung. Thesen und Diskussionsvorschläge <strong>der</strong> KMK (April).<br />
Bonn.<br />
Kruse, J. & Nahm, K. (1979). Phasenausbildung – ein Erfahrungsbericht zur Weiterentwicklung<br />
beruflicher Bildung. Köln.<br />
Kutscha, G. (1992). Die Zukunft des Dualen Systems – eine Situationsanalyse. In<br />
Kuratorium <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft für Berufsbildung: Lernen am<br />
Arbeitsplatz – Veranstaltungsbericht (S. 9–15). Bonn.<br />
Lipsmeier, A. (1978). Organisation und Lernorte <strong>der</strong> Berufsausbildung. München.<br />
Lipsmeier, A. (1987). Neue Technologien, Technikwissenschaft und Technikdidaktik<br />
in ihrer Relevanz für eine Didaktik beruflichen Lernens. In Verbände<br />
<strong>der</strong> Lehrer an beruflichen Schulen und Kollegschulen in NW<br />
(Hrsg.), Berufliche Schulen – Multiplikatoren technologischer Innovation<br />
(S. 42–76). Frankfurt/M. u. a.<br />
Münch, J. (1977). Pluralität <strong>der</strong> Lernorte – Vorüberlegungen zu einer Theorie. In<br />
J. Münch (Hrsg.), Lernen – aber wo? Der Lernort als pädagogisches und<br />
lernorganisatorisches Problem (S. 177–187). Trier.<br />
23
Dieter Euler<br />
Münch, J. (1982). Das berufliche Bildungswesen in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland.<br />
In CEDEFOP (Hrsg.), Das berufliche Bildungswesen in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
Deutschland. Luxemburg.<br />
Münch, J. et al. (1981). Organisationsformen betrieblichen Lernens und ihr<br />
Einfluß auf Ausbildungsergebnisse. Berlin.<br />
Pätzold, G. (1995). Kooperation des Lehr- und Ausbildungspersonals in <strong>der</strong> beruflichen<br />
Bildung – Berufspädagogische Begründungen, Bilanz, Perspektiven.<br />
In G. Pätzold & G. Walden (Hrsg.), Lernorte im dualen System <strong>der</strong><br />
Berufsbildung (S. 143–166). Berlin, Bonn.<br />
Pätzold, G. & Drees, G. & Thiele, H. (1995). <strong>Lernortkooperation</strong> und neue Qualifikationen.<br />
In G. Pätzold & G. Walden (Hrsg.), Lernorte im dualen System<br />
<strong>der</strong> Berufsbildung (S. 431–450). Berlin, Bonn.<br />
Schmiel, M. (1976). Berufspädagogik, Teil I, Grundlagen. Trier.<br />
Schwiedrzik, B. (1980). Kooperation und Blocksystem, Berichte zur beruflichen<br />
Bildung. Heft 31. Berlin.<br />
Schwiedrzik, B. (1990). Bedingungen <strong>der</strong> Zusammenarbeit von Ausbil<strong>der</strong>n und<br />
Berufsschullehrern. In G. Pätzold (Hrsg.), <strong>Lernortkooperation</strong> (S. 15–30).<br />
Heidelberg.<br />
Stratenwerth, W. (1959). „Betriebsgebundene“ und „schulgebundene“ Berufserziehung.<br />
Eine Analyse <strong>der</strong> Begriffe. In Die Deutsche Berufs- und Fachschule.<br />
Heft 10, S. 810–822.<br />
Zabeck, J. (1996). Die dualistische deutsche Berufsausbildung als wissenschaftliche<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung. In W. Seyd & R. Witt (Hrsg.), Situation – Handlung<br />
– Persönlichkeit, Festschrift für Lothar Reetz (S. 71–86). Hamburg.<br />
Zedler, R. (1995). Berufsschule – Partner <strong>der</strong> Ausbildungsbetriebe. Ergebnisse<br />
einer Betriebsbefragung des Instituts <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft Köln. In<br />
G. Pätzold & G. Walden (Hrsg.), Lernorte im dualen System <strong>der</strong> Berufsbildung<br />
(S. 181–192). Berlin, Bonn.<br />
Zedler, R. (1996). Kooperation mit <strong>der</strong> Berufsschule – aus Sicht <strong>der</strong> Betriebe.<br />
In Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), <strong>Lernortkooperation</strong> und Abgrenzung<br />
<strong>der</strong> Funktionen von Betrieb und Berufsschule (S. 109–121).<br />
Bielefeld.<br />
Zedler, R. & Koch, R. (1992). Berufsschule – Partner <strong>der</strong> Ausbildungsbetriebe,<br />
Ergebnisse einer Unternehmensumfrage. Köln.<br />
24