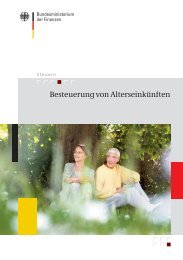37 SGB V - Häusliche Krankenpflege - Eureka24.de
37 SGB V - Häusliche Krankenpflege - Eureka24.de
37 SGB V - Häusliche Krankenpflege - Eureka24.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sozialgesetzbuch (<strong>SGB</strong>) Fünftes Buch (V) –<br />
Gesetzliche Krankenversicherung –<br />
(<strong>SGB</strong> V)<br />
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477)<br />
Folgende Änderungen sind berücksichtigt:<br />
– G. v. 22.03.1991 (BGBl. I S. 792)<br />
– G. v. 21.08.1995 (BGBl. I S. 1050)<br />
– G. v. 04.12.1995 (BGBl. I S. 1558)<br />
– G. v. 15.12.1995 (BGBl. I S. 1726)<br />
– G. v. 15.12.1995 (BGBl. I S. 1809)<br />
– G. v. 18.12.1995 (BGBl. I S. 1986)<br />
– G. v. 18.12.1995 (BGBl. I S. 1987)<br />
– G. v. 21.12.1992 (BGBl. I S. 2267)<br />
– G. v. 14.06.1996 (BGBl. I S. 830)<br />
– G. v. 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254)<br />
– G. v. 28.10.1996 (BGBl. I S. 1558)<br />
– G. v. 28.10.1996 (BGBl. I S. 1559)<br />
– G. v. 01.11.1996 (BGBl. I S. 1631)<br />
– G. v. 12.12.1996 (BGBl. I S. 1859); In-Kraft-Treten 01.01.1997<br />
– G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594); In-Kraft-Treten 01.01.1998<br />
– G. v. 23.06.1997 (BGBl. I S. 1518); In-Kraft-Treten 01.07.1997 / 01.09.1997<br />
– G. v. 23.06.1997 (BGBl. I S. 1520); In-Kraft-Treten 01.07.1997 / 01.01.1997 /<br />
01.01.1998 / 15.11.1996<br />
– G. v. 21.09.1997 (BGBl. I S. 2390); In-Kraft-Treten 14.10.1997<br />
– G. v. 05.11.1997 (BGBl. I S. 2631); In-Kraft-Treten 01.12.1997<br />
– G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2970); In-Kraft-Treten 01.01.1998 / 01.04.1998<br />
– G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998, 1998 S. 3843, 2000 S. 1827); In-Kraft-Treten<br />
01.07.1998 / 01.01.1999 / 01.01.2001<br />
– G. v. 17.12.1997 (BGBl. I S. 3108); In-Kraft-Treten 24.12.1997<br />
– G. v. 03.01.1998 (BGBl. I S. 38); In-Kraft-Treten 03.01.1998<br />
– G. v. 24.03.1998 (BGBl. I S. 526); In-Kraft-Treten 28.03.1998 / 01.01.1999<br />
– G. v. 06.04.1998 (BGBl. I S. 688); In-Kraft-Treten 01.01.1998<br />
– G. v. 08.05.1998 (BGBl. I S. 907, S. 3853); In-Kraft-Treten 01.01.1999<br />
– G. v. 16.06.1998 (BGBl. I S. 1311); In-Kraft-Treten 24.06.1998 / 01.01.1999<br />
– G. v. 06.08.1998 (BGBl. I S. 2005); In-Kraft-Treten 12.08.1998<br />
– G. v. 19.12.1998 (BGBl. I S. 3853); In-Kraft-Treten 01.01.1999<br />
– G. v. 24.03.1999 (BGBl. I S. 388); In-Kraft-Treten 01.04.1999<br />
– G. v. 21.07.1999 (BGBl. I S. 1648); In-Kraft-Treten 01.08.1999<br />
– G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2534); In-Kraft-Treten 01.01.2000<br />
– G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626, 2002 S. 684); In-Kraft-Treten 01.01.2000 /<br />
01.07.2000 / 01.01.2001 / 01.01.2006<br />
– G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2657); In-Kraft-Treten 01.01.2000 / 01.01.2001<br />
– G. v. 30.11.2000 (BGBl. I S. 1638); In-Kraft-Treten 02.01.2001<br />
– G. v. 19.12.2000 (BGBl. I S. 1815); In-Kraft-Treten 24.12.2000<br />
– G. v. 20.12.2000 (BGBl. I S. 1827); In-Kraft-Treten 01.01.2001<br />
– G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1971); In-Kraft-Treten 22.06.2000 / 01.01.2001<br />
– G. v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266); In-Kraft-Treten 01.08.2001<br />
– G. v. 21.03.2001 (BGBl. I S. 403); In-Kraft-Treten 01.01.2001 / 27.03.2001<br />
– G. v. 13.06.2001 (BGBl. I S. 1027); In-Kraft-Treten 01.07.2001 / 01.01.2002<br />
– G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046); In-Kraft-Treten 01.07.2001<br />
– G. v. 27.07.2001 (BGBl. I S. 1946); In-Kraft-Treten 01.01.2002<br />
– G. v. 27.07.2001 (BGBl. I S. 1948); In-Kraft-Treten 03.08.2001
<strong>SGB</strong> V<br />
nicht widerspricht. 2Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen, sofern<br />
das Arzneimittel auf Grund arzneimittelrechtlicher Vorschriften vom pharmazeutischen<br />
Unternehmer kostenlos bereitzustellen ist. 3Der Gemeinsame Bundesausschuss ist<br />
mindestens zehn Wochen vor dem Beginn der Arzneimittelverordnung zu informieren;<br />
er kann innerhalb von acht Wochen nach Eingang der Mitteilung widersprechen, sofern<br />
die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllt sind. 4Das Nähere, auch zu den Nachweisen<br />
und Informationspflichten, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in den<br />
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. 5Leisten Studien nach Satz 1 für die Erweiterung<br />
einer Zulassung einen entscheidenden Beitrag, hat der pharmazeutische Unternehmer<br />
den Krankenkassen die Verordnungskosten zu erstatten. 6Dies gilt auch<br />
für eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nach europäischem Recht.<br />
§ 36 Festbeträge für Hilfsmittel<br />
(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt Hilfsmittel, für die Festbeträge<br />
festgesetzt werden. 2Dabei sollen unter Berücksichtigung des Hilfsmittelverzeichnisses<br />
nach § 139 in ihrer Funktion gleichartige und gleichwertige Mittel in<br />
Gruppen zusammengefasst und die Einzelheiten der Versorgung festgelegt werden.<br />
3Den Spitzenorganisationen der betroffenen Hersteller und Leistungserbringer ist unter<br />
Übermittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen<br />
Frist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen<br />
sind in die Entscheidung einzubeziehen.<br />
(2) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen setzt für die Versorgung mit den<br />
nach Absatz 1 bestimmten Hilfsmitteln einheitliche Festbeträge fest. 2Absatz 1 Satz 3<br />
gilt entsprechend. 3Die Hersteller und Leistungserbringer sind verpflichtet, dem Spitzenverband<br />
Bund der Krankenkassen auf Verlangen die zur Wahrnehmung der Aufgaben<br />
nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 1 und 2 erforderlichen Informationen und<br />
Auskünfte, insbesondere auch zu den Abgabepreisen der Hilfsmittel, zu erteilen.<br />
(3) § 35 Abs. 5 und 7 gilt entsprechend.<br />
§ <strong>37</strong> <strong>Häusliche</strong> <strong>Krankenpflege</strong><br />
§ 36<br />
(1) 1Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten<br />
Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei<br />
besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben<br />
der ärztlichen Behandlung häusliche <strong>Krankenpflege</strong> durch geeignete Pflegekräfte,<br />
wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch<br />
die häusliche <strong>Krankenpflege</strong> vermieden oder verkürzt wird. 2§ 10 der Werkstättenverordnung<br />
bleibt unberührt. 3Die häusliche <strong>Krankenpflege</strong> umfaßt die im Einzelfall erforderliche<br />
Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung. 4Der<br />
Anspruch besteht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall. 5In begründeten Ausnahmefällen<br />
kann die Krankenkasse die häusliche <strong>Krankenpflege</strong> für einen längeren Zeitraum bewilligen,<br />
wenn der Medizinische Dienst (§ 275) festgestellt hat, daß dies aus den in<br />
Satz 1 genannten Gründen erforderlich ist.<br />
(2) 1Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten<br />
Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei<br />
besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen als<br />
häusliche <strong>Krankenpflege</strong> Behandlungspflege, wenn diese zur Sicherung des Ziels der<br />
ärztlichen Behandlung erforderlich ist; der Anspruch umfasst verrichtungsbezogene<br />
krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den Fällen, in denen dieser Hilfebedarf<br />
bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches<br />
zu berücksichtigen ist. 2§ 10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. 3Der Anspruch<br />
nach Satz 1 besteht über die dort genannten Fälle hinaus ausnahmsweise auch<br />
für solche Versicherte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des<br />
Elften Buches, die auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, einen be-<br />
41
<strong>SGB</strong> V<br />
sonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben. 4Die Satzung kann<br />
bestimmen, dass die Krankenkasse zusätzlich zur Behandlungspflege nach Satz 1 als<br />
häusliche <strong>Krankenpflege</strong> auch Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung erbringt.<br />
5Die Satzung kann dabei Dauer und Umfang der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen<br />
Versorgung nach Satz 4 bestimmen. 6Leistungen nach den Sätzen 4 und 5 sind<br />
nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit im Sinne des Elften Buches nicht zulässig. 7Versicherte,<br />
die nicht auf Dauer in Einrichtungen nach § 71 Abs. 2 oder 4 des Elften Buches<br />
aufgenommen sind, erhalten Leistungen nach Satz 1 und den Sätzen 4 bis 6 auch<br />
dann, wenn ihr Haushalt nicht mehr besteht und ihnen nur zur Durchführung der Behandlungspflege<br />
vorübergehender Aufenthalt in einer Einrichtung oder in einer anderen<br />
geeigneten Unterkunft zur Verfügung gestellt wird.<br />
(3) Der Anspruch auf häusliche <strong>Krankenpflege</strong> besteht nur, soweit eine im Haushalt<br />
lebende Person den Kranken in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen und versorgen<br />
kann.<br />
(4) Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche <strong>Krankenpflege</strong> stellen oder<br />
besteht Grund, davon abzusehen, sind den Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte<br />
Kraft in angemessener Höhe zu erstatten.<br />
(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung den<br />
sich nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertage<br />
der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr anfallenden Kosten an die Krankenkasse.<br />
(6) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in Richtlinien nach § 92 fest, an welchen<br />
Orten und in welchen Fällen Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 auch außerhalb<br />
des Haushalts und der Familie des Versicherten erbracht werden können. 2Er bestimmt<br />
darüber hinaus das Nähere über Art und Inhalt der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen<br />
Pflegemaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1.<br />
§ <strong>37</strong>a Soziotherapie<br />
(1) 1Versicherte, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind,<br />
ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen,<br />
haben Anspruch auf Soziotherapie, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden<br />
oder verkürzt wird oder wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist. 2Die Soziotherapie<br />
umfasst im Rahmen des Absatzes 2 die im Einzelfall erforderliche Koordinierung<br />
der verordneten Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren Inanspruchnahme.<br />
3Der Anspruch besteht für höchstens 120 Stunden innerhalb von drei Jahren je<br />
Krankheitsfall.<br />
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 das<br />
Nähere über Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung nach Absatz 1, insbesondere<br />
1. die Krankheitsbilder, bei deren Behandlung im Regelfall Soziotherapie erforderlich<br />
ist,<br />
2. die Ziele, den Inhalt, den Umfang, die Dauer und die Häufigkeit der Soziotherapie,<br />
3. die Voraussetzungen, unter denen Ärzte zur Verordnung von Soziotherapie<br />
berechtigt sind,<br />
4. die Anforderungen an die Therapiefähigkeit des Patienten,<br />
§ <strong>37</strong>a<br />
5. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem<br />
Leistungserbringer.<br />
(3) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung je Kalendertag<br />
der Leistungsinanspruchnahme den sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrag<br />
an die Krankenkasse.<br />
42
<strong>SGB</strong> V<br />
§ <strong>37</strong>b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung<br />
(1) 1Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen<br />
Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige<br />
Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung.<br />
2Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.<br />
3Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische<br />
Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und<br />
Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1<br />
in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Bereichs zu ermöglichen;<br />
hierzu zählen beispielsweise Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte<br />
Menschen und der Kinder- und Jugendhilfe. 4Versicherte in stationären Hospizen haben<br />
einen Anspruch auf die Teilleistung der erforderlichen ärztlichen Versorgung im Rahmen<br />
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. 5Dies gilt nur, wenn und soweit<br />
nicht andere Leistungsträger zur Leistung verpflichtet sind. 6Dabei sind die besonderen<br />
Belange von Kindern zu berücksichtigen.<br />
(2) 1Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 72 Abs. 1 des Elften<br />
Buches haben in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 einen Anspruch auf<br />
spezialisierte Palliativversorgung. 2Die Verträge nach § 132d Abs. 1 regeln, ob die<br />
Leistung nach Absatz 1 durch Vertragspartner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung<br />
oder durch Personal der Pflegeeinrichtung erbracht wird; § 132d Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 bis zum<br />
30. September 2007 das Nähere über die Leistungen, insbesondere<br />
1. die Anforderungen an die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 1 sowie an den<br />
besonderen Versorgungsbedarf der Versicherten,<br />
2. Inhalt und Umfang der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung einschließlich<br />
von deren Verhältnis zur ambulanten Versorgung und der Zusammenarbeit<br />
der Leistungserbringer mit den bestehenden ambulanten Hospizdiensten<br />
und stationären Hospizen (integrativer Ansatz); die gewachsenen<br />
Versorgungsstrukturen sind zu berücksichtigen,<br />
3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem<br />
Leistungserbringer.<br />
§ 38 Haushaltshilfe<br />
§ <strong>37</strong>b<br />
(1) 1Versicherte erhalten Haushaltshilfe, wenn ihnen wegen Krankenhausbehandlung<br />
oder wegen einer Leistung nach § 23 Abs. 2 oder 4, §§ 24, <strong>37</strong>, 40 oder § 41 die<br />
Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. 2Voraussetzung ist ferner, daß im<br />
Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch<br />
nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.<br />
(2) 1Die Satzung kann bestimmen, daß die Krankenkasse in anderen als den in Absatz 1<br />
genannten Fällen Haushaltshilfe erbringt, wenn Versicherten wegen Krankheit die<br />
Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. 2Sie kann dabei von Absatz 1 Satz 2<br />
abweichen sowie Umfang und Dauer der Leistung bestimmen.<br />
(3) Der Anspruch auf Haushaltshilfe besteht nur, soweit eine im Haushalt lebende<br />
Person den Haushalt nicht weiterführen kann.<br />
(4) 1Kann die Krankenkasse keine Haushaltshilfe stellen oder besteht Grund, davon<br />
abzusehen, sind den Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe<br />
in angemessener Höhe zu erstatten. 2Für Verwandte und Verschwägerte bis zum<br />
zweiten Grad werden keine Kosten erstattet; die Krankenkasse kann jedoch die erforderlichen<br />
Fahrkosten und den Verdienstausfall erstatten, wenn die Erstattung in einem<br />
angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine Ersatzkraft entstehenden Kosten steht.<br />
43