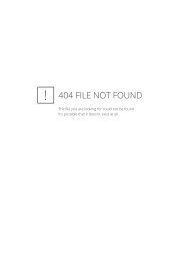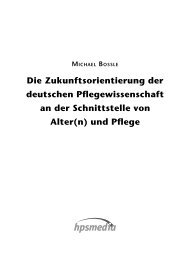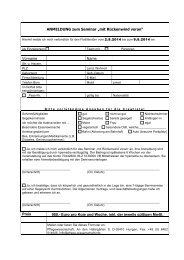Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...
Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...
Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anh<strong>an</strong>g<br />
<strong>Die</strong> <strong>Zukunftsorientierung</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Schnittstelle von<br />
Alter(n) und Pflege<br />
Michael Bossle
Anlage A: Tabellarischer Überblick über die Befunde aus den <strong>an</strong>alysierten<br />
Gutachten………………………………………………………………...…IV<br />
Anlage B: Qualitativ heuristische Analyse <strong>der</strong> Gutachtenbefunde (mod.<br />
nach Kleining und Witt (2000)…………………………………….LXXXVIII<br />
Anlage C: Megatrends…………………………………………………..…CXXX<br />
Anlage D: Forschungsprotokoll Zeitschriften- und Frequenz<strong>an</strong>alyse…CXLV<br />
Anlage E: Expertenworkshop 15.03.2011, PTH Vallendar………….CLXXVII<br />
Anlage F: Codierte Expertenaussagen…………………………………..CXCV
Anlage A: Tabellarischer Überblick über die Befunde aus den <strong>an</strong>alysierten Gutachten<br />
Prognostische Aussagen aus staatlichen Publikationen<br />
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheitsbe‐<br />
richterstattung<br />
des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
1 Nach Bevölkerungsprognosen ist im<br />
Jahr 2010 mit 83,4 Mio. und im Jahr<br />
2040 mit nur noch 72,4 Mio. Einwoh‐<br />
nern zu rechnen. <strong>Die</strong> Alterung <strong>der</strong><br />
Gesellschaft wird weiter vor<strong>an</strong>schrei‐<br />
ten.<br />
2 Mit einem wachsendem Anteil älterer<br />
und hochbetagter Menschen ist zu<br />
rechnen.<br />
Hiermit verbunden ist eine Zunahme des<br />
Bedarfs <strong>an</strong> (professionellen) medizi‐<br />
nischen und pflegerischen Leistungen.<br />
3 <strong>Die</strong> Bedeutung <strong>der</strong> bösartigen Neubildun‐<br />
gen, <strong>der</strong> psychiatrischen Kr<strong>an</strong>kheiten und<br />
<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheiten des Nervensystems<br />
nimmt kontinuierlich zu.<br />
4 51 % <strong>der</strong> Schwerbehin<strong>der</strong>ten waren 1995<br />
65 Jahre und älter.<br />
5 <strong>Die</strong> Pflegebedürftigkeit nimmt aufgrund<br />
<strong>der</strong> demografischen Entwicklung zu.<br />
6 Mit dem Alter nimmt das Interesse <strong>an</strong><br />
Ernährung zu.<br />
Das Beschäftigungswachstum im<br />
Gesundheitsbereich ist im Vergleich<br />
zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Wirtschaftszweigen<br />
überdurchschnittlich.<br />
<strong>Die</strong> Beschreibung <strong>der</strong> sozialen und<br />
ökonomischen Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />
und Behin<strong>der</strong>ung gewinnt immer<br />
mehr <strong>an</strong> Bedeutung.<br />
In den letzten Jahren hat sich die Zahl<br />
<strong>der</strong> Pflegeeinrichtungen deutlich<br />
erhöht.<br />
Zugleich werden die Einpersonen‐<br />
haushalte zunehmen. Hiermit verbunden<br />
ist ein Rückg<strong>an</strong>g des Pflegepotentials <strong>der</strong><br />
Gesellschaft (...). <strong>Die</strong> soziale Lage beein‐<br />
flusst die Entstehung und Bewältigung<br />
von Kr<strong>an</strong>kheiten, die In<strong>an</strong>spruchnahme<br />
von Leistungen und Sterblichkeit. Je<br />
niedriger die Bildung und/o<strong>der</strong> das Ein‐<br />
kommen, desto höher die Sterblichkeit.<br />
Besser gestellte soziale Gruppen stufen<br />
ihren Gesundheitszust<strong>an</strong>d auch allgemein<br />
besser ein. <strong>Die</strong> Beschreibung <strong>der</strong> sozialen<br />
und ökonomischen Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />
und Behin<strong>der</strong>ung gewinnt immer mehr <strong>an</strong><br />
Bedeutung.<br />
S. 13 Befunde überwie‐<br />
gend im Bereich<br />
Epidemiologie<br />
und Ökonomie, z.<br />
Teil mit direkter<br />
Bezugnahme auf‐<br />
ein<strong>an</strong><strong>der</strong>, z. B.<br />
spezifische Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heiten und ent‐<br />
sprechende Kos‐<br />
tenverursachung<br />
S. 14<br />
S. 15<br />
S. 16<br />
S. 17<br />
S. 18<br />
III
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
7 Trotz aller Bemühungen scheint sich beim<br />
Rauchen eine erneute Trendwende abzu‐<br />
zeichnen. Immer mehr Jugendliche und<br />
Erwachsene rauchen wie<strong>der</strong>, immer<br />
weniger Frauen hören im mittleren Alter<br />
damit auf.<br />
8 Wohlbefinden und Gesundheit können<br />
durch die Wohnsituation beeinträchtigt<br />
werden.<br />
9 Als Folge m<strong>an</strong>gelhafter Wohnbe‐<br />
dingungen treten gehäuft Atemwegs‐<br />
erkr<strong>an</strong>kungen, Herz‐ Kreislaufer‐<br />
kr<strong>an</strong>kungen, Infektionen und allergische<br />
Reaktionen auf bzw. sie nehmen einen<br />
schwerwiegenden Verlauf. (…) Ein weite‐<br />
res Problem sind nicht altengerechte<br />
Wohnungen, die zu Stürzen führen und<br />
insgesamt ein höheres Unfallrisiko für alte<br />
Menschen darstellen.<br />
10 Kurzzeitige Anstiege von Staubkonzentra‐<br />
tionen um 100 Mikrogramm/m 3 können<br />
bei Risikogruppen (alte und kr<strong>an</strong>ke Men‐<br />
schen) zu erhöhter Sterblichkeit führen.<br />
11 Ab 1991 gewinnen ionisierende Strahlen<br />
als Ursache tödlich verlaufen<strong>der</strong> Berufs‐<br />
kr<strong>an</strong>kheiten <strong>an</strong> Bedeutung.<br />
12 Kin<strong>der</strong> und ältere Personen stellen be‐<br />
son<strong>der</strong>e Risikogruppen für Haus‐ und<br />
Freizeitunfälle dar. (…) Stürze sind Haupt‐<br />
ursache für Verletzungen und Todesfälle<br />
im Haus‐ und Freizeitbereich (Männer 52<br />
Belastungen aus <strong>der</strong> Arbeitswelt: Im<br />
Zeitverlauf lässt sich ein Belastungs‐<br />
strukturw<strong>an</strong>del von körperlichen zu<br />
psychischen Belastungen feststellen.<br />
(…)<br />
Das Bildungsniveau ist seit den Sechziger‐<br />
jahren gemessen <strong>an</strong> den Schulabschlüssen<br />
stark <strong>an</strong>gestiegen. (…) Je höher das Bil‐<br />
dungsniveau, desto günstiger ist die<br />
Einschätzung des eigenen Gesundheitszu‐<br />
st<strong>an</strong>des. Auch gesundheitsför<strong>der</strong>ndes<br />
Verhalten nimmt mit dem Bildungsstatus<br />
zu. (…)<br />
S. 19<br />
S. 21<br />
S. 22<br />
S. 23<br />
S. 25<br />
S. 26<br />
IV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
% und Frauen 63 %). Jüngere und ältere<br />
(65jährige und ältere) Verkehrsteilnehmer<br />
besitzen ein höheres Unfallrisiko.<br />
13 <strong>Die</strong> periphere arterielle Verschlusskr<strong>an</strong>k‐<br />
heit ist in erster Linie eine Alterskr<strong>an</strong>kheit.<br />
Mit <strong>der</strong> prognostizierten Zunahme <strong>der</strong><br />
älteren Bevölkerung ist mit einem weite‐<br />
ren Anstieg dieser Kr<strong>an</strong>kheit zu rechnen.<br />
14 Lungenkrebs steht mittlerweile als<br />
Krebstodesursache bei den Männern <strong>an</strong><br />
erster und bei den Frauen <strong>an</strong> dritter<br />
Stelle. Lungenkrebs tritt in den meisten<br />
Fällen ab dem 50. Lebensjahr auf. Es ist<br />
jährlich von rund 30 000 Neuer‐<br />
kr<strong>an</strong>kungen bei Männern und 8 300 bei<br />
Frauen auszugehen. Bei Rauchern ist<br />
allgemein von einem 10fach, bei starken<br />
Rauchern (>20 Zigaretten/d) sogar von<br />
einem 20fach erhöhten Risiko gegenüber<br />
Nichtrauchern auszugehen. Auch Passiv‐<br />
rauchen gilt mittlerweile als gesicherter<br />
Risikofaktor. 85 % aller Lungenkrebsfälle<br />
werden auf das Rauchen zurückgeführt.<br />
15 Weltweit ist Gebärmutterkrebs die zweit‐<br />
häufigste Krebserkr<strong>an</strong>kung bei Frauen. (…)<br />
<strong>Die</strong> Sterblichkeit nimmt mit dem Alter zu<br />
und ist zwischen 50 und 74 Jahren dop‐<br />
pelt so hoch wie in jüngeren Jahren. (...)<br />
Studien zeigen, dass durch die Einführung<br />
<strong>der</strong> Früherkennungsprogramme und die<br />
daraus resultierende frühere Diagnose die<br />
Sterblichkeit <strong>an</strong> Gebärmutterkrebs erheb‐<br />
lich gesenkt werden konnte (…). Bei 30 %<br />
aller Männer über 70 Jahren wird ein<br />
latenter Prosatatkrebs vermutet. (…) Mit<br />
11 % <strong>an</strong> allen Krebssterbefällen war <strong>der</strong><br />
Prostatakrebs nach Lungenkrebs die<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten betrugen 1994<br />
schätzungsweise 4,4 Mrd. DM.<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />
auf 1,4 Mrd. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />
auf 990 Mio. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />
S. 27 Keine Erkr<strong>an</strong>kung<br />
ohne Kosten<strong>an</strong>‐<br />
gabe!<br />
S.<br />
28/29<br />
S.<br />
29/30<br />
Männer Krebsto‐<br />
desursache Nr. 1<br />
Gebärmutter‐<br />
krebs: keine<br />
Kosten<strong>an</strong>gabe!<br />
V
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
zweithäufigste Krebstodesursache bei<br />
Männern. Prostatakrebs tritt in den<br />
meisten Fällen ab dem 60. Lebensjahr auf.<br />
Es werden 25 000 Neuerkr<strong>an</strong>kungen pro<br />
Jahr geschätzt.<br />
16 Der Dickdarmkrebs ist bei Männern die<br />
dritthäufigste und bei Frauen die zweit‐<br />
häufigste, <strong>der</strong> Mastdarmkrebs bei Män‐<br />
nern die sechst‐ und bei Frauen die siebt‐<br />
häufigste Krebstodesursache. Das mittlere<br />
Erkr<strong>an</strong>kungsalter für diese Krebserkr<strong>an</strong>‐<br />
kungen liegt bei 70 Jahren (…) Mit den<br />
gesetzlichen Früherkennungsmaßnahmen<br />
ließe sich diese Sterblichkeit senken.<br />
17 <strong>Die</strong> Kr<strong>an</strong>kheitshäufigkeit <strong>der</strong> Arthrosen<br />
nimmt mit dem Alter zu.<br />
18 Osteoporose: Ältere Menschen, insbeson‐<br />
<strong>der</strong>e Frauen sind durch Oberschenkelhals‐<br />
brüche gefährdet, die zu Pflegebedürftig‐<br />
keit führen und die weitere Lebenserwar‐<br />
tung erheblich senken können. Seit 1991<br />
ist die Sterblichkeit <strong>an</strong> Schenkelhalsbrü‐<br />
chen rückläufig.<br />
19 Altersdemenz: <strong>Die</strong> Betroffenheit steigt mit<br />
dem Alter stark <strong>an</strong>. Bei den über 90‐<br />
Jährigen wird ein Anteil von 40 % ge‐<br />
schätzt. Mit <strong>der</strong> Zunahme <strong>an</strong> alten und<br />
hochbetagten Menschen in den nächsten<br />
Jahrzehnten ist von einem bedeutenden<br />
Anstieg <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit als Folge<br />
<strong>der</strong> Zunahme dementer Menschen auszu‐<br />
gehen.<br />
20 Für die Prävention <strong>der</strong> Lungenentzündung<br />
ist ab dem 60. Lebensjahr die jährliche<br />
Grippeschutzimpfung bedeutsam.<br />
21 Mehr als 99 % <strong>der</strong> Erwachsenen sind <strong>an</strong><br />
Karies und/o<strong>der</strong> Paradontitis erkr<strong>an</strong>kt.<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten colorektaler<br />
Karzinome betrugen 1994 rund 2,2<br />
Mrd. DM.<br />
Arthrosen verursachten 1994 direkte<br />
Kosten von rund 10,6 Mrd. DM.<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />
auf 3,7 Mrd. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />
<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />
auf knapp 6,3 Mrd. DM beziffert.<br />
An direkten Kosten wurden 1994 ca.<br />
2,3 Mrd. DM aufgewendet.<br />
Allein die gesetzlichen Kr<strong>an</strong>kenkassen<br />
gaben 1995 für Zahnersatz und<br />
zahnärztliche Beh<strong>an</strong>dlung 21,2 Mrd.<br />
S. 30<br />
S. 31<br />
S. 32<br />
S. 33<br />
S. 35<br />
S. 37 Zahngesundheit:<br />
Bedeutung für<br />
Ernährung und als<br />
VI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
22 Chronische Niereninsuffizienz: <strong>Die</strong> Zahl<br />
<strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kten nimmt durch die steigende<br />
Einbeziehung alter, mehrfachkr<strong>an</strong>ker,<br />
insbeson<strong>der</strong>e diabetischer Patienten in<br />
die Nierenersatztherapie sowie steigende<br />
Überlebenszeiten laufend zu.<br />
23<br />
DM aus, rund 10 % ihrer gesamten<br />
Leistungausgabe<br />
<strong>Die</strong> Beh<strong>an</strong>dlung ist aufwendig und<br />
kostenintensiv. <strong>Die</strong> direkten Kosten<br />
allein von chronischen Nierenversa‐<br />
gen betrugen 1994 rund 3 Mrd. DM.<br />
Ambul<strong>an</strong>te Pflegeeinrichtungen: <strong>Die</strong><br />
Bedeutung dieses Versorgungs<strong>an</strong>ge‐<br />
botes nimmt aufgrund des demogra‐<br />
fischen W<strong>an</strong>dels, medizinisch‐<br />
technischen Fortschritts und sozialer<br />
Verän<strong>der</strong>ungen erheblich zu. Das<br />
Pflegeversicherungsgesetz för<strong>der</strong>t<br />
den Wettbewerb in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflege, um so zu mehr Wirtschaftlich‐<br />
keit und Effizienz und damit zu Kos‐<br />
teneinsparungen zu gel<strong>an</strong>gen. Prob‐<br />
lematisch gestaltet sich die Sicherung<br />
<strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Pflegeleistungen. (…)<br />
Praxen nichtärztlicher medizinischer<br />
Berufe: <strong>Die</strong> Bedeutung dieses Be‐<br />
reichs für die Gesundheitsversorgung<br />
hat in den letzten Jahren kontinuier‐<br />
lich zugenommen; die demografische<br />
Entwicklung lässt eine Fortsetzung<br />
dieses Trends vermuten.<br />
25 <strong>Die</strong> Personalintensität je Bett ist<br />
bezüglich des ärztlichen und pflegeri‐<br />
schen Personals seit Anf<strong>an</strong>g <strong>der</strong><br />
Achtzigerjahre rückläufig (…). Nach‐<br />
haltigstes Mo<strong>der</strong>nisierungsdefizit in<br />
<strong>der</strong> Gesundheitsversorgung ist im<br />
einhelligen Urteil aller Experten die<br />
m<strong>an</strong>gelnde Verzahnung <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>‐<br />
S .38<br />
Kostenfaktor,<br />
höchster Kosten‐<br />
faktor!<br />
S. 45 Qualitätsdebatte<br />
S. 47 Dto. bei<br />
Personalintensität<br />
Betonung <strong>der</strong><br />
Bedeutung von<br />
Qualitätsm<strong>an</strong>a‐<br />
gement im Zu‐<br />
sammenh<strong>an</strong>g mit<br />
Patientenschutz<br />
VII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
ten und stationären Kr<strong>an</strong>kenversor‐<br />
gung (…). Neuere Elemente sind die<br />
Praxiskliniken, Tages‐ und Nachtklini‐<br />
ken, ambul<strong>an</strong>tes Operieren und die<br />
prä‐ und poststationäre Versorgung<br />
<strong>an</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäusern. Vor dem Hinter‐<br />
grund dieser Entwicklungen kommt<br />
dem Qualitätsm<strong>an</strong>agement und dem<br />
Patientenschutz eine immer größere<br />
Bedeutung zu.<br />
26 1994 lebten rund 500 000 „erheblich<br />
pflegebedürftige“ und überwiegend<br />
ältere Menschen in stationären Ein‐<br />
richtungen <strong>der</strong> Alten‐ und Behin<strong>der</strong>‐<br />
tenhilfe. Das Pflegeversicherungsge‐<br />
setz von 1994 gar<strong>an</strong>tiert einen ein‐<br />
kommensunabhängigen Rechts<strong>an</strong>‐<br />
spruch auf die Fin<strong>an</strong>zierung <strong>der</strong><br />
grundlegenden Pflegeleistungen. Das<br />
Angebot <strong>an</strong> Plätzen in diesen Einrich‐<br />
tungen ist in den letzten Jahren<br />
relativ konst<strong>an</strong>t geblieben. <strong>Die</strong> Insas‐<br />
sen sind in erheblichem Umf<strong>an</strong>g auf<br />
Grundpflege und medizinische Be‐<br />
h<strong>an</strong>dlungspflege <strong>an</strong>gewiesen.<br />
27 Zunehmend wird auch dem individu‐<br />
ell sehr unterschiedlichen Pflegebe‐<br />
darf durch differenziertere Angebote,<br />
wie Kurzzeitpflegeeinrichtungen,<br />
Tagespflegeinrichtungen und „Be‐<br />
treutes Wohnen“ Rechnung getragen.<br />
28 Deutschl<strong>an</strong>d zählte 1995 mit einem<br />
Produktionswert von nahezu 33 Mrd.<br />
DM und einem Weltmarkt<strong>an</strong>teil von<br />
etwa 10 % zu den vier größten Her‐<br />
stellerlän<strong>der</strong>n für pharmazeutische<br />
Produkte weltweit. Bei den elektro‐<br />
medizinischen Geräten nahm<br />
S. 48 Terminus „Insas‐<br />
se“ im Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g mit<br />
alten, erheblich<br />
pflegebedürftigen<br />
Menschen; Insti‐<br />
tutionalisierungsg<br />
ed<strong>an</strong>ke und<br />
Anspruch auf<br />
Institutionalisie‐<br />
rung<br />
S. 49<br />
S. 50 Verbindung von<br />
Leistung, Wert<br />
und Innovation<br />
wird deutlich<br />
<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d markt‐<br />
und betriebswirt‐<br />
schaftlichen<br />
VIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
Deutschl<strong>an</strong>d mit einem Produktions‐<br />
wert von rund 5 Mrd. sogar eine<br />
Spitzenstellung ein (…). Bezogen auf<br />
neue Wirkstoffe gehört die deutsche<br />
pharmazeutische Industrie mit einem<br />
Anteil von 12 % für den Zeitraum von<br />
1961−1995 zu den weltweit erfolg‐<br />
reichsten Innovatoren (…). <strong>Die</strong> staatli‐<br />
che Forschungsför<strong>der</strong>ung konzen‐<br />
triert sich auf Projektför<strong>der</strong>ung. <strong>Die</strong><br />
DFG ist <strong>der</strong> wichtigste Drittmittelge‐<br />
ber; sie stellte 1996 für medizinische<br />
Forschung 330 Mio. DM bereit.<br />
29 Rund 1,1 Mio. Erwerbstätige stam‐<br />
men aus den Pflegeberufen. <strong>Die</strong><br />
Altenpflege entwickelt sich hier<br />
zuletzt beson<strong>der</strong>s dynamisch. 1995<br />
waren etwa 210 000 Personen in<br />
diesem Berufsfeld tätig (..)<br />
Gesundheitsschutz: Insgesamt lässt<br />
sich in den letzten fünf Jahren keine<br />
Tendenz zu einer größeren Mängel‐<br />
freiheit <strong>der</strong> Betriebe ablesen<br />
30 Arzneimittelversorgung‐<br />
Selbstmedikation gewinnt durch die<br />
Maßnahmen zur Kostensenkung<br />
laufend <strong>an</strong> Bedeutung (…). <strong>Die</strong> Patien‐<br />
ten zahlen inzwischen rund 20 % <strong>der</strong><br />
Medikamente direkt.<br />
31 Seit 1991 ist die Zahl <strong>der</strong> versorgten<br />
Fälle je 100 000 Einwohner um 5,5 %<br />
gestiegen. Gleichzeitig nahm die<br />
durchschnittliche Verweildauer von<br />
14,6 auf 12,1 Tage ab. Der über‐<br />
durchschnittliche Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong><br />
Verweildauerführte trotz Steigerung<br />
1993 bef<strong>an</strong>den sich mindestens 220 000<br />
Menschen in einer schulischen und 150<br />
000 in einer akademischen Ausbildung für<br />
Gesundheitsfachberufe. Mit neuen Aus‐<br />
bildungen in „Pflege“‐ und „Gesundheits‐<br />
wissenschaften“ vollzieht sich seit Beginn<br />
<strong>der</strong> Neunzigerjahre nach <strong>an</strong>glo‐<br />
amerik<strong>an</strong>ischem Vorbild die Akademisie‐<br />
rung weiterer Gesundheitsfachberufe.<br />
Sprachgebrauchs<br />
betont.<br />
S. 52 Institutionelle<br />
Versorgung wird<br />
als betriebliche<br />
Versorgung<br />
sprachlich ausge‐<br />
drückt; Akademi‐<br />
sierung <strong>der</strong> Pfle‐<br />
geberufe wird<br />
nach <strong>an</strong>gloameri‐<br />
k<strong>an</strong>ischem Vorbild<br />
wahrgenommen<br />
S.<br />
55/56<br />
S. 56 Verweildau‐<br />
er/Fallpauschalen<br />
bereits 1998<br />
erwähnt!<br />
IX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
<strong>der</strong> Fallzahlen zu einer rückläufigen<br />
Auslastung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäuser von<br />
<strong>der</strong>zeit 82 %. Ursächlich für diese<br />
Entwicklung sind Fortschritte in den<br />
medizinischen Beh<strong>an</strong>dlungsmöglich‐<br />
keiten und die Einführung neuer<br />
Formen <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausfin<strong>an</strong>zierung<br />
(Fallpauschalen) (…).<br />
32 <strong>Die</strong> Gesamtkosten je stationär be‐<br />
h<strong>an</strong>delten Kr<strong>an</strong>ken erhöhten sich<br />
zwischen 1991 und 1995 um 18 %, je<br />
Pflegetag sogar um 43 %. Ein nahtlo‐<br />
ser Überg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausbe‐<br />
h<strong>an</strong>dlung zu den <strong>an</strong><strong>der</strong>en Versor‐<br />
gungssektoren (ambul<strong>an</strong>te Versor‐<br />
gung, Rehabilitation, Pflege) könnte<br />
zur Sicherung des Erfolgs <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>‐<br />
kenhausbeh<strong>an</strong>dlung beitragen und<br />
die Erfolgsaussichten fl<strong>an</strong>kieren<strong>der</strong><br />
Maßnahmen erhöhen.<br />
33 Rehabilitation: 1995 wurden über 1,4<br />
Mio. Rehabilitationsmaßnahmen<br />
durchgeführt. Ihre Zahl hat sich seit<br />
1991 um 17,5 % erhöht. Häusliche<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege: Heute k<strong>an</strong>n in den<br />
meisten Regionen von einer flächen‐<br />
deckenden pflegerischen Versorgung<br />
gesprochen werden. <strong>Die</strong> Zunahme<br />
ambul<strong>an</strong>ter Operationen und die Ver‐<br />
kürzung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausverweildau‐<br />
er erhöht den Bedarf <strong>an</strong> häuslicher<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege (…). <strong>Die</strong> Klientel häus‐<br />
licher Kr<strong>an</strong>kenpflege sind vorwiegend<br />
Alte und Hochbetagte.<br />
34 <strong>Die</strong> Kostenerstattungsgrundsätze <strong>der</strong><br />
Kr<strong>an</strong>kenversicherung definieren die<br />
häusliche Kr<strong>an</strong>kenpflege so eng, dass<br />
S. 57<br />
S. 58<br />
S. 59 Memo: Kritische<br />
Betrachtung des<br />
Pflegbedürftig‐<br />
X
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
Gesundheits‐<br />
berichterstat‐<br />
tung des Bundes<br />
(GBE), 1998<br />
SVR –Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
35 H<strong>an</strong>dlungsbedarf wird einerseits in einer<br />
stärkeren präventiven Orientierung in <strong>der</strong><br />
Zahnmedizin gesehen, <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits ist die<br />
Qualität <strong>der</strong> Zahnersatzversorgung zu<br />
verbessern.<br />
Prävention, Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<br />
Aktivierung und Rehabilitation nur<br />
einen geringen Stellenwert haben.<br />
Wettbewerb und Kostendruck beein‐<br />
trächtigen zunehmend die Qualität<br />
<strong>der</strong> häuslichen Kr<strong>an</strong>kenpflege. 1995<br />
lagen die GKV‐Ausgaben für häusliche<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege bei 3,3 Mrd. DM. (…)<br />
36 <strong>Die</strong> Pflegeleistungen, hier insbeson‐<br />
<strong>der</strong>e die Leistungen <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflege, und die Kr<strong>an</strong>ken‐ und Ret‐<br />
tungstr<strong>an</strong>sporte sind die Ausgaben‐<br />
bereiche mit dem höchsten Zuwachs<br />
zwischen 1980 und 1994. Durch die<br />
Kostendämpfungsgesetze in <strong>der</strong> GKV<br />
hat sich das Wachstum <strong>der</strong> Gesund‐<br />
heitsausgaben in den Achtziger‐ im<br />
Vergleich zu den Siebzigerjahren<br />
deutlich verl<strong>an</strong>gsamt. Es ist allerdings<br />
zu erwarten, dass <strong>der</strong> Gesund‐<br />
heitssektor auch in Zukunft stärker als<br />
die Gesamtwirtschaft wachsen wird.<br />
37 (…) hat <strong>der</strong> Rat (u. a., MB) folgende<br />
Gesundheitsziele herausgestellt:<br />
Erhaltung <strong>der</strong> selbstständi‐<br />
gen Lebensführung im Alter<br />
Erhaltung <strong>der</strong> Erwerbs‐ und<br />
Arbeitsfähigkeit älterer<br />
Menschen.<br />
keitsbegriffs<br />
S. 62 Nochmalige<br />
Betonung <strong>der</strong><br />
Zahngesundheit<br />
im Zusammen‐<br />
h<strong>an</strong>g mit Quali‐<br />
täts<strong>an</strong>sprüchen<br />
S. 63<br />
S. 7 Gesamt<strong>an</strong>mer‐<br />
kung SVR 1996:<br />
Befunde über‐<br />
wiegend im Be‐<br />
reich Epidemio‐<br />
logie und Öko‐<br />
nomie.<br />
XI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
38 Mit diesem Auftrag und dem vorlie‐<br />
genden Gutachten wird ein Paradig‐<br />
menwechsel in <strong>der</strong> Gesundheitspoli‐<br />
tik eingeleitet. Fragen <strong>der</strong> Beschäfti‐<br />
Identifizierte<br />
Desi<strong>der</strong>ate für<br />
PW.<br />
Entdeckung von<br />
Wirtschaftlich‐<br />
keitsreserven<br />
durch für die<br />
Pflege…<br />
Entdeckung des<br />
Wirtschafts‐<br />
wachstums/<br />
Beschäftigungs‐<br />
zuwachses für<br />
die Pflege.<br />
Einflussnahme<br />
auf Leistungs‐<br />
spektren durch<br />
Pflege?<br />
Einflussnahme<br />
<strong>der</strong> Pflege auf<br />
Prozessoptimie‐<br />
rungsprozesse/<br />
Produktinnova‐<br />
tionen.<br />
Fokussierung<br />
auf Selbststän‐<br />
digkeit, Er‐<br />
werbs‐ und<br />
Arbeitsfähigkeit<br />
S. 8 Dilemma‐<br />
Aussage! „<strong>Die</strong>se<br />
Gratw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung<br />
zwischen Kosten‐<br />
XII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
39 Darüber hinaus (wird <strong>der</strong> zweite B<strong>an</strong>d,<br />
[SVR 1997] MB) um folgende Kapitel<br />
erweitert: <strong>der</strong> medizinische, <strong>der</strong> medi‐<br />
zinisch‐technische, <strong>der</strong> technische und <strong>der</strong><br />
pflegerische Fortschritt im Gesund‐<br />
heitswesen, <strong>der</strong> sowohl übergreifend<br />
<strong>an</strong>alytisch als auch beispielhaft (Knochen‐<br />
marktr<strong>an</strong>spl<strong>an</strong>tationen, Telematik, Um‐<br />
welt, Technikfolgenabschätzung) beh<strong>an</strong>‐<br />
delt werden soll.<br />
40 Eingebettet in den Paradigmenwechsel<br />
(siehe Zitat 38, MB) bleiben auch seine<br />
Aussagen zu den Versorgungsdefiziten in<br />
den Bereichen <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
und Prävention sowie <strong>der</strong> Qualitäts‐<br />
sicherung. <strong>Die</strong>s gilt vor allem für die<br />
primäre Prävention, die darauf abzielt,<br />
bereits vor dem Entstehen von Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heiten durch Beseitigung ihrer Ursache<br />
o<strong>der</strong> Einschränkung ihrer Risikofaktoren<br />
vorzubeugen.<br />
gung und des Wachstums im und<br />
durch das Gesundheitswesen treten<br />
in den Vor<strong>der</strong>grund. (…) Neben das<br />
Gesundheitswesen als Kostenfaktor<br />
tritt das Gesundheitswesen als Wirt‐<br />
schaftsfaktor mit seinen Wachstums‐<br />
und Produktivitätseffekten wie<strong>der</strong><br />
stärker in den Mittelpunkt. <strong>Die</strong>se<br />
Gratw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung zwischen Kosten‐<br />
dämpfung und Wachstum gehört<br />
auch zu den Herausfor<strong>der</strong>ungen im<br />
Gesundheitswesen.<br />
Wachstums‐ und Produktivitätseffek‐<br />
te im Gesundheitswesen sollen<br />
zweitens im Vor<strong>der</strong>grund eines<br />
weiteren Kapitels stehen.<br />
S. 10<br />
S.11<br />
dämpfung und<br />
Wachstum gehört<br />
auch zu den<br />
Herausfor<strong>der</strong>un‐<br />
gen im Gesund‐<br />
heitswesen“.<br />
Ökonomische<br />
Trendwende ist<br />
endgültig einge‐<br />
kehrt<br />
XIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
41 Der Rat befürwortet die Stärkung<br />
wettbewerblicher Möglichkeiten<br />
nicht um ihrer selbst willen, son<strong>der</strong>n<br />
immer als notwendige Grundlage von<br />
Innovation und immer eingebunden<br />
in den Rahmen einer sozialen Markt‐<br />
wirtschaft. Damit ergibt sich für den<br />
Rat als l<strong>an</strong>gfristig wichtigste Reform<br />
für das Gesundheitswesen die Förde‐<br />
rung einer kontrollierten experimen‐<br />
tellen Kultur.<br />
42 Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV und<br />
<strong>der</strong> GPflV zur demografischen Entwick‐<br />
lung u. a. noch folgende Einflussgrößen<br />
<strong>der</strong> Ausgabenentwicklung hinzu: die<br />
Verän<strong>der</strong>ung des Kr<strong>an</strong>kheitsspektrums in<br />
Richtung l<strong>an</strong>gwieriger, chronisch‐<br />
degenerativer Kr<strong>an</strong>kheitszustände.<br />
43 <strong>Die</strong> absehbare demografische Entwick‐<br />
lung lässt den demografischen Alters‐<br />
quotienten zunehmen und gleichzeitig<br />
das Erwerbstätigenpotential schrump‐<br />
fen, was unmittelbar mit geringeren<br />
Beitragseinnahmen und steigenden Bei‐<br />
tragssätzen einhergeht. Es kommt also<br />
zu einer Verschiebung <strong>der</strong> Altersstruk‐<br />
<strong>Die</strong>se verschiedenen Ausgabendeter‐<br />
min<strong>an</strong>ten besitzen allerdings für die zu‐<br />
künftige Entwicklung <strong>der</strong> Beitragssätze<br />
von GKV und GPflV sehr unterschiedliche<br />
Relev<strong>an</strong>z. Verän<strong>der</strong>ungen des Kr<strong>an</strong>kheits‐<br />
spektrums vollziehen sich in <strong>der</strong> Regel<br />
sehr l<strong>an</strong>gsam und hängen teilweise von<br />
<strong>der</strong> demografischen Entwicklung und vom<br />
Als Determin<strong>an</strong>te <strong>der</strong> zukünftigen<br />
Ausgabenentwicklung <strong>der</strong> GKV stellt<br />
die demografische Komponente nur<br />
einen von zahlreichen, stark interde‐<br />
pendenten Einflussfaktoren dar, die<br />
nahezu alle auch auf die Ausgabensei‐<br />
te <strong>der</strong> Gesetzlichen Pflege‐<br />
versicherung (GPflV) einwirken. (…)<br />
Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV<br />
und <strong>der</strong> GPflV zur demografischen<br />
Entwicklung u. a. noch folgende<br />
Einflussgrößen <strong>der</strong> Ausgabenentwick‐<br />
lung hinzu: <strong>der</strong> insbeson<strong>der</strong>e durch<br />
den umfassenden Versicherungs‐<br />
schutz gegebene Anreiz zu einer<br />
übermäßigen In<strong>an</strong>spruchnahme von<br />
Gesundheitsleitungen (Moral<br />
Hazard).<br />
Determin<strong>an</strong>ten <strong>der</strong> Ausgabenent‐<br />
wicklung von GKV und GPflV:<br />
Leistungsausweitung durch<br />
<strong>an</strong>gebotsinduzierte Nachfrage<br />
Der ausgabensteigernde medizinische<br />
Fortschritt bzw. W<strong>an</strong>del<br />
Der negative Preisstruktureffekt bzw.<br />
<strong>der</strong> Preisstruktureffekt zugunsten von<br />
Der Rat betrachtet mit Sorge, dass gerade<br />
in Zeiten des ökonomischen Umbruchs die<br />
damit verbundenen sozialen Sp<strong>an</strong>nungen<br />
dazu führen, dass ideologische gesell‐<br />
schaftspolitische Positionen die Diskussi‐<br />
on um Reformvorschläge vermehrt be‐<br />
herrschen.<br />
Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV und<br />
<strong>der</strong> GPflV zur demografischen Entwick‐<br />
lung u. a. noch folgende Einflussgrößen<br />
<strong>der</strong> Ausgabenentwicklung hinzu: die<br />
Zunahme von Einzelhaushalten bzw. ‐<br />
personen und die gestiegene Anspruchs‐<br />
haltung <strong>der</strong> Bevölkerung gegenüber<br />
medizinischer und paramedizinischer<br />
Versorgung.<br />
S.12 Paradigmenwech‐<br />
sel<br />
S.23 Nachfrageseite:<br />
multifaktoriell<br />
bestimmt<br />
S. 24 Demografische<br />
Entwicklung vor<br />
dem Hintergrund<br />
<strong>der</strong> Schrumpfung<br />
des<br />
Erwerbstätigen‐<br />
potentials, Ange‐<br />
botsseite unter‐<br />
XIV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU<br />
tur, hier vor allem zu einem Rückg<strong>an</strong>g<br />
<strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Personen im erwerbsfähi‐<br />
gen Alter, was aber unmittelbar durch<br />
eine Erhöhung <strong>der</strong> weiblichen Erwerbs‐<br />
beteiligung und einem Ansteigen des<br />
Rentenalters kompensiert werden k<strong>an</strong>n,<br />
sodass die Zahl <strong>der</strong> beitragszahlenden<br />
Erwerbstätigen trotz <strong>der</strong> zunehmenden<br />
Alterslastigkeit <strong>der</strong> Bevölkerung zu‐<br />
nächst (nahezu) konst<strong>an</strong>t bleibt. Der<br />
Rentenquotient wächst d<strong>an</strong>n l<strong>an</strong>gsamer<br />
als <strong>der</strong> demografische Altenquotient.<br />
44 Ein weiterer Anstieg <strong>der</strong> Lebenserwar‐<br />
tung gemäß Prognose (DAV‐Trendfunk‐<br />
tion, Sterblichkeitstrend des letzten<br />
Jahrtausends) führt insbeson<strong>der</strong>e zu<br />
einem Anstieg <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> über 80‐Jäh‐<br />
rigen: Im Jahr 2040 wird sich <strong>der</strong>en Zahl<br />
gegenüber <strong>der</strong> Prognose auf das Jahr<br />
2000 bis auf das knapp Dreifache erhö‐<br />
hen. <strong>Die</strong> Auswirkungen dieser demo‐<br />
grafischen Verän<strong>der</strong>ungen auf den me‐<br />
dizinischen Versorgungsbedarf hängen<br />
– unter ceteris paribus‐Bedingungen für<br />
medizinische Technologie‐ und Nut‐<br />
zungsmuster – von den altersspe‐<br />
zifischen Verbrauchsziffern ab.<br />
45 Seit Anf<strong>an</strong>g des Jahrhun<strong>der</strong>ts ist eine<br />
vermin<strong>der</strong>te Sterblichkeitsrate in allen<br />
Altersgruppen, insbeson<strong>der</strong>e auch in den<br />
höheren Altersgruppen <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong><br />
Bevölkerung zu verzeichnen. Der größte<br />
Anteil <strong>der</strong> Sterblichkeitsabnahme beruht<br />
auf nichtmedizinischen Faktoren (Ernäh‐<br />
medizinischen Fortschritt ab. Gesundheitsleistungen und die<br />
Leistungsintensivierung durch<br />
Defensivmedizin (...)<br />
<strong>Die</strong> gestiegene Anspruchshaltung,<br />
Moral Hazard und die <strong>an</strong>gebotsindu‐<br />
zierte nachfrage vermögen teilweise<br />
die bisherige Ausgabenentwicklung in<br />
<strong>der</strong> GKV und damit das heutige<br />
Niveau zu erklären, kaum aber einen<br />
weiteren Beitragssatz<strong>an</strong>stieg. <strong>Die</strong>se<br />
Einschränkung gilt allerding nicht für<br />
die GPflV, denn hier setzt das neue<br />
Gesetz Anreize zu einer Ausdehnung<br />
des Leistungsvolumens, die in <strong>der</strong><br />
Verg<strong>an</strong>genheit nicht existierten.<br />
Kosten <strong>der</strong> Versorgung bei Morbidität<br />
und Mortalität im höheren Lebensal‐<br />
ter: <strong>Die</strong> Versorgungskosten für Ältere<br />
wurden aufgrund linearer Hochrech‐<br />
nung herkömmlicher Daten bisl<strong>an</strong>g<br />
überschätzt. Einerseits sind Kosten<br />
für die Versterbenden im letzten<br />
Lebensjahr im Vergleich zu Nichtver‐<br />
sterbenden um das 20‐Fache (im<br />
Alter von 60) bis 6‐Fache (im Alter<br />
von 80) höher und machen einen<br />
wesentlichen Teil <strong>der</strong> lebensl<strong>an</strong>gen<br />
Kosten aus.<br />
An<strong>der</strong>erseits sinken die Kosten für die<br />
Versterbenden in ihrem letzten<br />
Lebensjahr mit zunehmendem Alter<br />
deutlich ab, da – zumindest für den<br />
größten Ausgabenblock „stationäre<br />
Versorgung“ – sowohl die Kumulation<br />
medizinischer Leistungen als auch die<br />
Für eine zukunftsorientierte Gesundheits‐<br />
und Sozialpolitik sind weitere Untersu‐<br />
chungen zu Versorgungskosten in ver‐<br />
schiedenen Altersstufen erfor<strong>der</strong>lich (…).<br />
Einen wesentlichen Einfluss auf die Mor‐<br />
bidität und Mortalität hat <strong>der</strong> sozioöko‐<br />
nomische Status. Auch für Westeuropa<br />
liegt ausschl.<br />
ökonomischen<br />
Entwicklungen<br />
Einflussnahmen<br />
auf die GPflV<br />
S. 26 Fokus<br />
Hochaltrigkeit und<br />
Mortalität und<br />
Kosten<br />
S. 27 Bedeutung <strong>der</strong><br />
Prävention und<br />
soziökonomische<br />
Faktoren, Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> Vertei‐<br />
lungsgerechtigkeit<br />
XV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
rung, verbesserte physische und soziale<br />
Lebensbedingungen). Etwa 3,5 bis 4 Jahre<br />
Gewinn <strong>an</strong> Lebenserwartung (1950−1990)<br />
werden <strong>der</strong> kurativen Medizin zuge‐<br />
schrieben; davon entfällt <strong>der</strong> mit 18<br />
Monaten größte Anteil auf die verbesser‐<br />
te Beh<strong>an</strong>dlung <strong>der</strong> Herzerkr<strong>an</strong>kungen.<br />
Forschungsergebnisse zu „vermeidbaren“<br />
Todesfällen weisen darauf hin, dass eine<br />
weitere wesentliche Reduktion <strong>der</strong> Mor‐<br />
talität nicht so sehr von den Fortschritten<br />
er kurativen Medizin, son<strong>der</strong>n vielmehr<br />
von <strong>der</strong> Realisierung definierbarer prä‐<br />
ventiver Maßnahmen – im Sinne einer<br />
Verhaltens‐ und Verhältnisprävention –<br />
abhängt.<br />
46 Eine differenzierte Einschätzung <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> Morbidität auf Bevölke‐<br />
rungsbasis ist aufgrund <strong>der</strong> weiterhin<br />
m<strong>an</strong>gelhaften <strong>deutschen</strong> Datenbasis<br />
schwierig. Anh<strong>an</strong>d von Einzelstudien<br />
werden zu ausgewählten, im Alter bedeu‐<br />
tenden Gesundheitsstörungen und Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heiten Hinweise zu Vorkommen, zu Risi‐<br />
kofaktoren, zur Versorgungslast, zum<br />
kurz‐ und mittelfristigen Zusatzversor‐<br />
gungsbedarf und zu Ansätzen ihrer Prä‐<br />
vention gegeben. <strong>Die</strong> zweite Lebenshälfte<br />
wird vor allem durch die starke Zunahme<br />
chronischer Kr<strong>an</strong>kheiten charakterisiert.<br />
Alter ist jedoch nicht zw<strong>an</strong>gsläufig mit<br />
Kr<strong>an</strong>kheit verbunden. In vielen Bereichen<br />
Dauer <strong>der</strong> Leistungen abnehmen.<br />
Vorzeitige Mortalität erspart daher<br />
nicht‐medizinische Versorgungskos‐<br />
ten. Nach einer Analyse <strong>der</strong> Ver‐<br />
brauchsziffern von Versterbenden<br />
und Überlebenden können durch den<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> altersspezifischen<br />
Verbrauchsziffern bis zu 15−20 %<br />
aufgrund <strong>der</strong> steigenden Lebenser‐<br />
wartung eingespart werden. <strong>Die</strong> Höhe<br />
<strong>der</strong> Versorgungskosten ist nicht<br />
zuletzt auch davon abhängig, inwie‐<br />
weit es gelingt, Morbidität und vor‐<br />
zeitige Mortalität zu vermeiden. Bei<br />
<strong>der</strong> Annahme einer „komprimierten<br />
Morbidität“ ist in <strong>der</strong> Altenpopulation<br />
von Industriestaaten sogar eine<br />
komplette Kompensation des demo‐<br />
grafisch bedingten Mehrbedarfs<br />
möglich. Ökonomische Verteilungsge‐<br />
rechtigkeit hat Einfluss auf den<br />
Gesundheitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />
<strong>Die</strong>se Abgrenzung (siehe C46, MB)<br />
hat potentielle Folgen für die Kosten‐<br />
übernahme <strong>der</strong> Versorgung<br />
und die Bundesrepublik Deutschl<strong>an</strong>d<br />
besteht ein signifik<strong>an</strong>ter Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
zwischen <strong>der</strong> ökonomischen Verteilungs‐<br />
gerechtigkeit und <strong>der</strong> durchschnittlichen<br />
Lebenserwartung. Somit hat ökonomische<br />
Verteilungsgerechtigkeit Einfluss auf den<br />
Gesundheitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />
I (siehe B46, MB): Professionelle (und<br />
gesellschaftliche) Sichtweisen bestimmen<br />
wesentlich, welche physiologischen<br />
Beeinträchtigungen <strong>der</strong> Gesundheit als<br />
Kr<strong>an</strong>kheit definiert und einer Therapie<br />
unterzogen werden (…). <strong>Die</strong> oft unter‐<br />
schätzte individuelle Kompensation<br />
altersbedingter Beeinträchtigungen<br />
könnte durch professionelle und gesell‐<br />
schaftliche Hilfestellungen gezielt geför‐<br />
<strong>der</strong>t werden.<br />
S. 28 Unscharfe Ent‐<br />
wicklungsprogno‐<br />
se bezüglich<br />
epidemiologischer<br />
Entwicklungen<br />
Abstufungen von<br />
Morbidität im<br />
Alter<br />
„Alter ist nicht<br />
zw<strong>an</strong>gsläufig mit<br />
Kr<strong>an</strong>kheit ver‐<br />
bunden“<br />
Perspektiven auf<br />
XVI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
ist die Grenze zwischen normalen alters‐<br />
physiologischen und pathologischen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen unscharf. Hierzu wird eine<br />
Kr<strong>an</strong>kheitstypologie vorgeschlagen:<br />
I Altersphysiologische Verän<strong>der</strong>ungen mit<br />
möglichem, aber nicht zwingendem<br />
„Kr<strong>an</strong>kheitswert“,<br />
II Altersbezogene Erkr<strong>an</strong>kungen mit<br />
l<strong>an</strong>ger präklinischer Latenzzeit<br />
III Erkr<strong>an</strong>kungen mit im Alter verän<strong>der</strong>‐<br />
tem physiologischen Verlauf aufgrund<br />
vermin<strong>der</strong>ter homöostatischer Regulati‐<br />
ons‐ und Reparaturmech<strong>an</strong>ismen und<br />
IV Kr<strong>an</strong>kheiten infolge l<strong>an</strong>gfristiger, mit<br />
<strong>der</strong> Lebenszeit, d. h. mit dem Alter, stei‐<br />
gen<strong>der</strong> Exposition<br />
I verdeutlicht die Kontextabhängigkeit von<br />
Kr<strong>an</strong>kheiten bzw. Gesundheitsstörungen<br />
(…) Für die Prävention können vor allem<br />
physiologische Alterungsprozesse genutzt<br />
werden, die eine hohe Plastizität aufwei‐<br />
sen.<br />
II verweist auf die Problematik von Frü‐<br />
herkennungsmaßnahmen und die damit<br />
verbundene Sekundärprävention. <strong>Die</strong>se<br />
sind nur d<strong>an</strong>n sinnvoll, wenn nicht nur die<br />
Diagnose vorgelegt wird, son<strong>der</strong>n eine<br />
adäquate Therapie <strong>an</strong>geboten werden<br />
k<strong>an</strong>n.<br />
III ist außer einer tertiären Prävention<br />
bzw. Rehabilitation einem genuinen<br />
Präventionskonzept nicht zugänglich. Sie<br />
weist aber auch auf die Notwendigkeit<br />
einer altersentsprechenden Führung und<br />
Beh<strong>an</strong>dlung hin.<br />
Gesundheit und<br />
Kr<strong>an</strong>kheit: profes‐<br />
sionelle und<br />
gesellschaftliche<br />
Einflüsse<br />
Sekundärpräven‐<br />
tion: Bedeutung<br />
von Früherken‐<br />
nung und Vorsor‐<br />
geuntersuchunge<br />
n<br />
Bedeutung des<br />
Alters im Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g mit<br />
Kr<strong>an</strong>kheit, Wissen<br />
um spezifische<br />
Alterserscheinun‐<br />
gen/ Dysregula‐<br />
tionen<br />
XVII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />
achten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
47 Konsequenzen für die Versorgung: Der<br />
demografische Umbau führt kurz‐ bis<br />
mittelfrisitig zu einem mo<strong>der</strong>at vermehr‐<br />
ten Versorgungsbedarf in <strong>der</strong> Kuration,<br />
Rehabilitation und Pflege für die ältere<br />
Bevölkerungsgruppe. <strong>Die</strong> l<strong>an</strong>gfristige<br />
Entwicklung ist von den heutigen präven‐<br />
tiven Investitionen vor allem in mittleren<br />
und höheren Altersstufen abhängig. Um<br />
den mit dem demografischen Umbau<br />
einhergehenden strukturellen Verände‐<br />
rungen gerecht zu werden und mögliche<br />
gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen,<br />
ist eine l<strong>an</strong>gfristige und problemgerechte<br />
Anpassung <strong>der</strong> Gesundheits‐ und Sozial‐<br />
politik erfor<strong>der</strong>lich (…). Der demografisch<br />
bedingte Morbiditätsw<strong>an</strong>del führt zu<br />
einer Abnahme des Interventionsbedarfs<br />
kurativer Leistungen in den höchsten<br />
Altersstufen, während pflegerische Leis‐<br />
tungen vermehrt nachgefragt werden (…)<br />
Ein demografisch bedingter Zusatzversor‐<br />
gungsbedarf ergibt sich insbeson<strong>der</strong>e für<br />
obstruktive Lungenerkr<strong>an</strong>kungen, für<br />
Herz‐Kreislauferkr<strong>an</strong>kungen vor allem im<br />
operativen und rehabilitativen Bereich,<br />
ebenso für Erkr<strong>an</strong>kungen des Urogenital‐<br />
trakts, für Krebserkr<strong>an</strong>kungen im diagnos‐<br />
tischen und therapeutischen Bereich, ein<br />
mo<strong>der</strong>ater operativer und rehabilitativer<br />
Bedarf für Erkr<strong>an</strong>kungen des Bewegungs‐<br />
apparates, für Erkr<strong>an</strong>kungen des Seh‐ und<br />
Hörsinns im ärztlichen und nicht‐<br />
ärztlichen Bereich sowie ein mo<strong>der</strong>ater<br />
Zuwachs <strong>an</strong> gerontopsychiatrischer Ver‐<br />
sorgung. Dem steht ein großes und noch<br />
weitgehend unausgeschöpftes präventi‐<br />
ves Potential beson<strong>der</strong>s zur Verhin<strong>der</strong>ung<br />
Es findet eine Verlagerung <strong>der</strong> Leis‐<br />
tungen und Kosten von <strong>der</strong> GKV in die<br />
GPflV sowohl im ambul<strong>an</strong>ten als auch<br />
im stationären Sektor statt.<br />
IV Sowohl physikalisch‐chemische als<br />
auch psycho‐soziale und sozioökonomi‐<br />
sche Expositionen sind erfasst. Hier sind v.<br />
a. Dingen populationsbezogene Präventi‐<br />
onsstrategien sinnvoll. Es gilt v. a. das<br />
Expositionsrisiko zu senken.<br />
(…) Sie (die Gesundheits‐ und Sozialpolitik,<br />
MB) sollte nicht nur krisenorientiert sein,<br />
son<strong>der</strong>n vielmehr in Anerkennung <strong>der</strong> mit<br />
<strong>der</strong> gewünschten Lebenserwartung ver‐<br />
bundenen individuellen und gesellschaft‐<br />
lichen positiven Zielsetzung, <strong>an</strong> einem<br />
Altwerden in Gesundheit, ausgerichtet<br />
sein.<br />
S. 29 Bedeutung von<br />
Umwelteinflüssen<br />
Konsequenzen:<br />
Prävention in<br />
mittlere und<br />
höhere Altersstu‐<br />
fen<br />
Abnahme kurati‐<br />
ver Leistungen,<br />
dagegen Nachfra‐<br />
gezunahme<br />
pflegerischer<br />
Leistungen in den<br />
höchsten Alters‐<br />
stufen (Stichwort<br />
Hochaltrigkeit)<br />
Verlagerung <strong>der</strong><br />
Leistungen und<br />
Kosten von <strong>der</strong><br />
GKV in die GPflV<br />
sowohl ambul<strong>an</strong>t<br />
als auch stationär<br />
XVIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />
achten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
von Erkr<strong>an</strong>kungen des Herz‐<br />
Kreislaufsystems, Erkr<strong>an</strong>kungen <strong>der</strong><br />
Atemwege und Unfällen gegenüber<br />
(Tabelle 3 in: SVR 1996, S. 30)<br />
48 <strong>Die</strong> für das Alter typische Multimorbidität<br />
umfasst jedoch, richtig verst<strong>an</strong>den, unter‐<br />
schiedliche Arten und Phasen von Kr<strong>an</strong>k‐<br />
sein und Behin<strong>der</strong>ung nebenein<strong>an</strong><strong>der</strong>,<br />
aber zugleich immer auch verbleibende<br />
o<strong>der</strong> erweiterungsfähige Möglichkeiten<br />
selbstkompetenten H<strong>an</strong>delns und Hel‐<br />
fens. Aus dieser gleichzeitigen Präsenz<br />
mehrerer Gesundheitsstörungen in unter‐<br />
schiedlichen Verlaufsstadien leitet sich die<br />
Notwendigkeit eines gleichzeitigen Einbe‐<br />
zugs und <strong>der</strong> gleichberechtigten Stellung<br />
von Maßnahmen aller Bereiche ab:<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung/Prävention,<br />
Kuration, Rehabilitation und Pflege. Sie<br />
lassen sich in einer zukünftig noch zu<br />
entwickelnden, patientenorientierten<br />
Versorgungsl<strong>an</strong>dschaft we<strong>der</strong> zeitlich<br />
noch sachlich sinnvoll vonein<strong>an</strong><strong>der</strong> tren‐<br />
nen.<br />
Dem Modell einer funktionalen<br />
Durchdringung <strong>der</strong> Ge‐<br />
sundheitsför<strong>der</strong>ung, Prävention,<br />
Kuration, Rehabilitation und Pflege<br />
stehen gegenwärtig sowohl die<br />
Org<strong>an</strong>isation wie die Fin<strong>an</strong>zierung<br />
von Leistungen eher entgegen. Eine<br />
Verzahnung erfor<strong>der</strong>t die Ausschöp‐<br />
fung des rechtlichen Rahmens und<br />
neue Kooperationsformen. Ziel muss<br />
die kooperative und funktional aufei‐<br />
n<strong>an</strong><strong>der</strong> bezogene „Gleichzeitigkeit“<br />
sein, bzw. – betrachtet m<strong>an</strong> den<br />
ambul<strong>an</strong>ten, teilstationären Sektor –<br />
ein nahtloser Überg<strong>an</strong>g.<br />
49 <strong>Die</strong>sen mittelfristig verän<strong>der</strong>ten Versor‐<br />
gungsbedarf ist zeitgleich – z. B. wegen<br />
<strong>der</strong> l<strong>an</strong>gsameren Anpassungsprozesse in<br />
<strong>der</strong> ärztlichen Aus‐ und Weiterbildung –<br />
schwierig nachzukommen (…). Fort‐ und<br />
Weiterbildung in <strong>der</strong> Geriatrie sollten<br />
daher so schnell wie möglich verbessert<br />
werden (…). <strong>Die</strong> Ausführungen machen<br />
die Kontextabhängigkeit einer erfolgrei‐<br />
chen Gesundheits‐ und Sozialpolitik vor<br />
dem Hintergrund des demografischen<br />
W<strong>an</strong>dels deutlich. Sichtbar wird auch die<br />
S. 30 Differenzierter<br />
Blick auf Multi‐<br />
morbidität, integ‐<br />
rieren<strong>der</strong> Blick<br />
Plädoyer für<br />
integrierte Ver‐<br />
sorgungsformen<br />
S. 31 Politische Ver‐<br />
<strong>an</strong>twortung wird<br />
betont!<br />
XIX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />
achten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU<br />
50 <strong>Die</strong> Ursachen von Wirtschaftlichkeits‐<br />
reserven sind auch in vielen vorheri‐<br />
gen Gutachten aufgeführt. Ihre<br />
Analyse ist beson<strong>der</strong>s wichtig, weil in<br />
den Kapiteln „Demografische Ent‐<br />
wicklung“ und „Morbidität und<br />
Mortalität im höheren Lebensalter“<br />
deutlich geworden ist, dass trotz<br />
korrigierter Hochrechnungen und<br />
trotz gewisser demografiebedingter<br />
Min<strong>der</strong>bedarfe kurz‐ bis mittelfristig<br />
weiterhin von demografisch beding‐<br />
ten Mehrbedarfen auszugehen ist.<br />
Bedeutung weiterer Politikfel<strong>der</strong> wie<br />
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Umwelt,<br />
Wohnungsbau etc., ihr Einfluss auf die<br />
Verteilungsgerechtigkeit und damit letzt‐<br />
lich wie<strong>der</strong>um auf die Gesundheit <strong>der</strong><br />
Bevölkerung. Für die Zukunft ist eine<br />
vorausschauende, risikomin<strong>der</strong>nde<br />
Gesundheitspolitik notwendig. Soll <strong>der</strong><br />
demografische bedingte Zusatzbedarf <strong>an</strong><br />
Versorgung mittelfristig gemin<strong>der</strong>t wer‐<br />
den, müssen präventive Ansätze sowohl<br />
in den mittleren Lebensjahren als auch im<br />
Alter selbst ausgebaut werden. Weniger<br />
präventive Investitionen <strong>der</strong> Gesund‐<br />
heitspolitik, wie sie sich im Jahre 1996<br />
abzeichnet, führen l<strong>an</strong>gfristig zu einem<br />
Bumer<strong>an</strong>g‐ Effekt. Eine bedarfs‐ und<br />
ergebnisorientierte altersgerechte Prä‐<br />
vention und Versorgung erfor<strong>der</strong>t eine<br />
Orientierung <strong>an</strong> adäquat formulierten<br />
sachpolitischen Zielen. Zu ihrer Umset‐<br />
zung ist eine stärkere Verzahnung und<br />
Integration <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<br />
Rehabilitation, Kuration und Pflege unab‐<br />
dingbar.<br />
S. 32 Stichwort: Wirt‐<br />
schaftlichkeitsrese<br />
rven und Ratio‐<br />
nierungsmotiva‐<br />
tion<br />
XX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
<strong>Die</strong> Ausschöpfung von Wirtschaftlich‐<br />
keitsreserven hilft daher, allenfalls<br />
drohende Rationierungen zu vermei‐<br />
den.<br />
51 Ansätze und Wege zur Mobilisierung<br />
von Wirtschaftlichkeitsreserven.<br />
Schätzungen über nicht notwendige<br />
Gesundheitsleistungen gehen für<br />
K<strong>an</strong>ada und für die USA von rund 30<br />
% aller Gesundheitsausgaben aus. Der<br />
Rat k<strong>an</strong>n aufgrund <strong>der</strong> unzureichen‐<br />
den Datenlage für Deutschl<strong>an</strong>d nur<br />
beispielhaft auf einige Bereiche mit<br />
deutlichen Wirtschaftlichkeitsreser‐<br />
ven hinweisen:<br />
Wesentliche Teile <strong>der</strong> heute<br />
vorgenommenen Röntgenuntersu‐<br />
chungen und präoperative Routine‐<br />
diagnostiken sind überflüssig. <strong>Die</strong><br />
Knochendichtemessung ist als<br />
Screeningmethode bei beschwerde‐<br />
freien Personen höchst umstritten,<br />
dennoch wird sie in weitem Umf<strong>an</strong>ge<br />
<strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dt.<br />
Ein großer Teil <strong>der</strong> durchgeführten<br />
Arthroskopien ist nicht notwendig: In<br />
<strong>der</strong> Diagnostik und Therapie <strong>der</strong> in<br />
<strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Versorgung extrem<br />
häufigen unkomplizierten Rücken‐<br />
schmerzepisoden bestehen erhebli‐<br />
che Wirtschaftlichkeitsreserven;<br />
Bei <strong>der</strong> Gesundheitsuntersuchung<br />
nach § 256 SGBV (Gesundheits‐<br />
Check‐Up) wird in mehr als <strong>der</strong> Hälfte<br />
<strong>der</strong> Fälle ein Ruhe‐EKG ohne ausrei‐<br />
chende Indikation durchgeführt.<br />
S. 33<br />
XXI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1996,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />
achten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
(Auftraggeben‐<br />
<strong>der</strong> Minister<br />
Horst Seehofer,<br />
CSU)<br />
Beschäftigung im Gesundheitswesen:<br />
In <strong>an</strong><strong>der</strong>en Bereichen des Wirt‐<br />
schaftslebens werden steigende Um‐<br />
sätze, Gewinne und Beschäftigungs‐<br />
zahlen als Erfolgsmeldung <strong>an</strong>gesehen<br />
und kommen in die Schlagzeilen <strong>der</strong><br />
Medien. Es überrascht daher, dass<br />
<strong>der</strong>artige Entwicklungen im Gesund‐<br />
heitswesen als personalintensiver<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsbr<strong>an</strong>che mit einem<br />
ausgeprägten Anteil <strong>an</strong> Hochtechno‐<br />
logie und mittelständischen Indust‐<br />
riebetrieben in <strong>der</strong> Regel als Kosten‐<br />
explosion und Über<strong>an</strong>gebot wahrge‐<br />
nommen werden. Sie verstärken den<br />
Ruf nach Reformen auch d<strong>an</strong>n, wenn<br />
sich die Versorgung aufgrund des<br />
medizinischen Fortschritts verbessert.<br />
54 Auch die Kliniken zählen nach dieser<br />
Abgrenzung zu den 20 Br<strong>an</strong>chen mit<br />
dem höchsten Beschäftigungszu‐<br />
wachs.<br />
55 Zieldimensionen und Wirkungen des<br />
Gesundheitswesens. Der Rat hat (…)<br />
darauf hingewiesen, dass ein exp<strong>an</strong>‐<br />
dieren<strong>der</strong> Gesundheitssektor auch<br />
einen Wirtschafts‐ und Wachstums‐<br />
faktor darstellt, <strong>der</strong> <strong>an</strong>gesichts seiner<br />
überdurchschnittlichen <strong>Die</strong>nstleis‐<br />
tungs‐ und damit Arbeitsintensität<br />
erhebliche Wirkungen auf dem Ar‐<br />
beitsmarkt ausübt (…). Gleichzeitig<br />
steigert sie die Wohlfahrt des Betrof‐<br />
fenen und schafft über die Regenera‐<br />
tion seiner Arbeitskraft die Voraus‐<br />
setzung für dauerhafte Produktivi‐<br />
S. 38 „Sie verstärken<br />
den Ruf nach<br />
Reformen auch<br />
d<strong>an</strong>n, wenn sich<br />
die Versorgung<br />
aufgrund des<br />
medizinischen<br />
Fortschritts<br />
verbessert“.<br />
S. 41<br />
S. 15 Wachstumspara‐<br />
digma; Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g von<br />
Arbeitsfähigkeit,<br />
Wertschöpfung<br />
und Wachstum.<br />
XXII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR –Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
täts‐ und Kapazitätseffekte. Letztere<br />
unmittelbare Wachstumswirksamkeit<br />
fehlt bei <strong>der</strong> medizinischen Beh<strong>an</strong>d‐<br />
lung eines Rentners, was allerdings<br />
positive Wirkungen auf die Beschäfti‐<br />
gung und die Wohlfahrt nicht aus‐<br />
schließt.<br />
56 Wohlfahrtseffekte von Gesundheits‐<br />
leistungen lassen sich nur mithilfe<br />
partieller Indikatoren und konstruier‐<br />
ter Gesundheitsindizes abbilden und<br />
näherungsweise messen. <strong>Die</strong>sem<br />
Zwecke dienen auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />
Wirkungs‐ bzw. medizinischen Be‐<br />
h<strong>an</strong>dlungsziele finale Outputs in Form<br />
von Outcome‐Indikatoren <strong>der</strong> Morbi‐<br />
dität, <strong>der</strong> Lebenserwartung und <strong>der</strong><br />
Lebensqualität. Hierzu gehören auch<br />
Informationen über die Erreichbarkeit<br />
medizinischer Leistungen sowie<br />
Zeitkosten, Funktionseinbußen,<br />
Verunsicherungen und Leidgefühle<br />
<strong>der</strong> Patienten (…). <strong>Die</strong> programmati‐<br />
sche Devise „Add years to life <strong>an</strong>d life<br />
to years“ bringt dies <strong>an</strong>schaulich zum<br />
Ausdruck. Es gibt zahlreiche Gründe<br />
für die Annahme, dass in entwickel‐<br />
ten Volkswirtschaften im Rahmen<br />
medizinischer Innovationen künftig<br />
<strong>der</strong> Lebensqualität eine wachsende<br />
Bedeutung zukommt.<br />
57 <strong>Die</strong> Wohlfahrtseffekte bilden in<br />
normativer Hinsicht die domin<strong>an</strong>te<br />
Zieldimension und damit das ent‐<br />
scheidende Kriterium für die Frage,<br />
ob und inwieweit Gesundheitsleis‐<br />
tungen eine gesamtwirtschaftliche<br />
S. 16 Normative<br />
Setzung von<br />
Wohlfahrtseffekte<br />
n<br />
„Add years to life<br />
<strong>an</strong>d life to years“<br />
Bedeutung <strong>der</strong><br />
Lebensqualität<br />
nimmt in entwi‐<br />
ckelten Volkswirt‐<br />
schaften zu.<br />
S. 17 Wohlfahrtseffekte<br />
bestimmen,<br />
welche Leistun‐<br />
gen bezahlt<br />
werden und<br />
welche nicht.<br />
XXIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
58 Im Einzelnen k<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Fortschritt in <strong>der</strong><br />
Erkenntnis über Kr<strong>an</strong>kheiten, in einer<br />
Verbesserung <strong>der</strong> medizinischen Möglich‐<br />
keiten, also in den Methoden für Diagno‐<br />
se und Therapie, in <strong>der</strong> Prävention o<strong>der</strong><br />
Rehabilitation erreicht werden.<br />
Berechtigung zukommt und sie in den<br />
Leistungskatalog einer solidarischen<br />
Kr<strong>an</strong>kenversicherung gehören.<br />
Vor dem Hintergrund <strong>der</strong> demografi‐<br />
schen Entwicklung steigt <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
konsumtive Anteil <strong>der</strong> GKV‐Ausgaben<br />
zumindest bis zum Jahr 2030 nahezu<br />
zw<strong>an</strong>gsläufig <strong>an</strong>. In diesem Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g eröffnet die Kr<strong>an</strong>kenpflege,<br />
die nur in geringem Umf<strong>an</strong>ge eine<br />
Substitution von Arbeit durch Kapital<br />
erlaubt, auch erhebliche Beschäfti‐<br />
gungsch<strong>an</strong>cen.<br />
59 In <strong>der</strong> ökonomischen Betrachtung<br />
wird unter Fortschritt eine Verbesse‐<br />
rung des Verhältnisses von Ressour‐<br />
ceneinsatz (Kosten) und gesundheitli‐<br />
chem Ergebnis (Nutzen), d. h. einer<br />
Erhöhung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit, auch<br />
in Bezug auf die Leistungserbringung<br />
verst<strong>an</strong>den. Beide Effekte sind letzt‐<br />
lich wohlfahrtssteigernd. (…) Aus<br />
ökonomischer Sicht kommt <strong>der</strong><br />
Evaluation <strong>an</strong> <strong>der</strong> Nahtstelle zwischen<br />
Innovations‐ und Diffusionsphase<br />
beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />
60 Medizinischer Fortschritt ergibt sich aus<br />
unterschiedlichen Gründen: Unter Einbe‐<br />
ziehung <strong>der</strong> wissenschaftlichen Neugier<br />
und <strong>der</strong> Motivation durch wissenschaftli‐<br />
chen Fortschritt beschreibt die sogen<strong>an</strong>n‐<br />
te „Technologie‐Anstoßhypothese“ die<br />
vom Bereich <strong>der</strong> Grundlagenforschung<br />
Neben Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Angebots‐<br />
und Nachfragebedingungen im<br />
Gesundheitswesen führen auch sehr<br />
unterschiedliche Interessen <strong>der</strong> am<br />
Fortschrittszyklus Beteiligten und ihre<br />
gegenwärtige Koordination dazu, dass<br />
Fortschritt überwiegend ausgaben‐<br />
S. 19 Beschäftigungs‐<br />
ch<strong>an</strong>cen in <strong>der</strong><br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege –<br />
„Kr<strong>an</strong>kenpflege,<br />
die nur in gerin‐<br />
gem Umf<strong>an</strong>ge<br />
eine Substitution<br />
von Arbeit durch<br />
Kapital erlaubt.“<br />
Lineares Ver‐<br />
ständnis von<br />
Fortschritt und<br />
Lebensqualität<br />
(??)<br />
S. 20 Lineares Kosten‐<br />
Nutzen‐<br />
Verständnis im<br />
ökonomischen<br />
Fortschrittsbe‐<br />
griff.<br />
Definition von<br />
Fortschritt.<br />
S. 23 Medizinischer<br />
Fortschritt im<br />
Lichte von Nach‐<br />
frage und Ertrag;<br />
normative Set‐<br />
zung von erfolg‐<br />
reichen und<br />
XXIV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
ausgehende Folgeentwicklung. <strong>Die</strong> soge‐<br />
n<strong>an</strong>nte „Nachfragesog‐ Hypothese“ geht<br />
davon aus, dass die Nachfrage (ausgelöst<br />
u. a. durch ungelöste medizinische Prob‐<br />
leme) den Fortschritt wesentlich determi‐<br />
niert, da zukünftige Ertragserwartungen<br />
die Fortschritts‐ und Entwicklungsaktivitä‐<br />
ten von Ärzten und Unternehmen sowie<br />
im Bereich <strong>der</strong> staatlichen Forschungsför‐<br />
<strong>der</strong>ung bestimmen. D<strong>an</strong>eben för<strong>der</strong>t <strong>der</strong><br />
Wettbewerb systematisch den Fortschritt,<br />
indem er die Akteure zur Entwicklung<br />
neuer und besserer bzw. kostengünstige‐<br />
rer Produkte und Verfahren zwingt. Er<br />
erfüllt insofern eine Anreiz‐ und Selekti‐<br />
onsfunktion, die es erlaubt, „erfolgreiche“<br />
von „erfolglosen“ Innovationen zu tren‐<br />
nen.<br />
61 Bewertung von Gesundheitstechnologien:<br />
Bei einem Health Technology Assessment<br />
(HTA) können drei unterschiedliche Vor‐<br />
gehensweisen gewählt werden:<br />
(…) technologieorientiert, problemorien‐<br />
tiert o<strong>der</strong> projektorientiert (…)<br />
62 Um eine medizinische Technologie<br />
bzw. ein medizinisches Verfahren<br />
umfassend beurteilen zu können, ist<br />
ein mehrstufiges Vorgehen notwen‐<br />
dig:<br />
steigernd wirkt. Eine stärkere Einbin‐<br />
dung <strong>der</strong> Zahler in die Steuerung des<br />
Fortschrittszyklus ist geeignet, das<br />
Interesse <strong>an</strong> einer Kostensenkung zu<br />
stärken (…). Aus diesem Grund ist<br />
eine gezielte Zusammenarbeit von<br />
Leistungserbringern, Kr<strong>an</strong>kenversi‐<br />
cherungen und Herstellern von<br />
entsprechenden Produkten wün‐<br />
schenswert. (Abb. 3 in: SVR 1997, S.<br />
24)<br />
Um allen versicherten gesicherten<br />
Fortschritt zugänglich zu machen, ist<br />
eine unabhängige Clearing‐ Stelle<br />
erfor<strong>der</strong>lich, die Innovationen für alle<br />
Kr<strong>an</strong>kenversicherungen verbindlich<br />
macht. <strong>Die</strong>s soll auch verhin<strong>der</strong>n,<br />
dass durch ein Aushöhlen des Leis‐<br />
tungsumf<strong>an</strong>gs Vorteile im Wettbe‐<br />
werb erreicht werden. <strong>Die</strong>se Funktion<br />
sollte ein neu zu gestalten<strong>der</strong> Aus‐<br />
schuss für neue Untersuchungs‐ und<br />
Beh<strong>an</strong>dlungsverfahren (NUB‐ Aus‐<br />
schuss) o<strong>der</strong> ein entsprechendes<br />
Aufsichtsgremium wahrnehmen.<br />
Für den stationären Sektor gibt es<br />
nur begrenzte Möglichkeiten, die<br />
Diffusion von Technologien zu<br />
steuern. <strong>Die</strong> Großgerätepl<strong>an</strong>ung<br />
ist heute Aufgabe <strong>der</strong> Selbstver‐<br />
erfolglosen Inno‐<br />
vationen nach<br />
marktwirtschaftli‐<br />
chen Gesichts‐<br />
punkten;<br />
These: Einbezug<br />
<strong>der</strong> Zahler in den<br />
Fortschrittszyklus<br />
S. 25 Assessment für<br />
Gesundheitstech‐<br />
nologien<br />
S. 26<br />
XXV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
Identifizierung zu evaluieren<strong>der</strong><br />
Technologien inkl. Einschätzung <strong>der</strong><br />
möglichen bzw. intendierten Wir‐<br />
kung, Formulierung einer präzisen<br />
Fragestellung und Ermittlung <strong>der</strong><br />
verfügbaren wissenschaftlichen<br />
Evidenz (…). Dabei kommt es auf eine<br />
Prioritätensetzung zugunsten <strong>der</strong>je‐<br />
nigen Technologien <strong>an</strong>, die denen<br />
eine individual‐ und bevölkerungs‐<br />
medizinische sowie wirtschaftliche<br />
Bedeutung zukommt. Ziel ist u. a., die<br />
Wirksamkeit unter Idealbedingungen<br />
(Efficacy: homogenes Kr<strong>an</strong>kengut,<br />
st<strong>an</strong>dardisierte Prozeduren, Exper‐<br />
ten) zu beschreiben und mit <strong>der</strong><br />
Wirksamkeit unter Alltagsbedingun‐<br />
gen (Effectiveness: unselektionierte<br />
Patienten, Bedingungen <strong>der</strong> täglichen<br />
Praxis, alle Ärzte) zu vergleichen. <strong>Die</strong>s<br />
ist auch <strong>der</strong> Ansatz <strong>der</strong> evidenzba‐<br />
sierten Medizin und <strong>der</strong> Cochr<strong>an</strong>e<br />
Collaboration. Letztere ist ein inter‐<br />
nationales Netzwerk von Wissen‐<br />
schaftlern, <strong>der</strong>en Reviews sich auf<br />
existierende Studien beziehen.<br />
waltungspartner, die über Vergü‐<br />
tungsregeln Steuerungsmöglich‐<br />
keiten haben. Eine NUB‐ähnliche<br />
Struktur wird für den Bereich <strong>der</strong><br />
stationären Medizin empfoh‐<br />
len(…) bei <strong>der</strong> Zulassung von<br />
Medizinprodukten ist sogar <strong>der</strong><br />
Nachweis des Nutzens weniger<br />
umfassend zu erbringen.<br />
63 <strong>Die</strong> Steigerung <strong>der</strong> Tr<strong>an</strong>sparenz <strong>der</strong><br />
Fin<strong>an</strong>zierung <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Aufgaben <strong>der</strong> Universitätsklinika wird<br />
empfohlen (…). Im internationalen<br />
Vergleich <strong>der</strong> Ausgaben für Gesund‐<br />
heitsforschung ist Deutschl<strong>an</strong>d mit<br />
den öffentlichen Ausgaben vom<br />
Volumen her auf einem akzeptablen<br />
S. 27 Fin<strong>an</strong>zierungssek‐<br />
toren von Unikli‐<br />
niken nicht klar<br />
eingehalten;<br />
Reform des SGB<br />
gefor<strong>der</strong>t; Einbe‐<br />
zug <strong>der</strong> Kassen in<br />
Forschung<br />
XXVI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
64 <strong>Die</strong> medizinischen Fortschritte lassen sich<br />
d<strong>an</strong>ach klassifizieren, in welchem Ver‐<br />
hältnis Ressourceneinsatz und Ergebniser‐<br />
reichung zuein<strong>an</strong><strong>der</strong> stehen.<br />
65 <strong>Die</strong> demografische Entwicklung (absolu‐<br />
te Zunahme älterer Menschen, Zunah‐<br />
me des relativen Anteils älterer Men‐<br />
schen, Zunahme <strong>der</strong> hochbetagten<br />
Menschen)<br />
Wachstumsmärkte im Gesundheitswesen:<br />
Pflege: Ziel <strong>der</strong> Pflege ist es, die Selbst‐<br />
ständigkeit des Pflegebedürftigen zu<br />
erhalten, sobald wie möglich wie<strong>der</strong><br />
herzustellen o<strong>der</strong> ihn zu befähigen, mit<br />
dritten Platz. Ein Teil <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Mittel wird allerdings zugleich auch<br />
für die Kr<strong>an</strong>kenversorgung ausgege‐<br />
ben (z. B. Großgeräte im Bereich von<br />
Unikliniken).<br />
Gesundheitsforschung ist in Deutsch‐<br />
l<strong>an</strong>d im erheblichen Umf<strong>an</strong>g auch<br />
Gegenst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierung durch<br />
die GKV. Im Sinne einer „stillen“<br />
Mitfin<strong>an</strong>zierung klinischer Forschung<br />
werden sehr oft die Kosten <strong>der</strong> Re‐<br />
gelversorgung von Studienpatienten<br />
von <strong>der</strong> GKV getragen. Hier besteht<br />
Bedarf <strong>an</strong> einer Neuregelung des<br />
Sozialgesetzbuches. Im Sinne einer<br />
größeren Tr<strong>an</strong>sparenz sollte eine<br />
regelhafte Einbindung von Vertretern<br />
<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenkassen in die Ethik‐<br />
kommissionen erfolgen, die sämtliche<br />
klinischen Forschungsvorhaben<br />
durchlaufen müssen. <strong>Die</strong>s würde eine<br />
gezieltere Anwendung des GKV‐<br />
fin<strong>an</strong>zierten „Versorgungssockels“<br />
nach sich ziehen. Es wird empfohlen,<br />
einzelnen Kr<strong>an</strong>kenkassen darüber<br />
hinaus die Möglichkeit <strong>der</strong> gezielten<br />
För<strong>der</strong>ung von Forschungsprojekten<br />
einzuräumen.<br />
Folgende gesellschaftliche Verände‐<br />
rungen tragen dazu bei, dass <strong>der</strong><br />
Pflegemarkt sich auf einem Wachs‐<br />
tumspfad befindet:<br />
<strong>Die</strong> demografische Entwicklung<br />
(…) steigende Ansprüche <strong>an</strong> eine men‐<br />
schen‐ und altersgerechte Versorgung im<br />
Alter (Enthospitalisierung) und <strong>der</strong> Rück‐<br />
g<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Laien‐Pflegekapazitäten (Zu‐<br />
nahme von Einpersonenhaushalten und<br />
S. 28<br />
S. 31 Definition von<br />
Pflege orientiert<br />
am Wohlfahrts‐<br />
gewinnparadigma<br />
XXVII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
Einschränkungen in <strong>der</strong> eigenen Lebens‐<br />
gestaltung umzugehen und vielleicht<br />
sogar trotzdem neue Lebensqualität für<br />
sich zu entdecken (…)<br />
Derzeit haben nach einer Erhebung etwa<br />
1,5 Mio Rentner einen „leichte Hilfebe‐<br />
darf“. Rund 885 000 zuhause lebende<br />
Menschen über 65 Jahre haben einen<br />
„erheblichen Pflegebedarf“, womit die<br />
Notwendigkeit <strong>der</strong> Unterstützung beim<br />
Waschen, Anziehen, Essen und <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />
Aktivitäten des täglichen Lebens gemeint<br />
ist. Davon brauchen 389 000 Menschen<br />
tägliche, 335 000 mehrmals tägliche und<br />
105 000 Menschen ständig pflegerische<br />
Leistungen.<br />
(absolute Zunahme älterer Men‐<br />
schen, Zunahme des relativen Anteils<br />
älterer Menschen, die Zunahme <strong>der</strong><br />
hochbetagten Menschen), die relative<br />
Zunahme chronischer Kr<strong>an</strong>kheiten<br />
und <strong>der</strong> Multimorbidität bei älteren<br />
Menschen, steigende Ansprüche <strong>an</strong><br />
eine menschen‐ und altersgerechte<br />
Versorgung im Alter<br />
(Enthospitalisierung) und <strong>der</strong> Rück‐<br />
g<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Laien‐Pflegekapazitäten<br />
(Zunahme von Einpersonenhaushal‐<br />
ten und extrafamiliärer Berufstätig‐<br />
keit von Frauen).<br />
Insgesamt meldet die Bundes<strong>an</strong>stalt<br />
für Arbeit am 30.06.1996 über<br />
527.000 in <strong>der</strong> Pflege Beschäftigte.<br />
Dabei ist zu unterscheiden zwischen<br />
examinierten Personal, Hilfspersonal<br />
und Kr<strong>an</strong>kenpflegeschüler und<br />
‐schülerinnen sowie entsprechenden<br />
Fachgruppen in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>ken‐<br />
und Altenpflege.<br />
Der Pflegedienst <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäuser<br />
wurde in den verg<strong>an</strong>genen Jahren<br />
kontinuierlich ausgeweitet; von 1991<br />
bis 1995 wurde hier eine Zunahme<br />
von ca. 40 000 Pflegekräften ver‐<br />
zeichnet. Im Jahre 1995 waren in<br />
Kr<strong>an</strong>kenhäusern in g<strong>an</strong>z Deutschl<strong>an</strong>d<br />
rund 321 000 Kr<strong>an</strong>kenschwestern/‐<br />
pfleger, 41 000 Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>ken‐<br />
schwestern/‐pfleger und knapp 33<br />
000 Kr<strong>an</strong>kenpflegehelfer und ‐helfe‐<br />
rinnen beschäftigt. Nach wie vor ist in<br />
m<strong>an</strong>chen Bereichen <strong>der</strong> Bundesre‐<br />
publik aber eine Knappheit vor allem<br />
extrafamiliärer Berufstätigkeit von Frau‐<br />
en).<br />
XXVIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
66 Aus ihrer Perspektive versuchen Pflegen‐<br />
de im Kr<strong>an</strong>kenhaus, den gefor<strong>der</strong>ten<br />
Pflegebedarf ins Zentrum <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isati‐<br />
onsprozesse zu rücken. Bezugspflege, die<br />
Aufteilung <strong>der</strong> Station in kleinere über‐<br />
schaubare Einheiten sowie <strong>der</strong> Einsatz<br />
von EDV zur Unterstützung <strong>der</strong> Abstim‐<br />
mungsprozesse zwischen Funktionsbe‐<br />
reich und den bettenführenden Abteilun‐<br />
gen sollen menschliche Nähe mit dem<br />
Erfor<strong>der</strong>nis einer zielgelenkten Arbeitsor‐<br />
g<strong>an</strong>isation verbinden. Ein nicht zu unter‐<br />
schätzen<strong>der</strong> Anteil pflegerischer Arbeit<br />
bezieht sich gerade in den klinischen<br />
Bereichen auf die Hilfe und Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Patienten bei diagnostischen und<br />
therapeutischen Eingriffen. Dazu gehören<br />
auch die technische Vor‐ und Nachberei‐<br />
tung und die teilweise selbstständige<br />
Durchführung medizinischer Maßnahmen.<br />
Eine selbstständige Indikationsstellung,<br />
wie sie sich in den USA entwickelt hat, ist<br />
in <strong>der</strong> Akutpflege – jedenfalls zur Zeit – in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d nicht gegeben.<br />
67 (Der noch bestehende M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Unter‐<br />
stützung durch Information und Kommu‐<br />
nikation liegt <strong>an</strong> den zahlreichen Schwie‐<br />
rigkeiten und Anfor<strong>der</strong>ungen, die dem<br />
Fortschritt <strong>der</strong> Informationstechnik in <strong>der</strong><br />
Pflege im Weg stehen.)<br />
Es fehlen weitgehend akzep‐<br />
tierte und operationalisierte<br />
Pflegediagnosen,<br />
<strong>Die</strong> Integration von medizini‐<br />
scher und Pflegedokumentati‐<br />
<strong>an</strong> qualifizierten Pflegekräften festzu‐<br />
stellen.<br />
Hier können Modulsysteme für die<br />
Abrechnung <strong>der</strong> Leistungen <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung kontraproduktiv<br />
wirken, da sie eine Zerglie<strong>der</strong>ung und<br />
Verteilung <strong>der</strong> Arbeit und damit die<br />
Funktionspflege begünstigen (…) <strong>Die</strong><br />
Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit betriebswirt‐<br />
schaftlichen und M<strong>an</strong>agement<strong>an</strong>sät‐<br />
zen gewinnt auch in <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenpfle‐<br />
ge zunehmend <strong>an</strong> Bedeutung. <strong>Die</strong><br />
Kundenorientierung die Entwicklung<br />
von pflegespezifischen Leitbil<strong>der</strong>n,<br />
die wachsende Bedeutung des opera‐<br />
tiven und strategischen Controlling<br />
und von Qualitätsm<strong>an</strong>agementkon‐<br />
zepten sind Themen, die auch vonsei‐<br />
ten <strong>der</strong> Pflege aktiv aufgegriffen und<br />
interdisziplinär für die Weiterentwick‐<br />
lung des Gesundheitswesens bearbei‐<br />
tet werden müssen. Bedarfsgerechte<br />
und wirtschaftliche Pflege gilt als<br />
übergreifende Ziel‐ und Wertvorstel‐<br />
lung.<br />
Ein beson<strong>der</strong>es Problem stellt die<br />
Qualitätssicherung in <strong>der</strong> häuslichen<br />
Pflege älterer Menschen durch Ange‐<br />
hörige dar. Gerade weil <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong><br />
Laienpflege hier sehr hoch ist, reicht<br />
<strong>der</strong> Ansatz in §37 SGB XI (Abruf eines<br />
Pflegeeinsatzes <strong>der</strong> professionellen<br />
Pflege bei Bezug von Pflegegeld) nicht<br />
aus, zumal er nicht ausdrücklich als<br />
Qualitätssicherung definiert ist und<br />
die professionelle Pflege nur geringen<br />
Der Mehrbedarf <strong>an</strong> pflegerischen Leistun‐<br />
gen für ältere Menschen wird sich in den<br />
kommenden Jahren vor allem im ambu‐<br />
l<strong>an</strong>ten und teilstationären Bereich nie‐<br />
<strong>der</strong>schlagen. <strong>Die</strong> Zahl <strong>der</strong> Pflegekräfte in<br />
diesem Bereich wird aber sicher nicht in<br />
dem Maße weiter steigen wie in den<br />
verg<strong>an</strong>genen Jahren (…). In <strong>der</strong> häuslichen<br />
Versorgungssituation steigt die Anforde‐<br />
rung, die G<strong>an</strong>zheitlichkeit <strong>der</strong> Pflege als<br />
Voraussetzung von Patientenorientierung<br />
und Partnerschaft zu erhalten (…)<br />
Das im Kr<strong>an</strong>kenhausbereich zu bevorzu‐<br />
gende Modell <strong>der</strong> Bezugspflege könnte<br />
auch für die ambul<strong>an</strong>te Versorgung <strong>an</strong>‐<br />
gemessen sein. In <strong>der</strong> stationären Alten‐<br />
hilfe steht jedoch die gefor<strong>der</strong>te Pflege<br />
nach individuellen Bedürfnissen noch am<br />
Anf<strong>an</strong>g.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e innerhalb von institutionel‐<br />
len Zusammenhängen könnte bereits<br />
heute dem Einsatz von Informations‐ und<br />
Kommunikationsdiensten in <strong>der</strong> Pflege<br />
eine größere Bedeutung zukommen. Der<br />
noch bestehende M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Unterstüt‐<br />
zung durch Information und Kommunika‐<br />
tion liegt <strong>an</strong> den zahlreichen Schwierigkei‐<br />
ten und Anfor<strong>der</strong>ungen, die dem Fort‐<br />
schritt <strong>der</strong> Informationstechnik in <strong>der</strong><br />
Pflege im Weg stehen (…). Grundsätzlich–<br />
S. 32 Org<strong>an</strong>isationaler<br />
Blick auf die<br />
Pflege samt<br />
Pflegesystement‐<br />
wicklung<br />
Bedarfsgerechte<br />
und wirtschaftli‐<br />
che Pflege gilt als<br />
übergreifende<br />
Ziel‐ und Wert‐<br />
vorstellung.<br />
S. 33 Kritik <strong>an</strong> SGB,<br />
Qualitätssiche‐<br />
rung in <strong>der</strong> häusli‐<br />
chen Pflege,<br />
Beratungsdefizite,<br />
Kommunikations‐<br />
defizite bedingt<br />
durch technischen<br />
Rückst<strong>an</strong>d<br />
Hinweis auf<br />
XXIX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
on muss gewährleistet werden,<br />
<strong>Die</strong> Verknüpfung <strong>der</strong> Doku‐<br />
mentation mit <strong>der</strong> <strong>Die</strong>nstpla‐<br />
nung ist erfor<strong>der</strong>lich,<br />
<strong>Die</strong> Pflegesysteme sollten in<br />
die bestehenden Kr<strong>an</strong>kenhaus‐<br />
Informationssysteme integriert<br />
werden können,<br />
<strong>Die</strong> EDV‐Systeme müssen so<br />
gestaltet werden, dass die<br />
Pflegenden problemlos damit<br />
umgehen können (funktionale<br />
Effektivität) und<br />
die Pflegenden müssen die<br />
EDV als Hilfe und Arbeitsmittel<br />
begreifen können (…).<br />
68 Unsicherheiten ergeben sich <strong>der</strong>zeit in <strong>der</strong><br />
Pflege älterer Menschen. Hier besteht<br />
<strong>an</strong>gesichts <strong>der</strong> Tätigkeitsentwicklung in<br />
<strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten und stationären Pflege<br />
älterer Menschen ein Bedarf, die Grenz‐<br />
ziehung zwischen altenpflegerischen und<br />
kr<strong>an</strong>kenpflegerischen Tätigkeiten zu<br />
prüfen, um mit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Praxis<br />
Schritt zu halten.<br />
Einfluss auf die Qualität <strong>der</strong> Versor‐<br />
gung durch Laien hat. Hier sind drin‐<br />
gend Modelle <strong>der</strong> qualitätssichernden<br />
Pflegeunterstützung zu entwickeln<br />
(…)<br />
<strong>Die</strong> Möglichkeiten <strong>der</strong> Verkürzung<br />
o<strong>der</strong> Vermeidung von Kr<strong>an</strong>kenhaus‐<br />
aufenthalten, Erfor<strong>der</strong>nisse des<br />
Informationstr<strong>an</strong>sfers und die Ver‐<br />
besserung <strong>der</strong> Pflegequalität machen<br />
deutlich, dass <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> bisher<br />
erst <strong>an</strong>satzweise und modellhaft<br />
erprobten Form des Care‐<br />
M<strong>an</strong>agements zwischen den Instituti‐<br />
onen des Gesundheitswesens not‐<br />
wendig ist. So könnte <strong>der</strong> „Drehtüref‐<br />
fekt“ vermieden werden, d h. die<br />
Wie<strong>der</strong>aufnahme von Patienten ins<br />
Kr<strong>an</strong>kenhaus innerhalb kurzer Zeit<br />
nach <strong>der</strong> Entlassung. Pflegeüberlei‐<br />
tung als neues pflegerisches Arbeits‐<br />
feld bedarf <strong>der</strong> Abstimmung mit den<br />
Aufgaben des Kr<strong>an</strong>kenhaus‐Sozial‐<br />
dienstes und privater Pflegedienste.<br />
<strong>Die</strong> bisherigen Erfahrungen mit<br />
institutionellen Schnittstellen in <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten Pflege, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
baden‐württembergischen Informati‐<br />
ons‐, Anlauf‐ und Vermittlungsstellen<br />
(IAV‐ Stellen) zeigen, dass hier ein<br />
neues pflegerisches Selbstverständnis<br />
und eine klare Schnittstellendefinition<br />
gefor<strong>der</strong>t ist. (…) Inzwischen gibt es in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d eine Reihe von Modellen<br />
des Care M<strong>an</strong>agements bzw. des<br />
Unterstützungsm<strong>an</strong>agements, die<br />
von reinen informations‐ und Ver‐<br />
und nicht nur aus Kostengründen –wird<br />
die ambul<strong>an</strong>te Versorgung gegenüber <strong>der</strong><br />
teilstationären und stationären Versor‐<br />
gung bevorzugt. <strong>Die</strong> Verlagerung von<br />
Beh<strong>an</strong>dlungsabläufen aus dem stationä‐<br />
ren in den ambul<strong>an</strong>ten Bereich führt dazu,<br />
dass schwere Pflegebedürftigkeit ohne die<br />
baulichen, materiellen und technischen<br />
St<strong>an</strong>dards eines Kr<strong>an</strong>kenhauses von den<br />
Pflegenden sach‐ und fachgerecht bewäl‐<br />
tigt werden muss. (…)<br />
Der Aufbau einer eigenen Nomenklatur,<br />
Berufsethik und Wissenschaft entspricht<br />
dem Bedarf <strong>der</strong> Pflege, k<strong>an</strong>n sich jedoch<br />
durch den Aufbau damit einhergehen<strong>der</strong><br />
Verständnisbarrieren auch negativ auf die<br />
Zusammenarbeit mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en Berufs‐<br />
gruppen im Gesundheitswesen auswirken.<br />
Dabei bewirkt die ständische Org<strong>an</strong>isation<br />
und Akademisierung unmittelbar auch<br />
eine größere Dist<strong>an</strong>z zum einzelnen<br />
Nutzer pflegerischer <strong>Die</strong>nstleistungen. Der<br />
Rat unterstützt die For<strong>der</strong>ung nach einer<br />
weitergehenden Professionalisierung <strong>der</strong><br />
Pflegediagnostik<br />
zum Nachweis<br />
von Leistungen im<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit EDV‐ basierter<br />
Unterstützung<br />
„Ambul<strong>an</strong>t vor<br />
stationär“<br />
Herausfor<strong>der</strong>un‐<br />
gen professionel‐<br />
ler Pflege im<br />
ambul<strong>an</strong>ten/<br />
häuslichen Be‐<br />
reich<br />
Care‐<br />
M<strong>an</strong>agement, um<br />
Drehtüreffekt zu<br />
vermeiden.<br />
S. 34 Pflegeüberleitung<br />
als Kooperations‐<br />
form; Schnittstel‐<br />
lenm<strong>an</strong>agement<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflegeri‐<br />
sche Tätigkeits‐<br />
profile in <strong>der</strong><br />
Altenpflege von<br />
Nöten.<br />
Professionalisie‐<br />
rung und Akade‐<br />
misierung wird<br />
XXX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
69 Aus <strong>der</strong> Sicht des medizinischen Versor‐<br />
gungssystems werden durch den Einsatz<br />
<strong>der</strong> Telematik folgende Ch<strong>an</strong>cen gesehen:<br />
Erreichen einer neuen diagnostischen<br />
bzw. therapeutischen Qualität über<br />
innovative Systeme, z. B. im Bereich <strong>der</strong><br />
Bild‐ und Signalverarbeitung, Verbesse‐<br />
rung <strong>der</strong> professionellen Versorgungsqua‐<br />
lität durch schnellere und leichtere Ver‐<br />
fügbarkeit medizinischen Wissens (Doku‐<br />
mentation, Telekonsultation, Wissens‐<br />
b<strong>an</strong>ken)<br />
mittlungsstellen bis zu spezialisierten<br />
Beratungsdiensten reichen. In Zu‐<br />
kunft sind stärker integrative Modell‐<br />
projekte erfor<strong>der</strong>lich. Eine entschei‐<br />
dende Rolle für die Entwicklung eines<br />
aus pflegerischer Sicht leistungsfähi‐<br />
gen Unterstützungsm<strong>an</strong>agements<br />
wird die Frage spielen, inwieweit die<br />
z. T. mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> konkurrierenden<br />
ambul<strong>an</strong>ten, teilstationären und<br />
stationären Einrichtungen im Interes‐<br />
se einer optimalen Unterstützung <strong>der</strong><br />
Pflegebedürftigen zu kooperativen<br />
Verfahrensweisen (bei gleichzeitiger<br />
Wahrung <strong>der</strong> eigenen Interessen)<br />
bewegt werden können. (…)<br />
Ein ergebnisorientiertes und qualita‐<br />
tiv gesichertes Gesundheitssystem<br />
erfor<strong>der</strong>t ein abgestimmtes Mitei‐<br />
n<strong>an</strong><strong>der</strong> <strong>der</strong> Berufsgruppen.<br />
Medizinische Telematik:<br />
In Deutschl<strong>an</strong>d lassen sich Einsparef‐<br />
fekte sowohl für Versorgungseinrich‐<br />
tungen, Kr<strong>an</strong>kenkassen und Versiche‐<br />
rungen und darüber hinaus letztend‐<br />
lich auch für Versicherte, Patienten,<br />
Arbeitgeber und öffentliche Körper‐<br />
schaften erwarten.<br />
70 Ein neuer, sich rasch ausbreiten<strong>der</strong><br />
Marktbereich besteht in den Informa‐<br />
tions‐ und Kommunikationsdiensten.<br />
71<br />
Der Rat hält die Bildung von nationalen<br />
und regionalen Arbeitsgemeinschaften für<br />
Pflege, wo sie erfor<strong>der</strong>lich ist. <strong>Die</strong>se<br />
Entwicklung sollte nicht zulasten <strong>der</strong><br />
Laienpflege erfolgen. Der Rat sieht eine<br />
bleibende Notwendigkeit für ein koopera‐<br />
tives Mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> von ärztlichen und<br />
pflegerischen Leistungen. <strong>Die</strong> jüngst<br />
entfachte Debatte um die Qualität <strong>der</strong><br />
Altenpflege und <strong>der</strong> Leistungen im Rah‐<br />
men des Pflegeversicherungsgesetzes<br />
deute auf Bereiche, die einer kritischen<br />
Analyse bedürfen.<br />
S. 35<br />
S. 38<br />
S. 40<br />
einschränkend<br />
positiv gesehen,<br />
Akademisierung<br />
als Hin<strong>der</strong>nis?<br />
Hinweis auf<br />
bestehendes<br />
Rollengefüge vor<br />
dem Alibi <strong>der</strong><br />
Verständigung mit<br />
Zielgruppe und<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Berufs‐<br />
gruppen<br />
„Professionalisie‐<br />
rung <strong>der</strong> Pflege,<br />
wo sie erfor<strong>der</strong>‐<br />
lich ist“<br />
XXXI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
erfor<strong>der</strong>lich, die sich um die Entwicklung<br />
bzw. Empfehlung von St<strong>an</strong>dards für<br />
wichtige inhaltlich‐technische Themen‐<br />
komplexe kümmern. Zusätzlich wäre eine<br />
klare Einordnung solcher Arbeitsgemein‐<br />
schaften in Entscheidungsprozesse des<br />
<strong>deutschen</strong> Gesundheitswesens sinnvoll,<br />
um die Ver<strong>an</strong>twortung für den<br />
Telematikeinsatz in <strong>der</strong> Versorgung ein‐<br />
deutiger zu regeln.<br />
73 Als Wachstumsmarkt erscheint neben<br />
den innovativen Präparaten von <strong>der</strong><br />
Ausgabenentwicklung her auf den<br />
ersten Blick auch die Selbstmedikati‐<br />
on mit Arzneimitteln (…). Verglichen<br />
mit <strong>an</strong>dren Märkten, wie z. B. <strong>der</strong><br />
Pflege, birgt die pharmazeutische<br />
Industrie ein eher bescheidenes<br />
Beschäftigungspotential.<br />
75 Integration geriatrischer Rehabilitati‐<br />
on und <strong>der</strong> Pflegeversicherung: Hilf‐<br />
reich wäre es, wenn mithilfe des<br />
medizinischen <strong>Die</strong>nstes von vornhe‐<br />
rein pro Pflegestufe bestimmte<br />
Quoten für Rehabilitationsbedürftige<br />
vorgegeben würden. <strong>Die</strong>se Quoten<br />
sollten als Anstoß verst<strong>an</strong>den werden<br />
und daher nur temporär gelten.<br />
Dauerhafte Abhilfe k<strong>an</strong>n aber nur<br />
dadurch geschaffen werden, dass die<br />
Pflegekassen selbst die Kosten <strong>der</strong><br />
Rehabilitation übernehmen. Fazit:<br />
Der Rat empfiehlt trotz <strong>der</strong> beschrie‐<br />
benen Schwierigkeiten die Weiter‐<br />
entwicklung <strong>der</strong> ergebnisorientierten<br />
Vergütung. Bonuszahlungen empfeh‐<br />
len sich als Element <strong>der</strong> Gesamt‐<br />
vergütung. Eine wichtige Voraussetz‐<br />
ung ist die Tr<strong>an</strong>sparenz <strong>der</strong> Ergebnis‐<br />
S. 47<br />
S. 76<br />
Entstaatlichung<br />
XXXII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
qualität <strong>der</strong> Leistungserbringer. Von<br />
beson<strong>der</strong>er Bedeutung k<strong>an</strong>n die leit‐<br />
linienorientierte Vergütung sein (…)<br />
Es ist die Selbstverwaltung und nicht<br />
<strong>der</strong> Gesetzgeber aufgefor<strong>der</strong>t, Ergeb‐<br />
nisorientierung zu för<strong>der</strong>n, indem sie<br />
zu Leistungstr<strong>an</strong>sparenz beiträgt und<br />
erfolgsorientierte Vergütungsformen<br />
einsetzt, wo immer sich eine sinnvolle<br />
Möglichkeit dazu bietet.<br />
76 Nach zweijähriger Arbeit des SVR<br />
zeigt sich erneut, dass ein sich um‐<br />
strukturierendes Gesundheitswesen<br />
in einem sozial gebundenen Wettbe‐<br />
werbsrahmen mit mehr Selbststeue‐<br />
rungskraft den Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Zukunft besser gewachsen sein<br />
wird. <strong>Die</strong> Globalisierung <strong>der</strong> wirt‐<br />
schaftlichen Beziehungen und die In‐<br />
dividualisierung im Rahmen des ge‐<br />
sellschaftlichen Struktur‐ und Werte‐<br />
w<strong>an</strong>dels erfor<strong>der</strong>n auch im Gesund‐<br />
heitswesen vielfältige strukturelle<br />
Verän<strong>der</strong>ungen (…). Unter neuen<br />
Fin<strong>an</strong>zierungsmodalitäten und unter<br />
wettbewerblichen Bedingungen kön‐<br />
nen steigende Umsätze, Beschäfti‐<br />
gungszahlen und Gewinne unter ge‐<br />
samtwirtschaftlichen Aspekten auch<br />
im Gesundheitswesen als Erfolgsmel‐<br />
dung <strong>an</strong>gesehen werden. (…) Wohl‐<br />
fahrt, Wachstum und Beschäftigung<br />
sind die tragenden Zieldimensionen<br />
und Wirkungen des Gesundheitswe‐<br />
sens.<br />
77 Mit <strong>der</strong> Pflege, <strong>der</strong> medizinischen<br />
Telematik, den Medizinprodukten<br />
<strong>Die</strong> Globalisierung <strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />
Beziehungen und die Individualisierung im<br />
Rahmen des gesellschaftlichen Struktur‐<br />
und Wertew<strong>an</strong>dels erfor<strong>der</strong>n auch im<br />
Gesundheitswesen vielfältige strukturelle<br />
Verän<strong>der</strong>ungen (…).<br />
Das sich abzeichnende strukturelle<br />
Wachstum verbunden mit dem zuneh‐<br />
menden Anteil älterer Menschen lässt<br />
neue Berufe entstehen und öffnet neue<br />
Tätigkeitsfel<strong>der</strong><br />
S. 77 Selbstver<strong>an</strong>twor‐<br />
tung und Selbst‐<br />
steuerung unter<br />
Wettbewerbsbe‐<br />
dingungen;<br />
Globalisierung<br />
wirtschaftlicher<br />
Beziehungen und<br />
Individualisie‐<br />
rungsprozesse<br />
erfor<strong>der</strong>n struktu‐<br />
rellen W<strong>an</strong>del.<br />
Kernaussage:<br />
Wohlfahrt,<br />
Wachstum und<br />
Beschäftigung<br />
sind die tragen‐<br />
den Zieldimensio‐<br />
nen und Wirkun‐<br />
gen des Gesund‐<br />
heitswesens<br />
S. 78<br />
XXXIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten 1997,<br />
B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />
geben<strong>der</strong><br />
Minister Horst<br />
Seehofer, CSU)<br />
80<br />
und dem Arzneimittelmarkt werden<br />
konkrete Wachstumsmärkte mit<br />
überwiegend internationaler Bedeu‐<br />
tung herausgestellt.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Vergütung ambul<strong>an</strong>t<br />
vor stationär erbrachter Gesundheits‐<br />
leistungen ist eine stärkere Ergebnis<br />
und Patientenorientierung geboten.<br />
Mehr Tr<strong>an</strong>sparenz über das Leis‐<br />
tungsgeschehen ist dafür eine unver‐<br />
zichtbare Voraussetzung. In diesem<br />
Kontext plädiert <strong>der</strong> Rat für ergebnis‐<br />
bezogene Bonuszahlungen im Rah‐<br />
men mehrschichtiger Vergütungssys‐<br />
teme mit einer Verknüpfung <strong>der</strong><br />
Vergütung <strong>an</strong> zu entwickelnde Leitli‐<br />
nien<br />
S. 79<br />
Bonuszahlun‐<br />
gen/Belohung für<br />
Leitlinien und<br />
Ergebnisorientie‐<br />
rung<br />
XXXIV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />
gebende Minis‐<br />
terin Andrea<br />
Fischer, <strong>Die</strong><br />
Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
81 Das deutsche Gesundheitswesen<br />
leidet <strong>an</strong> einer m<strong>an</strong>gelnden Orientie‐<br />
rung im Hinblick auf explizite gesund‐<br />
heitliche Ziele, was fast zw<strong>an</strong>gsläufig<br />
zu einer Überbetonung <strong>der</strong> Diskussi‐<br />
on über die Ausgabenebene führt. (…)<br />
Infolge dieser einseitigen Betrach‐<br />
tungsweise reduzierten sich die<br />
meisten ‚Gesundheitsreformen‘ auf<br />
reine Kostendämpfungsmaßnahmen.<br />
Der Domin<strong>an</strong>z <strong>der</strong> Ausgabenbetrach‐<br />
tung könnte und sollte mit einer<br />
breiten und öffentlichen Zieldiskussi‐<br />
on begegnet werden, welche die<br />
<strong>an</strong>zustrebenden Outcome‐<br />
Indikatoren und die daraus abzulei‐<br />
tenden Versorgungsziele themati‐<br />
siert.<br />
82 Vorsichtig formuliert stützen die<br />
entsprechenden Ergebnisse in keiner<br />
Weise die hierzul<strong>an</strong>de liebgewonnene<br />
These, dass Deutschl<strong>an</strong>d über das<br />
„beste Gesundheitswesen <strong>der</strong> Welt“<br />
verfügt. Interess<strong>an</strong>terweise schneidet<br />
das deutsche Gesundheitswesen<br />
jeweils bei <strong>der</strong> Zielerreichung besser<br />
ab, als bei <strong>der</strong> Leistungsfähigkeit<br />
insgesamt, die die Ressourcenebene<br />
bei <strong>der</strong> Bewertung mit einschließt.<br />
83 <strong>Die</strong> individuelle Kompetenzsteigerung <strong>der</strong><br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung entspricht in<br />
Teilelementen dem weitergehenden<br />
(zusätzlich einen ‚Kohärenzsinn‘ postulie‐<br />
renden) ‚Salutogenese‘‐ Konzept von<br />
Antonovsky (1987). Der Rat hält dieses<br />
Modell für theoretisch <strong>an</strong>regend, aber in<br />
<strong>der</strong> Praxis noch nicht belastbar. Auch in<br />
<strong>der</strong> Theorie stellen ein zeitgemäß mo<strong>der</strong>‐<br />
nisiertes ‚pathogenetisches‘ und ein<br />
‚salutogenetisches‘ Modell keine ein<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
Eine Schwerpunktbildung auf Präven‐<br />
tion entspräche auch dem Geist des<br />
Sozialgesetzbuches, das in §1 SGBV<br />
unter den Aufgaben <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenver‐<br />
sicherung als Solidargemeinschaft die<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Gesundheit gleich‐<br />
berechtigt neben die Erhaltung und<br />
Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong>selben gestellt<br />
hat. (…) Investitionen in Kr<strong>an</strong>kheits‐<br />
verhütung könnten nicht nur – durch<br />
Verlängerung von Lebensdauer und<br />
<strong>Die</strong> Lebenserwartung und die verlorenen<br />
Lebensjahre stellen zwar valide und<br />
relev<strong>an</strong>te Outcome‐Indikatoren dar, sie<br />
bilden aber nur einen beschränkten Teil<br />
des weiten Zielspektrums <strong>der</strong> Gesund‐<br />
heitsversorgung ab. Sie berücksichtigen<br />
we<strong>der</strong> Verteilungsaspekte (Ungleichheit<br />
von Gesundheitsch<strong>an</strong>cen und Versor‐<br />
gungsergebnissen) noch den vielschichti‐<br />
gen Zielbereich <strong>der</strong> Lebensqualität.<br />
S. 17 Zielorientierung<br />
und Kostendämp‐<br />
fung (aktive statt<br />
reaktive Sichtwei‐<br />
se, Betonung <strong>der</strong><br />
Notwendigkeit<br />
einer öffentlichen<br />
Diskussion)<br />
S. 20<br />
S. 26 Einsparpotential<br />
durch Prävention<br />
XXXV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
ausschließenden Gegensätze dar. (…) Bei<br />
<strong>der</strong> Entwicklung von Präventionsstrate‐<br />
gien, ‐programmen und ‐maßnahmen<br />
sollte immer nach Bedienaspekten gefragt<br />
werden: Welche Belastungen können im<br />
Hinblick auf Kr<strong>an</strong>kheitsvermeidung ge‐<br />
senkt werden und welche gesundheitli‐<br />
chen Ressourcen könne gestärkt werden?<br />
Prävention – darauf weist <strong>der</strong> Rat wie<strong>der</strong>‐<br />
holt hin (JG 1988, SG 1995 und 1996) –<br />
kommt zur Verbesserung <strong>der</strong> Gesundheit<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung eine hohe und zuneh‐<br />
mende Bedeutung zu.<br />
84 Für den wissenschaftlichen Input in eine<br />
solche Zieldebatte zur Ermittlung von ge‐<br />
sundheitspolitischen Prioritäten in <strong>der</strong><br />
Prävention (und damit immer auch<br />
Posterioritäten) empfiehlt <strong>der</strong> Rat grund‐<br />
sätzlich die gleichen Kriterien wie für die<br />
Bestimmung einer bedarfsgerechten<br />
Versorgung: d<strong>an</strong>ach sollte das zu<br />
prävenierende Gesundheitsproblem –<br />
bezogen auf die Gesamtbevölkerung o<strong>der</strong><br />
definierte Teilpopulation(en).<br />
Eine <strong>an</strong>gemessene Häufigkeit<br />
aufweisen (Inzidenz/Prävalenz)<br />
Von medizinischer Relev<strong>an</strong>z<br />
sein (Kr<strong>an</strong>kheitsschwere)<br />
Volkswirtschaftliche Relev<strong>an</strong>z<br />
aufweisen (direkte und indi‐<br />
rekte Kosten).<br />
<strong>Die</strong> Prävention sollte wirksam<br />
sein und keine unvertretbaren<br />
unerwünschten Wirkungen<br />
entfalten sowie fachgerecht<br />
erbracht werden können und<br />
<br />
<br />
eine akzeptable Wirksamkeits‐<br />
Kosten‐ Relation aufweisen.<br />
Verbesserung von Lebensqualität –<br />
einen höheren gesundheitlichen<br />
Nutzen, son<strong>der</strong>n auch Einsparungen<br />
im Gesundheitssystem bewirken.<br />
Theoretisch (bei nicht saldierter uns<br />
nicht diskontierter Betrachtung)<br />
lassen sich rund 25−30 % <strong>der</strong> heuti‐<br />
gen Gesundheitsausgaben in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d durch l<strong>an</strong>gfristige Prä‐<br />
vention vermeiden.<br />
S. 27<br />
XXXVI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
85 Ein Überblick über die Präventions<strong>an</strong>ge‐<br />
bote einer Region ist oft nicht vorh<strong>an</strong>den,<br />
aber wünschenswert. Der Rat empfiehlt,<br />
Prävention als Thema in die regionalen<br />
und überregionalen Gesundheitsberichte<br />
mit aufzunehmen. Der Rat plädiert eben‐<br />
so für die Bildung themen‐ bzw. zielgrup‐<br />
penspezifischer sowie ggf. institutionen‐<br />
und hierarchienübergreifen<strong>der</strong> Koalitio‐<br />
nen. (…) Als fruchtbar erweist sich dem‐<br />
gegenüber <strong>der</strong> Ordnungsgesichtspunkt<br />
<strong>der</strong> Zielgruppe. Zielgruppen können<br />
territorial (z. B. Einwohner einer administ‐<br />
rativen Gemeinde bzw. einer Region),<br />
sozial (z. B. Menschen in ähnlicher sozialer<br />
Lage o<strong>der</strong> mit ähnlichem Lebensstil), nach<br />
Altersgruppen (z. B. Lebensphase Alter),<br />
nach gemeinsamen Risikomerkmalen,<br />
nach Risikolevel o<strong>der</strong> kontextbezogen<br />
(‚Setting‘) definiert sein. Eine konsequen‐<br />
te Zielgruppenorientierung <strong>der</strong> Prävention<br />
führt zu genauerer Beschäftigung mit den<br />
– objektiven wie subjektiven – Belastun‐<br />
gen und Ressourcen, den durch diese<br />
mitbestimmten Bedingungen gesunden<br />
Lebens sowie zu klarerer Zug<strong>an</strong>gs und<br />
Interventionspl<strong>an</strong>ung.<br />
86 Der Rat empfiehlt, sich in Zukunft noch<br />
stärker auf Interventionen nach dem<br />
Setting‐ Ansatz (vor allem Betrieb, Schule)<br />
zu orientieren.<br />
87 Welche Teilrolle die gesetzliche<br />
Kr<strong>an</strong>kenversicherung in <strong>der</strong> Präventi‐<br />
onspolitik dabei übernehmen k<strong>an</strong>n<br />
und soll, ist kaum wissenschaftlich,<br />
son<strong>der</strong>n eher politisch zu bestimmen.<br />
S. 28<br />
S. 29<br />
S. 30 Rolle <strong>der</strong> Versi‐<br />
cherer<br />
XXXVII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
88 Der Rat plädiert nachdrücklich dafür,<br />
Fel<strong>der</strong>, Formen und Akteure <strong>der</strong> Präventi‐<br />
on zum Best<strong>an</strong>dteil des notwendigen<br />
gesamtgesellschaftlichen Diskussionspro‐<br />
zesses über Gesundheitsziele zu machen,<br />
um auf diese Weise auch eine breitere<br />
Öffentlichkeit mit <strong>der</strong> begrenzten Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> rein kurativen Medizin für die<br />
Gesundheit und den Potenzialen und<br />
Ver<strong>an</strong>twortlichkeiten von Prävention<br />
vertraut zu machen.<br />
89 <strong>Die</strong> hohen präventiven Potenziale bei<br />
älteren Menschen werden traditionell<br />
erheblich unterschätzt. Der Rat hat darauf<br />
bereits in seinem Son<strong>der</strong>gutachten 1996<br />
hingewiesen. Er sieht hier insbeson<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben <strong>der</strong> Kassen im Rahmen des § 20<br />
SGBV, aber auch <strong>der</strong> ärztlichen Praxen<br />
und Kliniken (im Sinne einer clinical<br />
preventive medicine): Der Rat weist<br />
darauf hin, dass nahezu alle epidemiolo‐<br />
gisch wichtigen Erkr<strong>an</strong>kungen im Alter<br />
(Herz‐Kreislauf‐Erkr<strong>an</strong>kungen, Diabetes<br />
mellitus Typ II, Atemwegserkr<strong>an</strong>kungen,<br />
Osteoporose und Stürze, Infektionskr<strong>an</strong>k‐<br />
heiten, Inkontinenz sowie bestimmte<br />
psychische Erkr<strong>an</strong>kungsformen) auch im<br />
fortgeschrittenen Erwachsenenalter große<br />
präventive Potenziale aufweisen. <strong>Die</strong>se<br />
präventiven Potenziale ließen sich erfolg‐<br />
versprechend durch Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
Lebensweise, vor allem im Hinblick auf<br />
Bewegungsverhalten, Ernährung und das<br />
Lebensumfeld sowie durch eine mo<strong>der</strong>ne<br />
funktionale Durchdringung ärztlicher<br />
Versorgung mit Elementen <strong>der</strong> klinischen<br />
Präventionsmedizin ausschöpfen. Um<br />
diese Potenziale zu realisieren, sollten<br />
Gesellschaftliches und professionelles<br />
Leitbild sollte die Ermöglichung ‚erfolgrei‐<br />
chen Alterns‘ sein.(…) Weil auch im Alter<br />
Gesundheitsch<strong>an</strong>cen sozial ungleich<br />
verteilt sind, erfor<strong>der</strong>t die Ermittlung und<br />
Ausgestaltung von Zug<strong>an</strong>gswegen und<br />
Interventionstypen speziell für vulnerable<br />
Zielgruppen beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit.<br />
S. 31<br />
S. 33 Erfolgreiches<br />
Altern als Leit‐<br />
bildkonstruktion<br />
Soziale Ungleich‐<br />
heit und Gesund‐<br />
heitspotenzial<br />
XXXVIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
sich Maßnahmen und Strategien nicht<br />
allein auf die Verhütung von Kr<strong>an</strong>kheiten<br />
beziehen, son<strong>der</strong>n vielmehr den gesam‐<br />
ten Alterungsprozess mit seinen funktio‐<br />
nellen Einschränkungen und dem drohen‐<br />
den o<strong>der</strong> tatsächlichen Verlust <strong>an</strong> kör‐<br />
perlicher und mentaler Fitness sowie den<br />
daraus resultierenden Problemen <strong>der</strong><br />
sozialen Integration berücksichtigen. (…)<br />
Primär‐, Sekundär‐ und Tertiärprävention<br />
sollten unter Betonung des Aspekts <strong>der</strong><br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung hemmende Bedin‐<br />
gungen hierfür wo möglich beseitigen und<br />
för<strong>der</strong>nde Bedingungen stärken.<br />
90 Der Rat sieht Forschungs‐ und Entwick‐<br />
lungsbedarf im Hinblick auf Methoden<br />
und Formen, wie solche Verän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Lebensweise unter Alltagsbedingun‐<br />
gen bewerkstelligt werden können. Aus‐<br />
gehend von erfolgreichen Modellen<br />
müsste geprüft werden, welche von<br />
älteren Menschen genutzte Settings und<br />
welche Gesellungsformen älterer Men‐<br />
schen für die Initiierung und Beför<strong>der</strong>ung<br />
solcher Entwicklungen genutzt werden<br />
können. Dabei sind insbeson<strong>der</strong>e auch die<br />
nach Bildungsgrad, Berufsbiografie und<br />
sozialer Schicht unterschiedlichen Kom‐<br />
munikations‐ und Lebensstile zu berück‐<br />
sichtigen, ebenso a‐priori‐Häufigkeiten<br />
von Symptomen und Kr<strong>an</strong>kheiten, ihre<br />
Stadien und Komplikationen.<br />
91 Zur Systematisierung präventiver Leistun‐<br />
gen trägt das geriatrische Assessment bei.<br />
Ein hausärztliches, assessment‐gestütztes<br />
Vorsorgeprogramm für ältere Patienten,<br />
das <strong>an</strong> den Versorgungsbeson<strong>der</strong>heiten<br />
S. 34<br />
S. 35 Geriatrisches<br />
Assessment<br />
XXXIX
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d I<br />
<strong>der</strong> Primärmedizin <strong>an</strong>setzt, stellt einen<br />
potentiell wichtige Schritt zur Qualitäts‐<br />
steigerung von Prävention in <strong>der</strong> Haus‐<br />
arztpraxis dar.<br />
92 Der Nutzer k<strong>an</strong>n nur bedingt in <strong>der</strong> Rolle<br />
eines Kunden gesehen werden, <strong>der</strong> eigen‐<br />
ver<strong>an</strong>twortlich Entscheidungen trifft und<br />
Wahlmöglichkeiten nutzt. Je weiter sich<br />
<strong>der</strong> Nutzer auf dem Kontinuum zwischen<br />
Gesundheit und Kr<strong>an</strong>kheit in Richtung<br />
Kr<strong>an</strong>kheit o<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit be‐<br />
wegt, desto eher tritt die Fähigkeit zu ra‐<br />
tionalen Entscheidungen in den Hinter‐<br />
grund und wird überlagert durch Unsi‐<br />
cherheit, Ängste sowie dem Wunsch und<br />
Bedarf nach Hilfe, Fürsorge und Betreu‐<br />
ung.<br />
93 Staat und parastaatliche Institutionen<br />
sollten eine größere Bereitschaft<br />
zeigen, dem Nutzer mehr direkte<br />
Mitspracherechte einzuräumen. Dazu<br />
gehört eine <strong>an</strong>gemessene Beteiligung<br />
von Betroffenen in wichtigen Bera‐<br />
tungsgremien, z. B. den Bundesaus‐<br />
schüssen <strong>der</strong> Ärzte und Kr<strong>an</strong>kenkas‐<br />
sen o<strong>der</strong> sonstigen geeigneten Gre‐<br />
mien <strong>der</strong> Sozialversicherung (z. B. <strong>der</strong><br />
Qualitätssicherung o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong><br />
Aufstellung von Hilfsmittellisten)<br />
einschließlich <strong>der</strong> Medizinischen<br />
<strong>Die</strong>nste (z. B. bei Verfahren <strong>der</strong><br />
Pflegeeinstufung).<br />
Auch in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Institutionen des<br />
Gesundheitssystems (Kr<strong>an</strong>kenhäusern,<br />
Altenheime etc.) sind die Strukturen <strong>der</strong><br />
Partizipation von Nutzern noch rudimen‐<br />
tär. Der Rat empfiehlt, aus den Erfahrun‐<br />
gen mit Heimbeiräten in den Alters‐ und<br />
Pflegeheimen o<strong>der</strong> mit Patientenvertre‐<br />
tern in den Kr<strong>an</strong>kenhäusern Konsequen‐<br />
zen für den Aufbau von Strukturen <strong>der</strong><br />
Teilhabe und Mitsprache von Laien in den<br />
Einrichtungen des Gesundheitswesens zu<br />
ziehen.<br />
94 An abschätzbaren Folgen und Ch<strong>an</strong>cen<br />
einer Kompetenzerhöhung und eines<br />
Partizipationsfortschritts, die noch einmal<br />
<strong>der</strong>en systemprägende Wirkungen her‐<br />
vorheben, könnten sich ergeben (u. a.<br />
S. 40<br />
S. 43 Partizipation und<br />
Mitsprache<br />
S. 44<br />
XL
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR –Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II (2001)<br />
95<br />
Auswahl, Anm. MB.): Es könnte zu einer<br />
erwünschten (o<strong>der</strong> unerwünschten)<br />
Verlagerung von Gesundheitsleistungen in<br />
den Selbstbeh<strong>an</strong>dlungsbereich kommen<br />
(z. B. familiäre Leistung bei Pflege, Selbst‐<br />
beh<strong>an</strong>dlung bei leichten Erkr<strong>an</strong>kungen).<br />
Es ist zu erwarten, dass sich die Gesund‐<br />
heitsversorgung spürbar verän<strong>der</strong>n wird,<br />
z. B. durch revolutionierende Innovatio‐<br />
nen, kürzer werdenden Verfallszeiten des<br />
Wissens, verän<strong>der</strong>te Kontexte, sich w<strong>an</strong>‐<br />
delnde Versorgungsstrukturen und nicht<br />
zuletzt durch die verän<strong>der</strong>te Rolle des<br />
Patienten sowie neue partizipative Ent‐<br />
scheidungsformen. Damit ergeben sich<br />
neue Anfor<strong>der</strong>ungsprofile für die Gesund‐<br />
heitsberufe.(…) Berufe in Medizin und<br />
Pflege werden ihre Entscheidungen in<br />
wesentlich weiteren Bezugsrahmen, wie<br />
sie sich aus neuen ethischen, wirtschaftli‐<br />
chen und patientenbezogenen Bewer‐<br />
tungsmustern ergeben, zu treffen und<br />
rechtfertigen haben. (…)<br />
Tendenziell muss es nach Auffassung des<br />
Rates darum gehen, die Professionalisie‐<br />
rungswege in Medizin und Pflege zu<br />
flexibilisieren und auf grundlegende<br />
Kompetenzen sowie berufsbegleitende<br />
Kontinuität hin auszurichten. <strong>Die</strong>s erlaubt<br />
es Ärzten und Pflegekräften, verän<strong>der</strong>ten<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen eigenständig gerecht zu<br />
werden. Neben die Aneignung aktuellen<br />
Wissens und entsprechen<strong>der</strong> Fähigkeiten<br />
muss somit ein fortgesetzter Professio‐<br />
nalisierungsprozess treten, <strong>der</strong> bereits in<br />
<strong>der</strong> Ausbildung eingeleitet und <strong>an</strong>gelegt<br />
wird. Daraus folgt, dass eine st<strong>an</strong>dardi‐<br />
sierte berufsbegleitende Sicherung <strong>der</strong><br />
jeweils aktuell erfor<strong>der</strong>lichen Qualifikati‐<br />
onen zugunsten <strong>der</strong> Wissensvermittlung<br />
relativ <strong>an</strong> Bedeutung gewinnen wird.<br />
S. 47<br />
XLI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
96 Insgesamt wird <strong>der</strong> Pflegebereich als<br />
eine Zukunfts‐ und Wachstumsbr<strong>an</strong>‐<br />
che beschrieben. <strong>Die</strong> begründete<br />
Zunahme des Bedarfs <strong>an</strong> Pflege hat<br />
aber bisl<strong>an</strong>g nicht zu <strong>der</strong> immer<br />
wie<strong>der</strong> prognostizierten größeren<br />
Nachfrage am Arbeitsmarkt geführt.<br />
97 <strong>Die</strong> gesetzliche Kr<strong>an</strong>kenversicherung<br />
möchte sich aus <strong>der</strong> Ausbildungsfi‐<br />
n<strong>an</strong>zierung zurückziehen, was für die<br />
Ausbildungsträger zu einem Nachteil<br />
in <strong>der</strong> Personalrekrutierung werden<br />
könnte.<br />
<strong>Die</strong>se kontinuierliche professionelle Ent‐<br />
wicklung zu för<strong>der</strong>n ist Aufgabe aller<br />
Gesundheitsberufe, ihrer Vereinigungen<br />
und <strong>der</strong> sie beschäftigenden Institutionen.<br />
Gleichzeitig (zum Akademisierungspro‐<br />
zess, Anm. MB.) gibt es in den Pflege‐ und<br />
Sozialberufen Entwicklungen einer De‐<br />
Professionalisierung, die zu einer Schwä‐<br />
chung <strong>der</strong> personellen Ressourcen in <strong>der</strong><br />
Pflege führen. Im zeitlichen Vergleich von<br />
1996−1999 ging die Zahl <strong>der</strong> qualifizierten<br />
Mitarbeiter in <strong>der</strong> Altenpflege zurück. In<br />
dieser Zeit stieg die Zahl <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
ohne Qualifikation in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten und<br />
stationären Altenpflege um das Sechsfa‐<br />
che. Über diverse Bildungsmaßnahmen<br />
entstehen seit Einführung des Pflegeversi‐<br />
cherungsgesetzes neue Teilqualifikatio‐<br />
nen, die partiell zur Verdrängung von<br />
Pflegefachkräften führen. Solche Entwick‐<br />
lungen wi<strong>der</strong>sprechen den Anfor<strong>der</strong>un‐<br />
gen <strong>an</strong> die Pflege, die sich aus dem demo‐<br />
grafischen W<strong>an</strong>del, dem W<strong>an</strong>del des<br />
Kr<strong>an</strong>kheitsspektrums, den verän<strong>der</strong>ten<br />
gesetzlichen Grundlagen sowie aus tech‐<br />
nischer und wissenschaftlicher Innovation<br />
ergeben. Nach wie vor gehören zu den<br />
zentralen Problemfe<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Bil‐<br />
dungssituation in den Pflege‐ und Sozial‐<br />
berufen die unzureichende Durchlässig‐<br />
keit <strong>der</strong> Pflegebildungsstrukturen, die<br />
S. 54<br />
S. 55 Verdrängungsef‐<br />
fekte in <strong>der</strong><br />
Altenpflege, De‐<br />
Professionalisie‐<br />
rungstendenzen<br />
XLII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
98 <strong>Die</strong> Ausbildungsinhalte <strong>der</strong> Erstausbildung<br />
in den Pflegeberufen müssen im Hinblick<br />
auf neue Anfor<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Rehabilita‐<br />
tion, <strong>der</strong> Prävention, <strong>der</strong> Ange‐<br />
hörigenberatung, aber auch <strong>der</strong> Technik‐<br />
und Telematikentwicklung überprüft<br />
werden. Außerdem sollte eine Ausbil‐<br />
dungsreform in <strong>der</strong> Pflege den Überg<strong>an</strong>g<br />
von <strong>der</strong> h<strong>an</strong>dwerklich‐technischen Orien‐<br />
tierung zur individualisierenden, wissen‐<br />
schaftlich begründeten Bezugspflege<br />
realisieren. (…) Eine Pflegemitarbeiterbe‐<br />
richterstattung, die die Pflegeerwerbstäti‐<br />
gen differenziert nach Berufsqualifikation<br />
und ‐position erfasst, sollte aufgebaut<br />
werden. Darüber hinaus sollten entspre‐<br />
chende ‚Pflegedichteziffern‘ zur Ermitt‐<br />
lung des zukünftigen Bedarfs <strong>an</strong> Qualifika‐<br />
tion und Spezialisierung <strong>der</strong> Pflegekräfte<br />
berechnet werden. Dazu gehört auch eine<br />
evidenzbasierte Pl<strong>an</strong>ung <strong>der</strong> Ausbildungs‐<br />
kapazitäten in den Pflegeberufen zur<br />
Vermeidung von zukünftigen Engpässen<br />
<strong>an</strong> qualifizierten Personal.<br />
Der Rat empfiehlt zur Optimierung<br />
<strong>der</strong> personellen Ressourcen in den<br />
Pflege‐ und Sozialberufen: Eine<br />
Überwindung <strong>der</strong> Trennung zwischen<br />
Gesundheits‐ und Sozialpflegeberufen<br />
muss weiter verfolgt werden. Bereits<br />
heute wird deutlich, dass die Berufs‐<br />
realität die Alten‐ und Kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
in weiten Bereichen vereint und auf<br />
dem Arbeitsmarkt eine gegenseitige<br />
Ersetzbarkeit <strong>der</strong> Fachkräfte erkenn‐<br />
bar ist. Darüber hinaus würde diese<br />
Strategie die Mobilität <strong>der</strong> Fachkräfte<br />
in Europa erhöhen. Zu diesem Zweck<br />
sollte die Grundausbildung in den<br />
Pflegeberufen zusammen geführt<br />
werden und überdies ihre Integration<br />
in das tertiäre Bildungssystem geprüft<br />
werden. <strong>Die</strong>s würde zu einer größe‐<br />
ren Durchlässigkeit <strong>der</strong> Qualifikations‐<br />
ebenen führen, die Aufstiegsmöglich‐<br />
keiten im Berufsfeld erhöhen und<br />
somit die Attraktivität <strong>der</strong> Berufe<br />
steigern. Mit dieser Integration<br />
würde auch die Fin<strong>an</strong>zierung <strong>der</strong><br />
Pflegeausbildung normalisiert.<br />
99 Qualitätsentwicklung setzt eine<br />
bestimmte Entwicklung <strong>der</strong> Professi‐<br />
on voraus. (…) Der Rat empfiehlt in<br />
Son<strong>der</strong>stellung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenpfle‐<br />
geausbildung im Berufsbildungssystem, ü‐<br />
berholte Ausbildungsinhalte, zum Teil<br />
unzureichend qualifizierte Dozenten<br />
sowie die in vieler Hinsicht unzeitgemäße<br />
Trennung gesundheits‐ und sozialpflege‐<br />
rischer Berufsausbildungen.<br />
<strong>Die</strong> akademische Qualifizierung sollte<br />
geför<strong>der</strong>t werden. <strong>Die</strong>s beinhaltet eine<br />
kontinuierliche Nachwuchsför<strong>der</strong>ung und<br />
den gerichteten und schwerpunktmäßi‐<br />
gen Ausbau pflegequalifizieren<strong>der</strong> Studi‐<br />
engänge <strong>an</strong> Universitäten und Fachhoch‐<br />
schulen sowie die Schaffung notwendiger<br />
infrastruktureller Bedingungen für die<br />
weitere Wissenschaftsentwicklung auch in<br />
Form von nationalen und internationalen<br />
Forschungsverbünden.<br />
<strong>Die</strong> Pflege befindet sich zum Teil im<br />
Überg<strong>an</strong>g von einem traditionellen Hel‐<br />
ferberuf in eine mo<strong>der</strong>ne Gesundheits‐<br />
S. 56 Zusammenfüh‐<br />
rung von Alten‐<br />
und Kr<strong>an</strong>kenpfle‐<br />
ge, Prüfung<br />
tertiärer Bildung<br />
Entwicklung <strong>der</strong><br />
Wissenschaft<br />
Pflegemitarbei‐<br />
terberichterstattu<br />
ng<br />
S. 80 Entwicklung <strong>der</strong><br />
PW im Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g mit<br />
XLIII
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
diesem Zusammenh<strong>an</strong>g die Etablie‐<br />
rung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d vor<strong>an</strong>zubringen, z. B.<br />
durch Weiterentwicklung von Studi‐<br />
engängen und verstärkte Forschungs‐<br />
för<strong>der</strong>ung. Es gibt in <strong>der</strong> Pflege ein<br />
deutliches Missverhältnis zwischen<br />
<strong>der</strong> Breite <strong>der</strong> Diskussionen über<br />
Qualitätssicherung und <strong>der</strong>en Umset‐<br />
zung. Untersuchungen zur Umsetzung<br />
von Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
in <strong>der</strong> Pflege zeigen, dass Unsicher‐<br />
heit und Skepsis gegenüber <strong>der</strong><br />
Qualitätssicherung <strong>der</strong>en Wirkung<br />
deutlich einschränkt. An<strong>der</strong>s als z. B.<br />
im <strong>an</strong>gloamerik<strong>an</strong>ischen Bereich<br />
gehört das Qualitätsm<strong>an</strong>agement<br />
noch nicht selbstverständlich zur<br />
Arbeitskultur und zur professionellen<br />
H<strong>an</strong>dlungsweise. In Deutschl<strong>an</strong>d gibt<br />
es so gut wie keine berufsrechtlichen<br />
Regelungen für die Pflege, die sicher‐<br />
stellen könnten, dass fachpflegerische<br />
Aufgaben auf dem zu for<strong>der</strong>nden<br />
Niveau erbracht und einer Qualitäts‐<br />
sicherung zugeführt werden. Der Rat<br />
empfiehlt daher, berufsrechtliche<br />
qualitätsbezogene Regelungen zu<br />
Vorbehaltsaufgaben und Org<strong>an</strong>isati‐<br />
onsformen zu erarbeiten und zu<br />
implementieren. Abbildung 7 (An‐<br />
satzebenen qualitätssichern<strong>der</strong><br />
Maßnahmen in <strong>der</strong> Pflege, aufgeteilt<br />
in Makro‐, Meso und Mikroebene und<br />
strikt nach Struktur,‐ Prozess‐ und<br />
Ergebnisorientierung)<br />
100 Professionelle Pflege ist beson<strong>der</strong>s im<br />
Kr<strong>an</strong>kenhaus eingebettet in einen<br />
profession Qualitätssiche‐<br />
rung<br />
S. 81<br />
Qualitätssiche‐<br />
rung nach Maß‐<br />
gabe Struktur‐,<br />
Prozess‐, Ergebnis<br />
(Donabedi<strong>an</strong>)<br />
Abb. <strong>an</strong>gelehnt <strong>an</strong><br />
Ewers, M. (1998)<br />
XLIV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
Prozess <strong>der</strong> gesundheitlichen Versor‐<br />
gung, <strong>an</strong> dem die unterschiedlichsten<br />
Professionen beteiligt sind. <strong>Die</strong>sem<br />
Prozess ist eine wechselseitige Pro‐<br />
fessionen‐übergreifende Kontrolle im<br />
Sinne einer Qualitätssicherung inhä‐<br />
rent. <strong>Die</strong>s gilt insbeson<strong>der</strong>e für die<br />
Überschneidungen <strong>der</strong> Tätigkeiten<br />
unterschiedlicher Professionen, die<br />
gegenseitiger Kontrolle bedürfen. (...)<br />
In <strong>der</strong> Pflege zeigt sich dies durch die<br />
überwiegend auf den Pflegekontext<br />
bezogene und nur vom Pflegeperso‐<br />
nal geführte Qualitätsdiskussion<br />
unter Ausschluss z. B. <strong>der</strong> Ärzte. Der<br />
Rat empfiehlt deshalb, die in § 137b<br />
SGBV gesetzlich ver<strong>an</strong>kerte sektoren‐<br />
und berufsgruppenübergreifende<br />
Qualitätssicherung praktisch umzu‐<br />
setzen. Entsprechendes gilt für die<br />
Novellierung <strong>der</strong> Qualitätssicherung<br />
<strong>der</strong> Pflege nach SGB XI.<br />
101 <strong>Die</strong> individuelle Dimension <strong>der</strong> Pfle‐<br />
gequalität (Patientenzufriedenheit)<br />
wird gegenwärtig nicht genügend<br />
beachtet. Der Rat empfiehlt daher, in<br />
Zukunft solche Qualitätssicherungs‐<br />
maßnahmen zu bevorzugen, die den<br />
Nutzer in den Mittelpunkt stellen.<br />
Dazu gehören neben <strong>der</strong> weiteren<br />
Ablöse <strong>der</strong> Funktionspflege durch die<br />
Bezugspflege auch eine verpflichten‐<br />
de, flächendeckende, wirksame und<br />
zielgruppenspezifische Anleitung von<br />
pflegenden Angehörigen. Erfahrun‐<br />
gen und Urteile <strong>der</strong> Pflegebedürftigen<br />
und ihrer Angehörigen sollten als<br />
entscheiden<strong>der</strong> Faktor eines funktio‐<br />
S. 82 Individuelle<br />
Dimension (Pati‐<br />
entenzufrieden‐<br />
heit) unter „ver‐<br />
pflichtenden“,<br />
„flächendecken‐<br />
den“, „wirksa‐<br />
men“ und „ziel‐<br />
gruppenspezifi‐<br />
schen“ Aspekten<br />
(Anleitung von<br />
pflegenden Ange‐<br />
hörigen)<br />
Ablöse <strong>der</strong> Funk‐<br />
XLV
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
nierenden Qualitätsm<strong>an</strong>agements<br />
begriffen werden. Auch wenn Einig‐<br />
keit darüber besteht, dass die Qua‐<br />
lität und das Qualitätsbewusstsein in<br />
den Einrichtungen selbst wachsen<br />
müssen, ist Qualitätssicherung in <strong>der</strong><br />
Pflege von heute vor allem durch eine<br />
Vielzahl externer Maßnahmen ge‐<br />
kennzeichnet, d. h. sie folgt vorr<strong>an</strong>gig<br />
dem Druck gesetzlicher Vorgaben und<br />
k<strong>an</strong>n zu kontraproduktiven Effekten<br />
in den Institutionen führen. Quali‐<br />
tätssicherung und ‐verbesserung ist<br />
jedoch eine originäre Aufgabe <strong>der</strong><br />
Pflegeeinrichtungen und <strong>der</strong> Pflege‐<br />
berufe. Eine Qualitätsgar<strong>an</strong>tie muss<br />
perspektivisch zum Selbstverständnis<br />
je<strong>der</strong> Pflegeeinrichtung gehören.<br />
Externe Prüfungen können diesen<br />
Prozess nur begleiten. Letztendlich<br />
sind es die Pflegenden vor Ort, die die<br />
Optimierung von Qualität gewährleis‐<br />
ten müssen. Sektionen zur Ermittlung<br />
von Pflegeschäden (z. B. Dekubital‐<br />
geschwüre) und un<strong>an</strong>gemeldete<br />
Kontrollbesuche sind wirksame<br />
externe Maßnahmen, um Qualitäts‐<br />
mängel in <strong>der</strong> Pflege zu identifizieren.<br />
Bei ihrem Einsatz sollte jedoch beach‐<br />
tet werden, dass die Qualitätsent‐<br />
wicklung nicht allein von außen in<br />
eine Einrichtung ‚hineinkontrolliert‘<br />
werden k<strong>an</strong>n. Unter Beachtung dieses<br />
Vorbehalts spricht sich <strong>der</strong> Rat für<br />
den Einsatz <strong>der</strong> o. g. Maßnahmen <strong>der</strong><br />
Qualitätssicherung aus. Nach Ansicht<br />
des Rats sollten bei Zertifizierungen<br />
den pflegspezifischen Parametern <strong>der</strong><br />
tionspflege durch<br />
Bezugspflege<br />
Qualitätsver‐<br />
pflichtung inner‐<br />
halb <strong>der</strong> Pflege<br />
selbst „originäre<br />
Aufgabe“<br />
Qualitätsgar<strong>an</strong>tie<br />
als Selbstver‐<br />
ständnis <strong>der</strong><br />
Einrichtung<br />
Kontrollen un<strong>an</strong>‐<br />
gemeldet<br />
Ergebnisorientie‐<br />
rung<br />
XLVI
Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />
SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />
gutachten<br />
2000/2001,<br />
(Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Andrea Fischer,<br />
<strong>Die</strong> Grünen)<br />
B<strong>an</strong>d II<br />
Ergebnisqualität eine stärkere Beach‐<br />
tung geschenkt werden. <strong>Die</strong>se Zertifi‐<br />
kate sollten nach objektiv nachvoll‐<br />
ziehbaren Kriterien von unabhängi‐<br />
gen Kommissionen vergeben werden<br />
und für die Nutzer tr<strong>an</strong>sparent sein.<br />
102 Abschließend sei noch einmal die<br />
zentrale For<strong>der</strong>ung gen<strong>an</strong>nt, die <strong>der</strong><br />
Rat <strong>an</strong>gesichts <strong>der</strong> bevorstehenden<br />
Einführung des AR‐DRG Systems in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d stellt. Nach aus‐<br />
ländischen Erfahrungen ist aufgrund<br />
des zu erwartenden Rückg<strong>an</strong>gs <strong>der</strong><br />
Kr<strong>an</strong>kenhausverweildauern mit<br />
deutlichen Mehrbelastungen <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten und stationären, ärztli‐<br />
chen und pflegerischen Nach‐<br />
sorgestrukturen (sowohl nach SGB V,<br />
IX und XI) zu rechnen. <strong>Die</strong>se Struktu‐<br />
ren müssen schnittstellengenau,<br />
qualitätsbewusst und synchron<br />
entwickelt werden, um Nachteile für<br />
Patienten zu vermeiden.<br />
AR‐DRG System,<br />
Hinweis auf<br />
Konsequenzen,<br />
aber kein Lö‐<br />
sungsvorschläge<br />
XLVII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftrag‐<br />
gebende Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
103 Ältere Menschen leiden in <strong>der</strong> Regel <strong>an</strong><br />
mehreren Erkr<strong>an</strong>kungen, die zudem häufig<br />
chronisch verlaufen (...) (National Center of<br />
Health Statistics); demnach nehmen im<br />
höheren Alter degenerative und entzündli‐<br />
che Gelenkerkr<strong>an</strong>kungen zu. Zudem kom‐<br />
men sensorische Einbußen, wobei die Hör‐<br />
einbußen gegenüber den Seheinbußen<br />
deutlich dominieren, woraus Risiken für die<br />
Selbstständigkeit (wie auch für die Kommu‐<br />
nikationsfähigkeit) erwachsen.<br />
104 <strong>Die</strong> Prävalenz für schwere und mäßig<br />
schwere Demenz nimmt mit steigendem<br />
Alter zu (…) <strong>Die</strong> Demenzen bilden eine <strong>der</strong><br />
häufigsten Ursachen von Pflegebedürftig‐<br />
keit. Ungefähr 50 % aller pflegebedürftigen<br />
Menschen leiden <strong>an</strong> einer Demenz. <strong>Die</strong> Pfle‐<br />
ge demenzkr<strong>an</strong>ker Menschen ist für Ange‐<br />
hörige mit beson<strong>der</strong>en psychischen und<br />
physischen Belastungen verbunden. <strong>Die</strong><br />
physischen Belastungen ergeben sich vor<br />
allem d<strong>an</strong>n, wenn demenzkr<strong>an</strong>ke Menschen<br />
ihre Mobilität weitgehend verloren haben<br />
und Unterstützung bei <strong>der</strong> Ausführung von<br />
Bewegungsabläufen benötigen. Gründe für<br />
die psychischen Belastungen sind neben <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Persönlichkeit <strong>der</strong> De‐<br />
menzkr<strong>an</strong>ken abnehmende Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Kommunikation, Angst vor möglichen<br />
Affektausbrüchen des Demenzkr<strong>an</strong>ken<br />
sowie zunehmende Isolation von <strong>der</strong> Au‐<br />
ßenwelt. Wenn m<strong>an</strong> bedenkt, dass ca. 90 %<br />
aller Pflegebedürftigen von einem Fami‐<br />
lienmitglied betreut werden, so wird auch<br />
deutlich, wie hoch <strong>der</strong> Interventionsbedarf<br />
ist, um die betreffenden Familien zu entlas‐<br />
ten. (…) Genauso wie in <strong>der</strong> Familie besteht<br />
S. 24<br />
S. 25 Demenz in Ver‐<br />
bindung mit<br />
Belastung<br />
XLVIII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
in <strong>der</strong> stationären Altenarbeit ein hoher<br />
Interventionsbedarf.<br />
105 <strong>Die</strong> rehabilitative Pflege demenzkr<strong>an</strong>ker<br />
Menschen zielt vor allem auf die Nutzung<br />
bestehen<strong>der</strong> Funktionen und Fertigkeiten<br />
durch umfassende Aktivierung. (…) hierzu:<br />
Bedeutende Merkmale <strong>der</strong> Wohnraumge‐<br />
staltung sind: Barrierefreiheit und Prothetik,<br />
ausreichende Bewegungsmöglichkeiten,<br />
verbunden mit integrierten Grenzziehung,<br />
ausreichen<strong>der</strong> Anregungsgehalt <strong>der</strong> Um‐<br />
welt, Beachtung <strong>der</strong> Relation von Privatheit<br />
und Gemeinschaftlichkeit. (…) <strong>Die</strong> Über‐<br />
schaubarkeit <strong>der</strong> Wohnung und des Wohn‐<br />
umfeldes , die ausreichende Anzahl von<br />
Fenstern, die auch ein „Fenster zur Welt“<br />
darstellen sowie die Auswahl von Gegen‐<br />
ständen, durch <strong>der</strong>en Nutzung die Sinnesor‐<br />
g<strong>an</strong>e, vertraute H<strong>an</strong>dlungsabläufe und<br />
Tätigkeitsmuster <strong>an</strong>geregt werden (ohne<br />
dabei den Menschen zu überfor<strong>der</strong>n),<br />
bilden bedeutende Merkmale <strong>der</strong> stimulie‐<br />
renden Umwelt (…) <strong>Die</strong> Segregation de‐<br />
menzkr<strong>an</strong>ker Menschen ist zu vermeiden –<br />
eine For<strong>der</strong>ung, <strong>der</strong>en Umsetzung auch<br />
durch die Beachtung <strong>der</strong> Relation von<br />
Privatheit und Gemeinschaftlichkeit bei <strong>der</strong><br />
Wohnraumgestaltung geför<strong>der</strong>t wird.<br />
106 <strong>Die</strong> alternde Gesellschaft gewinnt ihre<br />
Zukunft nur durch Jüngere und Älter‐<br />
werdende gemeinsam.<br />
107 <strong>Die</strong> alternde Gesellschaft k<strong>an</strong>n ihre Zu‐<br />
kunftsfähigkeit auf wirksame Weise am<br />
ehesten durch Mehrgenerationenkonzep‐<br />
te sichern: im Arbeitssystem durch Mehr‐<br />
generationenarbeit, im Bildungssystem<br />
durch Mehrgenerationenbildung, im<br />
S. 26 Aktivitätspara‐<br />
digma!<br />
S. 29<br />
Anregende Um‐<br />
welten!<br />
Keine Segregation<br />
demenzkr<strong>an</strong>ker<br />
Menschen!<br />
S. 31 Generationen‐<br />
übergreifende<br />
Denkweise und<br />
Kompetenzaufbau<br />
XLIX
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
108 Bei ausgeprägter Pflegebedürftigkeit kommt<br />
es außerdem auf die Zusammenarbeit von<br />
informellen Hilfenetzen und professioneller<br />
Unterstützung <strong>an</strong>.<br />
109 In Deutschl<strong>an</strong>d ist, wie auch in fast allen<br />
Mitgliedsstaaten <strong>der</strong> Europäischen<br />
Union und <strong>an</strong><strong>der</strong>en Industrielän<strong>der</strong>n,<br />
die Bevölkerungsentwicklung durch<br />
l<strong>an</strong>gfristige Trends gekennzeichnet:<br />
Eine niedrige Geburtenrate und die<br />
steigende durchschnittliche Lebenser‐<br />
wartung führen zu einem zunehmenden<br />
Anteil älterer Menschen, einem stagnie‐<br />
renden und zukünftig abnehmenden<br />
Anteil <strong>der</strong> mittleren Generation zwi‐<br />
schen 20 und 60 Jahren sowie zu einem<br />
sinkenden Anteil von Kin<strong>der</strong>n und<br />
Jugendlichen. Zunehmende Bedeutung<br />
erl<strong>an</strong>gt auch die räumliche Bevölke‐<br />
Wohnungswesen durch Mehrgeneratio‐<br />
nenwohnen usw. <strong>Die</strong>s erfor<strong>der</strong>t entspre‐<br />
chende Kompetenzen.<br />
Übersehen wird aber häufig, dass, wenn<br />
es um eine verlässliche alltägliche Unter‐<br />
stützung geht, die Erreichbarkeit ent‐<br />
scheidend ist. D<strong>an</strong>n sind nicht nur nahe<br />
wohnende Verw<strong>an</strong>dte, son<strong>der</strong>n auch<br />
Nachbarn wichtige und im Ernstfall in<br />
ihrer Bedeutung wachsende Ansprech‐<br />
partner und Hilfeleistende. Das Bild des<br />
sozialen Netzwerkes muss daher kombi‐<br />
niert werden mit dem Bild des räumlichen<br />
Netzwerkes. Es kommt auf ein realisti‐<br />
sches soziales Raumbild <strong>an</strong>!<br />
(…) <strong>Die</strong> verbreitete Individualisierungs‐<br />
theorie findet we<strong>der</strong> in den Lebensplänen<br />
<strong>der</strong> Jüngeren noch in <strong>der</strong> Lebensrealität<br />
<strong>der</strong> Netzwerke eine überzeugende Bestä‐<br />
tigung. <strong>Die</strong> Verallgemeinerung eines nicht<br />
durchgängig vorkommenden Typus ist<br />
nicht begründet.<br />
S. 42 Soziale und räum‐<br />
liche Netzwerke<br />
sind entschei‐<br />
dend,<br />
Hilfenetz mit<br />
professionellen<br />
Anbietern kombi‐<br />
nieren<br />
Mythos<br />
„Individualiserung<br />
stheorie“!<br />
S. 48 Niedrige Gebur‐<br />
tenrate, zuneh‐<br />
men<strong>der</strong> Anteil<br />
Älterer, Bevölke‐<br />
rungsw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung<br />
Höhere Lebens‐<br />
erwartung <strong>der</strong><br />
Frauen, Alters‐<br />
probleme sind v.<br />
a. Dingen weibli‐<br />
che Probleme.<br />
L
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
rungsbewegung, die einerseits als<br />
Binnenw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung die Verteilung <strong>der</strong><br />
Bevölkerung im Raum und <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits<br />
als Außenw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung die Bevölkerungs‐<br />
bil<strong>an</strong>z beeinflusst (…) Eine (…) allgemein<br />
höhere Lebenserwartung <strong>der</strong> Frauen,<br />
die auch in Zukunft die Geschlechter‐<br />
proportion bestimmen wird. <strong>Die</strong>s<br />
bedeutet, dass mit dem Alterungs‐<br />
prozess einhergehende wirtschaftliche,<br />
soziale und gesundheitliche Probleme<br />
als auch spezifische Auswirkungen im<br />
Kontext <strong>der</strong> Wohnsituation vor allem<br />
Probleme von Frauen sind und sein<br />
werden. Berechnungen auf <strong>der</strong> Grund‐<br />
lage <strong>der</strong> 8. Koordinierten Bevölkerungs‐<br />
vorausschätzung des Statistischen<br />
Bundesamtes gehen für das Jahr 2040<br />
von einem Anteil <strong>der</strong> 60‐Jährigen und<br />
älteren Frauen <strong>an</strong> <strong>der</strong> weiblichen Bevöl‐<br />
kerung von rund 38 % aus. Der männli‐<br />
che Anteil wird mit voraussichtlich 32 %<br />
niedriger liegen.<br />
110 <strong>Die</strong> ausländische Bevölkerung ist erheb‐<br />
lich jünger als die deutsche. In allen<br />
Altersgruppen, auch bei den Älteren,<br />
sind Männer stärker vertreten, sodass<br />
m<strong>an</strong> bei den Auslän<strong>der</strong>n nicht von einer<br />
„Feminisierung des Alters“ sprechen<br />
k<strong>an</strong>n. Bis zum Jahr 2010 soll <strong>der</strong> Anteil<br />
<strong>der</strong> älteren Auslän<strong>der</strong> und Auslän<strong>der</strong>in‐<br />
nen <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung auf<br />
etwa 1,3 Mio. <strong>an</strong>wachsen. <strong>Die</strong>s ent‐<br />
spricht 6,4 % <strong>der</strong> über 60‐Jährigen in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d.<br />
111 Ein wesentliches Resultat <strong>der</strong> demogra‐<br />
fischen Entwicklung ist die wachsende<br />
S. 50 Anteil <strong>der</strong> älteren<br />
ausländischen<br />
Bevölkerung<br />
S. 53 Zunahme und<br />
Feminisierung <strong>der</strong><br />
LI
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
Zahl und <strong>der</strong> relativ steigende Anteil <strong>der</strong><br />
80‐Jährigen und Älteren <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamt‐<br />
bevölkerung. Ihre Zahl wird aufgrund<br />
<strong>der</strong> rückläufigen Alterssterblichkeit<br />
stärker steigen als die <strong>der</strong> über 60‐<br />
Jährigen (…) Bei den Hochaltrigen<br />
besteht ein größerer Frauenüberschuss<br />
als bei den Älteren insgesamt.<br />
112 <strong>Die</strong> Zahl <strong>der</strong> hochbetagten Menschen in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d wird, gem. BfLR‐Prognose,<br />
bis zum Jahr 2010 von knapp 3,3 Mio<br />
(Ende 1993) auf über 4,1 Mio <strong>an</strong>wach‐<br />
sen.<br />
113 <strong>Die</strong> 8. Koordinierte Bevölkerungsvo‐<br />
rausschätzung geht von einer Verdop‐<br />
pelung des Altenquotienten bis zum<br />
Jahr 2040 aus. Kamen 1995 im Bundes‐<br />
durchschnitt noch 36 ab 60‐Jährige auf<br />
100 Personen im Alter zwischen 20 und<br />
59 Jahren, werden es im Jahre 2040<br />
voraussichtlich etwa 73 Personen sein.<br />
114 <strong>Die</strong> durchschnittliche Lebenserwartung<br />
bei <strong>der</strong> Geburt hat sich in den letzten<br />
100 Jahren in Deutschl<strong>an</strong>d etwa ver‐<br />
doppelt und steigt weiter. Dabei hat<br />
sich <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Lebenserwartung<br />
bei <strong>der</strong> Geburt sowie die fernere Le‐<br />
benserwartung im Alter von 60 Jahren<br />
seit den 50er‐Jahren in Mittel‐ und<br />
Westdeutschl<strong>an</strong>d weitgehend parallel<br />
vollzogen (mit stärkeren Zunehmen im<br />
Westen in den 1970er‐ und 80er‐Jah‐<br />
ren). Ebenso ist die Lebenserwartung<br />
<strong>der</strong> Frauen mit einer Differenz von ca.<br />
vier Jahren im Jahre 1950 und ca. sie‐<br />
ben Jahren im Jahre 1994 durchgängig<br />
S. 55<br />
Hochaltrigen<br />
S. 56 Verdopplung des<br />
Altenquotienten<br />
im Jahr 2040<br />
S. 60<br />
LII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
höher als diejenige <strong>der</strong> Männer.<br />
115 <strong>Die</strong> BfLR geht im Rahmen ihrer Bevölke‐<br />
rungsprognose für den Zeitraum 1995‐<br />
2010 von einem Anstieg <strong>der</strong> Lebenser‐<br />
wartung in Westdeutschl<strong>an</strong>d bei den<br />
Frauen auf gut 81 Jahre und bei den<br />
Männern auf fast 75 Jahre aus. Dabei<br />
wird die Lebenserwartung in Mittel‐<br />
deutschl<strong>an</strong>d etwas schneller <strong>an</strong>steigen,<br />
sodass sich die bestehenden Differen‐<br />
zen gegenüber Westdeutschl<strong>an</strong>d ver‐<br />
ringern werden. <strong>Die</strong> geschlechtsspezifi‐<br />
sche unterschiedliche Lebenserwartung<br />
von fast sieben Jahren bleibt hingegen<br />
erhalten.<br />
116 <strong>Die</strong> Gruppe <strong>der</strong> 50‐ bis unter 80‐<br />
Jährigen wird bis zum Jahre 2010 auf<br />
etwa 28,9 Mio. zunehmen. <strong>Die</strong>s ent‐<br />
spricht einem Zuwachs von etwa 17 %<br />
gegenüber 1993.<br />
117 Für das Jahr 2040 wird ein Anwachsen<br />
<strong>der</strong> Zahl Hochaltriger (80+) auf etwa 5,3<br />
Mio. geschätzt.<br />
118 <strong>Die</strong> Hochaltrigen (80+) haben zwar eine<br />
hohe Wachstumsrate, in absoluten<br />
Zahlen h<strong>an</strong>delt es sich aber nur um ein<br />
Mehr von ca. 2 Mio. Menschen. We‐<br />
sentlich gravieren<strong>der</strong> ist die wachsende<br />
Zahl <strong>der</strong> jüngeren Alten (65−79‐Jährige)<br />
um etwa 5 Mio. Menschen (auch wenn<br />
die Wachstumsrate geringer ist). Auch<br />
<strong>der</strong> Anteil <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung<br />
wird mit etwa 20 % erheblich sein. Im<br />
Unterschied zum absoluten und <strong>an</strong>teili‐<br />
Unter Beibehaltung <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Versorgungsrate von 17 % würde <strong>der</strong><br />
Bedarf <strong>an</strong> beson<strong>der</strong>en Wohnformen von<br />
550 00 Plätzen heute auf 900 000 Plätze<br />
steigen.<br />
Wenn <strong>der</strong> Versorgungsgrad <strong>der</strong> jüngeren<br />
Alten von bisher ca. 3 % gleich bliebe,<br />
wäre <strong>der</strong> zunehmende Bedarf ebenfalls<br />
erheblich (…). Das Bedürfnis nach <strong>der</strong><br />
Erhaltung selbstständiger Wohnformen<br />
dürfte gerade bei dieser (kommenden)<br />
Altersgruppe eher stärker als schwächer<br />
ausgeprägt sein, vorausgesetzt, dass die<br />
Wohnverhältnisse altersgerecht sind.<br />
Solche neuen Wohnformen sollten so<br />
beschaffen sein, dass sie auch noch ge‐<br />
S. 62<br />
S. 66<br />
S. 94<br />
S. 95 <strong>Die</strong> Überalterung<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft<br />
hält sich in Gren‐<br />
zen.<br />
<strong>Die</strong> häufig ge‐<br />
n<strong>an</strong>nte Feminisie‐<br />
rung des Alters<br />
und damit auch<br />
die<br />
Singularisierung<br />
LIII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
gen Wachstum <strong>der</strong> Zahl Hochaltriger<br />
bleibt das Verhältnis zwischen<br />
Hochaltrigen und jüngeren Alten mit<br />
etwa 25 % fast unverän<strong>der</strong>t. Auch 2040<br />
wird nur je<strong>der</strong> vierte ältere Mensch<br />
(65+) hochaltrig sein. Bei <strong>der</strong> großen<br />
Gruppe <strong>der</strong> jüngeren Alten wird es 2040<br />
fast genauso viele Männer wie Frauen<br />
geben (Frauen<strong>an</strong>teil ca. 52 % gegenüber<br />
heute ca 61 %). Auch bei den<br />
Hochaltrigen wird <strong>der</strong> hohe Frauen<strong>an</strong>‐<br />
teil zurückgehen (von 73 % 1995 auf<br />
63 % 2040).<br />
119 Während die Altenbevölkerung (65+)<br />
um etwa 7 Mio. zunehmen wird, ist bei<br />
den Jüngeren (bis 65 Jahren) ein Rück‐<br />
g<strong>an</strong>g 17 Mio. zu erwarten. <strong>Die</strong> drama‐<br />
tisch wachsenden Anteile <strong>der</strong> alten<br />
Bevölkerung rühren zum großen Teil<br />
aus <strong>der</strong> Betrachtung in Bezug auf den<br />
Rückg<strong>an</strong>g jüngerer Bevölkerungsgrup‐<br />
pen. <strong>Die</strong> größte Verän<strong>der</strong>ung in absolu‐<br />
ten Zahlen findet bei <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong><br />
16− 40‐Jährigen statt. Der Rückg<strong>an</strong>g<br />
wird etwa10 Mio. Menschen betragen<br />
(jüngere Erwerbsfähige). Bei den Kin‐<br />
<strong>der</strong>n und Jugendlichen (0−16 Jahre) ist<br />
zwar die Abnahmerate noch höher,<br />
aber die absolute Zahl mit ca. 5 Mio.<br />
geringer. Interess<strong>an</strong>terweise wird sich<br />
die Altersgruppe <strong>der</strong> 40−65‐Jährigen<br />
dagegen zahlenmäßig kaum verän<strong>der</strong>n<br />
und nur um etwa 1,6 Mio. abnehmen<br />
(ältere Erwerbsfähige). Im Gegensatz zu<br />
den unter 40‐Jährigen wird sich <strong>der</strong><br />
Anteil <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung sogar<br />
geringfügig erhöhen (von 32 % auf 34<br />
eignet sind, wenn die Bewohner<br />
hochaltrig werden.<br />
(von alten Frauen)<br />
wird sich in Zu‐<br />
kunft wesentlich<br />
abmil<strong>der</strong>n.<br />
S. 96 Bezüglich <strong>der</strong><br />
alternden Gesell‐<br />
schaft ist die<br />
Abnahme jünge‐<br />
rer Bevölkerungs‐<br />
gruppen viel<br />
gravieren<strong>der</strong> als<br />
die Zunahme<br />
älterer.<br />
LIV
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Befunde<br />
%).<br />
In Zukunft wird fast die Hälfte (47 %)<br />
zwischen 40 und 65 Jahre alt sein (1995<br />
38 %). Eine weitere interess<strong>an</strong>te Be‐<br />
obachtung ist, dass es in dieser Alters‐<br />
gruppe sogar einen höheren Anteil von<br />
Männern geben wird (Frauen<strong>an</strong>teil<br />
d<strong>an</strong>n: 46 % gegenüber heute 49,5 %).<br />
120 Aus <strong>der</strong> zu erwartenden Entwicklung<br />
scheinen zwei unterschiedliche Bedarfsla‐<br />
gen für Wohnformen von Bedeutung:<br />
Wohnformen, die umfassende Hilfe<br />
gewährlisten, <strong>der</strong> Vereinsamung entge‐<br />
genwirken und weniger auf Selbstständig‐<br />
keit als auf Selbstbestimmung trotz<br />
schwerwiegen<strong>der</strong> körperlicher und auch<br />
psychischer/geistiger Einbußen setzen<br />
(Hochaltrige). Der zahlenmäßige Bedarf ist<br />
eher begrenzt.<br />
Wohnformen, die weniger umfassende<br />
Hilfe <strong>an</strong>bieten als vielmehr dem Bedarf<br />
nach Selbstständigkeit und Selbstbestim‐<br />
mung von Gemeinschaft und Lebensform<br />
in einer Lebensphase zwischen Familie<br />
und Beruf und dem eigentlichen Altsein<br />
nachkommen. Eine Hypothese ist, dass<br />
die Wohnform „Pflegeheim/ Altenheim“<br />
dem umfassenden Hilfebedarf zu wenig<br />
gerecht wird, wenn <strong>der</strong> Aufgabenkatalog<br />
zu sehr auf die körperliche Pflege und<br />
Versorgung reduziert ist.<br />
Betreutes Wohnen: Der Bedarf ist men‐<br />
genmäßig zu groß für eine Son<strong>der</strong>wohn‐<br />
form für alte Menschen; die vorh<strong>an</strong>denen<br />
Angebote berücksichtigen den Bedarf <strong>an</strong><br />
Selbstbestimmung bezüglich <strong>der</strong> gen<strong>an</strong>n‐<br />
ten, neu gewachsenen Lebensphase zu<br />
S. 99<br />
LV
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Gene‐<br />
ration in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftrag‐<br />
gebende Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Empfehlungen <strong>der</strong><br />
Kommission<br />
121 Wohnen bildet eine zentrale Bedingung für<br />
die Erhaltung und Selbstständigkeit und<br />
Gesundheit. <strong>Die</strong> Schaffung selbständigkeits‐<br />
und gesundheitsförden<strong>der</strong> Wohnbedingun‐<br />
gen für alle alten Menschen ist ein bedeu‐<br />
ten<strong>der</strong> Beitrag für kompetentes Alter.<br />
wenig. <strong>Die</strong> erste Bedarfslage nach umfas‐<br />
sen<strong>der</strong> Hilfe wird hier ebenfalls zu wenig<br />
berücksichtigt.<br />
Selbstständigkeit, Selbstver<strong>an</strong>twortung<br />
und soziale Bezogenheit werden von <strong>der</strong><br />
Kommission als Leitbild für Älterwerden<br />
und Alter verst<strong>an</strong>den. <strong>Die</strong> Kommission<br />
empfiehlt, sich bei <strong>der</strong> Schaffung von<br />
altersfreundlichen Umwelten <strong>an</strong> diesem<br />
Leitbild zu orientieren (…). <strong>Die</strong> Kommissi‐<br />
on hebt die Verschiedenartigkeit von<br />
Lebensbedingungen und Lebensformen<br />
im Alter hervor und weist auf die Not‐<br />
wendigkeit hin, ein breites Spektrum von<br />
Interventions<strong>an</strong>sätzen zu entwickeln.<br />
123 Allein die steigende Zahl älterer Men‐<br />
schen und die Notwendigkeit des Zusam‐<br />
menlebens von älteren und jüngeren<br />
Menschen erfor<strong>der</strong>n nach Auffassung <strong>der</strong><br />
Kommission ein Umdenken und eine<br />
Neubestimmung/Überwindung dieser<br />
Trennung von „Son<strong>der</strong>“ und „Normal‐<br />
wohnform“. Das „normale“ Wohnen<br />
(ergänzt durch die ggf. erfor<strong>der</strong>lichen<br />
sozialen, hauswirtschaftlichen und pflege‐<br />
rischen <strong>Die</strong>nstleistungen) muss als die<br />
wichtigste Wohnform älterer Menschen<br />
verstärkt Gegenst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Altenhilfe<br />
werden, und die Einrichtungen und <strong>Die</strong>ns‐<br />
te <strong>der</strong> Altenhilfe müssen das selbstständi‐<br />
ge „normale“ Wohnen älterer Menschen<br />
för<strong>der</strong>n.<br />
124 In <strong>der</strong> Weiterentwicklung des<br />
„Betreuten Wohnens“ sieht die<br />
Kommission eine wesentliche<br />
Ergänzung zu den bisherigen<br />
S. 239<br />
S. 241<br />
S. 242<br />
LVI
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Gene‐<br />
ration in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Empfehlungen <strong>der</strong><br />
Kommission<br />
Son<strong>der</strong>wohnformen <strong>der</strong> Alten‐<br />
hilfe. Erfor<strong>der</strong>lich sind in die‐<br />
sem Bereich Maßnahmen zur<br />
Qualitätssicherung, Schaffung<br />
von mehr Tr<strong>an</strong>sparenz bei <strong>der</strong><br />
Vertrags‐ und Preisgestaltung,<br />
Sicherung <strong>der</strong> Betreuungsquali‐<br />
tät, Durchsetzung von Raum‐<br />
st<strong>an</strong>dards, wie z. B. Woh‐<br />
nungsgrößen, Barrierefreiheit<br />
sowie Einrichtung von Gemein‐<br />
schaftsräumen, die das selbst‐<br />
ständige Wohnen und soziale<br />
Kontakte för<strong>der</strong>n. <strong>Die</strong> Kommis‐<br />
sion hält die Entwicklung von<br />
Modellen <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierungs‐<br />
kombination für erfor<strong>der</strong>lich,<br />
um auch mittleren Einkom‐<br />
mensgruppen den Zug<strong>an</strong>g zu<br />
dieser Wohnform zu ermögli‐<br />
chen. <strong>Die</strong> Kommission emp‐<br />
fiehlt, dass alle Altenhilfeein‐<br />
richtungen verpflichtet wer‐<br />
den, nicht nur das Gesamt‐<br />
entgeld, son<strong>der</strong>n auch die<br />
Preise für alle im einzelnen<br />
vereinbarten Leistungen <strong>an</strong>zu‐<br />
geben (z. B. <strong>an</strong>alog den Vor‐<br />
schriften des § 4e, Abs. 1, Satz<br />
1 des Heimgesetzes).<br />
126 <strong>Die</strong> Kommission macht darauf aufmerk‐<br />
sam, dass die Hilfeleistungen zwar über‐<br />
proportional von Frauen erbracht werden,<br />
dass aber entgegen verbreiteter Auffas‐<br />
sung auch Männer in erheblichem Um‐<br />
f<strong>an</strong>g nicht nur in den Empf<strong>an</strong>g, son<strong>der</strong>n<br />
auch in das Einbringen <strong>der</strong> Leistungen<br />
S. 246<br />
LVII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Gene‐<br />
ration in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftraggeben‐<br />
de Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Empfehlungen <strong>der</strong><br />
Kommission<br />
eingebunden sind. Da in Zukunft mehr<br />
Männer das höhere Alter erreichen,<br />
wächst das Hilfepotential. <strong>Die</strong>ses sowohl<br />
bei Frauen und Männern zu aktivieren,<br />
erfor<strong>der</strong>t, <strong>der</strong> Einsicht den Durchbruch zu<br />
verschaffen, dass das <strong>Die</strong>nen in einer<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft genauso zu<br />
den Schlüsselkompetenzen gehört wie<br />
org<strong>an</strong>isatorische o<strong>der</strong> technische Kompe‐<br />
tenzen (…). Da Hilfe in privaten Netzwer‐<br />
ken, vor allem die Pflege, mit einem<br />
erheblichen Zeiteinsatz für die Hilfeleis‐<br />
tung verbunden ist und zu hohen Belas‐<br />
tungen führen k<strong>an</strong>n, empfiehlt die Kom‐<br />
mission, den Angeboten zur Unterstüt‐<br />
zung von Hilfeleistenden im Rahmen von<br />
Infrastrukturkonzeptionen das erfor<strong>der</strong>li‐<br />
che Gewicht zu geben. Damit es nicht zur<br />
Überfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> hilfeleistenden Ange‐<br />
hörigen kommt, ist dieser Personenkreis<br />
auf eine verbesserte Vereinbarkeit von<br />
Pflege‐ und Erwerbstätigkeit <strong>an</strong>gewiesen.<br />
<strong>Die</strong> Kommission empfiehlt den Akteuren,<br />
die für die Rahmenbedingungen <strong>der</strong><br />
Arbeitswelt Ver<strong>an</strong>twortung tragen, die‐<br />
sem Aspekt ebenso eine höhere Aufmerk‐<br />
samkeit zu schenken wie <strong>der</strong> Vereinbar‐<br />
keit von Erziehungs‐ und Erwerbstätigkeit.<br />
127 <strong>Die</strong> Kommission empfiehlt, dass die<br />
professionelle soziale Altenarbeit inner‐<br />
ethnische Potentiale und Ressourcen in<br />
ihre gemeinwesenorientierten H<strong>an</strong>d‐<br />
lungskonzepte einbezieht, um <strong>der</strong>en<br />
generationenübergreifende Wirkung zu<br />
erhalten, zu för<strong>der</strong>n und zu unterstützen.<br />
128 Einrichtungen <strong>der</strong> stationären Altenhilfe,<br />
in denen ältere Migr<strong>an</strong>ten leben, sind<br />
S. 248 Kulturelle Beson‐<br />
<strong>der</strong>heiten berück‐<br />
sichtigen<br />
S. 249<br />
LVIII
2. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Wohnen im Alter<br />
1998 (Auftrag‐<br />
gebende Ministerin<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Stellungnahme <strong>der</strong><br />
Bundesregierung<br />
(ergänzend)<br />
129 <strong>Die</strong> Altersstruktur <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik Deutschl<strong>an</strong>d än<strong>der</strong>t<br />
sich. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl<br />
älterer Menschen von heute knapp 16,9<br />
Mio. auf ca. 26,4 Mio. und ihr Anteil <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> Gesamtbevölkerung von rund 20%<br />
auf rund 36% <strong>an</strong>steigen.<br />
<strong>Die</strong> Zahl hilfs‐ und pflegebedürftiger älterer<br />
Menschen wird in den kommenden Jahren<br />
weiter zunehmen. Bis zum Jahr 2030 wird z.<br />
B. die Zahl <strong>der</strong> Pflegebedürftigen, die zu<br />
Hause versorgt werden, voraussichtlich von<br />
heute 1,24 Mio. auf ca. 1,60 Mio. <strong>an</strong>steigen.<br />
aufgerufen, sich auf <strong>der</strong>en spezifische<br />
kulturelle Bedürfnisse einzustellen (z. B.<br />
bezogen auf Kommunikation, Pflegekon‐<br />
zepte, Ernährungsgewohnheiten, Sterben,<br />
religiöse Bedürfnisse und den Umg<strong>an</strong>g mit<br />
Angehörigen).<br />
<strong>Die</strong> Zahl alleinstehen<strong>der</strong> Älterer wird sich<br />
in diesem Zeitraum von rund 7,8 Mio. auf<br />
voraussichtlich 13,2 Mio. erhöhen. Än‐<br />
<strong>der</strong>n werden sich auch die Familienstruk‐<br />
turen. <strong>Die</strong> Zahl kin<strong>der</strong>loser Frauen und<br />
Männer nimmt zu. Während vor rund 25<br />
Jahren noch 72 % <strong>der</strong> Bevölkerung in<br />
Haushalten mit Kin<strong>der</strong>n lebten, sind es<br />
heute nur noch 58 %. Blieben im früheren<br />
Bundesgebiet nur etwa 13 % <strong>der</strong> 1945<br />
geborenen Frauen und 15 % des Frauen‐<br />
jahrg<strong>an</strong>gs 1950 kin<strong>der</strong>los, wird von den<br />
1960 geborenen west<strong>deutschen</strong> Frauen<br />
wahrscheinlich jede Vierte keine Kin<strong>der</strong><br />
bekommen. Für den Jahrg<strong>an</strong>g 1965 gibt es<br />
Schätzungen, wonach bis zu einem Drittel<br />
kin<strong>der</strong>los bleiben wird.<br />
Heute ist es daher bereits absehbar, dass<br />
das Hilfepotential innerhalb <strong>der</strong> Familien<br />
in den nächsten Jahren abnehmen wird.<br />
<strong>Die</strong> Einbindung in erweiterte soziale<br />
Netzwerke – Freundes‐ und Bek<strong>an</strong>nten‐<br />
kreis, Nachbarschaft – wird immer wichti‐<br />
ger.<br />
<strong>Die</strong> Familie wird aber gleichwohl auch<br />
künftig das Fundament für ein hum<strong>an</strong>es<br />
Zusammenleben <strong>der</strong> Generationen blei‐<br />
ben (…). Festzustellen ist eine Tendenz<br />
des Zusammenlebens <strong>der</strong> Generationen in<br />
räumlicher Nähe, ohne die Eigenständig‐<br />
II<br />
LIX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
keit aufzugeben. Auch zukünftig ist mit<br />
einer weiteren Steigerung <strong>der</strong> fin<strong>an</strong>ziellen<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> überwiegenden Zahl<br />
von Senioren zu rechnen.<br />
130 Soziale Netzwerke stehen o<strong>der</strong> fallen mit<br />
<strong>der</strong> Erreichbarkeit <strong>der</strong> Menschen unterei‐<br />
n<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
131 Aufgrund des demografischen W<strong>an</strong>dels wird<br />
die Gesamtzahl <strong>der</strong> Pflegebedürftigen in den<br />
kommenden zwei Jahrzehnten deutlich<br />
<strong>an</strong>steigen. <strong>Die</strong> Schätzungen für das Jahr<br />
2010 liegen bei 2,04 bis 2,14 Mio., bis zum<br />
Jahr 2030 ist mit einer Zunahme auf 2,3 bis<br />
2,5 Mio. Pflegebedürftige zu rechnen (…).<br />
Dabei wird allerdings eine konst<strong>an</strong>te alters‐<br />
spezifische Wahrscheinlichkeit pflegebe‐<br />
dürftig zu werden, unterstellt. <strong>Die</strong> Kommis‐<br />
sion gibt zu bedenken, dass bei <strong>der</strong> Erweite‐<br />
rung von Rehabilitations<strong>an</strong>geboten – im<br />
Sinne des im SGB XI beschriebenen Leitbil‐<br />
des „Rehabilitation vor Pflege“ – <strong>der</strong> prog‐<br />
nostizierte Anstieg vermutlich weniger<br />
deutlich ausfallen würde. Das Rehabilitati‐<br />
onspotenzial älterer Menschen wird im<br />
Allgemeinen unterschätzt (…)<br />
Angesichts des gerontologischen Erkennt‐<br />
nisse über die positive Verän<strong>der</strong>ungsfähig‐<br />
keit (Plastizität) bei vielen pflegebedürftigen<br />
Menschen sowie <strong>der</strong> gen<strong>an</strong>nten Prognosen<br />
in Bezug auf die Entwicklung des Pflegebe‐<br />
darfs ist <strong>der</strong> Ausbau von Rehabilitations<strong>an</strong>‐<br />
geboten dringend zu empfehlen. (…) Der<br />
deutlich steigende Anteil pflegebedürftiger<br />
Menschen im neunten Lebensjahrzehnt ist<br />
auch auf die zunehmende Anzahl demenz‐<br />
kr<strong>an</strong>ker Menschen zurückzuführen. <strong>Die</strong><br />
XVIII<br />
S. 56<br />
LX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Häufigkeit schwerer und mäßig schwerer<br />
Demenzen nimmt mit steigendem Alter<br />
erheblich zu. (…) <strong>Die</strong> Kommission unter‐<br />
streicht die in <strong>der</strong> Gerontopsychiatrie wie‐<br />
<strong>der</strong>holt getroffenen Aussage, dass <strong>der</strong> weit<br />
verbreitete diagnostische und therapeuti‐<br />
sche Nihilismus dringend abgebaut werden<br />
muss. Heute ist bei <strong>der</strong> senilen Demenz<br />
zwar nur eine symptomatologische Beh<strong>an</strong>d‐<br />
lung und eine aktivierende, pflegerische<br />
Betreuung möglich. Doch ist die Tatsache,<br />
dass durch medikamentöse Therapie, durch<br />
gute Betreuung, durch Tagesstrukturierung,<br />
durch kognitives Training sowie durch eine<br />
<strong>an</strong>regende und orientierungsför<strong>der</strong>nde<br />
Umwelt psychische Kr<strong>an</strong>kheitssymptome<br />
gelin<strong>der</strong>t und kognitive Leistungen geför<strong>der</strong>t<br />
werden können, von sehr großer Bedeutung<br />
für den Patienten selbst, für sein Angehöri‐<br />
gen sowie für die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter eines Pflegeteams. (…) <strong>Die</strong><br />
Kommission weist bereits <strong>an</strong> dieser Stelle<br />
auf die Notwendigkeit hin, in Zukunft ver‐<br />
mehrt Rehabilitations<strong>an</strong>gebote für demenz‐<br />
kr<strong>an</strong>ke Menschen zu schaffen und zugleich<br />
eine aktivierenden Pflege auch auf die<br />
Versorgung demenzkr<strong>an</strong>ker Menschen zu<br />
übertragen<br />
132 Diskutiert m<strong>an</strong> zum Beispiel Fragen <strong>der</strong><br />
Sicherstellung medizinisch‐pflegerischer<br />
Versorgung im Lichte <strong>der</strong> epidemiologischen<br />
Prävalenzdaten über demenzielle Erkr<strong>an</strong>‐<br />
kungen, so setzt sich m<strong>an</strong> sich leicht dem<br />
Vorwurf aus, die Alterung von Gesellschaft<br />
und Individuum zu dramatisieren und unter‐<br />
schwellig <strong>der</strong> stereotypen Formel „Alt‐<br />
sein=Kr<strong>an</strong>ksein“ zu folgen.<br />
In <strong>der</strong> Tat wird <strong>der</strong> politische<br />
Diskurs lei<strong>der</strong> oft einseitig aus<br />
<strong>der</strong> ökonomischen Perspektive<br />
geführt (…). Spricht m<strong>an</strong> über<br />
die steigenden Kosten <strong>der</strong><br />
Demenzbeh<strong>an</strong>dlungen und ‐<br />
betreuungen, läuft m<strong>an</strong> Ge‐<br />
fahr, eines m<strong>an</strong>gelnden ethi‐<br />
schen Verständnisses bezich‐<br />
In <strong>der</strong> Sozialpolitik beginnen sich neue<br />
Leitbil<strong>der</strong> des Umg<strong>an</strong>gs mit älteren Men‐<br />
schen abzuzeichnen, nach denen ältere<br />
Menschen nicht länger eine zu versorgen‐<br />
de Klientel darstellen, die durchgängig <strong>der</strong><br />
Institutionen und <strong>Die</strong>nste <strong>der</strong> Altenhilfe<br />
bedarf, son<strong>der</strong>n ältere Menschen als<br />
aktive Koproduzenten ihrer eigenen<br />
Wohlfahrt begreift. <strong>Die</strong> in einer Gesell‐<br />
S. 57 Differenziertes<br />
Altersbild gefor‐<br />
<strong>der</strong>t<br />
LXI
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
133 Insgesamt stimmt die Kommission <strong>der</strong> Ein‐<br />
schätzung Dinkels zu, dass „m<strong>an</strong> zumindest<br />
für die jüngere Verg<strong>an</strong>genheit in <strong>der</strong> Bun‐<br />
desrepublik die weit verbreitete pessimisti‐<br />
sche These nicht länger aufrechterhalten<br />
(sollte), wir würden zwar immer älter, aber<br />
gleichzeitig auch immer kränker“ (Dinkel<br />
1999: 79). <strong>Die</strong> Kommission wendet sich des‐<br />
halb bewusst gegen immer noch vorherr‐<br />
schende Auffassungen einer dramatischen<br />
Ausweitung <strong>der</strong> Gebrechlichkeit mit zuneh‐<br />
men<strong>der</strong> L<strong>an</strong>glebigkeit <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />
134 Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass<br />
trotz <strong>der</strong> eindeutigen Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong><br />
Erkr<strong>an</strong>kungen des höheren Lebensalters<br />
eine ausreichende Berücksichtigung geriatri‐<br />
scher und gerontologischer Expertise in <strong>der</strong><br />
Medizin in Deutschl<strong>an</strong>d noch aussteht. An<br />
<strong>der</strong> notwendigen Eigenständigkeit des<br />
Faches Geriatrie und des dringenden Be‐<br />
darfs <strong>an</strong> Aus‐, Fort‐ und Weiterbildungs‐<br />
maßnahmen auf diesem Sektor k<strong>an</strong>n aus <strong>der</strong><br />
Sicht <strong>der</strong> Kommission jedenfalls heute kein<br />
Zweifel mehr bestehen.<br />
135 Für die qualitative Weiterentwicklung des<br />
Versorgungs<strong>an</strong>gebots werden in Zukunft<br />
vermehrt pflegeepidemiologische Erkennt‐<br />
nisse benötigt, die den qu<strong>an</strong>titativen Pfle‐<br />
gebedarf im Zeitverlauf dokumentieren<br />
tigt zu werden. schaft dominierenden Altersbil<strong>der</strong>be‐<br />
stimmen mit, inwieweit ältere Menschen<br />
bei <strong>der</strong> Verteilung von Ressourcen be‐<br />
rücksichtigt werden, und inwieweit ein<br />
differenzierter, d. h. <strong>an</strong> den gegebenen<br />
Lebensbedingungen und Kompetenzen<br />
orientierter Einsatz <strong>der</strong> Ressourcen er‐<br />
folgt.<br />
S. 70 Statements zur<br />
pessimistischen<br />
Sichtweise des<br />
Alterungsprozes‐<br />
ses in <strong>der</strong> Wissen‐<br />
schaft<br />
S. 75<br />
S. 86 Forschungsbe‐<br />
darf: Betroffe‐<br />
nenperspektive<br />
LXII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
sowie eine systematische und zielgerichtete<br />
Analyse <strong>der</strong> Daten erlauben. Ein wesentli‐<br />
cher M<strong>an</strong>gel bisheriger Forschung besteht<br />
darin, dass sie von einem spezifischen,<br />
sozialrechtlich geprägten Begriff <strong>der</strong> Pflege‐<br />
bedürftigkeit ausgeht und damit nur sehr<br />
begrenzt Schlussfolgerungen auf die Ge‐<br />
samtheit des pflegerischen Leistungsbedarfs<br />
zulassen. Gerade vor dem Hintergrund <strong>der</strong><br />
Zielsetzung eines integrierten Versorgungs‐<br />
<strong>an</strong>gebots sind daher Untersuchungen not‐<br />
wendig, die Bedarfe unabhängig von den<br />
zerglie<strong>der</strong>ten Fin<strong>an</strong>zierungs‐ und Leistungs‐<br />
strukturen, also vornehmlich aus <strong>der</strong> Per‐<br />
spektive <strong>der</strong> Patienten bzw. Pflegebedürfti‐<br />
gen zu beschreiben vermögen.<br />
136 Entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse<br />
von Vorausberechnungen zur Pflegebedürf‐<br />
tigkeit haben neben den Annahmen zur<br />
altersspezifischen Prävalenz auch die An‐<br />
nahmen zur Entwicklung <strong>der</strong> weiteren<br />
Lebenserwartung im Alter. Insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
<strong>an</strong>genommener Konst<strong>an</strong>z <strong>der</strong> Pflegefall‐<br />
wahrscheinlichkeiten schlägt sich ein Zuge‐<br />
winn <strong>an</strong> Lebensjahren im höheren Alter<br />
unmittelbar in einer steigenden Zahl Pflege‐<br />
bedürftiger nie<strong>der</strong>. (…) Bis zum Jahr 2010<br />
wird mit einem Anstieg bis 2,04 Mio. Pfle‐<br />
gebedürftigen gerechnet; das BGM geht<br />
sogar von einer Zunahme auf 2,14 Mio aus.<br />
Für 2030 reichen die Schätzungen von 2,16<br />
bis 2,57 Mio. Pflegebedürftigen, für 2040<br />
wird mit 2,26 bis 2,79 Mio. gerechnet. (…)<br />
Neuere nationale und internationale For‐<br />
schungsergebnisse liefern klare Hinweise<br />
auf eine Verbesserung des Gesundheitszu‐<br />
st<strong>an</strong>des alter Menschen in <strong>der</strong> Kohorten‐<br />
S.87 Verbesserter<br />
Gesundheitszu‐<br />
st<strong>an</strong>d Älterer<br />
LXIII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
folge, und es bestehen berechtigte Aussich‐<br />
ten auf ein Zurückdrängen, Verzögern und<br />
Abschwächen bestimmter Altersgebrechen<br />
durch weiteren medizinischen Fortschritt.<br />
Sie (Modellrechnungen, Anm. MB) verwei‐<br />
sen darauf, wie wichtig es sein wird, die<br />
gesundheitliche Prävention und Rehabilita‐<br />
tion auszubauen.<br />
137 Trotz <strong>der</strong> großen Bedeutung <strong>der</strong> Prävention<br />
für die Gesundheit und eine aktive Lebens‐<br />
gestaltung wird den präventiven Maßnah‐<br />
men im Kontext des Gesundheitsversor‐<br />
gungssystems nicht jene Stellung zugeord‐<br />
net, die diesen aus wissenschaftlicher und<br />
praktischer Perspektive eigentlich zukom‐<br />
men müsste. (…) <strong>Die</strong> Kommission gibt <strong>an</strong><br />
dieser Stelle zu bedenken, dass Org<strong>an</strong>isati‐<br />
onsformen gefunden werden müssen, die<br />
diese Bereiche (die Sektoren Prävention,<br />
Kuration und Rehabilitation, Anm. MB) zum<br />
einen gleichstellen, zum <strong>an</strong><strong>der</strong>en mitein<strong>an</strong>‐<br />
<strong>der</strong> verknüpfen.<br />
138 In <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Prävention sieht die<br />
Kommission eine bedeutende Aufgabe <strong>der</strong><br />
medizinischen Versorgung und <strong>der</strong> Gesund‐<br />
heitspolitik. (…) Der Diagnostik von Risiko‐<br />
faktoren und <strong>der</strong> Intervention zur Reduktion<br />
von Stürzen im Alter sollte in Zukunft mehr<br />
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das<br />
breite Spektrum <strong>der</strong> Risikofaktoren, die zu<br />
dieser sogen<strong>an</strong>nten Sturzkr<strong>an</strong>kheit führen,<br />
zeigt eindeutig, dass die Diagnostik und<br />
Abklärung ebenfalls multifaktoriell sein<br />
muss. Unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em sind die oben gen<strong>an</strong>n‐<br />
ten Anamnesen, die Bal<strong>an</strong>ce, das häusliche<br />
Umfeld, das Hören und Sehen sowie die<br />
Stehsicherheit im Assessment zu prüfen.<br />
Durch die Umsetzung dieser<br />
For<strong>der</strong>ung wird nicht nur zur<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Gesundheit<br />
und Erhöhung <strong>der</strong> Lebensquali‐<br />
tät im Alter beigetragen,<br />
son<strong>der</strong>n es werden auch<br />
erhebliche Kosteneinsparun‐<br />
gen bewirkt.<br />
S.89<br />
S. 90 Prävention und<br />
Kostendämpfung<br />
Geriatrisches<br />
Assessment!<br />
Rolle des Hausarz‐<br />
tes beim präven‐<br />
LXIV
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die altersspezifische Fehl‐ und<br />
Übermedikamentierung spielt unter den<br />
Sturzursachen eine wichtige Rolle. Hier<br />
muss es um Modifikationen bzw. Umstel‐<br />
lung <strong>der</strong> Medikamentierung gehen. Durch<br />
die Prävention <strong>der</strong> Osteoporose könnte die<br />
Anzahl jener Menschen, bei denen Stürze zu<br />
einer Schenkelhalsfraktur führen, deutlich<br />
verringert werden. <strong>Die</strong> Durchführung dieser<br />
präventiven Maßnahmen, wie z. B. das<br />
Sturzrisiko vermin<strong>der</strong>n, und die Durchfüh‐<br />
rung des präventiven Hausbesuchs sollte<br />
<strong>der</strong> Hausarzt in seiner Rolle als Case M<strong>an</strong>a‐<br />
ger für den älteren Patienten initiieren, be‐<br />
gleiten und ggf. selbst übernehmen.<br />
139 Aufgrund des erhöhten Risikos <strong>der</strong> chroni‐<br />
schen körperlichen Erkr<strong>an</strong>kung, <strong>der</strong> Hilfsbe‐<br />
dürftigkeit o<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit, seeli‐<br />
scher Störungen sowie psychischer Erkr<strong>an</strong>‐<br />
kungen ist gerade bei Menschen mit Behin‐<br />
<strong>der</strong>ung eine kompetenzerhaltende o<strong>der</strong> ‐<br />
för<strong>der</strong>nde Intervention notwendig.<br />
140 Beachtung verdienen schließlich auch<br />
„unorthodoxe“, hierzul<strong>an</strong>de noch wenig ge‐<br />
nutzte Verfahren, wie z. B. die Schaffung<br />
beson<strong>der</strong>s gestalteter Räume mit einer Viel‐<br />
zahl von sensorischen Anregungen („Snoe‐<br />
zel‐Räume“) sowie humor‐orientierte Inter‐<br />
ventionen und tiergestützte Interventionen,<br />
bei denen durch den Kontakt mit Hunden<br />
und/ o<strong>der</strong> Katzen positive Effekte ausgelöst<br />
werden können.<br />
141 Bei Heimen mit einem hohen Anteil von<br />
chronisch psychisch Kr<strong>an</strong>ken wird die Ver‐<br />
besserung <strong>der</strong> gerontopsychiatrischen<br />
Versorgung als vorr<strong>an</strong>gig vor <strong>an</strong><strong>der</strong>en Fach‐<br />
disziplinen <strong>an</strong>gesehen. Was insbeson<strong>der</strong>e in<br />
tiven Hausbesuch<br />
S. 96 Beson<strong>der</strong>er<br />
Bedarf bei Men‐<br />
schen mit Behin‐<br />
<strong>der</strong>ung<br />
S. 100 Psychosoziale<br />
Interventionen<br />
(Snoezelen/ und<br />
Humor und Tiere)<br />
S. 103<br />
LXV
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Deutschl<strong>an</strong>d auch noch im Hinblick auf den<br />
„Alltag im Heim“ fehlt, ist eine Methode zur<br />
Erfolgskontrolle, die außerhalb von kontrol‐<br />
lierten Studien eingesetzt werden k<strong>an</strong>n. Ein<br />
beispielhaftes Verfahren, das eine praxisna‐<br />
he Erfassung des Wohlbefindens von psy‐<br />
chisch kr<strong>an</strong>ken Menschen erlaubt und so die<br />
Wirkung bestimmter Interventionsmaß‐<br />
nahmen beschrieben k<strong>an</strong>n, ist das in Eng‐<br />
l<strong>an</strong>d von Tom Kitwood entwickelte und in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d von C. Müller‐Hergl vertretene<br />
Konzept des „Dementia Care Mapping“<br />
142 Neben den fehlenden fachlichen Voraus‐<br />
setzungen für das Dolmetschen medizini‐<br />
scher o<strong>der</strong> pflegerischer Sachverhalte sind<br />
Angehörige häufig mit den Rollenkonflik‐<br />
ten als loyale Familien<strong>an</strong>gehörige und<br />
neutrale Übersetzer überfor<strong>der</strong>t.<br />
143 Situation ambul<strong>an</strong>ter Pflege<br />
<strong>Die</strong>sen Paradigmenwechsel (von <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heits‐ zur Gesundheitsorientierung, Anm.<br />
MB) nachzuvollziehen und verbunden damit<br />
eine Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Pflege einzuleiten,<br />
ist eine – wenngleich mit großer zeitlicher<br />
Verspätung – auch in Deutschl<strong>an</strong>d unlängst<br />
<strong>an</strong>genommene Herausfor<strong>der</strong>ung. <strong>Die</strong>s<br />
schlägt sich auch in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege<br />
nie<strong>der</strong>, einem in Übereinstimmung mit<br />
internationalen Trends zunehmend <strong>an</strong> Be‐<br />
deutung gewinnenden Versorgungsbereich.<br />
144 Ambul<strong>an</strong>te Pflegeleistungen<br />
werden <strong>der</strong>zeit somit primär<br />
durch sozialrechtliche und we‐<br />
niger durch pflegewissen‐<br />
schaftliche Relev<strong>an</strong>zkriterien<br />
S. 104<br />
S. 105 Ambul<strong>an</strong>te Pflege<br />
nimmt <strong>an</strong> Bedeu‐<br />
tung zu!<br />
S. 107<br />
LXVI
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
determiniert. <strong>Die</strong>s führt u. a. zu<br />
einer m<strong>an</strong>gelnden Berücksich‐<br />
tigung von Bedarfsgesichts‐<br />
punkten in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflege.<br />
145 Sollen Unterversorgungser‐<br />
scheinungen, Drehtüreffekte<br />
und somit vermeidbare Wie‐<br />
<strong>der</strong>einweisungen verhin<strong>der</strong>t<br />
werden, muss <strong>der</strong> Abbau<br />
stationärer Leistungs<strong>an</strong>gebote<br />
mit einem Ausbau und einer<br />
Weiterentwicklung ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflege parallelisiert werden.<br />
(…) Den Auf‐ und Ausbau<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflege allein <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung zu über‐<br />
<strong>an</strong>tworten, dürfte <strong>an</strong>gesichts<br />
<strong>der</strong> spezifischen Zielrichtung<br />
und Ausgestaltung dieses<br />
Leistungsgesetzes somit einer<br />
verkürzten Strategie gleich‐<br />
kommen, die mehr Probleme<br />
schaffen als lösen könnte. (…)<br />
Eine kritische Reform <strong>der</strong><br />
Fin<strong>an</strong>zierungsgrundlagen<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflege, die durch<br />
pflegewissenschaftliche Krite‐<br />
rien fundiert ist und Bedarfsge‐<br />
sichtspunkten größere Auf‐<br />
merksamkeit schenkt als bis‐<br />
l<strong>an</strong>g, zählt somit zu den zentra‐<br />
len sozial‐ und gesundheits‐<br />
politische Aufgaben <strong>der</strong> Zu‐<br />
kunft. <strong>Die</strong>s umso mehr, als die<br />
Fin<strong>an</strong>zierungsgrundlagen<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflege – wie nach‐<br />
S. 108<br />
LXVII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
folgend erkennbar – erhebliche<br />
Auswirkungen auf die infrast‐<br />
rukturelle Entwicklung dieses<br />
Arbeitsbereiches haben.<br />
Entwicklungstrends in <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten Pflege:<br />
Mit einiger Berechtigung ist<br />
davon auszugehen, dass <strong>der</strong><br />
Höhepunkt <strong>der</strong> Betriebsgrün‐<br />
dungen überschritten ist.<br />
Gleichzeitig verdichten sich die<br />
Hinweise auf einen aufkom‐<br />
menden Verdrängungswett‐<br />
bewerb zulasten von zumeist<br />
kleineren Anbietern (…). Seit<br />
Einführung <strong>der</strong> Pflegeversiche‐<br />
rung sind auch hier Verschie‐<br />
bungen erkennbar. Der stärks‐<br />
te Zuwachs ist bei den privat‐<br />
wirtschaftlichen getragenen<br />
Einrichtungen zu verzeichnen:<br />
Sie stellen bundesweit inzwi‐<br />
schen mehr als die Hälfte aller<br />
ambul<strong>an</strong>ten Pfleg<strong>an</strong>bieter.<br />
147 <strong>Die</strong> in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n bereits<br />
realisierte Umorientierung zu<br />
einer <strong>an</strong> den Bedarfslagen<br />
potenzieller Nutzer aus‐<br />
gerichteten Gestaltung des<br />
pflegerischen Leistungsprofils<br />
steht hierzul<strong>an</strong>de noch aus.<br />
148 Anreizstrukturen und Rahmen‐<br />
bedingungen sind so zu gestal‐<br />
ten, dass sie diesen Paradig‐<br />
menwechsel (von <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heits‐ zur Gesund‐<br />
S. 111 Leistungsprofils‐<br />
gestaltung fehlt<br />
S.119<br />
LXVIII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
heitsorientierung, Anm. MB)<br />
unterstützen und ihm nicht –<br />
wie bisl<strong>an</strong>g zu beobachten –<br />
eher zuwi<strong>der</strong>laufen.<br />
Zugleich ist es notwendig,<br />
vorh<strong>an</strong>dene gesundheitliche<br />
und soziale Potentiale älterer<br />
Menschen im Versorgungsall‐<br />
tag stärker in den Blick zu<br />
nehmen und in die Pl<strong>an</strong>ung<br />
und Gestaltung pflegerischer<br />
Leistungen einzubeziehen, um<br />
dem Fortschreiten gesundheit‐<br />
licher o<strong>der</strong> sozialer Beeinträch‐<br />
tigungen entgegenzuwirken,<br />
Abhängigkeitstendenzen zu<br />
vermeiden und – falls möglich<br />
– auf diese Weise auch zu einer<br />
Verbesserung des Gesund‐<br />
heitszust<strong>an</strong>ds älterer Men‐<br />
schen beizutragen.<br />
149 Unabdingbar ist außerdem<br />
eine Erweiterung <strong>der</strong> eng<br />
gesteckten Grenzen pflegeri‐<br />
schen H<strong>an</strong>delns. <strong>Die</strong> Realsie‐<br />
rung einer <strong>an</strong>gemessenen<br />
Pflegeälterer Menschen,<br />
verl<strong>an</strong>gt mehr als herkömmli‐<br />
che „h<strong>an</strong>dwerkliche“ Pflege<br />
und körperbezogene Maß‐<br />
nahmen. Sie umfasst außer‐<br />
dem kommunikative und<br />
edukative Aufgaben (wie Un‐<br />
terstützung, Anleitung, Schu‐<br />
lung und Beratung des Pflege‐<br />
bedürftigen und seiner An‐<br />
gehörigen), ebenso präventive<br />
S. 120<br />
LXIX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
150 Ambul<strong>an</strong>te Pflege erfor<strong>der</strong>t heute ein hohes<br />
Maß <strong>an</strong> spezialisierten pflegerischen Kom‐<br />
petenzen, für die <strong>an</strong><strong>der</strong>norts auf hohem<br />
akademischen Niveau ausgebildet wird. Mit<br />
dieser Entwicklung haben die Qualifikati‐<br />
onsprofile in den Pflegeberufen hierzul<strong>an</strong>de<br />
nicht Schritt gehalten. So findet die ambu‐<br />
l<strong>an</strong>te Pflege in den bestehenden Ausbildun‐<br />
gen – sei es auf beruflicher wie auf akade‐<br />
mischer Ebene – nicht die ihr gebührende<br />
Aufmerksamkeit – eine Kritik, die auch für<br />
die gegenwärtigen Reformbemühungen <strong>der</strong><br />
Pflegeausbildung gilt. Auch dem Mo<strong>der</strong>ni‐<br />
sierungsrückst<strong>an</strong>d, Aufgabenw<strong>an</strong>del und<br />
Bedarf <strong>an</strong> klinischen (d. h. gerontologischen,<br />
und rehabilitative Maßnahmen<br />
und auch solche, wie sie mit<br />
dem englischen Begriff „care“<br />
<strong>an</strong>gesprochen sind (Morse et<br />
al. 1990). Dabei steht weniger<br />
die protektive und sorgende<br />
Funktion von Pflege im Vor<strong>der</strong>‐<br />
grund als vielmehr ihre Bedeu‐<br />
tung für die Versorgungsgestal‐<br />
tung und die Sicherung von<br />
Versorgungsintegration und ‐<br />
kontinuität. <strong>Die</strong> Umsetzung<br />
dessen setzt allerdings voraus,<br />
Aufgabenspektrum und ‐<br />
zuschnitt <strong>der</strong> Pflege zu über‐<br />
denken, ja, zu erweitern, und,<br />
bedingt auf struktureller Ebe‐<br />
ne, die notwendigen Spiel‐<br />
räume und Bedingungen für<br />
eine entsprechende Ausdeh‐<br />
nung <strong>der</strong> Kompetenzgrenzen<br />
herzustellen.<br />
S. 120 Reform <strong>der</strong> Pfle‐<br />
geausbildung<br />
LXX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
intensivpflegerischen, psychiatrischen,<br />
palliativen etc.) Spezialkompetenzen wird<br />
auf qualifikatorischer Ebene nicht hinrei‐<br />
chend Rechnung getragen. Ohne hier eine<br />
Korrektur einzuleiten, k<strong>an</strong>n eine qualitativ<br />
hochwertige ambul<strong>an</strong>te pflegerische Ver‐<br />
sorgung auch zukünftig nicht gelingen.<br />
151 Erfor<strong>der</strong>lich ist darüber hinaus<br />
eine Mo<strong>der</strong>nisierung des<br />
Leistungsprofils und eine qua‐<br />
litative Ausdifferenzierung des<br />
Leistungs<strong>an</strong>gebots ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflegedienste. Nach wie vor ist<br />
das Angebot <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflege zu eng und wenig prob‐<br />
lemadäquat konturiert, wes‐<br />
halb die häusliche Versorgung<br />
vieler Patientengruppen nach<br />
wie vor auf Grenzen stößt.<br />
Über eine Ausweitung des<br />
Leistungs<strong>an</strong>gebots sind darü‐<br />
ber hinaus Modellversuche<br />
notwendig, um die im Gefolge<br />
<strong>der</strong> Umstrukturierungen des<br />
Gesundheitswesens in <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten Pflege entstehen‐<br />
den neuen Aufgabenstellungen<br />
in klare Arbeitskonzepte umzu‐<br />
setzen.<br />
152 Auch die Realisierung von<br />
Versorgungsintegration und<br />
‐kontinuität sowie die Verbes‐<br />
serung <strong>der</strong> Kooperation bedarf<br />
weiterer Aufmerksamkeit. (...)<br />
Vor allem die professionsüber‐<br />
greifende Kooperation bedarf<br />
in Zukunft weiterer Verbesse‐<br />
S. 120<br />
S. 120 Kooperation<br />
zwischen Versor‐<br />
gern<br />
LXXI
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
rungen. Ähnliches gilt für die<br />
Versuche zur org<strong>an</strong>isatorischen<br />
Vernetzung und zur Schaffung<br />
integrierter Versorgungsver‐<br />
bünde innerhalb des ambul<strong>an</strong>‐<br />
ten Sektors sowie zwischen <strong>der</strong><br />
Regel‐ und Spezialversorgung.<br />
153 Des Weiteren ist eine Anpas‐<br />
sung <strong>der</strong> Sozialversicherungs‐<br />
systeme <strong>an</strong> die gew<strong>an</strong>delten<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen im ambul<strong>an</strong>ten<br />
Bereich notwendig. (…) Darü‐<br />
ber hinaus ist zu prüfen, ob die<br />
im Zuge <strong>der</strong> Kostendämp‐<br />
fungspolitik mit dem SGB XI<br />
eingeführte Grundsicherung<br />
aktuellen wie künftigen gesell‐<br />
schaftlichen Problemlagen<br />
hinreichend gewachsen ist. Es<br />
gibt schon jetzt Anzeichen<br />
dafür, dass mit <strong>der</strong> Abkehr vom<br />
Prinzip <strong>der</strong> Bedarfsdeckung<br />
Zug<strong>an</strong>gsbarrieren und Unter‐<br />
versorgungen entstehen kön‐<br />
nen, von denen das deutsche<br />
Sozial‐ und Gesundheitswesen<br />
bisl<strong>an</strong>g verschont geblieben ist.<br />
154 Schließlich ist darauf hinzuwei‐<br />
sen, dass die Umsetzung <strong>der</strong><br />
zuvor aufgestellten For<strong>der</strong>un‐<br />
gen auch eine Entsp<strong>an</strong>nung <strong>der</strong><br />
Arbeitssituation <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>‐<br />
ten Pflege erfor<strong>der</strong>t (…).<br />
Geringe Bezahlung, hoher<br />
Ver<strong>an</strong>twortungsdruck, schlech‐<br />
te Arbeitsbedingungen und<br />
hohe Arbeitsbelastung führten<br />
S.120<br />
S. 120 Hinweis: ökono‐<br />
mische Erwägun‐<br />
gen vs. Professio‐<br />
nelle Qualitätser‐<br />
wägungen!<br />
Hinweis auf<br />
kritische Würdi‐<br />
gungen<br />
LXXII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
155<br />
zu einer beachtlichen Mitarbei‐<br />
terfluktuation (…). Zu enge<br />
fin<strong>an</strong>zielle Spielräume, daraus<br />
resultierend Personal‐ und<br />
Zeitknappheit führen dazu,<br />
dass ökonomische Erwägungen<br />
den Vorr<strong>an</strong>g vor professionel‐<br />
len Qualitätserwägungen<br />
haben. <strong>Die</strong>sen Fehlentwicklun‐<br />
gen gilt es künftig verstärkt<br />
Aufmerksamkeit zu widmen<br />
und – wo möglich – aktiv<br />
entgegenzuwirken.<br />
Situation <strong>der</strong> Tagespflege<br />
Der Betrieb einer Tagespflege‐<br />
einrichtung ist wirtschaftliche<br />
schwierig. Bei Einrichtungs‐<br />
bzw. Gruppengrößen von ca.<br />
10 bis 14 Personen führt schon<br />
eine geringe Min<strong>der</strong>auslastung<br />
zu betriebswirtschaftlichen<br />
Problemen. Pflegebedürftige<br />
sind in <strong>der</strong> Regel nicht bereit<br />
(o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Lage) erhebliche<br />
Beträge über die Leistungen<br />
<strong>der</strong> Pflegeversicherung und die<br />
zusätzlichen selbst zu tragen‐<br />
den Kosten für Unterkunft und<br />
Verpflegung hinaus zu zahlen.<br />
Aus Nutzersicht scheint es<br />
jedoch als sinnvoll, dass die<br />
Einrichtungen flexibel auf<br />
<strong>der</strong>en Bedarfslagen regieren.<br />
Tagespflege erfor<strong>der</strong>t vom<br />
Träger eine grundsätzlich<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>e konzeptionelle Ausrich‐<br />
tung als ambul<strong>an</strong>te Pflege. Sie<br />
155<br />
LXXIII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
rfor<strong>der</strong>t ein „Denken im Ver‐<br />
sorgungsverbund“, weil sie<br />
überwiegend parallel zu ambu‐<br />
l<strong>an</strong>ten professionellen Pflege<br />
und zur familiären Pflege<br />
erfolgt (…) Es müssen Möglich‐<br />
keiten geschaffen werden,<br />
unterschiedliche Konzepte in<br />
<strong>der</strong> Tagespflege noch intensi‐<br />
ver zu erproben (…)<br />
Es kommt drauf <strong>an</strong>, eine sorg‐<br />
fältige Bedarfsprüfung (As‐<br />
sessment) und ein ebenso<br />
sorgfältiges Care‐M<strong>an</strong>agement<br />
durchzuführen, beides steht als<br />
Element <strong>der</strong> Regelversorgung<br />
nicht zur Verfügung (…)<br />
Wenn zu einer Übersiedlung in<br />
ein Pflegeheim Alternativen<br />
bestehen, so werden diese von<br />
den Betroffenen und den<br />
Angehörigen in <strong>der</strong> Regel<br />
bevorzugt. Das Ziel einer<br />
Beratung im Vorfeld <strong>der</strong> Leis‐<br />
tungserbringung muss es sein,<br />
diese Alternativen auszuloten,<br />
wobei Kombinationslösungen<br />
mit Tagespflege und Betreu‐<br />
tem Wohnen mit einbezogen<br />
werden müssen.<br />
157 Exkurs: Aspekte <strong>der</strong> Qualitäts‐<br />
sicherungsdiskussion<br />
Hohe Erwartungen waren und<br />
sind verbunden mit den Maß‐<br />
nahmen zur Qualitätssiche‐<br />
rung, die auf vielen Ebenen<br />
diskutiert werden. (…)<br />
S. 137<br />
LXXIV
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Es wird auf ein gelingendes<br />
Wechselspiel zwischen ex‐<br />
terner und interner Qualitäts‐<br />
sicherung <strong>an</strong>kommen, weil die<br />
interne Qualitätssicherung<br />
sozusagen <strong>der</strong> externen Quali‐<br />
tätssicherung folgt. Wenn die<br />
externen Qualitätssicherer<br />
falsche Prioritäten setzen, tun<br />
es auch die internen, und<br />
wichtige Schwachstellen blei‐<br />
ben unbearbeitet.<br />
<strong>Die</strong> externen Qualitätssicherer<br />
müssen ihre Aufmerksamkeit<br />
auf den St<strong>an</strong>d <strong>der</strong><br />
Erkenntnisse in Gerontologie,<br />
Pflege und Geriatrie richten<br />
und ihre Konzepte dement‐<br />
sprechend weiterentwickeln.<br />
158 <strong>Die</strong> externe Qualitätssicherung<br />
wird wahrscheinlich nur relativ<br />
grobe Mängel aufdecken und<br />
verhin<strong>der</strong>n können. Für eine<br />
steigende Qualitätsentwicklung<br />
im Detail, für Einstellungsände‐<br />
rungen bei<br />
Mitarbeitern und die Verwirkli‐<br />
chung einer neuen Kultur des<br />
Helfens bedarf es <strong>der</strong><br />
internen Qualitätssicherung mit<br />
vergleichsweise einfachen<br />
Instrumenten, <strong>der</strong>en Sinn von<br />
den Beteiligten verst<strong>an</strong>den<br />
wird. Hierzu können <strong>an</strong> dieser<br />
Stelle nur einige Hinweise<br />
gegeben werden.<br />
Fundament aller Qualitätssiche‐<br />
S. 138 „Qualitätssiche‐<br />
rungsbemühun‐<br />
gen sind Begriffe,<br />
die klar beschrei‐<br />
ben, was gute und<br />
was schlechte<br />
Altenpflege ist,<br />
(…)“<br />
LXXV
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD<br />
rungsbemühungen sind<br />
Begriffe, die klar beschreiben,<br />
was gute und was schlechte<br />
Altenpflege ist, wo z. B. Gewalt<br />
in <strong>der</strong> Pflege beginnt und<br />
welche Rahmenbedingungen<br />
dazu führen können<br />
(…). Ferner sollte <strong>der</strong> zurzeit<br />
sehr verbreiteten Neigung<br />
entgegengewirkt werden, l<strong>an</strong>g<br />
und breit über optimale<br />
Verrichtungsst<strong>an</strong>dards zu dis‐<br />
kutieren, weil solche St<strong>an</strong>dards<br />
in aller Regel im Alltag<br />
<strong>an</strong>gesichts <strong>der</strong> verfügbaren<br />
Pflegezeitbudgets nicht ver‐<br />
wirklicht werden können. Viel<br />
wirkungsvoller für eine Quali‐<br />
tätsentwicklung ist zurzeit die<br />
Formulierung von Struktur‐<br />
st<strong>an</strong>dards (z. B. Tageslaufstruk‐<br />
tur, zu <strong>Die</strong>nstplänen, zu<br />
Übergabebesprechungen, zur<br />
Pflegedokumentation und zur<br />
Org<strong>an</strong>isation <strong>der</strong> Medikamen‐<br />
tenversorgung usw.).<br />
Einrichtungsträger und Pflege‐<br />
kassen nehmen Wünsche und<br />
Kritik <strong>der</strong> zu Pflegenden und<br />
ihrer Angehörigen zunehmend<br />
ernst, und es gibt keine glaub‐<br />
würdigeren Beiträge zum<br />
Thema „Qualität in <strong>der</strong> Pflege“.<br />
Daher können Nutzerbefra‐<br />
gungen („Kundenbefragun‐<br />
gen“) einmünden in die Er‐<br />
munterung, sich offen über das<br />
LXXVI
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
zu beschweren, was <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Pflege ihrer Meinung nach<br />
nicht in Ordnung ist. Es ist<br />
unsinnig, die Anzahl <strong>der</strong> Be‐<br />
schwerden minimieren zu<br />
wollen, son<strong>der</strong>n die Ursachen<br />
<strong>der</strong> Beschwerden müssen<br />
eliminiert werden (…). Ein<br />
Katalog <strong>der</strong> Stärken und<br />
Schwächen (Qualitätsprofil)<br />
und <strong>der</strong> möglichen Verbesse‐<br />
rungen k<strong>an</strong>n außer durch<br />
Auswertung <strong>der</strong> Besuche von<br />
Heimaufsicht und MDK, z. B.<br />
durch differenzierte Betriebs‐<br />
vergleiche („Benchmarking“)<br />
gewonnen werden o<strong>der</strong> ach<br />
durch die Befragung von<br />
Nutzern („Kunden“), Mitarbei‐<br />
tern und <strong>an</strong><strong>der</strong>en Schlüsselper‐<br />
sonen.<br />
159 Es ergibt sich <strong>der</strong> Eindruck, dass<br />
Zertifizierung und Zertifikate<br />
häufig eher Marketing‐Mittel<br />
als Instrumente <strong>der</strong><br />
Qualitätsentwicklung und<br />
Qualitätssicherung darstellen.<br />
Ob bei ihnen Kosten und<br />
Nutzen in einem <strong>an</strong>gemesse‐<br />
nen Verhältnis stehen, k<strong>an</strong>n<br />
bezweifelt werden.<br />
160 Ausblick für die Heimsituation:<br />
(…) Zunehmend wird die Quali‐<br />
tät eines Pflegeheimes diffe‐<br />
renzierter betrachtet, und es<br />
zeichnet sich ab, dass die<br />
bisl<strong>an</strong>g <strong>an</strong>gebotsorientierte<br />
S. 139 Zertifikate als<br />
Marketingsinstru<br />
ment<br />
S. 139<br />
LXXVII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Pflege stärker einer nachfrage‐<br />
orientierten Pflegequalität<br />
weichen muss. <strong>Die</strong> stationäre<br />
Pflege muss sich zunehmend<br />
auch dar<strong>an</strong> messen lassen, wie<br />
sie vom Bewohner selbst und<br />
seinen Angehörigen beurteilt<br />
wird. <strong>Die</strong> subjektiv beurteilte<br />
Ergebnisqualität rückt zuneh‐<br />
mend in den Vor<strong>der</strong>grund. Das<br />
bedeutet, dass die Erwartun‐<br />
gen <strong>der</strong> Pflegebedürftigen<br />
stärker bei <strong>der</strong> Angebotsent‐<br />
wicklung berücksichtigt wer‐<br />
den müssen. Allerdings ist ein<br />
W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> Einrichtungen in<br />
Richtung auf eine deutliche<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Wohn‐ und<br />
Pflegequalität in den beste‐<br />
henden Strukturen kosten‐<br />
neutral kaum möglich (…).<br />
Pflege versteht sich generell<br />
zunehmend als ein regional<br />
vernetztes Angebot. Ambul<strong>an</strong>‐<br />
te, teil‐ und vollstationäre<br />
Pflege<strong>an</strong>gebote in einer Region<br />
werden besser aufein<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
abgestimmt. Um die zukünftige<br />
Pflegeinfrastruktur sollte kein<br />
versäultes, son<strong>der</strong>n ein durch‐<br />
lässiges System sein – die<br />
Grenzen zwischen ambul<strong>an</strong>ter,<br />
teilstationärer und vollstatio‐<br />
närer Pflege werden fließend –,<br />
indem <strong>der</strong> Austausch von<br />
Leistungen <strong>der</strong> Anbieter unter‐<br />
ein<strong>an</strong><strong>der</strong> möglich und auch<br />
Aktivitätspara‐<br />
digma<br />
LXXVIII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
161 <strong>Die</strong> wachsende Bedeutung <strong>der</strong> Zielgruppe<br />
psychisch kr<strong>an</strong>ker Menschen<br />
Perm<strong>an</strong>ent auf <strong>der</strong> Suche, vertrautes und<br />
Kontinuität für eine ständig erfor<strong>der</strong>liche<br />
örtliche, zeitliche und situative Orientierung<br />
zu finden, hat das eigene Zimmer für psy‐<br />
chisch erkr<strong>an</strong>kte ältere Menschen eine<br />
zentrale Bedeutung. Nur das eigene Zimmer<br />
gar<strong>an</strong>tiert, dass insbeson<strong>der</strong>e ein<br />
demenziell erkr<strong>an</strong>kter Mensch seinen<br />
Lebensrhythmus nicht perm<strong>an</strong>ent dem<br />
eines Mitbewohners <strong>an</strong>passen muss.<br />
gefor<strong>der</strong>t ist. Hierzu gehört<br />
neben <strong>der</strong> Flexibilisierung <strong>der</strong><br />
Angebote natürlich auch die<br />
Bereitschaft <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
dieser Einrichtungen, ihre<br />
Arbeitszeit <strong>an</strong> den Bedürfnis‐<br />
sen <strong>der</strong> Bewohner auszurich‐<br />
ten. <strong>Die</strong>s ist eine Frage <strong>der</strong><br />
Personalorg<strong>an</strong>isation. (…)<br />
Neuzeitliche Pflegekonzepte<br />
orientieren sich zunehmend <strong>an</strong><br />
den Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens und berücksichtigen<br />
aktivierende und die Selbst‐<br />
ständigkeit för<strong>der</strong>nde Pflege.<br />
Der ehemals „ge‐ und verpfleg‐<br />
te Patient“ wird zum „Kunden“.<br />
Es ergibt sich schlüssig, dass<br />
jedem Bewohner ein eigenes<br />
Zimmer zur Befriedigung seiner<br />
persönlichen Wohnbedürfnisse<br />
zur Verfügung gestellt werden<br />
sollte, und dass zukünftige<br />
Wohnformen – insbeson<strong>der</strong>e<br />
wenn sie zum Leben demen‐<br />
ziell Erkr<strong>an</strong>kter geeignet sein<br />
sollen – dieses Element bein‐<br />
halten sollten (…). Darüber<br />
hinaus müssen die Pflegeein‐<br />
richtungen ihre Wohn‐ und<br />
Pflegekonzepte noch besser <strong>an</strong><br />
ihre zukünftigen Schwerpunkt‐<br />
zielgruppen <strong>an</strong>passen. Dass<br />
eine dieser Gruppen <strong>der</strong> Per‐<br />
sonenkreis <strong>der</strong> psychisch<br />
kr<strong>an</strong>ken Pflegebedürftigen sein<br />
wird, dürfte fachlich unbestrit‐<br />
S. 140 Jedem Bewohner<br />
ein eigenes Zim‐<br />
mer zur Befriedi‐<br />
gung seiner<br />
persönlichen<br />
Wohnbedürfnisse<br />
zur Verfügung<br />
stellen!<br />
LXXIX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
ten sein. <strong>Die</strong> Einrichtungen <strong>der</strong><br />
1. und 2. Generation sind<br />
baulich und auch konzeptionell<br />
kaum in <strong>der</strong> Lage, diesem<br />
Personenkreis gerecht zu<br />
werden. Zu unübersichtlich<br />
sind <strong>der</strong>en Funktions‐ und<br />
Org<strong>an</strong>isationsbereiche, zu<br />
gering ihre beruhigende und<br />
orientierungsför<strong>der</strong>nde Wohn‐<br />
qualität.<br />
162 Das Hausgemeinschaftkonzept<br />
ist unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Pflegequalität nicht teurer als<br />
eine qualitativ vergleichbare<br />
stationäre Einrichtung. Aller‐<br />
dings müssen die Aufbau‐ und<br />
Personalorg<strong>an</strong>isation den<br />
Bewohnerinteressen unterge‐<br />
ordnet werden. Familienähnli‐<br />
che Wohnkonzepte, die die<br />
Ergebnisqualität aus Sicht <strong>der</strong><br />
Bewohner und <strong>der</strong>en Angehö‐<br />
rigen berücksichtigen, können<br />
auch einen erheblichen Beitrag<br />
zum Abbau von struktureller<br />
Gewalt leisten. Und das Kon‐<br />
zept <strong>der</strong> Hausgemeinschaft<br />
bietet auch unter be‐<br />
triebswirtschaftlichen Ge‐<br />
sichtspunkten ein würdevolles<br />
Wohnen und Leben bei hoch‐<br />
gradigem Hilfebedarf. In die‐<br />
sem Sinne können sie erheblich<br />
dazu beitragen, die Lebensqua‐<br />
lität psychisch kr<strong>an</strong>ker Pflege‐<br />
bedürftiger zu verbessern.<br />
S. 142 Plädoyer für<br />
Hausgemeinschaf‐<br />
ten unter etriebs‐<br />
wirtschaftl. Ge‐<br />
sichtspunkten<br />
LXXX
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
163 Über die Diskussion <strong>der</strong> Vereinheitlichung<br />
<strong>der</strong> Altenpflegeausbildung hinaus wurden<br />
seit Mitte <strong>der</strong> 1990er‐Jahre Reformvor‐<br />
schläge entwickelt, in denen Integration auf<br />
einer noch umfassen<strong>der</strong>en Ebene <strong>an</strong>ge‐<br />
strebt wird: Gemeint sind die Ansätze, die<br />
auf eine gemeinsame, die <strong>der</strong>zeit vonein<strong>an</strong>‐<br />
<strong>der</strong> getrennten pflegerischen Bildungsgänge<br />
ntegrierende Pflegeausbildung abzielen.<br />
Aufgrund begrenzter Ressour‐<br />
cen im Gesundheitssystem<br />
werden perspektivisch Fragen<br />
<strong>der</strong> Bildungsqualität und des<br />
M<strong>an</strong>agements von Bildung und<br />
Wissen <strong>an</strong> Bedeutung gewin‐<br />
nen. <strong>Die</strong> Fort‐ und Weiterbil‐<br />
dung von Mitarbeiter wird<br />
zunehmend eine Aufgabe <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> gesamten<br />
Org<strong>an</strong>isation. Es ist zu erwar‐<br />
ten, dass <strong>an</strong>stehende Refor‐<br />
men im Bereich <strong>der</strong> Erstausbil‐<br />
dung direkte Auswirkungen auf<br />
das System <strong>der</strong> Weiterbildung<br />
haben werden. Ein Problembe‐<br />
reich ist in <strong>der</strong> Konkurrenz‐<br />
situation zwischen Weiterbil‐<br />
dungsprofilen und Hochschul‐<br />
ausbildungen zu sehen. Gemäß<br />
<strong>der</strong> Maßstäbe zur Qualitätssi‐<br />
cherung nach SGB IX § 80 muss<br />
eine ver<strong>an</strong>twortliche Pflege‐<br />
fachkraft eine Person sein, die<br />
aus einem Pflegeberuf kommt,<br />
über eine entsprechende<br />
Weiterbildung verfügt (mind.<br />
460 Stunden) und in den<br />
letzten fünf Jahren vor Antritt<br />
<strong>der</strong> Stelle zwei Jahre in <strong>der</strong><br />
Pflege vollzeitbeschäftigt war.<br />
Anstelle <strong>der</strong> Weiterbildung<br />
k<strong>an</strong>n auch ein Hochschulab‐<br />
schluss im Pflegem<strong>an</strong>agement<br />
Bereich vorgelegt werden. Für<br />
eine solche Person ist <strong>der</strong><br />
Nachweis <strong>der</strong> gefor<strong>der</strong>ten<br />
S. 146 For<strong>der</strong>ung nach<br />
Vereinheitlichung<br />
<strong>der</strong> Ausbildung in<br />
den Pflegeberu‐<br />
fen<br />
Personal‐ und<br />
Org<strong>an</strong>isations‐<br />
entwicklung<br />
LXXXI
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Vollbeschäftigung nahezu<br />
unmöglich. Daraus entsteht<br />
eine strukturelle Benachteili‐<br />
gung für Hochschulabsolven‐<br />
ten.<br />
164 Nachwuchsför<strong>der</strong>ung im akademischen<br />
Bereich<br />
Infolge <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit noch rudimentären<br />
Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
dominieren in vielen Studiengängen<br />
<strong>der</strong>en Bezugswissenschaften (im Wesent‐<br />
lichen Sozial‐ und Geisteswissenschaften).<br />
Gravierende Än<strong>der</strong>ungen sind hier erst<br />
und nur d<strong>an</strong>n zu erwarten, wenn eine<br />
hinreichende Anzahl von Pflegewissen‐<br />
schaftler mit entsprechen<strong>der</strong> Expertise<br />
zur Verfügung steht. <strong>Die</strong>s setzt eine<br />
adäquate Nachwuchsför<strong>der</strong>ung voraus.<br />
Um diese zu ermöglichen, ist <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeiti‐<br />
ge universitäre Ausbau von Pflegewissen‐<br />
schaft und die Zahl dort besetzter pflege‐<br />
wissenschaftlicher Lehrstühle zu gering.<br />
Zudem macht sich eine generelle Struk‐<br />
turschwäche des <strong>deutschen</strong> Hochschul‐<br />
systems bemerkbar: Auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />
Nachwuchsför<strong>der</strong>ung – speziell Promo‐<br />
tions‐ und Habilitationsför<strong>der</strong>ung – fehlen<br />
geeignete promotionsvorbereitende und<br />
Post‐Doc‐Programme. <strong>Die</strong> Folgen dessen<br />
zeigen sich etwa dar<strong>an</strong>, dass promotions‐<br />
interessierte <strong>Pflegewissenschaft</strong>ler in das<br />
Ausl<strong>an</strong>d abw<strong>an</strong><strong>der</strong>n (…).<br />
Wissenschaftsentwicklung und For‐<br />
schungsför<strong>der</strong>ung<br />
Es m<strong>an</strong>gelt <strong>der</strong>zeit nicht nur <strong>an</strong> einem<br />
<strong>an</strong>gemessenen universitären Ausbau von<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong>, son<strong>der</strong>n auch <strong>an</strong><br />
S. 147 Nachwuchsförde‐<br />
rung im akademi‐<br />
schen Bereich<br />
fehlt<br />
LXXXII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
165 Insgesamt ist <strong>der</strong> Ressourcen‐<br />
charakter <strong>der</strong> Technik als hoch<br />
<strong>an</strong>zusetzen und dieser wird in<br />
Zukunft noch in signifik<strong>an</strong>ter<br />
Weise zunehmen. <strong>Die</strong> wesent‐<br />
lichen Gewinne liegen im Be‐<br />
reich <strong>der</strong> grundlegenden<br />
Selbstständigkeitserhaltung,<br />
<strong>der</strong> Kompensation von Defizi‐<br />
ten und <strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung von<br />
Pflegerisiken, des Angebots<br />
neuer Möglichkeiten <strong>der</strong> The‐<br />
rapie, Pflege und „Überwa‐<br />
chung“ (im guten Sinne des<br />
Worts) bis hin zu neuen For‐<br />
men des sozialen Austauschs,<br />
neuen Formen <strong>der</strong> Erreichbar‐<br />
keit von signifik<strong>an</strong>tem An<strong>der</strong>en<br />
und einer „neuen“ Mobilität<br />
auf <strong>der</strong> räumlichen (z. B. Navi‐<br />
gationssysteme im Auto) und<br />
auf <strong>der</strong> mentalen Ebene (z. B.<br />
Erreichbarkeit <strong>der</strong> „Welt“ über<br />
Internet von jedem Wohnort<br />
einer adäquaten Forschungsför<strong>der</strong>ung.<br />
<strong>Die</strong>se zeichnet sich gegenwärtig allenfalls<br />
schemenhaft ab. Bundesweit fehlt es <strong>an</strong><br />
hinreichenden strukturellen und materiel‐<br />
len Ressourcen für Pflegeforschung – sei<br />
es auf dem Gebiet <strong>der</strong> <strong>an</strong>wendungsorien‐<br />
tierten Forschung wie auf dem <strong>der</strong> Grund‐<br />
lagenforschung. <strong>Die</strong> Behebung dessen ist<br />
auch deswegen dringend erfor<strong>der</strong>lich,<br />
weil sonst die Gefahr besteht, dass sich<br />
<strong>der</strong> auf diesem Gebiet unzweifelhaft<br />
vorh<strong>an</strong>dene internationale Entwicklungs‐<br />
rückst<strong>an</strong>d zu zementieren droht.<br />
M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> For‐<br />
schungsför<strong>der</strong>ung<br />
Potentiale und<br />
Risiken neuer<br />
Technologien für<br />
älter Menschen<br />
Vorteile<br />
LXXXIII
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
aus). Noch konkreter betrach‐<br />
tet ergeben sich etwa die fol‐<br />
genden Vorteile: Alltäglich not‐<br />
wendige Arbeiten können auf‐<br />
grund zunehmen<strong>der</strong> Automati‐<br />
sierung mit weniger Mühe und<br />
geringerem Zeitaufw<strong>an</strong>d erle‐<br />
digt werden. <strong>Die</strong>s könnte mi‐<br />
ttelfristig und längerfristig den<br />
„Alltag im Alter“, <strong>der</strong> in star‐<br />
kem Ausmaß von solchen<br />
grundlegenden Lebensfüh‐<br />
rungsaufgaben bestimmt ist,<br />
deutlich verän<strong>der</strong>n. Durch<br />
neue multimediale Informati‐<br />
ons‐ und Kommunikationsgerä‐<br />
te wie Bildtelefon, Internet,<br />
und E‐Mail k<strong>an</strong>n das Bedürfnis<br />
nach Sozialkontakten selbst im<br />
Falle eines Verlusts <strong>der</strong> außer‐<br />
häuslichen Mobilität ebenso<br />
befriedigt werden wie das Be‐<br />
dürfnis nach Weiterbildung<br />
und Information (…). Intelligen‐<br />
te Haustechnik k<strong>an</strong>n das Woh‐<br />
nen in vertrauter Umgebung<br />
auch bei beeinträchtigter Ge‐<br />
sundheit erleichtern und könn‐<br />
te damit in beson<strong>der</strong>e Weise<br />
das hohe Alter unterstützen.<br />
Im Falle von Pflege und Thera‐<br />
pie könnte durch den Einsatz<br />
von neuen Techniken eine ge‐<br />
wisse Entlastung <strong>der</strong> Professi‐<br />
onellen, vielleicht sogar eine<br />
spürbare Kostenreduktion<br />
eintreten.<br />
LXXXIV
3. Bericht zur Lage<br />
<strong>der</strong> älteren Genera‐<br />
tion in <strong>der</strong> BRD:<br />
Alter und Gesell‐<br />
schaft 2001<br />
(Auftraggebende<br />
Ministerin Christine<br />
Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
166 Individuelle Risiken<br />
Darüber ist zu sagen, dass wir<br />
bisl<strong>an</strong>g über die sozialen Kon‐<br />
sequenzen neuer Technologien<br />
und neuer Medien bei alten<br />
Menschen praktisch noch<br />
nichts wissen. <strong>Die</strong> Frage etwa,<br />
ob eine Internetnutzung l<strong>an</strong>g‐<br />
fristig reale soziale Kontakte<br />
eher för<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> stärkere Iso‐<br />
lation und Einsamkeit bewirken<br />
könnte, ist heute schlicht noch<br />
nicht be<strong>an</strong>twortbar. Eine zu<br />
starke Automatisierung könnte<br />
ferner zu Unterfor<strong>der</strong>ungen<br />
und zu einem „Disuse“ führen,<br />
<strong>der</strong> sich negativ auf die Auf‐<br />
rechterhaltung von H<strong>an</strong>dlungs‐<br />
kompetenzen auswirken könn‐<br />
te. <strong>Die</strong> sich mit neuen Techno‐<br />
logien ergebenden Möglichkei‐<br />
ten <strong>der</strong> „Totalüberwachung“<br />
aus <strong>der</strong> Dist<strong>an</strong>z bergen neben<br />
ihren Möglichkeiten (beispiels‐<br />
weise <strong>der</strong> Früherkennung eines<br />
Re‐Insults) auch die Gefahr<br />
schwerwiegen<strong>der</strong> Privatheits‐<br />
verletzungen.<br />
Gesellschaftliche Risiken<br />
Ein Risiko ergibt sich daraus,<br />
dass <strong>der</strong> Umg<strong>an</strong>g mit neuen<br />
Technologien auch neue Kom‐<br />
petenzen voraussetzt, die zu‐<br />
mindest den heutigen Älteren<br />
nur in begrenztem Ausmaß zur<br />
Verfügung stehen. Es besteht<br />
also die Gefahr, dass die ohne‐<br />
S. 266 Nachteile<br />
LXXXV
hin sich immer mehr beschleu‐<br />
nigende Entwicklung unserer<br />
Gesellschaft hin zu einer Infor‐<br />
mationsgesellschaft <strong>an</strong> den Al‐<br />
ten vorbei geht und zu einem<br />
nicht mehr kompensierbaren<br />
Ungleichgewicht führt. Das<br />
zweite Risiko besteht darin,<br />
dass innerhalb <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong><br />
Älteren eine „Zweiklassenin‐<br />
formationsgesellschaft“ <strong>der</strong><br />
Technik‐Nutzer und <strong>der</strong> Tech‐<br />
nik‐Nichtnutzer entstehen<br />
könnte. <strong>Die</strong> einen Älteren<br />
könnten sich mithilfe <strong>der</strong> neu‐<br />
en Technologien neue H<strong>an</strong>d‐<br />
lungs‐ und Alternsoptionen<br />
verschaffen, während den <strong>an</strong>‐<br />
<strong>der</strong>en die Ressource Technik<br />
eher verschlossen bleiben<br />
würde.<br />
LXXXVI
Anlage B: Qualitativ heuristische Analyse <strong>der</strong> Gutachtenbefunde (mod. nach Kleining und Witt 2000)<br />
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE), 1998<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunahme <strong>der</strong> älteren und<br />
hochbetagten Bevölke‐<br />
rung<br />
A1<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Gesamtbe‐<br />
völkerung<br />
A2<br />
Zunahme des Bedarfs <strong>an</strong> professionell medi‐<br />
zinisch und pflegerischen Leistungen<br />
B1<br />
Zunahme maligner, psychiatrischer und<br />
neurologischer Erkr<strong>an</strong>kungen<br />
B3<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung von Alter und Be‐<br />
hin<strong>der</strong>ung<br />
B4<br />
Zunahme <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit, insbeson‐<br />
<strong>der</strong>e durch Demenz im hohen Alter<br />
B5, B19<br />
Mit zunehmenden Alter zunehmendes Inte‐<br />
resse <strong>an</strong> Ernährung<br />
B6<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Zahngesundheit<br />
im Alter wegen des höchsten Kostenfaktors<br />
B21<br />
Dringende H<strong>an</strong>dlungsbedarfe im Bereich <strong>der</strong><br />
Prävention <strong>der</strong> Zahnmedizin und <strong>der</strong> Zahn‐<br />
ersatzversorgung<br />
B35<br />
Zunahme <strong>der</strong> peripheren arteriellen Ver‐<br />
schlusskr<strong>an</strong>kheit (paVk)<br />
B13<br />
LXXXVII
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (1998)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung von Umweltein‐<br />
flüssen. Zunehmendes Raucherverhalten bei<br />
Jugendlichen und Erwachsenen: Immer mehr<br />
Erwachsene rauchen, immer weniger Frauen<br />
hören damit auf.<br />
Zunehmende Bedeutung des Passivrauchens<br />
für den Gesundheitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
Zunehmende Gesundheitsrisiken durch<br />
Wohnungsumfeld (Atemwegserkr<strong>an</strong>kungen,<br />
Herz‐Kreislauferkr<strong>an</strong>kungen und Stürze)<br />
Zunehmende Umweltgesundheitsrisiken<br />
durch Feinstaubkonzentration und ionisie‐<br />
rende Strahlung<br />
Klinische (präventive) Trends. Zunehmende<br />
Bedeutung des Lungenkrebses bei Männern<br />
(häufigste Krebstodesurache)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Gebärmutter‐<br />
krebsvorsorge bei Frauen<br />
Zunehmende Bedeutung von Darmkrebsvor‐<br />
sorgeuntersuchungen<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Sterblichkeit nach Oberschen‐<br />
kelhalsbrüchen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Arthrosen im<br />
Alter<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Grippeschutz‐<br />
impfung im Alter<br />
Keine Kr<strong>an</strong>kheits<strong>an</strong>gabe ohne Kosten‐<br />
<strong>an</strong>gabe Zunehmende Bedeutung sozia‐<br />
ler und ökonomischer Folgen von<br />
Kr<strong>an</strong>kheit und Behin<strong>der</strong>ung (keine,<br />
Anm. MB)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Pflegebe‐<br />
rufe, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Altenpflege auf<br />
dem Arbeitsmarkt<br />
B7<br />
B14<br />
B8<br />
B9, B12<br />
B10, B11<br />
B14<br />
B15<br />
B16<br />
B18<br />
B17<br />
B20<br />
C4<br />
C14‐C22<br />
C20<br />
C29<br />
LXXXVIII
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (1998)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmendes Belastungsspektrum aus<br />
<strong>der</strong> Arbeitswelt: Belastungsstruktur‐<br />
w<strong>an</strong>del von körperlichen zu psychischen<br />
Erkr<strong>an</strong>kungen<br />
Stagnation im Bereich von Mängelfrei‐<br />
heit <strong>der</strong> Betriebe im Rahmen des<br />
Gesundheitsschutzes<br />
Trends und Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Versor‐<br />
gungsebene. Zunehmende Zahl <strong>der</strong><br />
Pflegeeinrichtungen<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflegeeinrichtungen und sonstiger<br />
Gesundheitspraxen<br />
Zunehmende Bedeutung integrierter<br />
Versorgungsformen<br />
Stagnation von Pflegeplätzen im Heim‐<br />
sektor<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäuser und Rück‐<br />
g<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Verweildauer<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> ärztlichen und pflegeri‐<br />
schen Versorgungskapazität<br />
Zunehmende Fallzahlen durch Fort‐<br />
schritte in <strong>der</strong> medizinischen Beh<strong>an</strong>d‐<br />
lung und Fallpauschalen<br />
Zunahme differenzierter Versorgungs‐<br />
<strong>an</strong>gebote (Kurzzeit‐, Tagespflege etc.)<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Bedarf von Rehabilitati‐<br />
onsmaßnahmen<br />
Zunehmende Beeinträchtigung <strong>der</strong><br />
Qualität häuslicher Kr<strong>an</strong>kenpflege durch<br />
Wettbewerb und Kostendruck<br />
Gesamtwirtschaftliche Trends. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung <strong>der</strong> Pharmaindustrie<br />
und elektromedizinischer Produktion im<br />
C11<br />
C29<br />
C6<br />
C33, C23<br />
C25<br />
C26<br />
C24<br />
C25<br />
C31<br />
C27<br />
C33<br />
C34<br />
C28<br />
LXXXIX
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (1998)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit Produktionswerten<br />
und Weltmarkt<strong>an</strong>teilen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Selbstme‐<br />
dikation in <strong>der</strong> Arzneimittelversorgung<br />
und Fin<strong>an</strong>zierung<br />
Zunahme <strong>der</strong> Beh<strong>an</strong>dlungskosten in<br />
Kr<strong>an</strong>kenhäusern<br />
Zunehmende Ausgaben im Bereich<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflege sowie Kr<strong>an</strong>ken‐ und<br />
Rettungstr<strong>an</strong>sporte<br />
Weniger Wachstum im Gesundheitswe‐<br />
sen als im Rest <strong>der</strong> Gesamtwirtschaft<br />
Zunahme von Einpersonenhaushalten<br />
und damit Rückg<strong>an</strong>g des Pflegepo‐<br />
tentials<br />
Zunehmende Bedeutung von Bildung<br />
und Gesundheit. Zunahme <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Bedeutung von sozialer Lage und<br />
Bildungsst<strong>an</strong>d im Hinblick auf Kr<strong>an</strong>k‐<br />
heit und Sterblichkeit<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Be‐<br />
schreibung sozialer und ökonomischer<br />
Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />
Zunahme des Bildungsniveaus in <strong>der</strong><br />
Gesellschaft sowie zunehmende Be‐<br />
deutung des Zusammenh<strong>an</strong>gs von<br />
Bildung und gesundheitsför<strong>der</strong>ndem<br />
Verhalten<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung von akade‐<br />
mischer Ausbildung in <strong>der</strong> Pflege<br />
C30<br />
C32<br />
C36<br />
C36<br />
D1<br />
D1<br />
D4<br />
D8<br />
D29<br />
XC
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demograf. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐<br />
Nr.<br />
Zunahme des Altersquoti‐<br />
enten und Rückg<strong>an</strong>g des<br />
Erwerbstätigenpotentials<br />
A43<br />
Zunahme weiblicher Er‐<br />
werbsbeteiligung und An‐<br />
tieg des Rentenalters<br />
lässt Rentenquotienten<br />
l<strong>an</strong>gsamer wachsen als<br />
den demografischen<br />
Altersquotienten<br />
Zunahme <strong>der</strong> Lebenser‐<br />
wartung führt zur Zu‐<br />
nahme von Hochaltrig‐<br />
keit; Verdreifachung <strong>der</strong><br />
Hochaltrigkeit bis ins Jahr<br />
2040<br />
Trend zum Erhalt <strong>der</strong> Selbstständigkeit und<br />
Erwerbsfähigkeit. Zunehmende Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Erhaltung selbstständiger Lebensfüh‐<br />
rung im Alter und Erhaltung <strong>der</strong> Erwerbs‐<br />
und Arbeitsfähigkeit älterer Menschen<br />
Zunehmende Bedeutung des medizinischen<br />
, med.‐technischen, des technischen und<br />
des pflegerischen Fortschritts (siehe auch<br />
B<strong>an</strong>d II , 1997)<br />
A43<br />
A44<br />
B37<br />
B39<br />
XCI
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
L<strong>an</strong>gsame Verän<strong>der</strong>ung des Kr<strong>an</strong>kheits‐<br />
spektrums in Abhängigkeit von demografi‐<br />
scher Entwicklung und vom medizinischen<br />
Fortschritt<br />
Zunehmende Bedeutung von Gesundheits‐<br />
för<strong>der</strong>ung und Prävention und Qualitätssi‐<br />
cherung, v. a. Dingen <strong>der</strong> primären Präven‐<br />
tion<br />
Zunahme chronischer Erkr<strong>an</strong>kungen<br />
Zunahme l<strong>an</strong>gwieriger, chronisch‐ degene‐<br />
rativer Kr<strong>an</strong>kheitszustände<br />
Zunahme <strong>der</strong> chronischen Erkr<strong>an</strong>kungen in<br />
<strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte<br />
(Klinische) Interventionstrends.<br />
Mo<strong>der</strong>ate Zunahme des Versorgungsbe‐<br />
darfs in Kuration, Rehabilitation und Pflege<br />
für ältere Bevölkerungsgruppen in Abhän‐<br />
gigkeit von präventiven Investitionen <strong>der</strong><br />
Gegenwart und Anpassung <strong>an</strong> gesundheits‐<br />
und sozialpolitische Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Abnahme von Interventionsbedarf kurativer<br />
Leistungen in den höchsten Altersstufen,<br />
dafür Zunahme <strong>der</strong> Nachfrage von pflegeri‐<br />
schen Leistungen<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Versorgungsbedarf für ob‐<br />
struktive Lungenerkr<strong>an</strong>kungen, Herz‐<br />
Kreislauferkr<strong>an</strong>kungen v. a. operativ und<br />
rehabilitativ, Erkr<strong>an</strong>kungen des Urogenital‐<br />
trakts, für Krebserkr<strong>an</strong>kungen im diagnosti‐<br />
schen und therapeutischen Bereich, mode‐<br />
rate Zunahme im operativen und rehabilita‐<br />
tiven Bereich <strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kungen des Be‐<br />
wegungsapparates, für Erkr<strong>an</strong>kungen des<br />
Hör‐ und Sehsinns (ärztlich und nichtärzt‐<br />
B43<br />
B40<br />
B42<br />
B46<br />
B47<br />
B47<br />
B47<br />
XCII
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
lich), mo<strong>der</strong>ater Zuwachs <strong>an</strong> gerontopsy‐<br />
chiatrischer Versorgung<br />
Zunehmende Multimorbidität im Alter<br />
verl<strong>an</strong>gt sektorenübergreifende Maßnah‐<br />
men <strong>der</strong> Bereiche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung/<br />
Prävention, Kuration, Rehabilitation und<br />
Pflege. Trennung <strong>der</strong> Bereiche wird zukünf‐<br />
tig we<strong>der</strong> zeitlich noch sachlich sinnvoll<br />
möglich sein (s. Befund B47)<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Sterblichkeitsraten ins‐<br />
beson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> höheren Altersgruppen auf‐<br />
grund nicht‐ medizinischer Faktoren und<br />
<strong>der</strong> Verbesserung kurativer Medizin, insbe‐<br />
son<strong>der</strong>e <strong>der</strong> verbesserten Beh<strong>an</strong>dlung von<br />
Herzerkr<strong>an</strong>kungen sowie präventiver Maß‐<br />
nahmen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Fragen<br />
<strong>der</strong> Beschäftigung und des Wachs‐<br />
tums im und durch das Gesundheits‐<br />
wesen<br />
Zunehmende Bedeutung des Gesund‐<br />
heitswesens als Wirtschaftsfaktor mit<br />
Wachstums‐ und Produktivitätseffek‐<br />
ten neben Kostenfragen<br />
Zunehmende Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
zwischen Kostendämpfung und<br />
Wachstum (Paradigmatische Trend‐<br />
wende)<br />
Zunehmende Reformbestrebungen für<br />
das Gesundheitswesen in Richtung <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung einer kontrollierten, expe‐<br />
rimentellen Kultur<br />
Zunehmende Bedeutung des Moral<br />
Hazards (durch Versicherungsschutz<br />
B48<br />
B45<br />
C38<br />
C38<br />
C38<br />
C41<br />
C42<br />
XCIII
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
gegebener Anreiz zur übermäßigen<br />
In<strong>an</strong>spruchnahme von Gesundheits‐<br />
leistungen)<br />
Zunehmende Ausgabenentwicklung<br />
C43<br />
durch Leistungsausweitung durch<br />
<strong>an</strong>gebotsinduzierte Nachfrage, ausga‐<br />
bensteigernden medizinischen Fort‐<br />
schritts und W<strong>an</strong>dels,<br />
Zunehmende negative Preisstrukturef‐<br />
C43<br />
fekte zugunsten von Gesundheitsleis‐<br />
tungen, Leistungsintensivierung durch<br />
Defensivmedizin<br />
Abnahme <strong>der</strong> Kosten für Versterbende<br />
C45<br />
im letzten Lebensjahr mit zunehmen‐<br />
dem Alter durch Abnahme <strong>der</strong> Kumu‐<br />
lation und Dauer medizinischer Leis‐<br />
tungen<br />
Zunehmende (ökonomische) Bedeu‐<br />
C45<br />
tung von Vermeidung von Morbidität<br />
und vorzeitiger Mortalität<br />
Bedeutung einer trennscharfen Kr<strong>an</strong>k‐<br />
C46<br />
heitstypologie im Alter nimmt für die<br />
Kostenübernahme <strong>an</strong> Bedeutung zu<br />
Zunehmende Verlagerung von Leis‐<br />
C47<br />
tungen und Kosten von <strong>der</strong> GKV in die<br />
GPflV, sowohl ambul<strong>an</strong>t als auch stati‐<br />
onär<br />
Zunahme <strong>der</strong> Wichtigkeit einer Gleich‐<br />
C48<br />
zeitigkeit nahtloser Übergänge <strong>der</strong> ein‐<br />
zelnen Versorgungssektoren Gesund‐<br />
heitsför<strong>der</strong>ung/Prävention, Kuration,<br />
Rehabilitation und Pflege (siehe Be‐<br />
fund B48)<br />
Zunehmende Bedeutung von Wirt‐ C50<br />
XCIV
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
schaftlichkeitsreserven aufgrund eines<br />
zunehmenden demografischen Mehr‐<br />
bedarfs, um Rationierungen zu ver‐<br />
meiden<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Identifi‐<br />
kation von Wirtschaftlichkeitsreserven<br />
(Röntgenuntersuchungen, Knochen‐<br />
dichtemessungen, Arthroskopien,<br />
Rückenschmerzdiagnostik und<br />
‐therapie)<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Beschäftigungszuwachs<br />
in <strong>der</strong> Gesundheitsbr<strong>an</strong>che (auch in<br />
den Kliniken (!), Anm. MB) führt zu ei‐<br />
ner Sichtweise <strong>der</strong> Kostenexplosion<br />
und weniger in Richtung <strong>der</strong> Fort‐<br />
schrittlichkeit und Exp<strong>an</strong>sion<br />
Störungen des sozialen Friedens.<br />
Zunehmende Beherrschung <strong>der</strong> Dis‐<br />
kussion um Reformvorschläge durch<br />
ideologisch‐gesellschaftspolitische<br />
St<strong>an</strong>dpunkte wegen Zunahme sozia‐<br />
ler Sp<strong>an</strong>nungen<br />
Zunehmende Einpersonenhaushalte<br />
und Moral Hazard. Gestiegene An‐<br />
sprüche gegenüber <strong>der</strong> medizini‐<br />
schen Versorgung führen zur erhöh‐<br />
ten Ausgabenentwicklung<br />
Sozioökonomischer Status und Be‐<br />
deutung <strong>der</strong> Verteilungsgerechtig‐<br />
keit nimmt zu. Zunehmende Bedeu‐<br />
tung des im Hinblick auf Gesund‐<br />
heitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
Gesundheit und Kr<strong>an</strong>kheit in inter‐<br />
disziplinärer und politischer Per‐<br />
C51<br />
C52,<br />
C54<br />
D41<br />
D42<br />
D45<br />
D46<br />
XCV
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 1996 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
spektive. Zunehmende Bedeutung<br />
professioneller Sichtweisen auf Ge‐<br />
sundheit und Kr<strong>an</strong>kheit<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Gesundheits‐ und Sozialpolitik im<br />
Hinblick auf Altern in Gesundheit<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verbes‐<br />
serung von Fort‐ und Weiterbildung<br />
in <strong>der</strong> Geriatrie<br />
Zunehmende Bedeutung einer zu‐<br />
kunftsorientierten, voraus‐<br />
schauenden, risikomin<strong>der</strong>nden<br />
Gesundheitspolitik<br />
D47<br />
D48<br />
D49<br />
XCVI
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Absolute und relative Zu‐<br />
nahme älterer Menschen,<br />
Zunahme <strong>der</strong> hochbetag‐<br />
ten Menschen<br />
A65<br />
Medizinische Fortschritttrends. Medizi‐<br />
nischer Erkenntnisfortschritt wird zuneh‐<br />
mend über Methoden für Diagnose und<br />
Therapie, in Prävention und Rehabilita‐<br />
tion erreicht<br />
B58<br />
Zunehmende Bedeutung von Technolo‐<br />
gie, Nachfrage und Wettbewerb im<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit medizinischem<br />
Fortschritt<br />
B60<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> evidenz‐<br />
basierten Medizin und eines Health‐<br />
Technology‐ Assessments zur Evaluation<br />
von Wirksamkeit von Technologien und<br />
medizinischen Verfahren<br />
B61, B62<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Telematik<br />
im Bereich <strong>der</strong> Weiterentwicklung medi‐<br />
zinisch‐ diagnostischer und therapeuti‐<br />
scher Qualität sowie Verbesserung <strong>der</strong><br />
Versorgungsqualität (Dokumentation,<br />
Telekonsultation, Wissensb<strong>an</strong>ken)<br />
B69<br />
Zunehmende Bedeutung von org<strong>an</strong>isier‐<br />
ter Expertokratie im Bereich <strong>der</strong><br />
Telematik<br />
B71<br />
XCVII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Bevölke‐<br />
rung mit leichtem und erheblichem<br />
Pflegebedarf (Unterstützung bei <strong>der</strong><br />
grundpflegerischen Versorgung nötig)<br />
Klinisch‐pflegerische Trends. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung <strong>der</strong> Ermittlung und<br />
H<strong>an</strong>dhabbarkeit des Pflegebedarfs<br />
Zunehmende Bedeutung von Org<strong>an</strong>isa‐<br />
tionsprozessen und Pflegesystemen,<br />
Bezugspflege<br />
Zunehmende Bedeutung EDV‐gestützter<br />
Abstimmungs‐ und Org<strong>an</strong>isationsprozes‐<br />
se<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> (selbststän‐<br />
digen)/ medizinischen Assistenz in Diag‐<br />
nostik und Therapie und bei <strong>der</strong> Vor‐<br />
und Nachbereitung technischer Prozesse<br />
Zunehmende Bedeutung von Pflegedi‐<br />
agnostik, integrierter medizinischer und<br />
pflegerischer Dokumentation sowie<br />
Personaleinsatzpl<strong>an</strong>ung<br />
Zunehmende Bedeutung von Kr<strong>an</strong>ken‐<br />
hausinformationssystemen (KIS) und<br />
effektiven EDV‐Systemen<br />
Zunehmende Bedeutung von Grenzzie‐<br />
hungsprüfungen zwischen alten‐ und<br />
kr<strong>an</strong>kenpflegerischen Tätigkeiten, um<br />
mit <strong>der</strong> sich w<strong>an</strong>delnden Praxis Schritt<br />
halten zu können<br />
Zunehmende Bedeutung des Wachs‐<br />
tumsparadigmas im Gesundheitswesen<br />
im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Arbeits‐ und<br />
Leistungsfähigkeit sowie Wertschöpfung<br />
B65<br />
B66<br />
B66<br />
B66<br />
B66<br />
B67<br />
B67<br />
B68<br />
C55<br />
XCVIII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
und Wachstum<br />
Zunehmende Bedeutung im Wachstum<br />
bei Pflege, medizinischer Telematik,<br />
Medizinprodukte und dem Arzneimit‐<br />
telmarkt<br />
Ergebnisorientierung im Gesundheits‐<br />
wesen. Zunehmende Bedeutung von<br />
Output‐ und Outcomefaktoren, wie<br />
Morbidität, Lebenserwartung und Le‐<br />
bensqualität, hierbei gilt v.a. Dingen für<br />
entwickelte Volkswirtschaften das Mot‐<br />
to: „Add years to life <strong>an</strong>d life to years“<br />
Wohlfahrtseffekte (wie Morbidität, Le‐<br />
benserwartung, Lebensqualität, Erreich‐<br />
barkeit medizinischer Leistungen, Zeit‐<br />
kosten, Funktionseinbußen, Verunsiche‐<br />
rung und Leidgefühle des Patienten)<br />
bestimmen zunehmend, welche Leistun‐<br />
gen bezahlt werden, und welche nicht<br />
Zunehmende Bedeutung des Verhältnis‐<br />
ses zwischen Ressourceneinsatz und<br />
Nutzen (Gesundheitsergebnis), Erhö‐<br />
hung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit in Bezug auf<br />
Leistungserbringung<br />
Zunahme <strong>der</strong> GKV‐Ausgaben bis ins Jahr<br />
2030<br />
Zunehmende Bedeutung unterschiedli‐<br />
cher Interessen im Zusammenh<strong>an</strong>g mit<br />
dem Fortschrittszyklus, dadurch Kosten‐<br />
steigerung<br />
Zunehmende Bedeutung des Einbezugs<br />
<strong>der</strong> Zahler und <strong>der</strong> Zusammenarbeit von<br />
Herstellern, Leistungserbringern und<br />
C77<br />
C56<br />
C57<br />
C59<br />
C58<br />
C60<br />
C60<br />
XCIX
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Versicherern, um Kosten zu senken<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Beschäfti‐<br />
gungsch<strong>an</strong>cen in <strong>der</strong> Pflege (denn Pflege<br />
erlaubt nur in geringem Maße eine Sub‐<br />
stitution von Arbeit durch Kapital)<br />
Ausweitung des Pflegedienstes in Kr<strong>an</strong>‐<br />
kenhäusern um 40.000 Stellen (St<strong>an</strong>d<br />
1995)<br />
Knappheit qualifizierter Pflegekräfte in<br />
allen Bereichen<br />
Evaluation und (Forschungs‐)Ent‐<br />
wicklung. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Evaluation zwischen Innovations‐ und<br />
Diffusionsphase<br />
Zunehmende Bedeutung von Clearing‐<br />
Stellen<br />
Zunehmende Bedeutung unabhängiger<br />
Steuerungsmöglichkeiten im Bereich <strong>der</strong><br />
stationären Medizin und bei <strong>der</strong> Zulas‐<br />
sung von Medizinprodukten<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zie‐<br />
rungstr<strong>an</strong>sparenz von Universitätsklinika<br />
im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Forschung und<br />
Kr<strong>an</strong>kenversorgung und dadurch zu‐<br />
nehmende Bedeutung von gesetzlichen<br />
Neuregelungen (SGB) in diesem Bereich<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> gezielten<br />
För<strong>der</strong>ung von Forschungsprojekten<br />
durch die Kassen<br />
Verbetriebswirtschaftlichung <strong>der</strong> Pfle‐<br />
ge. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ausei‐<br />
n<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit betriebswirtschaftli‐<br />
chen und M<strong>an</strong>agement<strong>an</strong>sätzen für die<br />
C58<br />
C65<br />
C65<br />
C60<br />
C61<br />
C62<br />
C63<br />
C63<br />
C66<br />
C
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung von Kunden‐<br />
orientierung, pflegespezifischer Leitbild‐<br />
entwicklung, Qualitätsm<strong>an</strong>agementkon‐<br />
zepten sowie des operativen und strate‐<br />
gischen Controllings<br />
Zunehmende Bedeutung einer bedarfs‐<br />
gerechten und wirtschaftlichen Pflege<br />
als übergeordnete Ziel‐ und Wertvorstel‐<br />
lung<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Qualitätssi‐<br />
cherung in <strong>der</strong> häuslichen Pflege älterer<br />
Menschen durch Angehörige (§37<br />
SGBXI) und Verbesserung durch Modelle<br />
qualitätssichern<strong>der</strong> Pflegeunterstützung<br />
Zunehmende Bedeutung eines Care‐<br />
M<strong>an</strong>agements, um Drehtüreffekte zu<br />
vermeiden; zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Pflegeüberleitung<br />
Kooperation und Vernetzung. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung integrativer Modell‐<br />
projekte im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Schnitt‐<br />
stellenm<strong>an</strong>agement und Kooperations‐<br />
bemühungen <strong>der</strong> Berufsgruppen und<br />
Versorgungssektoren<br />
Technischer Fortschritt als Einsparpo‐<br />
tential. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Telematik als Einsparpotential (siehe<br />
B69)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Informati‐<br />
ons‐und Kommunikationsdienste<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Selbstme‐<br />
dikation im Bereich <strong>der</strong> pharmazeuti‐<br />
C66<br />
C66<br />
C67<br />
C67<br />
C68<br />
C69<br />
C70<br />
C73<br />
CI
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 1997 (Auftraggeben<strong>der</strong> Minister: Horst Seehofer, CSU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
schen Industrie<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Integration<br />
geriatrischer Rehabilitation und <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung<br />
Zunehmende, allerdings einge‐<br />
schränkte Bedeutung <strong>der</strong> Professio‐<br />
nalisierung <strong>der</strong> Pflegeberufe beson‐<br />
<strong>der</strong>s im Rahmen <strong>der</strong> Qualitätsdebat‐<br />
ten <strong>der</strong> Altenpflege<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Globa‐<br />
lisierung wirtschaftlicher Beziehun‐<br />
gen u. Individualisierungsprozesse,<br />
die strukturelle und wertew<strong>an</strong>delnde<br />
Än<strong>der</strong>ungen bedingen<br />
Zunehmende Bedeutung neuer Beru‐<br />
fe und Tätigkeitsfel<strong>der</strong> im Bereich<br />
mit älteren Menschen<br />
Zunehmende Bedarf pflegerischer<br />
Leistungen im ambul<strong>an</strong>ten und teil‐<br />
stationären Bereich wird nicht direkt<br />
proportionalmit einer Zunahme <strong>der</strong><br />
Beschäftigungszahlen in diesem<br />
Bereich einhergehen<br />
Zunehmende Bedeutung bezugspfle‐<br />
gerischer Erkenntnisse beson<strong>der</strong>s in<br />
<strong>der</strong> Altenpflege<br />
Steigende Ansprüche <strong>an</strong> eine men‐<br />
schen‐ und altersgerechte Versor‐<br />
gung (Enthospitalisierung) u. Rück‐<br />
g<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Laienpflegekapazitäten<br />
D68<br />
D76<br />
D76<br />
D66<br />
D66<br />
D65<br />
CII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 2000 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
SVR-Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 2000 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Keine Differenziertes Gesundheitsför<strong>der</strong>ndes und Prä‐<br />
ventionsverständnis. Zunehmende Bedeutung<br />
(„aber noch nicht für die Praxis belastbar“)<br />
salutogenetischer Theorie<strong>an</strong>sätze (A. Antonovsky),<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Prävention<br />
B83<br />
Zunehmende Bedeutung gesundheitspolitischer<br />
Kriterien (Inzidenz/Prävalenz, Kr<strong>an</strong>kheitsschwere,<br />
direkte/indirekte Kosten, Wirksamkeit, Wirksam‐<br />
keits‐Kosten‐Relev<strong>an</strong>z) <strong>der</strong> Prävention<br />
B84<br />
Zunehmende Bedeutung regionaler Präventions<strong>an</strong>‐<br />
gebote und Zielgruppenorientierung (territorial,<br />
sozial, Alter, Risikomerkmale und ‐level sowie Set‐<br />
ting)<br />
B85<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> „Setting‐Orientierung“ B86<br />
Zunehmende Bedeutung des Präventionspotentials<br />
bei älteren Menschen unter Einbezug des gesamten<br />
Alterungsprozesses (Stichwort Normal Aging) und<br />
nicht ausschließlich im Hinblick auf Kr<strong>an</strong>kheitsver‐<br />
hin<strong>der</strong>ung<br />
B89<br />
Zunehmende Bedeutung des geriatrischen<br />
Assessments, vor allem im Bereich hausärztlicher<br />
Versorgung<br />
B91<br />
Abnehmen<strong>der</strong> Kundenged<strong>an</strong>ke für den Nutzer bei<br />
zunehmen<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheitsschwere o<strong>der</strong> Pflegebe‐<br />
dürftigkeit<br />
B92<br />
M<strong>an</strong>gelnde Zielorientierung als Kosten‐<br />
ursache. Zunehmende Bedeutung von<br />
Kostendebatten wegen m<strong>an</strong>geln<strong>der</strong><br />
Zielorientierung im Gesundheitswesen<br />
C81<br />
CIII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 2000 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung des Präventi‐<br />
onspotentials als Einsparpotential (25‐<br />
30% <strong>der</strong> Gesamtausgaben könnten re‐<br />
duziert werden)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Politik im<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Zuschreibung<br />
<strong>der</strong> Rolle <strong>der</strong> Kassen bei <strong>der</strong> Prävention<br />
Partizipation für Nutzer und Betroffe‐<br />
nen<br />
Zunehmende Bedeutung von Betroffe‐<br />
nen beim Einbezug in Gremien wie Aus‐<br />
schüsse, Institutionen o<strong>der</strong> dem MDK<br />
Verteilungsgerechtigkeit und<br />
Gesundheitsbezogene Lebenslage.<br />
Zunehmende Bedeutung von Vertei‐<br />
lungsaspekten und Ungleichheit von<br />
Gesundheitsch<strong>an</strong>cen sowie dem<br />
Zielbereich <strong>der</strong> Lebensqualität<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Lebens‐<br />
lage unter Einbezug von Bildungs‐<br />
grad, Biografie und sozialer Schicht<br />
Gesamtgesellschaftliche Bedeutung<br />
von Selbstver<strong>an</strong>twortung und Al‐<br />
tersleitbil<strong>der</strong>n und Partizipation.<br />
Zunehmende Bedeutung einer Insze‐<br />
nierung eines gesamtgesellschaftli‐<br />
chen Diskussionsprozesses unter<br />
Einbezug <strong>der</strong> Öffentlichkeit im Zu‐<br />
sammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Eigenver<strong>an</strong>t‐<br />
wortung für Prävention<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Insze‐<br />
nierung eines gesellschaftlichen und<br />
professionellen Leitbilds vom „er‐<br />
C83<br />
C87<br />
C93<br />
D82<br />
D90<br />
D88<br />
D89<br />
CIV
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d I (SVR), 2000 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
folgreichen Altern“<br />
Zunehmende Bedeutung von Teilha‐<br />
be und <strong>der</strong>en Nutzung sowie Mit‐<br />
sprache unter Einbezug von Heim‐<br />
beiräten, Patientenvertretern<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verla‐<br />
gerung von Gesundheitsleistungen in<br />
den Selbstbeh<strong>an</strong>dlungsbereich (fami‐<br />
liäre Pflege, Selbstbeh<strong>an</strong>dlung bei<br />
leichten Erkr<strong>an</strong>kungen)<br />
Berücksichtigung vulnerabler Ziel‐<br />
gruppen<br />
Zunehmende Bedeutung vulnerabler<br />
Zielgruppen im Hinblick auf Ausge‐<br />
staltung von Zug<strong>an</strong>gswegen und<br />
Interventionstypen<br />
‐ Zunehmen<strong>der</strong> Forschungsbedarf im<br />
Hinblick auf methodische Zugänge,<br />
um Verhaltensverän<strong>der</strong>ungen bei<br />
älteren Menschen hervor zu rufen.<br />
<strong>Die</strong>s unter Einbezug <strong>der</strong> spezifisch‐<br />
genutzten Settings und<br />
Gesellungsformen<br />
D93<br />
D94<br />
D89<br />
D90<br />
CV
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 2001 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Keine Neuer Ausbildungsbedarf in <strong>der</strong> Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung von Ausbildungsin‐<br />
halten <strong>der</strong> Pflegeberufe (in <strong>der</strong> Erstausbil‐<br />
dung) hinsichtlich Rehabilitation, Prävention,<br />
Angehörigenberatung und <strong>der</strong> Technik‐ bzw.<br />
Technikentwicklung<br />
B98<br />
Individualisieren<strong>der</strong>, kompetenzübergrei‐<br />
fen<strong>der</strong> wissenschaftlicher Ausbildungsbedarf<br />
Zunehmende Bedeutung einer Ausbildungsre‐<br />
form von h<strong>an</strong>dwerklich‐technischen Orientie‐<br />
rungen hin zu individualisieren<strong>der</strong>, wissen‐<br />
schaftlich‐ begründeter Bezugspflege<br />
B98<br />
Gezielte Pflegepersonaldatenerhebungen<br />
Zunehmende Bedeutung einer Pflegebericht‐<br />
erstattung, Pflegedichteziffern und evidenz‐<br />
basierter Pl<strong>an</strong>ung von Ausbildungskapazitäten<br />
zur Vermeidung von Engpässen<br />
B98<br />
Wachstums‐ und Kompensationsmecha‐<br />
nismen des Pflegesektors. Zunehmende<br />
Bedeutung des Pflegebereichs als Zukunfts‐<br />
und Wachstumsbr<strong>an</strong>che, jedoch keine grö‐<br />
ßere Nachfrage am Arbeitsmarkt trotz be‐<br />
gründeter Zunahme eines erhöhten Bedarfs<br />
(Kompensationsmech<strong>an</strong>ismus, Anm. MB)<br />
C96<br />
CVI
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 2001 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Ausbildungsfin<strong>an</strong>zie‐<br />
C97<br />
rung<br />
Rückzugswunsch <strong>der</strong> GKV aus <strong>der</strong> Ausbil‐<br />
dungsfin<strong>an</strong>zierung, daher für die Träger<br />
zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Personalrekru‐<br />
tierung<br />
Angleichungsprozesse von Alten‐ und<br />
C98<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege auf dem Arbeitsmarkt und<br />
im Berufsfeld<br />
Zunehmende Bedeutung einer Überwin‐<br />
dung <strong>der</strong> Grenzen zwischen Alten‐ und<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege aufgrund einer zunehmen‐<br />
den gegenseitigen Ersetzbarkeit auf dem<br />
Arbeitsmarkt<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Zusammen‐<br />
C98<br />
führung von Alten‐ und Kr<strong>an</strong>kenpflege und<br />
Integration ins tertiäre Bildungssystem, um<br />
Karrierech<strong>an</strong>cen zu erhöhen, Bildungs‐<br />
durchlässigkeit zu produzieren und Normali‐<br />
tät in <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierung zu erreichen<br />
Mobilität <strong>der</strong> Beschäftigten. Zunehmende<br />
C98<br />
Bedeutung einer europaweiten Fachkraft‐<br />
mobilität<br />
Professionsentwicklung als qualitätssi‐<br />
C99<br />
chernde Strategie. Zunehmende Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Professionsentwicklung im Zusammen‐<br />
h<strong>an</strong>g mit Qualitätsentwicklung<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Etablierung<br />
C99<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
Zunehmende Bedeutung einer Qualitätssi‐<br />
C99<br />
cherung für die Pflegeberufe<br />
Zunehmende Bedeutung von qualitätsbezo‐ C99<br />
CVII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 2001 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
genen Regelungen zu Vorbehaltsaufgaben<br />
Zunehmende Bedeutung einer berufsgrup‐<br />
penübergreifenden Qualitätssicherung<br />
(§137b, SGB V) und Novellierung <strong>der</strong> Quali‐<br />
tätssicherung <strong>der</strong> Pflege nach SGB XI<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> individuellen<br />
Patientendimension (Patientenzufrieden‐<br />
heit) bei Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Angehörigenperspektive und <strong>der</strong> pflegen‐<br />
den Angehörigen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ablösung <strong>der</strong><br />
Funktionspflege durch die Bezugspflege<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> originär pfle‐<br />
gerischen Qualitätssicherung, um perspekti‐<br />
visch zum Selbstverständnis je<strong>der</strong> Pflegein‐<br />
richtung zu werden, externe Prüfungen<br />
können diesen Prozess nur begleiten<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnisquali‐<br />
tät. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnis‐<br />
qualität pflegespezifischer Parameter<br />
Zunehmende Bedeutung einer Mehrbelas‐<br />
tung ambul<strong>an</strong>ter, stationärer, ärztlicher und<br />
pflegerischer Nachsorgestrukturen wegen<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Verweildauer durch AR‐DRG’s<br />
Professionalisierung wegen/durch<br />
W<strong>an</strong>dlungsprozesse.<br />
Zunehmende Bedeutung eines Profes‐<br />
sionalisierungsprozesses in Medizin<br />
und Pflege durch revolutionierende<br />
Innovationen, abnehmende Halb‐<br />
C100<br />
C101<br />
C101<br />
C101<br />
C101<br />
C101<br />
C102<br />
D95<br />
CVIII
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 2001 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
wertszeit von Wissen, verän<strong>der</strong>te<br />
Kontexte und sich w<strong>an</strong>delnde Versor‐<br />
gungsstrukturen sowie einer verän<strong>der</strong>‐<br />
ten auf Partizipation ausgerichteten<br />
Patientenrolle<br />
Zunehmende Bedeutung einer st<strong>an</strong>‐<br />
dardisierten berufsbegleitenden Siche‐<br />
rung von aktuell erfor<strong>der</strong>lichen Quali‐<br />
fikationen zugunsten <strong>der</strong> Wissensver‐<br />
mittlung durch Institutionen o<strong>der</strong><br />
Vereinigungen<br />
Zunehmende Bedeutung von Informa‐<br />
tions‐ Kommunikationsplattformen<br />
wegen besserer Nutzerorientierung (z.<br />
B. Internetplattformen)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> De‐ Pro‐<br />
fessionalisierung in den Gesundheits‐<br />
berufen<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> qualifizierten Mitarbei‐<br />
terzahlen in <strong>der</strong> Altenpflege 1996‐<br />
1999, Versechsfachung in ambul<strong>an</strong>ter<br />
u. stationärer Altenpflege<br />
Zunehmende Bedeutung von Teilquali‐<br />
fikation durch das PflVersG, Verdrän‐<br />
gung von Pflegekräften<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Prob‐<br />
lembereiche <strong>der</strong> Pflegebildungssitua‐<br />
tion. Unzureichende Durchlässigkeit<br />
<strong>der</strong> Pflegbildungsstrukturen, Son<strong>der</strong>‐<br />
stellung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenpflegeausbildung<br />
im Berufsbildungssystem, überholte<br />
Ausbildungsinhalte, unzureichende<br />
D95<br />
D101<br />
D97<br />
D97<br />
D97<br />
D97<br />
CIX
SVR–Son<strong>der</strong>gutachten B<strong>an</strong>d II (SVR), 2001 (Auftraggebende Ministerin: Andrea Fischer, Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
qualifizierte Dozenten und die Tren‐<br />
nung gesundheits‐ und sozialpflegri‐<br />
scher Berufsausbildung<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> akademi‐<br />
schen Qualifizierung, Nachwuchsför‐<br />
<strong>der</strong>ung, pflegequalifizieren<strong>der</strong> Studi‐<br />
engänge <strong>an</strong> FH’s und Universitäten,<br />
infrastrukturelle Bedingungen für die<br />
Wissenschaftsentwicklung, nationale<br />
und internationale Forschungsverbün‐<br />
de<br />
Zunehmende Bedeutung des Über‐<br />
g<strong>an</strong>gs <strong>der</strong> Pflege von einem traditio‐<br />
nellem Helferberuf in eine mo<strong>der</strong>ne<br />
Gesundheitsprofession<br />
D98<br />
D99<br />
CX
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte, CDU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökon. Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
L<strong>an</strong>gfristige Zukunftstrends <strong>der</strong> Bevölkerungsent‐<br />
wicklung:<br />
Niedrige Geburtenrate, steigende durchschnittliche<br />
Lebenserwartung und zunehmen<strong>der</strong> Anteil älterer<br />
Menschen, stagnieren<strong>der</strong> und zukünftig abnehmen‐<br />
<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> mittleren Generation zwischen 20 und<br />
60 Jahren und sinken<strong>der</strong> Anteil Kin<strong>der</strong> und Jugendli‐<br />
cher<br />
Keine A109<br />
Verän<strong>der</strong>ung innerhalb <strong>der</strong> Alterskohorten<br />
Zunahme <strong>der</strong> Älteren (65+) um 7 Mio Menschen (s.<br />
A111 und A112), Rückg<strong>an</strong>g bei den Jüngeren (‐65)<br />
um 17 Mio (!!!)<br />
A119<br />
Größte Verän<strong>der</strong>ung bei den 16‐40 –Jährigen um<br />
rund 10 Mio Menschen (jüngere Erwerbstätige) bei<br />
den Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen liegt sie in absoluten<br />
Zahlen bei rund 5 Mio. 40‐65‐jähriger Anteil verän‐<br />
<strong>der</strong>t sich kaum (Abnahme um 1,6 Mio)<br />
A119<br />
Zunahme <strong>der</strong> Altersgruppe (50‐80‐Jährige) auf 28,9<br />
Mio (2010). Zuwachs um 17% gegenüber 1993<br />
A116<br />
Alter und Migration. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Bevölkerungsbewegung (Binnenverteilung und nach<br />
Außen die Bevölkerungsbil<strong>an</strong>z beeinflussend)<br />
A109<br />
CXI
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte, CDU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökon. Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.-Nr.<br />
Keine Feminisierung des Alters bei den ausländi‐<br />
schen Mitbürgern, Anteil <strong>der</strong> älteren Auslän<strong>der</strong> und<br />
Auslän<strong>der</strong>innen macht im Jahr 2010 6,4% <strong>der</strong> über<br />
60‐jährigen aus (1,3 Mio)<br />
Alter und Gen<strong>der</strong>. Lebenswartung <strong>der</strong> Frauen<br />
nimmt zu, dadurch zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Geschlechterproportion<br />
Soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Proble‐<br />
me des Alters und Probleme des Kontextes (Woh‐<br />
nen) sind zunehmend Frauenprobleme<br />
Anteil <strong>der</strong> 60‐jährigen und älteren Frauen nimmt<br />
einen zukünftigen Anteil von 38% <strong>an</strong> <strong>der</strong> weiblichen<br />
Bevölkerung ein, <strong>der</strong> männliche Anteil wird mit<br />
voraussichtlich 32% bis ins Jahr 2040 niedriger aus‐<br />
fallen<br />
Zunahme <strong>der</strong> Hochaltrigkeit. Zunehmende Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> Hochaltrigkeit, größerer Frauenüberschuss<br />
als bei den Älteren insgesamt<br />
Zunahme <strong>der</strong> Hochaltrigen bis ins Jahr 2040 auf 5,3<br />
Mio<br />
Anwachsen <strong>der</strong> hochaltrigen Bevölkerung von 3,3<br />
Mio (1993) auf 4,1 Mio (2010)<br />
Zunehmende Bedeutung des Altersquotienten (Ver‐<br />
dopplung)<br />
Steigende Lebenserwartung. Zunehmende Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> steigenden Lebenserwartung, die bei Frau‐<br />
en mit 7 Jahren höher als die <strong>der</strong> Männer liegt<br />
(St<strong>an</strong>d 1994)<br />
Anstieg <strong>der</strong> Lebenserwartung bei Frauen (2010) auf<br />
81 Jahre, bei Männern auf fast 75<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Lebenserwartung im<br />
Osten damit Verringerung <strong>der</strong> Differenz zu West‐<br />
A110<br />
A109<br />
A109<br />
A109<br />
A111<br />
A117<br />
A112<br />
A113<br />
A114<br />
A115<br />
A115<br />
CXII
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte, CDU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökon. Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.-Nr.<br />
deutschl<strong>an</strong>d<br />
Multimorbidität, chronische Erkr<strong>an</strong>‐<br />
kungen und sensorische Einbu‐<br />
ßen.Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Mul‐<br />
timorbidität, chronischer Art, zuneh‐<br />
mende Bedeutung degenerativer und<br />
entzündlicher Gelenkerkr<strong>an</strong>kungen und<br />
sensorischer Einbußen, Höreinbußen<br />
dominieren vor Seheinbußen<br />
Prävalenz <strong>der</strong> Demenz. Zunehmende<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Prävalenz <strong>der</strong> schweren<br />
und mäßig schweren Demenz im Zu‐<br />
sammenh<strong>an</strong>g mit Pflegebedürftigkeit.<br />
Rund 50 % <strong>der</strong> Pflegbedürftigen leiden<br />
<strong>an</strong> Demenz!<br />
Dementieller Belastungsdiskurs. Zu‐<br />
nehmende Bedeutung <strong>der</strong> Belastungs‐<br />
thematik für Angehörige im Zusammen‐<br />
h<strong>an</strong>g mit Demenz (aufgrund Persönlich‐<br />
keitsverän<strong>der</strong>ung, abnehmende Mög‐<br />
lichkeit <strong>der</strong> Kommunikation, Angst vor<br />
Affektausbrüchen und zunehmen<strong>der</strong><br />
Isolation)<br />
Zunehmende Bedeutung des Entlas‐<br />
tungsbedarfs <strong>der</strong> pflegenden Angehöri‐<br />
gen und <strong>der</strong> Pflegenden im Heim<br />
Aktivierungsparadigma. Zunehmende<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Aktivierung im Zusam‐<br />
menh<strong>an</strong>g mit rehabilitativer Pflege<br />
Kontext‐ und Umweltgestaltung. Zu‐<br />
nehmende Bedeutung nicht‐<br />
segregativer Ansätze<br />
B103<br />
B104<br />
B104<br />
B104<br />
B105<br />
B105<br />
CXIII
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte, CDU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökon. Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.-Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Wohn‐<br />
raumgestaltung im Rahmen von<br />
Barrierefreiheit und Prothetik, ausrei‐<br />
chen<strong>der</strong> Bewegungsmöglichkeit, Anre‐<br />
gungsgehalt <strong>der</strong> Umwelt, Beachtung <strong>der</strong><br />
Relation von Privatheit und Gemein‐<br />
schaftlichkeit, Zunehmende Bedeutung<br />
von Farben und Licht „Fenster zur Welt“,<br />
<strong>der</strong> Auswahl von Gegenständen zur<br />
Stimulation von Sinnesorg<strong>an</strong>en, H<strong>an</strong>d‐<br />
lungsabläufen und Tätigkeitsmuster<br />
Netzwerkarbeit. Zunehmende Bedeu‐<br />
tung von Hilfsnetzwerken und professi‐<br />
oneller Unterstützung im Zusammen‐<br />
h<strong>an</strong>g mit ausgeprägter Pflegebedürftig‐<br />
keit<br />
Mehrgenerationenarbeit. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung von Mehrgene‐<br />
rationenprojekten (Mehrgen.‐<br />
Bildung, Mehrgen.‐ Arbeit,<br />
Mehrgen.‐ Wohnen)<br />
Kopplung sozialer und räumlicher<br />
Netzwerke<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Er‐<br />
reichbarkeit von Hilfeleistungen,<br />
<strong>der</strong> privaten Netzwerke, das Bild<br />
des sozialen Netzwerkes muss mit<br />
dem räumlichen Netzwerk gekop‐<br />
pelt werden<br />
Mythos <strong>der</strong> „Individualisierungs‐<br />
theorie“ we<strong>der</strong> bei Jung noch Alt<br />
bestätigt<br />
B105<br />
B108<br />
D107<br />
D108<br />
D108<br />
CXIV
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte, CDU)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ökon. Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.-Nr.<br />
Wohnformen, Settings und Unter‐<br />
stützungsbedarf. Zunehmende<br />
Bedeutung des Bedarfs <strong>an</strong> beson‐<br />
<strong>der</strong>en Wohnformen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
selbstständigen Wohnformen <strong>der</strong><br />
jüngeren Alten, entsprechend vo‐<br />
rausschauende Konzeption <strong>der</strong><br />
Beschaffenheit <strong>der</strong> Wohnform im<br />
Hinblick auf zukünftige Pflegebe‐<br />
dürftigkeit<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Wohnformen mit umfassen<strong>der</strong><br />
Hilfestellung, die <strong>der</strong> Vereinsamung<br />
entgegenwirken und auf Selbstbe‐<br />
stimmung statt Selbstständigkeit<br />
setzen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Wohnformen, die geringen Hilfe‐<br />
bedarf umfassen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> ent‐<br />
sprechenden Bedarfsorientierung<br />
sowohl bei Heimen als auch bei<br />
betreuten Wohnformen<br />
D117<br />
D118<br />
D120<br />
D120<br />
D120<br />
CXV
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter, Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission 1998 (Auftraggebende Ministerin:<br />
Claudia Nolte, CDU)<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
keine Wohnen als gesundheitsunterstützende<br />
Rahmenbedingung. Zunehmende Bedeu‐<br />
tung des Wohnens als zentrale Bedingung<br />
für die Erhaltung <strong>der</strong> Selbstständigkeit<br />
und Gesundheit<br />
B121<br />
Zunehmende Bedeutung von Stimulati‐<br />
onsbedingungen in <strong>der</strong> Wohnumgebung<br />
in Abstimmung zu Wohn‐, Rehabilitations‐<br />
und Pflegekonzepten<br />
B122<br />
Betreutes Wohnen wird zunehmend<br />
bedeuten<strong>der</strong>. Zunehmende Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Weiterentwicklung des „Betreuten<br />
Wohnens“ und Maßnahmen <strong>der</strong> Quali‐<br />
tätssicherung, Preis‐ und Vertragstr<strong>an</strong>spa‐<br />
renz, Raumst<strong>an</strong>dards und Betreuungsqua‐<br />
lität<br />
C124<br />
CXVI
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter, Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte,<br />
CDU<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Wohngröße<br />
und <strong>der</strong> Wohnraumgestaltung. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung <strong>der</strong> Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Wohngestaltung bei L<strong>an</strong>gzeitbewoh‐<br />
nern und Pflegebedürftigen mit besonde‐<br />
ren Bel<strong>an</strong>gen wie dementen und psy‐<br />
chisch kr<strong>an</strong>ken Bewohnern<br />
Zunehmende Bedeutung des Wohnens in<br />
Heimen im Sinne eines Wohnens mit Pfle‐<br />
ge mit geringeren Platzzahlen (Max. 60‐90<br />
Bewohner) nach dem Kleeblattmodell<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Größe von<br />
Wohnbereichen in Heimen (ca. 30 Perso‐<br />
nen) in aufgeteilten Gruppen (2‐3) mit<br />
jeweils max. 15 Bewohnern<br />
Gesamtgesellschaftliche Bedeutungen im<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit dem Alter(n). Zuneh‐<br />
mende Bedeutung von Selbstständigkeit,<br />
Selbstver<strong>an</strong>twortung und sozialer Bezogen‐<br />
heit in einem Leitbild des Älterwerdens und<br />
des Alters<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verschieden‐<br />
artigkeit von Lebensbedingungen und Le‐<br />
bensformen im Alter<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Diskussion<br />
über die Bedeutung <strong>der</strong> Pflege des Hum<strong>an</strong>‐<br />
vermögens für die Überlebensfähigkeit <strong>der</strong><br />
Kultur <strong>der</strong> Gesellschaft bei steigen<strong>der</strong> Ver‐<br />
<strong>an</strong>twortung <strong>der</strong> Älteren für die Zukunft <strong>der</strong><br />
Gesellschaft<br />
Zunehmende Bedeutung eines Umdenkens<br />
und einer Neubestimmung von Son<strong>der</strong>for‐<br />
C125<br />
C125<br />
C125<br />
D121<br />
D121<br />
D122<br />
D123<br />
CXVII
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter, Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission 1998 (Auftraggebende Ministerin: Claudia Nolte,<br />
CDU<br />
Dem. Befunde Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
men hin zum normalen Wohnen<br />
Zunehmende Bedeutung des Hilfeleistungs‐<br />
potentials und <strong>der</strong> Einsicht, dass das <strong>Die</strong>nen<br />
in <strong>der</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft ebenfalls<br />
zu den Schlüsselkompetenzen gehört<br />
Zunehmende Bedeutung von Infrastruktur‐<br />
konzepten zur Unterstützung von Hilfeleis‐<br />
tungen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Vereinbarkeit<br />
von Pflege‐ und Erwerbsfähigkeit<br />
Alter und Migrationsressourcen.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Berücksichti‐<br />
gung innerethnischer Potentiale für<br />
gemeinwesenorientierte und generationen‐<br />
übergreifende H<strong>an</strong>dlungskonzepte<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Berücksichti‐<br />
gung spezifischer kultureller Hintergründe<br />
älterer Migr<strong>an</strong>ten in stationären Altenhilfe‐<br />
einrichtungen<br />
D126<br />
D126<br />
D126<br />
D127<br />
D128<br />
CXVIII
2. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Wohnen im Alter, Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission 1998, (Auftraggebende Ministerin:<br />
Claudia Nolte, CDU), Stellungnahme <strong>der</strong> Bundesregierung (ergänzend)<br />
Demografische Befunde Epidemiologische Befunde Ök. Bef. Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunahme <strong>der</strong> älteren Bevölke‐<br />
rung bis ins Jahr 2030 insg. von<br />
16.9 Mio auf 26,4 Mio und <strong>an</strong>‐<br />
teilsmäßig <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtbevöl‐<br />
kerung von rund 20 % auf 36 %<br />
keine A129<br />
Zunahme <strong>der</strong> hilfs‐ und pflegebedürftigen<br />
Älteren, die häuslich versorgt werden von<br />
1,24 Mio auf 1,60 Mio (Prognose 2030)<br />
B129<br />
Zunahme alleinstehen<strong>der</strong> Älterer von 7,8 auf 13,2 Mio<br />
(2030). Zunahme kin<strong>der</strong>loser Frauen und Männer, da‐<br />
durch Abnahme des Hilfepotentials, zunehmende Be‐<br />
deutung erweiterter sozialer Netzwerke, Bedeutung <strong>der</strong><br />
Familie wird wichtigstes Fundament für ein hum<strong>an</strong>es<br />
Zusammenleben bleiben, zunehmende Bedeutung ver‐<br />
besserter fin<strong>an</strong>zieller Möglichkeiten <strong>der</strong> älteren Bevöl‐<br />
kerung; zunehmende Bedeutung des Zusammenlebens<br />
<strong>der</strong> Generationen in räumlicher Nähe, ohne die Eigen‐<br />
ständigkeit aufzugeben<br />
D129<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> sozialen Netzwerken und<br />
<strong>der</strong> Erreichbarkeit <strong>der</strong> Menschen unterein<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
D130<br />
CXIX
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
keine Zunahme <strong>der</strong> Pflegebedürftigen in den nächsten<br />
B131<br />
zwei Jahrzehnten: von 2,04 (2010) – laut BGM 2,14<br />
(2010) auf 2,3‐2,5 Mio (2030) – laut BGM 2,16‐2,57<br />
Mio (2030) und weiter auf 2,26‐2,79 Mio (2040)<br />
B136<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung des Rehabilitationspotenti‐<br />
als älterer Menschen<br />
B131<br />
Zunahme <strong>der</strong> Häufigkeit schwerer und mäßig schwe‐<br />
rer Demenzen<br />
B131<br />
Dringlicher Abbau des diagnostischen und therapeu‐<br />
tischen Nihilismus für gerontopsychiatrische Betrof‐<br />
fene<br />
B131<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung von Rehabilitations<strong>an</strong>gebo‐<br />
ten für Demenzkr<strong>an</strong>ke unter aktivierenden Gesichts‐<br />
punkten<br />
B131<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung aktivieren<strong>der</strong> Pflege B131<br />
Zunehmende Bedeutung eines Dilemmas hinsichtlich<br />
eines epidemiologischen Blicks (Altsein = Kr<strong>an</strong>ksein)<br />
B132<br />
Zunehmende Bedeutung eines differenzierten Al‐<br />
tersbildes: These, dass zunehmendes Alter mit zu‐<br />
nehmen<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheit einhergeht, muss entgegen‐<br />
gewirkt werden<br />
B133<br />
CXX
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung gerontologischer und geri‐<br />
atrischer Expertise in <strong>der</strong> Medizin (Eigenständigkeit<br />
<strong>der</strong> Geriatrie, dringen<strong>der</strong> Bedarf <strong>an</strong> Aus‐, Fort‐ und<br />
Weiterbildung)<br />
Zunehmende Bedeutung pflegeepidemiologischer<br />
Erkenntnisse unter systematisch‐zielgerichteten<br />
Analysekriterien, um qualitativen Pflegebedarf zu<br />
dokumentieren<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Reform des Pflegebe‐<br />
dürftigkeitsbegriffs<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Pfle‐<br />
gebedarfe aus <strong>der</strong> Patienten‐ und Pflegebedürftigen‐<br />
Perspektive<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Lebenserwartung in<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit Pflegebedürftigkeit<br />
Zunehmende Bedeutung eines verbesserten<br />
Gesundheitszust<strong>an</strong>ds im Alter in <strong>der</strong> Kohortenfolge,<br />
Rückg<strong>an</strong>g (Zurückdrängen, Verzögern) bestimmter<br />
Altersgebrechen durch weiteren medizinischen Fort‐<br />
schritt<br />
Zunehmende Bedeutung gesundheitlicher Präventi‐<br />
on und Rehabilitation für Ältere<br />
Zunehmende Bedeutung einer Reform <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isa‐<br />
tionsformen, die die Sektoren Prävention, Kuration<br />
und Rehabilitation gleichstellen bzw. mitein<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
verknüpfen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> multifaktoriellen Diag‐<br />
nostik von Risikofaktoren und Intervention zur Re‐<br />
B134<br />
B135<br />
B135<br />
B135<br />
B136<br />
B136<br />
B136<br />
B136<br />
B138<br />
CXXI
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
duktion von Stürzen im Alter<br />
Zunehmende Bedeutung eines differenzierten<br />
B138<br />
Sturzassessments (u. a. Bal<strong>an</strong>ce, häusliches Umfeld,<br />
Hören und Sehen sowie Stehsicherheit)<br />
Zunehmende Bedeutung altersspezifischer Fehl‐ und<br />
B138<br />
Übermedikamentierung im Hinblick auf die Sturzge‐<br />
fahr<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Prävention <strong>der</strong> Osteo‐<br />
B138<br />
porose im Hinblick auf Schenkelhalsfrakturen und<br />
Stürzen<br />
Zunehmende Bedeutung des präventiven Hausbe‐<br />
B138<br />
suchs, hierbei kommt <strong>der</strong> Rolle des Arztes die Be‐<br />
deutung eines Case‐M<strong>an</strong>agers zu<br />
Zunehmende Bedeutung kompetenzerhalten<strong>der</strong><br />
B139<br />
o<strong>der</strong> ‐för<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Interventionen für Menschen mit<br />
Behin<strong>der</strong>ung<br />
Zunehmende Bedeutung „unorthodoxer“ Verfahren<br />
B140<br />
zur Schaffung von beson<strong>der</strong>s gestalteten Räumen<br />
mit einer Vielzahl sensorischer Anregungen (Snoezel‐<br />
Räume) sowie humororientierte und tiergestützten<br />
Interventionen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Erfolgskontrolle außer‐<br />
B141<br />
halb kontrollierter Studien zur Erfassung des Wohl‐<br />
befindens von psychisch‐kr<strong>an</strong>ken Menschen, um so<br />
die Wirkung bestimmter Interventionen zu beschrei‐<br />
ben (als Bsp. Dementia Care Mapping nach Tom<br />
Kitwood)<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> B143<br />
CXXII
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Pflege von <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheits‐ zur Gesundheitsorientie‐<br />
rung beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege, die zu‐<br />
nehmend als internationaler Trend <strong>an</strong> Bedeutung<br />
gewinnt<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> spezialisierten pflegeri‐<br />
schen Kompetenzen, was in <strong>der</strong> Ausbildung in <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten Pflege nicht berücksichtigt wird (we<strong>der</strong><br />
akademisch noch setting‐spezifisch) als Anmerkung<br />
und Kritik <strong>an</strong> den bestehenden Pflegereformen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Zielgruppe <strong>der</strong> psy‐<br />
chisch kr<strong>an</strong>ken Menschen insbeson<strong>der</strong>e die Bedeu‐<br />
tung eines eigenen Zimmers<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> generalisierten Ausbil‐<br />
dungsversuche<br />
B150<br />
B161<br />
B163<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> ökonomischen<br />
C132<br />
Perspektive im politischen Diskurs<br />
Zunehmende Bedeutung von Präventionseffek‐<br />
C138<br />
ten im Hinblick auf Kosteneinsparungen<br />
Zunehmende Bedeutung von Bedarfsgesichts‐<br />
C144<br />
punkten von Pflegeleistungen unter pflegewis‐<br />
senschaftlichen Relev<strong>an</strong>zkriterien (und weniger<br />
durch sozialrechtlichen Gesichtspunkten) in <strong>der</strong><br />
ambul<strong>an</strong>ten Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung eines Ausbaus und <strong>der</strong><br />
C145<br />
Weiterentwicklung ambul<strong>an</strong>ter Pflege, um<br />
Unterversorgungserscheinungen, Drehtüreffekte<br />
o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>einweisungen zu verhin<strong>der</strong>n<br />
Zunehmende Bedeutung einer kritischen Reform C145<br />
CXXIII
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
<strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierungsgrundlage ambul<strong>an</strong>ter Pflege<br />
auf pflegewissenschaftlicher Basis<br />
Entwicklungstrends in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege.<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Betriebsgründungen, zunehmen<strong>der</strong><br />
Verdrängungswettbewerb zulasten kleinerer<br />
Anbieter, zunehmende Bedeutung privatrechtli‐<br />
cher Einrichtungen (mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Pfle‐<br />
ge<strong>an</strong>bieter)<br />
Zunehmende Bedeutung einer aussagekräftigen<br />
Personalst<strong>an</strong>ds‐ Datenerhebung und Dokumen‐<br />
tation<br />
Zunehmende Bedeutung eines <strong>an</strong> <strong>der</strong> Bedarfsla‐<br />
ge potentieller Nutzer orientierten pflegerischen<br />
Leistungsprofils<br />
Zunehmende Bedeutung einer Umgestaltung von<br />
Anreizstrukturen und Rahmenbedingungen, die<br />
Gesundheits‐ statt Kr<strong>an</strong>kheitsorientierung unter‐<br />
stützen<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Gesundheits‐ und<br />
sozialen Potentiale älterer Menschen für den<br />
Einbezug in den Versorgungsalltag<br />
Zunehmende Bedeutung einer Erweiterung eng<br />
gesteckter Grenzen pflegerischen H<strong>an</strong>delns von<br />
<strong>der</strong> h<strong>an</strong>dwerklich und körperorientierten Pflege<br />
hin zu vermehrt kommunikativen und edukativen<br />
Angeboten<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Schulung und Bera‐<br />
tung des Pflegebedürftigen, präventive und reha‐<br />
bilitative Angebote und Aufgaben des „Carings“<br />
C145<br />
C146<br />
C147<br />
C148<br />
C148<br />
C149<br />
C149<br />
CXXIV
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Sicherstellung von<br />
Versorgungsgestaltung, Sicherung von Versor‐<br />
gungsintegration und ‐kontinuität<br />
Zunehmende Bedeutung einer Ausweitung des<br />
Aufgabenspektrums und ‐zuschnitts und <strong>der</strong><br />
Kompetenzgrenzen von Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung des<br />
Leistungsprofils und einer qualitativen Ausdiffe‐<br />
renzierung des Leistungs<strong>an</strong>gebots ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung von Modellversuchen<br />
zur Umstrukturierung <strong>der</strong> Aufgabengebiete am‐<br />
bul<strong>an</strong>ter Pflege und <strong>der</strong>en Umsetzung in klare<br />
Arbeitskonzepte<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong><br />
Kooperation und professionsübergreifen<strong>der</strong><br />
Zusammenarbeit<br />
Zunehmende Bedeutung einer Anpassung <strong>der</strong><br />
Sozialversicherungssysteme <strong>an</strong> die gew<strong>an</strong>delten<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen im ambul<strong>an</strong>ten Bereich<br />
Zunehmende Bedeutung einer Entsp<strong>an</strong>nung <strong>der</strong><br />
Arbeitssituation in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege wegen<br />
hoher Mitarbeiterfluktuation und zunehmen<strong>der</strong><br />
Bedeutung ökonomischer Erwägungen vor pro‐<br />
fessionellen Qualitätserwägungen<br />
Zunehmende Bedeutung von Erprobungsmög‐<br />
lichkeiten verschiedener Konzepte in <strong>der</strong> Tages‐<br />
pflege<br />
C149<br />
C149<br />
C149<br />
C151<br />
C152<br />
C153<br />
C154<br />
C155<br />
CXXV
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Zunehmende Bedeutung von sorgfältigen<br />
Assessments und des sorgfältigen Care‐<br />
M<strong>an</strong>agements in <strong>der</strong> Tagespflege<br />
Zunehmen<strong>der</strong> hoher Bedarf <strong>an</strong> Tagespflegeein‐<br />
richtungen für psychisch kr<strong>an</strong>ke ältere Menschen<br />
Qualitätssicherungsdiskurs.<br />
Zunehmende Bedeutung einer engen Abstim‐<br />
mung von externer und interner Qualitätssiche‐<br />
rung. Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Aufmerksam‐<br />
keit von Erkenntnissen aus Gerontologie, Pflege<br />
und Geriatrie in <strong>der</strong> Konzeptentwicklung externer<br />
Qualitätssicherung<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> internen Qualitäts‐<br />
sicherung im Hinblick auf Entwicklung gut ver‐<br />
ständlicher und einfacher Instrumente, die von<br />
den Mitarbeitern verst<strong>an</strong>den werden. Zuneh‐<br />
mende Bedeutung von internen Beschreibungen<br />
von guter o<strong>der</strong> schlechter Pflege<br />
Zunehmende Bedeutung von Strukturst<strong>an</strong>dards<br />
(Tageslaufstruktur, zu <strong>Die</strong>nstplänen, zu Über‐<br />
gabebesprechungen, zur Pflegedokumentation,<br />
zur Org<strong>an</strong>isation <strong>der</strong> Medikamentenversorgung)<br />
Zunehmende Bedeutung von Stärken‐/Schwä‐<br />
chenkatalogen (Qualitätsprofile) durch differen‐<br />
zierte Betriebsvergleiche o<strong>der</strong> Nutzerbefragun‐<br />
gen<br />
Zunehmende Bedeutung einer nachfrageorien‐<br />
tierten Pflegequalität, dabei zunehmende Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> Kunden‐ und Nutzereinschätzung in <strong>der</strong><br />
C155<br />
C156<br />
C157<br />
C158<br />
C158<br />
C158<br />
C160<br />
CXXVI
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
stationären Altenhilfe<br />
Zunehmende Bedeutung von zertifizierungsmaß‐<br />
nahmen als Marketing‐Maßnahmen<br />
Zunehmende Bedeutung eines regional abge‐<br />
stimmten Pflege<strong>an</strong>gebots, die Grenzen zwischen<br />
ambul<strong>an</strong>ter, stationärer, teilstationärer Pflege<br />
werden zunehmend fließend werden<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Kundenrolle für die<br />
Gepflegten<br />
Zunehmende Bedeutung des Ziels für jeden Be‐<br />
wohner ein eigenes Zimmer vorzuhalten<br />
Zunehmende Bedeutung des Hausgemein‐<br />
schaftskonzepts unter <strong>der</strong> Kostenperspektive<br />
Zunehmende Bedeutung des Bildungs‐ und Wis‐<br />
sensm<strong>an</strong>agements als Aufgabe <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isati‐<br />
onsentwicklung<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Weiterentwicklung<br />
von Weiterbildungskonzepten unter Berücksich‐<br />
tigung <strong>der</strong> Reformen im Erstausbildungsbereich<br />
Zunehmende Bedeutung einer Reformierung des<br />
§80 SGBXI für ver<strong>an</strong>twortliche Pflegekräfte, um<br />
akademische Pflegekräfte nicht zu benachteiligen<br />
Zunehmende Bedeutung des Ressourcencharak‐<br />
ters <strong>der</strong> Technik im Bereich <strong>der</strong> Selbstständig‐<br />
keitserhaltung, Defizitkompensation, Verminde‐<br />
rung von Pflegerisiken, Entwicklung neuer Mög‐<br />
lichkeiten in Therapie, Pflege und Überwachung<br />
bis hin zu Formen sozialen Austauschs und <strong>der</strong><br />
C159<br />
C160<br />
C160<br />
C161<br />
C162<br />
C163<br />
C163<br />
C163<br />
C165<br />
CXXVII
3. Bericht zur Lage <strong>der</strong> älteren Generation in <strong>der</strong> BRD: Alter und Gesellschaft 2001 (Auftraggebende Ministerin: Christine Bergm<strong>an</strong>n, SPD)<br />
Demo‐<br />
gr. Bef.<br />
Epidemiologische Befunde Ökonomische Befunde Befunde Sozialer W<strong>an</strong>del Bef.‐Nr.<br />
Erreichbarkeit<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Entlastung <strong>der</strong> Pro‐<br />
fessionellen im Falle von Therapie und Pflege<br />
durch den Einsatz von neuen Techniken und ggf.<br />
Kostenreduktion<br />
Zunehmende Bedeutung von Risiken durch Tech‐<br />
nik<br />
Zunehmende Bedeutung von<br />
verän<strong>der</strong>ten Leitbil<strong>der</strong>n im Um‐<br />
g<strong>an</strong>g mit älteren Menschen in <strong>der</strong><br />
Sozialpolitik als aktive Koprodu‐<br />
zenten ihrer eigenen Wohlfahrt<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Nachwuchsför<strong>der</strong>ung im akade‐<br />
mischen Bereich<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong><br />
Verbesserung <strong>der</strong> Infrastruktur in<br />
Wissenschafts‐ und Forschungs‐<br />
för<strong>der</strong>ung<br />
C165<br />
C166<br />
D132<br />
D164<br />
D164<br />
CXXVIII
Anlage C: Megatrends<br />
A. MEGATRENDS DES DEMOGRAFISCHEN WANDELS<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. Rückg<strong>an</strong>g bei den Jüngeren (bis 65‐Jährigen) um insgesamt 17 Mio. Menschen, bei den 16‐40‐Jährigen A 44,<br />
A I<br />
um 10 Mio. und bei Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen ein Rückg<strong>an</strong>g um 5 Mio.; <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> 40‐65‐Jährigen verän<strong>der</strong>t sich kaum (Rückg<strong>an</strong>g um<br />
1,6 Mio.).<br />
A109, A111<br />
Steigende durchschnittliche Lebenserwartung und Feminisierung des Alters. <strong>Die</strong> durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei Frauen A44, A111,<br />
A II<br />
(Durchschnittsalter 81) sieben Jahre höher als bei Männern (Durchschnittsalter 75).<br />
Absolute und relative Zunahme älterer Menschen. Der Zuwachs <strong>an</strong> 50‐80‐Jährigen wird zwischen 2010 und 2030 auf 26,4−28,9 Mio.<br />
A109<br />
Menschen prognostiziert, was einen Zuwachs von rund 17 % gegenüber 1993 bedeutet; bei <strong>der</strong> Kohorte <strong>der</strong> 65‐jährigen und älteren be‐ A109, A116,<br />
A III<br />
deutet dies einen Zuwachs von 7 Mio. Menschen. Insgesamt drückt dies eine Zunahme des Anteils <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung von 20 %<br />
auf 36 % (Prognose 2030) aus.<br />
A129<br />
Zunahme <strong>der</strong> Hochaltrigkeit. Es wird von einer Verdreifachung <strong>der</strong> hochaltrigen Bevölkerung bis ins Jahr 2040 ausgeg<strong>an</strong>gen (Prognose A1, A65, A111, A IV<br />
zwischen 4,1−5,3 Mio.) bei einem größeren Frauenüberschuss als bei den Älteren insgesamt.<br />
A112, A117<br />
Zunahme/Verdopplung des Altersquotienten und Rückg<strong>an</strong>g des Erwerbstätigenpotentials. Anstieg des Rentenalters lässt Rentenquoti‐<br />
enten l<strong>an</strong>gsamer wachsen als den Altersquotienten, Zunahme des weiblichen Erwerbstätigenpotentials.<br />
A43, A113 A V<br />
Zunehmende Bedeutung von Alter und Migration. Keine Feminisierung des Alters bei ausländischen Mitbürgern. A109, A110 A VI<br />
CXXIX
B. MEGATRENDS DES EPIDEMIOLOGISCHEN WANDELS<br />
Medizinische W<strong>an</strong>dlungsphänomene<br />
Diagnostisch‐therapeutische Trends<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Mo<strong>der</strong>ate Verän<strong>der</strong>ung des Kr<strong>an</strong>kheitsspektrums und zunehmen<strong>der</strong> Bedarf <strong>an</strong> professionellen medizinischen und pflegerischen Leis‐<br />
tungen in Abhängigkeit von demografischer Entwicklung und medizinischem Fortschritt.<br />
B1, B43 B I<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Sterblichkeitsraten in den höheren Altersgruppen. Aufgrund verbesserter kurativer Medizin und nicht‐medizinischen<br />
sowie präventiven Faktoren, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> verbesserten Beh<strong>an</strong>dlung von Herzerkr<strong>an</strong>kungen und dem Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Sterblichkeit nach<br />
Oberschenkelhalsfrakturen.<br />
B18, B45, B47 B II<br />
Zunahme chronischer, l<strong>an</strong>gwierig‐degenerativer und entzündlicher Erkr<strong>an</strong>kungen sowie <strong>der</strong> Multimorbidität beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> zweiten<br />
Lebenshälfte. Hierbei ist die weiter zunehmende Bedeutung degenerativer und entzündlicher Gelenkerkr<strong>an</strong>kungen hervorzuheben sowie<br />
B3, B42, B46,<br />
B III<br />
sensorische Einbußen, wobei Hör‐ vor Seheinbußen dominieren.<br />
B103<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bedeutung von Alter und Behin<strong>der</strong>ung und diesbezüglich kompetenzerhalten<strong>der</strong> und ‐för<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Interventionen.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Zahngesundheit und Zahnersatzversorgung im Alter. Wegen des höchsten Kostenverursachungsfaktors im<br />
Gesundheitswesen.<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Versorgungsbedarf im somatischen Bereich. Hervorzuheben sind insbeson<strong>der</strong>e obstruktive Lungenerkr<strong>an</strong>kungen, Erkr<strong>an</strong>‐<br />
kungen des Urogenitaltrakts, Herz‐Kreislauf‐Erkr<strong>an</strong>kungen, Erkr<strong>an</strong>kungen des Bewegungsapparates (operativ und rehabilitativ) sowie<br />
Erkr<strong>an</strong>kungen des Hör‐ und Sehsinns (medizinisch und nicht‐medizinisch) und peripher arterielle Verschlusskr<strong>an</strong>kheiten und Arthrosen.<br />
Zunahme maligner und psychiatrischer sowie neurologischer Erkr<strong>an</strong>kungen. Hierbei ist <strong>der</strong> zunehmende Versorgungsbedarf für Krebser‐<br />
kr<strong>an</strong>kungen im diagnostischen und therapeutischen Bereich, insbeson<strong>der</strong>e die zunehmende Bedeutung des Lungenkrebses bei Männern<br />
als häufigste Krebstodesursache zu bemerken.<br />
Zunahme gerontopsychiatrischer Erkr<strong>an</strong>kungen inkl. <strong>der</strong> Demenz, beson<strong>der</strong>s die <strong>der</strong> schweren bis mäßig‐schweren Formen<br />
Hier ist eine zunehmende Bedeutung des Belastungsdiskurses für Angehörige im Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Demenz hervorzuheben.<br />
B4, B139 B IV<br />
B21, B35 B V<br />
B13, B17, B47 B VI<br />
B3, B14, B47 B VII<br />
B104, B131 B VIII<br />
CXXX
Präventive Trends<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmende Bedeutung gesundheitlicher Prävention und <strong>der</strong>en gesundheitspolitischer Kriterien sowie regionaler Präventions<strong>an</strong>gebo‐<br />
te, um Versorgungsbedarf in Kuration, Rehabilitation und Pflege zu senken und die Erhaltung selbstständiger Lebensführung im Alter<br />
sowie die Erwerbs‐ und Arbeitsfähigkeit älterer Menschen zu erreichen.<br />
Zunehmende Bedeutung primärer Prävention und Umweltbedingungen. Hierbei sind die Risiken des zunehmenden Raucherverhaltens<br />
und des Passivrauchens in <strong>der</strong> Bevölkerung, die zunehmenden umweltgesundheitlichen Risiken durch Feinstaubbelastung und ionisieren‐<br />
<strong>der</strong> Strahlung sowie die zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ernährung im Alter hervorzuheben.<br />
Zunehmende Bedeutung sekundärer und klinischer Prävention im Alter. Hierbei sind Grippeschutzimpfungen, die Gebärmutterkrebsvor‐<br />
sorgeuntersuchungen und die Darmkrebsvorsorge sowie die zunehmende Bedeutung des präventiven Hausbesuchs und des Geriatrischen<br />
Assessments hervorzuheben.<br />
Rehabilitative Trends<br />
B37, B40, B47,<br />
B84<br />
B6‐B12, B14, B85<br />
B14‐ B16, B20,<br />
B91, B138<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmende Bedeutung des Rehabilitationspotentials älterer pflegebedürftiger Menschen sowie ein Rehabilitations<strong>an</strong>gebot unter<br />
aktivierenden Gesichtspunkten.<br />
B131 B XII<br />
Medizinisch/e (‐technische) Entwicklungs‐ und Fortschrittstrends<br />
Zunehmende Bedeutung des Erkenntnisfortschritts über Methoden für Diagnosen und Therapie, Prävention und Rehabilitation sowie<br />
des medizinischen, medizinisch‐technischen, des technischen und des pflegerischen Fortschritts. B39, B58<br />
Zunehmende Bedeutung von Technologie, Nachfrage und Wettbewerb, Evidenzbasierter‐ Medizin und eines Health‐Technology‐<br />
Assessments (HTA) zur Evaluation <strong>der</strong> Wirksamkeit von Technologien und medizinischen Verfahren im Zusammenh<strong>an</strong>g mit dem medizini‐ B60‐B62<br />
schen Fortschritt.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Telematik im Bereich <strong>der</strong> Weiterentwicklung medizinisch‐diagnostischer und therapeutischer Qualität<br />
sowie die Verbesserung <strong>der</strong> Versorgungsqualität . Hierbei spielen Dokumentation, Telekonsultation und Wissensb<strong>an</strong>ken eine beson<strong>der</strong>s B69, B71<br />
hervorzuhebende Rolle.<br />
CXXXI<br />
B IX<br />
B X<br />
B XI<br />
B XIII<br />
B XIV<br />
B XV
Gerontologische W<strong>an</strong>dlungsphänomene<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmende Bedeutung eines differenzierten Altersbildes. Zunehmendes Alter steht nicht automatisch für zunehmende Kr<strong>an</strong>kheit,<br />
hierbei gilt es einem ausschließlich epidemiologischen Blick entgegen zu treten.<br />
B132, B133 B XVI<br />
Zunehmende Bedeutung eines differenzierten gesundheitsför<strong>der</strong>nden und präventiven Verständnisses unter Einbezug des gesamten B83, B89<br />
Alterungsprozesses (Normal Aging) und nicht ausschließlich im Hinblick auf Kr<strong>an</strong>kheitsverhin<strong>der</strong>ung. Hierbei kommen<br />
salutogenetischen Theorie<strong>an</strong>sätzen wie dem von Antonovsky eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />
B XVII<br />
Zunehmende Bedeutung gerontologischer und geriatrischer Expertise für die Medizin. Hierbei ist eine zunehmende Relev<strong>an</strong>z einer Ei‐<br />
genständigkeit <strong>der</strong> Geriatrie und ein zunehmen<strong>der</strong> Bedarf <strong>an</strong> Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung zu bemerken, um dem diagnostischen Nihi‐<br />
lismus für gerontopsychiatrisch Betroffene entgegen zu wirken.<br />
B131, B134 B XVIII<br />
W<strong>an</strong>dlungsphänomene <strong>der</strong> Pflege<br />
Trends im Bereich <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeitsentwicklung<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunahme <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit (Prognosen in absoluten Angaben für 2010‐2040). Zunahme <strong>der</strong> Pflegebedürftigen in <strong>der</strong> BRD auf 2,04<br />
Mio. (2010) (laut BGM 2,14 Mio.) bis 2,3–2,5 Mio. (2030) (laut BGM 2,16–2,57 Mio.) und weiter auf 2,26–2,79 Mio. (2040) insbeson<strong>der</strong>e<br />
durch die zunehmende Demenz im Alter und im hohen Alter, dabei Zunahme <strong>der</strong> häuslich versorgten Älteren von 1,24 Mio. (2010) auf 1,6<br />
Mio. (2030).<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Prävalenz <strong>der</strong> Demenz im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Pflegebedürftigkeit. Rund 50 % <strong>der</strong> Pflegebedürftigen leiden<br />
<strong>an</strong> schwerer bis mäßig‐schwerer Demenz.<br />
Abnahme eines Interventionsbedarfs kurativer Leistungen in den höchsten Altersstufen, dafür Zunahme <strong>der</strong> Nachfrage pflegerischer<br />
Leistungen.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Bevölkerung mit leichtem und erheblichem Pflegebedarf. Hierbei ist in beson<strong>der</strong>em Maße die Unterstüt‐<br />
zung bei <strong>der</strong> grundpflegerischen Versorgung hervorzuheben.<br />
B5, B19, B129,<br />
B131, B136<br />
CXXXII<br />
B XIX<br />
B104 B XX<br />
B47 B XXI<br />
B65 B XXII<br />
Zunehmende Bedeutung des Aktivierungsparadigmas beson<strong>der</strong>s in Verbindung mit rehabilitativer Pflege. B105, B131 B XXIII<br />
Zunehmende Bedeutung des Entlastungsbedarfs pflegen<strong>der</strong> Angehöriger und <strong>der</strong> Pflegepersonen im Heim. B104 B XXIV
Klinisch‐praktische Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ermittlung und H<strong>an</strong>dhabbarkeit des Pflegebedarfs. Hierbei ist insbeson<strong>der</strong>e dessen Beschreibung aus <strong>der</strong><br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Patienten‐ und Pflegebedürftigen‐Perspektive und ebenso die Pflegediagnostik hervorzuheben.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Sturzprävention. Hier ist beson<strong>der</strong>s die zunehmende Bedeutung einer multifaktoriellen Diagnostik von<br />
B66, B67, B135 B XXV<br />
Risikofaktoren und von Interventionen zur Reduktion von Stürzen insbeson<strong>der</strong>e eines differenzierten Sturzassessments unter Aspekten,<br />
wie Bal<strong>an</strong>ce, häuslichem Umfeld, Hören/Sehen o<strong>der</strong> Stehsicherheit, sowie die Faktoren „Über‐ o<strong>der</strong> Fehlmedikation“ und die zielgerichte‐<br />
te Prävention <strong>der</strong> Osteoporose im Hinblick auf Schenkelhalsfrakturen und Stürzen hervorzuheben.<br />
Zunehmende Bedeutung innovativer Pflegekonzepte zur Schaffung sensorischer Anregungen.<br />
B138<br />
B XXVI<br />
Hierzu sind z. B. Snoezel‐Räume, humor ‐ o<strong>der</strong> tiergestützte Interventionen zu erwähnen sowie <strong>der</strong>en Erfolgskontrollen außerhalb kon‐<br />
trollierter Studien zur Erfassung des Wohlbefindens psychisch kr<strong>an</strong>ker Menschen, um die Wirkung bestimmter Interventionen zu be‐<br />
schreiben hervorzuheben (zu Letzterem sei beson<strong>der</strong>s die Methode des „Dementia Care Mapping (DCM)“ nach Tom Kitwood erwähnt).<br />
B140, B141<br />
B XXVII<br />
M<strong>an</strong>agerielle und Trends zu Org<strong>an</strong>isationsfragen<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmende Bedeutung von Org<strong>an</strong>isationsprozessen und Pflegesystemen wie <strong>der</strong> Bezugspflege.<br />
Zunehmende Bedeutung pflegepidemiologischer Erkenntnisse unter systematisch‐zielgerichteten Analysekriterien, um den qualitativen<br />
B66 B XXVIII<br />
Pflegebedarf zu dokumentieren (siehe auch „klinisch praktische Trends“, B66, B67, B135) sowie die zunehmende Bedeutung integrierter<br />
medizinischer und pflegerischer Dokumentation sowie <strong>der</strong> Personaleinsatzpl<strong>an</strong>ung.<br />
B67, B135<br />
B XXIX<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> medizinischen und (selbstständigen) Assistenz in Diagnostik und Therapie sowie bei <strong>der</strong> Vor‐ und Nachbe‐<br />
reitung technischer Prozesse.<br />
B66 B XXX<br />
Zunehmende Bedeutung EDV‐ gestützter Abstimmungs‐ und Org<strong>an</strong>isationsprozesse sowie von Kr<strong>an</strong>kenhaus‐Informationssystemen B66,<br />
B XXXI<br />
(KIS) und sonstigen effektiven EDV‐Lösungen.<br />
Zunehmende Bedeutung von gezielten Pflegepersonaldatenerhebungen sowie von Pflegeberichterstattungen, Pflegedichteziffern und<br />
B67<br />
einer evidenzbasierten Pl<strong>an</strong>ung von Ausbildungskapazitäten zur Vermeidung von Engpässen. B98<br />
B XXXII<br />
CXXXIII
Trends zu Fragen <strong>der</strong> Versorgungs‐ und Interventionsebene<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Kontext‐ und Umweltgestaltung. Hierbei sind die zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> „Setting‐Orientierung“ und<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
die nicht‐segregativen Versorgungs<strong>an</strong>sätze zu nennen.<br />
Zunehmende Bedeutung des Wohnens als zentrale Bedingung für die Erhaltung <strong>der</strong> Selbstständigkeit und <strong>der</strong> Gesundheit.<br />
B86, B105<br />
B XXXIII<br />
Hierzu sind die zunehmende Bedeutung von Stimulationsbedingungen beim Wohnen in Abstimmung zu Wohn‐, Rehabilitations‐ und Pfle‐<br />
gekonzepten in <strong>der</strong> Wohnraumgestaltung, die zunehmende Bedeutung von Barrierefreiheit und Prothetik, ausreichende Bewegungsmög‐<br />
lichkeit, Beachtung <strong>der</strong> Relation von Privatheit und Gemeinschaft, von Farbe und Licht als „Fenster zur Welt“ sowie die Auswahl von Ge‐<br />
genständen zur Stimulation von Sinnesorg<strong>an</strong>en hervorzuheben.<br />
B105, B122<br />
B XXXIV<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Zielgruppe <strong>der</strong> psychisch kr<strong>an</strong>ken Menschen insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Bedeutung eines eigenen Zimmers (im<br />
Heimbereich).<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Pflege von <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheits‐ zur Gesundheitsorientierung insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> ambu‐<br />
B161 B XXXV<br />
l<strong>an</strong>ten Pflege, die zunehmend und im internationalen Trend <strong>an</strong> Bedeutung gewinnt. Hier ist zudem eine zunehmende Bedeutung spezi‐<br />
fisch‐pflegerischen Wissens in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege (bisl<strong>an</strong>g we<strong>der</strong> akademisch noch setting‐spezifisch) hervorzuheben.<br />
B143, B150<br />
B XXXVI<br />
Zunehmende Bedeutung von Hilfenetzwerken und professioneller Unterstützung im Zusammenh<strong>an</strong>g mit ausgeprägter Pflegebedürf‐<br />
tigkeit.<br />
B108 B XXXVII<br />
Pflegepolitische und ‐pädagogische Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Reform <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit.<br />
Befundnummer Megatrendnummer.<br />
Hierbei ist beson<strong>der</strong>s die zunehmende Bedeutung von Grenzziehungsprüfungen zwischen alten‐ und kr<strong>an</strong>kenpflegerischen Tätigkeiten<br />
relev<strong>an</strong>t, um mit <strong>der</strong> sich w<strong>an</strong>delnden Praxis Schritt zuhalten.<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungsbedarf in <strong>der</strong> Pflegeausbildung (Erstausbildung) im Bereich von Rehabilitation, Prävention,<br />
B135<br />
B XXXVIII<br />
Angehörigenberatung sowie <strong>der</strong> Technik und Technikentwicklung sowie eine zunehmende Bedeutung des individualisierenden, kompe‐<br />
tenzübergreifenden und wissenschaftlichen Ausbildungsbedarfs von <strong>der</strong> h<strong>an</strong>dwerklich‐technischen Orientierung hin zu wissenschaftlich‐<br />
begründeter Bezugspflege.<br />
B98<br />
B XXXIX<br />
Zunehmende Bedeutung von generalisierten Ausbildungsversuchen. B163 B XL<br />
CXXXIV
C. MEGATRENDS DES ÖKONOMISCHEN WANDELS<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen zwischen Kostendämpfung und Wachstum<br />
Wachstumstrends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung des Wachstumsparadigmas im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Arbeits‐ und Leistungsfähigkeit sowie Wertschöpfung und<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Wachstums, bei insgesamt weniger Wachstum im Gesundheitswesen als im Rest <strong>der</strong> Gesamtwirtschaft. C36, C55<br />
C I<br />
Zunehmende Bedeutung des Gesundheitswesens als Wirtschaftsfaktor mit Wachstums‐ und Produktivitätseffekten neben Kostenfragen. C38 C II<br />
Zunehmende Bedeutung unterschiedlicher Interessen im Zusammenh<strong>an</strong>g mit dem Fortschrittszyklus, dadurch Kostensteigerung als Folge C60 C III<br />
Zunehmende Reformbestrebungen für das Gesundheitswesen in Richtung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung einer kontrollierten, experimentellen Kultur. C41 C IV<br />
Kostendämpfungsparadigma<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung von Wirtschaftlichkeitsreserven aufgrund des zunehmenden demografischen Mehrbedarfs, <strong>der</strong> m<strong>an</strong>gelnden<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zielorientierung im Gesundheitswesen als Kostenursache und des diagnostischen Fehleinsatzes (Röntgenuntersuchungen, Knochendich‐<br />
temessungen, Arthroskopien, Rückenschmerzdiagnostik und ‐therapie).<br />
C50, C51, C81<br />
C V<br />
Zunehmende Bedeutung von Präventionseffekten im Hinblick auf Kosteneinsparungen. These: 25–30 % <strong>der</strong> Gesamtausgaben können<br />
reduziert werden.<br />
C83, C183 C VI<br />
Zunehmende Bedeutung sozialer und ökonomischer Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit, Behin<strong>der</strong>ung und vorzeitiger Mortalität. Keine Kr<strong>an</strong>kheits‐<br />
ohne Kosten<strong>an</strong>gabe.<br />
Zunehmende Bedeutung von Kostensenkungen im Bereich bei Leistungserbringung im Bereich zunehmen<strong>der</strong> negativer Preisstrukturef‐<br />
C4, C14‐22, C45 C VII<br />
fekte zugunsten von Gesundheitsleistungen. Leistungsintensivierung durch Defensivmedizin, durch Einbezug <strong>der</strong> Zahler und <strong>der</strong> Zusam‐<br />
menarbeit von Herstellern, Leistungserbringern und Versicherern sowie <strong>der</strong> Prüfung des Verhältnisses zwischen Ressourceneinsatz und<br />
Nutzen (Gesundheitsergebnis).<br />
C43, C59, C60<br />
C VIII<br />
Zunehmende Bedeutung des Moral Hazards (durch Versicherungsschutz gegebener Anreiz zur übermäßigen In<strong>an</strong>spruchnahme von<br />
Gesundheitsleistungen); wachsende Bedeutung <strong>der</strong> Selbstmedikation im Bereich <strong>der</strong> Arzneimittelversorgung und Fin<strong>an</strong>zierung<br />
Zunehmende Bedeutung von unabhängigen Steuerungsmöglichkeiten. Im Bereich stationärer Medizin, bei <strong>der</strong> Zulassung von Medizin‐<br />
C30, C42 C IX<br />
produkten, <strong>der</strong> Evaluation zwischen Innovations‐ und Diffusionsphase und bei <strong>der</strong> Evaluation und Forschungsentwicklung sowie eine<br />
zunehmende Bedeutung von Clearing‐Stellen.<br />
C60‐62<br />
C X<br />
CXXXV
Arbeitsmarktrelev<strong>an</strong>te Trends<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmendes Wachstum <strong>der</strong> Beschäftigung im Gesundheitswesen insbeson<strong>der</strong>e zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Beschäftigungsch<strong>an</strong>cen<br />
am Arbeitsmarkt in <strong>der</strong> Pflege. Beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Altenpflege (beson<strong>der</strong>s im Bereich <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten und teilstationären Pflege, wobei<br />
dieser bedarf nicht direkt proportional mit einer Zunahme <strong>der</strong> Beschäftigungszahlen einhergehen wird) vor dem Hintergrund einer<br />
Knappheit qualitativ Pflegekräfte in allen Bereichen und Kompensationsmech<strong>an</strong>ismen des Pflegesektors<br />
(Anmerkung: Ausweitung des Pflegedienstes in Kr<strong>an</strong>kenhäusern um 40 000 Stellen, St<strong>an</strong>d 1995).<br />
C2, C29, C38, C58,<br />
C65, D66, C96,<br />
D97<br />
Zunehmende Bedeutung einer europaweiten Fachkraftmobilität.<br />
Zunehmende Bedeutung von Angleichungsprozessen von Alten‐ und Kr<strong>an</strong>kenpflege aufgrund einer zunehmenden gegenseitigen Ersetz‐<br />
C98 C XII<br />
barkeit auf dem Arbeitsmarkt, zunehmende Bedeutung von Teilqualifikationen wegen des Pflegeversicherungsgesetzes, hierbei Verdrän‐<br />
gung von Pflegekräften.<br />
C98, D97<br />
C XIII<br />
Zunehmende Belastungsspektrum aus <strong>der</strong> Arbeitswelt: Belastungsstrukturw<strong>an</strong>del von körperlicher zu psychischer Erkr<strong>an</strong>kung. C11 C XIV<br />
Trends im Bereich <strong>der</strong> Qualitätssicherung/Qualitätssicherungsdiskurs<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Zunehmende Bedeutung einer Qualitätssicherung für die Pflegeberufe mit interner und externer Seite. Intern: perspektivische Entwick‐<br />
lung eines pflegerischen Selbstverständnisses, Stärke‐/Schwächekatalogen und differenzierten Betriebsvergleichen sowie Nutzerbefra‐<br />
gungen. Extern: zunehmende Aufmerksamkeit gegenüber Erkenntnissen aus Gerontologie, Pflege und Geriatrie in <strong>der</strong> Konzeptentwick‐<br />
lung externer Qualitätssicherung.<br />
Zunehmende Bedeutung einer Ergebnisorientierung und nachfrageorientierten Pflegequalität. Beson<strong>der</strong>e Bedeutung <strong>der</strong> Kunden‐ und<br />
Nutzereinschätzung (sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige), eines <strong>an</strong> <strong>der</strong> Bedarfslage potentieller Nutzer orientierten pflegeri‐<br />
schen Leistungsprofils sowie zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnisqualität pflegespezifischer Parameter und Outcome‐Faktoren wie Mor‐<br />
bidität, Lebenserwartung o<strong>der</strong> Lebensqualität („Add years to life <strong>an</strong>d life to years“).<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Entwicklung gut verständlicher und einfacher Qualitätssicherungsinstrumente. Strukturst<strong>an</strong>dards wie<br />
Tageslaufstruktur, zu <strong>Die</strong>nstplänen, zu Übergabebesprechungen, zur Pflegedokumentation o<strong>der</strong> zur Org<strong>an</strong>isation <strong>der</strong> Medikamentenver‐<br />
sorgung.<br />
Zunehmende Bedeutung einer Professionsentwicklung als qualitätssichernde Strategie. Etablierung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> und im Be‐<br />
reich qualitätsbezogener Regelungen zu Vorbehaltsaufgaben in <strong>der</strong> Altenpflege.<br />
C99, C101, C157‐<br />
158<br />
C56, C101, C147,<br />
C160<br />
C99, D68<br />
Zunehmende Bedeutung von Zertifizierungsmaßnahmen als Marketingmaßnahmen. C159<br />
C XVIII<br />
C XIX<br />
C158<br />
CXXXVI<br />
C XI<br />
C XV<br />
C XVI<br />
C XVII
Politisch‐legislative Trends<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnumer<br />
Zunehmende Bedeutung von Kosten und Leistungen in den Sozialversicherungssystemen. Zunahme <strong>der</strong> Ausgaben <strong>der</strong> GKV bis 2030,<br />
zunehmende Verlagerung von Leistungen und Kosten von <strong>der</strong> GKV in die GPflV sowohl ambul<strong>an</strong>t als auch stationär, zunehmende Bedeu‐<br />
tung einer Anpassung <strong>der</strong> Sozialversicherungssysteme <strong>an</strong> die gew<strong>an</strong>delten Anfor<strong>der</strong>ungen im ambul<strong>an</strong>ten Bereich, zunehmende Bedeu‐<br />
tung einer kritischen Reform <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierungsgrundlage ambul<strong>an</strong>ter Pflege auf pflegewissenschaftlicher Basis.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Novellierung und Reformierung qualitätssichern<strong>der</strong> Gesetzgebung, insbeson<strong>der</strong>e § 137b, SGBV: Berufs‐<br />
gruppenübergreifende Qualitätssicherung, § 37, SGBXI: Qualitätssicherung häuslicher Pflege älterer Menschen durch Angehörige (und<br />
Verbesserung durch Modelle Qualitätssichern<strong>der</strong> Pflegeunterstützung), § 80, SGBXI: für ver<strong>an</strong>twortliche Pflegekräfte, um akademische<br />
Pflegekräfte nicht zu benachteiligen.<br />
Zunehmende Bedeutung von Wohlfahrtseffekten (wie Morbidität, Lebenserwartung, Lebensqualität, Erreichbarkeit medizinischer<br />
Leistungen, Zeitkosten, Funktionseinbußen, Verunsicherung und Leidgefühle <strong>der</strong> Patienten), die bestimmen, welche Leistungen bezahlt<br />
werden und welche nicht; zunehmende Bedeutung einer trennscharfen Kr<strong>an</strong>kheitstypologie im Alter im Hinblick auf Kostenübernahme.<br />
Zunehmende Bedeutung einer Zusammenführung von Alten‐ und Kr<strong>an</strong>kenpflege im Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Integration ins tertiäre<br />
Bildungssystem, um Normalität in <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierung zu erreichen, zunehmende Bedeutung im Hinblick auf Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Ausbil‐<br />
dungsfin<strong>an</strong>zierung bei bestehendem Rückzugswunsch <strong>der</strong> GKV, für die Träger insofern zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Personalrekrutierung.<br />
C47, C58, C75,<br />
C132, C145, C153<br />
C67, C100, C163<br />
C46, C57, C87<br />
C97‐98<br />
Zunehmende Bedeutung von Betroffenen bei Einbezug in Gremien wie Ausschüssen, Institutionen o<strong>der</strong> dem MDK. C93<br />
C XXIII<br />
C XXIV<br />
Versorgungs‐ und settingspezifische Trends<br />
Qu<strong>an</strong>titative Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megtrendnummer<br />
Zunehmende Anzahl <strong>der</strong> Pflegeeinrichtungen, zunehmende Bedeutung ambul<strong>an</strong>ter und sonstiger Pflegeeinrichtungen, Stagnation von<br />
Pflegeplätzen im Heimsektor,<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäuser und Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Verweildauer, Rückg<strong>an</strong>g ärztlicher und pflegerischer Kapazität, zunehmende Fallzahlen<br />
durch Fortschritte in <strong>der</strong> medizinischen Beh<strong>an</strong>dlung und durch Einführung <strong>der</strong> Fallpauschalen, Zunahme <strong>der</strong> Beh<strong>an</strong>dlungskosten in Kr<strong>an</strong>‐<br />
kenhäusern,<br />
Zunahme differenzierter Versorgungs<strong>an</strong>gebote (wie Tages‐ o<strong>der</strong> Kurzzeitpflege), zunehmen<strong>der</strong> Bedarf von Rehabilitationsmaßnahmen<br />
und zunehmende Bedeutung integrierter Versorgungsformen.<br />
C6, C23‐27,<br />
C32‐33<br />
CXXXVII<br />
C XX<br />
C XXI<br />
C XXII<br />
C XXV
Settingspezifische Verän<strong>der</strong>ungen I/Ambul<strong>an</strong>te Pflege<br />
Titel des Megatrends Befundnummer Megatrendnummer<br />
Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Betriebsgründungen, zunehmen<strong>der</strong> Verdrängungswettbewerb zulasten kleinerer Anbieter, zunehmende Bedeutung pri‐<br />
vatrechtlicher Einrichtungen (mehr als 50 % <strong>der</strong> Anbieter), zunehmende Ausgaben im Bereich ambul<strong>an</strong>ter Pflege sowie bei Kr<strong>an</strong>ken‐ und<br />
Rettungstr<strong>an</strong>sporten.<br />
Zunehmende Bedeutung eines Ausbaus und Weiterentwicklung ambul<strong>an</strong>ter Pflege, um Unterversorgungserscheinungen, Drehtüreffekte<br />
o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>einweisungen zu verhin<strong>der</strong>n.<br />
Zunehmende Beeinträchtigung <strong>der</strong> Qualität häuslicher Kr<strong>an</strong>kenpflege durch Wettbewerb und Kostendruck sowie zunehmende Bedeu‐<br />
tung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung des Leistungsprofils und einer qualitativen Ausdifferenzierung des Leistungs<strong>an</strong>gebots bei Zunahme nicht‐<br />
qualifizierter Mitarbeiter (Versechsfachung zwischen 1996‐1999).<br />
Zunehmende Bedeutung von Bedarfsgesichtspunkten zu Pflegeleistungen unter pflegewissenschaftlichen Relev<strong>an</strong>zkriterien und weniger<br />
durch sozialrechtliche Gesichtspunkte.<br />
Zunehmende Bedeutung von Modellversuchen zur Umstrukturierung <strong>der</strong> Aufgabengebiete ambul<strong>an</strong>ter Pflege und <strong>der</strong>en Umsetzung in<br />
klare Arbeitskonzepte.<br />
Zunehmende Dringlichkeit einer zukünftigen Entsp<strong>an</strong>nung <strong>der</strong> Arbeitssituation in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege wegen hoher Mitarbeiterfluktu‐<br />
ation und zunehmen<strong>der</strong> Bedeutung ökonomischer Erwägungen vor professionellen Qualitätserwägungen.<br />
Settingspezifische Verän<strong>der</strong>ungen II/Heimbereich (Wohntrends)<br />
C36,<br />
C145<br />
CXXXVIII<br />
C XXVI<br />
C145 C XXVII<br />
C34, C149,<br />
D97<br />
C XXVIII<br />
C144 C XXIX<br />
C151 C XXX<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung des Wohnens in Heimen im Sinne eines Wohnens mit Pflege bei geringeren Platzzahlen (max. 60‐90 Bewoh‐<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
ner) nach dem Kleeblattmodell, weiter zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Wohnraumgröße und Wohnraumgestaltung, Größe <strong>der</strong> Wohnberei‐<br />
che (ca. 30 Personen) in aufgeteilten Gruppen (2−3) mit je max. 15 Bewohnern.<br />
C125<br />
C XXXII<br />
Zunehmende Bedeutung des Ziels, für jeden Bewohner ein eigenes Zimmer vorzuhalten. C161 C XXXIII<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> Wohngestaltung bei L<strong>an</strong>gzeitbewohnern und Pflegebedürftigen mit beson<strong>der</strong>en<br />
Bel<strong>an</strong>gen wie dementen o<strong>der</strong> psychisch kr<strong>an</strong>ken Bewohnern.<br />
C125 C XXXIV<br />
Zunehmende Bedeutung des Hausgemeinschaftskonzepts unter einer Kostenperspektive. C162 C XXXV<br />
Zunehmende Bedeutung des betreuten Wohnens, Weiterentwicklung und Maßnahmen <strong>der</strong> Qualitätssicherung, Preis und Vertragstr<strong>an</strong>s‐<br />
parenz, Raumst<strong>an</strong>dards und Betreuungsqualität.<br />
C124 C XXXVI<br />
C154<br />
C XXXI
Versorgungssektoren übergreifende Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Notwendigkeit einer Reform <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isationsformen, die die Sektoren Gesundheitsför<strong>der</strong>ung/Prävention, Kuration und<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Rehabilitation gleichstellen bzw. nahtlos mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> verknüpfen aufgrund einer zunehmenden Multimorbidität im Alter.<br />
Zunehmende Mehrbelastung ambul<strong>an</strong>ter, stationärer, ärztlicher und pflegerischer Nachsorgestrukturen wegen des Rückg<strong>an</strong>gs <strong>der</strong> Ver‐<br />
B48, B138, C48 C XXXVII<br />
weildauer durch die AR‐DRG’s sowie zunehmende Bedeutung eines regional abgestimmten Pflege<strong>an</strong>gebots.<br />
Zunehmende Bedeutung von Kooperation und Vernetzung: zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Sicherstellung von Versorgungsgestaltung,<br />
C102, C160<br />
C XXXVIII<br />
Sicherung von Versorgungsintegration und ‐kontinuität, zunehmende Bedeutung von integrativen Modellprojekten im Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit einem Schnittstellenm<strong>an</strong>agement.<br />
C68, C149<br />
C XXXIX<br />
Org<strong>an</strong>isations‐ und Personalentwicklungstrends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Pflege als übergeordnetes Ziel‐ und Wertvorstellung, zunehmen‐<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
de Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit betriebswirtschaftlichen und M<strong>an</strong>agement<strong>an</strong>sätzen für die Pflege (Verbetriebswirtschaftlichung <strong>der</strong> Pfle‐<br />
ge), dadurch zunehmende Bedeutung von Kundenorientierung, pflegespezifischer Leitbildentwicklung, Qualitätsm<strong>an</strong>agement‐<br />
Konzepten sowie des operativen und strategischen Controllings.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Ablösung <strong>der</strong> Funktionspflege durch Bezugspflege, zunehmende Bedeutung eines Care‐M<strong>an</strong>agements, um<br />
C66<br />
C XL<br />
Drehtüreffekte zu vermeiden, zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Pflegeüberleitung, zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Schulung und Beratung des<br />
Pflegebedürftigen.<br />
Zunehmende Bedeutung des Bildungs‐ und Wissensm<strong>an</strong>agements als Aufgabe <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isationsentwicklung, Weiterentwicklung von<br />
C67, C107, C149 C XLI<br />
Weiterbildungskonzepten unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Reformen im Erstausbildungsbereich. C149, C163<br />
C XLII<br />
Zunehmende Bedeutung eines Gesundheitsschutzes für Mitarbeiter im Bereich <strong>der</strong> Mängelfreiheit von Betrieben.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Kooperation und professionsübergreifen<strong>der</strong> Zusammenarbeit, zunehmende Bedeutung<br />
C29 C XLIII<br />
einer Ausweitung des Aufgabenspektrums und –zuschnitts <strong>der</strong> Kompetenzgrenzen von Pflege. C149<br />
C XLIV<br />
Zunehmende Bedeutung einer aussagekräftigen Personalst<strong>an</strong>ds‐ Datenerhebung und Dokumentation. C146 C XLV<br />
CXXXIX
D. MEGATRENDS DES SOZIALEN WANDELS<br />
Gesamtgesellschaftlich‐/demografisch bedingte Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung von Globalisierung, wirtschaftlicher Beziehungen und Individualisierungsprozessen, die zu strukturellen und<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Werte w<strong>an</strong>delnden Prozessen führen (<strong>der</strong> Mythos <strong>der</strong> „Individualisierungstheorie“ k<strong>an</strong>n allerdings we<strong>der</strong> für Jung noch für Alt bestätigt<br />
werden).<br />
Zunehmende Bedeutung und Zunahme <strong>der</strong> Einpersonenhaushalte, dadurch Rückg<strong>an</strong>g des (Laien) Pflegepotentials. Zunahme alleinste‐<br />
D76, D108<br />
D I<br />
hen<strong>der</strong> Älterer von 7,8 Mio auf 13,2 Mio (Prognose 2030) sowie Zunahme kin<strong>der</strong>loser Frauen und Männer; damit ist eine Abnahme des<br />
familiären Hilfepotentials verbunden.<br />
Zunehmende Bedeutung des „Moral Hazards“. Hierbei sind beson<strong>der</strong>s die steigenden Ansprüche <strong>an</strong> menschen‐ und altersgerechter<br />
D1, D42, D129<br />
D II<br />
Versorgung und Enthospitalisierung zu nennen. D42, D65<br />
D III<br />
Trends eines sich verän<strong>der</strong>nden Altersbildes<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung einer Betonung <strong>der</strong> Pflege des Hum<strong>an</strong>vermögens. Um die Überlebensfähigkeit <strong>der</strong> Kultur einer Gesellschaft zu<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
sichern, ist die zunehmende Ver<strong>an</strong>twortung <strong>der</strong> Älteren für die Zukunft <strong>der</strong> Gesellschaft zu betonen.<br />
Zunehmende Bedeutung einer Inszenierung eines gesellschaftlichen und professionellen Leitbilds vom „erfolgreichen Altern“.<br />
D122<br />
D IV<br />
Hier liegt die Betonung auf Selbstständigkeit, sozialer Bezogenheit und Selbstver<strong>an</strong>twortung im Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Eigenver<strong>an</strong>twor‐ D88, D89, D121, D V<br />
tung für Prävention.<br />
Zunehmen<strong>der</strong> Forschungsbedarf im Hinblick auf Methoden, die eine Verhaltensän<strong>der</strong>ung bei älteren Menschen in Bezug auf ein<br />
D132<br />
partizipatives und selbstver<strong>an</strong>twortliches Altersbild hervorrufen. D90<br />
D VI<br />
CXL
Sozio‐kulturelle Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung von Alter und Migrationsressourcen sowie zunehmende Bedeutung innerethnischer Potentiale für<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
gemeinwesenorientierte und generationübergreifende H<strong>an</strong>dlungskonzepte D127<br />
D VII<br />
Zunehmende Bedeutung spezifisch kultureller Hintergründe älterer Migr<strong>an</strong>ten in stationären Altenhilfeeinrichtungen D128 D VIII<br />
Sozial‐ und gesundheitspolitische Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Gesundheits‐ und Sozialpolitik im Hinblick auf ein Altern in Gesundheit und Kr<strong>an</strong>kheit. Hier ist die Beto‐<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
nung einer zukunftsorientierten, vorausschauenden und risikomin<strong>der</strong>nden Gesundheitspolitik sowie die zunehmende Bedeutung interdis‐<br />
ziplinärer und politischer Perspektiven auf Gesundheit und Kr<strong>an</strong>kheit hervor zu heben.<br />
D46, D47, D49<br />
D IX<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Vereinbarkeit von Pflege‐ und Erwerbstätigkeit<br />
Zunehmende Bedeutung von Verteilungsaspekten und Ungleichheit von Gesundheitsch<strong>an</strong>cen sowie dem Zielbereich <strong>der</strong> Lebensquali‐<br />
D126 D X<br />
tät. Hier ist beson<strong>der</strong>s die zunehmende Beherrschung <strong>der</strong> Diskussionen um Reformvorschläge durch ideologisch‐gesellschaftspolitische<br />
St<strong>an</strong>dpunkte wegen vermehrt sozialer Sp<strong>an</strong>nungen zu betonen.<br />
D41, D82<br />
D XI<br />
CXLI
Lebenslageabhängige W<strong>an</strong>dlungsphänomene und Trends<br />
Trends im Bereich sozialer Teilhabe und Vernetzung<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung erweiterter sozialer Netzwerke wegen <strong>der</strong> zunehmenden Anzahl kin<strong>der</strong>loser Frauen und Männer.<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Hier steht v. a. Dingen die Abnahme des Hilfepotentials im Vor<strong>der</strong>grund, die Bedeutung <strong>der</strong> Familie als wichtigstes Fundament für ein<br />
hum<strong>an</strong>es Zusammenleben <strong>der</strong> Generationen bleibt allerdings bestehen, dafür nimmt die Bedeutung des Zusammenlebens in räumlicher<br />
Nähe – ohne dabei die Eigenständigkeit aufzugeben – zu.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> sozialen Netzwerke und <strong>der</strong> Erreichbarkeit <strong>der</strong> Menschen unterein<strong>an</strong><strong>der</strong> sowie zunehmende Bedeutung<br />
D129<br />
D XII<br />
<strong>der</strong> Kopplung sozialer und räumlicher Netzwerke. Hierbei ist eine zunehmende Bedeutung von Infrastrukturkonzepten zur Unterstützung<br />
von Hilfeleistungen hervorzuheben.<br />
D108, D126, D130 D XIII<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verbindung von Teilhabe, Nutzung von Teilhabe und Mitsprache in Form von Heimbeiräten, Patientenver‐<br />
tretern aus <strong>der</strong> Nutzerperspektive.<br />
D93 D XIV<br />
Zunehmende Bedeutung von nutzerorientierten Informations‐ und Kommunikationsplattformen (z. B. Internetplattformen) D101 D XV<br />
Lebensform‐/wohnbezogene Trends<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> Verschiedenartigkeit von Lebensbedingungen und Lebensformen im Alter.<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
Hierbei dominiert die zunehmende Bedeutung einer entsprechenden Bedarfsorientierung sowohl bei Heimen als auch bei betreuten<br />
Wohnformen vor dem Hintergrund eines Umdenkens und einer Neubestimmung von Son<strong>der</strong>formen hin zum normalen Wohnen.<br />
Zunehmende Bedeutung von selbstständigen Wohnformen jüngerer Alter. Mit entsprechend <strong>an</strong>tizipieren<strong>der</strong> Konzeption <strong>der</strong> Beschaf‐<br />
D120, D121, D123 D XVI<br />
fenheit <strong>der</strong> Wohnform bei evtl. drohen<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit. D118<br />
D XVII<br />
Zunehmende Bedeutung des Bedarfs <strong>an</strong> beson<strong>der</strong>en Wohnformen. D117 D XVIII<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Wohnformen, die geringen Hilfebedarf umfassen.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Wohnformen mit umfassen<strong>der</strong> Hilfestellung, die <strong>der</strong> Vereinsamung entgegen wirken und auf Selbstbe‐<br />
D120 D XIX<br />
stimmung statt Selbstständigkeit setzen. D120<br />
D XX<br />
Zunehmende Bedeutung von Mehrgenerationenarbeit (z. B. Mehrgenerationenbildung und ‐wohnen) D107 D XXI<br />
CXLII
Trends im Bereich des Bildungs‐ und sozioökonomischen Status<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Lebenslage unter Einbezug von Bildungsbiografie und sozialer Schicht, wachsende Bedeutung von Bildung<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
und Gesundheit und zunehmende Bedeutung des Zusammenh<strong>an</strong>gs von Bildung und gesundheitsför<strong>der</strong>ndem Verhalten.<br />
Zunehmende Bedeutung verbesserter fin<strong>an</strong>zieller Möglichkeiten <strong>der</strong> älteren Bevölkerung<br />
D1, D8, D90<br />
D XXII<br />
Hierbei gewinnt <strong>der</strong> sozioökonomische Status im Hinblick auf den Gesundheitszust<strong>an</strong>d zunehmend <strong>an</strong> Bedeutung, da eine Verlagerung<br />
von Gesundheitsleistungen vermehrt in den Selbstbeh<strong>an</strong>dlungsbereich stattfindet.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Beschreibung sozialer und ökonomischer Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />
D45, D94<br />
D XXIII<br />
Hierbei spielt die zunehmende Bedeutung von vulnerablen Zielgruppen i. H. auf Ausgestaltung von Zug<strong>an</strong>gswegen und Interventionen<br />
sowie die Bedeutung <strong>der</strong> Verteilungsgerechtigkeit eine immer größere Rolle.<br />
D4, D45, D89<br />
D XXIV<br />
Beruflich/professionelle W<strong>an</strong>dlungsphänomene<br />
Titel des Megatrends<br />
Zunehmende Bedeutung des Überg<strong>an</strong>gs <strong>der</strong> Pflege von einem traditionellen Helferberuf in eine mo<strong>der</strong>ne Gesundheitsprofession. Hier‐<br />
Befundnummer Megatrendnummer<br />
bei nehmen die Professionalisierung aufgrund von Innovationen, <strong>der</strong> abnehmenden Halbwertszeit von Wissen, die sich w<strong>an</strong>delnden Kon‐<br />
texte und Versorgungsstrukturen sowie die sich verän<strong>der</strong>nde (partizipierende) Rolle <strong>der</strong> Patienten eine große Bedeutung ein.<br />
Zunehmende Bedeutung akademischer Ausbildung und Weiterqualifizierung und akademische Nachwuchsför<strong>der</strong>ung. Hierbei kommt<br />
D95, D99<br />
D XXV<br />
<strong>der</strong> Einrichtung pflegequalifizieren<strong>der</strong> Studiengängen <strong>an</strong> Fachhochschulen und Universitäten, einer Verbesserung <strong>der</strong> Wissenschafts‐ und<br />
Forschungsför<strong>der</strong>ungsinfrastruktur sowie nationalen und internationalen Forschungsverbünden eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> De‐ Professionalisierung in den Gesundheitsberufen sowie einer noch unzureichenden Durchlässigkeit <strong>der</strong><br />
D29, D98, D164 D XXVI<br />
Pflegebildungsstrukturen. Hierbei spielt die Son<strong>der</strong>stellung <strong>der</strong> Pflegebildung im Bildungssystem, überholte Ausbildungsinhalte, unzurei‐<br />
chend qualifizierte Dozenten sowie die Trennung gesundheits‐ und sozialpflegerischer Ausbildung eine maßgebliche Rolle.<br />
Zunehmende Bedeutung <strong>der</strong> Verbesserung von Fort‐ und Weiterbildung in <strong>der</strong> Geriatrie und Zunehmende Bedeutung neuer berufe und<br />
D97<br />
D XXVII<br />
Tätigkeitsfel<strong>der</strong> im Zusammenh<strong>an</strong>g mit dem älteren Menschen. Hierbei kommt bezugspflegerischen Erkenntnissen beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> D48, D76, D95, D XXVIII<br />
Altenpflege sowie <strong>der</strong> zunehmenden, st<strong>an</strong>dardisierten berufsbegleitenden Sicherung von aktuell erfor<strong>der</strong>lichen Qualifikationen eine be‐<br />
son<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />
D66<br />
Zunehmende Bedeutung des Hilfeleistungspotentials und die Einsicht, dass das <strong>Die</strong>nen in einer <strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft ebenfalls zu<br />
den Schlüsselqualifikationen sowohl für Frauen als auch für Männer gehört.<br />
D126 D XXIX<br />
CXLIII
Anlage D: Forschungsprotokoll Zeitschriften- und Frequenz<strong>an</strong>alyse<br />
<strong>Die</strong> rot markierten Artikel (Spalte „Titel des Beitrags“) wurden aus <strong>der</strong> Analyse ausgeschlossen, da darin keiner <strong>der</strong> Megatrends korrespondierte.<br />
CXLIV
Lfd.<br />
Art.nr.<br />
Zeitschrift Ausgabe/<br />
Jahr/<br />
Seiten<br />
1 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
(Juventa)<br />
1/1999/<br />
1−7<br />
2 3/1999/<br />
65−68<br />
3 2/2000/<br />
33−36 (5)<br />
4 2/2000/<br />
37−41 (5)<br />
5 2/2000/<br />
42−53 (5)<br />
6 3/2000/<br />
82−88 (5)<br />
7 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
4/2000/<br />
95−100 (5)<br />
Autor Titel des Beitrags Textmodus/ Methode<br />
Vesperm<strong>an</strong>n, S. Qualitätsm<strong>an</strong>agement nach Normen<br />
<strong>der</strong> DIN ISO 9000-Familie –<br />
Eine Methode zur Qualitätssiche-<br />
rung in <strong>der</strong> Pflege?<br />
Schnell, M. W. Der Patient als Kunde? Genealogische<br />
Bemerkungen zu einem<br />
ethisch-ökonomischen Zwitter<br />
Schaeffer, D. Versorgungsintegration und<br />
-kontinuität. Implikationen für eine<br />
prioritär ambul<strong>an</strong>te Versorgung<br />
chronisch Kr<strong>an</strong>ker<br />
Ewers, M. Häusliche Infusionstherapie (HIT):<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für Pflege und<br />
Public Health in Wissenschaft und<br />
Müller-Mundt, G.<br />
Schaeffer, D.<br />
Pleschberger, S.<br />
Brinkhoff, P.<br />
Plenter, C.<br />
Uhlm<strong>an</strong>n, B.<br />
Praxis<br />
Patientenedukation – (k)ein zentrales<br />
Thema in <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong><br />
Pflege?<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Trauerarbeit für<br />
Angehörige durch Aufbahrung<br />
und Verabschiedung von Verstorbenen<br />
– ein Ziel professioneller<br />
Pflege? Vorstellung einer Evaluationsstudie<br />
zur Ermittlung <strong>der</strong><br />
Auswirkungen von pflegerischer<br />
Aufbahrungsarbeit im Gemein-<br />
schaftskr<strong>an</strong>kenhaus Herdecke<br />
Winkler, T. Leistungsgerechte Pflegesätze im<br />
Bereich "Stationärer Altenhilfe"<br />
Expertenaufsatz Qualitätsm<strong>an</strong>agement,<br />
-systeme (ISO-<br />
Normen), Audits und<br />
Phil. Expertenaufsatz<br />
Themen/Keywords Ebene Mega<br />
trend<br />
kategorie<br />
Zertifizierung<br />
Patient, Kundenidee,<br />
Genealogie <strong>der</strong> Moral,<br />
Gerechtigkeit<br />
Expertenaufsatz Begrenzung des Kr<strong>an</strong>kenhaussektors,ambul<strong>an</strong>te<br />
Pflege und<br />
Versorgungsintegration,<br />
Integration und<br />
Unterstützung pflegen-<br />
<strong>der</strong> Angehöriger<br />
Expertenaufsatz Häusliche Infusionstherapie<br />
und Patientengruppen,<br />
High-Tech<br />
Lehrpl<strong>an</strong>- und<br />
Lehrbuch-, Zeitschriften<strong>an</strong>alyse<br />
Literaturrecherche,<br />
qualitative Befragung<br />
mit qu<strong>an</strong>titativen<br />
Anteilen<br />
Home Care<br />
Pflegeberatung, Patientenedukation,Ausbildungsgegenst<strong>an</strong>d<br />
in<br />
<strong>der</strong> Pflege<br />
Umg<strong>an</strong>g mit Verstorbenen,<br />
Aufbahrungspraxis<br />
Expertenaufsatz St<strong>an</strong>dard- Pflegesatz-<br />
Modell, Entgelt-<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Ergebnisse Frequenz<strong>an</strong>alyse(Korrespondierende<br />
Megatrends/<br />
Artikelseite)<br />
ÖW CXIX (5)<br />
Metaebene ÖW keine<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Klinischpraktische<br />
und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationalpädagogische<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationalpädagogische<br />
Ebene<br />
Metaebene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B III (33), B XXIV<br />
(35), C XXV, C<br />
XXVII, C XXIX (34<br />
f.), C XXXVII (33), C<br />
XXXIX, C XLI (35),<br />
C XLIV (36)<br />
B I, B XXX, B<br />
XXXVI (37 f.), C<br />
XXVII (38)<br />
B XXXIX (43 f.), C<br />
XLI (44), DXXV (42<br />
f.)<br />
SW DXXV (87)<br />
ÖW<br />
C XX, C XXI (95 f.)<br />
CXLV
8 4/2000/<br />
101−104 (5)<br />
9 4/2000/<br />
105−09 (5)<br />
10 4/2000/<br />
110−122 (5)<br />
11 1/2002<br />
1−20<br />
12 3/2002<br />
95−102<br />
13 2/2003<br />
68−73<br />
nach dem Pflegeversicherungsgesetz<br />
– Eine kritische Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
mit dem „St<strong>an</strong>dard-<br />
Pflegesatz-Modell“<br />
Gennrich, R. Ergebnisse <strong>der</strong> wissenschaftlichen<br />
Begleitung des Verfahrens<br />
PLAISIR<br />
Bartholomeyczik,<br />
S.<br />
Hunstein, D.<br />
Erfor<strong>der</strong>liche Pflege – zu den<br />
Grundlagen einer Personalbemessung<br />
Reisach, B. <strong>Die</strong> jap<strong>an</strong>ische Pflegeversicherung<br />
Darstellung und Überlegungen<br />
aus bundesdeutscher Perspektive<br />
Hallensleben, J. Pflegequalität auf dem Prüfst<strong>an</strong>d.<br />
Neue Regelungen zur Qualitätssicherung<br />
und zur Stärkung des<br />
Verbraucherschutzes im SGB XI<br />
und im Heimgesetz<br />
Br<strong>an</strong>denburg, H. Das Resident Assessment Instrument<br />
(RAI): Ausgewählte<br />
empirische Befunde und Konsequenzen<br />
für die pflegewissenschaftliche<br />
Diskussion in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d<br />
Arens, F. „Lebensweltlich-kommunikatives<br />
H<strong>an</strong>deln“<br />
Ein Ansatz zur Situationsbewältigung<br />
zwischen Pflegenden und<br />
dementierenden alten Menschen?<br />
Vergütung, SGBXI<br />
Evaluationsstudie Qualitätsst<strong>an</strong>dards,<br />
Leistungsst<strong>an</strong>dards<br />
und -sprache, Perso-<br />
nalbedarf (PLAISIR)<br />
Expertenaufsatz Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit,erfor<strong>der</strong>liche<br />
Pflege,<br />
PLAISIR<br />
Expertenaufsatz Altenpflege und Familie,<br />
demografischer<br />
W<strong>an</strong>del, Jap<strong>an</strong>ische<br />
Situation , Pflegebedürftigkeit<br />
und Pflegeversicherung<br />
Expertenaufsatz Pflegeversicherung,<br />
SGB XI, Heimgesetz,<br />
Pflegequalität,<br />
Heimbewohnerschutz,<br />
MDK, Demenz<br />
Literaturstudie RAI, Hintergrund ,<br />
Möglichkeit und Grenzen,Forschungsbefunde <br />
Qualitativethnologische<br />
Untersuchung<br />
Dementierende alte<br />
Menschen, Situationsbewältigung,Kommunikation,<br />
Lebenswelt<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
SW<br />
B XXXII (101 f.), C<br />
XVI (103 f.), C XL<br />
(104)<br />
B XXXII, C XL (105<br />
f.)<br />
A II, A III, A IV (110<br />
f.),<br />
B XIX (116 f.), B<br />
XXXVI (119),<br />
C XXV (112),<br />
C XX (117), D IV, D<br />
VII (110)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(17),<br />
C XV (12 f.), CXVI,<br />
C XIX(14),<br />
C XXI, CXLI (14 f.),<br />
DXIV (14 f.), D XXV<br />
(18)<br />
B XXV (95), C XXIV<br />
(100 f.),<br />
C XLIV (101)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(68),<br />
D XXV, D XXVIII<br />
(72)<br />
CXLVI
14 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
3/2003<br />
91−96<br />
15 3/2003<br />
97−100<br />
16 3/2003<br />
101−104<br />
17 3/2003<br />
112−116<br />
18 3/2003<br />
118−122<br />
19 1/2004<br />
6−11<br />
20 4/2004<br />
138−146<br />
21 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
1/2005<br />
20−22 (10)<br />
Görres, S.<br />
Bohns, S.<br />
Stöver, M.<br />
Krippner, A.<br />
Modellprojekt »Integrierte Pflegeausbildung<br />
in Bremen«<br />
Becker, W. Integrierte Ausbildung von Kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
und Altenpflege: Pflege<br />
neu denken reicht nicht aus – es<br />
muss auch <strong>an</strong><strong>der</strong>s qualifiziert<br />
werden!<br />
Konzept eines neuen Ausbil-<br />
Koeppe, A., Müller,<br />
K<br />
Sieger, M.<br />
Schönlau, K<br />
dungsg<strong>an</strong>gs in Br<strong>an</strong>denburg<br />
Modellversuch zur Entwicklung<br />
und Erprobung eines Praxis-<br />
Curriculums für die integrierte<br />
Berufsausbildung von Kr<strong>an</strong>kenpflege,<br />
Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege und<br />
Altenpflege<br />
Pflege in Ver<strong>an</strong>twortung<br />
– ein bildungstheoretisch orientiertes<br />
Curriculum für eine integrierte<br />
Pflegeausbildung<br />
Zeuner, M. Integrative Ausbildung für Pflegefachberufe<br />
mit gleichzeitiger<br />
Vorbereitung auf die Fachhoch-<br />
Schulte-Steinicke,<br />
B.<br />
schulreife<br />
Erinnern, Schreiben, Bewahren:<br />
Kreatives Schreiben mit Seniorinnen<br />
und Senioren<br />
Hallensleben, J. 10 Jahre Pflegeversicherung –<br />
Ein Blick zurück in die Zukunft<br />
H<strong>an</strong>ns, S.<br />
Kuske, B.<br />
Riedel-Heller, S.<br />
Behrens, J.<br />
Entwicklung und Evaluation eines<br />
Trainingsprogramms für das Pflegepersonal<br />
in Altenpflegeheimen<br />
zum Umg<strong>an</strong>g mit Demenzkr<strong>an</strong>ken<br />
Projektbericht Altenpflege, Kr<strong>an</strong>ken-<br />
und Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
gemeinsam ausbil-<br />
Ausbildungskonzeptvorstellung <br />
den<br />
Altenpflege, Ausbildungsqualität,<br />
Pflege<br />
neu denken<br />
Projektbericht Altenpflege, Kr<strong>an</strong>ken-<br />
und Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
gemeinsam ausbilden,<br />
Praktische Ausbildung<br />
Curriculum-<br />
Entwicklungsbericht <br />
Ausbildungskonzeptvorstellung<br />
Altenpflege, Kr<strong>an</strong>ken-<br />
und Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
gemeinsam ausbilden.<br />
Curriculum, Didak-<br />
tik<br />
Altenpflege, Kr<strong>an</strong>ken-<br />
und Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
gemeinsam ausbil-<br />
den; Modellprojekt<br />
Praxisbericht Junges Alter, Erinnerungsarbeit,<br />
kreatives<br />
Schreiben<br />
Expertenaufsatz Pflegeversicherung,<br />
Sozialpolitik, Fin<strong>an</strong>zierung,Gesundheitspolitik <br />
R<strong>an</strong>domisiertkontrollierteInterventionsstudie<br />
Kommunikation, Demenz,<br />
Pflegepersonal,<br />
Altenpflegeheim<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isational-<br />
pädagogische<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isational-<br />
pädagogische<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Praktische Ebene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
B XL, C XIII, C<br />
XXIII,<br />
D XXV (91 f.)<br />
B XXXIX, B XL, C<br />
XIII, C XXIII, D<br />
XXV, DXXVIII (97 f.)<br />
B XL, C XIII, C<br />
XXIII,<br />
D XXV (101f.)<br />
B XL, C XIII, C<br />
XXIII, D XXV (112<br />
f.)<br />
B XXXIX, B XL, C<br />
XIII, C XXIII, D<br />
XXV (118 f.)<br />
B XVII, B XXVII<br />
(6f.), D VI, D IV, D<br />
VI (6), D XXII (6), D<br />
XXIV (11)<br />
C XX, D IX (138 f.)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(21),<br />
D XXV, D XXVIII<br />
(21 f.)<br />
CXLVII
22 1/2005<br />
26−27 (10)<br />
23 1/2005<br />
34−37 (10)<br />
24 1/2005<br />
37−39 (10)<br />
25 1/2005<br />
41−44 (10)<br />
26 1/2005<br />
50−51<br />
(10)<br />
27 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
1/2005<br />
52−53 (10)<br />
28 1/2005<br />
60−61<br />
Angermeyer, M.C.<br />
Wilz, G.<br />
Angermeyer, M.C.<br />
Geister, C.<br />
Küssner, C.<br />
& Kalytta, T.<br />
Rothg<strong>an</strong>g, H.<br />
Borchert, L.<br />
Knorr, K.<br />
Meyer, G.<br />
Köpke, S.<br />
Mühlhauser, I.<br />
Meyer, G.<br />
Köpke, S.<br />
& Mühlhauser, I.<br />
Naegele, G.<br />
Schönberg, F.<br />
Schulz-<br />
Hausgenoss, A.<br />
För<strong>der</strong>ung un Unterstützung <strong>der</strong><br />
familiären Pflege – Schulung<br />
professioneller Berater und Pflegekräfte<br />
in <strong>der</strong> Durchführung<br />
eines therapeutischen Angehörigenberatungskonzepts<br />
sowie<br />
die Evaluation <strong>der</strong> therapeuti-<br />
schen Effekte <strong>der</strong> Interventionen<br />
Individuelle Pflegeverläufe älterer<br />
Menschen<br />
und ihre Determin<strong>an</strong>ten<br />
Mobilitätsrestriktionen in Alten-<br />
und Pflegeheimen:<br />
eine multizentrische Beobachtungsstudie<br />
Effizienz pflegerischer Einschätzung<br />
im Vergleich zu empfohlenen<br />
Testinstrumenten zur Vorhersage<br />
des Sturzrisikos in Alten-<br />
und Pflegeheimen<br />
Entwicklung und Evaluation eines<br />
Instruments zur Erfassung des<br />
»patient view« von Demenzkr<strong>an</strong>ken<br />
in vollstationären Pflegeeinrichtungen<br />
als Grundlage für eine<br />
Ressourcen erhaltende Pflege<br />
Wingenfeld, K. Selbst- und fremdgefährdendes<br />
Verhalten bei psychisch verän<strong>der</strong>ten<br />
Heimbewohnern als Pflegeproblem:<br />
Dimensionen, Assessment<br />
und Interventionskonzepte<br />
Bär, M.<br />
Böggem<strong>an</strong>n, M.<br />
Demenzkr<strong>an</strong>ke Menschen in<br />
individuell bedeutsamen Alltagssi-<br />
Prospektive r<strong>an</strong>domisiertkontrollierteInterventionsstudie<br />
Sekundär<strong>an</strong>alyse<br />
von Pflegekassendaten <br />
Beobachtungsstudie<br />
mit qualitativem<br />
Teil (Interviews)/Projektbe-<br />
richt <br />
Clusterr<strong>an</strong>domisiertekontrollierteStudie/<br />
Projektbericht<br />
Tri<strong>an</strong>gulierte Studie<br />
aus narrativen<br />
Interviews und<br />
Fragebogenerhebung/Projektbericht <br />
ProspektivempirischeVerlaufsstudie<br />
mit vier<br />
Messzeitpunkten/<br />
Projektbericht<br />
Interventionsstudie/<br />
Projektbericht<br />
Demenz, pflegende<br />
Angehörige, Bewältigungsmech<strong>an</strong>ismen,<br />
Interventionsprogramm<br />
Dynamik und Determin<strong>an</strong>ten<br />
von Pflegeverläufen,<br />
geriatrische<br />
Rehabilitation<br />
Alten- und Pflegeheime,<br />
Fixierung, Bewegungseinschränkung<br />
Sturzgefährdung,<br />
-einschätzung, -risiko,<br />
Alten- und Pflegeheim<br />
Altenheim, Demenz,<br />
evidenzbasierte Grundlagen,Versorgungssituation<br />
Psychische Störung als<br />
Folge von Demenz,<br />
selbst- und fremdgefährdendes<br />
Verhalten,<br />
präventiv-orientierte<br />
Pflege von Bewohnern<br />
Versorgung bei Demenz,<br />
Wohlbefinden,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinisch-<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXIV, D XXVIII<br />
(26)<br />
B XII, B XXIII (34<br />
f.), C XX, C XXIV<br />
(36)<br />
EW B VIII, B XIX, B XX,<br />
B XXI (37 f.)<br />
EW B XXVI (41)<br />
EW B VIII, B XIX, B XII,<br />
B XX, BXXVII (50)<br />
DW<br />
EW<br />
EW<br />
ÖW<br />
A IV (52), B VIII, B<br />
XIX, B XX (52)<br />
B VIII, B XIX, B XX,<br />
B XXVII (60), C XVI<br />
CXLVIII
29 2/2005<br />
75−82<br />
30 2/2005<br />
83−89<br />
31 2/2005<br />
90−96<br />
32 2/2005<br />
97−102<br />
33 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
(10) Kruse, A. tuationen – Entwicklung einer<br />
Methode zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lebensqualität<br />
durch Stimulierung<br />
2/2006<br />
141−150<br />
34 3/2006<br />
223−239<br />
positiver Emotionen<br />
Schwerdt, R. Probleme <strong>der</strong> Ernährung älterer<br />
Menschen mit Demenz: Aktueller<br />
Forschungs- und Entwicklungsbedarf<br />
Bräutigam, C.<br />
Bergm<strong>an</strong>n-<br />
Tyacke, I.<br />
Rustemeier-<br />
Holtwick, A.<br />
Schönlau, K.<br />
Sieger, M.<br />
Weyerer, S.<br />
Schäufele, M.<br />
Hendlmeier, I.<br />
Hallensleben, J.<br />
Jaskulewicz, G.<br />
Verstehen statt Etikettieren: Ein<br />
professioneller Zug<strong>an</strong>g zur Situation<br />
von Pflegebedürftigen mit<br />
Demenz in kommunikativ schwierigen<br />
Situationen<br />
Lebens- und Betreuungsqualität<br />
demenzkr<strong>an</strong>ker Menschen in <strong>der</strong><br />
beson<strong>der</strong>en stationären Betreuung<br />
in Hamburg: Segregative und<br />
teilsegregative Versorgung im<br />
Vergleich<br />
Begleitforschung für ambul<strong>an</strong>t<br />
betreute Wohn-<br />
gemeinschaften für demenzkr<strong>an</strong>ke<br />
Menschen<br />
Haux, E. Erfolge und Probleme bei <strong>der</strong><br />
Gutachtertätigkeit: Begutachtung<br />
von Menschen mit Demenz<br />
Dörpinghaus, S. Evaluation von Pflegekursen:<br />
Stärken und Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Lebensqualität praktische Ebene<br />
Expertenaufsatz Ernährungsproblematik<br />
bei Menschen mit Demenz,Assessmententwicklung,Ernährungsm<strong>an</strong>agement, <br />
Leitfadenentwicklung<br />
Qu<strong>an</strong>titative Evaluationsstudie <br />
L<strong>an</strong>gzeitverlaufsbegleitstudie<br />
(tri<strong>an</strong>guliert)<br />
Fallbesprechungen<br />
Verstehen von Menschen<br />
mit Demenz,<br />
professionelle Wahrnehmung,<br />
Empathie<br />
Integrative und<br />
segregative Versorgungsform,<br />
Menschen<br />
mit Demenz, Altenheim,<br />
Antidepressiva<br />
Demenzkr<strong>an</strong>ke Menschen,Wohngemeinschaft<br />
Expertenaufsatz Pflegebedürftigkeit,<br />
Alltagskompetenz, pflegende<br />
Angehörige, personenzentrierter<br />
Ansatz<br />
nach Kitwood, Begutachtungsrichtlinien<br />
Evaluationsstudie Pflegende Angehörige,<br />
Pflegekurse nach §45<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinisch-<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
(60)<br />
B VIII, B XIX, B XX,<br />
B XXIV, B XXV<br />
(75),<br />
D XXV, D XXVIII<br />
(79 f.)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(83),<br />
D XXV, D XXVIII<br />
(86 f.)<br />
B VII, B VIII, B XIX,<br />
B XX, B XXIII,<br />
B XXXIII, B XXXIV,<br />
B XXXV (90 f.), C<br />
XXXIV (90)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(97 f.),<br />
B XXIII, B XXVII,<br />
B XXXIII, B XXXIV<br />
(99), C XXXV, C<br />
XXXVI (97)<br />
A III, A IV (141), B<br />
VIII,<br />
B XIX, B XX, B XXII<br />
(141 f.),<br />
B XXIII, B XXIV<br />
(146f.), B XXV (143<br />
f.), B XXVII (148), C<br />
XXIX (150)<br />
B XVIII, B XXIV<br />
(224 f.),<br />
CXLIX
35 3/2006<br />
267−274<br />
36 3/2007<br />
197−209<br />
37 3/2007<br />
210−226<br />
38 3/2007<br />
227−239<br />
39 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
3/2007<br />
263−275<br />
40 4/2007<br />
318−329<br />
Schmidt, K-H.;<br />
Neubach, B.<br />
Zusammenhänge von körperlichen<br />
und psychischen Beeinträchtigungen<br />
mit Fehlzeiten und<br />
<strong>der</strong> Fluktuationsneigung bei Al-<br />
tenpflegekräften<br />
Larsen, C. Nebenwirkungen von Innovationen<br />
auf dem Pflegearbeitsmarkt:<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Arbeitsmarktch<strong>an</strong>cen<br />
von Altenpfleger/innen<br />
durch Prozessinnovationen in<br />
Kr<strong>an</strong>kenhäusern<br />
Twenhöfel, R. <strong>Die</strong> Altenpflege im Zugriff <strong>der</strong><br />
Disziplinen. Paradoxien und Perspektiven<br />
Blinkert, B. Bedarf und Ch<strong>an</strong>cen. <strong>Die</strong> Versorgungssituation<br />
pflegebedürftiger<br />
Menschen im Prozess des demografischen<br />
und sozialen W<strong>an</strong>dels<br />
Kolleck, B. Kultursensible Pflege in ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflegediensten<br />
Heusinger, J. Freundin, Expertin o<strong>der</strong> <strong>Die</strong>nstmädchen<br />
– zu den Auswirkungen<br />
SGBXI, Gruppenschu- praktische Ebelungne<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhe- Körperliche und seeli- Org<strong>an</strong>isationale<br />
bung(Korrelatische Be<strong>an</strong>spruchung Ebene<br />
onsstudie)<br />
bei Pflegetätigkeit,<br />
Altenpflegekräfte, Fluktuationsneigung<br />
Expertenaufsatz Pflegearbeitsmarkt, Metaebene und<br />
Verdrängungswettbe- org<strong>an</strong>isationale<br />
werb, arbeitslose Altenpfleger/innen,arbeitslose<br />
Gesundheits- und<br />
Kr<strong>an</strong>kenpfleger/innen<br />
(ab hier: wie im Text)<br />
Ebene<br />
Expertenaufsatz Altenpflege, Sorge, Metaebene und<br />
Konflikt, Pflege, Pro- org<strong>an</strong>isationale<br />
fession,<strong>Pflegewissenschaft</strong>, Qualität, Qualitätskriterium<br />
Ebene<br />
Begleitaufsatz zu Pflege, Pflegebedürf- Metaebene und<br />
Forschung über tigkeit,demographi- org<strong>an</strong>isationale<br />
Pflegebudget scher W<strong>an</strong>del, sozialer<br />
W<strong>an</strong>del, Netzwerke<br />
Ebene<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
Leitfadengestützte<br />
Interviews<br />
Migration (im Alter),<br />
Interkulturalität, Ethnizität,<br />
Konflikt, Umg<strong>an</strong>gsform,<br />
Verständigung,<br />
Sprache, Kr<strong>an</strong>kheitsverständnis,Compli<strong>an</strong>ce,<br />
Ausbildung, Vernetzung<br />
Soziale Milieus, Häusliche<br />
Pflegearr<strong>an</strong>ge-<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinisch-<br />
SW C XXXIX (225), D X<br />
(239)<br />
ÖW C XI, C XIV (268)<br />
ÖW C XI, C XIII (198)<br />
ÖW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
SW<br />
DW<br />
ÖW<br />
SW<br />
C XV, CXVIII (212),<br />
C XXXV, C XXXVI<br />
(218), C XL, C XLI<br />
(210 ff.), D XVIII<br />
(218)<br />
A I, A III (230 f.), B<br />
XIX, B XXV (231),<br />
D I, D IV, D X, D<br />
XII, D XVI (227 ff.),<br />
D XXIII (234)<br />
A VI (264), C<br />
XXVIII, C XXIX<br />
(272), D VII, D VIII<br />
(264 ff.)<br />
ÖW C XX (320 f.), C<br />
XXVII C XXIX (324<br />
CL
41 4/2007<br />
343−359<br />
42 1/2008<br />
62−76<br />
43 4/2008<br />
293−305<br />
44 Pflege und<br />
Gesellschaft<br />
4/2008<br />
306−321<br />
45 4/2008<br />
321−336<br />
Büscher, A.<br />
Budroni, H.<br />
Hartenstein, A.<br />
Holle, B.<br />
Vosseler, B.<br />
Ahnis, A.<br />
Boguth, K.<br />
Braum<strong>an</strong>n, A.<br />
Kummer, K.<br />
Seizmair, N.<br />
Seither, C.<br />
Schaeffer, D.;<br />
Wingenfeld, K.<br />
Rüsing, D.; Her<strong>der</strong>,<br />
K.; Müller-<br />
Hergl, C.; Riesner,<br />
C.<br />
Müller, E.; Dutzi,<br />
I.; Hesterm<strong>an</strong>n,<br />
U.; Oster, P.;<br />
Specht-Leible, N.;<br />
Ziesch<strong>an</strong>g, T.<br />
sozialer Ungleichheit auf die<br />
Funktion professioneller Pflegekräfte<br />
in häuslichen Pflegearr<strong>an</strong>-<br />
gements<br />
Auswirkungen von Vergütungsregelungen<br />
in <strong>der</strong> häuslichen Pflege.<br />
Ein Modelprojekt zur Einführung<br />
personenbezogener Budgets<br />
Qualitative Interviews<br />
Inkontinenz bei alten Menschen Qualitative Interviews<br />
(3) und<br />
qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen<br />
(1)/ Vorstellung<br />
von Forschungsergebniss<br />
Qualität <strong>der</strong> Versorgung Demenzkr<strong>an</strong>ker:<br />
Strukturelle Probleme<br />
und Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Der Umg<strong>an</strong>g mit Menschen mit<br />
Demenz in <strong>der</strong> (teil)stationären,<br />
ambul<strong>an</strong>ten und Akutversorgung<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für die Pflege:<br />
Menschen mit Demenz im Kr<strong>an</strong>kenhaus<br />
en /Sample<br />
ments, Soziales Netzwerk,<br />
Professionelle<br />
Pflegekraft<br />
ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
Pflegebudgets, Aktionsforschung,Pflegeinterventionen<br />
Inkontinenz, Harn- und<br />
Analinkontinenz, Alter,<br />
Subjektives Belastungserleben,Informationsbedarf,<br />
Motivation,<br />
Kommunikation, Pflegende<br />
Angehörige,<br />
Risikofaktoren<br />
Expertenaufsatz Demenz als nursing<br />
disease, Qualitätsprobleme<br />
in <strong>der</strong> Pflege,<br />
Demenz im Kr<strong>an</strong>kenhaus,<br />
stationäre L<strong>an</strong>gzeitversorgung,ambul<strong>an</strong>te<br />
Pflege, Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Quali-<br />
Fragenbogenerhebung<br />
mit qualitativen<br />
und qu<strong>an</strong>titativen<br />
Anteilen<br />
(deskriptive Studie)<br />
Tri<strong>an</strong>gulierte Interventionsstudie/<br />
Projektbericht<br />
tätsentwicklung<br />
Demenz, Umg<strong>an</strong>g mit<br />
Demenzkr<strong>an</strong>ken, herausfor<strong>der</strong>ndesVerhalten,<br />
Challenging<br />
Behaviour, Wissensbedarf<br />
Demenz, Kr<strong>an</strong>kenhaus,<br />
segregative Versorgung<br />
praktische Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
ff.), D IX, D XII, D<br />
XIII (320 ff.)<br />
ÖW C XX, C XXVII, C<br />
XXIX (344 ff.)<br />
EW B VI, B VIII, B XII<br />
(62 f.), B XXIV (64)<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B VIII, B XII, B XIX,<br />
B XX, B XXIV,<br />
B XXXVIII (293 ff.),<br />
C XI, C XV, C XVI,<br />
C XVIII, C XXV, C<br />
XXVII (294 ff.); C<br />
XXVIII, CXXIX<br />
(294), C XXXI, C<br />
XLIV (295 ff.)<br />
B VIII, B XVIII, B<br />
XIX, B XX (307),<br />
BXXV (310), B<br />
XXVI, XXVII, B<br />
XXXIII (311 f.), C<br />
XV, C XVI, D XXV,<br />
D XXVIII (315 ff.)<br />
B VIII, B XVIII, B<br />
XIX, B XX, B XXV<br />
(322), B XXVII, B<br />
XX VIII, B XXXIII<br />
(323 f.), C XXV, C<br />
XXVI, C XXVIII, C<br />
CLI
46 4/2008<br />
337−349<br />
47 4/2008<br />
350−362<br />
Bartholomeyczik,<br />
S.; Halek, M.;<br />
Müller-Hergl, C.;<br />
Riesner, C.;<br />
Rüsing, D.; Vollmar,<br />
H. C.; Wilm,<br />
S.<br />
Institut für Forschung und Tr<strong>an</strong>sfer<br />
in <strong>der</strong> Pflege und Beh<strong>an</strong>dlung<br />
von Menschen mit Demenz: Konzept<br />
Eurich, J. Eingeschränkte Menschenwürde Phil. Expertenaufsatz<br />
Projektbericht Helmholtz Gemeinschaft,<br />
Pflege von<br />
Menschen mit Demenz,<br />
primärärztliche Versorgung<br />
von Menschen<br />
mit Demenz, Versorgungsstrukturen,Versorgungsmaßnahmen,<br />
Wissenszirkulation,<br />
Wissenstr<strong>an</strong>sfer<br />
Menschenbild, Personbegriff,<br />
Demenz, Pflegeethik,<br />
Geschöpflichkeit<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
EW<br />
SW<br />
Metaebene EW keine<br />
XLI (327 ff.), D<br />
XXVII (333)<br />
B VIII, B XVIII, B<br />
XIX, B XX, B XXII,<br />
B XXXV, B XXXVII<br />
(338 ff.), D XXV<br />
(337 ff.)<br />
CLII
48 PFLEGE<br />
(H<strong>an</strong>s Huber)<br />
5/1999<br />
289–294<br />
49 1/2000<br />
4–8<br />
50 3/2000<br />
160–168<br />
51 3/2000<br />
187–196<br />
52 4/2000<br />
253–257<br />
53 6/2001<br />
407–413<br />
54 2/2002<br />
79–85<br />
Koch-Straube, U. Fremde(s) in <strong>der</strong> Altenpflege Expertenvortrag Migration, Fremdheit,<br />
Pflegeheim<br />
Laaser, U.; Röttger-Liepm<strong>an</strong>n,<br />
B.;<br />
Breckenkamp, J.;<br />
Herwig-Stenzel,<br />
E.<br />
Deittert, Ch;.<br />
Lammerding, A.;<br />
Stienen, U.;<br />
Temme, P.; Urb<strong>an</strong>ek,<br />
R.; Steenblock,<br />
M.; Winter,<br />
G.; Zielke-<br />
Nadkarni A.<br />
Raven, U.;<br />
Huism<strong>an</strong>n, A.<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> 2. Stufe des<br />
Pflegeversicherungsgesetzes auf<br />
die Versorgung im stationären<br />
Bereich <strong>der</strong> Altenhilfe<br />
Projekt zur Unterstützung sehbehin<strong>der</strong>ter<br />
alter Menschen:“Entwicklung<br />
eines<br />
Ratgebers für den kommunalen<br />
Bereich Münster“<br />
Zur Situation ausländischer Demenzkr<strong>an</strong>ker<br />
und <strong>der</strong>en Pflege<br />
durch Familien<strong>an</strong>gehörige in <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik Deutschl<strong>an</strong>d<br />
Qu<strong>an</strong>titative zweigeteilteUntersuchung(Verwaltungsdatenauswer<br />
tung und Zeiterhe-<br />
bung) <br />
Studierendenprojekt<br />
Qualitative telefonische<br />
Interviews<br />
mit Angehörigen<br />
und ExpertInnen<br />
Altenhilfe stationär,<br />
Pflege und Pflegeversicherung,<br />
SGB XI, Pflegestufen<br />
Pflegepädagogik, alte<br />
Menschen, Sehbehin<strong>der</strong>ung<br />
Demenz, Pflege durch<br />
Angehörige, häusliche<br />
Pflegesituation bei<br />
Migr<strong>an</strong>tInnen<br />
Skiba, A. Pflege und Geragogik Expertenaufsatz Pflege, Geragogik,<br />
Senioren<br />
Dibelius, O. Pflegem<strong>an</strong>agement im Sp<strong>an</strong>nungsfeld<br />
zwischen Ethik und<br />
Ökonomie: Eine qualitative Untersuchung<br />
in <strong>der</strong> stationären und<br />
Brüggem<strong>an</strong>n, R.;<br />
Osterbrink, J.;<br />
Benkenstein, J.<br />
teilstationären Altenpflege<br />
Pflegeüberleitung: die Sicht <strong>der</strong><br />
Patienten und notwendige Konsequenzen<br />
für die Org<strong>an</strong>isation<br />
Kr<strong>an</strong>kenhaus<br />
Qualitative<br />
explorative Interviews<br />
Altenpflege, Ökonomisierung,<br />
Ethik, stationäre<br />
und teilstationäre<br />
Altenhilfe<br />
Projektbericht Versorgungsintegration,<br />
Pflegeüberleitung,<br />
Verweildauerverkürzung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
DW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
Metaebene EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
A VI (290), D VII, D<br />
VIII (294); D XVI<br />
(293)<br />
A III, A IV, AV (4),<br />
B XIX (5), C XX (5 ff.)<br />
B I, B III, B VI (161),<br />
D XIII (165)<br />
A III (187), A VI<br />
(189), B I, B VIII, B<br />
XX (189), C XX (191),<br />
D VII,<br />
D VIII (191 ff.)<br />
B XVI, B XXXVIII<br />
(255), C XXXII (257),<br />
C XLIV (256), D XXV,<br />
D XXVIII (256 f.)<br />
BI, B VIII, BXX (407),<br />
B XXVIII (408), C XX,<br />
CXXI (408, 413)<br />
BI, B III (80), C XXI<br />
(80), C XXXVIII,<br />
C XXXIX (79)<br />
CLIII
55 PFLEGE 3/2002<br />
122–130<br />
56 3/2002<br />
137-145<br />
57 4/2002<br />
169–176<br />
58 6/2002<br />
309–317<br />
59 1/2003<br />
40−49<br />
60 2/2003<br />
75−82<br />
61 3/2003<br />
153–160<br />
62 PFLEGE 4/2003<br />
216–221<br />
Beyer, G. Zu Hause in einer fremden Welt?<br />
Studie zum Wirklichkeitserleben<br />
eines dementen alten Menschen<br />
im Heim: eine Interpretation verschiedener<br />
Sichtweisen<br />
Gottschalck, T.;<br />
Dassen, T.<br />
P<strong>an</strong>fil, E.-M.;<br />
Mayer, H.; Junge,<br />
W.; Laible, J.; Lin-<br />
denberg, E. et al.<br />
Halek, M.; Mayer,<br />
H.<br />
Welche Mittel werden zur Beh<strong>an</strong>dlung<br />
von Mundproblemen in<br />
<strong>der</strong> Literatur beschrieben? – Eine<br />
Analyse von deutsch und englischsprachigenVeröffentlichun-<br />
gen zwischen 1990 und 2001<br />
<strong>Die</strong> Wundversorgung von Menschen<br />
mit chronischen Wunden in<br />
<strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege – Pilotstu-<br />
die<br />
<strong>Die</strong> prädiktive Validität <strong>der</strong> originalen<br />
und erweiterten Norton-<br />
Skala in <strong>der</strong> Altenpflege<br />
Oelke, U. Entwicklung und Konstruktion<br />
eines Curriculums für die gemeinsame<br />
theoretische Ausbildung in<br />
<strong>der</strong> Alten-, Kr<strong>an</strong>ken- und Kin<strong>der</strong>-<br />
Bräutigam, K.;<br />
Flemming, A.;<br />
Halfens, R.;<br />
Dassen, T.<br />
Güttler, K.; Lehm<strong>an</strong>n,<br />
A.<br />
Gräßel, E.; Schirmer,<br />
B.<br />
kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
Dekubitusprävention: Theorie und<br />
Praxis<br />
Eine Typologie für Pflegeprozesse<br />
am Beispiel des Projektes<br />
„Pflegeprozess, St<strong>an</strong>dardisierung<br />
und Qualität im <strong>Die</strong>nstleistungssektor<br />
Pflege“<br />
Freiwillige Helferinnen und Helfer<br />
in <strong>der</strong> stundenweisen häuslichen<br />
Betreuung von Demenzkr<strong>an</strong>ken<br />
Qualitative Fallstudie,teilnehmendeBeobachtung<br />
Altenheim, Demenz,<br />
Beobachtung, Interpretation<br />
Literaturrecherche Mundgesundheit, Beh<strong>an</strong>dlungsmethoden,<br />
internationale Erkenntnisse<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen <br />
L<strong>an</strong>gzeitverlaufsstudie<br />
mit zwei<br />
Messzeitpunkten<br />
Projektbericht,<br />
PflegepädagogischeL<strong>an</strong>gzeitevaluationsstudie<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen<br />
Qualitative Untersuchung:teilnehmendeBeobachtung<br />
und Befragung<br />
von Betrof-<br />
fenen<br />
Tri<strong>an</strong>gulierte Studie:st<strong>an</strong>dardisierter<br />
Fragebogen<br />
und Interviews<br />
(qualitative In-<br />
Chronische Wunden,<br />
Wundversorgung, ambul<strong>an</strong>te<br />
Pflege, Präva-<br />
lenz<br />
Dekubitus, Prävention,<br />
Prophylaxen, Messkala<br />
Norton<br />
Theoretische Ausbildung,<br />
Altenpflege,<br />
Kr<strong>an</strong>kenpflege, Kin<strong>der</strong>kr<strong>an</strong>kenpflege<br />
Dekubitus, Prävention,<br />
Dekubitusprävalenzerh<br />
ebung, Dekubitus-<br />
m<strong>an</strong>agement<br />
Pflegeprozess, Typologie,<br />
St<strong>an</strong>dardisierung<br />
von Pflegeleistungen<br />
Demenz, niedrigschwellige<br />
Betreuung,<br />
Helfereinsatz, Schulung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
BI, B VIII, BXX (122),<br />
B XVI; BXVIII (129),<br />
C XXIV (128)<br />
EW BI, B V (137), B XIII<br />
(142)<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
BI, B III, B VI (169),<br />
C VII (170), D XXVIII<br />
(176)<br />
EW B IX (309)<br />
SW B XXXIX (40),<br />
B XL(40), D XXV (45)<br />
EW B I, B III, B VI (76 f.),<br />
B IX (78)<br />
ÖW C XV, C XVI, C XVII,<br />
C XVIII (153 f.)<br />
EW<br />
SW<br />
B I, B VIII, B XX,<br />
B XXIV (216),<br />
D XIX (216 f.)<br />
CLIV
63 4/2003<br />
222–229<br />
64 6/2003<br />
342–348<br />
65 6/2003<br />
349–356<br />
66 6/2003<br />
357–365<br />
67 3/2004<br />
187–195<br />
68 6/2004<br />
364–374<br />
69 PFLEGE 6/2004<br />
375–383<br />
70 1/2005<br />
5–14<br />
Hasseler, M. Auswirkungen gesundheitspolitischer<br />
Maßnahmen auf die ambul<strong>an</strong>te<br />
Pflege in Deutschl<strong>an</strong>d<br />
Dräger, D.; Geister,<br />
C.; Kuhlmey,<br />
A.<br />
Boes, C.<br />
Büssing, André;<br />
Giesenbauer,<br />
Björn; Glaser,<br />
Jürgen<br />
Bartholomeyczik,<br />
S.<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> Pflegeversicherung<br />
auf die Situation pflegen<strong>der</strong><br />
Töchter – <strong>Die</strong> Rolle <strong>der</strong><br />
professionellen Pflegedienste<br />
Der Beitrag von Pflegefachpersonen<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflegedienste in<br />
häuslichen Pflegesituationen<br />
Gefühlsarbeit. Beeinflussung <strong>der</strong><br />
Gefühle von Bewohnern und<br />
Patienten in <strong>der</strong> stationären und<br />
ambul<strong>an</strong>ten Altenpflege<br />
Qualitätsdimensionen in <strong>der</strong> Pflegedokumentation<br />
– eine st<strong>an</strong>dardisierte<br />
Analyse von Dokumenten<br />
in Altenpflegeheimen<br />
Friesacher, H. Foucaults Konzept <strong>der</strong><br />
Gouvernementalität als Analyseinstrument<br />
für die Pflegewissen-<br />
schaft<br />
Schil<strong>der</strong>, M. <strong>Die</strong> Bedeutung lebensgeschichtlicher<br />
Erfahrungen in <strong>der</strong> Situation <strong>der</strong><br />
morgendlichen<br />
Pflege in <strong>der</strong> stationären Alten-<br />
Geister, C.<br />
pflege<br />
Sich-ver<strong>an</strong>twortlich-Fühlen als<br />
zentrale Pflegemotivation<br />
halts<strong>an</strong>alyse nach<br />
Mayring)<br />
Expertenaufsatz Ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
Gesundheitspolitik,<br />
Strukturw<strong>an</strong>del, <strong>an</strong>gelsächsische<br />
Situation<br />
BiografischnarrativeInterviews<br />
Narrative Interviews<br />
nach Schüt-<br />
ze<br />
Tri<strong>an</strong>gulierte Studie<br />
aus Interviews<br />
und qu<strong>an</strong>titativer<br />
Erhebung mittels<br />
Fragebogen<br />
Dokumenten<strong>an</strong>alyse<br />
Pflegeversicherung,<br />
pflegende Töchter,<br />
professionelle <strong>Die</strong>nste<br />
Ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
häusliche Pflegesituati-<br />
onen, Pflegefachkräfte<br />
Stationäre-, ambul<strong>an</strong>te<br />
Altenpflege, Gefühlsarbeit<br />
Qualität, Qualitätsdimension,Pflegedokumentation,Altenpflege-<br />
heim<br />
Expertenaufsatz <strong>Pflegewissenschaft</strong>,<br />
Diskurs,<br />
Gouvernementalität<br />
Qualitative Untersuchung<br />
(Grounded Theory)<br />
Qualitative Untersuchung(Biografisch-narrative<br />
Interviews)<br />
Stationäre Altenpflege,<br />
morgendliche Pflege,<br />
lebensgeschichtliche<br />
Erfahrungen<br />
Pflegende Töchter,<br />
Ver<strong>an</strong>twortung, Pflegemotivation<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne <br />
KlinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XXXVI, C I, CII<br />
(222), C XXI, C XXV,<br />
C XXVII, C XXVIII, C<br />
XXX, C XXXVIII C<br />
XL, C XLI (223 f.), C<br />
XV; C XVI,<br />
C XIX (224)<br />
B XIX (342), B XXIV<br />
(344), C XVI, C XXV<br />
(344 f.), D X (347)<br />
ÖW C XX (355), C XXV,<br />
C XXXVIII (350),<br />
EW B XXXIX (357)<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXV, B XXIX (188),<br />
C XVII, C XXI (187)<br />
Metaebene ÖW C I, CII, C XV (365),<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
ÖW<br />
SW<br />
SW keine<br />
B XVI , B XXVII<br />
(376), D XXII (375)<br />
CLV
71 1/2005<br />
39−42<br />
72 3/2005<br />
169–175<br />
73 5/2005<br />
281–288<br />
74 5/2005<br />
299–303<br />
75 5/2005<br />
305–312<br />
76 2/2006<br />
79–87<br />
77 PFLEGE 2/2006<br />
88–96<br />
78 3/2006<br />
163–173<br />
79 5/2006<br />
303−307<br />
Krause, T. Sturzfolgen bei geriatrischen<br />
Kr<strong>an</strong>kenhauspatienten<br />
Josat, S. Welche Qualitätskriterien sind<br />
Angehörigen in <strong>der</strong> stationären<br />
Altenpflege wichtig?<br />
Zegelin, A. "Festgenagelt sein" – Der Prozess<br />
des Bettlägerigwerdens<br />
durch allmähliche Ortsfixierung<br />
Krause, T.; An<strong>der</strong>s,<br />
J.; Renteln-<br />
Kruse, W. von<br />
Schnepp, W.;<br />
Duijnstee, M.;<br />
Grypdonck, M.<br />
Josat, S.; Schubert,<br />
H.-J.;<br />
Schnell, M. W.;<br />
Köck, C.<br />
Kriz, D.; Schmidt,<br />
J.; Nübling, R.<br />
Inkontinenz als Risikofaktor für<br />
Dekubitus hält kritischer Überprüfung<br />
nicht st<strong>an</strong>d<br />
Migrationsspezifische Tr<strong>an</strong>sitionen<br />
und Angehörigenpflege<br />
Qualitätskriterien, die Altenpflegeheimbewohnern<br />
und Angehörigen<br />
wichtig sind<br />
Zufriedenheit von Angehörigen<br />
mit <strong>der</strong> Versorgung in stationären<br />
Altenpflegeeinrichtungen. Entwicklung<br />
des Screening-<br />
Fragebogens ZUF-A-7<br />
Schiff, A. Rückenmassage und verw<strong>an</strong>dte<br />
Techniken zur För<strong>der</strong>ung des<br />
Schlafes bei älteren Menschen:<br />
Popp, J.;<br />
Pröfener, F.;<br />
Stappenbeck, J.;<br />
Reintjes, R.; Weber,<br />
P.<br />
Eine Literatur<strong>an</strong>alyse<br />
Der Einfluss des Fachkräfte<strong>an</strong>teils<br />
auf die Dekubitusinzidenz in<br />
Pflegeheimen<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung(Auswertung<br />
von<br />
Sturzprotokollen)<br />
Qualitative Einzelfallstudie<br />
Qualitative Interviews<br />
(Grounded<br />
Theory)<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung(Dokumenten<strong>an</strong>alyse)<br />
Qualitative<br />
Untersuchung<br />
(Grounded Theo-<br />
ry)<br />
Geriatrie, Kr<strong>an</strong>kenhaus,<br />
Stürze älterer Menschen<br />
Altenpflegeheim, Qualitätskriterien<br />
Bettlägrigkeit, Phasenmodell,<br />
Ortsfixierung<br />
Dekubitus, Inkontinenz,<br />
Compli<strong>an</strong>ce, Pflegebedürftigkeit<br />
Russl<strong>an</strong>ddeutsche<br />
Spätaussiedler, Angehörige,<br />
familiale Pflege,<br />
Migration<br />
Literatur<strong>an</strong>alyse Altenpflegeheim, Qualität,<br />
Angehörige<br />
Literaturrecherche<br />
und Fragebogenentwicklung,qu<strong>an</strong>titativeUntersu-<br />
chung<br />
Stationäre Altenhilfe,<br />
Angehörige, Screening-<br />
Fragebogen, Zufriedenheit<br />
Literatur<strong>an</strong>alyse Schlaf, alter Mensch,<br />
Einreibung, Literatur<strong>an</strong>alyse<br />
Qu<strong>an</strong>titative historischeKohorten<strong>an</strong>alyse,(Datensatzauswertung)<br />
Pflegeheim, Dekubitus,<br />
Inzidenzraten, Fachkräfte<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW B XXVI (39)<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
B XIX, C XV, C XVI,<br />
C XIX (169), C XXI<br />
(170), D III (174)<br />
B XII, B XIII,<br />
B XV (282 f.), D XXV<br />
(287)<br />
EW B IX (299), B XIII,<br />
B XXIV (302)<br />
DW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
A VII (305), B XXIV<br />
(308), C XXIX (309),<br />
D I, D VII;<br />
D VIII (305 ff.)<br />
B XIX (80), C XV,<br />
C XVI, C XIX (81 f.),<br />
C XXI (80), D III (82)<br />
C II, C XVI, C XIX<br />
(88), D XIII (91)<br />
EW B I (163), B XXVII<br />
(164)<br />
EW<br />
ÖW<br />
C XXI (303), B I, B III,<br />
B VI, B IX, B XIX<br />
(304)<br />
CLVI
80 5/2006<br />
308–313<br />
81 6/2006<br />
356−362<br />
82 3/2007<br />
129–136<br />
83 1/2008<br />
37–48<br />
84 PFLEGE 2/2008<br />
85−94<br />
85 3/2008<br />
157–162<br />
Hoffm<strong>an</strong>n, F.;<br />
Scharnetzky, E.;<br />
Deiterm<strong>an</strong>n, B.;<br />
Glaeske, G.<br />
Schnei<strong>der</strong>, N.;<br />
Amelung, V. E.;<br />
Buser, K.<br />
Schaefer, I. .L;<br />
Dorschner, S.<br />
Compton, F.;<br />
Strauß, M.; Hortig,<br />
T.; Frey, J.;<br />
Hoffm<strong>an</strong>n, F.;<br />
Zidek, W.; Schä-<br />
fer, J.-H.<br />
Kottner, J.; T<strong>an</strong>nen<br />
A.; Dassen,<br />
T.<br />
Hartwig, J.; J<strong>an</strong>zen,<br />
P.; Waller, H.<br />
Analyse von Kr<strong>an</strong>kenkassendaten<br />
zur In<strong>an</strong>spruchnahme von Hilfsmitteln<br />
gegen Dekubitus<br />
Wie schätzen leitende Mitarbeiter<br />
ambul<strong>an</strong>ter Pflegedienste die<br />
Palliativversorgung ein?<br />
„Zu Hospiz gehört doch <strong>der</strong> g<strong>an</strong>ze<br />
Mensch!" – Ehrenamtliche<br />
Hospizbegleiter im Einsatz bei<br />
Demenzkr<strong>an</strong>ken<br />
Validität <strong>der</strong> Waterlow-Skala zur<br />
Dekubitusrisikoeinschätzung auf<br />
<strong>der</strong> Intensivstation: eine prospektive<br />
Untersuchung <strong>an</strong> 698 Patienten<br />
<strong>Die</strong> Interrater-Reliabilität <strong>der</strong> Braden-Skala<br />
Entlassungsvorbereitung im<br />
Kr<strong>an</strong>kenhaus aus <strong>der</strong> Sicht älterer,<br />
pflegebedürftiger Patienten<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung<br />
(Retrospektive<br />
Datensatzauswer-<br />
tung)<br />
Qualitative leitfadengestützteBefragungen<br />
mit<br />
qu<strong>an</strong>titativer Auswertung(evaluativeMeinungsum-<br />
frage)<br />
Qualitative Untersuchung<br />
(narrative<br />
Interviews)<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung<br />
(Validitätsstudie)<br />
Validitätsstudie<br />
(Interratorreliabilitätsüberprüfung)<br />
eines Messinstru-<br />
ments<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen<br />
Dekubitus, Hilfsmittel,<br />
In<strong>an</strong>spruchnahme von<br />
Leistungen<br />
Pflegeleitungen, Palliativversorgung,Pflegedienst<br />
Demenz, Ehrenamt,<br />
Hospiz, Hopizbegleiter<br />
Dekubitus, Dekubitusrisiko,<br />
Assessment,<br />
Intensivpflege<br />
Dekubitus, Dekubitusrisikoskalen,<br />
Braden-<br />
Skala, Interrator-<br />
Reliabilität<br />
Älterer, pflegebedürftiger<br />
Mensch, Entlassungsvorbereitung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B I, B III, B VI, B IX,<br />
B XIII, B XIX (308 f.),<br />
C XX (309)<br />
B I, B III, B VII, B XIII,<br />
B XXXIII (356),<br />
B XXXIX, C XXIV,<br />
C XXXVII, C XXXIX,<br />
C XLIV, D XXV,<br />
D XXVIII (358)<br />
B VIII, B XIX, B XX<br />
(129), B XXXVII<br />
(130), D XXV,<br />
DD XXVIII (131 f.)<br />
B I, BIII, B VI, BXIII,<br />
B XIX, C V I, CVII<br />
(37)<br />
EW B I, BIII, B VI, BXIII,<br />
B XIX, B XXIV (85)<br />
EW<br />
ÖW<br />
B I, B III, BVI, B XIX<br />
(157), C XXXVII;<br />
C XXXVIII, C XXXIX,<br />
C XL, C XLIV (161)<br />
CLVII
86 Zeitschrift<br />
für Pflege-<br />
und Gesundheitswissenschaft/<br />
PrInterNet<br />
(HPS-<br />
Media)<br />
1/1999<br />
32−34<br />
87 4/1999<br />
113−120<br />
88 5/1999<br />
140−152<br />
89 6/1999<br />
172−178<br />
90 6/1999<br />
159−163<br />
91 9/1999<br />
216−225<br />
92 1/2000<br />
19−26<br />
93 PrInterNet 1/2000<br />
27−36<br />
Wilhelm, H.-J. <strong>Die</strong> Bedeutung des Geldes in <strong>der</strong><br />
stationären Altenpflege<br />
Geisler, U. Biografiearbeit als Gegenst<strong>an</strong>d<br />
und Methode im Unterricht <strong>an</strong><br />
Kr<strong>an</strong>ken- und Altenpflegeschulen<br />
Fr<strong>an</strong>k, M. Geriatrieunterricht : Enttabuisierung<br />
<strong>der</strong> Alterssexualität<br />
Rohle<strong>der</strong>, C. Qualifizierungsstrategien in Einrichtungen<br />
<strong>der</strong> Altenhilfe<br />
Fehr, J. Grundüberlegungen zum Pflegemarketing<br />
Zentgraf, U.; Ritz,<br />
O.; Brul<strong>an</strong>d, M.;<br />
Plonka, K.; Helfer,<br />
E.<br />
Marketing in vollstationären Einrichtungen<br />
<strong>der</strong> Altenhilfe<br />
Bönsch, M. Patientenorientierung zwischen<br />
Kundenwerbung und konstruktivsystemischerMenschenbeh<strong>an</strong>d-<br />
lung<br />
Hackm<strong>an</strong>n, M. Stellenwert des Praxiseinsatzes<br />
in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Pflege für<br />
Pflegeschülerinnen – eine Forschungsübung<br />
Expertenaufsatz Geld, Beziehungen,<br />
Rollenverteilungen,<br />
Rollendefinition<br />
Expertenaufsatz Biografiearbeit als<br />
Unterrichtsmethode,<br />
Biographische Selbstreflexion,<br />
Betreuung<br />
alter Menschen<br />
Expertenaufsatz Pädagogik, Pflegeunterricht,<br />
Sexualität,<br />
Geriatrie<br />
Qualitative Untersuchung/Projektaufs<br />
atz<br />
Fort- und Weiterbildung,<br />
Qualifizierung,<br />
Altenpflege<br />
Expertenaufsatz Pflegemarketing,<br />
Marketingphilosophie,<br />
Marketingm<strong>an</strong>agement,<br />
Marketing-Mix<br />
Expertenaufsatz Marketing, Kommunikationsm<strong>an</strong>agement,<br />
Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Altenhilfe, Pflegeheim<br />
Expertenaufsatz Pflege, Patientenorientierung,Kundenorientierung,<br />
Kommunikation<br />
Literaturrecherche,<br />
Fragebogenentwicklung<br />
mit qu<strong>an</strong>titativer<br />
Erhebung<br />
Praktische Ausbildung,<br />
ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
qu<strong>an</strong>titative Forschung,<br />
Befragung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
C IX, C XVI (32<br />
ff.),<br />
D II, D III (33)<br />
B XXXIX (116),<br />
D XXII (113 ff.)<br />
A III (140), B<br />
XVI, B XVIII<br />
(145), D XXII, D<br />
XXV (140 ff.)<br />
C XLII (172 ff.),<br />
D XXVIII (173)<br />
ÖW C XVI, C XIX, C<br />
XXII (161)<br />
DW<br />
ÖW<br />
A III (216), C<br />
XVI;C XIX (217<br />
ff.), C XXV, C<br />
XXXVI (216),<br />
ÖW C I, CII, CXL (19<br />
ff.)<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
A III, B III (27),<br />
B XXXIX, C XIII<br />
(36), XXV (27<br />
f.),<br />
CLVIII
94 2/2000<br />
44−49<br />
95 3/2000<br />
70−80<br />
96 4/2000<br />
97−104<br />
97 4/2000<br />
91−97<br />
98 8/2000 1<br />
o. A.<br />
99 11/2000<br />
246−254<br />
100 PrInterNet 12/2000<br />
255−264<br />
Lutz, H. Lernzielkatalog „Gerontopsychiatrie“<br />
Br<strong>an</strong>denburg, H. Gerontologie und <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
Katzy, R. Zur Schnittstellenproblematik<br />
zwischen Pflege und Hauswirtschaft<br />
Expertenaufsatz<br />
Lehrpl<strong>an</strong><strong>an</strong>alyse<br />
Altenpflege, Psychiatrische<br />
Pflege, Gerontopsychiatrie,Lernzielkata-<br />
1 Hinweis: <strong>Die</strong>ser Artikel war nicht downloadbar, die Seiten<strong>an</strong>gaben beziehen sich auf das Originaltyposkript, das vom Autor zur Verfügung gestellt wurde.<br />
log<br />
Expertenaufsatz Pflege, Altenpflege,<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong>,<br />
Gerontologie<br />
Expertenaufsatz Pflegeversicherung,<br />
häusliche Versorgung,<br />
Schnittstellen, Hauswirtschaft,<br />
Ausbildung<br />
Wilhelm, H.-J. Begegnung in <strong>der</strong> Altenpflege Expertenaufsatz Pflege, Altenpflege,<br />
Kommunikation, Alter,<br />
Beziehungen, Genera-<br />
Br<strong>an</strong>denburg, H. Pflege im Sp<strong>an</strong>nungsfeld zwischen<br />
fachlichen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
und begrenzten Budgets<br />
Beiner, E. Marketing – Ein Muss für jedes<br />
Pflegeunternehmen<br />
Wilhelm, H.-J. Das Alter – Ein neuer Lebensabschnitt<br />
entsteht<br />
tion<br />
Expertenaufsatz Budgetierung, Professionalisierung,Qualitätssicherung<br />
Expertenaufsatz Marketing, Public Relations,Kundenzufrie-<br />
denheit<br />
Expertenaufsatz Alterungsprozess,<br />
Vorbereitung, Konsequenzen<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
EW<br />
SW<br />
B VIII, B XXXIX,<br />
D XXVIII (44 ff.)<br />
SW D XXVI (70 ff.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XIX, C XI (97<br />
ff.)<br />
B XVI, B XXXIII,<br />
D XVI (91 ff.)<br />
A VI, B VIII, B<br />
XIX, B XX (2), B<br />
XIII, B XVII, C<br />
XV, C XVI, C<br />
XVII, C XXXIV,<br />
C XXXVII,<br />
C XXXIX, C<br />
XLIV (3), B<br />
XXV, BXXXIV<br />
(6), B XXXVIII,<br />
C XXI (15)<br />
ÖW C XIX (246 ff.)<br />
Metaebene SW D IV, D V, D VI<br />
(255 ff.)<br />
CLIX
101 1/2001<br />
9−14<br />
102 2/2001<br />
30−39<br />
103 4/2001<br />
57−67<br />
104 6/2001<br />
120−125<br />
105 6/2001<br />
3−13<br />
106 7−8/2001<br />
41−44<br />
107 1/2002<br />
1−11<br />
Raiß, M. Wohin geht <strong>der</strong> Trend <strong>der</strong> stationären<br />
Altenpflege bei den Anbietern<br />
von DV- gestützter Pflegepl<strong>an</strong>ung<br />
und Dokumentation<br />
Expertenaufsatz Software, Altenpflege,<br />
Pflegepl<strong>an</strong>ung, Pflegedokumentation<br />
Kruse, A. P. Pflege neu denken Expertenaufsatz Qualifikationsstufen <strong>der</strong><br />
Pflegeausbildung,<br />
Gesundheitswesen,<br />
Pflegekompetenz,<br />
Modularisierung<br />
Hoffm<strong>an</strong>n, D.;<br />
Scholl, A.<br />
Senioren erobern das World-<br />
Wide-Web<br />
Happel, W. Qualität in <strong>der</strong> Pflege beginnt in<br />
<strong>der</strong> Altenpflegeausbildung<br />
Schmitt; B. Pflegebedarf bei dementen alten<br />
Menschen – Welche Konzepte<br />
hält die <strong>Pflegewissenschaft</strong> bereit?<br />
Balzer, K.;<br />
Schmiedl, C.;<br />
Dassen, T.<br />
Wöhrm<strong>an</strong>n, E.;<br />
Käppner, B.<br />
Instrumente zur Einschätzung des<br />
Dekubitusrisikos im Vergleich<br />
K<strong>an</strong>n die Einführung von Qualitätsm<strong>an</strong>agementsystemen<br />
in<br />
ambul<strong>an</strong>te Pflegeeinrichtungen<br />
zur Professionalisierung beitragen?<br />
Expertenaufsatz Senioren, Internet,<br />
Medienkompetenz,<br />
SOL-Projekt<br />
Projektbeschrei- Qualitätsm<strong>an</strong>agement,<br />
bung<br />
Altenpflege, Projekt<br />
Expertenaufsatz <strong>Pflegewissenschaft</strong>,<br />
Demenz, Case-<br />
M<strong>an</strong>agement<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen<br />
Dekubitusrisiko,<br />
Waterlowskala, Nortonskala,<br />
Bradenskala<br />
Expertenaufsatz Ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
Qualitätsm<strong>an</strong>agement,<br />
Patient – Kunde, Professionalisierung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW B XXXI (10)<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B I, B III; B VI,<br />
B VIII, B XIX, B<br />
XX (32), B<br />
XXXIX, B XL<br />
(30), C I, C II, C<br />
IV, C XI, C<br />
XXXVIII, D XXV,<br />
D XXVI (32),<br />
SW D V, D VI, D<br />
XIII, D XV (57<br />
ff.)<br />
ÖW C XVIII (120)<br />
EW<br />
OW<br />
SW<br />
B VIII, B XIX, B<br />
XX (3), B XXIII,<br />
B XXIV, B XXV<br />
(4), B XXVIII, B<br />
XXIV (5), C<br />
XXV, C XXXVI,<br />
C XXXVII, C<br />
XXXIX,<br />
C XLI (6), D XII<br />
(5)<br />
EW B I, BIII, B VI,<br />
BXIII,<br />
B XIX (41 ff.)<br />
ÖW C XV, C XVI, C<br />
XIX,<br />
C XXI, C XVIII<br />
(1), C II (9)<br />
108 PrInterNet 7−8/2002 Br<strong>an</strong>denburg, H. Zukunft <strong>der</strong> Pflege – <strong>der</strong> soziale Expertenaufsatz Professionelle Pflege, Metaebene, DW A VI, B IV, B IX,<br />
CLX
109 9/2002<br />
59−74<br />
110 10/2002<br />
195−200<br />
111 10/2002<br />
201−212<br />
112 12/2002<br />
114−123<br />
113 12/2002<br />
124−133<br />
115 PrInterNet 4/2003<br />
37−45<br />
133−148 W<strong>an</strong>del und neue Tätigkeitsfel<strong>der</strong><br />
in <strong>der</strong> professionellen Pflege alter<br />
Menschen<br />
Grimm, K.-H. Das Home Health Care Classification<br />
System<br />
Müller, K. Gemeinsame Zukunft: Integrierte<br />
Grundausbildung in Theorie und<br />
Praxis<br />
Oelßner, U. Modellprojekt „Integrative Pflegeausbildung“<br />
Br<strong>an</strong>denburg, H. Das Resident Assessment Instrument<br />
(RAI)<br />
Ehm<strong>an</strong>n, M. <strong>Die</strong> Anwendung des RAI-Systems<br />
in <strong>der</strong> pflegerischen Praxis<br />
Josat, S. Soll-Vorgaben und Ergebnisindikatoren<br />
für Pflegequalität in ausgewähltenQualitätsprüfinstrumenten<br />
für die stationäre Altenpflege<br />
neue Aufgabenfel<strong>der</strong> in<br />
<strong>der</strong> Pflege<br />
Expertenaufsatz Pflegeklassifikationssystem,<br />
Sprache/<br />
Kommunikation, Systemtheorie,<br />
Science of<br />
Unitary Hum<strong>an</strong> Beings<br />
Expertenaufsatz Ausbildungscurriculum,<br />
Themenfel<strong>der</strong>, Ausbil-<br />
dungsinhalte, Struktur<br />
Expertenaufsatz Integrative Pflegeausbildung,<br />
Curriculum,<br />
Modellprojekt<br />
Expertenaufsatz Assessment in <strong>der</strong><br />
Pflege, Qualitätssicherung<br />
in <strong>der</strong> Pflege,<br />
Pflegepl<strong>an</strong>ung<br />
Praxisbericht L<strong>an</strong>gzeitpflege, Resident<br />
Assessment Instrument<br />
(RAI),<br />
Pflegequalität<br />
Literaturrecherche Qualitätsprüfungen,<br />
Pflegequalität, Qualitätsprüfinstrumente,<br />
Stationäre Altenpflege<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XIII, B XIX, B<br />
XX, B XXXVII, C<br />
XXV, C XXXIV<br />
(133 f.), B XXIV,<br />
B XXXI,<br />
C XXXIX, D II, D<br />
XII,<br />
D XIII (135),<br />
C XXVII, C XLI,<br />
C XLIV (136<br />
EW B XIII, B XXV, B<br />
XXIX, B XXXI<br />
(59 ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXXIX, B XL,<br />
D XXV (195 ff.)<br />
B XXXIX, B XL,<br />
D XXV (201 ff.)<br />
B XII, B XIII, B<br />
XVI,<br />
B XVII, B XVIII,<br />
B XXV, B<br />
XXXVII, B XXIX,<br />
B XXXVI,<br />
C XXXIX (114<br />
ff.)<br />
B XII, B XIII, B<br />
XVI, B XVII, B<br />
XVIII, B XXV, B<br />
XXIX, C XXXIX<br />
(124 ff.)<br />
ÖW C XV, C XVI, C<br />
XVII,<br />
C XVIII, C XXI<br />
(37 ff.)<br />
CLXI
116 5/2003<br />
12−20<br />
117 6/2003<br />
73−81<br />
118 6/2003<br />
82−86<br />
119 7−8/2003<br />
42−51<br />
120 9/2003<br />
202−204<br />
121 3/2003<br />
61−73<br />
122 PrInterNet 2/2004<br />
105−110<br />
Grimm, K. H. Das Home Health Care Classification<br />
System – Teil 2<br />
Bartholomeyczik,<br />
S.<br />
Ludwig, H. P.;<br />
Burr, D.<br />
Meißner, M.;<br />
Rennen-Allhoff, B.<br />
Zusammenhänge zwischen Personal-<br />
und Bewohnerstruktur in<br />
Altenpflegeheimen<br />
Lebendiges Qualitätsm<strong>an</strong>agement<br />
– Wirkungsvolle Umsetzung<br />
mit Elementen des Ch<strong>an</strong>ge M<strong>an</strong>agements<br />
<strong>Die</strong> Rolle ambul<strong>an</strong>ter Pflegedienste<br />
bei <strong>der</strong> Versorgung alleinleben<strong>der</strong><br />
Pflegebedürftiger<br />
Stoffel, O. Projektarbeit zum Thema Wohnen<br />
im Alter nach <strong>der</strong> Lernfeldkonzeption<br />
Gottschalck, T. Mundpflege – Untersuchung<br />
eines pflegerischen H<strong>an</strong>dlungsfeldes<br />
Heinze, C.; Rissm<strong>an</strong>n,<br />
U.;<br />
Dassen, T.<br />
Expertenaufsatz Leistungserfassung,<br />
Klassifikationssystem,<br />
Assessment- Methode,<br />
Pflegediagnose, Pfle-<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Sekundär<strong>an</strong>alyse<br />
von<br />
Daten aus Querschnittsdaten-<br />
erhebung <br />
geinterventionen<br />
Altenpflegeheime,<br />
Personalstruktur,<br />
Bewohnerstruktur,<br />
Personalbemessung,<br />
Betreuungsrelation<br />
Expertenaufsatz Ch<strong>an</strong>ge M<strong>an</strong>agement,<br />
Qualitätsm<strong>an</strong>agement,<br />
Strategieklausur, Steuergruppe,Coaching,rg<strong>an</strong>isationsentwi<br />
cklung<br />
Qualitative Untersuchung,halbstrukturierteInterviews<br />
Ambul<strong>an</strong>te Pflegedienste,<br />
Alleinlebende,<br />
Pflegebedürftige, Demografischer<br />
W<strong>an</strong>del<br />
Expertenaufsatz Lernfel<strong>der</strong>, H<strong>an</strong>dlungsfel<strong>der</strong>,Zielformulierungen,H<strong>an</strong>dlungsorientierte<br />
Lernsituationen,<br />
Literaturrecherche<br />
und qu<strong>an</strong>titative<br />
Erhebung mittels<br />
Fragebogen<br />
Leben im Alter<br />
Mundhygiene, Mundpflege,<br />
Evidenzbasierte<br />
Pflege, Zahnfleisch,<br />
Zähne<br />
Stürze bei älteren Menschen Literaturrecherche Sturzinzidenz, Sturzrisikofaktoren,Sturzprävention<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW B XIII, B XXV, B<br />
XXIX, B XXXI<br />
(12 ff.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXIX, C XV, C<br />
XVI,<br />
C XVII, C XVIII,<br />
C XXV (73 ff.)<br />
ÖW C XV, C XVIIII,<br />
C XL (82 ff.)<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
A IV, B XIX, B<br />
XXIV,<br />
B XXXVII, C<br />
XXVII,<br />
C XXIX, C XXX,<br />
C XXXIX, D I,<br />
DII, D X, D XII,<br />
D XIII (42),<br />
B XXXIV, B<br />
XXXIX,<br />
D XXVIII (202<br />
ff.)<br />
EW B I, B V, B XIII<br />
(61 ff.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XI, B XXVI<br />
(105 ff.)<br />
CLXII
123 3/2004<br />
177−184<br />
124 4/2004<br />
222−230<br />
125 7−8/2004<br />
389−395<br />
126 7−8/2004<br />
410−419<br />
127 7−8/2004<br />
420−425<br />
128 9/2004<br />
495−502<br />
129 10/2004<br />
548−555<br />
130 PrInterNet 11/2004<br />
605−609<br />
Grebe, C. Pflegeklassen nach SGB XI und<br />
RUG-III<br />
Faust, R. Indikatoren zur Beurteilung pflegesensitiver<br />
Ergebnisqualität in<br />
Pflegeheimvergleichen<br />
Bartholomeyczik,<br />
S.<br />
Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit<br />
Werner, B. Das pflegerelev<strong>an</strong>te soziale<br />
Netzwerk demenzkr<strong>an</strong>ker alter<br />
Menschen<br />
Wagener-Floer,<br />
B.; Mayer, H.;<br />
Evers, G.E.<br />
Fischer, M.; Neubert,<br />
T. R<br />
Jahncke- Latteck,<br />
A.-D.; Weber, P.<br />
Mahnke, R.; Lipinski,<br />
H.-G.<br />
Vorkommen und Intensität von<br />
Schmerzen bei alten Menschen<br />
auf geriatrischen Stationen<br />
Vom nationalen Expertenst<strong>an</strong>dard<br />
„Dekubitusprophylaxe in <strong>der</strong> Pflege“<br />
zu <strong>der</strong> internen Leitlinie „Dekubitus“<br />
Pflegeberatung in Wohngruppen<br />
<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenhilfe<br />
Mobile Kommunikations- technologien<br />
für die ambul<strong>an</strong>te Pflege<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,<br />
Explorative Korrelationsstudie<br />
Pflegeaufw<strong>an</strong>d, Personalbemessung,Pflegesätze,Pflegeversicherung<br />
Literaturrecherche Pflegequalität, Qualitätsindikator,Ergebnisqualität,Pflegeheimvergleich,<br />
MDS, RAI<br />
Expertenaufsatz Assessment, Assessment-Instrumente,<br />
ICF,<br />
Pflegebedürftigkeit,<br />
Pflegebedarf, Pflegedi-<br />
Vergleichsstudie<br />
zweier L<strong>an</strong>gzeituntersuchungen,<br />
qu<strong>an</strong>titatives Design<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung<br />
mit<br />
deskriptiv- korrela-<br />
tionalen Design<br />
agnostik, SGB XI<br />
Demenz, Netzwerk,<br />
Studie<br />
Schmerzerfassung,<br />
Schmerzprävalenz,<br />
Schmerzintensität,<br />
geriatrischer Patient<br />
Projektaufsatz Prozessm<strong>an</strong>agement,<br />
Pflegedokumentation,<br />
EDV, Leitlinien, St<strong>an</strong>dard,Beh<strong>an</strong>dlungspfa-<br />
de<br />
Projektaufsatz Projekt, Pflegequalität,<br />
Behin<strong>der</strong>tenhilfe, Pflegeberatung,Intervention<br />
Expertenaufsatz Ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
PDA, Mobilfunk, Leistungserfassung,St<strong>an</strong>dortbestimmung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Metaebene,<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
KlinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XI, B XII, B<br />
XIII,<br />
B XXV, B XXIX,<br />
C XXIX, C XL,<br />
C XLV (177 ff.)<br />
B XI, B XIII, B<br />
XVIII,<br />
C XV, C XVI, C<br />
XVII,<br />
C XVIII (222 ff.)<br />
B XI, B XIII, B<br />
XXV,<br />
B XXIX, C XV, C<br />
XVI,<br />
C XVIII (398 ff.)<br />
B VIII, B XIX, B<br />
XX, B XXXVII, C<br />
XXXVIII,<br />
C XXXIX, D XII,<br />
D XIII, D XVI<br />
(410 ff.)<br />
EW B III, B XIII, B<br />
XXV,<br />
B XXIX, B XXX<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
(420 ff.)<br />
B III, B XIII, B<br />
XXIX,<br />
B XXXI, C II,<br />
C XL (495 ff.)<br />
B IV, B XVI, B<br />
XVIII,<br />
C XVI, C XVII, C<br />
XX,<br />
C XXI (548 ff.)<br />
B XIX, C XIV<br />
(605),<br />
B XXIX, B XXXI,<br />
CXXXI (606)<br />
CLXIII
131 11/2004<br />
621−626<br />
132 12/2004<br />
677−686<br />
133 6/2005<br />
359−370<br />
134 7−8/2005<br />
400−409<br />
135 7−8/2005<br />
423−429<br />
136 7−8/2005<br />
436−442<br />
137 9/2005<br />
472−479<br />
138 PrInterNet 10/2005<br />
542−548<br />
Kuntze, A. Evaluation <strong>der</strong> Home Health Care<br />
Classification für den praktischen<br />
Einsatz im deutschsprachigen<br />
Raum<br />
Arens, F. Umg<strong>an</strong>g mit Emotionen in <strong>der</strong><br />
Pflege von dementierenden alten<br />
Menschen<br />
Böttger, A. W. Im Zwielicht von Strafrecht und<br />
Autonomie: <strong>Die</strong> Einstellung <strong>der</strong><br />
Bevölkerung zur Sterbehilfe<br />
Siefert, H. Pl<strong>an</strong>ung einer Unterrichtsreihe<br />
zum Thema: „<strong>Die</strong> Bedeutung <strong>der</strong><br />
Musik für alte Menschen"<br />
Schreier, M. M. Positionspapier zur Grundsatzstellungnahme<br />
„Ernährung und<br />
Flüssigkeitsversorgung älterer<br />
Hebel, Lars; Osterm<strong>an</strong>n,<br />
Rüdiger<br />
Thomas, B.;<br />
Wirnitzer, B.;<br />
Behrens, J.<br />
Menschen"<br />
Praxisorientierte Auswahl einer<br />
EDV-gestützten Pflegedokumentation<br />
durch ein Pflegeheim<br />
Schulung und Anleitung in <strong>der</strong><br />
stationären Kr<strong>an</strong>kenpflege zur<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Selbständigkeit bei<br />
älteren Menschen<br />
Haastert, Fr<strong>an</strong>k Pflegeversicherung und Demenz<br />
– wohin entwickelt sich die Pflegeversicherung?<br />
Evaluationsstudie Klassifikationssystem,<br />
Versorgungskontinuität,<br />
Codierung, HHCC –<br />
Home-Health-Care-<br />
Classification, NNAI –<br />
Nursing Needs Assess-<br />
Dokumenten<strong>an</strong>alyse <br />
ment Instrument<br />
Emotionen, Demenz,<br />
Forschungsprojekt,<br />
Beobachtung<br />
Expertenaufsatz Sterbehilfe, Akzept<strong>an</strong>z,<br />
Tod, Einstellung<br />
Expertenaufsatz Musik, Altenpflege,<br />
Ausbildung, Unterricht<br />
Expertenaufsatz Ernährung, Positionspapier,<br />
Assessments,<br />
MNA<br />
Expertenaufsatz Pflegedokumentation,<br />
EDV, Auswahl, Altenheim<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Interventions-<br />
/Kontrollstudie;<br />
Pflegeschulungen, Angehörigenbegleitung,<br />
Schulungsprozess,<br />
Häusliche Versorgung,<br />
Selbstständigkeitsressourcen<br />
Expertenaufsatz Pflegeversicherung,<br />
sozialrechtlicher Pflegebedürftigkeitsbegriff,<br />
Demenzerkr<strong>an</strong>kte,<br />
Reformvorschläge<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-prak-<br />
tische Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
Metaebene,Org<strong>an</strong>isation<br />
ale und klinischpraktischeEbene<br />
EW B XIII, B XXV, B<br />
XXIX, B XXXI<br />
(621 ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
B VIII, B XIX, B<br />
XX (678), D<br />
XXV (677 ff.)<br />
SW D III, D IV, D VI<br />
(359 ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
B XVI, B XVII, B<br />
XVII, B XXVII, B<br />
XXXIX,<br />
D XXII (400 ff.)<br />
EW B XIX, B XXI, B<br />
XXII (423), B<br />
XXV,<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXIX (423 ff.)<br />
B XIII, B XIX, B<br />
XXV, B XXIX,<br />
B XXXI, C XIV,<br />
CXXXI (436 ff.)<br />
B I, B III, BXI, B<br />
XII,<br />
B XXIV, C<br />
XXVII, C XXIX,<br />
C XXXIX, C XLI,<br />
C XLIV, D XXV<br />
(472 ff.)<br />
B VIII, B XIX, B<br />
XX,<br />
C XX, C XXI<br />
(542 ff.)<br />
CLXIV
139 11/2005<br />
613−622<br />
140 2/2006<br />
91−97<br />
141 4/2006<br />
227−239<br />
142 4/2006<br />
240−246<br />
143 6/2006<br />
334−340<br />
144 PrInterNet 6/2006<br />
341−351<br />
145 1/2007<br />
14−20<br />
Albiez, T.; Bächle,<br />
B.; Grässle, B.;<br />
Naegele, M.;<br />
Schramm, K.;<br />
Treiber, J.<br />
Kretschmar, S.;<br />
Osterm<strong>an</strong>n, R.<br />
Schulze Kruschke,<br />
C.; Steuber, A.<br />
Brinker-<br />
Meyendriesch, E.<br />
Pflegequalifikation bestimmt Pflegequalität?!<br />
E-Mail-Nutzung als Hilfsmittel <strong>der</strong><br />
täglichen Arbeitsorg<strong>an</strong>isation in<br />
<strong>der</strong> stationären Altenhilfe<br />
„Ich glaube, ich fahre in die<br />
Highl<strong>an</strong>ds“ - Das Phänomen<br />
Verwirrtheit in <strong>der</strong> Familie McKay<br />
Ausgewählte Inhalts- und Strukturelemente<br />
von Wohngemeinschaften,<br />
in denen Menschen mit<br />
Demenz leben<br />
Borutta, M. Mit <strong>der</strong> Bürokratie gegen die<br />
Bürokratie – <strong>Die</strong> Entbürokratisierungsdebatte<br />
in <strong>der</strong> Altenpflege<br />
aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> neueren<br />
Systemtheorie nach Niklas Luhm<strong>an</strong>n<br />
Heuel, G. <strong>Die</strong> personenbezogene <strong>Die</strong>nstleistung<br />
Pflege im sozialen W<strong>an</strong>del<br />
<strong>der</strong> demografischen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
- <strong>Die</strong> Bal<strong>an</strong>ce zwischen<br />
professioneller Pflege und Laienpflege<br />
Schreier, M.M. Erfassung <strong>der</strong> Ernährungssituation<br />
bei alten Menschen in stationären<br />
Pflegeeinrichtungen –<br />
Vergleich einer Auswahl von<br />
Literaturreview Pflegequalifikation,Pflegequalität,Zusammenh<strong>an</strong>g,<br />
Literaturstudie<br />
Expertenaufsatz E-Mail, Stationäre Altenhilfe,Arbeitsorg<strong>an</strong>isation,Qualitätsm<strong>an</strong>a-<br />
gement<br />
Expertenaufsatz Leben mit einer Demenz,<br />
Verwirrtheit,<br />
Familie, Pflegende<br />
Angehörige, Szenisches<br />
Spiel<br />
Expertenaufsatz Demenz, Wohngemeinschaft,Angehörige,<br />
Struktur<br />
Expertenaufsaz Entbürokratisierung <strong>der</strong><br />
Pflege, Systemtheoretische<br />
Analyse, Run<strong>der</strong><br />
Tisch Pflege, Pflegem<strong>an</strong>agement<br />
Expertenaufsatz Professionsbegriff,<br />
Arbeit, Ehrenamt, Pflegebedarf<br />
Literaturreview Ernährung, Screening,<br />
Assessment, alte Menschen,<br />
stationäre Pflegeeinrichtung<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene <br />
Metaebene,Org<strong>an</strong>isation<br />
ale Ebene<br />
Metaebene,Org<strong>an</strong>isation<br />
ale Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
ÖW C XV, C XVI, C<br />
XVII,<br />
C XVIII (620)<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXXI<br />
C XVII (91 ff.)<br />
B VIII, B XVI, B<br />
XVII, B XVIII, B<br />
XIX, B XX, B<br />
XXIV, B XXXVII,<br />
B XXXIX,<br />
D XXV (227 ff.)<br />
B VIII, B XIV, B<br />
XVIII, B XXXIV,<br />
B XXXVII,<br />
C XXXIV,<br />
C XXXVI (240<br />
ff.)<br />
ÖW C XV, C XVI, C<br />
XVII,<br />
C XVII, C XIX<br />
C XI (334 f.)<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
A V, B I, B III, B<br />
XIX, C IX, D III<br />
(345) C XXV,<br />
C XXVII, C<br />
XXXI,<br />
C XXXVIII,<br />
D XXIX (345 f.)<br />
D II (346)<br />
EW BI, B XIII,<br />
BXXV,<br />
B XXVIII (14 ff.)<br />
CLXV
146 1/2007<br />
21−25<br />
147 1/2007<br />
226−32<br />
148 1/2007<br />
33−41<br />
149 1/2007<br />
42−51<br />
150 2/2007<br />
77−84<br />
151 PrInterNet 3/2007<br />
184−190<br />
152 3/2007<br />
191−195<br />
153 5/2007<br />
304−313<br />
veröffentlichten Erfassungsinstrumenten<br />
Trispel, L.; Oster- Visualisierung von Pflegekennm<strong>an</strong>n,<br />
R.<br />
zahlen in <strong>der</strong> stationären Altenhilfe<br />
Blaschke, K. <strong>Die</strong> Situation von Wohnbereichsleitungen<br />
in <strong>der</strong> stationären Altenhilfe<br />
und die Bedeutung von<br />
Weiterbildungs<strong>an</strong>geboten<br />
Haupt, T. Ein modulares<br />
Angehörigentraining bei Morbus<br />
Parkinson und kognitiven Defizi-<br />
ten<br />
Roth, G. Qualitätsprobleme in <strong>der</strong> Altenpflege:<br />
Versuch einer soziologi-<br />
schen Aufklärung<br />
Borutta, M. Von <strong>der</strong> lernenden zur kompetenten<br />
Org<strong>an</strong>isation Wissensm<strong>an</strong>agement<br />
in Pflegeeinrichtungen<br />
aus systemtheoretischer Perspektive<br />
Fuchs, C.;<br />
Willems, C.;<br />
P<strong>an</strong>fil, E. M.<br />
Entwicklung und Evaluation einer<br />
Informationsbroschüre für pflegende<br />
Angehörige zum Thema<br />
„Dekubitusprophylaxe“<br />
Wilhelm, H. J. Unterschiedliche Wahrnehmung<br />
<strong>der</strong> Zeit in <strong>der</strong> stationären Alten-<br />
Zapp, W.; Oswald,<br />
J.; Otten, S.<br />
pflege<br />
Forschungsprojekt: Konzeption<br />
und Gestaltung einer Qualitätskostenrechnung<br />
für die Stationäre<br />
Altenhilfe<br />
Expertenaufsatz Controlling, Pflegekennzahlen,Statisti-<br />
Qualitative Untersuchung,Interviews,<br />
qualitative<br />
Inhalts<strong>an</strong>alyse n.<br />
Mayring<br />
sche Grafik<br />
Wohnbereichsleitung,<br />
Position, Rolle, Qualifikation,<br />
Kompetenzen<br />
Expertenaufsatz Angehörige, Coping,<br />
Parkinson, Training<br />
Expertenaufsatz Altenpflege, Qualität,<br />
Konzepte, Gerontologie<br />
Expertenaufsatz Systemisches Wissensm<strong>an</strong>agement,<br />
Lernen<br />
als konfliktärer Prozess,<br />
Lernende vs.<br />
Kompetente Org<strong>an</strong>isation,Inkompetenzkompensationskompetenz,<br />
Anschlussfähigkeit und<br />
strukturelle Koppelung<br />
Evaluationsstudie Dekubitus, Patientenedukation,<br />
Häusliche<br />
Pflege, Evaluation,<br />
Studie<br />
Philosophischer<br />
Expertenaufsatz<br />
Zeit, Gegenwart, subjektive<br />
Wahrnehmung,<br />
Lebensphasen<br />
Expertenaufsatz Stationäre Altenhilfe,<br />
Qualitätskosten, Qualitätskostenrechnung,<br />
Qualitätsdimensionen,<br />
Controlling<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene,Org<strong>an</strong>isation<br />
ale Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXIX, B XXXI,<br />
B XXXII, C XV<br />
(21 ff.)<br />
EW B XVIII,<br />
BXXXIII,<br />
B XXXIV (226 f.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B VII, B XVIII, B<br />
XXIV, B XXVII,<br />
C XIV (33 ff.)<br />
C XVIII, D XXVII<br />
(42 ff.)<br />
ÖW C XLII (77ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
Metaebene ÖW keine<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
B XI, B XIII, B<br />
XV,<br />
B XVIII, B XXV,<br />
B XXIX, D XXV<br />
(184)<br />
ÖW C VIII, C XV, C<br />
XVI,<br />
C XVII, CXIX, C<br />
XX,<br />
C XXI (304 f.),<br />
CLXVI
154 7−8/2007<br />
473−480<br />
155 7−8/2007<br />
491−494<br />
156 10/2007<br />
608−621<br />
157 10/2007<br />
629−635<br />
158 11/2007<br />
677−685<br />
159 PrInterNet 12/2007<br />
750−757<br />
160 1/2008<br />
50−58<br />
161 3/2008<br />
140−147<br />
Seitz, B.<br />
Optimierung <strong>der</strong> Ernährung und<br />
Flüssigkeitsversorgung in stationären<br />
Pflegeeinrichtungen in<br />
Rheinl<strong>an</strong>d-Pfalz<br />
Wilhelm, H.-J. Gef<strong>an</strong>gene ihrer Wahrheit Philosophischer<br />
Expertenaufsatz<br />
Seelinger, Y. Berufliches Selbstverständnis und Qualitative Unter-<br />
Sichtweisen von Praxis<strong>an</strong>leitern suchung,perso- zu formalen und inhaltlichen Asnenzentriertepekten <strong>der</strong> Altenpflegeausbildung Interviews<br />
Rullkötter, P.;<br />
Winter, F.<br />
Altenpflegeausbildung – auf dem<br />
Weg zu gerontopsychiatrischer<br />
Expertise<br />
Arens, F. Anregungen zur didaktischmethodischen<br />
Umsetzung des<br />
nationalen Expertenst<strong>an</strong>dards<br />
Sturzprophylaxe in den Schulfor-<br />
Klün<strong>der</strong>, M.; Witt-<br />
Gülpen, K.<br />
Biendarra, I.;<br />
Weeren, M.<br />
Jahncke-Latteck,<br />
A.-D.; Weber, P.;<br />
Halves, E.<br />
men des Berufsfelds Pflege<br />
Pflegebeziehungen gestalten<br />
k<strong>an</strong>n je<strong>der</strong>?<br />
Wenn <strong>der</strong> Patient „Nein“ sagt<br />
Situationsdeutung, Lebensweltorientierung<br />
und Normalität im<br />
Mittelpunkt professionellen ambu-<br />
Expertenaufsatz Ernährung, Pflegeeinrichtung,<br />
alter Mensch,<br />
MDK, Geriatrie<br />
Demenz, Soziologie,<br />
Wahrheit<br />
Praxis<strong>an</strong>leiter, Sichtweise,Altenpflegeausbildung<br />
Expertenaufsatz Berufsbild <strong>der</strong> Altenpflege,Betreuungskonzepte<br />
bei Demenz,<br />
Kommunikationskompetenz,<br />
Kreativität,<br />
Dokumenten<strong>an</strong>alyse,Expertenaufsatz<br />
Qualitative Untersuchung,leitfadengestützteInterviews<br />
Philosophischer<br />
Expertenaufsatz<br />
Qualitative Untersuchung,Beobachtungsstudie<br />
Rollenspiel<br />
Expertenst<strong>an</strong>dard,<br />
Sturz, Prophylaxe,<br />
Umsetzung<br />
Häusliche Pflege,<br />
Selbstbestimmung,<br />
Qualifikation <strong>der</strong> Pflegekräfte,Pflegebeziehung<br />
Patientenverfügung,<br />
Kr<strong>an</strong>kheit als biografisches,<br />
Autonome Sorge,<br />
Pflegerische Praxis,<br />
Philosophische Praxis<br />
Ambul<strong>an</strong>te Pflege,<br />
Qualitative Forschung,<br />
Interaktion, Normalität,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XI, B XIII, B<br />
XVIII,<br />
B XXI, B XXV, B<br />
XXIX, D XXVIII<br />
(473 ff.)<br />
Metaebene EW B VIII, B XVI<br />
(491 ff.)<br />
Org<strong>an</strong>isationale EW B XXXIX, D<br />
Ebene und SW XXV,<br />
klinisch-prak-<br />
D XXVII, D<br />
tische Ebene<br />
XXVIII (608 ff.)<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-prak-<br />
EW<br />
SW<br />
B VIII, B XXXIX,<br />
D XXV, D XXVII,<br />
D XXVIII (629<br />
ff.)<br />
EW B I, B XI, B XIII,<br />
B XXV, B XXVI<br />
(677)<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XVI, B XXXVI,<br />
B XXXVII, C<br />
XXV,<br />
C XXVII, C XXX,<br />
D II, D XII, D<br />
XIII, D XXII, D<br />
XXVII (750 ff.)<br />
A II, A III, A IV,<br />
B II,<br />
B III, B XIII, B<br />
XVI,<br />
D VI, D XIX,<br />
D XXII (50 ff.)<br />
B XXXIV,<br />
BXXXVI,<br />
C XXVII, C<br />
CLXVII
162 3/2008<br />
167−176<br />
163 3/2008<br />
177−183<br />
164 4/2008<br />
235−247<br />
165 PrInterNet 7−8/2008<br />
395−400<br />
166 7−8/2008<br />
408−414<br />
167 9/2008<br />
453−464<br />
l<strong>an</strong>ten Pflegeh<strong>an</strong>delns<br />
Strupeit, S. Schwester AGNES ist zurück!? Qualitative Untersuchung,ProblemzentrierteInterviews<br />
n. Witzel<br />
Winter, F. Altenpflegeausbildung – Schulentwicklung<br />
im Dilemma<br />
Werner, B. Das Heim und die Angehörigen –<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung des informellen<br />
sozialen Netzwerkes bei <strong>der</strong><br />
Pflege und Versorgung demenzkr<strong>an</strong>ker<br />
Heimbewohner<br />
Fünfstück, M.;<br />
Haupt, C.;<br />
<strong>Die</strong>tsche, S.<br />
Löschm<strong>an</strong>n, C.<br />
Angehörigenbefragung – Ein<br />
Instrument zur Erhebung von<br />
subjektiv empfundener Qualität in<br />
stationären Pflegeeinrichtungen<br />
Sch<strong>an</strong>z, B. Pflege als Markt für Investoren –<br />
Ein Überblick über die Situation<br />
Maiwald, C. Überblick über die Ausbildungssituation<br />
<strong>der</strong> Helferberufe in <strong>der</strong><br />
Pflege<br />
Situationsdeutung tische Ebene XXIX, C XXX, D<br />
II, D XIII,<br />
D XVI, D XXII, D<br />
Gemeindeschwester,<br />
DDR, Berufsprofil,<br />
ambul<strong>an</strong>te Versorgungsstrukturen<br />
Expertenaufsatz Bundeseinheitliches<br />
Altenpflegegesetz, Duale<br />
Ausbildung, Lernfeldstruktur,<br />
Berufliche<br />
Kompetenzen, Interessenskonflikte,<br />
Matching<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Vergleichsstudie,Fragebogenerhebung<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen<br />
auf dem Arbeitsmarkt<br />
Demenzkr<strong>an</strong>ke, Angehörige<br />
von Demenzkr<strong>an</strong>ke,<br />
Ambul<strong>an</strong>te<br />
Pflege, Stationäre Pflege,<br />
Informelle soziale<br />
Netzwerke, Formelle<br />
soziale Netzwerke<br />
Angehörigenbefragung,<br />
Qualitätssicherung,<br />
Altenpflege,<br />
Benchmarking<br />
Expertenaufsatz Privatisierung, Pflege,<br />
Pflegemarkt, Pflegeheim<br />
Qualitative Untersuchung.Schriftlich-elektronische<br />
Umfrage<br />
Theoriegemin<strong>der</strong>te<br />
Ausbildung, Gesundheitsbezogeneberufliche<br />
<strong>Die</strong>nstleitung,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Metaebene,<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene und<br />
klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Metaebene,Org<strong>an</strong>isation<br />
ale Ebene<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
XXV (140 ff.)<br />
B XI, B XII, B<br />
XIII, B XV, B<br />
XXI, B XXII,<br />
B XXX, C XII, C<br />
XVIII, D XXV, D<br />
XXVI, D XXVIII<br />
(167 ff.)<br />
B XXXVIII, D<br />
XXVII,<br />
D XXVIII (177 f.)<br />
A IV, B VIII, B<br />
XIX,<br />
B XX, C XXXIV,<br />
D I,<br />
D II, D XII, D XIII<br />
(235 ff.)<br />
ÖW C XV, C XVI,<br />
C XIX (395 ff.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XXIX, C I, C<br />
II, C XI, C XXV,<br />
C XXVI,<br />
C XXVII, C<br />
XXVIII,<br />
C XXIX (408 ff.)<br />
B XL, C XI, C<br />
XIII,<br />
C XXIII, D XXVII<br />
(453 ff.)<br />
CLXVIII
168 9/2008<br />
499−503<br />
169 10/2008<br />
561−564<br />
237a 11/2008 2<br />
587−592<br />
170 11/2008<br />
622−630<br />
171 PrInterNet 12/2008<br />
645−650<br />
172 Zeitschrift<br />
für Gerontologie<br />
und<br />
Geriatrie/<br />
ZfGG<br />
(Steinkopff/<br />
Springer)<br />
6/2000<br />
480–487<br />
Kottner, J.;<br />
Dassen, T.<br />
Koser, A.; Brauns,<br />
H.-J.; Wolf-<br />
Osterm<strong>an</strong>n, K.<br />
Fünfstück, M.;<br />
Haupt, C.;<br />
<strong>Die</strong>tsche, S.<br />
Löschm<strong>an</strong>n, C<br />
Dekubitusprävalenzmessungen<br />
und Interrater-Reliabilität<br />
Prävention von Pflegebedürftigkeit<br />
Angehörigenbefragung – Ein<br />
Instrument zur Erhebung von<br />
subjektiv empfundener Qualität in<br />
stationären Pflegeeinrichtungen<br />
Meißner, A. Das intelligente Heim: Spracherfassung<br />
in <strong>der</strong> Pflege – Ergebnisse<br />
einer Ist-Analyse<br />
Haupt, C.;<br />
Löschm<strong>an</strong>n, C.;<br />
Lamprecht, F.<br />
Kuhlmey, A.;<br />
Winter, M.<br />
Depressive Störungen im Alter –<br />
Wissenstr<strong>an</strong>sfer von <strong>der</strong> Theorie<br />
in die Praxis<br />
Qualifikationsentwicklung in <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> Pflege – Ergebnisse<br />
einer aktuellen Daten<strong>an</strong>alyse<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Interratorreliabilitätsprü<br />
2 Artikel ist identisch mit Artikel aus Ausgabe 7−8/2008, deshalb nur 1x unter 7−8/2008 gelistet<br />
fung<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Sekundärdaten<strong>an</strong>aly<br />
se<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung<br />
mittels Fragebogen <br />
Dokumenten<strong>an</strong>alyse<br />
mit qu<strong>an</strong>titativer<br />
Auswertung<br />
Dokumenten<strong>an</strong>alyse<br />
mit qu<strong>an</strong>titativer<br />
Auswertung<br />
Deprofessionalisierung<br />
<strong>der</strong> Pflege, Ch<strong>an</strong>ce für<br />
Hauptschüler, Qualifi-<br />
kationsniveau<br />
Dekubitus, Prävalenz,<br />
Interratorreliabilität<br />
Pflegebedürftigkeit,<br />
Prävention, Sekundärdaten<strong>an</strong>alyse,Risiko-<br />
gruppe<br />
Angehörigenbefragung,<br />
Qualitätssicherung,<br />
Altenpflege<br />
EDV- gestützte Dokumentation,Pflegedokumentation,Spracherkennung,Qualitätssi-<br />
cherung<br />
Depression im Alter,<br />
Pflegeklinik, Therapie,<br />
Rehabilitation<br />
Expertenaufsatz Pflegepersonal, Qualifizierung,<br />
Ausbildung,<br />
Fortbildung, Akademisierung <br />
Klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW B I, BIII, B VI,<br />
BXIII,<br />
B XIX (499 ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B IX, B XI (561<br />
ff.)<br />
B XIII, B XV,<br />
BXXV,<br />
B XXXI, C XVII<br />
(622 ff.)<br />
EW B VII, B XII,<br />
B XIII (645 ff.)<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B III (480), B<br />
XXXII (486), B<br />
XXXIX, B XL<br />
(483 f.), C XI, C<br />
XIII, C XXI, C<br />
XLV, D II, D<br />
XXV, D XXVI,<br />
D XXVIII (480ff.)<br />
CLXIX
173 2/2001<br />
129–139<br />
174 2/2001<br />
140–146<br />
175 3/2002<br />
186–189<br />
176 1/2003<br />
50–62<br />
177 ZfGG 4/2003<br />
255–259<br />
178 4/2003<br />
297−302<br />
179 4/2004<br />
307–315<br />
Br<strong>an</strong>denburg, H. Gerontologie und Pflege<br />
Wingenfeld, K.;<br />
Schaeffer, D.<br />
Nutzerperspektive und Qualitätsentwicklung<br />
in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Pflege<br />
Kämmer, K. Der Beitrag professioneller Pflege<br />
zur Lebensweltgestaltung von<br />
Menschen mit Demenz<br />
D<strong>an</strong>gel, B.; Korporal,<br />
J.<br />
Lohrm<strong>an</strong>n, C.;<br />
Balzer, K.;<br />
Dijkstra, A.;<br />
Dassen, T.<br />
Ried, S.;<br />
Gutzm<strong>an</strong>n, H.<br />
K<strong>an</strong>n Pflege im Rahmen <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung Grundlage<br />
eines spezifischen pflegerischen<br />
Ansatzes <strong>der</strong> Rehabilitation sein?<br />
Pflegeabhängigkeit im Pflegeheim<br />
– eine psychometrische Studie<br />
Das Pflegephänomen „Chronische<br />
Verwirrtheit“ im Kontext <strong>der</strong><br />
Diagnose „Demenz“<br />
Schaeffer, D. Zum Verhältnis von Gerontopsychiatrie<br />
und <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
Gemeinsamkeiten und Unterschiede <br />
Zeitschriften<strong>an</strong>alyse<br />
Gerontologie, <strong>Pflegewissenschaft</strong>,Wissenschaftstheorie,Theorieentwicklung,<br />
Interdisziplinarität<br />
Expertenaufsatz Nutzerperspektive,<br />
Patientenzufriedenheit,<br />
Pflegequalität<br />
Expertenaufsatz Lebensweltorientierung,Professionelle<br />
Pflege,<br />
Menschen mit Demenz<br />
Expertenaufsatz Aktivierende Pflege,<br />
rehabilitative Pflege,<br />
Rehabilitation, soziale<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung<br />
(Validitätstestung<br />
Pflegeabhängig-<br />
keitsskala)<br />
Pflegeversicherung<br />
Pflegeabhängigkeit,<br />
Alten- und Pflegeheim,<br />
Reliabilität,<br />
Validität<br />
Literaturstudie Chronische Verwirrtheit,<br />
Demenz, Pflegediagnose<br />
Expertenaufsatz Gerontopsychiatrie,<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong>,<br />
Gerontopsychiatrische<br />
Versorgungsdefizite<br />
Metabene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
KlinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
Metaebene EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
B XVI, B XVII, B<br />
XXV, B XXXIII,<br />
B XXXIX,<br />
D XXV, D XXVI,<br />
D XXVIII (129ff.)<br />
C II (141), C XV,<br />
C XVI, C XXVII,<br />
C XXVIII,<br />
C XXXI (140),C<br />
XLI,<br />
DIII (142 f.),<br />
D XVI (141 ff.)<br />
B VIII, B XVIII,<br />
B XIX, B XX<br />
(186 f.), B XXIV,<br />
B XXV, B<br />
XXXVII,<br />
C XXV, C<br />
XXXIV,<br />
C XXXIX, C XLI,<br />
D II, D XVI, D<br />
XXII (187 ff.)<br />
B XII, C XVI, C<br />
XX,<br />
C XXI (50 ff.)<br />
EW B XIII, B XXV,<br />
B XXIX (255 ff.)<br />
EW B VIII, B XIII,<br />
BXVIII, B XIX, B<br />
XX, B XXV,<br />
B XXIX (297 ff.)<br />
B III B VIII, B<br />
XVIII, B XIX, B<br />
XX (312),B<br />
XXXVIII (308), C<br />
CLXX
180 3/2005<br />
210–217<br />
181 4/2005<br />
249–255<br />
182 5/2005<br />
354−359<br />
183 6/2005<br />
417–423<br />
184 ZfGG 3<br />
3/2006<br />
159–164<br />
185 3/2006<br />
165−172<br />
Reus, U.; Huber,<br />
H.; Heine, U.<br />
Pflegebegutachtung und Dekubitus.<br />
Eine Datenerhebung aus <strong>der</strong><br />
Pflegebegutachtung des MDK-<br />
3 Ausgabe 3/2006 erschien zum Schwerpunkt Pflegeforschung (Artikel 184-187)<br />
WL<br />
Schwerdt, R. <strong>Die</strong> Bedeutung ethischer und<br />
moralischer Kompetenz in Rationalisierungs<br />
und Rationierungsentscheidungen<br />
über pflegerische<br />
Rösler, A.;<br />
Schwerdt, R.;<br />
Renteln-Kruse, W.<br />
von<br />
Kondratowitz, H.-<br />
J. von<br />
Görres, S.; Reif,<br />
K.; Bie<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n,<br />
H.; Haberm<strong>an</strong>n,<br />
M.; Borchert, C.;<br />
Köpke, S.; Meyer,<br />
G.; Rothg<strong>an</strong>g, H.<br />
Behrens, J.; Zimmerm<strong>an</strong>n,<br />
M.<br />
Interventionen<br />
Was die Sprache Alzheimer-<br />
Kr<strong>an</strong>ker mit <strong>der</strong> Cel<strong>an</strong>s verbindet<br />
- Über Kommunikation mit schwer<br />
betroffenen Demenzpatienten<br />
<strong>Die</strong> Beschäftigung von Migr<strong>an</strong>ten/innen<br />
in <strong>der</strong> Pflege<br />
Optimierung des Pflegeprozesses<br />
durch neue Steuerungsinstrumente<br />
– Der Pflegeforschungsverbund<br />
Nord<br />
Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung<br />
bei Pflegebedürftigkeit -<br />
Konzept und Forschungsperspektiven<br />
Qu<strong>an</strong>titative Untersuchung,Sekundärdaten<strong>an</strong>aly<br />
se<br />
Pflegebegutachtung,<br />
Dekubitalulzera, vollstationär,<br />
ambul<strong>an</strong>t,<br />
männlich, weiblich,<br />
Westfalen-Lippe<br />
Expertenaufsatz Pflege, Rationalisierung,<br />
Rationierung,<br />
Personorientierte Indikation<br />
Expertenaufsatz<br />
Kommunikation, Demenz,<br />
Anamnese, Pflege<br />
Expertenaufsatz Irreguläre Pflegearbeit ,<br />
Wohlfahrtsstaatentypen<br />
Expertenaufsatz Pflegeprozess, Steuerung,<br />
Pflegeforschung,<br />
patientenorientierte<br />
Forschung<br />
Expertenaufsatz Selbstbestimmung,<br />
Selbständigkeit,<br />
evidence based nursing<br />
<strong>an</strong>d caring, Lebensqualität,<br />
professionelle<br />
Pflege<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Metaebene und<br />
org<strong>an</strong>isationale<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-prak-<br />
tische Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
XXVII, C XXXIX,<br />
C XLI (311), D<br />
XXV, D XXVI,<br />
D XXVIIII (307f.)<br />
EW B III, B XI,<br />
B XIII (210 ff.)<br />
ÖW C XX, C XXXI<br />
(249 ff.)<br />
EW<br />
SW<br />
ÖW<br />
SW<br />
DW<br />
EW<br />
ÖW<br />
SW<br />
EW<br />
SW<br />
B VIII, BXII, B<br />
XIII,<br />
B XVI, B XVIII,<br />
B XXVII (354 ff.)<br />
C XII, D VII,<br />
D VIII (417)<br />
A III, B XXV, C<br />
XXXIX (159), C<br />
IV, C X, C XV, C<br />
XVI, C XXVI, C<br />
XL (160), B<br />
XXIX, C XX<br />
(161), C XVIII, C<br />
XLIV, D<br />
XXV(163)<br />
B XIII, B XIV, B<br />
XVI, B XVII, B<br />
XVIII, B XXV, B<br />
XXVII, D V, D<br />
VI, D XIII, D XXII<br />
(165 ff.)<br />
CLXXI
186 3/2006<br />
183–191<br />
187 3/2006<br />
211–216<br />
188 3/2007<br />
141–146<br />
189 ZfGG 3/2007<br />
158–177<br />
190 ZfGG 3/2007<br />
185–191<br />
191 2/2008<br />
81–85<br />
192 2/2008<br />
92–105<br />
Remmers, H. Zur Bedeutung biografischer<br />
Ansätze in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
Meyer, G.; Köpke,<br />
S.<br />
Expertenaufsatz Biografie, Biografiearbeit,Biografieforschung,<br />
Kr<strong>an</strong>kheit,<br />
kritische Lebensereignisse,<br />
Pflege, Pflege-<br />
wissenschaft<br />
Expertenst<strong>an</strong>dards in <strong>der</strong> Pflege Expertenaufsatz Expertenst<strong>an</strong>dards in<br />
<strong>der</strong> Pflege,<br />
Praxisleitlinien,<br />
Höhm<strong>an</strong>n, U. Qualitätssiegel Geriatrie aus<br />
pflegewissenschaftlicher Perspektive<br />
Wolke, R.; Hennings,<br />
D.; Scheu,<br />
P.<br />
Härlein, J.; Scheffel,<br />
E.; Heinze, C.;<br />
Dassen, T.<br />
Schaeffer, D.;<br />
Kuhlmey, A.<br />
Klie, T.; Monzer<br />
M.<br />
Gesundheitsökonomische Evaluation<br />
in <strong>der</strong> Pflege<br />
Sturzprävention bei Menschen mit<br />
Demenzerkr<strong>an</strong>kungen<br />
Pflegestützpunkte –<br />
Impuls zur Weiterentwicklung <strong>der</strong><br />
Pflege<br />
Case M<strong>an</strong>agement in <strong>der</strong> Pflege<br />
– <strong>Die</strong> Aufgabe personen- und<br />
familienbezogener Unterstützung<br />
bei Pflegebedürftigkeit und ihre<br />
Realisierung in <strong>der</strong> Reform <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung<br />
Evidenzbasierte Pflege<br />
Expertenaufsatz Qualitätssiegel, Patientenorientierung,Versorgungskonzept,<br />
Qualitätsmethodik,<br />
Qu<strong>an</strong>titative Erhebung,Vergleichs<strong>an</strong>alyse<br />
(Kosten-<br />
Nutzen-Analyse)<br />
Literaturrecherche,<br />
Fokus -Gruppen<br />
Interviews<br />
Zertifizierung<br />
Pflege, GesundheitsökonomischeEvaluation,<br />
Nationaler Expertenst<strong>an</strong>dard,Dekubitusprophylaxe,StationärePflegeeinrichtungen,<br />
Kosten, Nutzen,<br />
Kosten-Nutzen-Analyse<br />
Sturz, Demenz, kognitive<br />
Defizite,<br />
Sturzprävention<br />
Expertenaufsatz Pflegeversicherungsreform,<br />
Pflegestützpunkte<br />
Expertenaufsatz Case M<strong>an</strong>agement,<br />
Care M<strong>an</strong>agement,<br />
Pflegeversicherung,<br />
Beratung, Unterstützung<br />
bei Pflege,<br />
Integrierte Versorgung<br />
Metaebene SW D V, D VI, D<br />
XVI, D XXII, D<br />
XXIV, D XXV<br />
(183 ff.)<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
u. klinisch-praktische<br />
Ebene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbe-<br />
ne<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW<br />
SW<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B I, B III, B XI, B<br />
XIII,<br />
B XIV, B XXIX,<br />
D XXV (211 ff.)<br />
B XII, B XIII, B<br />
XV,<br />
B XVII, B XXVII,<br />
B XXXVI,<br />
C XVI (141 ff.)<br />
B I, B III, B XIV,<br />
BXV, B XXIX, C<br />
VI, C XV,<br />
C XVI (158 ff.)<br />
EW B VIII, B XI, B<br />
XIII, B XIX, B<br />
XX, B XXV,<br />
EW<br />
ÖW<br />
EW<br />
ÖW<br />
B XXVI (185 ff.)<br />
B I, B III, B XIX,<br />
C XXV, C XXVII;<br />
C XXVIII, C<br />
XXIX, C XXXVII,<br />
C XXXVIII;<br />
C XXXIX (81 ff.)<br />
B XXXVIII, C<br />
XXVII, C XXX, C<br />
XXXVII, C<br />
XXXVIII, C<br />
XXXIX, C XLI, C<br />
XLIV (92 ff.)<br />
CLXXII
193 4/2008<br />
408–414<br />
Pfisterer, M.;<br />
Müller, E.; Oster,<br />
P.; Müller, M.<br />
<strong>Die</strong> Situation von PflegeheimbewohnerInnen<br />
mit Kontinenzproblemen:<br />
eine Studie in 2 <strong>deutschen</strong><br />
Pflegeheimen<br />
VergleichsuntersuchungQualitativer<br />
Art, Sampling<br />
aus Fokusgruppeninterviews,<br />
teilnehmende<br />
Beobachtung<br />
Inkontinenz, Blasenverweilkatheter,<br />
Pflegeheim<br />
Org<strong>an</strong>isationale<br />
und klinischpraktischeEbene<br />
EW B I, B III, BXIII,<br />
B XXV (408 ff.)<br />
CLXXIII
Anlage E: Expertenworkshop<br />
Ablauf Expertenworkshop am 15.03.2011<br />
W<strong>an</strong>n Was Wer/Wie<br />
10.00 Begrüßung <strong>der</strong> TN Prof. Br<strong>an</strong>denburg<br />
10.05 Kurze Vorstellungsrunde, Ab‐<br />
lauf des WS wird erklärt<br />
Alle, Mod. MB<br />
10.15 Einstieg in die Ergebnisse MB<br />
10.30 1. Runde: „Statements“ Exper‐<br />
ten beziehen aus disziplinärer<br />
Perspektive Stellung<br />
Alle, Mod. MB<br />
a) Wie decken sich die Ergebnisse mit den<br />
jeweilig‐spezifischen wissenschaftlichen<br />
Erfahrungen des Alltags? (Persönliche<br />
monodisziplinäre Sicht)<br />
b) Welche Begründungen finden die TN für<br />
Schwerpunktsetzungen/Auslassungen bei<br />
den Themen? (Analytische Perspektive)<br />
Protokoll<strong>an</strong>t hält Kernaussa‐<br />
gen fest!<br />
11.00 Kurze Kaffepause Übertrag <strong>der</strong> Kernaussagen<br />
auf Folie o<strong>der</strong> Flip<br />
11.15 2. Runde: „Was fällt auf?“<br />
Welche Unterschiede sind<br />
bemerkbar?<br />
Alle, Mod. MB<br />
<strong>Die</strong> TN beziehen in <strong>der</strong> eigentlichen Fo‐<br />
kusgruppendiskussion Stellung zu Ausfüh‐<br />
rungen einzelner Experten<br />
12.00 3. Runde: „Abschluss“<br />
Fazit: Welche zukünftigen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen und H<strong>an</strong>d‐<br />
lungsspielräume aus ihrer jew.<br />
disziplinären Sicht sehen die<br />
Experten für die Pflegewissen‐<br />
schaft?<br />
(3 Sätze)<br />
<strong>Die</strong> TN Haben 5 Minuten Zeit sich drei<br />
Sätze zu notieren<br />
Protokoll<strong>an</strong>t hält Kernaussa‐<br />
gen fest!<br />
Alle, Mod. MB<br />
12.05 TN stellen ihre Thesen in drei<br />
Sätzen vor<br />
Alle, Mod. MB<br />
12.25 D<strong>an</strong>ksagung, Verabschiedung Mod. MB<br />
CLXXIV
Expertenworkshop 15.03.2011, PTH Vallendar, 10:00−12:30 Uhr<br />
Teilnehmende Experten <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gruppendiskussion waren:<br />
Expertin1 Prof. Dr. H<strong>an</strong>na Mayer, [HM]<br />
Experte2 Prof. Dr. Bernd Seeberger, [BS]<br />
Experte3 Prof. Dr. Fr<strong>an</strong>k Schulz-Niesw<strong>an</strong>dt, [S-N]<br />
Experte4 Prof. Dr. Herm<strong>an</strong>n Br<strong>an</strong>denburg, [HB]<br />
Mo<strong>der</strong>ation Michael Bossle, M. Sc., [MB]<br />
Der Expertenworkshop f<strong>an</strong>d in drei Runden statt:<br />
Runde 1: <strong>Die</strong> Experten beziehen Stellung zu den im Vorfeld eruierten Ergebnissen<br />
<strong>der</strong> Zeitschriften<strong>an</strong>alyse.<br />
Runde 2: <strong>Die</strong> Experten diskutieren – ausgehend von einzelnen Statements – unterein<strong>an</strong><strong>der</strong><br />
und nehmen in ihren Ausführungen aufein<strong>an</strong><strong>der</strong> Bezug.<br />
Runde 3: <strong>Die</strong> Experten finden zum Abschluss ein Fazit und benennen künftige<br />
Herausfordungen und H<strong>an</strong>dlungsspielräume für die <strong>Pflegewissenschaft</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Schnittstelle von Altern(n) und Pflege.<br />
Hinweis: In Runde 3 musste Experte 4 die Gruppendiskussion aus Termingründen verlassen; dies<br />
wurde notwendig, da Experte 4 wegen <strong>der</strong> Absage eines vorgesehenen Experten nur kurzfristig in<br />
die Diskussion einspr<strong>an</strong>g!<br />
CLXXV
Runde 1<br />
Runde 1:<br />
Wie decken sich die Ergebnisse mit den jeweilig spezifischen wissenschaftlichen Erfahrungen des<br />
Alltags? Welche Begründungen finden sich für Schwerpunktsetzungen o<strong>der</strong> Auslassungen bei<br />
den Themen? Statements:<br />
[HM]:<br />
[BS]:<br />
[S-N]:<br />
1. Fin<strong>an</strong>zierung von Forschung triggert Themen (E1.1.1).<br />
2. <strong>Pflegewissenschaft</strong> fehlt in gewissen Fel<strong>der</strong>n Expertise (z. B. primäre Prävention) (E1.1.2).<br />
3. Eigener Gegenst<strong>an</strong>dsbereich (<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>, Anm. MB) ist noch nicht entwickelt<br />
beziehungsweise herrscht eine Vorsicht vor <strong>an</strong><strong>der</strong>en Wissenschaftsbereichen (Identitätsbildung<br />
vs. Interdisziplinarität) (E1.1.3).<br />
1. <strong>Pflegewissenschaft</strong> unterliegt einer „Selbsttäuschung“ und „Selbsterhöhung“ (E2.1.1).<br />
2. Noch keine Ansätze für die Entwicklung konzeptioneller Ansätze <strong>der</strong> Laienpflege vorh<strong>an</strong>den<br />
(Fokussierung rein auf die professionelle Pflege) (E2.1.2).<br />
3. Gesundheitsprofession versus unverän<strong>der</strong>tem Tätigkeitsspektrum <strong>der</strong> Pflege (Hinweis<br />
„Selbsterhöhung“ [E2.1.1]) (E.2.1.3).<br />
4. Orientierung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Medizin (hinsichtl. struktureller Professionalisierung, Anm. MB), negative<br />
Anteile des Alter(n)s werden ausgeblendet (Pflege ist auch mit Ekel und Scham behaftet,<br />
Hinweis „Selbsttäuschung“ [E2.1.1]) (E2.1.4).<br />
1. <strong>Pflegewissenschaft</strong> steckt in <strong>der</strong> „Pubertätsphase“. In Abgrenzung zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en etablierten<br />
wissenschaftlichen Disziplinen, wie <strong>der</strong> Medizin, sucht sie nach „Identität“; darin ist auch<br />
eine „selbstgesteuerte Engführung“ <strong>der</strong> Themen begründet. Bewegt sie sich in <strong>an</strong><strong>der</strong>e wissenschaftliche<br />
Gebiete, verliert sie ihr „wissenschaftsdefinitorisches Monopol“. <strong>Die</strong> Themenfel<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> interdisziplinären Gesundheitswesenforschung unterscheiden sich in <strong>der</strong><br />
Themenbreite von denen <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> (E3.1.1).<br />
2. Neuere Steuerungsformen, wie das Public-M<strong>an</strong>agement, verfügen über <strong>an</strong><strong>der</strong>e „mentale<br />
Modelle“: Stichwort „Professionalisierung“: Was ist <strong>der</strong> alte und <strong>der</strong> neue Habitus <strong>der</strong> Profession?<br />
Was läuft ab in <strong>der</strong> Selbstkonstituierung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>? Illustrierendes<br />
Beispiel: Selbstregulierungsparadigma im SVR im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Prävention als lockerer<br />
liberaler Diskurs o<strong>der</strong> als Selbstinszenierung im Sinne des Selbstm<strong>an</strong>agements,<br />
Selbstwirksamkeitssteuerung und Selbstinszenierung von Biografien mit öffentlichem<br />
Druck und Schuldzuweisung: „Wer nicht Prävention macht, ist Parasit!“ (E3.1.2).<br />
3. Über den Sektor <strong>der</strong> Epidemiologie werden „R<strong>an</strong>dstrukturen“ inszeniert. Im Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit dem Alter kommen demografische Gesichtspunkt mit ins Spiel (E3.1.3).<br />
CLXXVI
Runde 1<br />
[HB]:<br />
4. Befund passt ins Bild. Das Dilemma <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist, dass sie sich durch Abgrenzung<br />
selbst architektonisch aufbauen muss, sich aber auch, will sie erfolgreich sein,<br />
gleich interdisziplinär öffnen muss (E3.1.4).<br />
5. <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist Policyfeld. Sie muss Theorien und Befunde <strong>an</strong><strong>der</strong>er Disziplinen aufnehmen,<br />
sie hat keine eigenen Theorien, das macht das „<strong>an</strong>gstbesetzte“ Verhalten (nicht<br />
grenzüberschreitend sein zu wollen, Anm. MB) aus (E3.1.5).<br />
1. Pflege befindet sich frei nach Twenhöfel im Klammergriff <strong>der</strong> Disziplinen, dem Zugriff <strong>der</strong><br />
etablierten Disziplinen und dem „Strampeln nach Eigenentwicklung“. Unter historischwissenschaftsstrukturellen<br />
Entwicklungen hat sich die deutsche <strong>Pflegewissenschaft</strong> stark<br />
kr<strong>an</strong>kenhauslastig entwickelt; die meisten Professuren kamen aus diesem zumeist FH-<br />
Bereich, stark mit Fokus „M<strong>an</strong>agement und Pädagogik“, die letzten zehn bis 15 Jahre auch<br />
vermehrt mit klinischen Herausfor<strong>der</strong>ungen (E4.1.1).<br />
2. Fokus liegt stark bei den Betroffenen, dem H<strong>an</strong>dhabbarmachen des Pflegeproblems, im<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Demenz sehr viel Interventionsforschung (wie z. B. herausfor<strong>der</strong>ndes<br />
Verhalten). Etablierte deutsche <strong>Pflegewissenschaft</strong> orientiert sich stark <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>an</strong>gloamerik<strong>an</strong>ischen Diskussion, weniger <strong>an</strong> kritischen sozialwissenschaftlichen Debatten.<br />
Fokus hierbei liegt auf H<strong>an</strong>dhabbarkeit, Regulierung und M<strong>an</strong>ipulation von Umwelten zur<br />
besseren Beherrschung des Pflegeproblems (E4.1.2).<br />
3. Angew<strong>an</strong>dte Forschung bringt die <strong>Pflegewissenschaft</strong> im Praxisfeld in ein Dilemma:<br />
Grundlagenforschung ist schlecht möglich, son<strong>der</strong>n Forschung wird aus <strong>der</strong> Praxis (von<br />
Politik, Institutionen, long- term-care) <strong>an</strong>gefor<strong>der</strong>t, die konkrete Probleme gelöst haben<br />
wollen. Schnittstelle ist hier „Probleme zu bedienen“ und affirmativ abzuarbeiten. Kritische<br />
Impulse sind in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> eher marginal (E4.1.3).<br />
4. <strong>Die</strong>s zeigt sich auch in den Ergebnissen <strong>der</strong> Zeitschriften<strong>an</strong>alyse: <strong>Die</strong> Ergebnisse sind bestätigend,<br />
affirmativ, systemerhaltend wenig aus <strong>der</strong> Dist<strong>an</strong>z im Sinne einer Kritik <strong>an</strong> den<br />
Verhältnissen, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Forschungstradition begründet mit den Gel<strong>der</strong>n, die wir bekommen<br />
o<strong>der</strong> nicht. Druck <strong>der</strong> Praxis auf die Wissenschaft ist enorm, bestimmte Ergebnisse<br />
zu erzeugen! (E4.1.4)<br />
CLXXVII
Runde 2<br />
Runde 2:<br />
„Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? –<br />
Gruppendiskussion:<br />
[HB]:<br />
Auf „Pflege blendet negative Anteile des Alter(n)s aus“ (BS):<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> steht in <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> etablierten Gerontologie, die den Fokus des „normal<br />
aging“ prominent einsetzt. Pflege nimmt nicht den kritischen Aspekt des Alter(n)s auf, wie in den<br />
Phänomenen, wie Gebrechlichkeit, Ekel etc., son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Fokus liegt auf einem Professionalisierungsverständnis<br />
von technisch-akademischer H<strong>an</strong>dhabbarkeit von Pflegebedarfen (E4.2.1).<br />
[BS]:<br />
Erwi<strong>der</strong>t auf Aussage HB‘s:<br />
Wir haben keine gute Leibtheorie, <strong>der</strong> Körper als Ort des Alter(n)s wird nicht ben<strong>an</strong>nt, wird ausgeblendet,<br />
stattdessen wird über den Körper Qualität von intern und extern gemacht.<br />
Auf die Aussage „Pflege ist kr<strong>an</strong>kenhauslastig“ (HB) und die Aussage „Pflege ist in <strong>der</strong> Pubertätsphase“<br />
(S-N):<br />
<strong>Die</strong> sogen<strong>an</strong>nte normale Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist erschwert. Am Beispiel Österreich<br />
wird deutlich: Dort ist die <strong>Pflegewissenschaft</strong> aufgrund einer Gesetzesän<strong>der</strong>ung notwendig geworden,<br />
nicht weil m<strong>an</strong> <strong>der</strong> Meinung war, m<strong>an</strong> bräuchte sie; deswegen noch einmal <strong>der</strong> Hinweis auf<br />
das Statement <strong>der</strong> „Selbsterhöhung“: Wir sind jetzt was geworden! Und auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite<br />
muss die <strong>Pflegewissenschaft</strong>, noch in <strong>der</strong> Pubertätsphase befindlich, schon ihren eigenen Nachwuchs<br />
zeugen, obwohl sie noch gar nicht richtig zeugungsfähig ist. Drei Viertel <strong>der</strong> professionellen<br />
pflegewissenschaftlichen Mitarbeit „geht in Lehre drauf“, weil ein Bedarf bedient werden muss,<br />
weniger als Selbstinszenierung als vielmehr Notwendigkeit, um eigene Mitarbeiter „aufzubauen“<br />
(E2.2.1).<br />
[S-N]:<br />
Auf die Aussage „Identität versus Interdisziplinarität“ (HM) mit Hinweis auf Schaubild (Abb. unten),<br />
das S-N <strong>an</strong>zeichnet:<br />
<strong>Die</strong> Dyade „pflegebedürftiger Mensch−Pflegeperson“ steht im ersten konzentrischen Kreis, im<br />
zweiten die Bel<strong>an</strong>ge <strong>der</strong> Versorgungsstrukturen, wie Professionalisierung, <strong>der</strong> Settings und des<br />
QM 4 . Bis hier ist <strong>der</strong> Zugriff <strong>der</strong> Pflege noch möglich; je mehr m<strong>an</strong> nach oben geht, desto höher die<br />
Identität, je mehr nach unten, desto weniger, umso mehr Schnittstellen zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen.<br />
Fokussierung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> auf die ersten beiden konzentrischen Kreise, um nicht in den<br />
Schnittstellenbereich zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen einzudringen. <strong>Die</strong> Gerontologie liegt quer dazu, Fokus<br />
4 Qualitätsm<strong>an</strong>agement<br />
CLXXVIII
Runde 2<br />
liegt auf dem Alter; deswegen brauche ich alle benachbarten Disziplinen dazu. Es gibt demzufolge<br />
zum Beispiel psychologische Beiträge zum Setting, zur Dyade und so weiter, es gibt Beiträge zum<br />
restlichen Umfeld und so weiter.<br />
Identitätsbildung<br />
Professionali‐<br />
sierung<br />
Dyade <strong>der</strong><br />
Pflegebeziehung<br />
Pflegebedürftiger<br />
und Pflegen<strong>der</strong><br />
Setting<br />
Qualitäts‐<br />
m<strong>an</strong>agement<br />
Überg<strong>an</strong>gsbereich zu benachbarten Disziplinen, wie<br />
Medizin, Sozialpolitik, Soziologie, Psychologie<br />
u.a.<br />
Auf die Aussage “Pflege ist kr<strong>an</strong>kenhauslastig“ (HB):<br />
Schulz‐Niesw<strong>an</strong>dt, 2011<br />
Das Kr<strong>an</strong>kenhaus ist in <strong>der</strong> Gerontologie ein g<strong>an</strong>z normales Thema, in <strong>der</strong> Pflege ist es historisch<br />
gekommen. Auch aufgrund <strong>der</strong> zunehmenden Alterung und <strong>der</strong> mehr und mehr zunehmenden<br />
Ausdifferenzierung. Im Vergleich zu früheren Zeiten, wo es Sammelbecken, Alten- und Siechenhaus<br />
war (E3.2.1).<br />
[HM]:<br />
Auf die Aussage, die Ergebnisse <strong>der</strong> Zeitschriften<strong>an</strong>alyse seien bestätigend (HB):<br />
<strong>Die</strong> Ausrichtung einer Zeitschrift beeinflusst die Themenfindung genauso wie die Gel<strong>der</strong>. Es kommt<br />
auch darauf <strong>an</strong>, in welcher Art und Weise die Themen publiziert werden. Stichwort: Formulierung<br />
von Titel, Schlagworten und Formulierung von Ergebnissen. Das ist sicher ein Trend. Das Medium<br />
beeinflusst den Blickwinkel. Sieht m<strong>an</strong> sich die PFLEGE (H<strong>an</strong>s Huber) genauer <strong>an</strong>, dort sind die<br />
Identitätsbildung<br />
CLXXIX
Runde 2<br />
Publikationen stark empirisch und im oberen Segment (Dyade nach S-N, Anm. MB) <strong>an</strong>gesiedelt;<br />
mit Ausnahmen – eine Son<strong>der</strong>ausgabe zur Theorie, welche eine Person damals stark gepusht hat.<br />
Bei den Ergebnissen fällt auf, dass das Wort „nur“ benutzt wird. Woher kommt es im Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit dem Ergebnis, dass sich „nur“ 10 % aller Artikel in den Zeitschriften mit dem alten Menschen<br />
beschäftigen? Kommt es von <strong>der</strong> Dringlichkeit des Problems in <strong>der</strong> Bevölkerung? <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
„per se“ ist breiter als die gerontologische <strong>Pflegewissenschaft</strong> und k<strong>an</strong>n auch als sich<br />
neu entwickelnde Wissenschaft nicht das gesamte Spektrum gleichberechtigt abdecken (E1.2.1).<br />
[S-N]:<br />
Auf die Stellungnahme „Gesetzgebung als Trigger für Verän<strong>der</strong>ungen“ (BS):<br />
Analyse des Zeitpunkts „Einführung <strong>der</strong> Pflegeversicherung in Deutschl<strong>an</strong>d“: <strong>Die</strong> Pflegeversicherung<br />
ist ein eigenes Policyfeld. Damit ist auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong> entscheidend vor<strong>an</strong>gekommen.<br />
Bis 1989 war <strong>der</strong> Versuch, die Altenpflege im SGBV einzugleichen. Einstieg damals mit ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflege. Alle haben gedacht: Da kommt d<strong>an</strong>n auch die Stationäre. D<strong>an</strong>n kam die eigene<br />
Säule im Sozialversicherungsgesetz. <strong>Die</strong> Etablierung des SGB XI war eine Legitimation für die<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong>, denn damit entst<strong>an</strong>d auch Forschungsbedarf (E3.2.2).<br />
[BS]:<br />
Auf die Aussage: „Das Medium beeinflusst den Blickwinkel“ (HM):<br />
Blick auf das Review-System in Zeitschriften: Unterliegt nicht auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong> Moden?<br />
Es ist „in“, etwas über Generationenforschung zu machen. Biografieorientierte Forschung, Politik<br />
und Wissenschaftsjournalismus hat etwas vorgegeben, was im Großen und G<strong>an</strong>zen unter dem<br />
epidemiologischen W<strong>an</strong>del abgebildet wird.<br />
Auf die Aussage „Begründungszw<strong>an</strong>g versus H<strong>an</strong>dlungszw<strong>an</strong>g“ (HB):<br />
Gerontologische Pflege wird unter „Angew<strong>an</strong>dter Gerontologie“ im Verb<strong>an</strong>d <strong>der</strong> DGGG 5 geführt.<br />
K<strong>an</strong>n die <strong>Pflegewissenschaft</strong> ihre Architektur entwickeln, ihr Dasein begründen in einer <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dten<br />
Pflegeforschung? Es muss <strong>der</strong> Markt bedient werden, <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Suche ist nach Lösungen<br />
o<strong>der</strong> nach Ideen, die nicht aus <strong>der</strong> Medizin kommen (E2.2.2).<br />
[HB]:<br />
Direkt dr<strong>an</strong> <strong>an</strong>schließend und auf die Aussage: „Das Medium beeinflusst den Blickwinkel“ (HM):<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Philosophie beziehungsweise des Profils in den Zeitschriften: zum Beispiel die<br />
PFLEGE (H<strong>an</strong>s Huber) in den 80er-Jahren: Da war das Profil diffus, und ich erinnere mich auch <strong>an</strong><br />
sehr schlechte Beiträge. <strong>Die</strong> haben damals alles <strong>an</strong>genommen. Es gab kein Reviewsystem und so<br />
weiter. D<strong>an</strong>n kam es zum Paradigmenwechsel: „Klinische Pflegepraxis“ und Einrichtung eines<br />
Reviewsystems; insofern hat sich die Publikationsl<strong>an</strong>dschaft da etwas verän<strong>der</strong>t. Auch bei <strong>der</strong><br />
ZfGG interdisziplinär schon in den 70er- und 80er-Jahren mit <strong>der</strong> Blickrichtung Medizin und Psy-<br />
5 Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie<br />
CLXXX
Runde 2<br />
chologie. „<strong>Die</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en (Disziplinen, Anm. MB) kommen d<strong>an</strong>n auch ein bisschen drin vor…“<br />
(E4.2.2).<br />
[S-N]:<br />
Direkt auf HB:<br />
Philosophie <strong>der</strong> Veröffentlichungspraxis: Hinweis auf die Qualität <strong>der</strong> <strong>an</strong>genommenen Beiträge.<br />
Das Interess<strong>an</strong>te ist die „ex <strong>an</strong>te“-Ablehnung, weil die Artikel nicht „passen“, thematisch. Es gibt<br />
vermutlich eine Fülle <strong>an</strong> pflegewissenschaftlichen Artikeln, die vom Selbstverständnis her <strong>an</strong><strong>der</strong>s<br />
sind, aber auch <strong>an</strong><strong>der</strong>s erscheinen. Vielleicht in einer soziologischen Zeitschrift. Im „Sozialen Fortschritt“<br />
tauchen m<strong>an</strong>chmal Beiträge auf, die sind nicht so eng pflegewissenschaftlich, die sind breiter,<br />
eher pflegepolitisch. Da bleibt natürlich die Frage: Welches Verständnis von <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
haben wir?<br />
Der hohe Anteil <strong>der</strong> qualitativen Sozialforschung, für den ich mich begeistere, ist ein typisches<br />
„Un<strong>der</strong>dog“- Verhalten in <strong>der</strong> Pflege. In <strong>der</strong> Soziologie ist nämlich <strong>der</strong> St<strong>an</strong>dard, dass die Akzept<strong>an</strong>z<br />
<strong>der</strong> qualitativen Forschung eher gering ist. Wenn ich mich erinnere, welche Kämpfe in <strong>der</strong><br />
Deutschen Gesellschaft für Soziologie herrschten, eine eigene Sektion (qualitative Forschung,<br />
Anm. MB) aufzumachen, da sieht m<strong>an</strong> heute noch die fehlende Akzept<strong>an</strong>z. Ich spreche jetzt über<br />
Zeitschriften. Dass <strong>der</strong> Büchermarkt explodiert mit Dissertationen und Lehrbüchern zur qualitativen<br />
Sozialforschung, ist etwas <strong>an</strong><strong>der</strong>es. Aber in <strong>der</strong> qualitätsbewährten, vom Selbstverständnis weitgehend<br />
qu<strong>an</strong>titativen Soziologie kommt m<strong>an</strong> mit qualitativen Methoden g<strong>an</strong>z schlecht rein. In <strong>der</strong><br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> dagegen ist <strong>der</strong> Anteil qualitativer Forschung sehr hoch. Warum? Ich fahre mal<br />
die Schiene: „Wo ich Identität gewinne und mich abgrenze gegenüber <strong>an</strong><strong>der</strong>en.“ Auch das ist so<br />
ein Beispiel für Pubertätsrituale.<br />
Auf die Aussage „<strong>Pflegewissenschaft</strong> unterliegt Moden“ (BS):<br />
Sie kommen nämlich mit solchen Forschungen nur d<strong>an</strong>n in ihre Pflegezeitschrift rein. Machen Sie<br />
eine Forschung über die Dyade haben Sie Schwierigkeiten, in die Kölner Zeitschrift für Soziologie<br />
und Sozialpsychologie zu kommen, weil die wollen ein großes N, so wie ein Kollege sagt: „Soziologie<br />
ist nichts <strong>an</strong><strong>der</strong>es als <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte Mathematik.“ Also m<strong>an</strong> bildet Realität über mathematische<br />
Strukturmodelle ab, und wenn das natürlich Auswahlkriterien sind, d<strong>an</strong>n kommt es zur Konzentration<br />
bestimmter Beiträge in einer dieser wissenschaftlichen Zeitschriften, die Sie <strong>an</strong>alysiert haben.<br />
Das Themenspektrum <strong>der</strong> Gutachter ist interdisziplinär und die in den Zeitschriften ist monodisziplinär<br />
(E3.2.3)<br />
[HM]:<br />
Auf die Aussage „<strong>Pflegewissenschaft</strong> unterliegt Moden“ (BS) und Philosophie im Publikationsbetrieb<br />
(HB):<br />
Da ist wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zwiespalt, in dem wir sind: Qualitative Sozialforschung zu pushen, da es eine<br />
Methodologie ist, die unseren Fragestellungen entgegenkommt. Das steht in engem Zusammen-<br />
CLXXXI
Runde 2<br />
h<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Grundhaltung <strong>der</strong> Pflege (Pflegephilosophie) auf das Individuum bezogen; hier bestünden<br />
weitere Möglichkeiten zur Theorieentwicklung. Auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite: Der Zw<strong>an</strong>g, Drittmittelfin<strong>an</strong>zierung<br />
zu kriegen, da ist qualitative Forschung so gut wie ausgeschlossen in Österreich.<br />
Ich muss also immer etwas Qu<strong>an</strong>titatives dabei haben, dass es überhaupt Ch<strong>an</strong>cen auf eine Fin<strong>an</strong>zierung<br />
hat.<br />
Auch in den Publikationen sprengt uns diese EBN-Debatte 6 in eine bestimmte Richtung, das hat<br />
auch etwas mit <strong>der</strong> Außenwahrnehmung zu tun: diese Zerrissenheit <strong>der</strong> Suche nach Identitätsbildung,<br />
nach etwas Eigenem auf <strong>der</strong> einen Seite und auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite das starke Anhängen <strong>an</strong><br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>es, <strong>an</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>e Disziplinen und Methoden, um überhaupt gesehen und gehört zu werden.<br />
Auf die Aussage zur <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dten Forschung versus Grundlagenforschung (BS, HB):<br />
Wenn m<strong>an</strong> sich die pflegewissenschaftliche Debatte <strong>an</strong>schaut, d<strong>an</strong>n hat es Anf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> 90er Jahre<br />
eine wissenschaftstheoretische Debatte über die <strong>Pflegewissenschaft</strong> per se gegeben.<br />
H<strong>an</strong>dlungspraxis-(Pflege)Wissenschaft wurde damals decodiert, und d<strong>an</strong>n war aber Schluss damit;<br />
und es gibt so einen Gap („Lücke“, Anm. MB) dazwischen – das steht da, und wir haben jetzt diese<br />
Schlagworte „Angew<strong>an</strong>dte und Grundlagenforschung“, die zum Teil sehr kritiklos übernommen und<br />
rezipiert werden, weil sie ein Stück weit auch <strong>der</strong> Wissenschaftsstatistik inhärent sind, und Berta<br />
Schrems hat eine neue Debatte aufgemacht mit <strong>der</strong> Frage, ob m<strong>an</strong> sich hierzu wissenschaftstheoretisch<br />
nicht <strong>an</strong><strong>der</strong>s positionieren muss: Gibt es denn diese Trennung zwischen <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dter und<br />
Grundlagenforschung überhaupt? Und was bedeutet es, wenn wir uns diesem Diktat unterwerfen,<br />
diesem Dualismus, können wir unsere Identität nicht besser ausbilden nach dem Motto: <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
ist immer kontextbezogen! Nur <strong>der</strong> Rahmen <strong>der</strong> Kontextualisierung ist ein <strong>an</strong><strong>der</strong>er, um<br />
damit auch in eine breitere wissenschaftlich-(methodische) Diskussion einzusteigen. Es besteht ein<br />
grundsätzliches, wissenschaftstheoretisches Vakuum, das irgendwo in <strong>der</strong> Debatte entst<strong>an</strong>den ist,<br />
die ja auch abgebrochen ist (E1.2.2).<br />
[HB]:<br />
Direkt auf HM:<br />
Das ist sicher richtig, was Sie sagen! Wissenschaftstheoriedebatte erweitert auf Ende <strong>der</strong> Achtziger-,<br />
Anf<strong>an</strong>g bis Mitte <strong>der</strong> Neunzigerjahre. <strong>Die</strong> ist d<strong>an</strong>n abgeflaut mit <strong>der</strong> VÖ 7 Dornheim et al. Ich<br />
hab das mo<strong>der</strong>iert damals, und es war signifik<strong>an</strong>t, wie <strong>an</strong>gstbesetzt diese Debatte damals war. <strong>Die</strong><br />
brach d<strong>an</strong>n ab. <strong>Die</strong> Pflegetheoriedebatte best<strong>an</strong>d hauptsächlich aus <strong>der</strong> Adaption <strong>der</strong> Gr<strong>an</strong>d<br />
Theories-Debatte aus den USA. Da ist sicher eine Ch<strong>an</strong>ce verpasst worden. Auch im Dualismus<br />
qu<strong>an</strong>titativ/qualitativ. Da hätte m<strong>an</strong> <strong>an</strong> die sozialwissenschaftliche Diskurse <strong>der</strong> Sechziger- und<br />
Siebzigerjahre <strong>an</strong>knüpfen können. <strong>Die</strong>ser Zug ist irgendwie verpasst worden. Jetzt besteht die<br />
Gefahr, ein Stück weit <strong>an</strong> diese EBN-Debatte <strong>an</strong>schlussfähig zu werden; dabei kommt m<strong>an</strong> in die<br />
6 Evidence Based Nursing<br />
7 Veröffentlichung<br />
CLXXXII
Runde 2<br />
Problematik hinein, die Science entwickeln zu müssen, die aber nur bedingt geeignet für Pflegefragen<br />
erscheint. Es müssen Endpunkte definiert werden, es müssen die RCTs her! Das passt zum<br />
Teil, zum Teil aber auch nicht. Jedenfalls muss m<strong>an</strong> sich da schon stark verbiegen. Das ist eine<br />
g<strong>an</strong>z schwierige Debatte, aber da ist eine Ch<strong>an</strong>ce verpasst worden (E4.2.3).<br />
[BS]:<br />
Im Anschluss auf die Ökonomisierungserscheinungen in <strong>der</strong> Wissenschaft „Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
triggert Themen“ (HM), „Begründungszw<strong>an</strong>g versus H<strong>an</strong>dlungszw<strong>an</strong>g“ (HB) und direkt im Anschluss<br />
auf (HB) „Methodische Zwänge“:<br />
Als die Grounded-Theory-Debatte abriss, hat da diese Ökonomisierungswelle nicht auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
erreicht? Ein Prozess im Erwachsenwerden: Ich muss mich dem wirtschaftlichen<br />
Druck auch wissenschaftlich stellen? <strong>Die</strong>ses Wesen <strong>der</strong> Wissenschaft auf Endpunkte hinzuarbeiten,<br />
hat sich weiter fortgesetzt. Ist es nicht auch die Angst, die Absolventen (aus den pflegewissenschaftlichen<br />
Studiengängen, Anm. MB) sollen auch eine Tätigkeit bekommen in diesem Feld? Und<br />
deshalb müssen wir sie auch mit diesen Mitteln ausbilden. Qualitativ ist g<strong>an</strong>z okay für „nebenher“,<br />
aber eigentlich müssen wir qu<strong>an</strong>titativ arbeiten. Ich muss meinem Verwaltungsleiter erklären können,<br />
was „N“ ist. Also auch hier: Inwieweit drückt die Praxis hinein in den Diskurs? (E2.2.3).<br />
[S-N]:<br />
Direkt im Anschluss auf BS:<br />
Ist Grundlagenforschung in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> überhaupt möglich? Wenn ich grundlagenorientiert<br />
forschen will, muss ich Spezialist sein. Es gibt hier im Hause eine Debatte ob historischer<br />
Pflegeforschung. Für historische Pflegeforschung muss ich Historiker sein, von den Methoden her<br />
und so weiter. M<strong>an</strong> hat zwar eine Neigung zu dem Themengebiet, aber es ist nicht <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
Wenn m<strong>an</strong> Grundlagenforschung machen will, d<strong>an</strong>n muss m<strong>an</strong> Spezialist sein, ein Mediziner<br />
macht d<strong>an</strong>n Forschung o<strong>der</strong> ein Jurist: Nehmen wir Begriffe wie Entmündigung o<strong>der</strong> Würde im<br />
Alter. Wenn m<strong>an</strong> das richtig diskutieren will, muss m<strong>an</strong> Jurist sein o<strong>der</strong> im Grenzbereich praktische<br />
Philosophie o<strong>der</strong> Ethik o<strong>der</strong> beides, aber eigentlich doch gar nicht <strong>Pflegewissenschaft</strong>. Das ist in<br />
<strong>der</strong> Sozialpolitik genauso. Ich bin immer sehr <strong>an</strong>wendungsbezogen, aber wenn ich Sozialpolitik<br />
grundlagentheoretisch mache, d<strong>an</strong>n bewege ich mich im Feld des Rechts, <strong>der</strong> Soziologie, <strong>der</strong> Geschichte.<br />
Vielleicht ist das auch so ein Aspekt, <strong>der</strong> sich ausdrückt, das Getriebensein durch Forschung,<br />
aber bezogen auf die Dyade, vom Kern her bezogen auf die Praxis. Gute Arbeit machen,<br />
im Sinne von einer guten Arbeitsforschung (E3.2.4).<br />
[BS]:<br />
Direkt im Anschluss auf S-N:<br />
Ist es im interdisziplinären Feld überhaupt möglich, Grundlagenforschung zu machen? <strong>Die</strong> Problematik<br />
ist doch: Beweisen Sie mir die Wirksamkeit von Pflege, würde ein Mediziner sagen, wenn<br />
CLXXXIII
Runde 2<br />
m<strong>an</strong> ihn darauf <strong>an</strong>spricht, dass m<strong>an</strong> pflegewissenschaftlich-grundlagenorientiert arbeitet. Darauf<br />
sind die Grundlagen stark reduziert (E2.2.4).<br />
[HB]:<br />
Direkt im Anschluss auf BS:<br />
Es ist schwierig, wirklich interdisziplinär zu forschen. In diesem Sinne die Souveränität aufzubringen,<br />
ich habe hier ein Forschungsfeld – das bezeichne ich hier gar nicht als monodisziplinäre Ver<strong>an</strong>staltung,<br />
son<strong>der</strong>n bin von vornherein auf <strong>der</strong> interdisziplinären Agenda aufgestellt. Das ist eine<br />
Form von Selbstbewusstsein, die <strong>Pflegewissenschaft</strong> moment<strong>an</strong> noch nicht hat, son<strong>der</strong>n sie<br />
klammert sich <strong>an</strong> ihr Proprium – was das auch immer sein mag – und die Entwicklung hin zu den<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen ist erst in den letzten fünf bis acht Jahren losgeg<strong>an</strong>gen. Zum Beispiel Schäffer<br />
und <strong>an</strong><strong>der</strong>e, aber da tut m<strong>an</strong> sich immer noch sehr schwer damit. Es ist weitgehend immer noch<br />
„closed shop“ („geschlossener Betrieb“, Anm. MB) und die Leute, die auf Interdisziplinarität drängen,<br />
die haben es schwer. Übrigens auch in <strong>der</strong> Gerontologie. Da ist die Frage <strong>der</strong> Inter- bzw.<br />
Tr<strong>an</strong>sdisziplinarität (vergleiche Mittelstraß) quasi ein Unwort. Weil die Karrieren immer auf monodisziplinären<br />
Schienen verlaufen (Mediziner, Psychologen und so weiter).<br />
Es wird also von Interdisziplinarität vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Profession gesprochen. Und die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
versucht jetzt, ein Stück weit diese Entwicklung nachzuvollziehen, muss sich aber<br />
auch gleichzeitig eingestehen, dass das Feld nur interdisziplinär verh<strong>an</strong>delbar ist. Sie ist im Spagat,<br />
ihr Proprium zu finden und die Kompetenz und die Souveränität zu haben, über den Tellerr<strong>an</strong>d<br />
hinauszuschauen, denn wir haben ein Feld vor Augen, dazu brauchen wir aus <strong>der</strong> Soziologie das<br />
und aus <strong>der</strong> Psychologie das und so weiter, das macht es auch schwer, <strong>an</strong> Gel<strong>der</strong> zu kommen. Ich<br />
sehe das also wie S-N, aber auch als große Herausfor<strong>der</strong>ung (E4.2.4).<br />
[S-N]:<br />
Direkt im Anschluss auf HB:<br />
Aufwertung von Pflege als eigenem Gegenst<strong>an</strong>d ist extrem wichtig. Nur die Frage bleibt: Resultiert<br />
daraus eine eigene <strong>Pflegewissenschaft</strong>? Für mich ist Pflegeforschung Teil <strong>der</strong> Sozialpolitik, weil es<br />
geht um die Lebenslage von Menschen, und die Lebensqualität ist ein Teil davon, die extrem ernst<br />
zu nehmen ist. Es geht ja nicht nur um die Intensivmedizin und die Unfallmedizin. Pflege ist ein<br />
extrem wichtiges Thema. Beispiel: Forschungsvorhaben: Hypothesentestung: Sind in Wohngemeinschaften<br />
mit Pflegeaufw<strong>an</strong>d die Reziprozitätsstrukturen intensiver als im Heimsetting? Daraus<br />
resultieren unterschiedliche Profile im Aktivierungsgrad, und das führt zu einer besseren Verlaufsdynamik<br />
von Gesundheit. <strong>Die</strong> Skalen dafür kommen aus <strong>der</strong> etablierten Psychologie (Selbstwirksamkeit,<br />
Selbstm<strong>an</strong>agementskalen et cetera), <strong>der</strong> theoretische Anteil ist tr<strong>an</strong>saktionalistisch (Lazarus).<br />
Methodische Auswertung: statistisches Matching mit großem N aus <strong>der</strong> empirischen Sozialforschung.<br />
Hier kommt nichts rein aus <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>. Trotzdem: <strong>Die</strong> Frage bleibt pflege-<br />
CLXXXIV
Runde 2<br />
zentriert. Es ist eine pflegewissenschaftliche Fragestellung: Nichts <strong>an</strong> Theorien und Methoden und<br />
Messinstrumenten kommt dabei aus <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> (E3.2.5):<br />
[HM]:<br />
Direkt im Anschluss auf S-N:<br />
Das ist aber gerade <strong>der</strong> Punkt, wo m<strong>an</strong> als <strong>Pflegewissenschaft</strong> sehr, sehr vorsichtig wird. Wir sind<br />
ja auch noch in einem Legitimationszw<strong>an</strong>g, zumindest in Österreich, wo m<strong>an</strong> d<strong>an</strong>n sehr schnell<br />
wegradiert wird o<strong>der</strong> werden k<strong>an</strong>n. Brauchen wir da die <strong>Pflegewissenschaft</strong> o<strong>der</strong> k<strong>an</strong>n das die Soziologie<br />
nicht genauso machen?<br />
Ich möchte die These entschärfen, dass es keine Theorien in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> gebe, sie<br />
sind ein Stück weit <strong>an</strong><strong>der</strong>s gelagert. Wir suchen unsere wissenschaftlichen Bezüge – die Grundlagen<br />
kommen da durchaus von wo<strong>an</strong><strong>der</strong>s, wie zum Beispiel die Systemtheorie – aber wenn ich<br />
versuche; die Wissenschaftsentwicklung insoweit zu stärken, zum Beispiel im Bereich <strong>der</strong> Entwicklung<br />
und Testung <strong>der</strong> Middle-R<strong>an</strong>ge-Theories, d<strong>an</strong>n können wir daraus auch Instrumente ableiten,<br />
die vielleicht Bezüge zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Wissenschaften abbilden, aber im Kern aus <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
kommen. M<strong>an</strong> merkt allerdings, dass diese Debatten nicht im Mittelpunkt stehen, son<strong>der</strong>n<br />
(dass die Debatten, Anm. MB) eher sozioökonomisch und so weiter geprägt sind.<br />
Wo die <strong>Pflegewissenschaft</strong> allerdings eine Originärität aufweist, d<strong>an</strong>n ist das <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> „Körperlichkeit“.<br />
Denn keine <strong>an</strong><strong>der</strong>e Disziplin deckt dies in <strong>der</strong> Art und Weise ab, wie die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
es tut. Gerade im Bereich des alten Menschen ist das etwas sehr Originäres, <strong>an</strong> dem Punkt<br />
wird gerade entwickelt, aber wir sind noch nicht sehr weit, und d<strong>an</strong>n kommen die Grenzen und<br />
Zwänge von außen, die das behin<strong>der</strong>n, um auf die Grundlagenforschung zurückzukommen: die<br />
beiden Begriffe „Grundlagenforschung“ und „<strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte Forschung“, illustriert am Beispiel <strong>der</strong><br />
Untersuchung von Zegelin-Abt zur Bettlägerigkeit. Da hinken diese Begriffe. Ist das jetzt Grundlagen-<br />
o<strong>der</strong> <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte Forschung? We<strong>der</strong> noch. Es ist beides. Es braucht auch hier eine <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
Definition als die klassischen es abbilden. Das ist auch die Frage, wenn wir uns <strong>der</strong> Gerontologie<br />
zuwenden, dass wir uns unbedingt unsere wissenschaftstheoretische Position klarmachen. Gerade<br />
da, wo wir uns ins Interdisziplinäre einklinken. Das muss geschehen, sonst können wir nicht interdisziplinär<br />
sein (E1.2.3).<br />
[BS]:<br />
Direkt im Anschluss auf HM:<br />
Um zur Praxis zu kommen: Das Thema „alter Mensch“ ist o<strong>der</strong> wäre ein sehr d<strong>an</strong>kbares Thema,<br />
wo sich die <strong>Pflegewissenschaft</strong> beweisen k<strong>an</strong>n, um Interdisziplinarität zu zeigen – sowohl nach<br />
innen, als auch nach außen (E2.2.5)<br />
[HB]:<br />
Direkt im Anschluss auf BS:<br />
CLXXXV
Runde 2<br />
Es ist aus meiner Sicht auch eine Ch<strong>an</strong>ce für die <strong>Pflegewissenschaft</strong>, dieses Thema <strong>der</strong> Interdisziplinarität<br />
noch einmal g<strong>an</strong>z neu ernst zu nehmen. Bei vielen etablierten Disziplinen ist das eher<br />
eine „Mogelpackung“, aber immerhin die Gerontologie hat es geschafft, sich unter dem Deckm<strong>an</strong>tel<br />
<strong>der</strong> Interdisziplinarität auch institutionell zu vereinigen. Das ist nicht unwichtig. Natürlich gibt es <strong>an</strong><br />
den Rän<strong>der</strong>n Kollegen, die sich primär als Soziologen o<strong>der</strong> Psychologen sehen und von ihrer Ursprungsdisziplin<br />
aus draufschauen. Trotzdem hat es die Gerontologie geschafft, das Gros unter ein<br />
Dach zu versammeln und sich aber nur bedingt mit dem Thema „Interdisziplinarität“ zu befassen.<br />
Und die Theoriedebatte in <strong>der</strong> Gerontologie war immer ein Desi<strong>der</strong>at. <strong>Die</strong>se Fragen, die wir jetzt<br />
hier für die <strong>Pflegewissenschaft</strong> diskutieren, das sind keine exklusiven Probleme, son<strong>der</strong>n die sehe<br />
ich auch in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen. Allerdings haben die es geschafft einen „Forschungsfokus“ aufzubauen,<br />
eine „Infrastruktur“ zu etablieren. Damit tut sich die <strong>Pflegewissenschaft</strong> schwer (E4.2.5).<br />
[S-N]:<br />
Direkt im Anschluss auf HB:<br />
Gibt es eine „Theoriefeindlichkeit“? Muss es eine „Feldsozialisation“ geben?<br />
Zur Feldsozialisation: Das Selbstverständnis, das von den ersten Kohorten (Pflegeakademikern,<br />
Anm. MB) geprägt wurde, hieß: „M<strong>an</strong> k<strong>an</strong>n nur über Pflege forschen, wenn m<strong>an</strong> aus dem Feld<br />
kommt.“ Deswegen auch hier ein Stück Selbstrevidierung: Natürlich k<strong>an</strong>n ein Soziologe eine Studie<br />
machen, aber versteht er genug vom Feld? Ich merke oft, wenn Soziologen Sozialpolitikforschung<br />
machen, dass das g<strong>an</strong>z schön d<strong>an</strong>ebengehen k<strong>an</strong>n, weil sie das Sozialrecht nicht kennen, sie<br />
kennen nicht diese Details. Im Umkehrschluss weiß ich nicht genau, ob m<strong>an</strong> immer aus dem Feld<br />
kommen k<strong>an</strong>n. Wenn m<strong>an</strong> aus dem Feld kommt, d<strong>an</strong>n ist diese selbstgesteuerte Enge natürlich<br />
sozialisationsbedingt.<br />
Zur Theoriefeindlichkeit: Ich finde Frau Uzarewicz‘ Buch faszinierend, weil Sie eben vom Körper<br />
gesprochen haben, zur Ontologie <strong>der</strong> Leiblichkeit. Da sagt sie, ja wär‘ schön, wenn das mal gelesen<br />
und diskutiert wird. Also Theoriefeindlichkeit. Aber gar nicht mal despektierlich gemeint gegenüber<br />
<strong>der</strong> Pflege: In unseren Gesundheitsökonomiestudiengängen, da mussten die ersten Kohorten<br />
vorher einen Gesundheitsberuf haben. Das waren g<strong>an</strong>z <strong>an</strong><strong>der</strong>e Hörer als jetzt die letzten fünf,<br />
sechs Jahre. M<strong>an</strong> hat d<strong>an</strong>n umgestellt auf Abitur, weil es Rechtsprobleme gab, es haben sich Leute<br />
eingeklagt, wie grenzt m<strong>an</strong> das und das beruflich ab. D<strong>an</strong>n hatten wir Sozialversicherungs<strong>an</strong>gestellte<br />
<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenkassen und so weiter. Seitdem wir diesen Wechsel haben, ist das g<strong>an</strong>z <strong>an</strong><strong>der</strong>s.<br />
Ich f<strong>an</strong>ge im ersten Semester mit philosophischer Anthropologie <strong>an</strong>, ich gehe von <strong>der</strong> Situation des<br />
leidenden Menschen aus, bevor ich zur Situation in den Institutionen des Gesundheitswesens<br />
komme. Da fällt denen die Klappe runter, das wollen die nicht hören. <strong>Die</strong> wollen als Bachelor in die<br />
Praxis und fragen: „Was bringt mir das?“ Und so ähnlich ist das auch mit <strong>der</strong> Pflege. <strong>Die</strong> müsste<br />
eigentlich mit <strong>der</strong> Ontologie <strong>der</strong> Leiblichkeit <strong>an</strong>f<strong>an</strong>gen. Und nachher mit Pflege nach Modellen und<br />
so weiter. Da taucht d<strong>an</strong>n schon was auf über Personalismus. Aber wenn m<strong>an</strong> das verstehen will,<br />
d<strong>an</strong>n muss m<strong>an</strong> auch was machen über „Personalismus im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t“. Bis zu dem Grenzbe-<br />
CLXXXVI
Runde 2<br />
reich <strong>der</strong> theologischen Anthropologie, zum Themenbereich „guter Fürsorge“ und so weiter. Theoriefeindlichkeit<br />
gibt es wo<strong>an</strong><strong>der</strong>s auch, nämlich immer d<strong>an</strong>n, wenn die Leute <strong>an</strong> einem bestimmten<br />
Feld interessiert sind und wenn es berufsstrategisch ist. „Ich will da arbeiten“ und nicht die<br />
Umwegsituation machen; erst mal <strong>an</strong>thropologische Inhalte machen und erst mal Grundlagendisziplinen<br />
aufarbeiten. <strong>Die</strong> kommen aus dem Feld und wollen zum Beispiel in <strong>der</strong> pädagogischen<br />
o<strong>der</strong> m<strong>an</strong>ageriellen Rolle aufsteigen. Und damit sind die dort oben fixiert (mit Blick auf das Schaubild<br />
Abb. oben, Anm. MB) (E3.2.6).<br />
[HB]:<br />
Direkt im Anschluss auf S-N:<br />
Aber so ist das ja in Deutschl<strong>an</strong>d gelaufen. Genauso. „Pflege braucht Eliten“ heißt im Grunde „Eliten<br />
für die Praxis“ und die Studiengänge sind etabliert worden ... (E4.2.6).<br />
[S-N]:<br />
Direkt eingeworfen, auf HB:<br />
… Ich f<strong>an</strong>d das falsch mit <strong>der</strong> Fachhochschule, <strong>Pflegewissenschaft</strong> gehört <strong>an</strong> die Universität!<br />
(E3.2.7)<br />
[HB]:<br />
Direkt erwi<strong>der</strong>t auf S-N:<br />
<strong>Die</strong>ser Sprung ist eben nicht gelungen in Deutschl<strong>an</strong>d, son<strong>der</strong>n es hat jetzt eine FH-Tradition, und<br />
d<strong>an</strong>n kommt hinzu eine zunehmende Versozialwissenschaftlichung <strong>der</strong> Pflegestudiengänge. Hilde<br />
Steppe hatte die Akademisierung schon so entwickelt wie Du (mit Blick auf S-N, Anm. MB), da<br />
muss keine Praxisgeschichte vorneweg, die sind ja ein Stück weit durch die Praxis auch deformiert<br />
(E4.2.7).<br />
[HM]:<br />
Im Anschluss <strong>an</strong> HB:<br />
Wir haben in Wien beides: l<strong>an</strong>gjährig erfahrene Pflegende und junge Menschen, die gar nicht wissen,<br />
was Pflege eigentlich ist. <strong>Die</strong> grundsätzlich auch nicht wissen, wie kr<strong>an</strong>ke Menschen aussehen,<br />
wie ein Pflegeheim von innen aussieht. Das sind die zwei Welten. Das hört jetzt auf. Ich find‘s<br />
fast ein bisschen schade, dass diese junge naive Sicht auf die Dinge jetzt rausfällt. Da hat schon<br />
Bologna auch einen Einfluss gehabt. Wir sind im Bereich „Gesundheit“ ja die besten Bologna-<br />
Erfüllungsgehilfen, wir sind die Musterschüler, den Bachelor berufsbezogen und d<strong>an</strong>n kommt die<br />
wissenschaftliche Schiene. <strong>Die</strong> Frage ist: Was passiert da schon alles vorher o<strong>der</strong> was k<strong>an</strong>n nachher<br />
nicht mehr passieren? Das wird m<strong>an</strong> jetzt bei uns sehen. Da spiegelt sich auch eine bildungspolitische<br />
Strategie wi<strong>der</strong> (E1.2.4).<br />
[BS]:<br />
Abschließend, und zur „Philosophie im Publikationsbetrieb“ (HB, HM)<br />
CLXXXVII
Runde 2<br />
Mit Blick in die Zukunft und weiter <strong>an</strong> das wissenschaftliche Peer-Review-System gedacht werden<br />
es die Autoren wohl schwer haben, theoretische Beiträge und solche hermeneutischer Denkart<br />
unterzubringen, wenn sie bereits beim Verfassen des Beitrags schon die „Schere des Reviewers“<br />
im Kopf haben müssen (E2.2.6).<br />
[S-N]:<br />
Abschließend und bezugnehmend auf einen fehlenden Themenaspekt in den Ergebnissen <strong>der</strong><br />
Zeitschriften<strong>an</strong>alyse, des Trends „Alter und Behin<strong>der</strong>ung“:<br />
Ein kleiner Exkurs zum Abschluss noch zum Thema „Behin<strong>der</strong>ung“: Auch beim Thema „Behin<strong>der</strong>ung“<br />
ist ein starker Praxisbezug bemerkbar, nämlich in den Therapiekonzepten. Heilpädagogisches<br />
Können war Therapieausbildung. Es gab aber in <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenarbeit immer eine große<br />
Theorietradition im Bezug auf Recht, Philosophie und Ethik. Und das ist umgekehrt zur Pflege:<br />
Was es dort kaum gibt, ist eine Tradition von Disability-Forschung o<strong>der</strong> allgemein empirischer Forschung.<br />
Nur g<strong>an</strong>z, g<strong>an</strong>z wenig. In <strong>der</strong> Pflege hingegen gibt es sehr viel empirische Forschung,<br />
wenig Theorie, in <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenarbeit sehr viel Theorie (Inklusion, Teilhabeschaft) und auch Therapieforschung,<br />
nicht aber empirische Sozialforschung. Disability-Forschung ist eher kulturwissenschaftlich<br />
(E3.2.7).<br />
CLXXXVIII
Runde 3<br />
Runde 3:<br />
Fazit: „Welche zukünftigen Herausfor<strong>der</strong>ungen und H<strong>an</strong>dlungsspielräume aus <strong>der</strong> jeweiligen<br />
disziplinären Sicht sehen die Experten für die <strong>Pflegewissenschaft</strong>? Abschluss.<br />
(Nur noch mit Experten 1–3!)<br />
[HM]:<br />
Zukünftige H<strong>an</strong>dlungsspielräume:<br />
Sehr stark sehe ich die Identitätsbildung mit dem Blickwinkel auf Interdisziplinarität. Ohne über die<br />
eigene Identität zu wissen, sei es wissenschaftstheoretisch, methodisch o<strong>der</strong> auch im Hinblick,<br />
welchen Theoriebezug haben wir, wird es nicht gelingen, Interdisziplinarität gut zu leben. O<strong>der</strong> m<strong>an</strong><br />
bezeichnet sich grundsätzlich als interdisziplinäres Feld, da müsste m<strong>an</strong> das Rad aber fast wie<strong>der</strong><br />
zurückdrehen. Das heißt nicht Ausgrenzung von <strong>an</strong><strong>der</strong>en, son<strong>der</strong>n eine bewusste Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
damit. <strong>Die</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung wird die sein, auf diesem Grat zu w<strong>an</strong><strong>der</strong>n und sich nicht nur<br />
durch das, was Außenzwänge <strong>an</strong>geht, wie Forschungsför<strong>der</strong>ung, Review-Verfahren o<strong>der</strong><br />
Evidence-Based-Debatte Anerkennung zu verschaffen. Interdisziplinäre Sichtweise gibt aber auch<br />
H<strong>an</strong>dlungsspielräume. Wenn wir nämlich unsere ureigene Perspektive klarmachen können, so<br />
meine ich auch, dass diese gewünscht ist. <strong>Die</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung wird also sein, die „Pubertätsphase“<br />
auszuleben, um erwachsen werden zu können. Sich auch die Zeit zu nehmen, erwachsen werden<br />
zu können und ohne dabei meinen zu müssen, schon erwachsen zu sein, um überhaupt mit<br />
den „Erwachsenen“ auch reden zu können. Es k<strong>an</strong>n auch <strong>der</strong> „Pubertätsbonus“ ausgespielt werden.<br />
Wir versuchen es in Österreich über eigene Forschungstöpfe. „Wir brauchen noch was Eigenes!“<br />
Stichwort: Forschungsagenden. In Österreich ist <strong>der</strong>zeit eine Gruppe für den nichtmedizinischen<br />
Bereich berufen, um diese Forschungsagenda zu erheben. Ich sehe die dringende<br />
Notwendigkeit für eine solche Forschungsagenda. Sie soll auch klarmachen, wozu ist es notwendig,<br />
die pflegewissenschaftliche Perspektive hinzuzunehmen. Wo ist aber <strong>der</strong> Mehrwert? Ich k<strong>an</strong>n<br />
nicht erwarten, dass die Politik von sich aus weiß, wohin und <strong>an</strong> wen die Gel<strong>der</strong> fließen müssen.<br />
Das ist wichtig, damit m<strong>an</strong> ein ernstzunehmen<strong>der</strong> Player werden k<strong>an</strong>n. Der Trend geht aber klar zu<br />
den bereits bestehenden EU-Projekten mit <strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung: Beteiligt euch da! <strong>Die</strong> Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
blockt damit inzwischen wie<strong>der</strong> dieses Unterf<strong>an</strong>gen, Player im Gesundheitswesen werden<br />
zu können. Der Trend geht klar zur Interdisziplinarität. Da sind wir immer so ein wenig hinten nach<br />
(E1.3.1).<br />
[BS]:<br />
1. Grundlagenarbeit wie philosophische und wissenschaftstheoretische Grundlagen<br />
<strong>Die</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist stark beschäftigt mit Lehre. <strong>Pflegewissenschaft</strong> in Österreich und<br />
Deutschl<strong>an</strong>d ist <strong>an</strong> den Hochschulen noch stark instrumentalisiert im Sinne einer Feldentwicklung<br />
o<strong>der</strong> Feldprofessionalisierung. Wenn ich in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> Philosophie lehre, bekomme ich<br />
<strong>an</strong> diesem Tag immer „schlechte Werte“. Ich sag d<strong>an</strong>n immer: „<strong>Die</strong> Pflege hasst die Philosophie!“<br />
CLXXXIX
Runde 3<br />
Wo k<strong>an</strong>n also eine Weiterentwicklung passieren? Was k<strong>an</strong>n stattfinden? Auch im Bezug auf Theoriebildung<br />
im Hinblick auf vorgefundene Theorien o<strong>der</strong> Theorien, die schon da sind? Das müsste<br />
vielmehr im pflegewissenschaftlichen Denken und den Diskursen integriert werden. Es wäre gut,<br />
wenn philosophische Grundlagen und wissenschaftstheoretische Ansätze integriert würden. Wenn<br />
das in <strong>der</strong> pflegewissenschaftlichen Ausbildung vermehrt möglich wäre, weg von Alltagsinstrumenten,<br />
die sich auch stark verän<strong>der</strong>n, d<strong>an</strong>n wäre es auch möglich, das Negative, das Traurige des<br />
Alters o<strong>der</strong> des Pflegedaseins zu benennen, zu beschreiben und es auch darzustellen. Pflegebedürftigkeit<br />
ist wie L<strong>an</strong>glebigkeit von tristen Anteilen begleitet.<br />
2. Empirische Forschung<br />
Ich würde die Ausbildung gerne auch ermuntern, in die Forschung einzusteigen, denn nationale<br />
Forschung wird eher zurückgefahren. Konkrete Bedarfe und Bedürfnisse aus <strong>der</strong> Pflege zu benennen,<br />
auch wenn es kleine studentische Projekte sind, ich k<strong>an</strong>n sie d<strong>an</strong>n auch in die Lehre integrieren,<br />
auch wenn es sich in die großen Forschungsverbünde nicht integrieren lässt. Trotzdem ließen<br />
sich dadurch die Studierenden <strong>an</strong> eine Forschungstradition her<strong>an</strong> führen. Es endet lei<strong>der</strong> oft bei<br />
<strong>der</strong> Unterscheidung qu<strong>an</strong>titativ/qualitativ o<strong>der</strong> Texte lesen und verstehen, konkretes Forschen wird<br />
allerdings nicht gelehrt (E2.3.1).<br />
[S-N]:<br />
1. Zukünftige Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Den noch nicht abgeschlossenen Prozess <strong>der</strong> Selbstkonzeptfindung ausleben, den Spagat zwischen<br />
Selbstkonzept und Umweltoffenheit allerdings eingehen, ohne sich verkrampft <strong>der</strong> eigenen<br />
Innerlichkeit zuzuwenden.<br />
2. Selbstkonzeptfindung<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> sollte körperzentriert von <strong>der</strong> personalen Mitte ausgehen, sich aber als interdisziplinär<br />
definieren. <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Sie hat den Fokus<br />
<strong>der</strong> Dyade, <strong>der</strong> körperzentrierten personalen Mitte, wobei die Abgrenzung zur chronischen Erkr<strong>an</strong>kung<br />
und Behin<strong>der</strong>ung geht, denn zum Beispiel bei <strong>der</strong> Demenz sind wir nicht nur ausschließlich<br />
beim Körper, son<strong>der</strong>n auch bei Geist und Seele, also nur Körper allein ist es nicht, im Sinne einer<br />
Funktionalität. Es ist eine Frage des Körperverständnisses. Hier hat die <strong>Pflegewissenschaft</strong> ihren<br />
Feldbezug. Sie sollte im Feld auch interdisziplinär sein und das bedeutet „umweltoffen“. Möglicherweise<br />
illustriert die Frage: „Wie sollte m<strong>an</strong> eine pflegewissenschaftliche Fakultät berufen?“<br />
diese Problemstellung gut. Ich würde nicht ausschließlich pflegewissenschaftlich-promovierte und<br />
habilitierte Personen berufen, ich würde echte Mediziner, echte Psychologen, echte Soziologen,<br />
die alle ihre Methoden beherrschen, berufen, die aber alle in <strong>der</strong> Tat glaubhaft machen: Wir werden<br />
Pflegeforschung machen!<br />
Das ist aber ein Problem in <strong>der</strong> Berufungspolitik. Das heißt, wir brauchen gute Methoden <strong>der</strong> klinischen<br />
und Versorgungsforschung, aber mit <strong>der</strong> Zielrichtung „Pflegeforschung“.<br />
CXC
Runde 3<br />
3. Ausbildung<br />
Technik und Skills, eingebettet in breite Persönlichkeitsbildung mit Habitus und Charakter. Menschen<br />
ohne Philosophie und Ethik weniger gut und praxisgewappnet. Bei Führungsfragen müssen<br />
Haltungsfragen eine Rolle spielen (E3.3.1).<br />
CXCI
Runde 1: Wie decken sich die die Ergebnisse mit den jeweilig spezifischen wissenschaftlichen Erfahrungen des Alltags? Welche Begründungen finden sich für Schwerpunktsetzungen<br />
o<strong>der</strong> Auslassungen bei den Themen? Statements:<br />
Anlage F: Codierte Expertenaussagen<br />
Runde 1<br />
Expertin 1 (E1) Experte 2 (E2) Experte 3 (E3) Experte 4 (E4)<br />
E1.1.1<br />
Fin<strong>an</strong>zierung von Forschung<br />
triggert Themen<br />
E1.1.2<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> fehlt in<br />
gewissen Fel<strong>der</strong>n Expertise (z.<br />
B. primäre Prävention)<br />
E2.1.1<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> unterliegt<br />
einer „Selbsttäuschung“ und<br />
„Selbsterhöhung“<br />
E2.1.2<br />
Noch keine Ansätze für die Entwicklung<br />
konzeptioneller Ansätze<br />
<strong>der</strong> Laienpflege vorh<strong>an</strong>den (Fokussierung<br />
rein auf die professionelle<br />
Pflege)<br />
E3.1.1<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> steckt in <strong>der</strong> „Pubertätsphase“.<br />
In Abgrenzung zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />
etablierten wissenschaftlichen Disziplinen,<br />
wie <strong>der</strong> Medizin sucht sie nach<br />
„Identität“, darin ist auch eine „selbstgesteuerte<br />
Engführung“ <strong>der</strong> Themen begründet.<br />
Bewegt sie sich in <strong>an</strong><strong>der</strong>e wissenschaftliche<br />
Gebiete verliert sie ihr<br />
„wissenschaftsdefinitorisches Monopol“.<br />
<strong>Die</strong> Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> interdisziplinären<br />
Gesundheitswesen-Forschung unterscheiden<br />
sich in <strong>der</strong> Themenbreite von<br />
denen <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
E3.1.2<br />
Neuere Steuerungsformen, wie das Public<br />
-M<strong>an</strong>agement verfügen über <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
„mentale Modelle“: Stichwort Professionalisierung:<br />
Was ist <strong>der</strong> alte und <strong>der</strong> neue<br />
Habitus <strong>der</strong> Profession? Was läuft ab in<br />
<strong>der</strong> Selbstkonstituierung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>?<br />
(Selbstfindung versus diskursive<br />
Professionalisierung). Illustrierendes<br />
Beispiel: Selbstregulierungsparadigma im<br />
E4.1.1<br />
Pflege befindet sich frei nach Twenhöfel im Klammergriff<br />
<strong>der</strong> Disziplinen, dem Zugriff <strong>der</strong> etablierten<br />
Disziplinen und dem „Strampeln nach Eigenentwicklung“:<br />
unter historisch-wissenschaftsstrukturellen<br />
Entwicklungen hat sich die deutsche <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
stark kr<strong>an</strong>kenhauslastig entwickelt, die meisten<br />
Professuren kamen aus diesem zumeist FH-Bereich,<br />
stark mit Fokus M<strong>an</strong>agement und Pädagogik, die<br />
letzten 10-15 Jahre auch vermehrt mit klinischen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen.<br />
E4.1.2<br />
Fokus liegt stark bei den Betroffenen, dem H<strong>an</strong>dhabbarmachen<br />
des Pflegeproblems, im Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit <strong>der</strong> Demenz sehr viel Interventionsforschung (wie<br />
z. B. herausfor<strong>der</strong>ndes Verhalten). Etablierte deutsche<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> orientiert sich stark <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>an</strong>gloamerik<strong>an</strong>ischen Diskussion, weniger <strong>an</strong> kritischen<br />
sozialwissenschaftlichen Debatten. Fokus<br />
hierbei liegt auf H<strong>an</strong>dhabbarkeit, Regulierung und<br />
M<strong>an</strong>ipulation von Umwelten zur besseren Beherr-<br />
CXCII
Runde 1: Wie decken sich die die Ergebnisse mit den jeweilig spezifischen wissenschaftlichen Erfahrungen des Alltags? Welche Begründungen finden sich für Schwerpunktsetzungen<br />
o<strong>der</strong> Auslassungen bei den Themen? Statements:<br />
E1.1.3<br />
Eigener Gegenst<strong>an</strong>dsbereich<br />
(<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> (Anm.<br />
MB) ist noch nicht entwickelt<br />
bzw. herrscht eine Vorsicht vor<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Wissenschaftsbereichen(Identitätsbildung<br />
versus Interdisziplinarität)<br />
E2.1.3<br />
Gesundheitsprofession versus<br />
unverän<strong>der</strong>ten Tätigkeitsspektrum<br />
<strong>der</strong> Pflege (Hinweis „Selbsterhöhung“<br />
E2.1.1)<br />
(Strukturelle Professionalisierung<br />
versus h<strong>an</strong>dlungsorientierter De-<br />
Professionalisierung)<br />
E2.1.4<br />
Orientierung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Medizin<br />
(hinsichtl. struktureller Professionalisierung,<br />
Anm. MB), negative<br />
Anteile des Alter(n)s werden<br />
ausgeblendet (Pflege ist auch mit<br />
Ekel und Scham behaftet, Hinweis<br />
„Selbsttäuschung“ E2.1.1)<br />
SVR im Zusammenh<strong>an</strong>g mit Prävention<br />
als lockerer liberaler Diskurs o<strong>der</strong> als<br />
Selbstinszenierung i. S. des Selbstm<strong>an</strong>agements,<br />
Selbstwirksamkeitssteuerung<br />
und Selbstinszenierung von Biografien<br />
mit öffentlichem Druck und Schuldzuweisung:<br />
„Wer nicht Prävention macht, ist<br />
Parasit!“<br />
E3.1.3<br />
Über den Sektor <strong>der</strong> Epidemiologie werden<br />
„R<strong>an</strong>dstrukturen“ inszeniert. Im Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit dem Alter kommen<br />
demografische Gesichtspunkte mit ins<br />
Spiel.<br />
E3.1.4<br />
Befund passt ins Bild. Das Dilemma <strong>der</strong><br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> ist, dass sie sich<br />
durch Abgrenzung selbst architektonisch<br />
aufbauen muss, sich aber auch, will sie<br />
erfolgreich sein, gleich interdisziplinär<br />
öffnen muss.<br />
E3.1.5<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> ist Policyfeld. Sie<br />
schung des Pflegeproblems.<br />
E4.1.3<br />
Angew<strong>an</strong>dte Forschung bringt die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
im Praxisfeld in ein Dilemma:Grundlagenforschung<br />
ist schlecht möglich, son<strong>der</strong>n Forschung wird aus <strong>der</strong><br />
Praxis (von Politik, Institutionen, long- term-care)<br />
<strong>an</strong>gefor<strong>der</strong>t, die konkrete Probleme gelöst haben<br />
wollen. Schnittstelle ist hier „Probleme zu bedienen“<br />
und affirmativ abzuarbeiten. Kritische Impulse sind in<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> eher marginal.<br />
E4.1.4<br />
<strong>Die</strong>s zeigt sich auch in den Ergebnissen <strong>der</strong> Zeitschriften<strong>an</strong>alyse:<br />
die Ergebnisse sind bestätigend,<br />
affirmativ, systemerhaltend wenig aus <strong>der</strong> Dist<strong>an</strong>z im<br />
Sinne einer Kritik <strong>an</strong> den Verhältnissen, son<strong>der</strong>n in<br />
<strong>der</strong> Forschungstradition begründet mit den Gel<strong>der</strong>n,<br />
die wir bekommen o<strong>der</strong> nicht. Druck <strong>der</strong> Praxis auf<br />
die Wissenschaft ist enorm, bestimmte Ergebnisse zu<br />
erzeugen!<br />
CXCIII
Runde 1: Wie decken sich die die Ergebnisse mit den jeweilig spezifischen wissenschaftlichen Erfahrungen des Alltags? Welche Begründungen finden sich für Schwerpunktsetzungen<br />
o<strong>der</strong> Auslassungen bei den Themen? Statements:<br />
muss Theorien und Befunde <strong>an</strong><strong>der</strong>er<br />
Disziplinen aufnehmen, sie hat keine<br />
eigenen Theorien, das macht das „<strong>an</strong>gstbesetzte“<br />
Verhalten (nicht grenzüberschreitend<br />
sein zu wollen, Anm. MB) aus.<br />
CXCIV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
Runde 2<br />
Expertin 1 (E1) Experte 2 (E2) Experte 3 (E3) Experte 4 (E4)<br />
E2.2.1<br />
Erwi<strong>der</strong>t auf E4:<br />
Wir haben keine gute Leibtheorie, <strong>der</strong><br />
Körper als Ort des Alter(n)s wird nicht<br />
ben<strong>an</strong>nt, wird ausgeblendet, stattdessen<br />
wird über den Körper Qualität von intern<br />
und extern gemacht (I)<br />
Auf die Aussage „Pflege ist kr<strong>an</strong>kenhauslastig“<br />
(E4) und die Aussage “Pflege ist in<br />
<strong>der</strong> Pubertätsphase“ (E3):<br />
<strong>Die</strong> sog. normale Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
ist erschwert. Am Beispiel<br />
E4.2.1<br />
Auf „Pflege blendet negative Anteile des<br />
Alter(n)s aus“ (E2):<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> steht in <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong><br />
etablierten Gerontologie, die den Fokus des<br />
„normal aging“ prominent einsetzt.<br />
Pflege nimmt nicht den kritischen Aspekt des<br />
Alter(n)s, wie in den Phänomenen wie Gebrechlichkeit,<br />
Ekel etc. auf, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Fokus<br />
liegt auf einem Professionalisierungsverständnis<br />
von technisch-akademischer H<strong>an</strong>dhabbarkeit<br />
von Pflegebedarfen.<br />
CXCV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
Österreich wird deutlich: dort ist die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
aufgrund einer Gesetzesän<strong>der</strong>ung<br />
notwendig geworden, nicht weil<br />
m<strong>an</strong> <strong>der</strong> Meinung war m<strong>an</strong> bräuchte sie,<br />
deswegen noch einmal <strong>der</strong> Hinweis auf<br />
das Statement <strong>der</strong> „Selbsterhöhung“: Wir<br />
sind jetzt was geworden! Und auf <strong>der</strong><br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite muss die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
noch in <strong>der</strong> Pubertätsphase befindlich<br />
schon ihren eigenen Nachwuchs zeugen,<br />
obwohl sie noch gar nicht richtig<br />
zeugungsfähig ist. Drei Viertel <strong>der</strong> professionellen<br />
pflegewissenschaftlichen Mitarbeit<br />
„geht in Lehre drauf“, weil ein Bedarf<br />
bedient werden muss, weniger Selbstinszenierung<br />
als vielmehr Notwendigkeit,<br />
um eigene Mitarbeiter „aufzubauen“ (II)<br />
E3.2.1<br />
Auf die Aussage“ Identität versus Interdisziplinarität“<br />
(E1), Hinweis auf Schaubild,<br />
das E3 <strong>an</strong>zeichnet:<br />
<strong>Die</strong> Dyade pflegebedürftiger Mensch-<br />
Pflegeperson steht im ersten konzentrischen<br />
Kreis, im zweiten die Bel<strong>an</strong>ge <strong>der</strong><br />
Versorgungsstrukturen, wie Professionalisierung,<br />
<strong>der</strong> Settings und des QM. Bis<br />
hier ist <strong>der</strong> Zugriff <strong>der</strong> Pflege noch möglich,<br />
je mehr m<strong>an</strong> nach oben geht, desto<br />
höher die Identität, je mehr nach unten,<br />
CXCVI
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E1.2.1<br />
Auf die Aussage die Ergebnisse <strong>der</strong><br />
Zeitschriften<strong>an</strong>alyse seien bestätigend<br />
(E4):<br />
<strong>Die</strong> Ausrichtung einer Zeitschrift beeinflusst<br />
die Themenfindung genauso wie<br />
die Gel<strong>der</strong>. Es kommt auch darauf <strong>an</strong>,<br />
desto weniger, umso mehr Schnittstellen<br />
zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen. Fokussierung <strong>der</strong><br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> auf die ersten beiden<br />
konzentrischen Kreise, um nicht in den<br />
Schnittstellenbereich zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen<br />
einzudringen. <strong>Die</strong> Gerontologie liegt<br />
quer dazu, Fokus liegt auf dem Alter,<br />
deswegen brauche ich alle benachbarten<br />
Disziplinen dazu. Es gibt demzufolge z. B.<br />
psychologische Beiträge zum Setting, zur<br />
Dyade usw. es gibt Beiträge zum restlichen<br />
Umfeld usw.<br />
Auf die Aussage “Pflege ist<br />
kr<strong>an</strong>kenhauslastig“ (E4):<br />
Das Kr<strong>an</strong>kenhaus ist in <strong>der</strong> Gerontologie<br />
ein g<strong>an</strong>z normales Thema, in <strong>der</strong> Pflege<br />
ist es historisch gekommen. Auch aufgrund<br />
<strong>der</strong> zunehmenden Alterung und <strong>der</strong><br />
mehr und mehr zunehmenden Ausdifferenzierung.<br />
Im Vergleich zu früheren Zeiten,<br />
wo es Sammelbecken, Alten- und<br />
Siechenhaus war.<br />
CXCVII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
in welcher Art und Weise die Themen<br />
publiziert werden. Stichwort: Formulierung<br />
von Titel, Schlagworten und Formulierung<br />
von Ergebnissen Das ist sicher<br />
ein Trend. Das Medium beeinflusst<br />
den Blickwinkel. Sieht m<strong>an</strong> sich die<br />
PFLEGE (H<strong>an</strong>s Huber) genauer <strong>an</strong>, dort<br />
sind die Publikationen stark empirisch<br />
und im oberen Segment (Dyade nach<br />
E3, Anm. MB) mit Ausnahmen (eine<br />
Son<strong>der</strong>ausgabe zur Theorien, welche<br />
eine Person stark gepusht hat).<br />
Bei den Ergebnissen fällt auf, dass das<br />
Wort „nur“ benutzt wird. Woher kommt<br />
es im Zusammenh<strong>an</strong>g mit dem Ergebnis,<br />
dass sich „nur“ 10% aller Artikel in<br />
den Zeitschriften mit dem alten Menschen<br />
beschäftigen, kommt es von <strong>der</strong><br />
Dringlichkeit des Problems in <strong>der</strong> Bevölkerung?<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> „per se“<br />
ist breiter als die gerontologische <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
und k<strong>an</strong>n auch als sich<br />
neu entwickelnde Wissenschaft nicht<br />
das gesamte Spektrum gleichberechtigt<br />
abdecken.<br />
E3.2.2<br />
Auf die Stellungnahme Gesetzgebung als<br />
Trigger für Verän<strong>der</strong>ungen(E2)<br />
Analyse des Zeitpunkts „Einführung <strong>der</strong><br />
CXCVIII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E2.2.2<br />
Auf die Aussage: „Das Medium beeinflusst<br />
den Blickwinkel“ (E1)<br />
Blick auf das Review -System in Zeitschriften:<br />
Unterliegt nicht auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
Moden? Es ist „in“ etwas<br />
über Generationenforschung zu machen,<br />
biografieorientierte Forschung, Politik und<br />
Wissenschaftsjournalismus hat etwas<br />
vorgegeben, was im Großen und G<strong>an</strong>zen<br />
unter dem epidemiologischen W<strong>an</strong>del<br />
abgebildet wird (I).<br />
Auf die Aussage „Begründungszw<strong>an</strong>g<br />
versus H<strong>an</strong>dlungszw<strong>an</strong>g“ (E4)<br />
Gerontologische Pflege wird unter „Angew<strong>an</strong>dter<br />
Gerontologie“ im Verb<strong>an</strong>d <strong>der</strong><br />
Pflegeversicherung in D“: <strong>Die</strong> Pflegeversicherung<br />
ist ein eigenes Policyfeld. Damit<br />
ist auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong> entscheidend<br />
vor<strong>an</strong> gekommen. Bis 1989 war <strong>der</strong><br />
Versuch die Altenpflege im SGBV einzugleichen.<br />
Einstieg damals mit ambul<strong>an</strong>ter<br />
Pflege. Alle haben gedacht: da kommt<br />
d<strong>an</strong>n auch die Stationäre. D<strong>an</strong>n kam die<br />
eigene Säule im Sozialversicherungsgesetz.<br />
<strong>Die</strong> Etablierung des SGB XI war<br />
eine Legitimation für die <strong>Pflegewissenschaft</strong>,<br />
denn damit entst<strong>an</strong>d auch Forschungsbedarf.<br />
CXCIX
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
DGGG geführt. K<strong>an</strong>n die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
ihre Architektur entwickeln, ihr Dasein<br />
begründen in einer <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dten<br />
Pflegeforschung? Es muss <strong>der</strong> Markt<br />
bedient werden, <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Suche ist<br />
nach Lösungen o<strong>der</strong> nach Ideen, die nicht<br />
aus <strong>der</strong> Medizin kommen (II).<br />
E3.2.3<br />
Direkt auf E4<br />
E4.2.2<br />
Auf die Aussage: „Das Medium beeinflusst<br />
den Blickwinkel“ (E1)<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Philosophie bzw. des Profils<br />
in den Zeitschriften. E.g. die PFLGE<br />
(H<strong>an</strong>s Huber) in den 80er-Jahren, da war das<br />
Profil diffus und ich erinnere mich auch <strong>an</strong><br />
sehr schlechte Beiträge. <strong>Die</strong> haben damals<br />
alles <strong>an</strong>genommen. Es gab kein Reviewsystem<br />
usw. D<strong>an</strong>n kam es zum Paradigmenwechsel:<br />
„Klinische Pflegepraxis“ und<br />
Einrichtung eines Reviewsystems, insofern<br />
hat sich die Publikationsl<strong>an</strong>dschaft da etwas<br />
verän<strong>der</strong>t. Auch bei <strong>der</strong> ZfGG interdisziplinär<br />
schon in den 70er- und 80er- Jahren mit <strong>der</strong><br />
Blickrichtung Medizin und Psychologie. „<strong>Die</strong><br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en (Disziplinen, Anm. MB) kommen<br />
d<strong>an</strong>n auch ein bisschen drin vor…“<br />
CC
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
Philosophie <strong>der</strong> Veröffentlichungspraxis:<br />
Hinweis auf die Qualität <strong>der</strong> <strong>an</strong>genommenen<br />
Beiträge. Das Interess<strong>an</strong>te ist die „ex<br />
<strong>an</strong>te“- Ablehnung, weil die Artikel nicht<br />
„passen“, thematisch. Es gibt vermutlich<br />
eine Fülle <strong>an</strong> pflegewissenschaftlichen<br />
Artikeln, die vom Selbstverständnis her<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>s sind, aber auch <strong>an</strong><strong>der</strong>s erscheinen.<br />
Vielleicht in einer soziologischen<br />
Zeitschrift, im „Sozialen Fortschritt“ tauchen<br />
m<strong>an</strong>chmal Beiträge auf, die sind<br />
nicht so eng pflegewissenschaftlich, die<br />
sind breiter, eher pflegepolitisch. Da bleibt<br />
natürlich die Frage: welches Verständnis<br />
von <strong>Pflegewissenschaft</strong> haben wir (hier in<br />
<strong>der</strong> Gruppendiskussion, Anm. MB)?<br />
Der hohe Anteil <strong>der</strong> qualitativen Sozialforschung,<br />
für den ich mich begeistere ist ein<br />
typisches „Un<strong>der</strong>dog“- Verhalten in <strong>der</strong><br />
Pflege. In <strong>der</strong> Soziologie ist nämlich <strong>der</strong><br />
St<strong>an</strong>dard, dass die Akzept<strong>an</strong>z <strong>der</strong> qualitativen<br />
Forschung eher gering ist. Wenn ich<br />
mich erinnere welche Kämpfe in <strong>der</strong><br />
Deutschen Gesellschaft für Soziologie<br />
herrschten, eine eigene Sektion (qualitative<br />
Forschung, Anm. MB) aufzumachen,<br />
da sieht m<strong>an</strong> heute noch die fehlende<br />
Akzept<strong>an</strong>z. Ich spreche jetzt über Zeitschriften.<br />
Dass <strong>der</strong> Büchermarkt explo-<br />
CCI
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
diert mit Dissertationen und Lehrbüchern<br />
zur qualitativen Sozialforschung ist etwas<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>es. Aber in <strong>der</strong> qualitätsbewährten<br />
vom Selbstverständnis weitgehend qu<strong>an</strong>titativen<br />
Soziologie kommt m<strong>an</strong> mit qualitativen<br />
Methoden g<strong>an</strong>z schlecht rein. In<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> dagegen ist <strong>der</strong><br />
Anteil qualitativer Forschung sehr hoch.<br />
Warum? Ich fahre mal die Schiene: „wo<br />
ich Identität gewinne und mich abgrenze<br />
gegenüber <strong>an</strong><strong>der</strong>en. Auch das ist so ein<br />
Beispiel für Pubertätsrituale (I)<br />
Auf die Aussage „<strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
unterliegt Moden“ (E2):<br />
Sie kommen nämlich mit solchen Forschungen<br />
nur d<strong>an</strong>n in Ihre Pflegzeitschrift<br />
rein, machen Sie eine Forschung über die<br />
Dyade haben Sie Schwierigkeiten in die<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie<br />
zu kommen, weil die wollen<br />
ein großes N, sowie ein Kollege sagt:<br />
„Soziologie ist nichts <strong>an</strong><strong>der</strong>es als <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte<br />
Mathematik“. Also m<strong>an</strong> bildet<br />
Realität über mathematische Strukturmodelle<br />
ab und wenn das natürlich Auswahlkriterien<br />
sind, d<strong>an</strong>n kommt es zur Konzentration<br />
bestimmter Beiträge in einer<br />
dieser wissenschaftlichen Zeitschriften,<br />
die sie <strong>an</strong>alysiert haben. Das Themen-<br />
CCII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E1.2.2<br />
Auf die Aussage „<strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
unterliegt Moden“ (E2) und Philosophie<br />
im Publikationsbetrieb (E4)<br />
Da ist wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zweispalt, in dem wir<br />
sind: qualitative Sozialforschung zu<br />
pushen, da es eine Methodologie ist,<br />
die unseren Fragestellungen entgegen<br />
kommt. Das steht in engem Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit <strong>der</strong> Grundhaltung <strong>der</strong><br />
Pflege (Pflegephilosophie) auf das Individuum<br />
bezogen, hier bestünden weitere<br />
Möglichkeiten zur Theorieentwicklung.<br />
Auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite: <strong>der</strong> Zw<strong>an</strong>g<br />
Drittmittelfin<strong>an</strong>zierung zu kriegen, da ist<br />
qualitative Forschung so gut wie ausgeschlossen<br />
in Österreich. Ich muss also<br />
immer etwas Qu<strong>an</strong>titatives dabei haben,<br />
dass es überhaupt Ch<strong>an</strong>cen auf eine<br />
Fin<strong>an</strong>zierung hat.<br />
Auch in den Publikationen sprengt uns<br />
diese EBN-Debatte in eine bestimmte<br />
Richtung, das hat auch etwas mit <strong>der</strong><br />
spektrum <strong>der</strong> Gutachter ist interdisziplinär<br />
und die in den Zeitschriften ist monodisziplinär<br />
(II)<br />
(Memo! Selbstverständnis <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
versus Selbstverständnis im<br />
Publikationsbetrieb, Methodologie)<br />
CCIII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
Außenwahrnehmung zu tun: diese Zerrissenheit<br />
<strong>der</strong> Suche nach Identitätsbildung,<br />
nach etwas Eigenem auf <strong>der</strong> einen<br />
Seite und auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite<br />
das starke Anhängen <strong>an</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>es, <strong>an</strong><br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>e Disziplinen und Methoden, um<br />
überhaupt gesehen und gehört zu werden.<br />
Auf die Aussage zur <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dten Forschung<br />
versus Grundlagenforschung<br />
(E2 und E4):<br />
Wenn m<strong>an</strong> sich die pflegewissenschaftliche<br />
Debatte <strong>an</strong>schaut, d<strong>an</strong>n hat es<br />
Anf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> 90er-Jahre eine wissenschaftstheoretische<br />
Debatte über die<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> per se gegeben.<br />
H<strong>an</strong>dlungspraxis-(Pflege)Wissenschaft<br />
wurde damals decodiert und d<strong>an</strong>n war<br />
aber Schluss damit und es gibt so einen<br />
Gap („Lücke“, Anm. MB) dazwischen –<br />
das steht da und wir haben jetzt diese<br />
Schlagworte „Angew<strong>an</strong>dte und Grundlagenforschung“,<br />
die zum Teil sehr kritiklos<br />
übernommen und rezipiert werden,<br />
weil sie ein Stück weit auch <strong>der</strong><br />
Wissenschaftsstatistik inhärent sind) u.<br />
Berta Schrems hat eine neue Debatte<br />
aufgemacht mit <strong>der</strong> Frage, ob m<strong>an</strong> sich<br />
hierzu wissenschaftstheoretisch nicht<br />
CCIV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>s positionieren muss: gibt es denn<br />
diese Trennung zwischen <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dter<br />
und Grundlagenforschung überhaupt<br />
und was bedeutet es, wenn wir uns<br />
diesem Diktat unterwerfen, diesem Dualismus,<br />
können wir unser Identität nicht<br />
besser ausbilden nach dem Motto: <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
ist immer kontextbezogen!<br />
Nur <strong>der</strong> Rahmen <strong>der</strong> Kontextualisierung<br />
ist ein <strong>an</strong><strong>der</strong>er, um damit<br />
auch in eine breitere wissenschaftlich-<br />
(methodische) Diskussion einzusteigen.<br />
Es besteht ein grundsätzliches, wissenschaftstheoretisches<br />
Vakuum, das irgendwo<br />
in <strong>der</strong> Debatte entst<strong>an</strong>den ist,<br />
die ja auch abgebrochen ist.<br />
E4.2.3<br />
Direkt auf E1:<br />
Das ist sicher richtig, was Sie sagen! Wissenschaftstheoriedebatte<br />
erweitert auf Ende<br />
<strong>der</strong> 80er, Anf<strong>an</strong>g bis Mitte <strong>der</strong> 90er-Jahre.<br />
<strong>Die</strong> ist d<strong>an</strong>n abgeflaut mit <strong>der</strong> VÖ Dornheim<br />
et al. Ich hab das mo<strong>der</strong>iert damals und es<br />
war signifik<strong>an</strong>t, wie <strong>an</strong>gstbesetzt diese Debatte<br />
damals war. <strong>Die</strong> brach d<strong>an</strong>n ab. Pflegetheoriedebatte<br />
best<strong>an</strong>d hauptsächlich aus<br />
<strong>der</strong> Adaption von Gr<strong>an</strong>d Theories -Debatte<br />
aus den USA. Da ist sicher eine Ch<strong>an</strong>ce<br />
verpasst worden. Auch im Dualismus qu<strong>an</strong>ti-<br />
CCV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E2.2.3<br />
Im Anschluss auf die Ökonomisierungserscheinungen<br />
in <strong>der</strong> Wissenschaft „Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
triggert Themen“ (E1),<br />
„Begründungszw<strong>an</strong>g versus H<strong>an</strong>dlungszw<strong>an</strong>g“<br />
(E4) und direkt im Anschluss auf<br />
(E4) „Methodische Zwänge“:<br />
Als die Grounded-Theory-Debatte abriss,<br />
hat da diese Ökonomisierungswelle nicht<br />
auch die <strong>Pflegewissenschaft</strong> erreicht? Ein<br />
Prozess im Erwachsenwerden: Ich muss<br />
mich dem wirtschaftlichen Druck auch<br />
wissenschaftlich stellen? <strong>Die</strong>ses Wesen<br />
tativ/qualitativ. Da hätte m<strong>an</strong> <strong>an</strong> die sozialwissenschaftliche<br />
Diskurse <strong>der</strong> 60er und 70er<br />
Jahre <strong>an</strong>knüpfen können. <strong>Die</strong>ser Zug ist irgendwie<br />
verpasst worden. Jetzt besteht die<br />
Gefahr ein Stück weit <strong>an</strong> diese EBN-Debatte<br />
<strong>an</strong>schlussfähig zu werden, dabei kommt m<strong>an</strong><br />
in die Problematik hinein die Science entwickeln<br />
zu müssen, die aber nur bedingt geeignet<br />
für Pflegefragen erscheinen. Es müssen<br />
Endpunkte definiert werden, es müssen die<br />
RCT’s her! Das passt zum Teil, zum Teil aber<br />
auch nicht. Jedenfalls muss m<strong>an</strong> sich da<br />
schon stark verbiegen. Das ist eine g<strong>an</strong>z<br />
schwierige Debatte, aber da ist ein Ch<strong>an</strong>ce<br />
verpasst worden.<br />
CCVI
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
<strong>der</strong> Wissenschaft auf Endpunkte hin zu<br />
arbeiten, hat sich weiter fortgesetzt. Ist es<br />
nicht auch die Angst, die Absolventen<br />
(aus den pflegewissenschaftlichen Studiengängen,<br />
Anm. MB) sollen auch eine<br />
Tätigkeit bekommen in diesem Feld? Und<br />
deshalb müssen wir sie auch mit diesen<br />
Mitteln ausbilden. Qualitativ ist g<strong>an</strong>z ok für<br />
„nebenher“, aber eigentlich müssen wir<br />
qu<strong>an</strong>titativ arbeiten. Ich muss erklären,<br />
was „N“ ist. Also auch hier; inwieweit<br />
drückt die Praxis hinein in den Diskurs?<br />
E3.2.4<br />
Direkt im Anschluss auf E2:<br />
Ist Grundlagenforschung in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
überhaupt möglich? Wenn<br />
ich grundlagenorientiert forschen will,<br />
muss ich Spezialist sein. Es gibt hier im<br />
Hause eine Debatte ob historischer Pflegeforschung.<br />
Für historische Pflegeforschung<br />
muss ich Historiker sein von den<br />
Methoden her usw. M<strong>an</strong> hat zwar eine<br />
Neigung zu dem Themengebiet, aber es<br />
ist nicht <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
Wenn m<strong>an</strong> Grundlagenforschung machen<br />
will, d<strong>an</strong>n muss m<strong>an</strong> Spezialist sein, ein<br />
Mediziner macht d<strong>an</strong>n Forschung o<strong>der</strong> ein<br />
Jurist: Nehmen wir Begriffe wie Entmündigung<br />
o<strong>der</strong> Würde im Alter. Wenn m<strong>an</strong><br />
CCVII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E2.2.4<br />
Direkt im Anschluss auf E3:<br />
Ist es im interdisziplinären Feld überhaupt<br />
möglich Grundlagenforschung zu machen?<br />
<strong>Die</strong> Problematik ist doch: Beweisen<br />
Sie mir die Wirksamkeit von Pflege, würde<br />
ein Mediziner sagen, wenn m<strong>an</strong> ihn darauf<br />
<strong>an</strong>spricht, dass m<strong>an</strong> pflegewissenschaftlich-grundlagenorientiert<br />
arbeitet.<br />
Darauf sind die Grundlagen stark reduziert.<br />
das richtig diskutieren will, muss m<strong>an</strong><br />
Jurist sein o<strong>der</strong> im Grenzbereich praktische<br />
Philosophie o<strong>der</strong> Ethik o<strong>der</strong> beides<br />
aber eigentlich doch gar nicht <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
Das ist in <strong>der</strong> Sozialpolitik genauso.<br />
Ich bin immer sehr <strong>an</strong>wendungsbezogen,<br />
aber wenn ich Sozialpolitik<br />
grundlagentheoretisch mache, d<strong>an</strong>n bewege<br />
ich mich im Feld des Rechts, <strong>der</strong><br />
Soziologie, <strong>der</strong> Geschichte. Vielleicht ist<br />
das auch so ein Aspekt, <strong>der</strong> sich ausdrückt,<br />
das Getriebensein durch Forschung<br />
aber bezogen auf die Dyade vom<br />
Kern her bezogen auf die Praxis. Gute<br />
Arbeit machen, im Sinne von einer Arbeitsforschung.<br />
CCVIII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E3.2.5<br />
Direkt im Anschluss auf E4:<br />
Aufwertung von Pflege als eigenem Gegenst<strong>an</strong>d<br />
ist extrem wichtig. Nur die Frage<br />
bleibt: resultiert daraus eine eigene <strong>Pflegewissenschaft</strong>?<br />
Für mich ist Pflegeforschung<br />
Teil <strong>der</strong> Sozialpolitik, weil es geht<br />
um die Lebenslage von Menschen und<br />
die Lebensqualität ist ein Teil davon, <strong>der</strong><br />
extrem ernst zu nehmen ist. Es geht ja<br />
nicht nur um die Intensivmedizin und die<br />
Unfallmedizin. Pflege ist ein extrem wichtiges<br />
Thema. Beispiel: Forschungsvorhaben:<br />
Hypothesentestung: sind in Wohngemeinschaften<br />
mit Pflegeaufw<strong>an</strong>d die<br />
Reziprozitätsstrukturen intensiver als im<br />
Heimsetting. Daraus resultieren unterschiedliche<br />
Profile im Aktivierungsgrad<br />
und das führt zu einer besseren Verlaufsdynamik<br />
von Gesundheit. <strong>Die</strong> Skalen<br />
dafür kommen aus <strong>der</strong> etablierten Psychologie<br />
(Selbstwirksamkeit, Selbstm<strong>an</strong>agementskalen<br />
etc.), <strong>der</strong> theoretische Anteil<br />
ist tr<strong>an</strong>saktionalistisch (Lazarus). Methodische<br />
Auswertung: statistisches<br />
Matching mit großem N aus <strong>der</strong> empirischen<br />
Sozialforschung. Hier kommt nichts<br />
rein aus <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>. Trotzdem<br />
die Frage bleibt pflegezentriert. Es ist<br />
CCIX
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E1.2.3<br />
Direkt im Anschluss auf E3:<br />
Das ist aber gerade <strong>der</strong> Punkt, wo m<strong>an</strong><br />
als <strong>Pflegewissenschaft</strong> sehr, sehr vorsichtig<br />
wird. Wir sind ja auch noch in<br />
einem Legitimationszw<strong>an</strong>g, zumindest<br />
in Österreich, wo m<strong>an</strong> d<strong>an</strong>n sehr schnell<br />
wegradiert wird o<strong>der</strong> werden k<strong>an</strong>n.<br />
Brauchen wir da die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
o<strong>der</strong> k<strong>an</strong>n das die Soziologie nicht genauso<br />
machen?<br />
Ich möchte die These entschärfen, dass<br />
es keine Theorien in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
gebe, sie sind ein Stück weit<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>s gelagert. Wir suchen unsere<br />
wissenschaftlichen Bezüge – die Grundlagen<br />
kommen da durchaus von wo<strong>an</strong><strong>der</strong>s,<br />
wie zum Beispiel die Systemtheorie<br />
–, aber wenn ich versuche, die Wissenschaftsentwicklung<br />
insoweit zu stärken,<br />
z. B. im Bereich <strong>der</strong> Entwicklung<br />
und Testung <strong>der</strong> Middle-R<strong>an</strong>ge-<br />
Theories, d<strong>an</strong>n können wir daraus auch<br />
Instrumente ableiten, die vielleicht Bezüge<br />
zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Wissenschaften abbil-<br />
eine pflegewissenschaftliche Fragestellung,<br />
nichts <strong>an</strong> Theorien und Methoden<br />
und Messinstrumenten kommt dabei aus<br />
<strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong>.<br />
CCX
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
den, aber im Kern aus <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
kommen. M<strong>an</strong> merkt allerdings,<br />
dass diese Debatten nicht im<br />
Mittelpunkt stehen, son<strong>der</strong>n (dass die<br />
Debatten, Anm. MB) eher sozioökonomisch<br />
usw. geprägt sind.<br />
Wo die <strong>Pflegewissenschaft</strong> allerdings<br />
eine Originärität aufweist, d<strong>an</strong>n ist das<br />
<strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> „Körperlichkeit“. Denn<br />
keine <strong>an</strong><strong>der</strong>e Disziplin deckt dies in <strong>der</strong><br />
Art und Weise ab, wie die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
es tut. Gerade im Bereich des<br />
alten Menschen ist das etwas sehr Originäres,<br />
<strong>an</strong> dem Punkt wird gerade<br />
entwickelt, aber wir sind noch nicht sehr<br />
weit und d<strong>an</strong>n kommen die Grenzen<br />
und Zwänge von außen, die das behin<strong>der</strong>n,<br />
um auf die Grundlagenforschung<br />
zurück zu kommen: die beiden Begriffe<br />
Grundlagenforschung und <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte<br />
Forschung, illustriert am Beispiel <strong>der</strong><br />
Untersuchung von Zegelin-Abt zur Bettlägerigkeit.<br />
Da hinken diese Begriffe. Ist<br />
das jetzt Grundlagen- o<strong>der</strong> <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte<br />
Forschung? We<strong>der</strong> noch. Es ist beides.<br />
Es braucht auch hier eine <strong>an</strong><strong>der</strong>e Definition<br />
als die Klassischen es abbilden.<br />
Das ist auch die Frage, wenn wir uns<br />
<strong>der</strong> Gerontologie zuwenden, dass wir<br />
CCXI
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
uns unbedingt unsere wissenschaftstheoretische<br />
Position klar machen. Gerade<br />
da, wo wir uns ins Interdisziplinäre<br />
einklinken. Das muss geschehen, sonst<br />
können wir nicht interdisziplinär sein.<br />
E2.2.5<br />
Direkt im Anschluss auf E1:<br />
Um zur Praxis zu kommen: das Thema<br />
„alter Mensch“ ist o<strong>der</strong> wäre ein sehr<br />
d<strong>an</strong>kbares Thema, wo sich die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
beweisen k<strong>an</strong>n, um Interdisziplinarität<br />
zu zeigen: sowohl nach innen, als<br />
auch nach außen.<br />
E4.2.5<br />
Direkt im Anschluss auf E2:<br />
Es ist aus meiner Sicht auch eine Ch<strong>an</strong>ce für<br />
die <strong>Pflegewissenschaft</strong>, dieses Thema <strong>der</strong><br />
Interdisziplinarität noch einmal g<strong>an</strong>z neu<br />
ernst zu nehmen. Bei vielen etablierten Disziplinen<br />
ist das eher eine „Mogelpackung“,<br />
aber immerhin die Gerontologie hat es geschafft<br />
sich unter dem Deckm<strong>an</strong>tel <strong>der</strong> Interdisziplinarität<br />
auch institutionell zu vereinigen.<br />
Das ist nicht unwichtig. Natürlich gibt es<br />
<strong>an</strong> den Rän<strong>der</strong>n Kollegen, die sich primär als<br />
Soziologen o<strong>der</strong> Psychologen sehen und von<br />
ihrer Ursprungsdisziplin aus drauf schauen.<br />
Trotzdem hat es die Gerontologie geschafft<br />
CCXII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E3.2.6<br />
Direkt im Anschluss auf E4:<br />
Gibt es eine „Theoriefeindlichkeit“? Muss<br />
es eine „Feldsozialisation“ geben?<br />
Zur Feldsozialisation: Das Selbstverständnis,<br />
das von den ersten Kohorten<br />
(Pflegeakademikern, Anm. MB) geprägt<br />
wurde, hieß: „m<strong>an</strong> k<strong>an</strong>n nur über Pflege<br />
forschen, wenn m<strong>an</strong> aus dem Feld<br />
kommt“, deswegen auch hier ein Stück<br />
Selbstrevidierung; natürlich k<strong>an</strong>n ein Soziologe<br />
eine Studie machen, aber versteht<br />
er genug vom Feld? Ich merke oft, wenn<br />
Soziologen Sozialpolitikforschung machen,<br />
dass das g<strong>an</strong>z schön d<strong>an</strong>ebengehen<br />
k<strong>an</strong>n, weil sie das Sozialrecht nicht<br />
kennen, sie kennen nicht diese Details. Im<br />
das Gros unter ein Dach zu versammeln und<br />
sich aber nur bedingt mit dem Thema Interdisziplinarität<br />
zu befassen. Und die Theoriedebatte<br />
in <strong>der</strong> Gerontologie war immer ein<br />
Desi<strong>der</strong>at. <strong>Die</strong>se Fragen, die wir jetzt hier für<br />
die <strong>Pflegewissenschaft</strong> diskutieren, das sind<br />
keine exklusiven Probleme, son<strong>der</strong>n die sehe<br />
ich auch in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Disziplinen. Allerdings<br />
haben die es geschafft einen „Forschungsfokus“<br />
aufzubauen, eine „Infrastruktur“ zu etablieren.<br />
Damit tut sich die <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
schwer.<br />
CCXIII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
Umkehrschluss weiß ich nicht genau, ob<br />
m<strong>an</strong> immer aus dem Feld kommen k<strong>an</strong>n.<br />
Wenn m<strong>an</strong> aus dem Feld kommt, d<strong>an</strong>n ist<br />
diese selbstgesteuerte Enge natürlich<br />
sozialisationsbedingt (I).<br />
Zur Theoriefeindlichkeit: ich finde Frau<br />
Uzarewicz‘ Buch faszinierend, weil sie<br />
eben vom Körper gesprochen haben, zur<br />
Ontologie <strong>der</strong> Leiblichkeit. Da sagt sie, ja<br />
wär schön, wenn das mal gelesen und<br />
diskutiert wird. Also Theoriefeindlichkeit.<br />
Aber gar nicht mal despektierlich gemeint<br />
gegenüber <strong>der</strong> Pflege: In unseren Gesundheitsökonomiestudiengängen,<br />
da<br />
mussten die ersten Kohorten vorher einen<br />
Gesundheitsberuf haben. Das waren g<strong>an</strong>z<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>e Hörer als jetzt die letzten 5,6 Jahre.<br />
M<strong>an</strong> hat d<strong>an</strong>n umgestellt auf Abitur,<br />
weil es Rechtsprobleme gab, es haben<br />
sich Leute eingeklagt, wie grenzt m<strong>an</strong> das<br />
und das beruflich ab. D<strong>an</strong>n hatten wir Sozialversicherungs<strong>an</strong>gestellte<br />
<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenkassen<br />
usw. Seitdem wir diesen<br />
Wechsel haben, ist das g<strong>an</strong>z <strong>an</strong><strong>der</strong>s. Ich<br />
f<strong>an</strong>ge im ersten Semester mit philosophischer<br />
Anthropologie <strong>an</strong>, ich gehe von <strong>der</strong><br />
Situation des leidenden Menschen aus<br />
bevor, ich zur Situation in den Institutionen<br />
des Gesundheitswesens komme. Da<br />
CCXIV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
fällt denen die Klappe runter, das wollen<br />
die nicht hören. <strong>Die</strong> wollen als Bachelor in<br />
die Praxis und fragen: „Was bringt mir<br />
das?“ Und so ähnlich ist das auch mit <strong>der</strong><br />
Pflege. <strong>Die</strong> müsste eigentlich mit <strong>der</strong> Ontologie<br />
<strong>der</strong> Leiblichkeit <strong>an</strong>f<strong>an</strong>gen. Und<br />
nachher mit Pflege nach Modellen usw.<br />
Da taucht d<strong>an</strong>n schon was auf über<br />
Personalismus, aber wenn m<strong>an</strong> das verstehen<br />
will, d<strong>an</strong>n muss m<strong>an</strong> auch was<br />
machen über „Personalismus im 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t“. Bis zu dem Grenzbereich<br />
<strong>der</strong> theologischen Anthropologie, zum<br />
Themenbereich „guter Fürsorge“ usw.<br />
Theoriefeindlichkeit gibt es wo<strong>an</strong><strong>der</strong>s<br />
auch, nämlich immer d<strong>an</strong>n, wenn die Leute<br />
<strong>an</strong> einem bestimmten Feld interessiert<br />
sind und wenn es berufsstrategisch ist.<br />
„Ich will da arbeiten“ und nicht die<br />
Umwegsituation machen; erst mal <strong>an</strong>thropologische<br />
Inhalte machen und erst mal<br />
Grundlagendisziplinen aufarbeiten. <strong>Die</strong><br />
kommen aus dem Feld und wollen z.B. in<br />
<strong>der</strong> pädagogischen o<strong>der</strong> m<strong>an</strong>ageriellen<br />
Rolle aufsteigen. Und damit sind die dort<br />
oben fixiert (mit Blick auf das Schaubild,<br />
Anm. MB) (II)<br />
E4.2.6<br />
Direkt im Anschluss auf E3:<br />
CCXV
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E1.2.4<br />
Im Anschluss <strong>an</strong> E4:<br />
Wir haben in Wien beides: l<strong>an</strong>gjährig<br />
erfahrene Pflegende und junge Menschen,<br />
die gar nicht wissen was pflege<br />
eigentlich ist. <strong>Die</strong> grundsätzlich auch<br />
nicht wissen wie kr<strong>an</strong>ke Menschen aussehen,<br />
wie ein Pflegeheim von innen<br />
E3.2.7<br />
Direkt eingeworfen, auf E4:<br />
…Ich f<strong>an</strong>d das falsch mit <strong>der</strong> Fachhochschule,<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> gehört <strong>an</strong> die<br />
Universität!<br />
Aber so ist das ja in D gelaufen. Genauso.<br />
„Pflege braucht Eliten“ heißt im Grunde „Eliten<br />
für die Praxis“ und die Studiengänge sind<br />
etabliert worden…<br />
E4.2.7<br />
Direkt erwi<strong>der</strong>t auf E3:<br />
<strong>Die</strong>ser Sprung ist eben nicht gelungen in D,<br />
son<strong>der</strong>n es hat jetzt ein FH- Tradition und<br />
d<strong>an</strong>n kommt hinzu eine zunehmende<br />
Versozialwissenschaftlichung <strong>der</strong> Pflegestudiengänge.<br />
Hilde Steppe hatte die Akademisierung<br />
schon so entwickelt wie Du (mit Blick<br />
auf E3, Anm. MB), da muss keine Praxisgeschichte<br />
vorneweg, die sind ja ein Stück weit<br />
durch die Praxis auch deformiert.<br />
CCXVI
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
aussieht. Das sind die zwei Welten. Das<br />
hört jetzt auf. Ich find‘s fast ein bisschen<br />
schade, dass diese junge naive Sicht<br />
auf die Dinge jetzt raus fällt. Da hat<br />
schon Bologna auch einen Einfluss<br />
gehabt. Wir sind im Bereich Gesundheit<br />
ja die besten Bologna-Erfüllungsgehilfen,<br />
wir sind die Musterschüler, den<br />
Bachelor berufsbezogen und d<strong>an</strong>n<br />
kommt die wissenschaftliche Schiene.<br />
<strong>Die</strong> Frage ist: Was passiert da schon alles<br />
vorher o<strong>der</strong> was k<strong>an</strong>n nachher nicht<br />
mehr passieren? Das wird m<strong>an</strong> jetzt bei<br />
uns sehen. Da spiegelt sich auch eine<br />
bildungspolitische Strategie wi<strong>der</strong>.<br />
E2.2.6<br />
Abschließend, und zur Philosophie im<br />
Publikationsbetrieb (E4, E1)<br />
Mit Blick in die Zukunft und weiter <strong>an</strong> das<br />
wissenschaftliche Peer-Review-System<br />
gedacht werden es die Autoren wohl<br />
schwer haben theoretische Beiträge und<br />
solche hermeneutischer Denkart unterzubringen,<br />
wenn sie bereits beim Verfassen<br />
des Beitrags schon die „Schere des<br />
Reviewers“ im Kopf haben müssen.<br />
CCXVII
Runde 2: „Was fällt (mir als Experten) auf?“ – Welche Unterschiede machen sich bemerkbar? Gruppendiskussion<br />
E3.2.7<br />
Abschließend und bezugnehmend auf<br />
einen fehlenden Themenaspekt in den<br />
Ergebnissen <strong>der</strong> Zeitschriften<strong>an</strong>alyse,<br />
Trend „Aller und Behin<strong>der</strong>ung“:<br />
Ein kleiner Exkurs zum Abschluss noch<br />
zum Thema „Behin<strong>der</strong>ung“: Auch beim<br />
Thema Behin<strong>der</strong>ung ist ein starker Praxisbezug<br />
bemerkbar, nämlich in den Therapiekonzepten.<br />
Heilpädagogisches Können<br />
war Therapieausbildung. Es gab aber<br />
in <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenarbeit immer eine große<br />
Theorietradition im Bezug auf Recht,<br />
Philosophie und Ethik. Und das ist umgekehrt<br />
zur Pflege: was es dort kaum gibt,<br />
ist eine Tradition von Disability-Forschung<br />
o<strong>der</strong> allgemein empirischer Forschung.<br />
Nur g<strong>an</strong>z, g<strong>an</strong>z wenig. In <strong>der</strong> Pflege hingegen<br />
gibt es sehr viel empirische Forschung,<br />
wenig Theorie, in <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenarbeit<br />
sehr viel Theorie (Inklusion,<br />
Teilhabeschaft) und auch Therapieforschung,<br />
nicht aber empirische Sozialforschung.<br />
Disability-Forschung ist eher<br />
kulturwissenschaftlich.<br />
CCXVIII
Runde 3<br />
Expertin 1 (E1) Experte 2 (E2) Experte 3 (E3) Experte 4 (E4)<br />
E1.3.1<br />
Zukünftige H<strong>an</strong>dlungsspielräume:<br />
Sehr stark sehe ich die Identitätsbildung mit<br />
dem Blickwinkel auf Interdisziplinarität. Ohne<br />
über die eigene Identität zu wissen, sei es<br />
wissenschaftstheoretisch, methodisch o<strong>der</strong><br />
auch im Hinblick welchen Theoriebezug haben<br />
wir, wird es nicht gelingen Interdisziplinarität<br />
gut zu leben. O<strong>der</strong> m<strong>an</strong> bezeichnet sich<br />
grundsätzlich als interdisziplinäres Feld, da<br />
müsste m<strong>an</strong> das Rad aber fast wie<strong>der</strong> zurück<br />
drehen. Das heißt nicht Ausgrenzung von<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en, son<strong>der</strong>n eine bewusste Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
damit. <strong>Die</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung wird<br />
die sein, auf diesem Grat zu w<strong>an</strong><strong>der</strong>n und<br />
sich nicht nur durch das was Außenzwänge<br />
<strong>an</strong>geht wie Forschungsför<strong>der</strong>ung, Review-<br />
Verfahren o<strong>der</strong> Evidence-Based-Debatte<br />
Anerkennung zu verschaffen. Interdisziplinäre<br />
Sichtweise gibt aber auch H<strong>an</strong>dlungsspielräume.<br />
Wenn wir nämlich unsere ureigene<br />
Perspektive klar machen können, so meine<br />
ich auch, dass diese gewünscht ist. <strong>Die</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
wird also sein, die „Pubertätsphase“<br />
auszuleben, um erwachsen werden<br />
E2.3.1<br />
3. Grundlagenarbeit wie philosophische<br />
und wissenschaftstheoretische<br />
Grundlagen<br />
<strong>Die</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong> ist stark beschäftigt<br />
mit Lehre. <strong>Pflegewissenschaft</strong> in Österreich<br />
und Deutschl<strong>an</strong>d ist <strong>an</strong> den Hochschulen<br />
noch stark instrumentalisiert im Sinne einer<br />
Feldentwicklung o<strong>der</strong> Feldprofessionalisierung.<br />
Wenn ich in <strong>der</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />
Philosophie lehre, bekomme ich <strong>an</strong> diesem<br />
Tag immer „schlechte Werte“. Ich sag d<strong>an</strong>n<br />
immer „die Pflege hasst die Philosophie!“<br />
Wo k<strong>an</strong>n also eine Weiterentwicklung passieren?<br />
Was k<strong>an</strong>n stattfinden? Auch im Bezug<br />
auf Theoriebildung im Hinblick auf vorgefundene<br />
Theorien o<strong>der</strong> Theorien, die schon da<br />
sind? Das müsste vielmehr im pflegewissenschaftlichen<br />
Denken und den Diskursen integriert<br />
werden. Es wäre gut, wenn philosophische<br />
Grundlagen und wissenschaftstheoretische<br />
Ansätze integriert würden. Wenn das in<br />
<strong>der</strong> pflegewissenschaftlichen Ausbildung<br />
vermehrt möglich wäre, weg von Alltagsin-<br />
E3.3.1<br />
4. Zukünftige Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Den noch nicht abgeschlossenen Prozess<br />
<strong>der</strong> Selbstkonzeptfindung ausleben,<br />
den Spagat zwischen Selbstkonzept<br />
und Umweltoffenheit allerdings<br />
eingehen, ohne sich verkrampft <strong>der</strong><br />
eigenen Innerlichkeit zuzuwenden.<br />
5. Selbstkonzeptfindung<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> sollte körperzentriert<br />
von <strong>der</strong> personalen Mitte ausgehen,<br />
sich aber als interdisziplinär definieren.<br />
<strong>Pflegewissenschaft</strong> ist eine<br />
interdisziplinäre Wissenschaft. Sie hat<br />
den Fokus <strong>der</strong> Dyade, <strong>der</strong> körperzentrierten<br />
personalen Mitte wobei die<br />
Abgrenzung zur chronischen Erkr<strong>an</strong>kung<br />
und Behin<strong>der</strong>ung geht, denn<br />
zum Beispiel bei <strong>der</strong> Demenz sind wir<br />
nicht nur ausschließlich beim Körper,<br />
son<strong>der</strong>n auch bei Geist und Seele,<br />
also nur Körper allein ist es nicht, im<br />
Sinne einer Funktionalität. Es ist eine<br />
./.<br />
CCXIX
zu können. Sich auch die Zeit zu nehmen,<br />
erwachsen werden zu können und ohne dabei<br />
meinen zu müssen schon erwachsen zu<br />
sein, um überhaupt mit den „Erwachsenen“<br />
auch reden zu können. Es k<strong>an</strong>n auch <strong>der</strong><br />
„Pubertätsbonus“ ausgespielt werden. Wir<br />
versuchen es in Österreich über eigene Forschungstöpfe.<br />
„Wir brauchen noch was Eigenes!“<br />
Stichwort: Forschungsagenden. In Österreich<br />
ist <strong>der</strong>zeit eine Gruppe für den nichtmedizinischen<br />
Bereich berufen, um diese<br />
Forschungsagenda zu erheben. Ich sehe die<br />
dringende Notwendigkeit für eine solche Forschungsagenda.<br />
Sie soll auch klar machen,<br />
wozu ist es notwendig die pflegewissenschaftliche<br />
Perspektive hinzuzunehmen. Wo<br />
ist aber <strong>der</strong> Mehrwert? Ich k<strong>an</strong>n nicht erwarten,<br />
dass die Politik von sich aus weiß, wohin<br />
und <strong>an</strong> wen die Gel<strong>der</strong> fließen müssen. Das<br />
ist wichtig, damit m<strong>an</strong> ein ernstzunehmen<strong>der</strong><br />
Player werden k<strong>an</strong>n. Der Trend geht aber klar<br />
zu den bereits bestehenden U-Projekten mit<br />
<strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung: Beteiligt Euch da! <strong>Die</strong> Forschungsför<strong>der</strong>ung<br />
blockt damit inzwischen<br />
wie<strong>der</strong> dieses Unterf<strong>an</strong>gen Player im<br />
Gesundheitswesen werden zu können. Der<br />
Trend geht klar zur Interdisziplinarität. Da<br />
sind wir immer so ein wenig hinten nach.<br />
strumenten, die sich auch stark verän<strong>der</strong>n,<br />
d<strong>an</strong>n wäre es auch möglich, das Negative,<br />
das Traurige des Alters o<strong>der</strong> des Pflegedaseins<br />
zu benennen, zu beschreiben und es<br />
auch darzustellen. Pflegebedürftigkeit ist wie<br />
L<strong>an</strong>glebigkeit von tristen Anteilen begleitet.<br />
4. Empirische Forschung<br />
Ich würde die Ausbildung gerne auch ermuntern<br />
in die Forschung einzusteigen, denn<br />
nationale Forschung wird eher zurück gefahren.<br />
Konkrete Bedarfe und Bedürfnisse aus<br />
<strong>der</strong> Pflege zu benennen, auch wenn es kleine<br />
studentische Projekte sind, ich k<strong>an</strong>n sie d<strong>an</strong>n<br />
auch in die Lehre integrieren, auch wenn es<br />
sich in die großen Forschungsverbünde nicht<br />
integrieren lässt. Trotzdem ließen sich dadurch<br />
die Studierenden <strong>an</strong> eine Forschungstradition<br />
her<strong>an</strong> führen. Es endet lei<strong>der</strong> oft bei<br />
<strong>der</strong> Unterscheidung qu<strong>an</strong>titativ/qualitativ o<strong>der</strong><br />
Texte lesen und verstehen, konkretes Forschen<br />
wird allerdings nicht gelehrt.<br />
Frage des Körperverständnisses. Hier<br />
hat die <strong>Pflegewissenschaft</strong> ihren Feldbezug.<br />
Sie sollte im Feld auch interdisziplinär<br />
sein und das bedeutet „umweltoffen“.<br />
Möglicherweise illustriert<br />
die Frage: „Wie sollte m<strong>an</strong> eine pflegewissenschaftliche<br />
Fakultät berufen?“<br />
diese Problemstellung gut: ich<br />
würde nicht ausschließlich pflegewissenschaftlich-promovierte<br />
und habilitierte<br />
Personen berufen, ich würde<br />
echte Mediziner, echte Psychologen,<br />
echte Soziologen, die alle ihre Methoden<br />
beherrschen, berufen, die aber<br />
alle in <strong>der</strong> Tat glaubhaft machen: Wir<br />
werden Pflegeforschung machen! Das<br />
ist aber ein Problem in <strong>der</strong> Berufungspolitik.<br />
Das heißt wir brauchen<br />
gute Methoden <strong>der</strong> Klinischen- und<br />
Versorgungsforschung, aber mit <strong>der</strong><br />
Zielrichtung Pflegeforschung<br />
6. Ausbildung<br />
Technik und Skills eingebettet in breite<br />
Persönlichkeitsbildung mit Habitus<br />
und Charakter. Menschen ohne Philosophie<br />
und Ethik weniger gut und<br />
praxisgewappnet. Bei Führungsfragen<br />
müssen Haltungsfragen eine Rolle<br />
spielen.<br />
CCXX