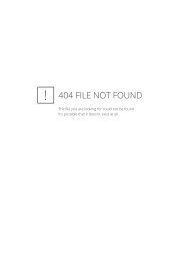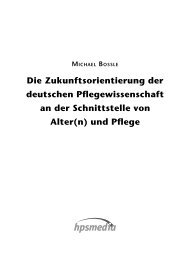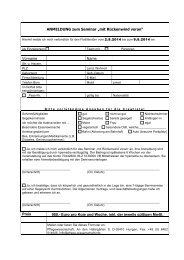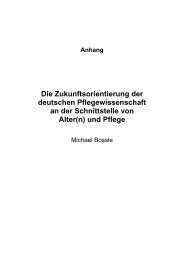Heller-Meier Wissensorientierte Spitalführung.indd
Heller-Meier Wissensorientierte Spitalführung.indd
Heller-Meier Wissensorientierte Spitalführung.indd
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MONIKA HELLER-MEIER<br />
<strong>Wissensorientierte</strong><br />
<strong>Spitalführung</strong><br />
EFFIZIENTES LERNEN UND ARBEITEN<br />
MIT COMPUTERUNTERSTÜTZUNG<br />
3
INHALT<br />
TEIL 1<br />
WISSENSMANAGEMENT IM SPITAL<br />
NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN AM BEISPIEL SPITAL ZOFINGEN<br />
MIT FOKUS AUF GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
VORWORT 13<br />
1 EINLEITUNG 17<br />
2 THEORIE DER BEGRIFFLICHKEITEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
UND WISSENSMANAGEMENT<br />
2.1 GESUNDHEIT UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG 19<br />
2.1.1 GESUNDHEIT 20<br />
2.1.2 GESUNDHEITSFÖRDERUNG 22<br />
2.1.3 GESUNDHEITSFÖRDERUNG ALS INTERVENTION IN SOZIALE SYSTEME 25<br />
2.2 WISSEN UND WISSENSMANAGEMENT 28<br />
2.2.1 WISSEN 28<br />
2.2.2 WISSENSMANAGEMENT 30<br />
2.3 WISSENSMANAGEMENT IM GESUNDHEITSWESEN UND IM SPITAL 34<br />
2.3.1 WISSENSMANAGEMENT IM GESUNDHEITSWESEN 34<br />
2.3.2 WISSENSMANAGEMENT IM SPITAL 36<br />
5<br />
19
3 BEDARFSABKLÄRUNG: WISSENSMANAGEMENT IM SPITAL ZOFINGEN 44<br />
3.1 KONZEPTION 45<br />
3.2 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IN GRUPPEN 46<br />
3.2.1 PERSONALANGABEN 46<br />
3.2.2 OPS-PFLEGE (N = 14) 47<br />
3.2.3 CHIRURGEN (N = 9) 48<br />
3.2.4 ANÄSTHESIE-PFLEGE (N = 8) 49<br />
3.2.5 GRUPPE DIVERSE (N = 4) 50<br />
3.2.6 ZUSAMMENFASSUNG ANHAND DER HYPOTHESEN 51<br />
4 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES WISSENSMANAGEMENTS IM SPITAL<br />
ZOFINGEN MIT FOKUS AUF DIE GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
5 EMPFEHLUNGEN 58<br />
5.1 ALLGEMEINE GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN 58<br />
5.2 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR EINE GESUNDHEITSFÖRDERNDE<br />
WISSENSPLATTFORM<br />
6 RÜCKBLICK, ZUSAMMENFASSUNG 65<br />
LITERATURVERZEICHNIS 67<br />
6<br />
54<br />
62
TEIL 2<br />
WISSENSORIENTIERTE SPITALFÜHRUNG<br />
EFFIZIENTES LERNEN UND ARBEITEN MIT<br />
COMPUTERUNTERSTÜTZUNG<br />
1 EINLEITUNG 73<br />
2 THEORIE DER BEGRIFFLICHKEITEN WISSENSORIENTIERTE UNTERNEHMENS-<br />
FÜHRUNG, EHEALTH STRATEGIE SCHWEIZ, VERHALTEN BEIM LERNEN<br />
IM NETZ UND ELEARNING<br />
2.1 WISSENSORIENTIERTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 75<br />
2.1.1 ENTWICKLUNG DER WISSENSGESELLSCHAFT 76<br />
2.1.2 WISSENSORIENTIERTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 77<br />
2.1.3 EHEALTH STRATEGIE SCHWEIZ 78<br />
2.2 BERUFSBILDUNG IN DER SCHWEIZ 81<br />
2.2.1 BESTIMMUNGEN DURCH GESETZ (BILDUNGSSYSTEMATIK DER GESUND-<br />
HEITSBERUFE IN DER SCHWEIZ)<br />
2.2.2 GRUNDLAGEN DER PROZESSGESTALTUNG UND QUALITÄTSVERBESSERUNG 83<br />
2.2.3 SCHWEIZERISCHE QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG FÜR WEITERBILDUNGS-<br />
INSTITUTIONEN EDUQUA<br />
2.2.4 QUALITÄT IN DER BETRIEBLICHEN BILDUNG AM BEISPIEL LERNORIENTIERTE<br />
QUALITÄT IN DER WEITERBILDUNG VON ART SET HANNOVER<br />
7<br />
75<br />
81<br />
85<br />
86
2.3 VERHALTEN BEIM LERNEN IM NETZ 89<br />
2.3.1 KOMMUNIKATIONSMEDIEN – KOOPERATION AUF DISTANZ – NETZWERKE 89<br />
2.3.2 AUF DISTANZ FÜHREN – VERTRAUENSAUFBAU 91<br />
2.3.3 VIRTUELLE TEAMS IM KONTEXT DER ORGANISATION 93<br />
2.3.4 DEN ARBEITSALLTAG MEISTERN 94<br />
2.3.5 PERSONALENTWICKLUNG FÜR VIRTUELLE TEAMS 96<br />
2.4 ELEARNING 97<br />
2.4.1 BEGRIFFSDEFINITION 97<br />
2.4.2 ANFORDERUNGEN AN ELEARNING 99<br />
2.4.3 LERNFORMEN MIT ELEARNING 100<br />
2.4.4 BLENDED LEARNING 102<br />
2.4.5 MEDIENKOMPETENZ – ANSPRÜCHE AN DIE KOMPETENZEN DER LEHRENDEN<br />
UND LERNENDEN<br />
8<br />
102<br />
2.4.6 ANERKENNUNG VON LERNZEITEN UND LERNORTEN 105<br />
2.4.7 EINSATZ VON LERNPLATTFORMEN, WIKIS, WEBLOG UND CHAT<br />
(WEB 2.0)<br />
2.4.8 NEUORIENTIERUNG IN DER WEITERBILDUNG IM GESUNDHEITSBEREICH:<br />
VERNETZUNG ALS LÖSUNGSSTRATEGIE<br />
3 UMSETZUNG PILOTPROJEKT WISSENSMANAGEMENT OPS<br />
SPITAL ZOFINGEN<br />
106<br />
107<br />
112<br />
3.1 SITUATIONSANALYSE DES WISSENSMANAGEMENTS OPS PFLEGE 112<br />
3.1.1 BESCHREIBUNG DES IST-ZUSTANDES WISSENSMANAGEMENT OPS 113<br />
3.1.2 BESCHREIBUNG DES SOLL-ZUSTANDES WISSENSMANAGEMENT OPS 114<br />
3.2 KONZEPTION 115<br />
3.2.1 IDEE EINES NEUEN SYSTEMS 116<br />
3.2.2 WISSENSMANAGEMENTKONZEPT 118<br />
3.3 WEG ZUM PILOTPROJEKT, REALISIERUNG DER WISSENSPLATTFORM 123<br />
3.3.1 HALTUNGEN GEGENÜBER DER PROJEKTORGANISATION, GRUNDHALTUNG<br />
GEGENÜBER WISSENSMANAGEMENT<br />
124
3.3.2 INTERNE UND EXTERNE KOMMUNIKATION 125<br />
3.3.3 INFORMELLE UND FORMELLE KOMMUNIKATION 126<br />
3.3.4 KOMMUNIKATIONS- UND ENTSCHEIDUNGSPROZESSE 126<br />
3.3.5 KOOPERATION UND VERNETZUNG 127<br />
3.3.6 EINFLUSSFAKTOREN VON VERÄNDERUNGSPROZESSEN 127<br />
3.4 PROZESS DER WISSENSORIENTIERTEN SPITALFÜHRUNG 128<br />
3.4.1 ORGANISATIONALE WISSENSBASIS, INDIKATORENKLASSE I 129<br />
3.4.2 INPUT UND PROZESSE ALS MESSBARE GRÖSSE VON INTERVENTIONEN<br />
ZUR VERÄNDERUNG DER ORGANISATIONALEN WISSENSBASIS,<br />
INDIKATORENKLASSE II<br />
3.4.3 ZWISCHENERFOLGE UND ÜBERTRAGUNGSEFFEKTE WERDEN GEMESSEN,<br />
INDIKATORENKLASSE III<br />
3.4.4 DIE ERGEBNISSE SOWOHL FINANZIELLER UND AUCH NICHT FINANZIELLER<br />
ART, INDIKATORENKLASSE IV<br />
3.5 EINFÜHRUNG DES PILOTPROJEKTES 131<br />
3.5.1 BESCHREIBUNG DES PILOTPROJEKTES „REGALSUCHE“<br />
(PROJEKTSKIZZE, KOSTENSCHÄTZUNG)<br />
9<br />
130<br />
130<br />
131<br />
132<br />
3.5.2 VORBEREITUNGSARBEITEN 136<br />
3.6 SCHULUNG DER WISSENSPLATTFORM 137<br />
3.6.1 VORBEREITUNGSARBEITEN 137<br />
3.6.2 SCHULUNG DER MITARBEITENDEN 137<br />
3.7 EVALUATION DER WISSENSPLATTFORM 138<br />
3.7.1 AUSARBEITUNG DES FRAGEBOGENS 138<br />
3.7.2 BEWERTUNG DES FRAGEBOGENS NACH DEN FÜNF SCHWERPUNKTEN 139<br />
3.7.3 ZUSAMMENFASSUNG ANHAND DER HYPOTHESEN 144<br />
3.7.4 ERGEBNISSE DES PROJEKTS „REGALSUCHE“ 145<br />
3.7.5 EMPFEHLUNGEN 145<br />
4 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN EINER WISSENSPLATTFORM 146
5 ENTWICKLUNGSLEITFADEN ELEARNING IM SPITAL 148<br />
5.1 ENTWICKLUNGSTENDENZEN ELEARNING IM SPITAL<br />
5.1.1 ELEMENTARES GRUNDWISSEN ÜBER PROJEKTMANAGEMENT UND<br />
INNOVATIONSPROZESSE<br />
5.1.2 KOMPETENZMANAGEMENT ANHAND VON KOMPETENZPORTFOLIOS<br />
DER MITARBEITENDEN UND ABTEILUNGEN<br />
10<br />
149<br />
152<br />
5.1.3 MEDIENKOMPETENZENTWICKLUNG 154<br />
5.1.4 QUALITÄT EINER ELEARNING-PLATTFORM 157<br />
5.2 ELEARNING GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN 157<br />
6 RÜCKBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG 160<br />
7 LITERATURVERZEICHNIS 163
TEIL 1 SITUATIONSANALYSE<br />
WISSENSMANAGEMENT IM SPITAL<br />
NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN AM BEISPIEL<br />
SPITAL ZOFINGEN MIT FOKUS AUF<br />
GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
11
V ORWORT<br />
VORWORT<br />
WISSENSMANAGEMENT IM SPITAL<br />
NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN AM BEISPIEL SPITAL ZOFINGEN<br />
MIT FOKUS AUF GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
Die Diplomarbeit zum Thema „Wissensmanagement im Spital“ mit Fokus auf Gesundheitsförderung<br />
basiert auf einer Projektarbeit zu diesen Themen. Intensive Studien einer<br />
großen Zahl von Publikationen zu den oben genannten Fachgebieten verschafften<br />
mir einen fundierten Überblick über die Schwerpunkte.<br />
Mit der Einreichung der vorliegenden Arbeit steht das Nachdiplomstudium in Prävention<br />
an der HOCHSCHULE FÜR SOZIALE ARBEIT LUZERN kurz vor dem Abschluss. Ich<br />
möchte mich an dieser Stelle bei jenen Personen bedanken, die mir während dieses<br />
Studiums mit tatkräftiger Unterstützung beigestanden sind. Ebenfalls danke ich Herrn<br />
Dr. Martin Hafen, der mir mit wertvollen Ratschlägen zur Seite gestanden ist.<br />
Ich danke Frau Marie-Josée Staff-Theis und Herrn Dr. med. Mehdi Fartab für das mir<br />
entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, meine Diplomarbeit, gestützt auf<br />
ein Projekt im Spital Zofi ngen, schreiben zu dürfen.<br />
Zu großem Dank verpfl ichtet bin ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Operationssaal.<br />
Sie unterstützten mich maßgeblich mit dem Ausfüllen meines Fragebogens,<br />
ohne den diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.<br />
Zu guter Letzt gilt mein Dank all jenen Menschen, die mir vor und während dieser Arbeit<br />
immer wieder beigestanden sind. Dazu gehört auch mein Mann, der mir während<br />
meines Studiums immer zur Seite gestanden ist.<br />
13
V ORWORT<br />
WISSENSORIENTIERTE SPITALFÜHRUNG<br />
EFFIZIENTES LERNEN UND ARBEITEN MIT<br />
COMPUTERUNTERSTÜTZUNG<br />
Die Faszination des Themas Wissensmanagement im Spital mit Fokus auf Gesundheitsförderung<br />
blieb auch nach Abschluss des Präventionsstudiums bestehen und bildete<br />
die Motivation für eine Weiterbearbeitung der Situationsanalyse der Diplomarbeit. So<br />
entstand das Thema „<strong>Wissensorientierte</strong> <strong>Spitalführung</strong>, effi zientes Lernen und Arbeiten<br />
mit Computerunterstützung“. Dieses Projekt wurde im Operationssaal des Spitals<br />
Zofi ngen in die Praxis umgesetzt. Weitere Grundlagen wurden durch intensive Studien<br />
einer großen Zahl von Publikationen über die oben genannten Fachgebiete erarbeitet<br />
und ergaben einen fundierten Überblick über die für die Umsetzung notwendigen<br />
Schwerpunkte.<br />
Das Spital Zofi ngen bot mir die Möglichkeit zur intensiven Auseinandersetzung mit diesen<br />
Grundlagen. Ich entschied mich, meine diesbezüglichen Erfahrungen in Buchform<br />
zu verfassen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei jenen Personen bedanken, die mir<br />
bei dieser Arbeit mit tatkräftiger Unterstützung beigestanden sind. Ebenfalls danke ich<br />
Frau Susanne Gammeter und Frau Anne Grossen, die mir mit wertvollen Ratschlägen<br />
zur Seite gestanden sind.<br />
Ich danke Frau Claudia Käch, CEO, Frau Caroline Nyfeler, Leitung Pfl ege und Herrn Dr.<br />
med. Jürg Gurzeler, Chefarzt für das entgegengebrachte Vertrauen und die mir gebotene<br />
Möglichkeit, diese Arbeit gestützt auf ein Projekt im Spital Zofi ngen in Buchform<br />
schreiben zu dürfen.<br />
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Reto Gfeller und Herrn Pascal<br />
Lisske der Firma SDN in Obfelden, wo ich immer wieder an den Erfahrungsaustausch-<br />
Meetings teilnehmen durfte und mein Wissen im Bereich praktische Umsetzung in<br />
eLearning vertiefen konnte.<br />
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen im Operationssaal. Sie unterstützten mich<br />
maßgeblich mit dem Ausfüllen des Fragebogens der Regalsuche, ohne den diese Arbeit<br />
nicht ganzheitlich betrachtet gewesen wäre. Zu guter Letzt gilt mein Dank all jenen<br />
Menschen, die mir vor und während dieser Arbeit immer wieder beigestanden sind.<br />
Dazu gehört auch mein Mann, der mir bei EDV-Schwierigkeiten zur Seite gestanden ist.<br />
14
1 EINLEITUNG<br />
1.<br />
EINLEITUNG<br />
Das Spital als Kompetenzzentrum des Gesundheitssystems ist heute mit großen Herausforderungen<br />
konfrontiert. Eine wirtschaftliche und am Wettbewerb orientierte<br />
Betriebsführung ist eine Herausforderung im Gesundheitswesen. Ein hoher Innovationsdruck<br />
und ein verändertes Nachfrageverhalten werden erzeugt durch den medizinischen<br />
Fortschritt und die demografi sche Entwicklung. Eine alternde Gesellschaft<br />
steht den fast grenzenlosen Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin gegenüber (vgl.<br />
Undritz, 2004, S. 130-136).<br />
Diese Fakten führen zu einem Veränderungsdruck in den Spitälern. Bewältigt werden<br />
können diese Herausforderungen, wenn die Spitäler das Wissen ihrer Mitarbeitenden<br />
optimal ausnützen.<br />
Von der Organisationstheorie her wird das Wissen der Menschen als Ressource je<br />
länger je mehr diskutiert. Seit Beginn der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts<br />
hat Wissensmanagement an Bedeutung gewonnen, jedoch meist bezogen auf<br />
die technischen Aspekte. Der Vergleich unterschiedlicher Defi nitionen des Begriffs in<br />
verschiedenen Arbeitskulturen zeigt, dass wir uns nicht auf das „Managen von Wissen“<br />
begrenzen dürfen, sondern Wissen teilen müssen, um eventuell neues Wissen zu kreieren.<br />
Dabei muss Wissensmanagement in den drei Kernbereichen Technik, Organisation<br />
und Individuum ganzheitlich erfasst werden (vgl. Hofmann, 2005).<br />
In der Gesundheitsförderung bietet das Wissensmanagement zahlreiche Chancen,<br />
Gesundheitssysteme zu stärken und einen substantiellen Beitrag zur Verbesserung<br />
der Gesundheit der Bevölkerung zu leisten. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass<br />
Mitarbeitende durch den Austausch ihrer Erfahrungen und ihres Fachwissens zu einer<br />
Optimierung der heutigen Situation beitragen können. Da in den Spitälern eine multikulturelle<br />
Belegschaft arbeitet, ist eine immense Vielfalt an gesundheitlichem Wissen<br />
vorhanden, das kultiviert und für die Organisation zugänglich gemacht werden muss.<br />
Im folgenden Kapitel werden als Erstes die Theorien über Gesundheit und Gesundheitsförderung,<br />
Wissen und Wissensmanagement sowie Wissensmanagement im Gesundheitswesen<br />
und im Spital beschrieben.<br />
17
1 EINLEITUNG<br />
Das dritte Kapitel widmet sich der empirischen Befragung über Wissensmanagement<br />
in Gesundheitsförderung im Setting Operationssaal. Die Methodik und die Ergebnisse<br />
werden beschrieben. Nachfolgend kommt es im vierten Kapitel zu einer Interpretation<br />
der Auswertung im Spital Zofi ngen mit deren Möglichkeiten und Grenzen, worauf<br />
im fünften Kapitel sechs allgemeine Empfehlungen und die Handlungsempfehlung in<br />
Gesundheitsförderung aufgezeigt werden.<br />
Das Schlusskapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen Ausblick<br />
über die Möglichkeiten und Grenzen des gesundheitsfördernden Wissensmanagements.<br />
Im EDV-Bereich werden zahlreiche Ausdrücke auf verschiedene Arten geschrieben. Wir<br />
verwenden in dieser Arbeit die zurzeit meistverwendete Schreibweise wie eHealth,<br />
eLearning, eTutor etc.<br />
Diese Arbeit richtet sich an Mitarbeitende in Spitälern als Einführung in das Thema<br />
Wissensmanagement und Gesundheitsförderung.<br />
18
TEIL 2 UMSETZUNG<br />
WISSENSORIENTIERTE SPITALFÜHRUNG<br />
EFFIZIENTES LERNEN UND ARBEITEN MIT<br />
COMPUTERUNTERSTÜTZUNG<br />
71
1 EINLEITUNG<br />
1.<br />
EINLEITUNG<br />
In der Juli-Ausgabe 2006 der Zeitschrift „Krankenpfl ege“ durfte ich eine Zusammenfassung<br />
meiner Diplomarbeit „Wissensmanagement im Spital“ publizieren. Diese Arbeit<br />
stieß auf großen Anklang beim Pfl egepersonal. Herr Nils Undritz, Koordinator der<br />
gesundheitsfördernden Spitäler Schweiz ermöglichte mir die Veröffentlichung der<br />
Diplomarbeit auf deren Internetplattform. Dieselbe Fassung publizierte die Redaktion<br />
der wissenschaftlichen Pfl egezeitschrift „Printernet“ in der Mai-Ausgabe 2007.<br />
Im August 2006 hat Stephan Sigrist am Gottlieb Duttweiler Institut im Auftrag des<br />
Eidgenössischen Departements des Innern sechs Thesen zur Zukunft der Gesundheit<br />
der Schweiz wie folgt beschrieben:<br />
3.1 Gesundheitsboom 3.2 Der neue Markt für<br />
als wichtiger Treiber Gesundheit fördert Innovation<br />
für Wachstum<br />
3.3 Der Fokus auf Preis<br />
und Mehrwert eröffnet 3.4 Die Solidarität zwischen<br />
Chancen für Anbieter<br />
und Patienten<br />
Thesen zur<br />
Zukunft der<br />
Gesundheit<br />
Gesunden und Kranken<br />
gerät unter Druck<br />
3.6 Der Mensch steht im<br />
Zentrum von Gesundheits-<br />
3.5 Gesundheitsanbieter fragen – Anbieter brauchen<br />
müssen sich neu ausrichten neue Netzwerke<br />
Abb. 1: Quelle: GDI Gesundheitsmarkt Stephan Sigrist S. 62<br />
73
1 EINLEITUNG<br />
Wo stehen wir heute in der elektronischen Datenverarbeitung im Gesundheitswesen?<br />
Im 2006 wurde ein Konzept für eine nationale Strategie „eHealth“ im Auftrag des Bundesrates<br />
erarbeitet. In einem gemeinsamen Projekt vom Bundesamt für Gesundheit,<br />
vom Bundesamt für Kommunikation und der Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektoren<br />
wurde dies erarbeitet. Diese Rahmenvereinbarung wurde am 6. September<br />
2007 unterzeichnet.<br />
Im Operationssaal sind wir mit gesundheitsfördernden Themen, Pfl egethemen und<br />
medizinischen Themen, aber auch mit wirtschaftlichen Themen konfrontiert. Wir benötigen<br />
daher nebst Leistungen auch Wissen über all die genannten Themen. Genau diese<br />
Elemente müssen durch Partnerschaftsreformen im Technologietransfer erfasst und<br />
unterstützt werden. Somit wird auch die Sicherstellung der Lehrtätigkeit unterstützt.<br />
Wissensmanagement kann helfen, Qualität und Effi zienz sozialer Dienstleistungen zu<br />
steigern, wenn die Konzepte den Anforderungen gerecht werden.<br />
Im folgenden Kapitel werden als Erstes die Theorien über wissensorientierte Unternehmensführung,<br />
eHealth Strategie sowie Berufsbildung in der Schweiz beschrieben.<br />
Unter dem Punkt eLearning werden unter anderem von den Anforderungen an<br />
eLearning über Medienkompetenz bis hin zu einer Theorie in der Weiterbildung im<br />
Gesundheitsbereich mit Vernetzung als Lösungsstrategie aufgezeigt.<br />
Das Kapitel drei umfasst die Umsetzung Pilotprojekt Wissensmanagement OPS Spital<br />
Zofi ngen. Die Idee eines neuen Systems wird beschrieben. Es ist ein Wissensmanagementkonzept<br />
erstellt worden. Anhand des Prozesses der wissensorientierten <strong>Spitalführung</strong><br />
wird auf die Entscheidungen eingegangen und anschließend der Weg zum<br />
Pilotprojekt mit der Realisierung der Wissensplattform beschrieben.<br />
Im vierten Kapitel werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Wissensplattform aufgezeigt.<br />
Die theoretisch erarbeiteten Kenntnisse und die Ergebnisse aus der Befragung<br />
werden Zusammengeführt und erläutert.<br />
Im Kapitel fünf wird ein Entwicklungsleitfaden eLearning im Spital mit einer Gestaltungsempfehlung<br />
erarbeitet unter Berücksichtigung von Entwicklungstendenzen.<br />
Das Schlusskapitel bietet einen Rückblick und eine Zusammenfassung über das Thema<br />
„<strong>Wissensorientierte</strong> <strong>Spitalführung</strong>, effi zientes Lernen und Arbeiten mit Computerunterstützung“.<br />
Diese Arbeit richtet sich an PraktikerInnen der Pfl ege im Spital auf der nicht universitären<br />
Ebene. Die Umsetzung soll das Wissen fördern, teilen und weiterentwickeln.<br />
74