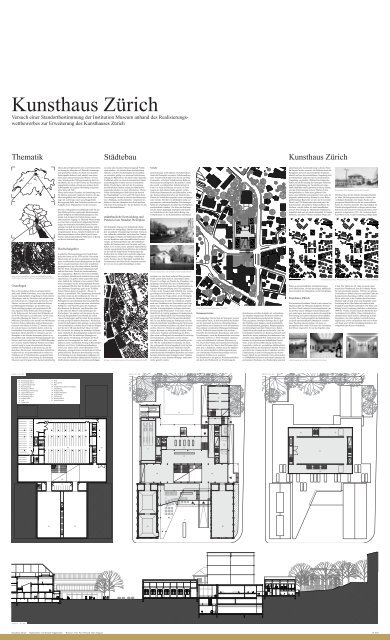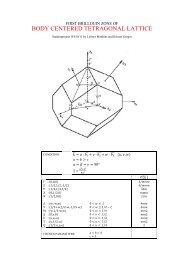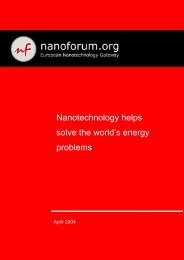PDF, Plakate - lamp.tugraz.at
PDF, Plakate - lamp.tugraz.at
PDF, Plakate - lamp.tugraz.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kunsthaus Zürich<br />
Versuch einer Standortbestimmung der Institution Museum anhand des Realisierungswettbewerbes<br />
zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />
Them<strong>at</strong>ik Städtebau Kunsthaus Zürich<br />
Zoom in das Projektgebiet: Schweiz und Stadtgebiet Zürich;<br />
Zürich und historischer Stadtkern; Umgebung Kunsthaus Zürich<br />
Grundlagen<br />
Das in der nördlichen Schweiz gelegene Zürich<br />
zählt rund 380000 Einwohner, weist eine beeindruckende<br />
landschaftliche Umgebung in Form mehrere<br />
»Hausberge« und des Zürichsees auf und gilt unter<br />
den Schweizern als »Hauptstadt der Herzen«. Der<br />
Zürcher verweist mit Stolz auf zahlreiche Kultur-<br />
und Bildungseinrichtungen, die das Bild seiner<br />
Stadt einschlägig prägen und symptom<strong>at</strong>isch für<br />
eine allgemein hohe Dichte jener Einrichtungen<br />
in der Schweiz sind. So kommt laut Wikipedia auf<br />
alle 8100 Einwohner je ein Museum, was bei einer<br />
Gesamtbevölkerung der Schweiz von rund 7,7<br />
Millionen Einwohnern eine Anzahl von 948 Museen<br />
bedeutet. Neben zahlreichen anderen Museumsinstitutionen<br />
sind alleine in Zürich 27 Museen situiert,<br />
die sich der Kunst verschrieben haben, wobei das<br />
bedeutendste Ausstellungshaus jenes der Institution<br />
Kunsthaus Zürich darstellt. In zentraler Lage am<br />
Heimpl<strong>at</strong>z in der Zürcher Innenstadt, gehört es zu<br />
den größten und wichtigsten Museumsgebäuden der<br />
Schweiz und lockt jedes Jahr rund 300000 Besucher<br />
an. Um diese n<strong>at</strong>ional führende Position zu festigen<br />
und sich auch in einem intern<strong>at</strong>ionalen Kunstgeschehen<br />
mit Nachdruck zu positionieren, h<strong>at</strong> das<br />
Kunsthaus Zürich einen intern<strong>at</strong>ionalen Architekturwettbewerb<br />
als »Projektwettbewerb im selektiven<br />
Verfahren mit 20 Teilnehmenden« ausgeschrieben,<br />
der sich die bauliche Erweiterung des bestehenden<br />
Museums zum Ziel gesetzt h<strong>at</strong> und auch gleichzeitig<br />
Thema dieser Diplomarbeit sein wird. Durch die Erweiterung<br />
des Museums soll Pl<strong>at</strong>z für Sammlungsteile<br />
geschaffen werden, die durch zwei konträre<br />
Schwerpunkte definiert sind, nämlich zum einen<br />
durch jenen impressionistischer Malerei in Form<br />
einer Schenkung der Stiftung Sammlung Emil Georg<br />
Bührle, die neu in das Inventar des Kunsthauses<br />
eingegliedert werden soll und zum anderen durch<br />
Schwerpunkte der eigenen Sammlung zeitgenössischer<br />
Kunst ab 1960.<br />
Dieser ambivalente Charakter der Sammlung sowie<br />
der überaus spannende städtische Kontext, den das<br />
Museumsgebäude des Kunsthauses durch seine<br />
Lage mit sich bringt, waren ausschlaggebende<br />
Beweggründe dafür, den Architekturwettbewerb zur<br />
Aufgabe dieser Diplomarbeit werden zu lassen.<br />
Das hier vorliegende Entwurfsprojekt sieht die aus<br />
dem Wettbewerb hervorgehenden Bestimmungen<br />
jedoch lediglich als Rahmenbedingungen an und<br />
nimmt sich dezidiert die Freiheit heraus, einen<br />
umfassenderen Zugang zur Them<strong>at</strong>ik Museumsbau<br />
zu entwickeln, erreicht durch tiefgehende Betrachtungen<br />
der Institution hinsichtlich deren Positionierung<br />
innerhalb der Gesellschaftsstruktur und in<br />
Hinblick auf deren Wechselbeziehung zu Arbeiten<br />
zeitgenössischer Kunst. Aktuelle Tendenzen in der<br />
Museumsarchitektur sollen dabei kritisch hinterleuchtet<br />
und gesellschaftliche Phänomene in Bezug<br />
auf Kunst berücksichtigt werden.<br />
Hochschulgebiet<br />
In aktuellen Planungsstr<strong>at</strong>egien der Stadt Zürich<br />
stellt das Gebiet um die ETH und die Universität<br />
Zürich eines der aus dem so genannten »Zimmerplan«<br />
resultierenden Entwicklungsgebiete der Stadt<br />
dar. Es ist gekennzeichnet durch eine wunderbare<br />
geographische Lage, die einen schönen Ausblick<br />
über die Stadt, die angrenzende Hügellandschaft<br />
und den See bietet. Durch die Ausformulierung<br />
der vorgelagerten »Balkone« der Universitätsbauten<br />
wird diese Qualität noch zusätzlich betont und<br />
unterstrichen. Ein gewiss nicht ungewollter heroischer<br />
Anblick der Gebäude ist ein weiterer Effekt<br />
dieser Setzungen und die Institutsgebäude thronen<br />
wie mahnende Wächter über der Stadt, um stets mit<br />
dem erhobenen Zeigefinger ganz in der Tradition<br />
Francis Bacons dessen Ausspruch: »Wissen ist<br />
Macht« zu postulieren. Die Stadtplanung beschreibt<br />
das Gebiet rund um die Großbauten der Uni wie<br />
folgt: »Zwischen der Altstadt und den bevorzugten<br />
Wohngebieten am Zürichberg besetzen große Bauten<br />
und gewichtige Adressen mit einer erheblichen<br />
Publikums- und Nutzerfrequenz den Stadtraum.<br />
Hier flanieren die Besucher zum Kunsthaus oder<br />
zu den zahlreich Museen und Sammlungen der<br />
Hochschulen. Sie mischen sich mit jenen, die aus<br />
Richtung Hauptbahnhof und Altstadt die steilen<br />
Gassen heraufsteigen und hier oben Wissen generieren<br />
und geistige Produktion betreiben.« Wesentlich<br />
ist das Hochschulgebiet also geprägt von den großen<br />
Universitätsbauten, errichtet durch Gottfried Semper<br />
im Falle der ETH und durch Karl Moser im Falle<br />
der Universität, die entlang der markanten Geländekante<br />
oberhalb des Hirschengrabens aufgereiht sind.<br />
Als primäres Ziel für zukünftige Planungen im<br />
Gebiet gilt die Verstärkung der Präsenz der Hochschulen<br />
im Zentrumsgebiet der Stadt, was unter<br />
anderem einen wesentlichen Anstieg an Raumbedarf<br />
bedeuten wird. Diese Verdichtungsmaßnahmen<br />
sollen einer immer mehr voranschreitenden »Verhäuselung«<br />
entgegenwirken und durch das Errichten<br />
großer baulicher Strukturen bewerkstelligt werden.<br />
In Verbindung mit den bestehenden Gebäuden soll<br />
somit eine klar ablesbare städtebauliche Struktur an<br />
Großvolumen entstehen, die wiederum großzügige,<br />
zwischen den einzelnen Häusern liegende Freiflächen<br />
erlauben. Als Auftakt dieses rhythmisierten<br />
Ablaufes soll der Erweiterungsbau des Kunsthauses<br />
entstehen, gefolgt von weiteren Großvolumen<br />
entlang der Rämistrasse. Die dazwischen liegenden<br />
Freiflächen sollen zu einem kontinuierlichen Band<br />
zusammengefasst werden und eine Flaniermeile<br />
bilden. Parallel dazu wird auch die Erweiterung<br />
der öffentlichen Flächen entlang der Rämistrasse<br />
angestrebt, gekrönt von einer »Hochschul – Plaza«<br />
Folder Hochschulgebiet Stadt Zürich im Bereich<br />
der Hauptegbäude von Uni und ETH. Durch diese<br />
Erweiterungen entsteht im Bereich der Rämistrasse<br />
eine »Bildungs- und Kulturmeile« , beginnend am<br />
Bellevue, über den Heimpl<strong>at</strong>z mit dem Kunsthaus<br />
und seiner Erweiterung als »Tor der Künste« bis hin<br />
zu den Hochschulbauten.<br />
städtebauliche Entwicklung und<br />
Potenzial am Standort Heimpl<strong>at</strong>z<br />
Der Heimpl<strong>at</strong>z liegt an einer bedeutenden Stelle<br />
innerhalb des Stadtgefüges Zürichs und wird durch<br />
drei wesentliche Charakterzüge bestimmt. Einen davon<br />
stellen die zahlreichen, mit kulturellen Funktionen<br />
belegten, Gebäude und Gebäudeensembles dar,<br />
wie das Kunsthaus und seine zahlreichen Erweiterungen,<br />
das Schauspielhaus oder das Gebäudeensemble<br />
der Kantonsschule mit Turnpl<strong>at</strong>z und Turnhallen.<br />
Zwei weitere dieser primären Eigenschaften<br />
sind die topografische Beschaffenheit des Geländes,<br />
an der mehrere tiefgreifende Veränderungen der<br />
Stadtstruktur im Verlauf der Geschichte abgelesen<br />
werden können, sowie die wichtige verkehrstechnische<br />
Position, die der Heimpl<strong>at</strong>z innerhalb des<br />
Verkehrsnetzes der Stadt Zürich einnimmt und mit<br />
der wir uns etwas näher beschäftigen wollen.<br />
Bildungs- und Kulturmeile(schraff) und Hochschulgebiet(strichl)<br />
Verkehr<br />
Sein heutzutage wohl stärkstes Charakteristikum<br />
findet der Heimpl<strong>at</strong>z im starken Verkehrsaufkommen.<br />
Verantwortlich dafür sind die sich am Pl<strong>at</strong>z<br />
kreuzenden, wichtigen Verkehrsachsen Bellevue-<br />
Hochschule beziehungsweise Kreuzpl<strong>at</strong>z-Central,<br />
die sowohl von öffentlichen Verkehrsmitteln in<br />
Form von Tram und Bussen, als auch von Fahrzeugen<br />
des Individualverkehrs genutzt werden.<br />
Zusätzliche Wartebereiche und Haltestellen, sowie<br />
das Tramwartehäuschen heben die Funktion des<br />
Pl<strong>at</strong>zes als Verkehrsknotenpunkt hervor und prägen<br />
seine Gestalt. Die über ein Jahrhundert stetig vorgenommenen<br />
verkehrstechnischen Erweiterungen<br />
haben das ursprüngliche Aussehen des Heimpl<strong>at</strong>zes<br />
einschneidend verändert. Vor allem das Schrumpfen<br />
der damals großzügig angelegten und begrünten<br />
Verkehrsinsel, die einen starken Bezug zum<br />
Turnpl<strong>at</strong>zareal vor der Kantonsschule aufzubauen<br />
Fotos des Heimpl<strong>at</strong>zes und der beiden Kantonsschulturnhallen<br />
imstande war, dies heute aufgrund ihrer geringen<br />
Größe jedoch nicht mehr ist, unterstützte diesen<br />
Prozess. Es erfolgte ein Wandel des Charakters vom<br />
parkartigen Grünraum hin zum verkehrslastigen<br />
Stadtraum. N<strong>at</strong>ürlich kann diese Transform<strong>at</strong>ion als<br />
logische Weiterentwicklung einer Zeit angesehen<br />
werden, in der Transport und Mobilität eine weitaus<br />
gewichtigere Rolle spielen als zuvor. Daher muss<br />
man sich heute die Frage stellen, ob der Heimpl<strong>at</strong>z<br />
seinen momentanen Anforderungen gerecht wird,<br />
beziehungsweise ob nicht ein verändertes Umfeld<br />
auch eine Modifik<strong>at</strong>ion der Pl<strong>at</strong>zstruktur zur Folge<br />
haben muss. Das starke Personenaufkommen und<br />
die hohe Nutzungsfrequenz verlangen nach einer<br />
Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes. Trotz eines von der<br />
Stadt Zürich in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens,<br />
das die Möglichkeit einer Neustrukturierung<br />
der Verkehrswege am Pl<strong>at</strong>z für unwahrscheinlich<br />
hält, ist eine Reduzierung der Fahrspuren und eine<br />
dadurch entstehende Vergrößerung des Pl<strong>at</strong>zraumes<br />
vor dem bestehende Kunsthaus auf jeden Fall anzustreben.<br />
Dieser im Moment als undefinierter, dreieckiger<br />
Restraum zu deklarierende Vorpl<strong>at</strong>z würde<br />
somit seiner Funktion und Bedeutung am Heimpl<strong>at</strong>z,<br />
auch im Bezug auf die neuerliche Erweiterung<br />
des Kunsthauses, entsprechen und als urbaner,<br />
innerstädtischer Pl<strong>at</strong>z vehement an Qualität gewinnen.<br />
Mit der zusätzlichen Erweiterung, die durch<br />
den vorliegenden Entwurf angedacht wird und den<br />
Bereich zwischen den beiden Turnhallen betrifft,<br />
würde der Heimpl<strong>at</strong>z ein gelungenes Ensemble an<br />
unterschiedlichen Pl<strong>at</strong>zräumen darstellen und seinen<br />
heutigen Anforderungen bezüglich seiner Funktion<br />
als Auftakt zu einer belebten Bildungs- und Kulturmeile,<br />
gerecht werden.<br />
Lageplan des Erweiterungsprojektes, M 1:2000<br />
Bebauungsstruktur<br />
Im Stadtgefüge Zürichs liegt der Heimpl<strong>at</strong>z an einer<br />
interessanten Stelle, da hier mittelalterliche Strukturen<br />
der Innenstadt auf lockere villenartige Bebauungsstrukturen<br />
der Gründerzeit sowie auf markante<br />
Bauvolumen verschiedener Bildungseinrichtungen<br />
treffen. Zusätzlich dazu befinden sich mit dem<br />
Ensemble des bestehenden Kunsthauses und seinen<br />
Erweiterungen, sowie der Kantonsschule und seinen<br />
Turnhallen mehrere, in ihrem Charakter, erhaltenswerte<br />
und städtebaulich wirksame Elemente vor<br />
Ort. Durch den Neubau der Kunsthauserweiterung<br />
besteht nicht nur die Chance, den Pl<strong>at</strong>zraum Heimpl<strong>at</strong>z<br />
neu zu definieren, sondern auch die Möglichkeit,<br />
den unterschiedlichen Bebauungsstrukturen<br />
ein vermittelndes Element hinzuzufügen und auf<br />
bestehende Strukturen zu reagieren.<br />
Die Kombin<strong>at</strong>ion und gewisse Widersprüchlichkeit<br />
der durch den Wettbewerb zur Erweiterung des<br />
Kunsthauses gestellten Aufgabe mit vorhandenen,<br />
den Baupl<strong>at</strong>z umgebenden Strukturen stellte eine<br />
große Herausforderung bezüglich der Findung<br />
eines geeigneten Lösungsvorschlages dar. Es galt<br />
den Einklang eines üppigen, durch großmaßstäbliche<br />
Räumlichkeiten geprägten, Raumprogramms<br />
mit kleinteiligen baulichen Strukturen zu finden.<br />
Zusätzlich erschwerend war die T<strong>at</strong>sache, dass die<br />
bestehenden Turnhallen am Kantonsschulareal nach<br />
Ansicht des Autors unbedingt als erhaltenswert einzustufen<br />
sind, aufgrund ihrer schützenswerten, sich<br />
beinahe im Originalzustand befindlichen Bausubstanz,<br />
sowie der Ensemblewirkung mit der Kantonsschule,<br />
welche ein wesentliches städtebauliches<br />
Charakteristikum des Heimpl<strong>at</strong>zes darstellt. Weiters<br />
unterstützt die Umnutzung der Turnhallen und ihre<br />
Eingliederung in den Erweiterungsbau des Kunsthauses<br />
Zürich den am Heimpl<strong>at</strong>z stets durch mehrere<br />
Gebäudekonstell<strong>at</strong>ionen präsenten Gedanken des<br />
permanenten Wachsens einer Stadtstruktur und eine<br />
GR UG 2 M 1:400 GR EG M 1:400 GR OG3 M 1:400<br />
01 Ausstellung Halle 3<br />
02 Ausstellung Halle 4<br />
03 Lager Kur<strong>at</strong>orenraum<br />
04 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />
05 Kunstdepot 1000m²<br />
06 Ausstellungsvorbereitung<br />
07 Lager Nicht-Kunst<br />
08 Ausstellung Halle 1<br />
09 Ausstellung Halle 2<br />
10 zentrale Halle<br />
11 Café<br />
12 Ticket, Info<br />
Schnitt 01 M 1:400<br />
07<br />
13 Shop<br />
14 Restaur<strong>at</strong>ion<br />
15 Büro<br />
16 Gruppenräume Kunstvermittlung<br />
17 Anlieferung<br />
18 Skulpturenhof<br />
19 Vorpl<strong>at</strong>z Heimpl<strong>at</strong>z<br />
20 Erschließung<br />
21 Ausstellung<br />
22 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />
23 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />
04<br />
03<br />
05 06<br />
01 02<br />
08 09<br />
17<br />
10 10<br />
11<br />
18<br />
13<br />
12<br />
19<br />
architektonische Ausformulierung in diesem Sinne.<br />
Im Entwurf wurde versucht, das Gebäude durch die<br />
Bezugname auf zwei unterschiedliche Strukturen,<br />
nämlich auf jene der unmittelbaren Umgebung, also<br />
des Heimpl<strong>at</strong>zes und jene einer weitreichenderen<br />
Umgebung, zu gliedern. Während die Erdgeschoßebene<br />
durch die Setzung der benötigten Volumina<br />
und der Eingliederung der Turnhallen auf umgebende<br />
Maßstäbe und Gegebenheiten Bezug nimmt,<br />
setzt die Positionierung weiterer Flächen in den<br />
Obergeschoßen, in Form eines größeren Volumens,<br />
neue Maßstäbe und präsentiert sich somit als<br />
prägendes städtebauliches Element in einer Reihe<br />
großform<strong>at</strong>iger Bauwerke wie jene der Universität<br />
Zürich, der ETH Zürich oder aber auch jenes der<br />
Kantonsschule. Die gesamte Erdgeschoßzone des<br />
Neubaus, sowohl Außen- als auch Innenflächen,<br />
wird als Erweiterung des öffentlichen Stadtraumes<br />
angesehen und auch als solcher behandelt. Zwischen<br />
mehreren, einzelnen Volumen entstehen Wege und<br />
100m<br />
Plätze in unterschiedlichen Ausformulierungen,<br />
sowie Blickachsen, die den derzeitigen, städtebaulichen<br />
Charakter des Heimpl<strong>at</strong>zes weiter bekräftigen.<br />
Kunshaus Zürich<br />
Die Institution Kunsthaus Zürich ist mit seinem Gebäudeensemble<br />
am Heimpl<strong>at</strong>z prägendes Element<br />
des Ortes. Durch mehrere Erweiterungsbauten wurde<br />
der Pl<strong>at</strong>z einem ständigen Transform<strong>at</strong>ionsprozess<br />
unterzogen, den man nun durch die neuerliche<br />
Erweiterung am Kantonsschulareal abzuschließen<br />
versucht. Das Erscheinungsbild des Bestandsbaus<br />
ist durch unterschiedliche Gebäudeteile verschiedener<br />
Epochen gekennzeichnet. Als erster, ursprünglicher<br />
Bau wurde 1910 jener des Architekten<br />
Karl Moser eingeweiht. Er war das Ergebnis eines<br />
Ausstellungsräume und Foyer im bestehenden Kunsthaus<br />
Bestandsbau des Kunsthauses Zürich am Heimpl<strong>at</strong>z<br />
Wettbewerbes, den die Zürcher Kunstgesellschaft<br />
im Jahre 1904 ausgeschrieben h<strong>at</strong>te, welcher den<br />
vorläufigen Endpunkt einer langen Suche nach<br />
geeigneten Räumlichkeiten für die auszustellende<br />
Kunst des Vereines darstellte. Die rege Tätigkei der<br />
Zürcher Kunstgesellschaft verlangte jedoch schon<br />
bald nach einer ersten Erweiterung des Baues. Dies<br />
passierte in den Jahren 1924 - 26, wiederum durch<br />
Karl Moser. Eine zweite Erweiterung erfolgte dann<br />
Strukturpläne der zwei »Wahrnehmungsebenen«, links: Pl<strong>at</strong>zniveau, rechts: Stadtebene<br />
in den 50er Jahren des 20. Jhdts, als nach einem<br />
neuerlichen Wettbewerb, den die Gebrüder Pfister<br />
für sich entscheiden konnten, 1958 der neu erbaute<br />
Trakt inklusive Bührle-Saal am westlichen Ende des<br />
Konglomer<strong>at</strong>es Kunsthaus eröffnet werden konnte.<br />
Dieser steht stark in der Tradition der klassischen<br />
Moderne und sah sich schon zum Zeitpunkt seiner<br />
Errichtung in den 50er Jahren mit starker Kritik<br />
bezüglich seiner Ideale konfrontiert. Die dritte und<br />
bislang letzte Erweiterung fand dann in den Jahren<br />
1969 bis 74 st<strong>at</strong>t, errichtet nach den Entwürfen des<br />
Architekten Erwin Müller. Dieser Gebäudeteil ist<br />
charakterisiert durch mehrere hallenartige Ausstellungsräume,<br />
die, über mehrere Geschoße hinweg<br />
organsisiert, schwer zu bespielen sind und in denen<br />
sich heute jener Teil der Sammlung Kunsthaus mit<br />
zeitgenössischer Kunst wiederfindet.<br />
Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 01 (04)<br />
16<br />
15<br />
14<br />
22 23<br />
21<br />
20
Aufgabe Kunsthaus+<br />
Wettbewerb, Aufgabe<br />
Trotz umfassender Sanierung des bestehenden<br />
Kunsthauses von 2001 bis 2005 will deren Trägerschaft<br />
nicht darauf verzichten, sich in der intern<strong>at</strong>ionalen<br />
Museenlandschaft mit Nachdruck zu<br />
positionieren und das bestehende Haus erneut einer<br />
Vergrößerung zu unterziehen. Zu dem Zweck wurde<br />
2008 der Wettbewerb zur Erweiterung des Kunsthauses<br />
Zürich als »Projektwettbewerb im selektiven<br />
Verfahren mit 20 Teilnehmenden« ausgeschrieben,<br />
an dem intern<strong>at</strong>ional renommierte Architekturbüros<br />
teilnahmen. Ziel des Verfahrens ist es, »das<br />
Kunsthaus als Museum für das 21. Jahrhundert von<br />
innen heraus neu zu definieren.« Eine dynamisierte,<br />
vernetztere Bespielung der eigenen Sammlung<br />
von Kunst ab den 1960er Jahren, sowie der neue<br />
Schwerpunkt Französische Malerei, ergänzt durch<br />
die Sammlung E. G. Bührles stehen im Vordergrund<br />
der Bemühungen. Vereint am Standort Heimpl<strong>at</strong>z<br />
soll das neue Kunsthaus Zürich als größter Museumskomplex<br />
der Schweiz auch über deren Landesgrenze<br />
hinaus an Strahlkraft gewinnen.<br />
Rahmenbedingungen<br />
Als wichtiges Ziel des Bauvorhabens Kunsthaus+<br />
wird die allgemeine Stärkung des Standortes<br />
Heimpl<strong>at</strong>z angesehen. Neben der Errichtung eines<br />
expliziten Ausstellungshauses mit starkem Öffentlichkeitsbezug<br />
soll zusätzlich ein Garten der Kunst<br />
entstehen. Das Konglomer<strong>at</strong> Kunsthaus wird als<br />
»Tor der Künste« zum Auftaktspunkt der Zürcher<br />
Bildungs- und Kulturmeile, der Garten der Kunst<br />
zum Beginn des sich entlang dieser Achse etablierenden<br />
Grünraumes.<br />
Seitens des Auslobers werden in den Ausschreibungsunterlagen<br />
zum Architekturwettbewerb eine<br />
Gesamtnettonutzfläche von 12750m² und ein dadurch<br />
entstehendes Volumen von 90000m³ genannt.<br />
Damit wird am Heimpl<strong>at</strong>z ein Maßstabssprung<br />
erfolgen, den es in Einklang mit der umgebenden<br />
Stadtstruktur zu bringen gilt. Die Setzung eines<br />
größeren, markanten Volumens mit einer Obergrenze<br />
von 45000 bis 55000m³, die den Ort in seiner<br />
Erscheinung nachhaltig prägen und verändern wird,<br />
erscheint in der Ansicht des Auslobers als möglich<br />
und erstrebenswert. Bei einem Gesamtvolumen von<br />
90000m³ würde dies bedeuten, dass ein wesentlicher<br />
Teil des Gebäudes unterirdisch anzuordnen ist. Wei-<br />
Siegreicher Wettbewerbsbeitrag von Arch. David Chipperfield<br />
ters soll der Neubau in Zukunft das neue Haupt- und<br />
Eingangsgebäude des Kunsthauses Zürich darstellen<br />
und unterirdisch mit den Bestandsbauten verbunden<br />
sein.<br />
Betrachtet man das benötigte Gesamtvolumen in<br />
Bezug auf das städtebaulich verträgliche Maß und<br />
der Aufgabe eines Kunstmuseums, so wird schnell<br />
klar, dass das Raumprogramm für den spezifischen<br />
Ort des Kantonsschulareals eindeutig überfrachtet<br />
wurde. Klar zum Ausdruck kommt dies auch beim<br />
Siegerentwurf des Wettbewerbes des britischen Architekten<br />
David Chipperfield. In einem kompakten<br />
Baukörper organisiert, bringt es sein Erweiterungs-<br />
Modellfoto Ansicht Ost<br />
Schnitt 02 M 1:400<br />
Vergleich des Baumassenmodelles des siegreichen Wettbewerbes (links) mit jenem des Diplomprojektes (rechts)<br />
gebäude auf ein oberirdisches Gesamtvolumen von<br />
rund 93000m³ und steht dadurch in keiner Rel<strong>at</strong>ion<br />
zum Maßstab des Ortes. Unterstützt durch eine in<br />
Sandstein geplante, klassizistisch anmutende Fassade,<br />
wurde das Gebäude schon als »Palazzo, der<br />
mit seiner gravitätischen Erscheinung und seinem<br />
Volumen das städtische Gefüge am Heimpl<strong>at</strong>z zu<br />
sprengen droht«, bezeichnet. Es liegt also nahe, die<br />
Ausmaße des Wettbewerbsprogramms zu überdenken<br />
und ein maßgeschneidertes Raumprogramm für<br />
den Ort zu erstellen. Der Entwurf zu dieser Diplomarbeit<br />
bringt es durch mehrere Einsparungen gegenüber<br />
den Forderungen des Wettbewerbes auf ein<br />
oberirdisches Gesamtvolumen von rund 55000m³,<br />
zuzüglich den beiden Turnhallen am Kantonsschulareal<br />
mit einem Volumen von rund 13500m³.<br />
Die beiden Turnhallen, die in Kombin<strong>at</strong>ion mit der<br />
Alten Kantonsschule ein städtebaulich prägendes<br />
Element des Heimpl<strong>at</strong>zes darstellen, werden in Anbetracht<br />
der Erweiterung des Kunsthauses und der<br />
damit verbundenen Errichtung eines großen Volumens<br />
am Kantonsschulareal, trotz ihrer Eintragung<br />
im kantonalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen<br />
Schutzobjekte im Zuge der Wettbewerbsausschreibung<br />
als nicht schützenswert eingestuft.<br />
Es scheint, als sei eine sinnvolle und funktionale<br />
Einbindung in den Gesamtkomplex Kunsthaus nicht<br />
möglich.<br />
Nach Ansicht des Autors sind die Turnhallen jedoch<br />
sowohl durch ihre städtebaulich prägende Funktion<br />
am Ort, als auch durch ihre an sich erhaltenswerte<br />
Bausubstanz unbedingt in ein Erweiterungskonzept<br />
für das Kunsthaus Zürich aufzunehmen. Die<br />
T<strong>at</strong>sache, dass dadurch die Möglichkeit besteht, eine<br />
Erweiterung des Heimpl<strong>at</strong>zes in Form eines gefassten<br />
Vorpl<strong>at</strong>zes zu erreichen, sowie die durchaus gute<br />
Eignung der Bausubstanz für Räume der Kunst,<br />
unterstreichen diese Forderung nur zusätzlich. Im<br />
Entwurf wurden beide Hallen in das Raumprogramm<br />
eingegliedert und stellen, durch die Aufnahme<br />
von Kunstwerken zeitgenössischer Kunst, einen<br />
zentralen Schwerpunkt des Entwurfkonzeptes dar.<br />
Raumprogramm<br />
Wie wir soeben gehört haben, beläuft sich das<br />
Raumprogramm des Wettbewerbes auf eine Größe<br />
von 12750m² Nutzfläche. Die wichtigsten Elemente<br />
des Programms sollen hier kurz erwähnt und genauer<br />
erläutert werden. Da im schlussendlichen Entwurf<br />
gewisse Teile des vorgeschlagenen Raumprogramms<br />
nicht berücksichtigt wurden, beziehungsweise mehrere<br />
Modifik<strong>at</strong>ionen unternommen worden sind, was<br />
im Allgemeinen zu einer Verminderung der Nutzflächen<br />
geführt h<strong>at</strong>, werden zuerst die durch den Wettbewerb<br />
gewünschten Forderungen angeführt und<br />
diese danach in Bezug auf die t<strong>at</strong>sächlich geplanten<br />
Ausführungen reflektiert. Gesamt erfolgte eine<br />
Reduzierung der Nettonutzflächen von geforderten<br />
12750m² auf 11024m² und ein dadurch entstehendes<br />
Gesamtvolumen von 105347m³ gegenüber einem<br />
veranschlagten Volumen von 90000m³.<br />
Halle und öffentliche Funktionen<br />
Herzstück des Erweiterungsbaues soll eine zentrale<br />
Halle darstellen. Gekennzeichnet durch einen stark<br />
öffentlichen Charakter ist sie sowohl Verteiler zu<br />
den übrigen Funktionen wie den Galerieräumen<br />
oder den Räumen der Kunstvermittlung, als auch<br />
Kommunik<strong>at</strong>ions- und Begegnungsort, »in welchem<br />
die Kunst in sozial experimenteller oder Vertiefung<br />
erheischenden Form bereits ihre herausfordernde<br />
Präsenz haben kann«. Als neuer Haupteingang und<br />
100m<br />
Kunsthaus Zürich - 1] Bauteil Moser 2] Bauteil Pfister + Müller 3] Bauteil KH+<br />
CH<br />
Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur<br />
2<br />
3<br />
1<br />
B ges<br />
309545<br />
B ges<br />
289493<br />
B 1<br />
263337<br />
B 2<br />
26156<br />
B ges<br />
695000<br />
B 1<br />
206000<br />
B ges<br />
47600<br />
B ges<br />
250000<br />
B ges<br />
871384<br />
B 1<br />
218386<br />
+<br />
B ges<br />
2652924<br />
B 2<br />
B 2<br />
189000<br />
B 3<br />
300000<br />
204016<br />
B 3<br />
448982<br />
SB ges<br />
ka<br />
SB 1+2<br />
ka<br />
SB ges<br />
ka<br />
SB 1<br />
ka<br />
SB 2<br />
ka<br />
SB ges<br />
12000+<br />
SB 1<br />
7000+<br />
SB ges<br />
0<br />
SB ges<br />
ka<br />
SB ges<br />
ka<br />
SB 1<br />
1000+ (700)<br />
SB ges<br />
8000+ (1500)<br />
SB 2<br />
SB 2<br />
SB 3<br />
ka<br />
0<br />
SB 3<br />
5000+<br />
3300+ (400)<br />
SB 3<br />
NF ges<br />
22804<br />
NF 1<br />
5051<br />
NF 2<br />
6729<br />
NF 3<br />
11024<br />
NF ges<br />
ka<br />
NF 1<br />
ka<br />
NF 2<br />
ka<br />
NF 3<br />
10000<br />
NF ges<br />
37700<br />
NF 1<br />
14000<br />
NF ges<br />
2500<br />
NF 2<br />
NF ges<br />
24113<br />
NF 1<br />
15000<br />
NF 2<br />
9113<br />
10800<br />
NF 3<br />
12900<br />
ka<br />
NF ges<br />
ka<br />
NF 1<br />
ka<br />
NF 2<br />
11500<br />
NF 3<br />
20105<br />
NF ges<br />
44300<br />
NF 1<br />
28600<br />
NF 2<br />
15700<br />
AF ges<br />
11802<br />
AF 1<br />
3013<br />
AF 2<br />
3432<br />
AF 3<br />
5357<br />
Kunstmuseum Basel - 1] Bauteil Christ + Bon<strong>at</strong>z (Umbau Gigon Guyer) 2] Bauteil Steib 3] Bauteil 2009 (Projekt)<br />
CH<br />
2<br />
1<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
Museumsquartier Wien - Ortner & Ortner 1] MUMOK 2] Kunsthalle Wien 3] Sammlung Leopold<br />
A<br />
Kunsthaus Bregenz - Peter Zumthor<br />
A<br />
Hamburger Bahnhof Berlin - 1] Bauteil Umbau Kleihues 2] Bauteil Umbau Kuehn & Malvezzi<br />
D<br />
1 2<br />
AF ges<br />
ka<br />
AF 1<br />
ka<br />
AF 2<br />
ka<br />
AF 3<br />
ka<br />
AF ges<br />
11900<br />
AF 1<br />
4800<br />
AF 2<br />
1700<br />
AF 3<br />
5400<br />
AF ges<br />
1500<br />
Pinakothekenareal München - 1] Alte Pinakothek 2] Neue Pinakothek 3] Pinakothek der Moderne<br />
D<br />
Museo del Prado Madrid - 1] Bauteil Villanueva 2] Bauteil Moneo<br />
E<br />
durch einen starken Bezug von Innen- und Außenraum<br />
ist die Halle Sinnbild einer neuen Öffentlichkeit,<br />
die für die Institution Kunsthaus stehen<br />
soll. Weitere öffentliche Funktionen, wie ein Café<br />
und ein Museumsshop sollen an diesen zentralen<br />
Bereich der Halle angelagert werden.<br />
Mit 527m² Nutzfläche der Halle, was gegenüber den<br />
Wettbewerbsvorgaben eine Vergrößerung der Fläche<br />
um 27m² darstellt, und einer generellen Vergrößerung<br />
der öffentlichen Funktionen von Café und Kassenbereich<br />
wurden im Entwurfsprojekt ein großer<br />
Wert auf den gesamten Öffentlichkeitscharakter des<br />
Erweiterungsbaus gelegt. Dies soll Offenheit und<br />
Großzügigkeit ausstrahlen und den Verzicht auf den<br />
als »Anlässe« bezeichneten Bereich des Wettbewerbsprogramms<br />
kompensieren.<br />
Sammlungsgalerien Kunsthaus, Kunst ab 1960,<br />
Wechselausstellungen<br />
Diesem Teil der Sammlung Kunsthaus soll im Neubau<br />
besondere Beachtung geschenkt werden. Eine<br />
bessere und vernetztere Präsent<strong>at</strong>ion zeitgenössischer<br />
Kunst steht im Vordergrund der Bestrebungen<br />
und soll, gegenüber den schwer zu bespielenden<br />
Teilen des Bestandsbaus, neue Möglichkeiten zu<br />
intern<strong>at</strong>ionaler Vergleich unterschiedlicher Museumsinstitutionen (Zürich, Basel, Wien, Bregenz, Berlin, München, Madrid)<br />
AF ges<br />
13000<br />
AF 1<br />
7000<br />
AF 2<br />
6000<br />
AF ges<br />
ka<br />
AF 1<br />
ka<br />
AF 2<br />
7250<br />
AF 3<br />
12000<br />
AF ges<br />
ka<br />
AF 1<br />
ka<br />
AF 2<br />
ka<br />
B...Besucher SB...Sammlungsbestand in Objekten (davon ausgestellt) NF...Nutzflächen in m² AF...Ausstellungsflächen in m²<br />
einer nicht linear angeordneten Ausstellungstätigkeit<br />
bieten. Gefordert wurden laut Wettbewerbsprogramm<br />
Raumfolgen mit Ausstellungsräumen unterschiedlicher<br />
Größe in der Dimension von 3250m²,<br />
geeignet für Kunstgegenstände unterschiedlichster<br />
Medien und Größen. Wechselausstellungsgalerien<br />
sollen zusätzliche 900m² Fläche bieten und mit<br />
Ausstellungen, gekennzeichnet durch einen starken<br />
inhaltlichen Bezug zur Sammlung Kunsthaus,<br />
bespielt werden.<br />
Die vernetzte Bespielung der Sammlung Kunsthaus<br />
mit Kunst ab 1960 steht auch im Zentrum des<br />
Entwurfes dieser Diplomarbeit. Außerdem wird ein<br />
starker Öffentlichkeitsbezug dieses Sammlungsteils<br />
angestrebt, der einer inhaltlichen Neudefinition<br />
der Kunst und einer dadurch entstandenen Vielfalt<br />
innerhalb der Kunstproduktion gerecht werden soll.<br />
Es werden daher all jene Sammlungsteile, die zeitgenössische<br />
Kunst beinhalten, entweder im Erdgeschoß<br />
oder im Untergeschoß angeordnet. Um eine<br />
Verringerung der Ausstellungsflächen gegenüber<br />
dem Raumprogramm um rund 2000m² auszugleichen,<br />
wurde ein Ausstellungskonzept entwickelt,<br />
welches diese Flächen durch sogenannte »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />
zu ersetzten versucht. Diese liegen<br />
entweder als Vermittlungsraum zwischen Erschließungs-<br />
und Ausstellungsbereich, beziehungsweise<br />
ergänzen die Ausstellungsflächen in nicht linearer<br />
Anordnung und belaufen sich auf eine Gesamtnutzfläche<br />
von 1436m².<br />
Sammlung Bührle und Sammlungsgarlerien<br />
Kunsthaus, Malerei 19. Jahrhundert, klassische<br />
Moderne<br />
Als in sich ruhende Sammlung umfasst die Sammlung<br />
Bührle Räumlichkeiten im Ausmaß von<br />
1500m² Nutzfläche. Als klassische Ausstellungsgalerie<br />
soll eine lineare Abfolge unterschiedlich großer<br />
Ausstellungsräume ermöglicht werden. Wichtiges<br />
Element stellt ein zentraler Galerieraum dar, der den<br />
Kern der Sammlung mit Meisterwerken der impressionistischen<br />
Malerei und deren Hauptvertreter von<br />
Manet, über Cézanne bis hin zu Van Gogh beinhaltet.<br />
Ergänzt wird die Sammlung Bührle mit Werken<br />
klassischer Malerei des 19. Jahrhunderts und<br />
Werken der klassischen Moderne aus der Sammlung<br />
Kunsthaus, die in Räumen mit einer Gesamtnutzfläche<br />
von 500m² untergebracht werden sollen.<br />
Im Entwurf wurden die geforderten Flächen für<br />
diesen Teil der Ausstellungsgalerien eins zu eins<br />
übernommen. Sie befinden sich in den drei Obergeschoßen<br />
des Gebäudes.<br />
Kunstvermittlung<br />
Als ergänzende Räumlichkeiten zu den im Bestandsbau<br />
situierten Mal<strong>at</strong>eliers und Gruppenräumen<br />
soll im Erweiterungsbau ein Zentrum für Aktivitäten<br />
von Besuchern in Gruppen entstehen. Dieses<br />
beinhaltet unterschiedlich kombinierbare Gruppenräume<br />
sowie ein großes, multifunktionales Atelier<br />
zur Kunstproduktion. Während ein Großteil der<br />
Vermittlungsarbeit direkt in den Galerien st<strong>at</strong>tfinden<br />
wird, sollen vor allem spezifische Vermittlungskurse<br />
der Institution Kunsthaus und Schulklassen in den<br />
neu geschaffenen Räumen der Kunstvermittlung<br />
ihren Pl<strong>at</strong>z finden.<br />
Die Aufsplittung der Vermittlungstätigkeit kommt<br />
auch im Entwurf dieser Arbeit zum Ausdruck,<br />
indem Kunstvermittlung zum einen in den »Kur<strong>at</strong>orenräumen«<br />
erfolgen kann und dort ihre räumliche<br />
Verortung findet und zum anderen in einem eigenständigen<br />
Gebäude, das die eben beschriebenen<br />
zusätzlichen Räumlichkeiten des Wettbewerbsprogramms<br />
in sich aufnimmt und einen geforderten,<br />
eigenständigen Betrieb der Vermittlungsarbeit<br />
ermöglicht.<br />
Anlässe<br />
Laut Wettbewerbsprogramm wurde ein Veranstaltungsbereich<br />
in der Größenordnung von 1200m²<br />
Nutzfläche vorgesehen. Er sollte einen Veranstaltungs-<br />
und Festsaal mit zugehörigem Foyer, Gruppenräume<br />
und einen C<strong>at</strong>eringbereich beinhalten.<br />
Die Errichtung dieser Räumlichkeiten scheint<br />
wenig sinnvoll, da schon der bestehende Bau einen<br />
Festsaal in ähnlicher Dimension aufweist und das<br />
Raumprogramm ohnehin als überfrachtet angesehen<br />
wird. Dadurch ist der gesamte Bereich »Anlässe«<br />
im Entwurfsprozess nicht berücksichtigt worden.<br />
Durch eine Vergrößerung der öffentlichen Bereiche<br />
der Halle und des Cafés samt zugehöriger Infrastruktur<br />
sollen trotzdem unterschiedlichste Veranstaltungen<br />
im Neubau des Kunsthauses ermöglicht<br />
werden. Leichte Modifik<strong>at</strong>ionen des bestehenden<br />
Veranstaltungsbereiches in den Bestandsbauten von<br />
Karl Moser und der Gebrüder Pfister sollen diesen<br />
Teil samt Veranstaltungssaal für größere Ereignisse<br />
<strong>at</strong>traktiver machen und die Position der Bestandsbauten<br />
im späteren Konglomer<strong>at</strong> Kunsthaus Zürich<br />
stärken.<br />
Infrastruktur<br />
Ein ebenfalls wesentlicher Teil des Neubaus soll<br />
ein Kunstdepot im Ausmaß von 1000m² Nutzfläche<br />
darstellen, was auch im Zuge des Diplomprojekts<br />
als sinnvoll erachtet und in das Raumprogramm<br />
übernommen wurde.<br />
Strukturmodell, Sicht vom Heimpl<strong>at</strong>z aus<br />
Gebäudestruktur<br />
Der neue Gebäudeteil zur Erweiterung des Kunsthauses<br />
Zürich ist, wie in der Wettbewerbsausschreibung<br />
vorgeschlagen, am Areal der Kantonsschule<br />
situiert. Die für den Heimpl<strong>at</strong>z prägenden Turnhallenbauten<br />
werden in das Organis<strong>at</strong>ionskonzept<br />
integriert und stellen nach wie vor ein wichtiges,<br />
charakteristisches Element des Ortes dar. Während<br />
in der Erdgeschoßebene ein weiteres Gebäude, das<br />
die Kunstvermittlung in sich aufnimmt, und mehrere<br />
kleinere Volumina mit dienender Funktion die umgebende,<br />
städtische Struktur aufnehmen und sie im<br />
Inneren des Gebäudes fortführen um mit dem Baukörper<br />
der Kantonsschule ein städtisches Ensemble<br />
zu bilden, markiert ein markantes Volumen ab dem<br />
1. Obergeschoß die Wichtigkeit des Ortes und die<br />
besondere Bedeutung des Gebäudes im städtischen<br />
Gefüge. Als Zäsur zwischen öffentlicher Erdgeschoßebene<br />
und den Galerieebenen in den Obergeschoßen<br />
fungiert eine Betonstruktur, die gleichzeitig<br />
Dach, Vordach und auf die innere Organis<strong>at</strong>ion<br />
des Gebäudes verweisendes Element ist. Durch<br />
die beiden ehemaligen Turnhallen und einer leicht<br />
geschwungenen Glasfront wird ein dreiseitig abgeschlossener<br />
Pl<strong>at</strong>zraum gebildet, der den Heimpl<strong>at</strong>z<br />
Richtung Norden hin erweitert. An diesem Pl<strong>at</strong>z<br />
liegen auch der Haupteingang des Erweiterungsbaus<br />
und ein Café. Durch den Verzicht auf eine unterirdische<br />
Verbindung des Neubaus mit den Bestandsbauten<br />
wird die Präsenz des Heimpl<strong>at</strong>zes als öffentlicher<br />
Raum gestärkt. Die Behandlung des Foyers und<br />
der Halle als Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes bekräftigt<br />
dies zusätzlich. Eine Umkehr in der Betrachtung<br />
von Außen und Innen führ dazu, dass, während<br />
der neu geschaffene, zentrale Bereich des Erweiterungsbaus<br />
an Öffentlichkeitscharakter gewinnt, der<br />
Heimpl<strong>at</strong>z zum neuen Foyer beider Bauten wird.<br />
Ganz im Sinne der Wettbewerbsausschreibung, wird<br />
eine gleichwertige Anordnung von bestehendem<br />
Kunsthaus und neu zu errichtender Erweiterung am<br />
Heimpl<strong>at</strong>z ermöglicht und die Wirkung des heutigen<br />
Gebäudes als »Altbau« vermieden. Im Norden des<br />
Gebäudes ist ein weiterer öffentlicher Pl<strong>at</strong>zraum<br />
angegliedert, der als »Hof der Kunst« ausgebildet<br />
wird und den Übergang zum bestehenden Grünraum<br />
am Kantonsschulareal schafft. An diesen Bereich,<br />
der sich als Skulpturenhof gut zur Präsent<strong>at</strong>ion von<br />
Skulpturen und Objekten eignet, wurde der Museumsshop<br />
angegliedert. Das Gebäude ist sowohl über<br />
den Heimpl<strong>at</strong>z, die Rämistraße, als auch über den<br />
»Hof der Kunst« zu betreten, was eine gute Durchwegung<br />
des Gebäudes mit größtmöglichem Öffentlichkeitscharakter<br />
ermöglicht.<br />
Innere Organis<strong>at</strong>ion<br />
Über die zentrale Halle mit ihrem starken Bezug<br />
zum Außenraum wird das Gebäude betreten. An die<br />
Halle sind die öffentlichen Funktionen wie das Café,<br />
der Shop und der Ticket- und Inform<strong>at</strong>ionsbereich<br />
angelagert. Durch einen großen Luftraum wird der<br />
über 700m² große »Kur<strong>at</strong>orenraum« im Untergeschoß<br />
erlebbar und physisch mit der Halle verbunden.<br />
Über die Einheit Halle und »Kur<strong>at</strong>orenraum«<br />
können sämtliche Ausstellungsräume der Sammlung<br />
Kunsthaus mit Kunst seit 1960, sowie der Wechselausstellung<br />
betreten werden. Diese befinden<br />
sich in den beiden ehemaligen Turnhallen, sowie<br />
zwei weiteren Ausstellungshallen im Untergeschoß.<br />
Weiters ist die zentrale Halle Erschließungsraum für<br />
sämtliche, sich zusätzlich im Erdgeschoß befindliche<br />
Funktionseinheiten, die sowohl die Kunstvermittlung,<br />
als auch Verwaltung, Restaur<strong>at</strong>ion und<br />
Anlieferung beinhalten. Über einen durch die Decke<br />
ausladenden Stiegenraum sind die Sammlungsräume<br />
der Obergeschoße erreichbar. Dies unterstreicht<br />
die im heutigen Kunsthaus gepflegte Tradition des<br />
»Hinaufgehens zur Kunst«, deren Stärkung ganz<br />
im Sinne der Institution Kunsthaus auch durch das<br />
neue Gebäude zum Ausdruck kommen soll. An die<br />
zentralen Ausstellungshallen in den Obergeschoßen<br />
sind südseitig Erschließungsbereiche und Richtung<br />
Norden pro Geschoß jeweils zwei weitere »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />
angeordnet, die die Ausstellungsräume<br />
komplettieren.<br />
Neben dem Kunstdepot sind in den beiden Untergeschoßen<br />
noch Räume der Ausstellungsvorbereitung,<br />
der Technik, sowie weitere Lagerflächen und Werkstätten<br />
situiert. Die Anlieferung von Kunstwerken<br />
erfolgt über einen eigenen Gebäudeteil im Erdgeschoß,<br />
von wo aus sie mittels eines Lastenliftes im<br />
Gebäude verteilt werden können.<br />
Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 02 (04)
Museum Typologie<br />
Museum und Gesellschaft<br />
Die große Frage, die sich bezüglich der Institution<br />
Museum in Zukunft stellen wird, ist jene nach deren<br />
Stellung in der Gesellschaft, wobei hier wiederum<br />
Aspekte bezüglich der Öffnung der Museen<br />
ausschlaggebend sein werden. Aktuell scheint es,<br />
als würde dies auf eine Diskussion über die einzunehmende<br />
Haltung hinsichtlich der Pl<strong>at</strong>zierung der<br />
Institution in einem kapitalistischen Marktsystem<br />
hinauslaufen. »Das Museum muss sich den »Herausforderungen<br />
der Kommunik<strong>at</strong>ionsgesellschaft«<br />
stellen«, jedoch erscheint es schwierig, bei dieser<br />
Herausforderung eine vernünftige, für alle Seiten<br />
sinnvolle Abstimmung von marktwirtschaftlich<br />
orientierten Maßnahmen mit jenen hinsichtlich eines<br />
produktiven Umganges mit Kunst zu finden. Das<br />
Architektenduo Gigon-Guyer zeigt sich hier gegenüber<br />
skeptisch und bemerkt: »Rückblickend entsteht<br />
der Eindruck, als sei die einst berechtigte Forderung<br />
der Öffnung der Museen, die bessere Erschließung<br />
der Sammlungen, die Aufarbeitung zeitgenössischer<br />
Kunst und die Erweiterung der Kunstinhalte in zeitrelevanten<br />
Ausstellungen mit einer Profanisierung<br />
und einer auf Besucherzahlen und Großereignisse<br />
abgestellten Kunstpolitik gründlich missverstanden<br />
worden.« Auch wenn » [...] eine konsequente Orientierung<br />
am zahlenden Besucher für die Zukunft der<br />
wichtigste Erfolgsfaktor für die Existenzsicherung<br />
und Behauptung von Kulturinstitutionen auf dem<br />
durch starke Konkurrenz gekennzeichneten Freizeitmarkt<br />
ist«, so darf eine kommerzielle Ausrichtung<br />
nicht zum Erstanliegen der Institution Museum<br />
werden und das Museum nicht zum Kind kapitalistischer<br />
Zwänge mutieren. Aus diesen Erkenntnissen<br />
heraus sollen nun die Aufgaben der Institution<br />
Museum für die Zukunft entwickelt und konkret am<br />
Beispiel zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />
angewandt werden.<br />
Museum als Impulsbringer<br />
Ein weit verbreitetes Phänomen bei Neuerrichtungen<br />
von Museumsbauten ist deren gleichzeitige<br />
Verwendung als Elemente der punktuellen Stadtrepar<strong>at</strong>ur.<br />
Durch das Einsetzen von Kunst-, Kultur-<br />
und Bildungseinrichtungen in das Stadtgefüge wird<br />
versucht, ganze Stadtbezirke zu transformieren und<br />
den Effekt der Bedeutungsverschiebung des Ortes<br />
für eine nachhaltige Entwicklung des Gebietes zu<br />
nutzen. So entstehen Gebiete, die durch eine hohe<br />
Konzentr<strong>at</strong>ion ebensolcher Institutionen geprägt<br />
sind. Interessant sind die unterschiedlichen Strukturen,<br />
die solche Gebiete aufweisen können und<br />
die Beziehungen, die unter den unterschiedlichen<br />
Einrichtungen zueinander vorherrschen.<br />
Solche Konzentr<strong>at</strong>ionen von Bildungs- Kultur- und<br />
Kunsteinrichtungen können in ganz Europa beobachtet<br />
werden; fünf sollen hier kurz ihre Erwähnung<br />
finden und bezüglich ihrer Strukturen analysiert<br />
werden. Beginnen wir mit Stuttgart, wo durch die<br />
Errichtung des Erweiterungsbaus der Sta<strong>at</strong>sgalerie,<br />
sowie des Neubaus des Stuttgarter Kunstmuseums<br />
gezielt durch punktuelle Interventionen Stadtrepar<strong>at</strong>ur<br />
erfolgte. Vor allem dem Kunstmuseum kommt<br />
hierbei eine besondere Bedeutung zu, da es durch<br />
seine Setzung Lücken an einem str<strong>at</strong>egisch wichtigen<br />
Punkt im städtischen Gefüge schließt, die im<br />
Zuge des zweiten Weltkrieges entstanden waren,<br />
und somit entscheidend für die Entwicklung des<br />
Gebietes verantwortlich ist. Als zweites Beispiel<br />
soll die Stadt München herangezogen werden, wo<br />
das Gebiet der Maxvorstadt immer mehr durch<br />
Bildungs- und Kulturbauten funktional verdichtet<br />
wird. Hier sind einige der wichtigsten Museumsbauten<br />
Deutschlands vertreten, die ihre Wirkung<br />
auf die Umgebung durch eine flächige Anordnung<br />
der einzelnen Institutionen erreichen. Im Gegens<strong>at</strong>z<br />
Modellfoto Ansicht Eingang<br />
Modellfoto Ansicht Rämistraße<br />
Modellfoto zentrale Halle<br />
intern<strong>at</strong>ionaler Vergleich: Kulturareale (Stuttgart, München, Zürich, Wien, Paris)<br />
Stuttgart - Stuttgarter Kulturmeile -<br />
München - Kunstareal München -<br />
Zürich - Bildungs- und Kulturmeile -<br />
Wien - Wiener Ringstraße und Museumsquartier -<br />
Paris - Museumskomplex des Louvre -<br />
Institutionen<br />
500m Kunstmuseen sonstige Museen The<strong>at</strong>er & Schauspiel Bildungseinrichtungen<br />
steht die Bildungs- und Kulturmeile in Zürich, die,<br />
wie der Name schon sagt, eine lineare Entwicklung<br />
verfolgt. Auch hier wird durch ein hohes Vorkommen<br />
an unterschiedlichsten Einrichtungen, das in<br />
Zukunft einer weiteren Verdichtung unterzogen<br />
werden soll, zu der auch der Neubau der Kunsthauserweiterung<br />
beitragen wird, eine positive Wirkung<br />
in punkto Stadtentwicklung erwartet. Ganz anders<br />
erfolgte eine solche Verdichtung an Bildungs- und<br />
Kultureinrichtungen in Wien, wo im Falle des<br />
Museumsquartiers eine punktuelle Anordnung vieler<br />
verschiedener Einrichtungen zum gewünschten<br />
Ergebnis führte. Auf engstem Raum ist so eine Fülle<br />
an Institutionen unterschiedlichster Art vertreten,<br />
was einen lebendigen Kulturbetrieb ermöglicht. Am<br />
Beispiel von Paris wiederum kann ein Phänomen<br />
beobachtet werden, wo durch die schiere Größe<br />
einzelner Institutionen, wie dem Louvre oder dem<br />
Centre Pompidou eine positive Ausstrahlung auf<br />
umgebende Stadträume erfolgt.<br />
Museum und öffentlicher Raum<br />
Auch wenn der Begriff der »Stadtrepar<strong>at</strong>ur« in<br />
Bezug auf die Aufgabe zur Erweiterung des Kunsthauses<br />
Zürich als etwas überzeichnet wirkt, besteht<br />
dennoch auch hier die einzigartige Chance zur<br />
Neudefinition der Situ<strong>at</strong>ion am Heimpl<strong>at</strong>z und somit<br />
Modellfoto „Kur<strong>at</strong>orenraum“<br />
Neue Sta<strong>at</strong>sgalerie<br />
Kunstgebäude Stuttgart<br />
Kunstmuseum Stuttgart<br />
Museum der bild. Künste<br />
Landesmuseum Württemb.<br />
Sta<strong>at</strong>sthe<strong>at</strong>er<br />
Friedrichsbau<br />
Universität Stuttgart<br />
Hochschule für Musik<br />
und darstellende Kunst<br />
Hochschule für Technik<br />
Institutionen<br />
Alte Pinakothek<br />
Neue Pinakothek<br />
Pinakothek der Moderne<br />
Museum Brandhorst<br />
Glyptothek<br />
Sta<strong>at</strong>liche Sammlungen<br />
Lendbachhaus<br />
Paläontologisches Museum<br />
Amerika Haus<br />
Technische Universität<br />
Bayrische Sta<strong>at</strong>sbibliothek<br />
Institutionen<br />
Kunsthaus Zürich<br />
Sammlungen ETH<br />
Sammlungen Universität<br />
Schauspielhaus<br />
Zentralbibliothek<br />
ETH Zürich<br />
Universität Zürich<br />
Konserv<strong>at</strong>orium<br />
Opernhaus Zürich<br />
The<strong>at</strong>er Stok<br />
The<strong>at</strong>er an der Winkelwiese<br />
Institutionen<br />
Kunsthistorisches Museum<br />
N<strong>at</strong>urhistorisches Museum<br />
MUMOK<br />
Sammlung Leopold<br />
Kunsthalle Wien<br />
Architekturzentrum Wien<br />
Burgthe<strong>at</strong>er<br />
Volksthe<strong>at</strong>er<br />
Tanzquartier Wien<br />
Universität Wien<br />
Akademie der Künste<br />
Institutionen<br />
Louvre<br />
Musée d‘Orsay<br />
Institut de France<br />
École des Beaux Arts<br />
zu einer Transform<strong>at</strong>ion des Ortes. Als wesentliche<br />
Aufgabe in dieser Hinsicht wurde im Zuge des<br />
Entwurfes die Them<strong>at</strong>ik des öffentlichen Raumes im<br />
Umfeld des Museumsbaus angesehen. Als öffentlich<br />
zugängliche Einrichtung soll ein Museum auch dazu<br />
verpflichtet sein, öffentliche Räume zu generieren.<br />
Im Entwurfsprojekt geschah dies in Form der<br />
Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes Heimpl<strong>at</strong>z durch den<br />
Bereich, der sich zwischen den beiden ehemaligen<br />
Turnhallen befindet, sowie der Schaffung eines<br />
»Hofes der Kunst«, der, als Skulpturenhof genutzt,<br />
einen weiteren öffentlichen Bereich im Norden des<br />
Gebäudes darstellt. Doch auch die Innenräume der<br />
zentralen Halle und des »Kur<strong>at</strong>orenraumes« im Untergeschoß,<br />
sowie deren zugeordnete, öffentlichen<br />
Funktionen wie das Café und der Museumsshop<br />
sollen einen größtmöglichen Öffentlichkeitscharakter<br />
besitzen. In Kombin<strong>at</strong>ion mit einer funktional<br />
gliedernden Terrassierung dieser Innenräume steht<br />
dies in einer Bautradition, wie sie in Zürich öfters<br />
zu beobachten ist. Solche öffentlich anmutende<br />
Innenräume sind zum Beispiel die umgenutzte alte<br />
Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes, der zentrale<br />
Pl<strong>at</strong>zraum des Gebäudes »Puls5« im ehemaligen<br />
Industriegebiet Zürich West, sowie der überdachte<br />
Innenhof der Universität Zürich.<br />
Architektur<br />
Durch das architektonische Erscheinungsbild des<br />
Gebäudes soll dessen innere Struktur widergespiegelt<br />
und nach außen ablesbar gemacht werden. Die<br />
unterschiedlichen Charaktere der Sammlungen<br />
fordern so ihren Tribut in Bezug auf die Architektur.<br />
Die Ausstellungsgalerien der Sammlung Bührle in<br />
den drei Obergeschoßen sollen in dieser Konstell<strong>at</strong>ion<br />
durch einen nach außen hin abgeschlossenen<br />
Quader repräsentiert werden, der zwar in den ersten<br />
beiden Obergeschoßen aufgebrochen wird, dessen<br />
Wirkung als massiver, die Kunst in Sicherheit verwahrender<br />
Baukörper jedoch durch eine transluzente<br />
Fassadengestaltung gewahrt bleibt, die den Blick<br />
auf den massiven Betonkern, der die Ausstellungsgalerien<br />
umgrenzt, weiterhin freigibt. Die transluzente<br />
Wirkung der Haut dieses Gebäudeteiles wird<br />
durch den Eins<strong>at</strong>z von grobmaschigem Streckmetallgitter<br />
ermöglicht, welches verzinkt ausgeführt,<br />
seinem immanenten M<strong>at</strong>erialcharakter als industriell<br />
gefertigtes Produkt Rechnung tragen soll. Durch die<br />
Betonung konstruktiver Elemente, die die Fassade<br />
horizontal gliedern, wird die Wirkung als ästhetisierende<br />
»Kunstbox« im Sinne einer Haltung des Minimalismus<br />
vermieden. Vielmehr soll das Gebäude<br />
durch seine Merkmale bezüglich Konstruktion und<br />
M<strong>at</strong>erialität ein Gefühl der Vertrautheit hervorrufen,<br />
sich in bestehende Strukturen einfügen, und so zum<br />
adäqu<strong>at</strong>en Ort der Kunst werden.<br />
Die architektonische Gestaltung der Erdgeschoßzone<br />
ist in Hinblick auf jenen Gebäudeteil, der die<br />
Sammlung Bührle beinhaltet, als eine ihr gegenläufige<br />
zu bezeichnen. Bedingt durch das zentrale<br />
Entwurfsthema der Dialektik von Geschlossenheit<br />
und Offenheit versucht dieses Geschoß einen größtmöglichen<br />
Öffentlichkeitscharakter zu erreichen.<br />
Dies geschieht zum einen durch den maßstäblichen<br />
Bezug der Setzung benötigter Volumina auf die<br />
umgebenden Stadtstrukturen, sowie zum anderen<br />
durch die Verwendung von M<strong>at</strong>erialien, die einen<br />
öffentlichen Stadtraum ausmachen. Entscheidend<br />
dabei ist, dass eine Aufhebung der Trennung von<br />
Außen- und Innenraum angestrebt wird. Der öffentliche<br />
Raum fließt durch das Gebäude, die zentrale<br />
Halle wird zum belebten Stadtraum. Als architektonische<br />
Vorbilder können hierfür das von Lac<strong>at</strong>on<br />
Vassal umgebaute Palais du Tokyo in Paris oder die<br />
von Herzog de Meuron adaptierte T<strong>at</strong>e Modern in<br />
London angesehen werden.<br />
Auch in Hinblick auf die Eingangssitu<strong>at</strong>ion am<br />
Heimpl<strong>at</strong>z spielt das Thema der Offenheit und deren<br />
architektonische Ausformulierung eine zentrale<br />
Beispiele von Innenräumen mit starkem Öffentlichkeitscharakter (Uni Zürich, Puls 5 in Zürich West, Hauptbahnhof)<br />
Referenzen: zentrale Halle (Entwurfsprojekt Kunsthaus+, Palais du Tokyo in Paris, T<strong>at</strong>e Modern in London)<br />
Rolle. So wurde versucht, durch eine zeitgemäße<br />
Interpret<strong>at</strong>ion einer klassischen Loggia, wie sie am<br />
Beispiel des Alten Museums von Karl Friedrich<br />
Schinkel in Berlin zu beobachten ist, den für ein<br />
Museum typischen Schwellenbereich aufzulösen.<br />
Ähnlich wie es Stephan Braunfels bei der Pinakothek<br />
der Moderne in München löste, soll die<br />
Frontalität der Fassade im Eingangsbereich gebrochen<br />
werden, im Falle des Erweiterungsbaus für<br />
das Kunsthaus Zürich jedoch zusätzlich, durch ein<br />
ausladendes Vordach, in die Tiefe erweitert werden,<br />
was zu einem Verschmelzen von Pl<strong>at</strong>zraum, Foyer<br />
und zentraler Halle führen soll.<br />
Referenzen: Eingangsbereich (Altes Museum, Pinakothek der<br />
Moderne, Entwurfsprojekt Kunsthaus+)<br />
In seinem Gesamterscheinungsbild soll der Gebäudekomplex<br />
zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />
Ausdruck der gestellten, komplexen Bauaufgabe<br />
selbst sein. In einer Architektur des Dialoges vereinen<br />
sich vielschichtige Elemente wie die öffentlichen<br />
Flächen der Pl<strong>at</strong>zräume, die Innenräume mit<br />
starkem Öffentlichkeitscharakter in Form des Cafés,<br />
des Museumsshops und der zentralen Halle, die<br />
Kur<strong>at</strong>oren- und Ausstellungsräume, sowie die umgenutzten<br />
Turnhallen zu einem neuen Ganzen. Das<br />
Gebäude ist nicht Produkt einer Architektursprache,<br />
sondern die Antwort auf eine konkrete architektonische<br />
Problemstellung, unter der Berücksichtigung<br />
von Forderungen seitens der Kunst und der Gesellschaft,<br />
aber auch seitens der Stadt, des Ortes. Das<br />
Museum soll nicht Architektur des Besonderen, sondern<br />
des Gewöhnlichen sein und seine Besonderheit<br />
durch die Dialektik und nicht durch das Spektakel<br />
erzielen.<br />
Zur Typologie<br />
Der heutige Museumsbau ist durch zwei unterschiedliche<br />
Denkansätze geprägt. Einerseits<br />
entstehen nach wie vor Museen des Spektakels,<br />
deren Weg vor allem durch den Museumsbauboom<br />
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts geebnet wurde,<br />
andererseits bezieht man sich wieder vermehrt auf<br />
Elemente eines klassischen Museumsbautypus, wie<br />
er sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert<br />
h<strong>at</strong>. Eine weitere wesentliche Beeinflussung<br />
heutiger Museumsarchitekturen stellt die Umnutzung<br />
historischer Bausubstanzen dar, wodurch<br />
wichtige Museumsbauten einschlägiger Kulturinstitutionen<br />
entstanden, die als richtungweisend für<br />
die Zukunft gelten können. All diese Entwicklungen<br />
haben unterschiedliche Typologien hervorgebracht,<br />
beginnend bei der Enfilade an Ausstellungsräumen<br />
bis hin zur Ausstellungshalle, die heute als allgemein<br />
gültige und sinnvolle Form des Ausstellungsraumes<br />
gelten.<br />
So war im Entwurfsprozess zu dieser Arbeit<br />
nicht die Entwicklung einer neuartigen Typologie<br />
ausschlaggebend, es wurde vielmehr der Versuch<br />
unternommen, unterschiedliche typologische Elemente<br />
neu zu kombinieren und, noch wichtiger, neu<br />
zu programmieren. In der gegebenen Situ<strong>at</strong>ion am<br />
Heimpl<strong>at</strong>z in Zürich, geprägt durch seine städtebauliche<br />
Lage und die am Pl<strong>at</strong>z situierten Turnhallen<br />
wurde dahingehend ein großes Potenzial gesehen.<br />
Der neue Gebäudekomplex zur Erweiterung des<br />
Kunsthauses Zürich definiert sich durch die Kombin<strong>at</strong>ion<br />
von umgenutzten Gebäuden, einem zentralen<br />
Erschließungsraum mit starkem Öffentlichkeitscharakter,<br />
einer gestapelten, dreigeschoßigen Ausstellungsgalerie<br />
und mehreren Ausstellungshallen sowie<br />
darüber hinaus über eine Architektursprache, die<br />
versucht, diese Vielfalt auch nach außen ablesbar<br />
zu machen. All diese Elemente haben in sich wieder<br />
typologische Vorbilder, durch ihre Kombin<strong>at</strong>ion<br />
jedoch entsteht im Zürcher Museumszubau jedoch<br />
ein einzigartiges Konglomer<strong>at</strong>, abgestimmt auf die<br />
auszustellende Kunst, die umgebenden Stadtstrukturen<br />
und auf den Charakter des Ortes.<br />
Nun sollen die einzelnen Elemente des Gebäudes<br />
beschrieben werden und in Hinsicht auf typologisch<br />
verwandte Beispiele reflektiert werden. Die zentrale<br />
Halle im Erdgeschoß und der Kur<strong>at</strong>orenraum im<br />
Untergeschoß, die, über einen Luftraum verbunden<br />
eine Einheit bilden, können in Form eines Zentralraumes<br />
als Herz des Gebäudes verstanden werden,<br />
über das die Erschließung der restlichen Gebäudeteile<br />
erfolgt. Typologische Vorbilder sind hier zum<br />
einen das Alte Museum von Schinkel, mit einem<br />
Zentralraum in Form einer Rotunde oder aber auch<br />
die T<strong>at</strong>e Modern, wo diese Funktion durch die ehemalige<br />
Turbinenhalle übernommen wird. In seinem<br />
Charakter, vor allem im Sinne des Ausstellungskonzeptes<br />
soll jener Raum aber eher einem, den einzelnen<br />
Ausstellungsräumen zwischengeschalteten Bereich<br />
ohne präzise Funktionsbelegung entsprechen,<br />
wie es vielleicht bei der Berliner Gemäldegalerie<br />
nach deren Umbau durch die Architekten Hilmer<br />
und S<strong>at</strong>tler der Fall ist.<br />
Die Ausstellungsräume für den Teil der Sammlung<br />
Kunsthaus mit Kunst seit 1960, die sich im Erdgeschoß<br />
und im Untergeschoß befinden, entsprechen<br />
dem Typus der Ausstellungshalle, nur die westlich<br />
gelegene Turnhalle erhält Einbauten in Form zweier<br />
Ausstellungsräume mit Oberlicht, um auch traditionellen<br />
Form<strong>at</strong>en zeitgenössischer Kunst einen<br />
optimalen Rahmen zu bieten. Eine gewisse Verwandtschaft<br />
dieser Räume besteht zur Temporären<br />
Kunsthalle in Berlin von Adolf Krischanitz, die<br />
eine auf das nötigste reduzierte Ausstellungshalle<br />
darstellt, welche sich durch die temporäre Nutzung,<br />
sein Konstruktionsprinzip und seine M<strong>at</strong>erialität von<br />
den Gedanken des White Cubes lossagt.<br />
Die drei Obergeschoße finden ihre typologische Entsprechung<br />
am ehesten in der Alten Pinakothek von<br />
Leo von Klenze. Hier ist, wie auch beim Entwurf<br />
dieser Arbeit, eine dreischiffige Anordnung unterschiedlicher<br />
Raumgruppen der Fall. Die Kabinette<br />
an der Nordseite des Gebäudes werden beim Kunsthauszubau<br />
durch die so genannten »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />
ersetzt, ansonsten liegt durch den zentralen<br />
Bereich als Ausstellungsgalerie und dem an der südlichen<br />
Fassade gelegenen Erschließungsbereich eine<br />
typologische Entsprechung vor, die jedoch durch die<br />
Stapelung über drei Ebenen und die dadurch veränderte<br />
Lichtsitu<strong>at</strong>ion, sowie der zusätzlichen Unterteilung<br />
der Ausstellungshallen in Galeriefolgen, zum<br />
Teil aufgeweicht wird. So wird aus der Enfilade an<br />
Galerieräumen der Alten Pinakothek eine m<strong>at</strong>rixartige<br />
Anordnung an Ausstellungssälen in unterschiedlichen<br />
Größen und Proportionen, die jedoch trotz<br />
ihrer strukturellen Positionierung eine Ausstellung<br />
in lineare Form ermöglichen. Ein Museumsgebäude,<br />
wo solche Strukturen bereits zur Ausführung kamen,<br />
jedoch erneut nicht in gestapelter Form, sondern auf<br />
einer Ebene, ist das Moderna und Arkitektur Museet<br />
typologischer Vergleich: Gemäldegalerie in Berlin, T<strong>at</strong>e Modern in London, Entwurfsprojekt Kunsthaus+<br />
von Rafael Moneo in Stockholm.<br />
Neben all diesen typologischen und architektonischen<br />
Bezügen der einzelnen Gebäudeteile erreicht<br />
das entworfene Gebäude zur Erweiterung des<br />
Kunsthauses Zürich seine Wirkung und innere Logik<br />
durch die Kombin<strong>at</strong>ion und eine daraus resultierende<br />
Dialektik der Einzelelemente.<br />
Obergeschoße als Ausstellungshalle<br />
Obergeschoße als adaptierte Galerienfolge<br />
typologischer Vergleich: Alte Pinakothek in München, Moderna und Arkitektur Museet in Stockholm, Entwurfsprojekt Kunsthaus+<br />
Modellfoto Ausstellung Turnhalle 2<br />
Modellfoto Ausstellung OG 1<br />
Modellfoto Ausstellung OG 3<br />
Modellfoto Ansicht Skulpturenhof Modellfoto Erschließung 2.OG<br />
Modellfoto Ausstellung Turnhalle 1<br />
Ansicht Ost M 1:400<br />
Oberlicht<br />
Kur<strong>at</strong>orenaum<br />
Ausstellung<br />
Erschließungszone<br />
Kunstvermittlung<br />
dienende Funktionen<br />
Skulpturenhof<br />
Ausstellung Halle 2<br />
Shop<br />
Ticket / Info<br />
Anlieferung<br />
Café<br />
Anzeiger<br />
Ausstellung Halle 1<br />
Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 03 (04)<br />
Kunstvermittlung<br />
dienende Funktionen<br />
Skulpturenhof<br />
Shop<br />
zentrale Halle<br />
Anlieferung<br />
Ausstellung Halle 2<br />
Café<br />
Rampe Eingang<br />
Anzeiger<br />
Ausstellung Halle 1<br />
Vorbereitung Ausst.<br />
Kunstdepot<br />
Kur<strong>at</strong>orenraum<br />
Lager Nicht-Kunst<br />
Ausstellung Halle 4<br />
Ausstellung Halle 3<br />
Axonometrische Darstellungen:<br />
links: Erdgeschoßbereich mit zentraler Halle, Obergeschoße mit Ausstellungshalle; rechts: Erdgeschoßbereich mit Ausstellungsflächen und<br />
Kunstvermittlung, 2. Untergeschoß mit Ausstellungshallen
Kunst, Ausstellungsraum<br />
Ausstellungskonzept<br />
Sammlungs- und Ausstellungsaktivität des Kunsthauses<br />
Zürich sind geprägt durch eine bewusst<br />
gelebte Kombin<strong>at</strong>ion aus konservierender Sammlungstätigkeit<br />
und gleichzeitiger Aufmerksamkeit<br />
auf avancierte Kunst der Gegenwart. Die Institution<br />
beschreibt den Kern ihrer künstlerischen Arbeit<br />
als »doppelte Spannung und Wechselwirkung von<br />
Sammlung und Ausstellung: historische Tiefendimension<br />
und Gegenwartsbezug, Geschlossenheit<br />
und Offenheit.« Schon die Bezeichnung des<br />
Ausstellungshauses beziehungsweise der Institution<br />
als »Kunsthaus« spiegelt dies wider. Man ist weder<br />
reines Museum, noch Kunsthalle ohne Sammlung.<br />
Vielmehr versucht man Eigenschaften beider Organis<strong>at</strong>ionsmodelle<br />
zu verbinden, was auch durch die<br />
Architektur des zukünftigen Erweiterungsbaus zum<br />
Ausdruck kommen soll. Die Entscheidung, einen<br />
Neubau für Sammlungsteile, die bezüglich ihrer<br />
Inhalte als komplett unterschiedlich zu gelten haben,<br />
zu errichten, unterstreicht die Absicht der Institution<br />
Kunsthaus nur zusätzlich.<br />
Im Entwurf zu dieser Arbeit wurde gerade die<br />
soeben beschriebene Unterschiedlichkeit der zu<br />
organisierenden Sammlungsteile als großes Potenzial<br />
angesehen und versucht, dies auch am neuen<br />
Ausstellungsgebäude ablesbar zu machen. Während<br />
sämtliche Sammlungsteile zeitgenössischer Kunst<br />
und die Wechselausstellung im Erd- beziehungsweise<br />
im Untergeschoß angeordnet sind, befinden sich<br />
die Sammlungsteile mit klassischer Malerei und<br />
Skulpturen in den Obergeschoßen des Museumsbaus.<br />
Doch nicht nur die räumliche Verortung unterscheidet<br />
die einzelnen Sammlungsteile voneinander,<br />
sondern auch deren Ausstellungskonzepte selbst, auf<br />
die nun im Detail eingegangen werden soll.<br />
Ganz im Sinne der Aussage des Architekten Jean<br />
Nouvel: »Die erste Aufgabe eines Museums ist<br />
es zu zeigen, was es zu zeigen gibt.«, wurden die<br />
unterschiedlichen Konzepte aus den Inhalten und<br />
Charakteren der jeweils auszustellenden Kunstwerke<br />
der einzelnen Sammlungen heraus entwickelt.<br />
Sammlungsgalerien Kunsthaus, Kunst ab 1960,<br />
Wechselausstellungen<br />
Jener Sammlungsteil des Kunsthauses Zürich mit<br />
Kunst ab 1960 ist gekennzeichnet durch unterschiedlichste<br />
Inhalte, Form<strong>at</strong>e und Medien, die eine<br />
allgemeine, sich seit dieser Zeit abzeichnende, Vielfalt<br />
der Kunst widerspiegeln. Neben Schwerpunkten<br />
in zeitgenössischer Schweizer Kunst mit Vertretern<br />
wie Jean Tinguely, Markus Raetz, Dieter Roth oder<br />
Skizze: Aufsplitten der Sammlung Kunsthaus Zürich<br />
Kunstwerke der Sammlung mit Kunst ab 1960: Joseph Beuys,<br />
Pipilotti Rist, Cy Twombly<br />
dem Künstlerduo Fischli-Weiss und Schwerpunkten<br />
in zeitgenössischer Intern<strong>at</strong>ionaler Kunst, die<br />
durch namhafte Künstler wie Cy Twombly, Joseph<br />
Beuys, Marc Rothko, Bruce Nauman oder Richard<br />
Long ihre Vertretung finden, sind auch zahlreiche<br />
Arbeiten in Form von Neuen Medien vorhanden,<br />
wie Video- Photo- und Diaarbeiten der Künstler Jeff<br />
Wall, Be<strong>at</strong> Streuli, Pipilotti Rist oder Jenny Holzer,<br />
um nur einige wenige zu nennen. Laut Kunsthaus<br />
Zürich haben solche Konstell<strong>at</strong>ionen von Sammlungen<br />
zur Folge, »dass sich heutige Kunstinstitutionen<br />
immer deutlicher von der Vorstellung einer sich linear<br />
entwickelnden Kunstgeschichte verabschieden,<br />
die in einem Museum gewissermaßen ihre Abbildung<br />
finden müsste. Kunst, Publikum und Kunsthaus<br />
interessiert heute vielmehr das Nachspüren und<br />
Aufzeigen von Kohärenzen und Affinitäten innerhalb<br />
verschiedener Epochen und Bewegungen.« In<br />
diesem Sinne ist also eine stark vernetzte Form der<br />
Ausstellungstätigkeit in Gestalt einer nicht linearen<br />
Ausstellungsform anzustreben.<br />
In der Wettbewerbsausschreibung wird ein Ausstellungskonzept<br />
vorgeschlagen, das auf drei unterschiedlich<br />
großen Raumtypen basiert und vielfältige<br />
Raumfolgen ermöglicht, welche aus der Kombin<strong>at</strong>ion<br />
der verschiedenen Typen zu Accrochagen von<br />
fünf bis sechs Einheiten gebildet werden können.<br />
Dadurch soll der Kur<strong>at</strong>or nach Leitvorstellungen<br />
unterschiedlichster Art agieren können und eine dynamisierte<br />
Bespielung der Sammlung möglich werden.<br />
Die Gesamtgröße der Galerien wird durch eine<br />
Nutzfläche von 3250m² vorgegeben. Zusätzlich zu<br />
diesen Flächen werden Wechselausstellungsflächen<br />
in der Größenordnung von 900m² veranschlagt.<br />
Hier steht, neben einer formalen Anlehnung an die<br />
Galerieräume der Sammlung, eine flexibel mögliche<br />
Bespielung der Räumlichkeiten im Vordergrund.<br />
Dies soll durch einen großen und zwei weitere,<br />
kleine Ausstellungssäle erreicht werden.<br />
Durch die Reduktion der Ausstellungsflächen, die<br />
für den Sammlungsteil Kunst ab 1960 im Verlauf<br />
des Entwurfsprozesses veranschlagt wurde und etwa<br />
eine Halbierung der Galerieflächen bedeutet, war<br />
es notwendig, ein altern<strong>at</strong>ives Ausstellungskonzept<br />
zu generieren. Die massive Verkleinerung lässt<br />
die vorgesehene Kombin<strong>at</strong>ion unterschiedlicher<br />
Raumtypen zu inhaltlich aneinander gebundenen<br />
Raumeinheiten nicht zu, da eine dafür benötigte<br />
kritische Gesamtgröße nicht erreicht werden kann.<br />
Anstelle dieser Raumabfolgen sollen möglichst flexible<br />
Ausstellungshallen errichtet werden, die über<br />
die Kombin<strong>at</strong>ion mit den zusätzlichen Elementen<br />
des »Kur<strong>at</strong>orenraumes« und der »zentralen Halle«<br />
eine ebenso fruchtbare, im Sinne einer vernetzten,<br />
dynamischen Bespielung sinnvolle, Ausstellungstätigkeit<br />
ermöglichen. Der »Kur<strong>at</strong>orenraum« tritt<br />
als mittig liegender, kubischer Raum im Untergeschoß<br />
in Erscheinung, ist über einen Luftraum mit<br />
der zentralen Halle optisch verbunden, wodurch<br />
seine Präsenz auch im Erdgeschoßbereich gewahrt<br />
ist, und wird dadurch zum pulsierenden Herz des<br />
gesamten Erweiterungsbaus. Durch seine mächtigen<br />
Dimensionen, die sich in 725m² Nutzfläche und<br />
einer Raumhöhe von 10 Metern manifestieren, und<br />
seine zentrale Lage, ist er ein wichtiges Element des<br />
Ausstellungskonzeptes. Als Raum, der sich zwischen<br />
zentrale Halle und Ausstellungshallen schiebt,<br />
soll er unterschiedlichste Funktionen in sich aufnehmen<br />
können, jedoch in erster Linie dem Kur<strong>at</strong>or<br />
zur Bespielung verfügbar sein, und somit Teil der<br />
Kunstpräsent<strong>at</strong>ion werden. Von der eigens für diesen<br />
Raum geschaffenen Kunstinstall<strong>at</strong>ion, über Bereiche<br />
der Kunstvermittlung, aber auch das Ausstellen von<br />
Kunstwerken selbst, bis hin zu Veranstaltungen soll<br />
hier alles verwirklicht werden können. Der »Kur<strong>at</strong>orenraum«<br />
soll die Vermittlung zwischen Betrachter<br />
und zeitgenössischem Kunstwerk bewerkstelligen<br />
und den oft fehlenden Link zwischen Kunst und<br />
Leben, soweit dieser überhaupt ermöglicht werden<br />
kann, darstellen.<br />
Als eigentliche Ausstellungsfläche sollen vier<br />
Ausstellungshallen dienen, was eine, sowohl unter<br />
Künstlern als auch unter Kur<strong>at</strong>oren, beliebte Form<br />
des Ausstellungsraumes darstellt. So meint etwa<br />
Richard Serra: »Der Charakter der Architektur<br />
kommt den Bedürfnissen der Künstler dann am<br />
meisten entgegen, wenn der Architekt das Gebäude<br />
so wenig wie möglich unterteilt und fragmentarisiert.<br />
[...] Ich möchte, dass die Museumsräume so<br />
neutral, so offen, so flexibel wie möglich sind, damit<br />
Fassadenansicht Eingangsbereich Fassadenansicht Rämistraße<br />
Schnitt 03 M 1:400<br />
der Künstler den Raum strukturieren, neu definieren<br />
und seinen speziellen Bedürfnissen anpassen kann.«<br />
Zwei dieser Ausstellungshallen werden in den<br />
ehemaligen Turnhallen der Kantonsschule errichtet,<br />
die zu diesem Zweck adaptiert werden, zwei weitere<br />
befinden sich im Untergeschoß und erinnern in<br />
Form und Proportion an die Turnhallenbauten, was<br />
die Entstehung einer Ensemblewirkung zur Folge<br />
haben soll. Eine strikte Trennung in permanente<br />
Ausstellung der Sammlung und Wechselausstellung<br />
wird aufgehoben, was trotz eingeschränkter Ausstellungsfläche<br />
eine große Bandbreite an gezeigten<br />
Objekten des Sammlungsfundus ermöglichen soll.<br />
Je nach Them<strong>at</strong>ik und Inhalt von Ausstellungen,<br />
egal ob Wechselausstellung oder ausgestellter<br />
Sammlungsschwerpunkt, sollen Räumlichkeiten<br />
gewählt und auf die Anforderungen der jeweiligen<br />
Ausstellung hin konfiguriert werden. Wesentlich bei<br />
jeder Ausstellungstätigkeit im Erweiterungsbau soll<br />
jedoch der starke Bezug zur eigenen Sammlung des<br />
Kunsthauses Zürich sein, was eine größtmögliche<br />
Rot<strong>at</strong>ion der Kunstwerke aus ebendieser Sammlung<br />
zur Folge haben soll. Ist das Ensemble der vier<br />
Ausstellungshallen durchaus als sehr flexibel zu bezeichnen,<br />
so geben jedoch eine unterschiedliche Behandlung<br />
der Hallen in Strukturierung und Belichtung<br />
sowie die Lage zweier Ausstellungshallen im<br />
Untergeschoß eine gewisse Nutzung der einzelnen<br />
Hallen vor. In diesem Sinne eignet sich die Turnhalle<br />
am westlichen Ende des Heimpl<strong>at</strong>zes durch die<br />
Unterteilung in zwei Säle und die Belichtung über<br />
Kunstwerke der Sammlung Bührle: Paul Cézanne, Pierre-Auguste<br />
Renoir, Camille Pissarro<br />
streiflichtfreies Oberlicht besonders für klassische<br />
Form<strong>at</strong>e der Malerei und Kunstwerke, die einem traditionellen<br />
Kunstbegriff verhaftet sind, während die<br />
Turnhalle im östlichen Teil durch Belichtung über<br />
Seitenlicht vor allem für Install<strong>at</strong>ionen und Skulpturen<br />
geeignet ist. Die beiden, in ihrer Ausführung<br />
identen, Ausstellungshallen im Untergeschoß sind<br />
wiederum sehr flexibel in ihrer Nutzung und auch<br />
gut durch neue Medien zu bespielen.<br />
Bei jeglicher Ausstellungskonfigur<strong>at</strong>ion der Sammlungsteile<br />
Kunst ab 1960 sowie bei den damit in<br />
Verbindung stehenden Wechselausstellungen soll<br />
jedoch eines stets als Leitmotiv gelten; der produktive<br />
Umgang mit zeitgenössischer Kunst, wie er im<br />
vorhergehenden Abs<strong>at</strong>z angedacht wurde.<br />
Sammlung Bührle und Sammlungsgarlerien<br />
Kunsthaus, Malerei 19. Jahrhundert, klassische<br />
Moderne<br />
Im krassen Gegens<strong>at</strong>z zu den soeben beschrieben<br />
Teilen der Sammlung Kunsthaus mit Kunst ab<br />
1960 steht die in sich abgeschlossene Sammlung<br />
Emil Georg Bührles, die durch einzelne Werke<br />
der Sammlung Kunsthaus mit klassischer Malerei<br />
des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne<br />
ergänzt werden soll. Im Mittelpunkt der Sammlung<br />
Bührle steht die Malerei des Impressionismus und<br />
des Nachimpressionismus. Rund um diese Werke<br />
findet sich ein Ensemble französischer Kunst des 19.<br />
Jahrhunderts, die den Impressionismus vorbereitet<br />
oder ihn begleitet. Daran fügen sich Beispiele aus<br />
dem Schaffen der Nabis, der Fauves, der Kubisten<br />
und weiterer Vertreter der französischen Avantgarde<br />
seit 1900 sowie Abteilungen älterer Kunst vor allem<br />
mit holländischen Malern des 17. und italienischen<br />
Malern des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die Sammlung<br />
stellt eine der bedeutendsten Priv<strong>at</strong>sammlungen<br />
Europas dar und beinhaltet zahlreiche namhafte<br />
Künstler von Ingres über Courbet, Cézanne, Manet,<br />
Degas, Renoir oder Monet bis hin zu Van Gogh<br />
oder Picasso. Das Raumprogramm für diesen Teil<br />
des Museums, das sich auf eine Ausstellungsfläche<br />
von 2000m² beläuft und im Entwurf dieser Arbeit<br />
bezüglich ihrer Größe eins zu eins umgesetzt wurde,<br />
sieht eine lineare Raumfolge unterschiedlich großer<br />
Einheiten im Stil einer »zeitgemäßen Interpret<strong>at</strong>ion<br />
der klassischen Galerie« vor. Herzstück dabei<br />
sollen ein zentraler Galerieraum mit den wichtigsten<br />
Werken der Sammlung, sowie zwei weitere, daran<br />
angegliederte Hauptsäle sein.<br />
Im vorliegenden Entwurf wurden die erforderlichen<br />
Räume in drei Obergeschoßen eingerichtet und als<br />
gestapelte Ausstellungshallen, die für die jetzige<br />
Nutzung als Galerieräume der Sammlung Bührle, in<br />
Form einer linearen Raumfolge, adaptiert wird. Im<br />
Sinne des Wachstumsprozesses, durch den sich die<br />
Institution Kunsthaus Zürich immer weiter in den<br />
umgebenden Stadtraum rund um den Heimpl<strong>at</strong>z ausbreitet,<br />
sollen diese Adaptionen jedoch in Zukunft<br />
auch wieder entfernt werden können, wodurch die<br />
Nutzung der Räume als Ausstellungshalle möglich<br />
wird, was wiederum eine Eignung zur Präsent<strong>at</strong>ion<br />
zeitgenössischer Kunst nach sich ziehen würde. So<br />
ist es vorstellbar, dass einmal der ganze Erweite-<br />
Referenz: Temporäre Kunsthalle Berlin<br />
Referenzen: Dulwich Picture Gallery, Sainsbury Wing in London, Entwurfsprojekt Kunsthaus+<br />
rungsbau des Kunsthauses durch zeitgenössische<br />
Kunst bespielt werden wird, während die Sammlung<br />
Bührle als in sich geschlossene Sammlung an einen<br />
anderen Ort weiterzieht.<br />
Weiteres wichtiges Element dieses Konzeptes ist die<br />
erneute Anlagerung von »Kur<strong>at</strong>orenräumen« an die<br />
Ausstellungshallen, welche sich an der Nordseite<br />
des Gebäudes befinden, was die Verwirklichung<br />
eines ähnlichen Ausstellungskonzeptes wie im<br />
Erd- und Untergeschoß ermöglicht. Im jetzigen<br />
Betrieb als Galerie der Sammlung Bührle sollen<br />
diese »Kur<strong>at</strong>orenräume« jedoch als der Ausstellung<br />
zwischengeschaltete Ruhe- Inform<strong>at</strong>ions- oder<br />
Vermittlungsbereiche genutzt werden. Ein zu langes,<br />
abwechslungsarmes Aneinanderreihen von Ausstellungsräumen,<br />
die den Besucher ermüden, wird<br />
dadurch vermieden. Ähnlich funktioniert die an der<br />
Südseite des Gebäudes gelegene Erschließungszone,<br />
die ein schnelles Erreichen der jeweiligen Ausstellungsgeschoße<br />
gewährleistet. Die Intensität des<br />
Kunstkonsums, die sich durch die Konstell<strong>at</strong>ion von<br />
Räumen der Kunst mit Räumen der Erschließung<br />
und der »Kur<strong>at</strong>orenräume« definiert, kann somit<br />
vom jeweiligen Besucher individuell gesteuert<br />
werden.<br />
Ausstellungsarchitektur<br />
Nach der Definition der Ausstellungskonzepte soll<br />
nun ein Überblick der architektonischen Ausgestaltung<br />
der Galerieräume, Ausstellungshallen und<br />
Kur<strong>at</strong>orenräume folgen und Fragen der Belichtung,<br />
der M<strong>at</strong>erialien aber auch einer allgemeinen<br />
Beschaffenheit und Wirkung des gesamten Erweiterungsbaus<br />
geklärt werden.<br />
Ein allgemein erwünschtes Erscheinungsbild sämtlicher<br />
Ausstellungsräume beschreibt die Institution<br />
Kunsthaus in den Wettbewerbsunterlagen durch<br />
deren Gestalt als »klar definierte, in sich ruhende«<br />
Räume, die »Zurückhaltung gegenüber den präsentierten<br />
Kunstformen« ausstrahlen, sowie »angemessene<br />
Raumproportionen und n<strong>at</strong>ürliches Licht wo<br />
immer möglich« aufweisen. Dieser Idee entsprechend<br />
wurden Art und Weise der Belichtung sowie<br />
die Beschaffenheit der M<strong>at</strong>erialien gewählt. In ihrer<br />
Zurückhaltung und Purität sollen sie den durch<br />
Künstler mehrfach formulierten Forderungen bezüglich<br />
der Gestaltung von Ausstellungsräumen entsprechen.<br />
In diesem Sinne verlangte zum Beispiel<br />
Arnulf Rainer: »Museen und Ausstellungshallen haben<br />
vor allen anderen die Verpflichtung, Kunstwerke<br />
so zu verdeutlichen, wie sie der Künstler selbst<br />
gestaltet h<strong>at</strong>, das heißt in einem akzentuierten, die<br />
M<strong>at</strong>erie betonenden, ungeschminkten, nackten Atelierzustand.<br />
Es sollte der Purzustand sein, vor der<br />
Behandlung durch Dekor<strong>at</strong>eure, Transportrahmer,<br />
Eigentumsprotzer, Rahmendesigner, Schöngeister<br />
oder Kulturkontexter.« Dies bekräftigt erneut die<br />
Intention der Anordnung der Ausstellungsflächen in<br />
Form von Ausstellungshallen und deren Implemen-<br />
tierung in die Bestandsbauten der Turnhallen am<br />
Kantonsschulareal. Erst durch den Künstler, beziehungsweise<br />
den Kur<strong>at</strong>or, finden sie ihre endgültige<br />
Ausformulierung und erinnern in ihrer Wirkung an<br />
Künstler<strong>at</strong>eliers und dessen Prototyp des New Yorker<br />
Künstlerlofts als umgenutztes Industriegebäude.<br />
Es wird eine Angemessenheit des architektonischen<br />
Ausdrucks gegenüber dem Kunstwerk angestrebt,<br />
was den Versuch der Architektur, »künstlerischer zu<br />
sein als die Kunst«, wie es Markus Lüpertz einmal<br />
formulierte, vermeidet. »Die Architektur müsste die<br />
Größe besitzen, sich so angelegt darzustellen, dass<br />
Kunst in ihr möglich ist, ohne dass sie durch eigenen<br />
Anspruch Kunst vertreibt oder schlimmer noch,<br />
dekor<strong>at</strong>iv benutzt«, so Lüpertz dazu.<br />
Im Kontrast zu den Ausstellungsräumlichkeiten<br />
steht die Wirkung des restlichen Gebäudes, vor<br />
allem jener Teile der »öffentlichen« Flächen und<br />
der »Kur<strong>at</strong>orenräume«, die sich besonders in der<br />
M<strong>at</strong>erialität klar von den Ausstellungsräumen<br />
abheben. Es ist also eine Architektur der Dialektik,<br />
der Kombin<strong>at</strong>ion unterschiedlicher Raumeindrücke,<br />
die zu einer gewinnbringenden Kunstwahrnehmung<br />
führen soll. Gerade im Spannungsfeld von Innen-<br />
und Außenraum beziehungsweise von Kunst- und<br />
Nicht-Kunstraum inklusive deren fallweise Überschneidung<br />
wird ein großes Potenzial vermutet.<br />
Belichtung<br />
Wo immer es möglich war, wurden sowohl die<br />
Ausstellungsgalerien der Sammlung Bührle als<br />
auch die Ausstellungshallen der Sammlung Kunsthaus<br />
mit Kunst ab 1960 n<strong>at</strong>ürlich belichtet. So<br />
geschieht dies in einer der beiden Turnhallen über<br />
Oberlichter, während die Belichtung der zweiten<br />
Halle durch Seitenlicht gewährleistet wird. Die<br />
dadurch entstehenden, unterschiedlichen Qualitäten<br />
der Lichtstimmungen kommen der großen Vielfalt<br />
auszustellender Kunstwerke nur entgegen. Die beiden<br />
Ausstellungshallen im Untergeschoß hingegen<br />
werden ausschließlich durch Kunstlicht belichtet,<br />
was bei einer häufig anzunehmenden Bespielung<br />
durch neue Medien jedoch kaum von Nachteil<br />
sein wird. In den gestapelten Ausstellungshallen<br />
der Obergeschoße und deren adaptierte Nutzung<br />
als Galerienfolge gestaltet sich eine ausschließlich<br />
n<strong>at</strong>ürliche Belichtung als schwierig. Trotzdem wurde<br />
versucht, alle Ebenen mit n<strong>at</strong>ürlichem Licht zu<br />
versorgen. Dies erfolgt im ersten sowie im zweiten<br />
Obergeschoß durch Seitenlicht, das bei Bedarf<br />
durch Kunstlicht, welches über eine Staubdecke in<br />
den Raum gelangt, ergänzt wird, während im dritten<br />
Obergeschoß, wo sich auch die wichtigsten Ausstellungssäle<br />
befinden, mit Oberlicht gearbeitet werden<br />
kann. Dieses wird, zuvor abgesch<strong>at</strong>tet und durch<br />
die Gebäudehülle gefiltert, über eine Staubdecke<br />
gleichmäßig im Raum verteilt. Um Streiflicht an den<br />
Wänden zu vermeiden, sollen im Deckenzwischenraum<br />
zusätzliche Absch<strong>at</strong>tungselemente errichtet<br />
werden, die je nach Bedarf und Raumaufteilung der<br />
Ausstellungshalle konfiguriert werden.<br />
M<strong>at</strong>erialien<br />
Wie bereits zuvor erwähnt, soll die M<strong>at</strong>erialität in<br />
den Ausstellungsräumen eine gewisse Zurückhaltung<br />
gegenüber den Arbeiten der Kunst ausdrücken.<br />
Man bedient sich der aur<strong>at</strong>ischen Wirkung<br />
der Kombin<strong>at</strong>ion einfacher M<strong>at</strong>erialien wie weißer<br />
Wände und Holzfußböden, im Sinne eines White<br />
Cubes, jedoch mit dem Anspruch, einer »Überästhetisierung«<br />
im Sinne des Minimalismus entgegenzusteuern.<br />
Im Gegens<strong>at</strong>z zu der oft üblichen Praxis<br />
des Verkleidens der Wände mit Gipspl<strong>at</strong>ten sollen<br />
diese in Form von weiß gestrichenen Betonwänden<br />
errichtet werden, die gleichzeitig die Primärstruktur<br />
darstellen. Dies ermöglicht erneut ein Ablesen der<br />
sich zeitlich verändernden Nutzung an der Bausubstanz<br />
selbst, erreicht durch Spuren ehemaliger<br />
Befestigungen, Aufhängungen und deren anschließende<br />
Verspachtelungen. Außerdem soll die Primärstruktur<br />
dabei helfen, das Raumklima zu regulieren<br />
und über eine Betonkernaktivierung den Heiz- und<br />
Kühlbedarf des Gebäudes so gering wie möglich zu<br />
gestalten.<br />
Einen Kontrapunkt zur M<strong>at</strong>erialität der Kunsträume<br />
stellt jene der »öffentlichen« Flächen, wie dem<br />
Café, dem Shop, der Eingangshalle sowie jene<br />
der »Kur<strong>at</strong>orenräume« dar. Um den Charakter der<br />
Offenheit gegenüber dem Besucher zu erreichen,<br />
wurden Oberflächenm<strong>at</strong>erialien verwendet, die auch<br />
im öffentlichen, den Kunsthausbau umgebenden<br />
Stadtraum zu finden sind. Während der »Kur<strong>at</strong>orenraum«<br />
durch die Verwendung von Sichtbeton<br />
geprägt wird, stellen die verschiedenen Volumina im<br />
Erdgeschoß in Kombin<strong>at</strong>ion mit der zentralen Halle<br />
eine Erweiterung des Stadtraumes dar, was zusätzlich<br />
durch die Verwendung der M<strong>at</strong>erialien Stein,<br />
nämlich Bollinger Sandstein, wie er auch beim ersten<br />
Museumsgebäude für das Kunsthaus Zürich von<br />
Karl Moser zum Eins<strong>at</strong>z kam, sowie Putz, der die<br />
am häufigsten vorkommende Oberfläche der Fassaden<br />
umgebender Gebäude darstellt, zum Ausdruck<br />
kommt. Der industrielle Charakter der Halle und des<br />
Kur<strong>at</strong>orenraumes im Untergeschoß, erreicht durch<br />
die Verwendung von Sichtbeton, geschliffenem<br />
Estrich sowie generell unbehandelter M<strong>at</strong>erialien,<br />
sollen den produktiven Charakter dieser Räumlichkeiten<br />
unterstreichen. Die Wirkung des Unvollendeten<br />
soll die Aktivität des Besuchers anregen.<br />
Referenzen: Entwurfsprojekt Kunsthaus+, Kirchner Museum in Davos, Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz<br />
Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 04 (04)<br />
Schnitt 05 M 1:400<br />
Schnitt 04 M 1:400