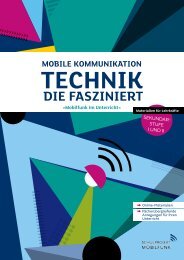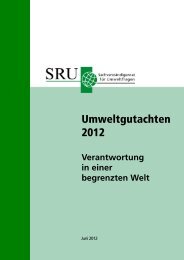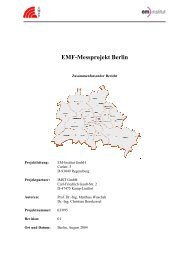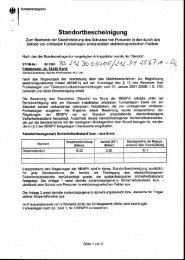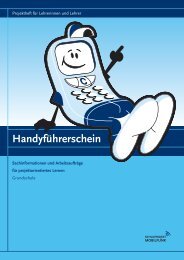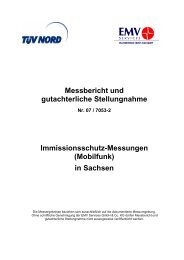Eilantrag gegen Mobilfunkanlage abgelehnt
Eilantrag gegen Mobilfunkanlage abgelehnt
Eilantrag gegen Mobilfunkanlage abgelehnt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verwaltungsgericht<br />
der Freien Hansestadt Bremen<br />
- Pressestelle -<br />
PRESSEMITTEILUNG<br />
Betr.: Lokalredaktion (Justiz)<br />
Freie<br />
Hansestadt<br />
Bremen<br />
Auskunft erteilen: Anette Ohrmann (04 21) 3 61 - 46 30 anette.ohrmann@verwaltungsgericht.bremen.de<br />
Dr. Carsten Bauer (04 21) 3 61 - 69 92 carsten.bauer@verwaltungsgericht.bremen.de<br />
Fax (04 21) 3 61 - 67 97<br />
<strong>Eilantrag</strong> <strong>gegen</strong> <strong>Mobilfunkanlage</strong> <strong>abgelehnt</strong><br />
Bremen, den 20.02.2004<br />
Bereits im Dezember 2000 wurde der Firma DeTe Mobil Telekom MobilfNet GmbH eine<br />
Baugenehmigung für die Errichtung und Nutzung eines Mobilfunkmastes an der Arberger<br />
Heerstraße 29 in Bremen erteilt. Bei der Anlage handelt es sich um eine etwa 33 m hohe<br />
Stahlgitterkonstruktion mit Antennen und Fernmeldeschrank. In einer Standortbescheini-<br />
gung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post vom 10.08.2000 wurde<br />
ein Sicherheitsabstand von 5,66 m festgelegt, bei dessen Einhaltung nicht von einer Ge-<br />
sundheitsgefährdung ausgegangen werden könne. Die <strong>Mobilfunkanlage</strong> wurde errichtet<br />
und in Betrieb genommen. Sie wird derzeit im so genannten GMS-Standard genutzt. Vor-<br />
gesehen ist aber auch eine Nutzung für die im Aufbau befindliche UMTS-Technik.<br />
Gegen die für die Errichtung und Nutzung des Mobilfunkmastes erteilte Baugenehmigung<br />
legten mehrere Eigentümer und Bewohner von in der Nähe liegenden Hausgrundstücken<br />
Widerspruch ein. Nachdem Vergleichsverhandlungen über eine Begrenzung der Nutzung<br />
der Anlage und eine Entschädigungszahlung zunächst erfolglos blieben, haben sie beim<br />
Verwaltungsgericht Bremen um vorläufigen Rechtsschutz <strong>gegen</strong> die weitere Nutzung des<br />
Mobilfunkmastes nachgesucht. Zur Begründung berufen sich die Antragsteller zum einen<br />
darauf, dass die Baugenehmigung unter Verstoß <strong>gegen</strong> bauplanungs- und bauordnungs-<br />
rechtliche Vorschriften erteilt worden sei. Zum anderen machen sie geltend, dass nach<br />
heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der elektromagnetischen Strah-<br />
lenfelder nicht auszuschließen sei, dass von der <strong>Mobilfunkanlage</strong> Gesundheitsgefährdun-<br />
gen ausgingen. Insbesondere seien thermische Effekte elektromagnetischer Strahlenfelder<br />
nicht hinreichend berücksichtigt. Die Hauptstrahlenbelastung liege in einem Abstand von<br />
100 bis 150 m und damit gerade in dem Bereich, in dem sich ihre Grundstücke befänden.
2<br />
Sechs der zunächst insgesamt zehn Antragsteller haben nach einer im Verlauf des ge-<br />
richtlichen Verfahrens getroffenen vergleichsweisen Regelung ihre Anträge wieder zurück-<br />
genommen. Die Eilanträge der verbleibenden vier Antragsteller hat die 1. Kammer des<br />
Verwaltungsgericht nunmehr mit Beschluss vom 17.02.2004 <strong>abgelehnt</strong>. Zur Begründung<br />
heißt es:<br />
Zwar seien die Anträge im Wesentlichen zulässig. Insbesondere stehe der Zulässigkeit<br />
nicht ent<strong>gegen</strong>, dass die <strong>Mobilfunkanlage</strong> bereits fertiggestellt sei. Denn die Antragsteller<br />
beriefen sich gerade darauf, durch die Nutzung des Mobilfunkmastes in ihren Rechten<br />
beeinträchtigt zu sein.<br />
Die Eilanträge seien jedoch nicht begründet. Es lasse sich nicht feststellen, dass bei der<br />
Genehmigung und Inbetriebnahme der <strong>Mobilfunkanlage</strong> nachbarschützende Bestimmun-<br />
gen zu Lasten der Antragsteller missachtet worden seien. Insbesondere könne nach der in<br />
einem Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung nicht davon ausgegangen werden,<br />
dass die mit dem Betrieb der <strong>Mobilfunkanlage</strong> verbundene Strahlenbelastung das baupla-<br />
nungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme verletze, nach dem Anlagen unzulässig seien,<br />
von denen Belästigungen oder Störungen ausgingen, die nach der Eigenart des Bauge-<br />
biets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar seien. Denn nach den<br />
derzeitigen Erkenntnissen könne nicht angenommen werden, dass die Antragsteller durch<br />
den Betrieb der <strong>Mobilfunkanlage</strong> in ihrer Gesundheit beeinträchtigt würden:<br />
Durch die Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und<br />
Post vom 10.08.2000 werde bestätigt, dass der in der 26. Bundesimmissionsschutzver-<br />
ordnung vorgeschriebene Schutz bei Beachtung der Sicherheitsabstände gegeben sei.<br />
Die in der genannten Verordnung festgelegten Grenzwerte beruhten auf international aner-<br />
kannten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Kommission<br />
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung und des Bundesamts für Strahlenschutz.<br />
Zwar sei richtig, dass die athermischen Effekte, die nicht durch die strahlenbedingte Er-<br />
wärmung des menschlichen Körpers hervorgerufen würden, bislang noch nicht abschlie-<br />
ßend wissenschaftlich erforscht seien. Fundierte Anhaltspunkte dafür, welche Auswirkun-<br />
gen athermische Effekte auf den menschlichen Körper haben könnten und welche Grenz-<br />
werte eingehalten werden müssten, um auch unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge Ge-<br />
sundheitsbeschädigungen schon im Vorfeld auszuschließen, hätten sich jedoch bislang<br />
nicht finden lassen. Es könne - zumal in einem Eilverfahren - nicht Sache der Gerichte<br />
sein, auf der Grundlage ungesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse die Schutzeignung
3<br />
der vom Verordnungsgeber festgesetzten Grenzwerte in Zweifel zu ziehen und den jeweils<br />
aktuellen Stand der Forschung zu ermitteln. Es sei vielmehr Sache des Verordnungsge-<br />
bers, den Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft mit geeigneten Mitteln nach allen Seiten<br />
zu beobachten und zu bewerten und ggf. weiter gehende Schutzmaßnahmen zu treffen.<br />
Dass der Verordnungsgeber seiner insoweit bestehenden Pflicht nicht nachgekommen<br />
sei, könne nicht festgestellt werden.<br />
Schließlich werde es für die vorgesehene Umstellung der <strong>Mobilfunkanlage</strong> auf UMTS-<br />
Betrieb oder der Installation weiterer Anlagen an dem Sendemast der Einholung aktueller<br />
Standortbescheinigungen bedürfen, in deren Rahmen die Einhaltung der vorgeschriebenen<br />
Personenschutzwerte erneut zu überprüfen sein werde.<br />
Der - in der anliegenden Datei wiedergegebene - Beschluss des Verwaltungsgerichts ist<br />
nicht rechtskräftig; <strong>gegen</strong> ihn kann binnen zwei Wochen Beschwerde an das Oberverwal-<br />
tungsgerichts Bremen eingelegt werden.<br />
Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, B. v. 17.02.2004 - 1 V 501/02 -
Verwaltungsgericht<br />
der Freien Hansestadt Bremen<br />
Az: 1 V 501/02<br />
1.<br />
2.<br />
die Antragsteller zu 1. und 2. beide wohnhaft:<br />
3.<br />
4. ,<br />
die Antragsteller zu 3. und 4. beide wohnhaft:<br />
5. ,<br />
6.<br />
die Antragsteller zu 5. und 6. beide wohnhaft: ,<br />
7. ,<br />
8. ,<br />
die Antragsteller zu 7. und 8. beide wohnhaft:<br />
9. ,<br />
10. ,<br />
die Antragsteller zu 9. und 10. beide wohnhaft:<br />
Prozessbevollmächtigter:<br />
Beschluss<br />
In der Verwaltungsrechtssache<br />
<strong>gegen</strong><br />
Freie<br />
Hansestadt<br />
Bremen<br />
Antragsteller,<br />
die Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, Ansgaritorstraße<br />
2, 28195 Bremen,<br />
Prozessbevollmächtigter:<br />
Beigeladene:<br />
Firma DeTe Mobil Telekom MobilfNet GmbH,<br />
Antragsgegnerin,<br />
hat das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - 1. Kammer - durch Richter<br />
Klose, Richter Sperlich und Richterin Dr. Jörgensen am 17.02.2004 beschlossen:<br />
...
- 2 -<br />
Soweit die Antragsteller zu 1 bis 6 ihre Anträge zurückgenommen<br />
haben, wird das Verfahren eingestellt.<br />
Die Anträge der Antragsteller zu 7 bis 10 werden <strong>abgelehnt</strong>.<br />
Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens mit<br />
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen,<br />
die diese selbst zu tragen hat.<br />
Der Streitwert wird zum Zwecke der Kostenberechnung bis<br />
zur Verbindung für die Verfahren 1 V 501/02, 1 V 636/02, 1 V<br />
710/02 auf jeweils 10.000,-- Euro und für das Verfahren 1 V<br />
624/02 auf 20.000,-- Euro festgesetzt.<br />
Gründe<br />
I. Soweit die Anträge nicht zurückgenommen worden sind, begehren die Antragsteller die An-<br />
ordnung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruches <strong>gegen</strong> die Baugenehmigung für<br />
eine <strong>Mobilfunkanlage</strong>.<br />
Mit Bescheid vom 14. Dezember 2000 erteilte das Amt für Stadtplanung und Bauordnung der<br />
Freien Hansestadt Bremen der Beigeladenen eine Baugenehmigung für die Errichtung und<br />
Nutzung eines Mobilfunkmastes an der Arberger Heerstraße 29 in Bremen. Bei der Anlage<br />
handelt es sich um eine etwa 33 Meter hohe Stahlgitterkonstruktion mit Antennen und Fern-<br />
meldeschrank. Eine Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation<br />
und Post lag vor. Darin wurde ein Sicherheitsabstand von 5,66 m festgelegt, bei dessen Ein-<br />
haltung nicht von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden könne. Die Mobilfunkan-<br />
lage wurde errichtet und in Betrieb genommen. Sie wird derzeit im so genannten GMS-<br />
Standard genutzt. Vorgesehen ist aber auch eine Nutzung für die im Aufbau befindliche UMTS-<br />
Technik. Ein dementsprechendes Netz ist derzeit noch nicht geschaltet. Der Mobilfunkmast<br />
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2134 vom 25.11.1996. Im westlichen Teil<br />
des Plangebietes befinden sich Einzelhandels- und Gewerbebetriebe. Im südöstlichen Teil liegt<br />
das von einem Verein betriebene Freibad Rottkuhle. Außerhalb des Plangebietes befinden sich<br />
östlich des Freibades mehrere freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser. Im Süden wird das<br />
Plangebiet durch den Arberger Deich begrenzt. Dahinter liegt die Bundesautobahn A 1. Der<br />
Mobilfunkmast wurde im Randbereich einer Fläche errichtet, für die der Bebauungsplan „Öf-<br />
fentliche Sportanlage (Badeanstalt und Spielplatz)“ mit dem Zusatz „Flächen für Maßnahmen<br />
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20<br />
BauGB)“ festsetzt. Die Fläche ist jedoch gleichzeitig Bestandteil eines Gewerbegrundstücks.<br />
...
- 3 -<br />
Wegen der Zugehörigkeit zum Gewerbegrundstück wurde im Genehmigungsverfahren nicht<br />
erkannt, dass sich das geplante Vorhaben außerhalb der gewerblichen Festsetzungen und im<br />
Bereich einer Schutzzone befand. Eine Befreiung wurde nicht erteilt.<br />
Die Antragsteller sind Eigentümer und Bewohner von Hausgrundstücken, die östlich an das<br />
Freibad Rottkuhle angrenzen und sich in einer Entfernung von 100 bis 150 Meter von der Mo-<br />
bilfunkanlage befinden. Sie legten <strong>gegen</strong> die Baugenehmigung für die Mobilfunkstation Wider-<br />
spruch ein und führten zur Begründung im Wesentlichen aus:<br />
Die Baugenehmigung sei schon deshalb rechtswidrig, weil sie <strong>gegen</strong> die planungsrechtlichen<br />
Festsetzungen verstieße. Dieser Umstand werde auch in Vermerken der Bauakte von der An-<br />
tragsgegnerin eingeräumt. Ein Dispens sei nicht erteilt worden. Ferner seien auch die notwen-<br />
digen Abstandsflächen nach der Landesbauordnung nicht eingehalten worden. Der Bauge-<br />
nehmigung stünden auch die Abwehrrechte aus §§ 22 ff. BImSchG ent<strong>gegen</strong>, weil nach heuti-<br />
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der elektromagnetischen Strahlenfelder<br />
nicht auszuschließen sei, dass von der <strong>Mobilfunkanlage</strong> Gesundheitsgefährdungen ausgingen.<br />
Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen belegten, dass die Gefahr einer Gesundheits-<br />
schädigung auch unterhalb der Grenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung be-<br />
stünde. Insbesondere seien thermische Effekte elektromagnetischer Strahlenfelder nicht hin-<br />
reichend berücksichtigt. Die Hauptstrahlenbelastung liege gerade in einem Abstand von 100<br />
bis 150 m und damit in einem Bereich, dem auch die Grundstücke der Antragsteller zuzuord-<br />
nen seien. Schließlich verstoße das Bauwerk und seine Nutzung auch <strong>gegen</strong> das aus § 15<br />
BauNVO folgende Rücksichtnahmegebot. Die Hausgrundstücke seien in einem Umfang von<br />
10 bis 20% in ihrem Wert gemindert.<br />
Vergleichsverhandlungen, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens mit der Antragsgegne-<br />
rin und der Beigeladenen über eine Begrenzung der Nutzung und eine Entschädigungszahlung<br />
geführt wurden, blieben zunächst erfolglos. Daraufhin haben die Antragsteller beim Verwal-<br />
tungsgericht um vorläufigen Rechtsschutz <strong>gegen</strong> die weitere Nutzung der Mobilfunkstation<br />
nachgesucht. Eine gerichtliche Entscheidung ist jedoch auf Wunsch der Beteiligten mit Blick<br />
auf die Fortsetzung der Verhandlungen wiederholt aufgeschoben worden. Am 12.11.2003 ha-<br />
ben die Antragsteller zu 1 bis 6 nach erfolgter vergleichsweiser Regelung die Eilanträge zu-<br />
rückgenommen. Mit den Antragstellern zu 7 bis 10 ist eine vergleichsweise Regelung nicht<br />
getroffen worden. Sie halten ihre Eilanträge aufrecht und tragen ergänzend vor:<br />
Auch wenn ihnen kein subjektives Recht auf Einhaltung der Abstandsvorschriften zustehe, so<br />
hätten sie doch einen Anspruch auf Wahrung des Gebietscharakters, wie er satzungsrechtlich<br />
...
- 4 -<br />
durch die Bauleitplanung festgelegt worden sei. Gerade aufgrund der sehr engen, unterschied-<br />
lichen Nutzungsformen habe die Konfliktsituation planungsrechtlich geregelt werden müssen.<br />
Die Zulassung der gewerblichen Anlage widerspreche den Vorgaben des Satzungsgebers und<br />
sei nicht zulässig. Sie wirke sich mit Blick auf die atypische Nutzungsweise und auch optisch<br />
belastend auf die Nachbarschaft aus. Abwehransprüche <strong>gegen</strong> die gebietsfremde Nutzung<br />
ergäben sich auch aus § 15 BauNVO. Indiz für die erhebliche Betroffenheit sei insoweit die<br />
Wertminderungen der Hausgrundstücke. Zusätzlich zu der Beeinträchtigung der Grundstücke<br />
durch die rechtswidrige gewerbliche Nutzung in der Nachbarschaft sei auch eine Verletzung<br />
des Rücksichtnahmegebotes in Verbindung mit §§ 22 ff. BImSchG festzustellen, weil die<br />
Grenzwerte der 26. BImSchV keinen ausreichenden Gesundheitsschutz gewährleisteten.<br />
Die Antragsteller zu 7 bis 10 beantragen,<br />
Die Antragsgegnerin beantragt,<br />
1. die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs <strong>gegen</strong> die erteilte Baugenehmigung<br />
für die Errichtung und Inbetriebnahme einer D1-<br />
<strong>Mobilfunkanlage</strong> in der Arberger Heerstraße 29 in Bremen anzuordnen.<br />
2. die Rückgängigmachung der Vollziehung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 3<br />
VwGO anzuordnen.<br />
die Anträge abzuweisen.<br />
Sie ist der Auffassung, dass die gestellten Eilanträge bereits unzulässig seien. Nach Errich-<br />
tung eines genehmigten Bauwerks gebe es für einen <strong>Eilantrag</strong> <strong>gegen</strong> eine Baugenehmigung<br />
kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Über die Rechtmäßigkeit des genehmigten Vorhabens<br />
könne nach dessen Fertigstellung nur noch im Hauptsacheverfahren entschieden werden. Im<br />
Übrigen seien die Anträge auch unbegründet. Die Regulierungsbehörde habe für das Vorhaben<br />
eine Standortbescheinigung erteilt und damit die Feststellung getroffen, dass nach derzeitigen<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Gesundheitsgefährdung vorliege. Soweit die Mobil-<br />
funkanlage im Widerspruch zu Festsetzungen des Bebauungsplans stehe, seien diese nicht<br />
nachbarschützend.<br />
Der das Baugenehmigungsverfahren betreffende Verwaltungsvorgang hat der Kammer vor-<br />
gelegen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Bescheid und die zwi-<br />
schen den Beteiligten im Verfahren gewechselten Schriftsätze verwiesen.<br />
II. Nachdem die Antragsteller zu 1 bis 6 ihre Anträge zurückgenommen haben, wird das Ver-<br />
fahren insoweit entsprechend § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO eingestellt. Die von den Antragstellern<br />
zu 7 bis 10 aufrechterhaltenen Anträge auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wi-<br />
...
- 5 -<br />
derspruches <strong>gegen</strong> die erteilte Baugenehmigung nach § 80 a Abs. 3 VwGO sind zulässig, aber<br />
unbegründet.<br />
1. Ein Rechtsschutzbedürfnis ist für die Eilanträge trotz Fertigstellung des Bauwerks gegeben.<br />
Das Gericht kann auf Antrag eines Nachbarn die sofortige Vollziehung einer Baugenehmigung<br />
aussetzen und einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Nachbarn treffen. Die<br />
gerichtliche Aussetzung kommt allerdings grundsätzlich nur bis zur Fertigstellung des Bauvor-<br />
habens in Betracht. Nach diesem Zeitpunkt, d. h. nachdem der Bauherr von der Baugenehmi-<br />
gung umfassend Gebrauch gemacht hat, fehlt in der Regel das Rechtsschutzbedürfnis. Der<br />
vorläufige Rechtsschutz soll sicherstellen, dass vor Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsaktes<br />
vollendete Tatsachen geschaffen werden, ohne dass die Betroffenen die Möglichkeit wirksa-<br />
men Rechtsschutzes haben. Ist das Bauwerk bereits errichtet und gehen die Beeinträchtigun-<br />
gen ausschließlich von dem Bauwerk selbst aus, kann die spätere Durchsetzung von Abwehr-<br />
rechten nicht mehr erschwert werden. Der Nachbar kann unter diesen Voraussetzungen<br />
Rechtsschutz nur im Hauptsacheverfahren erlangen. Der Durchführung eines Eilverfahrens<br />
bedarf es zur Sicherung seiner Rechte nicht mehr. Insbesondere kommt eine Veränderung<br />
des bereits bestehenden Zustandes durch Abbruch in Verfahren auf Wiederherstellung oder<br />
Anordnung der aufschiebenden Wirkung in der Regel nicht in Betracht (OVG Nordrhein-<br />
Westfalen, B. v. 13.02.1984, NVwZ 1984, S. 451 ). Hierfür kann dahinstehen, ob unter<br />
Vollziehung im Sinne des § 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO auch das Gebrauchmachen von einer<br />
Genehmigung durch Private zu verstehen ist (str., vgl. insoweit Kopp/Schenke, VwGO, 13.<br />
Aufl. 2003, § 80 Rn. 179 m.w.N); denn die summarische Prüfung im Eilverfahren bietet grund-<br />
sätzlich keine hinreichende Grundlage für die Anordnung des Abrisses eines genehmigten<br />
Bauwerks.<br />
Ein Rechtsschutzbedürfnis kann auch nach Errichtung des Bauwerks jedoch insoweit nicht<br />
verneint werden, als gerade die Nutzung des Bauwerks Beeinträchtigungen des Nachbarn<br />
auslöst oder die Nutzung - etwa aufgrund der Vermietung von Wohnungen in dem Bauvorha-<br />
ben - zu einer Verfestigung eines möglicherweise <strong>gegen</strong> Nachbarrechte verstoßenden Zu-<br />
stands führt (vgl. OVG Bremen, B. v. 29. September 2003 - 1 B 345/03; OVG Mecklenburg-<br />
Vorpommern, B. v. 03. Juni 1994, BRS 56 Nr. 167; OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 09. September<br />
1994, BRS 56 Nr. 115). Der Regelungsgehalt einer Baugenehmigung beschränkt sich nicht<br />
nur auf die Erlaubnis zur Errichtung eines Bauwerks, sondern umfasst auch dessen bestim-<br />
mungsgemäße Nutzung. Deshalb muss im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes <strong>gegen</strong><br />
Baugenehmigungen auch die Möglichkeit gegeben sein, durch Anordnung der aufschiebenden<br />
...
- 6 -<br />
Wirkung eines Rechtsmittels die Nutzung eines bereits errichteten Bauwerks zu unterbinden,<br />
wenn die geltend gemachte Verletzung nachbarschützender Vorschriften gerade und vorrangig<br />
durch die Nutzung eintritt oder eintreten kann.<br />
Das ist hier der Fall. Nicht der Stahlgittermast als Baukörper, sondern gerade die Nutzung als<br />
Funksendestelle lassen eine Beeinträchtigung von Rechten der Antragsteller nicht ausge-<br />
schlossen erscheinen (vgl. Niedersächsisches OVG, B. v. 02. Februar 1992, NVwZ 1993, S.<br />
1117). Auch das Begehren der Antragsteller selbst zielt vor allem darauf, die fortdauernde Nut-<br />
zung der Mobilfunksendeanlage bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren zu unter-<br />
binden und möglichen Erweiterungen der Anlage von vornherein ent<strong>gegen</strong>zuwirken. Das<br />
Rechtsschutzbedürfnis für ein auf die Beschränkung oder Untersagung der Baunutzung ge-<br />
richtetes Eilrechtsschutzbegehren entfällt nicht mit der Errichtung des Bauwerks.<br />
Danach sind die von den Antragstellern zu 7 bis 10 erhobenen Einwände im Wesentlichen<br />
zulässig. Das gilt insbesondere für die durch die Nutzung möglicherweise entstehenden Be-<br />
einträchtigungen der aus §§ 22 ff. BImSchG folgenden Nachbarrechte. Aber auch soweit sich<br />
die Antragsteller auf den Gebietserhaltungsanspruch und das Gebot der Rücksichtnahme be-<br />
rufen, geschieht dies maßgeblich mit Blick auf die gewerbliche Nutzung der Mobilfunksende-<br />
anlage und der von dieser Nutzung ausgehenden Folgen für die Grundstücke der Antragsteller.<br />
Ausgeschlossen bleiben die Antragsteller im vorliegenden Eilverfahren allerdings mit denjeni-<br />
gen Einwänden, die sich allein auf die Beeinträchtigung durch den Baukörper beziehen. So<br />
liegt es für die von den Antragstellern geltend gemachten Verstöße der <strong>Mobilfunkanlage</strong> <strong>gegen</strong><br />
die Abstandsvorschriften nach § 6 BremLBO. Die Regelungen über den Abstand von Bauwer-<br />
ken zur Nachbargrenze sollen keinen hinreichenden Sicherheitsabstand in Hinblick auf eine<br />
bestimmte Nutzung eines Bauwerks gewährleisten. Solche Sicherheitsabstände ergeben sich<br />
für <strong>Mobilfunkanlage</strong>n aus der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung und sie sind im vorlie-<br />
genden Fall in der Standortbescheinigung ausgewiesen worden. Die Abstandsvorschriften<br />
nach § 6 BremLBO sollen vielmehr die ausreichende Besonnung und Belüftung des Nachbar-<br />
grundstücks gewährleisten und damit Beeinträchtigungen vermeiden, die unmittelbar vom er-<br />
richteten Baukörper selbst ausgehen. Soweit die Antragsteller daher geltend machen, dass die<br />
<strong>Mobilfunkanlage</strong> aufgrund ihrer Höhe von annähernd 33 m einen weitaus größeren Abstand zur<br />
Nachbargrenze hätte einhalten müssen (vgl. zur Problematik OVG Nordrhein-Westfalen, B. v.<br />
10. Februar 1999, NVwZ-RR 1999, S. 714 f.), fehlt hierfür im Eilverfahren nach Errichtung des<br />
Bauwerks das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Abgesehen hiervon wären die Antragstel-<br />
ler zu 7 bis 10 insoweit auch nicht antragsbefugt, weil ihre Grundstücke nicht unmittelbar an<br />
...
- 7 -<br />
das mit der Mobilfunkstation bebaute Grundstück angrenzen, sondern in einer Entfernung von<br />
über 100 m hierzu liegen.<br />
2. Die danach im Wesentlichen zulässigen Anträge haben aber in der Sache keinen Erfolg.<br />
Das Gericht hat das Interesse der Antragsteller zu 7 bis 10 daran, dass die Beigeladene bis<br />
zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens von der angefochtenen Baugenehmigung keinen<br />
weiteren Gebrauch machen kann <strong>gegen</strong> das Interesse der Beigeladenen an der Ausnutzung<br />
der Baugenehmigung abzuwägen. Diese Abwägung fällt hier zu Lasten der Antragsteller aus,<br />
weil ihre Rechtsverfolgung in der Hauptsache voraussichtlich keinen Erfolg haben wird. Nach<br />
der im Eilverfahren nur möglichen summarischen Prüfung werden die Antragsteller durch die<br />
angefochtene Baugenehmigung nicht in ihren Rechten verletzt. Ein Grundstückseigentümer<br />
kann verlangen, dass bei Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und Nutzung eines Bau-<br />
vorhabens in der Nachbarschaft die zum Schutz seines Eigentums erlassenen öffentlich-<br />
rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Vorliegend ergibt sich jedoch nicht, dass die An-<br />
tragsgegnerin bei der Genehmigung der Errichtung und Inbetriebnahme der Mobilfunksende-<br />
anlage nachbarschützende Bestimmungen zu Lasten der Antragsteller missachtet hat.<br />
a) Die Antragsteller zu 7 bis 10 können sich nicht auf die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 20<br />
BauGB erfolgten Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 2134 berufen, weil diese nicht auch zu<br />
ihrem Schutz erlassen worden sind.<br />
aa) Die <strong>Mobilfunkanlage</strong> steht in Widerspruch zu den Festsetzungen des Bebauungsplans. Ihr<br />
Standort liegt im Randbereich eines Gebietes, für das der Bebauungsplan „Öffentliche<br />
Sportanlage (Badeanstalt und Spielplatz)“ sowie „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur<br />
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ festsetzt. Solche Festsetzungen konnte<br />
die Stadtgemeinde Bremen hier auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 20 BauGB<br />
treffen. Rechtsfolge solcher Festsetzungen ist, dass Vorhaben in den festgesetzten Grünflä-<br />
chen der jeweiligen Zweckbestimmung nicht widersprechen dürfen. Je nach Zweckbestim-<br />
mung sind auf den Grünflächen solche baulichen Anlagen und sonstigen Einrichtungen zuläs-<br />
sig, die sich im Rahmen der Zweckbestimmung halten (vgl. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB,<br />
Kommentar, Stand Sept. 2001, § 9 Rn. 131). Das wären vorliegend allein solche Bauvorhaben,<br />
die der Zweckbestimmung „Badeanstalt und Spielplatz“ dienen. Ein solcher Zusammenhang<br />
besteht in Hinblick auf die streitbefangene Mobilfunksendeanlage offenkundig nicht, so dass<br />
dem Vorhaben § 30 BauGB ent<strong>gegen</strong>stand. Auch eine Befreiung von den Festsetzungen des<br />
Bebauungsplans nach § 31 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt. Aufgrund der Grundstücks- und<br />
Eigentumssituation war die Antragsgegnerin - wie sie im vorliegenden Verfahren eingeräumt<br />
...
- 8 -<br />
hat - irrtümlich davon ausgegangen, dass sich der Standort der Mobilfunkstation in dem Be-<br />
reich des Plangebietes befindet, für den der Bebauungsplan Gewerbegebiet festsetzt. Dieser<br />
Rechtsfehler führt jedoch nicht zu einer Rechtsverletzung der Antragsteller zu 7 bis 10, weil<br />
den hier maßgeblichen Festsetzungen keine drittschützende Wirkung zukommt.<br />
bb) Ent<strong>gegen</strong> ihrer Auffassung können die Antragsteller nicht mit Erfolg die Verletzung des<br />
bundesrechtlichen Gebietserhaltungsanspruchs geltend machen.<br />
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwGE 94, 151 ff.) können<br />
sich Eigentümer von Grundstücken in einem im Bebauungsplan festgesetzten Gebiet oder in<br />
einem Baugebiet, das seiner Art nach einem der in der Baunutzungsverordnung bezeichneten<br />
Baugebiete entspricht, <strong>gegen</strong> die Zulassung gebietsuntypischer Vorhaben in diesem Gebiet<br />
wehren, ohne dass es darauf ankommt, ob sie durch das Vorhaben im Einzelfall nachweisbar<br />
beeinträchtigt werden. Der bauplanungsrechtliche Nachbarschutz, aus dem sich letztlich auch<br />
der Abwehranspruch <strong>gegen</strong> dem Gebietstyp widersprechende Vorhaben ableitet, beruht auf<br />
dem Gedanken eines wechselseitigen Austauschverhältnisses, in dem die einzelnen Grund-<br />
stücke durch das Bauplanungsrecht zu einer auch im Verhältnis untereinander verträglichen<br />
Nutzung gezwungen werden. Weil und soweit der Eigentümer eines Grundstücks in dessen<br />
Ausnutzung öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unterworfen ist, kann er deren Beachtung<br />
grundsätzlich auch im Verhältnis zum Nachbarn durchsetzen. Der Hauptanwendungsfall im<br />
Bauplanungsrecht für diesen Grundsatz sind Festsetzungen des Bebauungsplans über die Art<br />
der baulichen Nutzung beziehungsweise der einen Gebietstyp prägende vorhandene bauliche<br />
Bestand. Durch sie werden die betroffenen Eigentümer im Hinblick auf die Nutzung ihrer<br />
Grundstücke zu einer rechtlichen Schicksalsgemeinschaft verbunden, wobei die Beschrän-<br />
kung der Nutzungsmöglichkeiten des eigenen Grundstücks dadurch kompensiert wird, dass<br />
auch die anderen Grundstückseigentümer diesen Beschränkungen unterworfen sind. Der Ab-<br />
wehranspruch wird grundsätzlich bereits durch die Zulassung eines mit der Gebietsfestset-<br />
zung unvereinbaren Vorhabens ausgelöst, weil hierdurch das nachbarliche Austauschverhält-<br />
nis gestört und eine Verfremdung des Gebietes eingeleitet wird.<br />
Einem solchen Abwehranspruch der Antragsteller zu 7 bis 10 steht hier bereits der Umstand<br />
ent<strong>gegen</strong>, dass ihre Grundstücke außerhalb des Geltungsbereichs des für das Baugrundstück<br />
maßgeblichen Bebauungsplans liegen. Es besteht daher zwischen den Grundstücken der<br />
Antragsteller und dem mit der Mobilfunksendanlage bebauten Grundstück nicht das für ein<br />
Plangebiet typische wechselseitige Verhältnis, das die in einem Plangebiet zusammenge-<br />
fassten Grundstücke zu einer bau- und bodenrechtlichen Schicksalsgemeinschaft zusam-<br />
...
- 9 -<br />
menschließt . Der aus den Festsetzungen eines Bebauungsplans über die Art der Nutzung<br />
herzuleitende bundesrechtliche Gebietserhaltungsanspruch gilt grundsätzlich nur <strong>gegen</strong>über<br />
Bauvorhaben innerhalb eines festgesetzten Gebietes (vgl. vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt.<br />
v. 29. Juni 1994, BauR 1995, S. 70 f.; OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 14. August 1996 - 1 L<br />
232/95; Finkelnburg/Ortloff; Öffentliches Baurecht, Bd. II, 4. Aufl. 1998, S. 230).<br />
Der Gebietserhaltungsanspruch scheitert hier aber vor allem daran, dass den gemäß § 9 Abs.<br />
1 Nr. 15 und Nr. 20 BauGB getroffenen Festsetzungen keine generell drittschützende Wirkung<br />
zukommt. Als Festsetzung innerhalb eines Baugebietes über die Art der zulässigen Nutzung,<br />
welche unabhängig von den Vorstellungen des Plangebers bereits kraft Bundesrechts nach-<br />
barschützende Wirkung entfaltet, ist diese Ausweisung nicht zu qualifizieren. Vielmehr handelt<br />
es sich um eine der sonstigen nach dem Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB vorgesehenen Aus-<br />
weisungen, die prinzipiell nur städtebaulichen Zielen zu dienen bestimmt sind, sofern nicht<br />
dem Plan eine davon abweichende Schutzrichtung zugunsten bestimmter Planbetroffener zu<br />
entnehmen ist. Zwar gibt es auch innerhalb des Katalogs einzelne Festsetzungsmodalitäten,<br />
die schon inhaltlich auf Grund ihrer <strong>gegen</strong> Beeinträchtigungen durch schädliche Umwelteinwir-<br />
kungen gerichteten Funktion von vornherein drittschützende Wirkung zu entfalten vermögen.<br />
Darunter fällt jedoch die hier zu beurteilende Ausweisung nicht. Als Festsetzung einer öffentli-<br />
chen Grünanlage/öffentliche Sportanlage mit der Zweckbestimmung Badeanstalt und Spiel-<br />
platz gehört sie im Gegenteil zu denjenigen Ausweisungen, denen in aller Regel eine aus-<br />
schließlich dem Allgemeininteresse dienende Funktion zukommt. Denn die Aufgabe einer öf-<br />
fentlichen Badeanstalt mit Spielplatz und Grünanlagen besteht im Wesentlichen darin, den<br />
örtlichen und überörtlichen Erholungs- und Freizeitbedarf der Bevölkerung zu erfüllen. Ange-<br />
sichts der so beschaffenen öffentlichen Zweckbestimmung einer solchen Ausweisung ist des-<br />
halb im allgemeinen für die Annahme einer darüber hinaus durch den Plan auch vermittelten<br />
individuellen Schutzwirkung zugunsten der Eigentümer der angrenzenden oder im selben<br />
Baugebiet liegenden Grundstücke kein Raum (vgl. OVG Berlin, B. v. 15. September 1994, NuR<br />
1995, S. 299 f.).<br />
cc) Allerdings hat es der Plangeber in der Hand, einer solchen Festsetzung ausnahmsweise<br />
gleichwohl auch drittschützende Wirkung zuzuerkennen, die sich auch nicht nur auf das Plan-<br />
gebiet selbst beschränken muss, sondern auch eine gebietsüberschreitende Zielrichtung ha-<br />
ben kann (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 11. März 1997, NVwZ 1997, S. 384 f.). Ein<br />
dahingehender Wille muss jedoch eindeutig erkennbar sein. Er ist anhand einer Auslegung des<br />
Gesamtinhalts des jeweiligen Bebauungsplans nach Text und zeichnerischen Darstellungen<br />
unter Heranziehung seiner Begründung und gegebenenfalls weiterer sich aus den Planvorgän-<br />
...
- 10 -<br />
gen ergebenden Hinweise auf den Regelungswillen des Plangebers zu ermitteln (vgl. OVG<br />
Rheinland-Pfalz, Urt. v. 14. Januar 2001, BauR 200, S. 527 ff.; OVG Berlin, a.a.O.).<br />
Für die hier zu beurteilenden Festsetzungen ergeben sich indessen keine Anhaltspunkte für<br />
eine auch dem Schutz der an die Badeanstalt angrenzenden Wohnbebauung dienenden<br />
Funktion. Maßgebend für die Ermittlung der mit einem Bebauungsplan angestrebten Schutz-<br />
wirkungen bleiben vorrangig die den planerischen Regelungswillen dokumentierenden Äuße-<br />
rungen des Plangebers selbst. Diese lassen hier erkennen, dass der Plangeber insoweit allein<br />
die erörterte städtebauliche Funktion der öffentlichen Sportanlage im Auge hatte. Nach der<br />
Begründung zum Bebauungsplan (vgl. Bremische Bürgerschaft, Stadtbürgerschaft, Drucks.<br />
14/325 v. 22.10.1996) sollte mit der Festsetzung der öffentlichen Sportanlage und dem Zusatz<br />
„Badeanstalt und Spielplatz“ der Bestand des hier vorhandenen Freibades gesichert werden.<br />
Die Festsetzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
von Natur und Landschaft am westlichen Rand des Freibades dient nach der Begründung<br />
auch der Abschirmung der Sportfläche zum benachbarten Gewerbegebiet. An keiner Stelle der<br />
Begründung findet sich ein Hinweis darauf, dass die hier maßgeblichen, der Mobilfunksende-<br />
anlage ent<strong>gegen</strong>stehenden Festsetzungen auch zum Schutz der angrenzenden Wohnbebau-<br />
ung, etwa vor einer weiteren Ausdehnung des Gewerbegebietes, erfolgt sind.<br />
b) Fehlt danach eine generell nachbarschützende Wirkung der Festsetzung, kommt eine<br />
Rechtsverletzung der Antragsteller zu 7 bis 10 nur in Betracht, wenn mit der Abweichung von<br />
den Festsetzungen des Bebauungsplans zugleich ein Verstoß <strong>gegen</strong> das planungsrechtliche<br />
Gebot der Rücksichtnahme verbunden wäre.<br />
aa) Abwehrrechte <strong>gegen</strong> die Zulassung von Bauvorhaben unter Abweichung von nicht unmit-<br />
telbar drittschützend wirkenden, allein städtebaulich motivierten Festsetzungen stehen einem<br />
Nachbarn nur zu, wenn die betreffende Genehmigung zu seinem Nachteil <strong>gegen</strong> das Rück-<br />
sichtnahmegebot verstößt. Dieses ist im Falle einer von der Bauaufsichtsbehörde nicht er-<br />
kannten Abweichung den dann entsprechend anwendbaren Regelungen der § 31 Abs. 2<br />
BauGB, § 15 BauNVO zu entnehmen (vgl. BVerwG, Urt. v. 06. Oktober 1989, NJW 1990, S.<br />
1192). Ein gebietsübergreifender Nachbarschutz ist dann in entsprechender Anwendung des §<br />
15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO <strong>gegen</strong>über Anlagen gegeben, von denen Belästigungen oder Stö-<br />
rungen ausgehen, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen<br />
Umgebung unzumutbar sind (zum gebietsübergreifenden Nachbarschutz durch das Gebot der<br />
Rücksichtnahme vgl. OVG Bremen, Urt. v. 02. Dezember 1980 - UPR 1982, S. 25; VGH Ba-<br />
...
- 11 -<br />
den-Württemberg, Urt. v. 29. Juni 1994, BauR 1995, S. 70; OVG Berlin, B.v. 15. September<br />
1994, NuR 1995, S. 299 f.).<br />
Drittschützende Wirkung kommt dem in § 15 Abs. 1 BauNVO verankerten Gebot der Rück-<br />
sichtnahme dabei nur zu, soweit in qualifizierter und zugleich individualisierter Weise auf<br />
schutzwürdige Interessen eines erkennbar abgrenzbaren Kreises Dritter Rücksicht zu neh-<br />
men ist. Das gilt nur für diejenigen Ausnahmefälle, in denen die tatsächlichen Umstände hand-<br />
greiflich ergeben, auf wen Rücksicht zu nehmen ist, und eine besondere rechtliche<br />
Schutzwürdigkeit des Betroffenen anzuerkennen ist. Welche Anforderungen das Gebot der<br />
Rücksichtnahme stellt, hängt wesentlich von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Die<br />
Beurteilung findet auf der Grundlage einer am Kriterium der Zumutbarkeit orientierten Abwä-<br />
gung statt. Für die Annahme einer unzumutbaren Betroffenheit reichen bloße Lästigkeiten nicht<br />
aus. Erforderlich ist vielmehr eine hierüber hinausgehende qualifizierte Betroffenheit des<br />
Nachbarn (vgl. BVerwGE 52, 122 ).<br />
bb) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Antragsteller zu 7 bis 10 wird danach nicht bereits<br />
durch die gebietsfremde Nutzung begründet.<br />
Einer qualifizierten Betroffenheit bedarf es auch dann, wenn eine Baugenehmigung im Wider-<br />
spruch zu den Festsetzungen eines Bebauungsplans erteilt worden ist. In diesem Zusam-<br />
menhang ist zwar zu berücksichtigen, dass der Nachbarschutz in diesen Fällen nicht hinter<br />
dem aus § 31 Abs. 2 BauGB zurückbleiben darf. Der Nachbar kann danach um so mehr an<br />
Rücksichtnahme verlangen, je empfindlicher seine Stellung durch die vom Bebauungsplan<br />
abweichende Nutzung berührt werden kann. Umgekehrt braucht jedoch auch derjenige, der ein<br />
Bauvorhaben verwirklichen will, um so weniger Rücksicht zu nehmen, je verständlicher und<br />
unabweisbarer die von ihm verfolgten Interessen sind. Abwehren kann der Nachbar auch dann,<br />
wenn die Baugenehmigungsbehörde von den dem Vorhaben widersprechenden Festsetzun-<br />
gen nicht ausdrücklich befreit, sondern ohne Befreiung eine insoweit objektiv rechtswidrige<br />
Baugenehmigung erteilt hat, nur solche Beeinträchtigungen, die ihm nach Lage der Dinge nicht<br />
mehr zuzumuten sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 06. Oktober 1989, NJW 1990, S. 1192 f.).<br />
Daran fehlt es hier. Die Grundstücke der Antragsteller sind ca. 100 bis 150 m von der Mobil-<br />
funkanlage entfernt. Sie liegt im Randbereich der Festsetzung „Öffentliche Sportanlage“. Be-<br />
reits eine geringfügige Verschiebung des Sendemastes würde dazu führen, dass sich die Mo-<br />
bilfunkanlage im Gewerbegebiet befände und damit auch den planungsrechtlichen Festset-<br />
zungen entspräche. Der Umstand, dass sich die Antragsteller bei der Nutzung ihrer Grund-<br />
stücke darauf eingestellt haben, dass die angrenzende Badeanstalt nicht durch eine gewerbli-<br />
...
- 12 -<br />
che Nutzung überlagert wird, vermag ein insoweit bestehendes besonderes Schutzbedürfnis<br />
rechtlich nicht zu begründen. Hierbei handelt es sich um lediglich faktische Lagevorteile der<br />
Grundstücke. Die Anerkennung eines Anspruchs auf Erhaltung der öffentlichen Sportanlage in<br />
ihrem festgesetzten Umfang würde wiederum darauf hinauslaufen, dieser Festsetzung entge-<br />
gen ihrer rein städtebaulichen Funktion unmittelbaren Drittschutz zuzuerkennen. Auch von<br />
einer unzumutbaren optischen Einwirkung auf die Grundstücke der Antragsteller kann - unge-<br />
achtet der Unzulässigkeit eines solchen, auf die Beeinträchtigung durch den Baukörper ge-<br />
richteten Einwandes - schon in Anbetracht der Entfernung der <strong>Mobilfunkanlage</strong> von den<br />
Grundstücken nicht die Rede sein. Schließlich ist auch die von den Antragstellern behauptete<br />
Wertminderung der Hausgrundstücke allein kein Grund, der ihnen, unabhängig von einer als<br />
objektiv unzumutbar zu qualifizierenden Beeinträchtigung, Abwehrrechte <strong>gegen</strong> die Mobilfunk-<br />
anlage vermitteln könnte (vgl. BVerwG, Urt. v. 14. April 1978, BRS 33 Nr. 158).<br />
cc) Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes kann nach summarischer Prüfung auch<br />
nicht mit Blick auf die durch den Betrieb der <strong>Mobilfunkanlage</strong> verursachten Strahlenbelastung<br />
festgestellt werden.<br />
Bei der Bestimmung dessen, was den durch ein Vorhaben Belästigten zugemutet werden<br />
kann, ist, soweit es um Beeinträchtigungen durch emittierende Anlagen geht, an die Vorgaben<br />
des Bundesimmissionsschutzgesetzes anzuknüpfen. Dieses Gesetz verlangt von den Betrei-<br />
bern emittierender Anlagen, dass vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen unterbleiben.<br />
Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 BImSchG alle Immissionen, die nach Art, Aus-<br />
maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen<br />
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen. Einwirkungen dieses Grades - und<br />
nicht erst enteignende Beeinträchtigungen oder ernste Gesundheitsbeeinträchtigungen - sind<br />
den davon Betroffenen grundsätzlich unzumutbar (vgl. BVerwGE 52, 122 ). Das Bunde-<br />
simmissionsschutzgesetz und die insbesondere hier maßgebliche 26. Verordnung zur<br />
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 16. Dezember 1996 (BGBl. I S.<br />
1966, 26. BImSchV) konkretisieren die gebotene Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft all-<br />
gemein und damit auch für das Baurecht. Ferner sind die §§ 22 ff BImschG und damit auch<br />
die Vorgaben der 26. BImSchV „als sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften“ bei der Erteilung<br />
der Baugenehmigung zu beachten (vgl. Wahlfels, NVwZ 2003, S. 653 ; Kutscheidt,<br />
NVwZ 1997, S. 2481 ; zur nachbarschützenden Wirkung des § 22 BImSchG OVG<br />
Bremen, NVwZ 1986, S. 672).<br />
...
- 13 -<br />
Durch die vorgelegte Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation<br />
und Post vom 10. August 2000 wird bestätigt, dass der in der 26. BImSchV vorgeschriebene<br />
Schutz bei Beachtung der Sicherheitsabstände gegeben ist. Nach den derzeitigen Erkenntnis-<br />
sen kann danach nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsteller durch den Betrieb<br />
der <strong>Mobilfunkanlage</strong> eine gesundheitliche Beeinträchtigung erfahren werden. Den § 22 Abs. 1<br />
BImSchG zu entnehmenden Anforderungen des Nachbarschutzes <strong>gegen</strong>über den von einer<br />
<strong>Mobilfunkanlage</strong> erzeugten elektromagnetischen Feldern wird nach derzeitigem Erkenntnis-<br />
stand bei Beachtung der in der 26. BImSchV enthaltenen Grenzwerte entsprochen. Diese<br />
Grenzwerte beruhen auf den international anerkannten Empfehlungen der Weltgesundheitsor-<br />
ganisation, der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung und<br />
des Bundesamts für Strahlenschutz. Bei Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte der 26.<br />
BImSchV kann nach dem heutigen Stand von Forschung und Technik nicht von einer Gesund-<br />
heitsgefährdung ausgegangen werden werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, B. v. 20. August<br />
2001, NVwZ-RR 2002, S. 17; VGH Baden-Württemberg, B. v. 19. April 2002, NVwZ-RR 2003,<br />
S. 27; Niedersächsisches OVG, B. v. 19. Januar 2001, NVwZ 2001, S. 456).<br />
Richtig ist zwar, dass die athermischen Effekte, die nicht durch die strahlenbedingte Erwär-<br />
mung des menschlichen Körpers hervorgerufen werden können, bislang noch nicht abschlie-<br />
ßend wissenschaftlich erforscht sind. Auch wenn hier nach wie vor noch Forschungsbedarf<br />
besteht, um den noch offenen Fragen weiter nachzugehen, haben sich wissenschaftlich fun-<br />
dierte Anhaltspunkte dafür, dass und unter welchen Umständen <strong>Mobilfunkanlage</strong>n athermisch<br />
auf den menschlichen Organismus einwirken können, welche Effekte solche Strahlen auf den<br />
menschlichen Körper haben können und welche Grenzwerte eingehalten werden müssen, um<br />
auch unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge Gesundheitsbeschädigungen schon im Vorfeld<br />
auszuschließen, bislang nicht finden lassen. Nach polizeirechtlichen Grundsätzen besteht mit<br />
anderen Worten ein Anfangsverdacht, der es rechtfertigt, dem durch weitere Forschung nach-<br />
zugehen. Ausreichend wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die der Rechtsfindung als hin-<br />
reichend sichere Tatsachengrundlage zugrunde gelegt werden könnten, sind jedoch bislang<br />
nicht ersichtlich und werden auch von den Antragstellern nicht vorgetragen. Der Eintritt ge-<br />
sundheitlicher Nachteile erscheint nach derzeitigem Erkenntnisstand bei Einhaltung der in der<br />
26. BImSchV enthaltenen Grenzwerte dermaßen unwahrscheinlich, dass ein noch verbleiben-<br />
des Restrisiko vernachlässigt werden darf (vgl. Niedersächsisches OVG, a.a.O, S. 457).<br />
Es kann - zumal in einem Eilverfahren - nicht Sache der Gerichte sein, auf der Grundlage un-<br />
gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse die Schutzeignung der vom Verordnungsgeber<br />
festgesetzten Grenzwerte in Zweifel zu ziehen und den jeweils aktuellen Stand der Forschung<br />
...
- 14 -<br />
zu ermitteln. Es ist vielmehr Sache des Verordnungsgebers, den Erkenntnisfortschritt der<br />
Wissenschaft mit geeigneten Mitteln nach allen Seiten zu beobachten und zu bewerten, um<br />
gegebenenfalls weiter gehende Schutzmaßnahmen zu treffen (vgl. BVerfG, 3. Kammer des<br />
Ersten Senats, B. v. 28. Februar 2002, NJW 2002, S. 1638). Dass der Verordnungsgeber sei-<br />
ner insoweit bestehenden Pflicht nicht nachgekommen ist, kann nicht festgestellt werden.<br />
Nach der Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 13. September 2001 zu Grenz-<br />
werten und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Fel-<br />
dern liegen auch nach aktueller Bewertung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur kei-<br />
ne neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, die durchgreifende Zweifel an den <strong>gegen</strong>wärtig<br />
geltenden Grenzwerten zu begründen vermögen (VGH Baden-Württemberg, B. v. 26. Juni<br />
2002, NVwZ-RR 2003, S. 27 f.).<br />
Danach haben die Antragsteller eine unzumutbare Beeinträchtigung durch den Betrieb der<br />
Mobilfunkstation unter Einhaltung der in der Standortbescheinigung angegebenen Grenzwerte<br />
nicht zu erwarten. Für die Umstellung der Anlage auf UMTS-Betrieb oder der Installation weite-<br />
rer Anlagen an dem Sendemast wird es der Einholung aktueller Standortbescheinigungen be-<br />
dürfen, so dass auch für den Fall einer Veränderung der Mobilfunksendeanlage die Einhaltung<br />
der vorgeschriebenen Personenschutzwerte erneut zu überprüfen sein wird. Es ist Aufgabe<br />
der Antragsgegnerin sicherzustellen, dass die errichtete <strong>Mobilfunkanlage</strong> nicht im Widerspruch<br />
zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften benutzt wird. Derzeit bestehen hierfür aber keine An-<br />
haltspunkte.<br />
Bleiben nach alledem die Anträge auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Widersprü-<br />
che ohne Erfolg, besteht von vornherein kein Raum für die Aufhebung der Vollziehung nach §<br />
80 Abs. 5 VwGO oder die Anordnung sichernder Maßnahmen nach §§ 80 a Abs. 3 i.V.m. 80a<br />
Abs. 1 Nr. 2 VwGO.<br />
3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 2, 159 Satz 1, 162 Abs. 3<br />
VwGO. Danach tragen die Antragsteller die Kosten des Verfahrens zu gleichen Teilen. Die<br />
Beigeladene hat ihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen, da sie im gerichtlichen Eil-<br />
verfahren keinen Antrag gestellt und damit auch kein Verfahrensrisiko übernommen hat.<br />
Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 13 Abs. 1, 20 Abs. 3 GKG. In Anbetracht der<br />
von den Antragstellern geltend gemachten Grundstückswertverluste, die durch den Betrieb der<br />
<strong>Mobilfunkanlage</strong> eingetreten sein sollen, erscheint der festgesetzte Streitwert der Bedeutung<br />
des Eilverfahrens angemessen.<br />
...
- 15 -<br />
Rechtsmittelbelehrung<br />
Gegen diesen Beschluss ist - abgesehen von der Streitwertfestsetzung - die Beschwerde an<br />
das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen statthaft. Die Beschwerde ist innerhalb<br />
von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei dem<br />
Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Altenwall 6, 28195 Bremen,<br />
einzulegen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses zu begründen.<br />
Die Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt oder einem sonst nach § 67 Abs. 1 VwGO<br />
zur Vertretung berechtigten Bevollmächtigten eingelegt werden.<br />
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem<br />
Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen einzureichen. Die Beschwerde muss<br />
einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern<br />
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen.<br />
Die sich auf den durch Antragsrücknahme beendeten Verfahrensteil beziehende Einstellungsund<br />
Kostenentscheidung ist entsprechend §§ 92 Abs. 3 Satz 2, 158 Abs. 2 VwGO unanfechtbar.<br />
Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht der Freien<br />
Hansestadt Bremen statthaft, wenn der Wert des Beschwerde<strong>gegen</strong>standes 50,00 Euro<br />
übersteigt. Die Beschwerde ist spätestens innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung<br />
in der Hauptsache Rechtskraft erlangt hat oder das Verfahren sich anderweitig erledigt<br />
hat, bei dem<br />
Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Altenwall 6, 28195 Bremen,<br />
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.<br />
gez.: Klose gez.: Sperlich gez.: Dr. Jörgensen