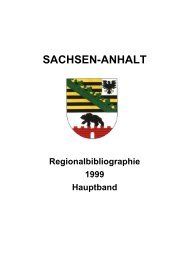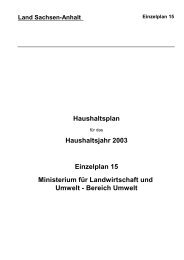Pflichtexemplarrecht und Pflichtexemplarpraxis - Martin-Luther ...
Pflichtexemplarrecht und Pflichtexemplarpraxis - Martin-Luther ...
Pflichtexemplarrecht und Pflichtexemplarpraxis - Martin-Luther ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflichtexemplarpraxis</strong> in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung<br />
Sachsen-Anhalts<br />
Vergleichende Untersuchung der Gesetze zur Pflichtexemplarablieferung<br />
<strong>und</strong> ihrer praktischen Umsetzung in den empfangsberechtigten Bibliotheken<br />
der Länder<br />
Diplomarbeit<br />
an der<br />
Hochschule für Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Kultur Leipzig (FH)<br />
Fachbereich Buch <strong>und</strong> Museum<br />
Studiengang Bibliothekswesen<br />
vorgelegt von<br />
Lydia Krause<br />
Leipzig, 2001
Krause, Lydia:<br />
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflichtexemplarpraxis</strong> in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
unter besonderer Berücksichtigung Sachsen-Anhalts : vergleichende Untersuchung<br />
der Gesetze zur Pflichtexemplarablieferung <strong>und</strong> ihrer praktischen Umsetzung<br />
in den empfangsberechtigten Bibliotheken der Länder / Lydia Krause. -<br />
2001. - 71, [20] Bl. : graph. Darst<br />
Leipzig, Hochschule. für Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Kultur (FH), Diplomarbeit, 2001<br />
Kurzreferat:<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> Deutschlands der Gegenwart besteht auf B<strong>und</strong>esebene<br />
<strong>und</strong> Länderebene. Auf B<strong>und</strong>esebene ist es im Gesetz über die Deutsche Bibliothek<br />
<strong>und</strong> einer Verordnung über die Pflichtablieferung von Druckwerken geregelt.<br />
Die Länder haben aufgr<strong>und</strong> der föderalistischen Struktur jeweils eigene Gesetze<br />
<strong>und</strong> Durchführungsverordnungen. In Ermangelung eines Rahmengesetzes hat<br />
das Gesetz über Die Deutsche Bibliothek eine gewisse Vorbildfunktion. Das<br />
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> ist in elf Ländern im Pressegesetz geregelt; in fünf Ländern<br />
als autonomes Gesetz. Dies ist ein entscheidendes Klassifikationsmerkmal. Die<br />
Ansiedelung an das Presserecht hat historische Gründe <strong>und</strong> wird immer wieder<br />
kritisiert. Autonome Gesetze werden den zu regelnden Sachverhalten besser gerecht.<br />
In gr<strong>und</strong>sätzlichen Fragen (z. B. Ablieferungspflichtige, Empfangsberechtigte,<br />
Ablieferungsgut, Entschädigung) stimmen die Gesetze - mit verschiedenen<br />
Modifikationen - überein.<br />
Der Sinn des Pflichtexemplars besteht in der Sammlung des gesamten Schrifttums<br />
einer Region bzw. eines Landes, seiner bibliographischen Verzeichnung <strong>und</strong><br />
Archivierung für nachfolgende Generationen. Bei der Durchsetzung der Gesetze<br />
treten spezifische Probleme auf: neuen bzw. nicht professionellen Verlagen ist die<br />
Ablieferungspflicht oft nicht bekannt; die Bibliotheken haben enormen Verwaltungsbedarf<br />
bei der Ermittlung <strong>und</strong> Erschließung insbes. von grauer Literatur,<br />
Kleinschrifttum <strong>und</strong> Groschenheften; neue Publikationsformen aufgr<strong>und</strong> neuer<br />
Technologien (bes. elektronische Publikationen) erfordern neue gesetzliche Bestimmungen<br />
<strong>und</strong> Konservierung; kaum Anwendung von Verwaltungszwang bei<br />
Nichtablieferung. Demnach kann eine Vollständigkeit der Sammlung nur angestrebt,<br />
niemals erreicht werden. Die in fünf Ländern der Ablieferungspflicht vorgeschaltete<br />
Anbietungspflicht ist im Gr<strong>und</strong>e mit dem kulturpolitischen Auftrag des<br />
Pflichtexemplars nicht vereinbar.<br />
Die Untersuchung der Bibliothekspraxis beruht auf der Auswertung von Fragebögen,<br />
die 23 empfangsberechtigte Bibliotheken zurückgesandt hatten.<br />
Eine Reformierung der meisten Pflichtexemplargesetze der Länder ist wünschenswert.<br />
Optimal wäre ein einheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>, das die Erfahrungen<br />
Der Deutschen Bibliothek <strong>und</strong> aller B<strong>und</strong>esländer berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis<br />
- 3 -<br />
1 Vorwort 7<br />
2 Das Pflichtexemplar der Gegenwart <strong>und</strong> seine kulturpolitische Bedeutung 9<br />
2.1 Pflichtexemplar <strong>und</strong> <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> 9<br />
2.2 Kulturpolitischer Auftrag des Pflichtexemplars 9<br />
2.3 Landes- <strong>und</strong> andere Regionalbibliotheken 11<br />
2.3.1 Entstehung <strong>und</strong> Typologie 11<br />
2.3.2 Aufgaben 12<br />
3 Entwicklung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s von den Anfängen bis zur Gegenwart 13<br />
3.1 Anfänge bis zum 19. Jahrh<strong>und</strong>ert 13<br />
3.1.1 Historische Wurzeln 13<br />
3.1.2 Zensurexemplar 13<br />
3.1.3 Privilegienexemplar 15<br />
3.1.4 Urheberschutzexemplar 15<br />
3.1.5 Bibliotheksexemplar<br />
3.2 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bis 1945 unter besonderer Berücksichtigung der preußischen<br />
15<br />
Provinz Sachsen <strong>und</strong> des Herzogtums bzw. Freistaates Anhalt 16<br />
3.2.1 Preußen 16<br />
3.2.2 Anhalt 17<br />
3.2.3 Deutsches Kaiserreich ab 1871 18<br />
3.2.4 Weimarer Republik <strong>und</strong> Nationalsozialismus 18<br />
3.3 1945 bis heute 20<br />
3.3.1 Sowjetische Besatzungszone <strong>und</strong> DDR am Beispiel Sachsen-Anhalts 20<br />
3.3.1.1 Geschichte der Verwaltungseinheit Sachsen-Anhalt<br />
3.3.1.2 Die sachsen-anhaltischen Landesbibliotheken <strong>und</strong> das<br />
20<br />
Pflichtexemplar 20<br />
3.3.1.3 Staatlich geregeltes einheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> 23<br />
3.3.2 B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland 23<br />
3.3.2.1 Erste Nachkriegsjahre 23<br />
3.3.2.2 Entstehung der Deutschen Bibliothek 24<br />
3.3.2.3 Bemühungen um ein neues <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> 25<br />
3.3.2.4 <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>gesetz 26<br />
3.4 Die deutsche Einheit 27<br />
4 Die Arbeit der heutigen Pflichtexemplarstelle der ULB in Halle 29<br />
5 Geltende Pflichtexemplargesetze, Verordnungen <strong>und</strong> Richtlinien 31<br />
5.1 B<strong>und</strong>esrecht 31<br />
5.2 Landesrecht 31<br />
5.2.1 Baden-Württemberg (BAW) 31<br />
5.2.2 Bayern (BAY) 32<br />
5.2.3 Berlin (BER) 32<br />
5.2.4 Brandenburg (BRA) 32<br />
5.2.5 Bremen (BRE) 33<br />
5.2.6 Hamburg (HAM) 33<br />
5.2.7 Hessen (HES) 33
- 4 -<br />
5.2.8 Mecklenburg-Vorpommern (MEC) 33<br />
5.2.9 Niedersachsen (NIE) 33<br />
5.2.10 Nordrhein-Westfalen (NRW) 34<br />
5.2.11 Rheinland-Pfalz (RPF) 34<br />
5.2.12 Saarland (SAR) 34<br />
5.2.13 Sachsen (SAX) 34<br />
5.2.14 Sachsen-Anhalt (SAA) 34<br />
5.2.15 Schleswig-Holstein (SCH) 35<br />
5.2.16 Thüringen (THU) 35<br />
6 Inhalt des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s <strong>und</strong> seine Durchsetzung in den Ländern 35<br />
6.1 Statistische Angaben aus 23 Pflichtexemplarbibliotheken 35<br />
6.2 Rechtliche Einbindung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s 37<br />
6.3 Anbietungs- <strong>und</strong> Ablieferungspflicht 38<br />
6.3.1 Gesetzliche Bestimmungen 38<br />
6.3.2 Auswertung des Fragebogens 39<br />
6.3.3 Diskussion 40<br />
6.4 Die Verpflichteten 41<br />
6.4.1 Gesetzliche Bestimmungen 41<br />
6.4.2 Auswertung des Fragebogens 42<br />
6.4.3 Diskussion 42<br />
6.5 Umfang der Ablieferungspflicht 43<br />
6.5.1 Gesetzliche Bestimmungen 43<br />
6.5.2 Auswertung des Fragebogens 44<br />
6.5.3 Diskussion 45<br />
6.5.3.1 Begriff Druckwerk 45<br />
6.5.3.2 Ton- <strong>und</strong> Bildtonträger 46<br />
6.5.3.3 Elektronische Publikationen 47<br />
6.6 Ausnahmen von der Ablieferungspflicht 48<br />
6.6.1 Gesetzliche Bestimmungen 48<br />
6.6.2 Diskussion 50<br />
6.7 Vergütungsregelung 51<br />
6.7.1 Gesetzliche Bestimmungen 51<br />
6.7.2 Auswertung des Fragebogens 52<br />
6.7.3 Diskussion 52<br />
6.8 Durchsetzung der Verpflichtung 52<br />
6.8.1 Gesetzliche Bestimmungen 52<br />
6.8.1.1 In den Ländern 52<br />
6.8.1.2 In Sachsen-Anhalt 53<br />
6.8.2 Auswertung des Fragebogens 54<br />
6.8.3 Diskussion 56<br />
6.8.3.1 Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Mahnungen 56<br />
6.8.3.2 Verwaltungszwang <strong>und</strong> Verfolgung als Ordnungswidrigkeit 56<br />
7 Schlussfolgerungen 58<br />
8 Literaturverzeichnis 60
Abkürzungsverzeichnis<br />
- 5 -<br />
Abs. ................................................... Absatz<br />
Art...................................................... Artikel<br />
BAW .................................................. Baden-Württemberg<br />
BAY ................................................... Bayern<br />
BbgPG .............................................. Brandenburgisches Landespressegesetz<br />
BER................................................... Berlin<br />
BLB .................................................. Badische Landesbibliothek<br />
BRA................................................... Brandenburg<br />
BRE................................................... Bremen<br />
BSB .................................................. Bayerische Staatsbibliothek<br />
DBS .................................................. Deutsche Bibliotheksstatistik<br />
DDB .................................................. Die Deutsche Bibliothek<br />
GBV .................................................. Gemeinsamer Bibliotheksverb<strong>und</strong><br />
GG. ................................................... Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
HAM .................................................. Hamburg<br />
HES................................................... Hessen<br />
GHB .................................................. Gesamthochschul-Bibliothek Kassel<br />
HLB .................................................. Hessische Landesbibliothek<br />
Kap.................................................... Kapitel<br />
LB ..................................................... Landesbibliothek<br />
LPG .................................................. Landespressegesetz<br />
MEC .................................................. Mecklenburg-Vorpommern<br />
NIE .................................................... Niedersachsen<br />
NLB .................................................. Niedersächsische Landesbibliothek<br />
NRW.................................................. Nordrhein-Westfalen<br />
NW (im Zitat) ..................................... Nordrhein-Westfalen<br />
PEG. ................................................. Pflichtexemplargesetz (Hamburg)<br />
PflExG ............................................. Pflichtexemplargesetz (Berlin)<br />
PflStG .............................................. Pflichtstückegesetz (Bayern)<br />
RPF ................................................... Rheinland-Pfalz<br />
RPG ................................................. Reichspreßgesetz<br />
SAA ................................................... Sachsen-Anhalt<br />
SächsPresseG ................................. Sächsisches Gesetz über die Presse<br />
SAR................................................... Saarland<br />
SAX ................................................... Sachsen<br />
SCH................................................... Schleswig-Holstein<br />
SLB ................................................... Sächsische Landesbibliothek<br />
SMAD .............................................. Sowjetische Militäradministration<br />
SPresseG.......................................... Saarländisches Pressegesetz<br />
StB. .................................................. Stadtbibliothek
- 6 -<br />
StLB. ................................................ Stadt- <strong>und</strong> Landesbibliothek<br />
StUB.................................................. Stadt- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek<br />
SUB. ................................................. Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek<br />
THU................................................... Thüringen<br />
TPG. ................................................. Thüringer Pressegesetz<br />
UB .................................................... Universitätsbibliothek<br />
ULB .................................................. Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek<br />
WLB ................................................. Württembergische Landesbibliothek<br />
VO .................................................... Verordnung<br />
ZLB ................................................... Zentral- <strong>und</strong> Landesbibliothek
1 Vorwort<br />
- 7 -<br />
Pflichtexemplare haben eine lange Tradition. Und sie haben auch nach internationalen<br />
Maßstäben ihre Berechtigung. Gesetzliche Bestimmungen zur Ablieferung<br />
von Pflichtexemplaren gibt es in fast allen modernen Staaten. In dieser Beziehung<br />
herrschte selbst Übereinstimmung zwischen den sozialistischen <strong>und</strong> den kapitalistischen<br />
Ländern. Demzufolge können auch die Pflichtexemplarbibliotheken der<br />
neuen Länder auf eine lange <strong>und</strong> meistens ununterbrochene Pflichtexemplartradition<br />
zurückblicken. Die Pflichtexemplarabgabe war seit 1960 zentral für die Deutsche<br />
Demokratische Republik geregelt.<br />
Seit circa zehn Jahren gilt auch in den neuen B<strong>und</strong>esländern der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland neben dem <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> auf B<strong>und</strong>esebene das regionale,<br />
auf dem föderalistischen Prinzip beruhende <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>. (Das bedeutet,<br />
dass die gesetzlichen Bestimmungen zur Ablieferung der Pflichtliteratur in den<br />
einzelnen B<strong>und</strong>esländern neben Übereinstimmung im Gr<strong>und</strong>sätzlichen auch Differenzen<br />
in den Details aufweisen.)<br />
Seit circa zehn Jahren versuchen die jeweils ein oder zwei Bibliothekarinnen <strong>und</strong><br />
Bibliothekare in den fünf empfangsberechtigten Bibliotheken der neuen Länder,<br />
die z. T. neue Rechtsmaterie in die Praxis umzusetzen.<br />
So auch die Verfasserin dieser Arbeit, die von 1996 bis 1998 die Pflichtliteratur an<br />
der Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle betreute. In Sachsen-Anhalt<br />
ist die Abgabe der Pflichtliteratur im § 11 des Landespressegesetzes<br />
vom 14. August 1991 /Anlage 2/ geregelt.<br />
Dabei traten neben vielen anderen folgende Fragen immer wieder auf:<br />
1. Wieso ist das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> Sachsen-Anhalts im Pressegesetz <strong>und</strong> nicht<br />
in einem separaten Pflichtexemplargesetz geregelt?<br />
2. Wie kann man wenigstens annähernd vollständig die Ablieferungspflichtigen<br />
<strong>und</strong> ihre Publikationen ermitteln?<br />
3. Wie ist im Falle von Nichtlieferung zu verfahren?<br />
Es schien geboten, die Gesetzgebung der anderen B<strong>und</strong>esländer <strong>und</strong> die praktischen<br />
Erfahrungen der Bibliotheken bei ihrer Umsetzung zu ergründen.<br />
Die Gelegenheit dazu bot sich, als sich die Verfasserin im Rahmen eines Brükkenkurses<br />
zwecks Nachdiplomierung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Kultur Leipzig (FH) - Fachbereich Buch <strong>und</strong> Museum, Bibliothekswesen - für<br />
ein Diplomarbeits-Thema zu entscheiden hatte.<br />
Die nun vorliegende Diplomarbeit widmet sich den drei Bereichen Historie des<br />
Pflichtexemplars, <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflichtexemplarpraxis</strong> der Gegenwart -<br />
unter besonderer Berücksichtigung des Landes Sachsen-Anhalt.<br />
Während die Geschichte <strong>und</strong> die gesetzlichen Bestimmungen zum Pflichtexemplar<br />
durch Quellenstudium <strong>und</strong> eine Fülle von Sek<strong>und</strong>ärliteratur erarbeitet werden<br />
können, lässt sich die <strong>Pflichtexemplarpraxis</strong> der Gegenwart nur durch die Auswertung<br />
praktischer Erfahrungen der einzelnen empfangsberechtigten Bibliothe-
- 8 -<br />
ken fassen. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen /Anlage 3/ erstellt <strong>und</strong> 29<br />
regionalen empfangsberechtigten Bibliotheken zugesandt. Der Fragebogen bezieht<br />
sich nur auf die o. g. Schwerpunkte. Eine umfassende Befragung der<br />
Pflichtexemplarbibliotheken, wie sie schon einmal vor zwei Jahrzehnten unter<br />
Bertold Picard, dem damaligen Direktor der Deutschen Bibliothek Frankfurt mit<br />
insgesamt 120 Fragen erfolgte, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zudem<br />
bestünde das Risiko, dass die Bibliotheken von einem derart umfassenden<br />
Fragenkatalog abgeschreckt würden <strong>und</strong> die Mitarbeit verweigerten.<br />
Die Pflichtexemplar-Bibliothek des B<strong>und</strong>es, Die Deutsche Bibliothek, wurde nicht<br />
in die Fragebogen-Aktion einbezogen, da sie mit den regionalen Pflichtexemplarbibliotheken<br />
nur bedingt zu vergleichen ist.<br />
Ausgenommen wurden außerdem die Bibliotheken Bayerns, die über die Bayerische<br />
Staatsbibliothek in München mit einem zweiten Exemplar versorgt werden.<br />
Ausgenommen wurden ebenfalls Bibliotheken, die ausschließlich Amtsdruckschriften<br />
als Pflichtexemplare erhalten. Amtliche Druckschriften <strong>und</strong> Dissertationen<br />
sind im weiteren Sinne zwar auch Pflichtexemplare, unterliegen aber eigenen<br />
gesetzlichen Bestimmungen, so dass sie nicht Gegenstand dieser Arbeit sein<br />
können.<br />
Drei<strong>und</strong>zwanzig der neun<strong>und</strong>zwanzig angeschriebenen Bibliotheken (79 %)<br />
schickten den Fragebogen dankenswerterweise ausgefüllt zurück. Es fehlen die<br />
Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, die Universitäts<strong>und</strong><br />
Landesbibliothek Münster, die Universitätsbibliothek Mainz, die Rheinische<br />
Landesbibliothek Koblenz, die Stadtbibliothek Trier <strong>und</strong> die Universitätsbibliothek<br />
Kiel.<br />
Die meisten Bibliotheken bek<strong>und</strong>eten Interesse an dieser Arbeit. Was darauf<br />
schließen lässt, dass die Pflicht-Materie in der heutigen Gesetzgebung viele Fragen<br />
bei den Pflicht-Bibliothekarinnen <strong>und</strong> Bibliothekaren aufwirft - <strong>und</strong> das nicht<br />
nur in den neuen B<strong>und</strong>esländern. Die Verfasserin hofft, einen Beitrag zur Beseitigung<br />
der einen oder anderen Unklarheit geleistet zu haben. Ganz besonders hofft<br />
sie, dass die Bibliothekarinnen <strong>und</strong> Bibliothekare miteinander ins Gespräch kommen.
- 9 -<br />
2 Das Pflichtexemplar der Gegenwart <strong>und</strong> seine kulturpolitische<br />
Bedeutung<br />
2.1 Pflichtexemplar <strong>und</strong> <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
Ein „Pflichtexemplar (Pflichtstück) ist das Exemplar einer Veröffentlichung, das<br />
aufgr<strong>und</strong> gesetzlicher Vorgabe an eine Bibliothek zumeist kostenfrei abgeliefert<br />
werden muss.“ /Lohse, Hartwig 1999, S. 623/ Der Terminus „Pflichtexemplar“ hat<br />
sich heute weitgehend in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland durchgesetzt. Aber<br />
auch der Begriff „Pflichtstück“ ist gebräuchlich - so in der Pflichtstückverordnung<br />
zum Gesetz über Die Deutsche Bibliothek /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 505/ <strong>und</strong> im<br />
Pflichtstückegesetz von Bayern /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 535/. Vor 1945 wurden<br />
neben diesen auch die Begriffe „Freiexemplare“ (so im Reichspreßgesetz von<br />
1874) <strong>und</strong> „Freistücke“ (während der Weimarer Republik <strong>und</strong> des Nationalsozialismus)<br />
verwendet.<br />
„Unter <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> versteht man die durch Gesetze oder auf Gr<strong>und</strong> von<br />
Gesetzen geregelte Ablieferung von Druckerzeugnissen an Bibliotheken.“<br />
/Kirchner 1981, S. 178/ Solche Regelungen können neben Gesetzen Verordnungen,<br />
Anordnungen oder Richtlinien sein. In der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland existieren<br />
Pflichtexemplarregelungen auf B<strong>und</strong>esebene <strong>und</strong> in den einzelnen B<strong>und</strong>esländern.<br />
Auf einem Modellentwurf beruhend ist das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> überwiegend im §<br />
12 der Pressegesetze der Länder geregelt. Eigene, also autonome, Pflichtexemplar-<br />
bzw. Pflichtstück(e)gesetze gibt es auf B<strong>und</strong>esebene (seit 1969) <strong>und</strong> in den<br />
Ländern Baden-Württemberg (1976), Bayern (1986), Hamburg (1988), Nordrhein-<br />
Westfalen (1993) <strong>und</strong> Berlin (1994). Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> erfasst einerseits<br />
die ablieferungspflichtigen Verlage, Personen oder Institutionen <strong>und</strong> andererseits<br />
die empfangsberechtigten Bibliotheken. Der Abgabepflicht steht die Verpflichtung<br />
der empfangsberechtigten Bibliotheken gegenüber, die Pflichtexemplare zu ermitteln,<br />
zu sammeln, zu erschließen, zu archivieren <strong>und</strong> dem Benutzer zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
2.2 Kulturpolitischer Auftrag des Pflichtexemplars<br />
Das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht stellte 1981 in einem Gr<strong>und</strong>satzurteil den kulturpolitschen<br />
Auftrag des Pflichtexemplars heraus. Der Sinn der Pflichtablieferung<br />
besteht demnach darin, „die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich <strong>und</strong><br />
kulturell Interessierten möglichst geschlossen zugänglich zu machen <strong>und</strong> künftigen<br />
Generationen einen umfassenden Eindruck vom geistigen Schaffen früherer<br />
Epochen zu vermitteln.“ /Pohley, S. 10/ Es soll gewährleistet werden, dass an<br />
wenigstens einem Ort die Publikationen des betreffenden Landes bzw. einer Region<br />
vorhanden sind <strong>und</strong> für die Nachwelt erhalten werden.
- 10 -<br />
Pflichtexemplargesetze gibt es auch in den anderen Ländern. „Nach internationalem<br />
Verständnis ist die Pflichtablieferung eine entscheidende Voraussetzung für<br />
die Erfüllung der Kernaufgabe einer Nationalbibliothek: die Veröffentlichungen ihres<br />
Landes möglichst vollständig zu sammeln, zu erschließen, zu archivieren <strong>und</strong><br />
für die Benutzung bereitzuhalten.“ /Picard 1996, S. 149/ Dem entspricht die Aufgabe<br />
des modernen Pflichtexemplars auf Länderebene, bezogen auf sämtliche<br />
Publikationen eines Landes oder einer Region.<br />
Pflichtexemplare des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder ergänzen sich. Erstens werden die<br />
Bestände der Deutschen Bibliothek in Frankfurt <strong>und</strong> Leipzig nicht außer Haus verliehen,<br />
sie sind Präsenzbibliotheken. Die Pflichtexemplare der Länder stehen, sofern<br />
keine Benutzungsbeschränkungen vorliegen, zur Ausleihe zur Verfügung.<br />
Zweitens bestehen Abweichungen im Sammelumfang. Die einzelnen Länder <strong>und</strong><br />
der B<strong>und</strong> haben unterschiedliche Ausnahmen von der Ablieferungspflicht per Gesetz<br />
vorgesehen. Drittens können B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder von den Rechercheergebnissen<br />
des jeweils anderen profitieren. Viele Landesbibliotheken nutzten insbesondere<br />
die Deutsche Nationalbibliographie Reihe B für ihre Ermittlungstätigkeit. Andererseits<br />
bietet in den Ländern die räumliche Nähe der empfangsberechtigten Bibliotheken<br />
zu den Verlegern <strong>und</strong> publizierenden Institutionen den Vorteil, Literaturrecherchen<br />
ggf. effizienter durchführen zu können. Viertens hatte bis zur Deutschen<br />
Einheit 1990 das Argument, im Falle eines Pflichtexemplarverlustes sei<br />
gewährleistet, dass noch mindestens ein weiteres Exemplar für die Nachwelt <strong>und</strong><br />
eventuellen Ersatz (z. B. als Kopie) in einer weiteren Pflichtexemplarbibliothek<br />
vorhanden sei, durchaus seine Berechtigung. Das Gesetz über die Deutsche Bibliothek<br />
vom 31. März 1969, geändert durch Einigungsvertragsgesetz vom 31.<br />
August 1990 /Anlage 1/, schreibt nunmehr die Ablieferung je eines Stückes an die<br />
Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main <strong>und</strong> die Deutsche Bücherei in Leipzig<br />
vor. Somit werden schon allein auf B<strong>und</strong>esebene zwei Exemplare gesammelt.<br />
Es ist entscheidend zu wissen, „dass die Deutsche Bibliothek die Sammelentscheidungen<br />
nicht allein <strong>und</strong> isoliert auf nationaler Ebene getroffen hat <strong>und</strong> trifft.<br />
Sie steht vielmehr in ständigem Austausch mit den Pflichtexemplar-Bibliotheken<br />
der Länder. Die Kontakte reichen von individuellen Klärungen anfallender Probleme<br />
in Sammelfragen zwischen den einzelnen Landesbibliotheken <strong>und</strong> Der Deutschen<br />
Bibliothek über den Austausch von Titelinformationen zu den eingegangenen<br />
Pflichtstücken bis hin zu gemeinsamen gr<strong>und</strong>sätzlichen Überlegungen. Letztere<br />
haben zu zwei großen Symposien geführt, in denen Sammelprobleme <strong>und</strong><br />
Fragen zu Sammelaufgaben gemeinsam diskutiert <strong>und</strong> anzustrebende Sammelprofile<br />
beschlossen wurden.“ /Walter, S. 51/
- 11 -<br />
2.3 Landes- <strong>und</strong> andere Regionalbibliotheken<br />
2.3.1 Entstehung <strong>und</strong> Typologie<br />
Auf Länderebene haben die Verleger ein bis zwei Pflichtexemplare an die „regionalen<br />
Depotbibliotheken“ abzuliefern. /Syré 2000, S. 17/ Die klassischen Regionalbibliotheken<br />
sind die Landesbibliotheken, „in dem doppelten Sinne, dass sie<br />
vom Land unterhalten werden <strong>und</strong> zugleich das Land in seinen gegenwärtigen<br />
Grenzen wie in seinen historischen Erscheinungsformen als Zielpunkt ihrer Arbeit<br />
betrachten.“ /Dittrich 1998, S. 100/ Zu den Regionalbibliotheken werden auch<br />
Wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken gezählt.<br />
Die Landesbibliotheken gingen zumeist aus fürstlichen Hofbibliotheken hervor.<br />
Auch vor allem ältere Universitätsbibliotheken entstammen oft der gleichen Wurzel,<br />
einem fürstlichen Gründungsakt. „Wenn aus historischen Gründen oder Zufällen<br />
eine Landesbibliothek nicht vorhanden war, ergab es sich von selbst, dass<br />
eine Universitätsbibliothek die regionalen Aufgaben übernahm.“ /Dittrich 1998, S.<br />
101/<br />
Landesbibliotheken sind wissenschaftliche Universalbibliotheken, „die sich trotz<br />
Gemeinsamkeiten untereinander nach Herkunft, geschichtlicher Entwicklung,<br />
Größe des Buchbestandes, Benutzergruppen <strong>und</strong> -frequenz voneinander unterscheiden“.<br />
/Römer, S. 397/ Zu den Landesbibliotheken sind auch die Staatsbibliotheken<br />
zu zählen - mit Ausnahme der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz<br />
Berlin, die heute überwiegend überregionale Aufgaben wahrnimmt. Auch die<br />
Bayerische Staatsbibliothek München nimmt überregionale Funktionen wahr, fungiert<br />
aber gleichzeitig als zentrale Landesbibliothek für Bayern. Diese beiden Bibliotheken<br />
gehören zusammen mit Der Deutschen Bibliothek zu den Universalen<br />
Bibliotheken von überregionaler Bedeutung entsprechend der Funktionsstufe vier<br />
(hochspezialisierter Bedarf) im Bibliotheksnetz der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
/Bibliotheken, S. 50 - 53/<br />
Die Landes- <strong>und</strong> anderen Regionalbibliotheken nehmen zusammen mit den Bibliothekssystemen<br />
der Hochschulen <strong>und</strong> wissenschaftlichen Spezialbibliotheken<br />
arbeitsteilig die Aufgaben der Funktionsstufe drei (spezialisierter Bedarf) wahr.<br />
/Bibliotheken, S. 34/<br />
Regionalbibliotheken können unter unterschiedlicher Trägerschaft (z. B. Land,<br />
Stadt) stehen <strong>und</strong> verschiedene Bibliothekstypen verkörpern. Regionalbibliotheken<br />
sind sehr heterogen zusammengesetzt.<br />
Das Pflichtexemplar macht einen wesentlichen Bestandteil nicht aller Regionalbibliotheken,<br />
aber zumindest der Landesbibliotheken aus. „Es gibt nur wenige Landesbibliotheken,<br />
die auf das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> zu Gunsten anderer Landesbibliotheken<br />
verzichten müssen (Detmold, Oldenburg).“ In Einzelfällen sind Universitätsbibliotheken<br />
(Kiel, Mainz, München) oder Wissenschaftliche Stadtbibliothe-
- 12 -<br />
ken (Mainz, Trier) an der Sammlung von Pflichtexemplaren beteiligt. /Syré 2000,<br />
S. 17/<br />
2.3.2 Aufgaben<br />
Zu den Aufgaben der Bibliotheken der Funktionsstufe drei gehören insbesondere<br />
die Befriedigung des „spezialisierten Bedarfs an Information <strong>und</strong> Medien“, Unterstützung<br />
der Wirtschaft, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung, Sicherung <strong>und</strong> Nutzbarmachung<br />
von Überlieferungen, kulturelle Aufgaben. /Bibliotheken, S. 35/ Die Regionalbibliotheken<br />
versorgen die breiten Bevölkerungsschichten der Region mit Literatur,<br />
insbesondere mit außeruniversitärer. Befindet sich eine Universität oder Hochschule<br />
in der Nähe <strong>und</strong> erwirbt diese wissenschaftliche Literatur entsprechend ihrem<br />
Bibliotheksprofil, so leisten Regionalbibliotheken einen unverzichtbaren Beitrag<br />
auch zur universitären Literaturversorgung. Darüber hinaus haben Regionalbibliotheken<br />
für ihre Region (Land im politischen Sinn, Landesteil, historische<br />
Landschaft, Stadt <strong>und</strong> ihr Umfeld) weitere Aufgaben:<br />
• „Ermittlung, Sammlung, Erschließung, Archivierung <strong>und</strong> Bereitstellung der gesamten<br />
im Land erschienenen Literatur.“ (Pflichtexemplar) /Bibliotheken, S. 38/<br />
• Möglichst vollständige <strong>und</strong> fächerübergreifende Sammlung aller Schriften, die<br />
über die entsprechende Region erschienen sind bzw. einen sonstigen Bezug<br />
zur Region haben. Dazu gehören neben historischen <strong>und</strong> landesk<strong>und</strong>lichen<br />
auch naturwissenschaftliche Veröffentlichungen. „Der regionale Bezug ist ein<br />
fachüberschreitendes formales Sammelprinzip, das im Gr<strong>und</strong>e keine Ausnahmen<br />
duldet <strong>und</strong> auch minderwichtiges, ephemeres oder scheinbar wertloses<br />
Schrifttum durchaus einschließt.“ /Dittrich 1998, S. 102/ Aus dieser angestrebten<br />
Vollständigkeit ergibt sich der große wissenschaftliche <strong>und</strong> dokumentarische<br />
Wert, da nur an dieser einen Stelle eine so umfangreiche Sammlung zu<br />
einer Region besteht.<br />
• Der regionale Sammelauftrag umfasst darüber hinaus sämtliche „in Wort <strong>und</strong><br />
Schrift fixierten Leistungen auf wissenschaftlichem <strong>und</strong> künstlerischen Gebiet“,<br />
die die Region hervorgebracht hat. Dazu gehören auch Handschriften <strong>und</strong><br />
Nachlässe. Nach dem so genannten „Landeskinderprinzip“ werden alle Veröffentlichungen<br />
<strong>und</strong> Zeugnisse der Personen archiviert, die aus der Region<br />
stammen, hier einen Lebensabschnitt verbrachten oder anderweitig einen intensiven<br />
Bezug zur Region haben. /Dittrich 1998, S. 102/<br />
• In allen B<strong>und</strong>esländern erscheinen Regionalbibliographien - mit Ausnahme des<br />
Stadtstaates Bremen, der in der Niedersächsischen Bibliographie Berücksichtigung<br />
findet. Deren Zweck ist die Verzeichnung aller - von der Publikationsform<br />
unabhängigen - Neuerscheinungen über ein Land, seine Regionen <strong>und</strong> Orte<br />
sowie die mit dem Land verb<strong>und</strong>enen Persönlichkeiten. /Syré 2000, S. 17/ In<br />
den Ländern mit geteiltem <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> sind meist mehrere Regionalbibliotheken<br />
an der Erstellung der Regionalbibliographie beteiligt.
- 13 -<br />
• Eine zentrale Aufgabe der Regionalbibliotheken ist die Erschließung <strong>und</strong> Pflege<br />
des Altbestandes.<br />
Gemäß „Bibliotheksplan 73“ <strong>und</strong> „Bibliotheken 93“ sind die Regionalbibliotheken<br />
ein tragendes Element im Netz der überregionalen Literaturversorgung, z. B.<br />
durch die Teilnahme am regionalen <strong>und</strong> überregionalen Leihverkehr <strong>und</strong> ihre Wirkung<br />
als Leitbibliotheken.<br />
3 Entwicklung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s von den Anfängen<br />
bis zur Gegenwart<br />
3.1 Anfänge bis zum 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
3.1.1 Historische Wurzeln<br />
Das Bibliotheksexemplar war historisch überwiegend mit Zensur, aber auch Privilegienwesen<br />
<strong>und</strong> Urhebergesetzen gekoppelt. Denn es kann eine Zensur „ohne<br />
Vorlage der Werke nicht ausgeübt werden, ein Privileg verlangt eine Gegenleistung,<br />
der Urheberschutz bedarf der Aufbewahrung eines Kontrollstückes .“<br />
/Flemming, S. 9/) Dieser Zusammenhang war zwar häufig, aber nicht zwingend.<br />
Es gab schon frühzeitig Bestimmungen über die Ablieferung reiner Pflichtexemplare<br />
im heutigen Sinn. Demzufolge unterscheidet man vier Arten von Pflichtexemplaren:<br />
das Zensurexemplar, das Privilegienexemplar, das Urheberschutzexemplar<br />
<strong>und</strong> das Bibliotheks- bzw. Studienexemplar. /Raub, S. 11/ Das Bibliotheksexemplar<br />
ist das einzige Pflichtexemplar, das in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
der Gegenwart eine rechtliche Gr<strong>und</strong>lage hat.<br />
Zwei charakteristische Merkmale des gegenwärtigen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland beruhen auf historischen Ursachen:<br />
Zum einen hat das „föderativ angelegte deutsche Verfassungssystem . aus historischen<br />
Gründen eine Vielzahl von Pflichtexemplarbibliotheken hervorgebracht. „<br />
/Walter, S. 50/ <strong>und</strong> auch eine Vielzahl voneinander abweichender Länderregelungen.<br />
Zum anderen ist die historische Verknüpfung von Zensur <strong>und</strong> Pflichtexemplar die<br />
Ursache für die Verankerung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s in den Pressegesetzen,<br />
die sich in den meisten B<strong>und</strong>esländern bis heute erhalten hat, auch wenn der ursprüngliche<br />
Zusammenhang längst nicht mehr gegeben ist.<br />
3.1.2 Zensurexemplar<br />
Die Zensur, schon aus dem Altertum <strong>und</strong> Mittelalter bekannt, entfaltete sich besonders<br />
nach der Erfindung der Buchdrucks.<br />
Zunächst erließ die Kirche Zensurbestimmungen. Hier ist besonders die Präventivzensur<br />
zu nennen: der Zensor überprüfte ein Manuskript vor dem Druck auf<br />
seine „Rechtgläubigkeit usw.“ /Raub, S. 11/ <strong>und</strong> nach dem Druck die Einhaltung
- 14 -<br />
der Auflagen. Früheste Beispiele der kirchlichen Präventivzensur stammen aus<br />
dem Jahre 1475.<br />
Das Wormser Edikt von 1521 dagegen ist das früheste Beispiel staatlicher Zensur.<br />
Nach dieser Ächtungsurk<strong>und</strong>e Karls V. „sollten <strong>Luther</strong>s Bücher verbrannt<br />
werden, sprechen <strong>und</strong> streiten über sie war bei Strafe verboten. . Generell durfte<br />
„nichts Theologisches“ ohne Erlaubnis des Bischofs gedruckt werden. Das Wormser<br />
Edikt war die erste reichsrechtliche Presseverordnung.“ /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955,<br />
S. 17/ So diente die Pressegesetzgebung im Deutschen Reich im Zeitalter des<br />
Humanismus <strong>und</strong> der Reformation im wesentlichen dem Schutz der kirchlichen<br />
Lehre. Aber die zum Teil grausamen staatlichen <strong>und</strong> kirchlichen Zensurmaßnahmen<br />
konnten die Fortentwicklung der Presse weder in Deutschland noch in Frankreich<br />
oder England aufhalten. /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 20/ Die Durchführung der<br />
zahlreichen gesetzlichen Maßnahmen scheiterte immer wieder an der erstarkenden<br />
Selbstständigkeit der Territorialgewalten, die auf die Einnahmen aus dem<br />
Druckgewerbe nicht verzichten wollten. Auch die Errichtung einer Oberzensurbehörde<br />
in Frankfurt am Main im Jahre 1608 mit dem Ziel der staatlichen <strong>und</strong> kirchlichen<br />
Kontrolle von Buchhandel <strong>und</strong> Pressewesen konnte die Dezentralisation<br />
nicht mehr aufhalten. Die bestehenden Zensureinrichtungen wurden zu Organen<br />
der absoluten Landesfürsten. /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 18/ Während der Aufklärung<br />
war die Bevorm<strong>und</strong>ung durch die kirchlich-staatliche Pressezensur immer<br />
weniger mit der Überzeugung zu vereinbaren, dass zum Wesen des Menschen<br />
die Glaubens- <strong>und</strong> Gewissensfreiheit gehöre. Nach dem Zerfall der zentralen<br />
Reichsgewalt übten die autoritär regierenden Landesfürsten die Zensur mehr oder<br />
weniger liberal aus. Die Skala reichte von „harter Unterdrückung“ (so büßte der<br />
Dichter Schubart seine in der „Deutschen Chronik“ geübte Kritik an den politischen<br />
Verhältnissen in seiner Heimat Württemberg mit Kerkerhaft von 1777 -<br />
1787 auf der Festung Hohenasperg) über strenge Zensur (Preußen) bis zur „praktischen<br />
Pressefreiheit (Weimar, Mecklenburg)“. /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 23/<br />
Während das Verlangen nach Pressefreiheit immer größer wurde, wurde sie von<br />
Seiten der Mächtigen bekämpft, da Zeitungen <strong>und</strong> Zeitschriften von jeher eine<br />
große publizistische Wirkung hatten <strong>und</strong> man sich ihrer zur Durchsetzung politischer<br />
Interessen bediente. Auch der Militär- <strong>und</strong> Beamtenstaat Preußen wollte<br />
sich nicht der Kritik einer freien Presse stellen <strong>und</strong> hielt an der Zensur fest. Als<br />
1815 auf dem Wiener Kongress der aus dem alten deutschen Reich hervorgegangene<br />
Deutsche B<strong>und</strong> gegründet wurde, erfüllte sich die Hoffnung der souveränen<br />
deutschen B<strong>und</strong>esstaaten auf eine Reformierung des Presserechts nicht.<br />
/Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 23/ Die beiden führenden Länder Österreich <strong>und</strong> Preußen<br />
waren sich in streng gehandhabten Zensurfragen einig <strong>und</strong> strebten weiterhin<br />
nach Unterdrückung liberaler freiheitlicher Kräfte. Das änderte sich erst mit der<br />
Revolution von 1848. Per Beschluss vom 3. März 1848 stellte der Deutsche B<strong>und</strong><br />
jedem deutschen Staat die Aufhebung der Zensur frei. Art. 4 der Reichsverfas-
- 15 -<br />
sung vom 28. April 1849 proklamierte „die materielle <strong>und</strong> formelle Pressefreiheit“.<br />
/Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 25/ Sieben<strong>und</strong>zwanzig deutsche Staaten stimmten der<br />
Reichsverfassung zu, die auf dem Prinzip der konstitutionellen Erbmonarchie beruhte.<br />
Auch wenn die Revolution von 1848 letztendlich gescheitert ist, wurde die<br />
Zensur nicht wieder eingeführt. „Es schien nicht mehr möglich, die deutsche Öffentlichkeit<br />
in die politische Unmündigkeit zurückzustoßen, die Amerika vor siebzig,<br />
England vor mehr als h<strong>und</strong>ertfünfzig Jahren überw<strong>und</strong>en hatte. Die Pressefreiheit<br />
war neben der konstitutionellen Verfassungsform die bleibende Errungenschaft<br />
des Jahres 1848.“ /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 25/<br />
3.1.3 Privilegienexemplar<br />
Die Privilegienexemplare unterteilten sich nach so genannten Betriebsprivilegien<br />
<strong>und</strong> Verlagsprivilegien. Die Betriebsprivilegien wurden vom Landesherrn für den<br />
Gewerbebetrieb des Druckers <strong>und</strong> des Buchhändlers erteilt. Ein solches für einen<br />
Drucker ist aus dem Jahre 1469 bekannt. Die Verlagsprivilegien dienten dem<br />
Schutz gegen unberechtigten Nachdruck. Sie wurden für ein einzelnes Werk<br />
(Spezialprivileg) oder für alle Werke des Privilegierten (Generalprivileg) erteilt. Das<br />
früheste in Deutschland nachweisbare Verlagsprivileg erhielt Conrad Celtis für die<br />
Herausgabe der Werke von Hroswitha von Gandersheim im Jahre 1501.<br />
Auch die Privilegien waren häufig mit der Ablieferung von Büchern verb<strong>und</strong>en.<br />
Letztendlich gelangten nur wenige Zensur- oder Privilegienexemplare in Bibliotheken.<br />
Ein überliefertes Beispiel aus dem Jahre 1668 sind die Privilegienexemplare<br />
von Carpzows Werken an die Königliche Bibliothek zu Berlin.<br />
3.1.4 Urheberschutzexemplar<br />
Der Urheberschutz war jahrh<strong>und</strong>ertelang nur durch die Verlagsprivilegien gegeben.<br />
Erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelte sich ein allgemeiner<br />
Urheberrechtsschutz. /Raub, S. 12/ Der Landesherr hatte als Gegenleistung für<br />
den Urheberschutz Anspruch auf ein Freiexemplar. So hat sich die Abgabe des<br />
Urheberschutzexemplars „aus einem landesherrlichen Sonderprivileg entwickelt“.<br />
/Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 453/ Das Urheberschutzexemplar verlor seinen ursprünglichen<br />
Sinn, nachdem der Urheberrechtsschutz gesetzlich geregelt wurde.<br />
3.1.5 Bibliotheksexemplar<br />
Eine bayerische Verfügung aus dem Jahre 1663 gilt als „eine erste Regelung, die<br />
ausschließlich im Sinne des heutigen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s die unentgeltliche Ablieferung<br />
aller Druckartikel an die Hofbibliothek in München vorschreibt. /Kichner<br />
1981, S. 179/<br />
In Preußen sorgte ein Erlass des Kurfürsten Friedrich III. vom 26. Oktober 1699<br />
für eine Abgabe von 2 Exemplaren an die Königliche Bibliothek in Berlin. Allerdings<br />
wurde dieser von den Verlegern kaum befolgt. Ein umfassendes Pflichtex-
- 16 -<br />
emplargesetz erhielt Preußen erst am 28. September 1789. /Haas-Träger, S. 21/<br />
Ein Zensuredict vom 18. Oktober 1819 hob in § 15 die Pflichtablieferung wieder<br />
auf /Haas-Träger, S. 21/, doch schon fünf Jahre später wurde diese mit der Allerhöchsten<br />
Kabinettsorder über einige nähere die Zensur betreffende Bestimmungen<br />
des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. vom 28. Dezember 1824 erneut<br />
eingeführt. Die Kabinettsorder verlangt, „dass mit dem 1sten Januar 1825 . jeder<br />
Verleger wiederum schuldig seyn soll, zwei Exemplare jedes seiner Verlagsartikel,<br />
<strong>und</strong> zwar eins an die große Bibliothek hieselbst, das andere aber an die Bibliothek<br />
der Universität derjenigen Provinz, in welcher der Verleger wohnt, unentgeltlich<br />
einzusenden. Bei der Verpflichtung zur Abgabe eines Exemplars an den Zensor<br />
hat es sein Verbleiben.“ /Gesetz-Sammlung für die, S. 3/ Neu an dieser Kabinettsorder<br />
war, dass neben der Königlichen Bibliothek in Berlin die Universitätsbibliotheken<br />
der preußischen Provinzen ein Pflichtexemplar erhielten. Somit sollte<br />
gewährleistet werden, dass die Ablieferungspflicht „nicht allein dem Zweck, die<br />
Druckerzeugnisse auf ihre Geisteshaltung hin zu überprüfen, sondern der Kultur<strong>und</strong><br />
Wissenschaftspflege, der Förderung der kulturpolitischen Belange des<br />
Staatswesens“ diente. „Die Presseerzeugnisse sollten jedem . zugänglich gemacht<br />
werden <strong>und</strong> der gesamte Bestand des schöpferischen Wirkens der Epoche<br />
als Ganzes unversehrt <strong>und</strong> ungeschmälert der Nachwelt erhalten bleiben.“ /Haas-<br />
Träger, S. 21 - 22/ Es wurden „Motive erkennbar, die auf den Gedanken einer<br />
wissenschaftlichen Quellensicherung“ hinausliefen. /Dittrich 1998, S. 105/<br />
3.2 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bis 1945 unter besonderer Berücksichtigung<br />
der preußischen Provinz Sachsen <strong>und</strong> des Herzogtums<br />
bzw. Freistaates Anhalt<br />
3.2.1 Preußen<br />
Durch die Niederlage im Krieg gegen Frankreich 1806/07 verlor Preußen mehr als<br />
die Hälfte seines Territoriums: Nach der Schlacht bei Jena <strong>und</strong> Auerstedt floh der<br />
preußische König Friedrich Wilhelm III. nach Ostpreußen. Napoleon annektierte<br />
das preußische Territorium westlich der Elbe <strong>und</strong> bildete das Großherzogtum<br />
Warschau aus den polnischen Gebieten. Der Expansionskrieg Napoleons gegen<br />
Rußland endete für Frankreich mit einer Niederlage, die in der Völkerschlacht bei<br />
Leipzig 1813 besiegelt wurde. Auf dem Friedenskongreß in Wien 1814/15 wurde<br />
die Staatenordnung neu geregelt. Demnach bestand Preußen am 30. 4. 1815 aus<br />
zehn Provinzen: Ost- <strong>und</strong> Westpreußen, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg,<br />
Sachsen, Westfalen, Jülich-Kleve-Berg, Niederrhein. Ost- <strong>und</strong> Westpreußen<br />
waren von 1824 bis 1877 zur Provinz Preußen vereint, Jülich-Kleve-Berg <strong>und</strong><br />
Niederrhein ab 1822 zur Rheinprovinz. Also bestand Preußen im Jahr 1824 aus<br />
acht Provinzen, zu denen 1866 die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover <strong>und</strong><br />
Hessen-Nassau kamen. /Richter, S. 159/
- 17 -<br />
Die preußische Provinz Sachsen „wurde 1815 aus altpreußischem Besitz, insbesondere<br />
der Altmark, Magdeburg-Halle, Halberstadt, sowie aus den ehemaligen<br />
Gebieten des Königreichs Sachsen, die beim Wiener Kongress 1815 Preußen an<br />
sich genommen hatte, nämlich aus den Gebieten Wittenberg, Torgau, Merseburg,<br />
Naumburg, Nordthüringen, gebildet. Dazu kamen noch die früher mainfränkischen<br />
Territorien Erfurt <strong>und</strong> Eichsfeld.“ /Richter, S. 151/ Verwaltungsmäßig<br />
gliederte sich die Provinz in die Regierungsbezirke Magdeburg, Merseburg <strong>und</strong><br />
Eichsfeld. Die Hauptstadt war Magdeburg, jedoch konnte sie sich nicht zu einer<br />
starken Provinzialhauptstadt entwickeln. Die Konkurrenz von Halle/Saale - immerhin<br />
im Besitz der 1694 durch Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg gegründeten<br />
Universität <strong>und</strong> des Oberbergamtes - war zu groß. /Richter, S. 151/<br />
Auch in der preußischen Provinz Sachsen galt also die o. g. Kabinettsorder von<br />
1824. Sie sei die „Geburtsst<strong>und</strong>e des halleschen Pflichtexemplars“. /Langer, S.<br />
187/ Die empfangsberechtigte Bibliothek für die Provinz Sachsen war die Universitätsbibliothek<br />
in Halle/Saale. Auf Gr<strong>und</strong> eines Verwaltungsfehlers kam die entsprechende<br />
Bekanntmachung - die namentliche Nennung der Universitätsbibliothek<br />
Halle - mit fünfzehnmonatiger Verspätung in das Merseburger Amtsblatt, so<br />
dass die „Freistücke“ erst ab 1826 in Halle abgeliefert wurden. /Langer, S. 187/<br />
Das preußische Gesetz über die Presse vom 2. Mai 1851 bestätigte im § 6 die<br />
„bisherige Verpflichtung des Verlegers, zwei Exemplare seiner Verlagsartikel, <strong>und</strong><br />
zwar eins an die Königliche Bibliothek in Berlin, das andere an die Bibliothek der<br />
Universität derjenigen Provinz, in welcher er wohnt, unentgeltlich einzusenden .“<br />
/Gesetz-Sammlung für die, S. 2/ Demzufolge galt für die preußischen Provinzen<br />
als staatliche Verwaltungsbezirke ohne politische Autonomie die Kabinettsorder<br />
von 1824 fort. Nicht aber für die Provinzen, die 1866 dem preußischen Staatsverband<br />
eingegliedert wurden, also Hannover, Hessen-Nassau <strong>und</strong> Schleswig-<br />
Holstein. Denn die Bestimmungen von 1851 wurden nicht auf diese Gebiete ausgeweitet.<br />
So galten für diese Provinzen die alten gesetzlichen Bestimmungen -z.<br />
B. Hannover: Bekanntmachung vom 19. März 1828 <strong>und</strong> Schleswig-Holstein: Verfügung<br />
vom 10 Januar 1781 <strong>und</strong> Patent vom 18. Mai 1822. /Karstedt, S. 60 - 61/)<br />
Letztlich verfügten im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert alle deutschen Staaten über Gesetze zur<br />
Abgabe von Bibliotheksexemplaren, meist ohne Nebenzweck (z. B. Württemberg<br />
1817, Hessen 1836, Bayern 1865). In einigen Ländern bestand jedoch noch eine<br />
Ablieferungspflicht aus Zensurgründen, das galt „z. B. für Sachsen, Baden <strong>und</strong><br />
beide Mecklenburg“ /Flemming, S. 21/.<br />
3.2.2 Anhalt<br />
Anhalt war ein zwischen Fläming <strong>und</strong> Unterharz gelegenes Land des ehemaligen<br />
Deutschen Reiches (bis 1806) mit der Hauptstadt Dessau. Das Fürstentum der<br />
Askanier zerfiel infolge Erbteilungen. 1806/07 wurden die anhaltinischen Herzogtümer<br />
Bernburg, Dessau <strong>und</strong> Köthen gebildet, die bis 1813 zum Rheinb<strong>und</strong> ge-
- 18 -<br />
hörten. Die Herzogtümer wurden 1863 zum Herzogtum Anhalt vereinigt. 1867 trat<br />
Anhalt dem neu gegründeten Norddeutschen B<strong>und</strong> bei. Von 1918 bis 1933 war<br />
Anhalt Freistaat, von 1933 bis 1945 mit Braunschweig vereinigt. /Richter, S. 152/<br />
1877 wurde durch Zusammenlegung verschiedener Bernburger <strong>und</strong> Dessauer<br />
Sammlungen die Herzoglich-Anhaltische Behördenbibliothek gegründet <strong>und</strong> 1922<br />
zur Anhaltischen Landesbücherei erweitert. Diese war berechtigt, Freistücke zu<br />
empfangen, zuletzt geregelt im Gesetz über die Verpflichtung der Verleger zur unentgeltlichen<br />
Abgabe von Freistücken ihrer Verlagsartikel vom 5. Mai 1926.<br />
/Gesetzsammlung für Anhalt, S. 24/<br />
3.2.3 Deutsches Kaiserreich ab 1871<br />
1871 entstand das Deutsche Kaiserreich aus dem 1867 gegründeten Norddeutschen<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den süddeutschen Staaten. Es erscholl der Ruf nach einem einheitlichen<br />
deutschen Presserecht, das die 27 bestehenden Landespressegesetze<br />
ersetzen sollte. /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 30/ Dennoch blieb sowohl das bestehende<br />
Landesrecht als auch die Zuständigkeit der Länder für spätere Gesetzgebung<br />
erhalten. Das am 7. Mai 1874 verabschiedete Reichspreßgesetz (RPG) überließ<br />
den Ländern in § 30, Abs. 3 die Regelung der „Abgabe von Freiexemplaren an Bibliotheken<br />
<strong>und</strong> öffentliche Sammlungen“. /Franke, S. 188/ Nur die Ablieferung<br />
amtlicher Druckschriften durch Behörden <strong>und</strong> Dienststellen des Reichs wurde<br />
zentral geregelt. /Flemming, S. 22/ Das Reichspreßgesetz hob die Zensur weitgehend<br />
auf. Allerdings schrieb § 9 die unentgeltliche Abgabe einer periodischen<br />
Druckschrift „an die Polizeibehörde des Ausgabeortes“ vor, ausgenommen hiervon<br />
wären jedoch „Druckschriften, welche ausschließlich Zwecken der Wissenschaft,<br />
der Kunst, des Gewerbes oder der Industrie dienen.“ /Franke, S. 107/)<br />
Auch auf nationaler Ebene existierte kein „gesamtdeutsches einheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>,<br />
das vor allem die zentrale Sammlung des gesamten Schrifttums in<br />
einer „Nationalbibliothek“ festlegt.„ /Kapsers 1961, S. 374/ Kapsers bezeichnet die<br />
Bayerisches Staatsbibliothek in München <strong>und</strong> die Preußische Staatsbibliothek in<br />
Berlin „als einen gewissen Ausgleich“, da sich die Bestände der beiden größten<br />
deutschen Länder zu erheblichen Teilen aus den jeweiligen Pflichtexemplarregelungen<br />
heraus rekrutierten. 1912 kam die Deutsche Bücherei in Leipzig hinzu, an<br />
die ab 1913 deutsche Verleger auf freiwilliger Basis Pflichtexemplare ablieferten.<br />
Sie war vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig mit Unterstützung<br />
der Stadt Leipzig <strong>und</strong> des Königreichs Sachsen gegründet worden. /Busse,<br />
S. 66/<br />
3.2.4 Weimarer Republik <strong>und</strong> Nationalsozialismus<br />
Im Zusammenhang mit Bestrebungen um eine deutsche Nationalbibliothek erhielt<br />
im Jahre 1935 die Deutsche Bücherei in Leipzig einen rechtlichen Anspruch auf
- 19 -<br />
das gesamte deutsche Schrifttum per „pflichtexemplarähnlicher Anordnung der<br />
Reichskulturkammer“. /Raub, S. 53/<br />
Es gab „nach 1933 Streben nach einer einheitlichen Bibliotheksverwaltung im<br />
Reich: 1936 Begründung des Reichsbeirats für Bibliotheksangelegenheiten.<br />
Planmäßige Schließung der Lücken in der Pflichtexemplargesetzgebung“<br />
/Vorstius, S. 94/ Meist autonome (!) Gesetze über die Abgabe von Freistücken<br />
waren bereits oder wurden noch erlassen:<br />
• Anhalt: Gesetz über die Verpflichtung der Verleger zur unentgeltlichen Abgabe<br />
von Freistücken ihrer Verlagsartikel vom 5. Mai 1926<br />
• Land Bremen: Gesetz, betreffend die Abgabe von Freistücken der Druckwerke<br />
an die Staatsbibliothek vom 25. Juli 1933<br />
• Hamburg: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der Druckwerke an die<br />
Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek Hamburg vom 8. August 1934<br />
• Thüringen: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der Druckwerke an die<br />
Universitätsbibliothek in Jena vom 18. Oktober 1935; Ausführungsvorschriften<br />
1936<br />
• Baden: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der im Lande Baden erscheinenden<br />
oder daselbst zum Druck gelangten Druckwerke an die badische Landesbibliothek<br />
vom 27. Februar 1936; Landesgesetz über die Abgabe von<br />
Freistücken der im Lande Baden erscheinenden oder daselbst zum Druck gelangten<br />
Druckwerke an die Universitätsbibliothek Freiburg vom 6. August 1948<br />
• Hessen: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der Druckwerke an die Landesbibliothek<br />
Darmstadt vom 3. Mai 1937<br />
• Sachsen: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der Druckwerke an die<br />
Landesbibliothek in Dresden <strong>und</strong> die Universitätsbibliothek in Leipzig vom 3.<br />
Februar 1938; Durchführungsverordnung 1938 <strong>und</strong> 1948<br />
• Mecklenburg: Gesetz über die Abgabe von Freistücken der Druckwerke an die<br />
Universitätsbibliothek in Rostock <strong>und</strong> die Landesbibliothek in Schwerin vom 17.<br />
Juni 1938<br />
Außerdem in Ergänzung zum Presserecht in:<br />
• Bayern: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht<br />
<strong>und</strong> Kultus über die Ablieferung von Verlagsstücken vom 29. Januar 1927<br />
• Württemberg: Verordnung des Kultusministeriums über die Abgabe von<br />
Schriften an die Landesbibliothek in Stuttgart vom 24. Juni 1931<br />
• Pfalz: Entschließung der Provinzialregierung Pfalz vom 5. Mai 1947 /Will 1955,<br />
S. 120 - 165/<br />
Auch im „Dritten Reich“ wurde kein reichseinheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> geschaffen.<br />
Der Entwurf eines Reichspflichtexemplargesetzes von 1938 durch die<br />
Reichsschrifttumskammer wurde nicht geltendes Recht. /Will 1955, S. 13/
3.3 1945 bis heute<br />
- 20 -<br />
3.3.1 Sowjetische Besatzungszone <strong>und</strong> DDR am Beispiel Sachsen-<br />
Anhalts<br />
3.3.1.1 Geschichte der Verwaltungseinheit Sachsen-Anhalt<br />
Das Land Sachsen-Anhalt ist keine historisch gewachsene, sondern eine erst<br />
nach dem Krieg geschaffene Verwaltungseinheit. Teile der preußischen Provinz<br />
Sachsen (Magdeburg, Halle-Merseburg) <strong>und</strong> der Freistaat Anhalt wurden 1945 zur<br />
Provinz Sachsen-Anhalt vereint. In rechtsstaatlicher Hinsicht sei auf die uneinheitliche<br />
Rechtsentwicklung in Gesetzgebung, Rechtsprechung <strong>und</strong> Verwaltung der<br />
preußischen Provinz Sachsen <strong>und</strong> des Herzogtums/Freistaats Anhalt hingewiesen.<br />
Es wurden Regionen mit sächsischer - in den zwangsweise abgetretenen<br />
sächsischen Gebieten von 1815 - <strong>und</strong> preußischer Vergangenheit vereint. Im Herzogtum<br />
Anhalt waren „auch eigene Gedanken in rechtlicher Hinsicht vorhanden“,<br />
jedoch gab es eine starke Anlehnung an Preußen. /Richter, S. 152/<br />
Im Juli 1945 bestätigte die Sowjetische Militäradministration (SMAD) die Verwaltungen<br />
<strong>und</strong> ihre Präsidenten in den Ländern Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern<br />
<strong>und</strong> Thüringen sowie in den Provinzen (seit 21. 7. 1947 Länder) Brandenburg <strong>und</strong><br />
Sachsen-Anhalt. Am 22. Oktober 1945 bevollmächtigte die SMAD die Landes<strong>und</strong><br />
Provinzialverwaltungen, Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen zu erlassen.“ /Lehmann,<br />
Hans Georg, S. 32/ Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland beschloß per Gesetz<br />
vom 25. Februar 1947 die Auflösung des Staates Preußen, da Preußen „seit jeher<br />
Träger des Militarismus <strong>und</strong> der Reaktion in Deutschland gewesen“ sei.<br />
/Lehmann, Hans Georg, S. 23/ Am 20. März 1948 stellte die Sowjetunion ihre Arbeit<br />
im Alliierten Kontrollrat ein, der nicht wieder zusammentrat. /Lehmann, Hans<br />
Georg, S. 49/<br />
Im Zuge der Verwaltungsreform von 1952 gingen aus dem Land Sachsen-Anhalt<br />
die Bezirke Halle <strong>und</strong> Magdeburg mit den gleichnamigen Bezirksstädten hervor,<br />
die aber in ihren Grenzen nicht völlig identisch mit dem ehemaligen Land verliefen.<br />
Einige Regionen im Südosten des Landes wurden aus ökonomischen Gründen<br />
den Bezirken Leipzig <strong>und</strong> Cottbus angegliedert.<br />
Am 25. März 1954 erklärte die Sowjetunion die DDR für souverän. Nun konnte die<br />
DDR nach eigenem Ermessen über innere <strong>und</strong> äußere Angelegenheiten entscheiden.<br />
/Lehmann, Hans Georg, S. 87/]<br />
3.3.1.2 Die sachsen-anhaltischen Landesbibliotheken <strong>und</strong> das Pflichtexemplar<br />
Im Gegensatz zu den benachbarten Ländern Sachsen, Thüringen <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern<br />
besaß Sachsen-Anhalt keine Landesbibliothek. Die Anhaltische<br />
Landesbibliothek Dessau war im 2. Weltkrieg stark zerstört worden, ebenso eine
- 21 -<br />
andere wissenschaftliche Bibliothek in Sachsen-Anhalt - die Stadtbibliothek in<br />
Magdeburg. Die Universitätsbibliothek Halle dagegen hatte kaum Kriegsverluste<br />
zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden ihr im Zuge der Bodenreform beträchtliche<br />
Bestände zugeführt.<br />
Die im Herbst 1946 durch die SMAD erlassenen Befehle bestätigten das seit 1824<br />
(de facto 1826) für die preußische Provinz Sachsen geltende <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
im Wesentlichen <strong>und</strong> bezogen es auf die Provinz bzw. das Land Sachsen-Anhalt.<br />
Nach dem Befehl der SMAD Nr. 262 vom 2. September 1946 mussten vorübergehend<br />
die Druckwerke aus der gesamten Sowjetischen Besatzungszone neben<br />
anderen Dienststellen <strong>und</strong> Bibliotheken auch an die Universitätsbibliothek Halle in<br />
einem Exemplar - allerdings gegen Entgelt - abgeliefert werden. /Gesetzblatt, S.<br />
402/ Diesen Befehl löste wenige Wochen später der Befehl der SMAD Nr. 356<br />
vom 24. Dezember 1946 ab, der die kostenlose Pflichtabgabe wieder auf die Provinz<br />
beschränkte. /Verordnungsblatt, S. 4 - 5/<br />
Im Jahre 1948 wurden der Universitätsbibliothek Halle als der größten <strong>und</strong> am besten<br />
erhaltenen Bibliothek in Sachsen-Anhalt von der Landesregierung Sachsen-<br />
Anhalt die zusätzlichen Aufgaben einer Landesbibliothek zugewiesen. Dem vorausgegangen<br />
war ein Bericht <strong>und</strong> Vorschlag des damaligen Bibliotheksdirektors<br />
Dr. Horst Kunze an die Landesregierung über die Erweiterung der Universitätsbibliothek<br />
zur Landesbibliothek. /Scheschonk, S. 77/ Kunze brachte u. a. folgende<br />
Argumente vor: das seit 1824 zugestandene Pflichtexemplar, die Ponickau-<br />
Bibliothek, der Sitz der Bibliothek in der Landeshauptstadt, der relativ geringe<br />
Personal- <strong>und</strong> Sachaufwand. /Scheschonk, S. 23/ Von Ponickau war ein sächsischer<br />
Kriegsrat gewesen, dessen kostbare Sammlung mit etwa 10 000 Bänden<br />
<strong>und</strong> 15 000 kleinen Schriften zur sächsisch-thüringischen Geschichte <strong>und</strong> Landesk<strong>und</strong>e<br />
über Umwege 1823 nach Halle kam. /Kunze 1949, S. 7/ Minister <strong>und</strong><br />
Rektor der halleschen Universität stimmten der Erweiterung unter der Bedingung<br />
zu, dass die Bibliothek ihrer bisherigen Funktion als Universitätsbibliothek hinsichtlich<br />
Forschung <strong>und</strong> Lehre auch weiterhin uneingeschränkt gerecht werde.<br />
In der 18. Kabinettsitzung der Landesregierung am 26. Mai 1948 wurde die Errichtung<br />
einer Landesbibliothek als selbstständige Institution, die der Universitätsbibliothek<br />
in Halle angegliedert werden sollte, unter der Bezeichnung „Universitäts-<br />
<strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle/S.“ beschlossen. Die Rechtsstellung<br />
der Universitätsbibliothek unter die Universität sollte beibehalten werden,<br />
der Teil Landesbibliothek unmittelbar dem Volksbildungsministerium Sachsen-<br />
Anhalts unterstellt werden. Kunze bekräftigte in seiner Rede anlässlich der feierlichen<br />
Eröffnung am 16. Juli 1948, dass sich die Aufgaben einer Universitätsbibliothek<br />
<strong>und</strong> einer Landesbibliothek nicht störten, sondern sich gegenseitig ergänzten.<br />
/Scheschonk, S. 23/<br />
Hatte die alte Universitätsbibliothek Halle auch schon lange die Sammlung landesk<strong>und</strong>lichen<br />
<strong>und</strong> landesgeschichtlichen Schrifttums zu verschiedenen Zeiten in
- 22 -<br />
unterschiedlicher Intensität gepflegt, so bestand für die neue Universitäts- <strong>und</strong><br />
Landesbibliothek nun die Verpflichtung, sowohl in Sachsen-Anhalt herausgegebene<br />
Literatur aufgr<strong>und</strong> der Pflichtexemplargesetzgebung als auch Schrifttum über<br />
Sachsen-Anhalt zu sammeln, zu erschließen <strong>und</strong> zu bewahren. „Daneben hat eine<br />
Landesbibliothek allgemeine Bildungsaufgaben zu erfüllen. Aber gerade die<br />
Vereinigung der Arbeit einer Landesbibliothek mit der einer Universitätsbibliothek<br />
bietet die beste Gewähr für eine zweckmäßige <strong>und</strong> sinnvolle Verbindung von Bildungsaufgaben<br />
<strong>und</strong> Wissenschaftsaufgaben.“ /Kunze 1949, S. 17/<br />
Nach der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 <strong>und</strong> der Auflösung der SMAD<br />
am 10. Oktober 1949 - diese übertrug die Verwaltungsfunktionen an die DDR-<br />
Regierung - ging die Pflichtexemplarregelung an die deutschen Dienststellen über.<br />
Es folgten provisorische Regelungen in den Jahren 1951 <strong>und</strong> 1953. /Kunze 1976,<br />
S. 161/<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Verordnung über die Neuorganisation des Hochschulwesens<br />
vom 22. Februar 1951 erfolgte die Unterstellung der großen wissenschaftlichen<br />
Bibliotheken unter das Staatssekretariat für Hochschulwesen unter der Herauslösung<br />
aus dem Zuständigkeitsbereich der Länder. Das war ein Bruch mit aller<br />
Tradition <strong>und</strong> zugleich eine beachtliche Zentralisierung als Voraussetzung für die<br />
einheitliche staatliche Organisierung dieses Bibliothekszweiges. Damit hatte das<br />
doppelte Unterstellungsverhältnis der ULB Halle (Universität <strong>und</strong> Volksbildungsministerium<br />
von Sachsen-Anhalt) ein Ende. /Scheschonk, S. 30/<br />
Auch nach der Verwaltungsreform von 1952 blieb das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> für die<br />
Bezirke Halle <strong>und</strong> Magdeburg bei der halleschen Bibliothek.<br />
1957 verlor die Anhaltische Landesbücherei Dessau ihre Selbstständigkeit <strong>und</strong><br />
wurde eine Zweigstelle der ULB Halle. Im Zuge der Hochschulreform wurde sie<br />
1969 mit der 1898 gegründeten kommunalen öffentlichen Bibliothek „verwaltungstechnisch<br />
in der Trägerschaft der Stadt Dessau zusammengelegt“.<br />
/Schneider, S. 214/<br />
Mit der Gründung des Arbeitskreises der Landesbibliotheken 1965 erhielt die ULB<br />
entscheidende Impulse <strong>und</strong> begann noch im selben Jahr - als letzte Landesbibliothek<br />
der DDR - die Regionalbibliographie zu erarbeiten <strong>und</strong> herauszugeben.<br />
Dabei wurde selbstständig <strong>und</strong> unselbstständig erschienene landesk<strong>und</strong>liche Literatur<br />
erfasst. Die selbstständig erschienene Literatur war bis zu diesem Zeitpunkt<br />
in die Ponickausche Sammlung eingearbeitet <strong>und</strong> in ihrem Katalog verzeichnet<br />
worden. Die Bibliographie erschien alle zwei Jahre unter dem Titel „Sachsen-<br />
Anhalt : Regionalbibliographie für die Bezirke Halle <strong>und</strong> Magdeburg“.<br />
/Scheschonk, S. 45/<br />
(Die Regionalbibliographie wird heute unter dem Titel: „Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie“<br />
veröffentlicht.)
- 23 -<br />
3.3.1.3 Staatlich geregeltes einheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
Die Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Entwicklung fortschrittlicher<br />
Literatur - Pflichtexemplare vom 1. September 1955 traf entscheidende<br />
Bestimmungen zur Ablieferung von Pflichtexemplaren. /Kunze 1976, S. 161/<br />
Sie wurde 1960 ersetzt durch ein staatlich geregeltes einheitliches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>,<br />
nämlich durch die Anordnung (Nr. 1) über die Ablieferung von Pflichtexemplaren<br />
vom 4. Juli 1960. /Rechts-ABC, S. 260 - 262/ Die Anordnung schrieb die<br />
zentrale Abgabe sämtlicher Druckerzeugnisse der DDR aus der Verlagsproduktion<br />
an die Deutsche Bücherei Leipzig (2 Exemplare), die Deutsche Staatsbibliothek<br />
Berlin (1 Exemplar) <strong>und</strong> das Ministerium für Kultur („Exemplar lt. Lizenzurk<strong>und</strong>e“)<br />
vor. Für Druckerzeugnisse außerhalb der Verlagsproduktion bestand Ablieferungspflicht<br />
von je einem Exemplar an die Deutsche Bücherei, Die Deutsche<br />
Staatsbibliothek <strong>und</strong> „die die Druckgenehmigung erteilende Stelle; außerdem an<br />
das Deutsche Zentralarchiv von amtlichen Druckschriften, die nicht für die Öffentlichkeit<br />
bestimmt sind“. /Rechts-ABC, S. 260/ Weiterhin war unter anderem auch<br />
die zentrale Ablieferung der Buchproduktion an die zuständige Landesbibliothek<br />
bzw. Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek vorgeschrieben - geregelt per Anordnung<br />
Nr. 2 vom 10. November 1970. Die neue Fassung der Anordnung nahm<br />
Bezug auf die „Veränderungen in der regionalen Bibliotheksstruktur der DDR“, die<br />
sich infolge der Bibliotheksverordnung vom 31. Mai 1968 ergeben hatte. /Rechts-<br />
ABC, S. 262/ Je nach Erscheinungsort der Pflichtexemplare war je ein Exemplar<br />
an folgende Bibliotheken abzuliefern:<br />
• Nationale Forschungs- <strong>und</strong> Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur<br />
in Weimar, Zentralbibliothek der Deutschen Klassik (aus den Bezirken<br />
Erfurt, Gera, Suhl)<br />
• Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (aus den Bezirken Halle,<br />
Magdeburg)<br />
• Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek Potsdam (aus den Bezirken Potsdam,<br />
Cottbus, Frankfurt/Oder)<br />
• Sächsische Landesbibliothek Dresden (aus den Bezirken Dresden, Leipzig,<br />
Karl-Marx-Stadt)<br />
• Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek Schwerin (aus den Bezirken Schwerin,<br />
Rostock, Neubrandenburg)<br />
• Berliner Stadtbibliothek (aus Berlin, Hauptstadt der DDR) /Rechts-ABC, S. 262<br />
- 263/<br />
3.3.2 B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
3.3.2.1 Erste Nachkriegsjahre<br />
Nach dem Kriege galten die bestehenden Pflichtexemplarregelungen der einzelnen<br />
Länder - so auch die Kabinettsorder von 1824 in den (ehemaligen) preußi-
- 24 -<br />
schen Provinzen - zunächst fort. Das Reichspreßgesetz von 1874 hatte ja den<br />
Ländern die Hoheit über die Pflichtexemplar-Regelungen überlassen.<br />
Die Ablieferung der Pflichtexemplare von alteingesessenen Verlagen erfolgte<br />
auch in den ersten Nachkriegsjahren, soweit das in dem zerstörten <strong>und</strong> ausgebluteten<br />
Land möglich war. „. Schwieriger konnte es werden, wenn man erstmals<br />
an Selbstverleger oder neu in NW etablierte Verlage herantreten <strong>und</strong> unter Hinweis<br />
auf die Kabinettsorder von 1824 Pflicht-Exemplare anfordern musste.“ /Raub,<br />
S. 63/<br />
Mit dem Erlass des Gr<strong>und</strong>gesetzes am 23. Mai 1949 <strong>und</strong> der Gründung der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland im September 1949 kamen Zweifel auf, ob § 30 RPG<br />
<strong>und</strong> die landesrechtlichen Pflichtexemplarvorschriften noch geltendes Recht sind.<br />
„Die damalige rechtliche Regelung .“ konnte jedoch „ . nicht mehr mit den Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
des modernen Rechtsstaates in Einklang stehend angesehen werden.“<br />
/Kirchner 1961, S. 382/ Das Presserecht war erneuerungsbedürftig <strong>und</strong> so kam<br />
es, dass es in der Nachkriegszeit von verschiedenen Ländern teilweise außer<br />
Kraft gesetzt wurde. Als einziges Land hatte Hessen am 23. Juni 1949 sogar ein<br />
neues - das Hessische Gesetz über Freiheit <strong>und</strong> Recht der Presse - verabschiedet.<br />
Doch zunächst - seit dem 21. September 1949 - galt das Gr<strong>und</strong>gesetz Nr. 5 der<br />
Alliierten Hohen Kommission über Presse, R<strong>und</strong>funk, Berichterstattung <strong>und</strong> Unterhaltungsstätten.<br />
Als Besatzungsrecht ging es dem Gr<strong>und</strong>gesetz vor. /Will, S.<br />
66/ Im April 1949 war an die Stelle der Militärregierung (USA, Großbritannien <strong>und</strong><br />
Frankreich) die zivile Alliierte Hohe Kommission getreten. Den Besatzungsbehörden<br />
blieb das Recht, die Gesetzgebung, Verwaltung u. a. zu kontrollieren. Die<br />
Überwachung der B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Ländergesetzgebung endete 1951 /Lehmann,<br />
Hans Georg, S. 65/, das „Besatzungsregime“ 1954. Damit erlangte die BRD weitestgehend<br />
Souveränität. /Lehmann, Hans Georg, S. 84/<br />
Während der Geltungsdauer des Besatzungsrechts stand „die kostenlose Ablieferung<br />
von Pflichtexemplaren . nicht im Widerspruch zu Art. 14 GG .“ /Will, S. 66/<br />
3.3.2.2 Entstehung der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek war bereits im Jahre 1946 „auf verlegerische <strong>und</strong> bibliothekarische<br />
Initiative mit Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main <strong>und</strong> mit Zustimmung<br />
der US-amerikanischen Militärregierung“ gegründet worden. Das war<br />
notwendig geworden auf Gr<strong>und</strong> der „Abschnürung der einzelnen Besatzungszonen<br />
in der ersten Zeit der alliierten Besetzung Deutschlands seit dem Frühjahr<br />
<strong>und</strong> Sommer 1945, durch die der Buchhandel . in seinen Aktivitäten empfindlich<br />
eingeengt <strong>und</strong> eine nationalbibliothekarische <strong>und</strong> nationalbibliographische Arbeit<br />
vom sowjetisch besetzten Leipzig aus unmöglich gemacht wurde.“ /Busse, S. 66 -<br />
68/ Die Sammlung beruhte auf freiwilliger Ablieferung west- <strong>und</strong> auch ostdeutscher<br />
Verlage. (Diese Zusammensetzung der Sammlung trifft im Gegenzug auch
- 25 -<br />
auf die Deutsche Bücherei Leipzig zu.) Erst 1969 wurde die zentrale Pflichtexemplarabgabe<br />
an die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main per Gesetz über die<br />
Deutsche Bibliothek vom 31. 3. 1969 geregelt, eine Pflichtstückverordnung kam<br />
1982 hinzu. Im Jahre 1970 entstand „durch b<strong>und</strong>esgesetzlichen Auftrag in Berlin<br />
(West)“ das Deutsche Musikarchiv. /Busse, S. 68/<br />
3.3.2.3 Bemühungen um ein neues <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
Der Verein Deutscher Bibliothekare forderte ein B<strong>und</strong>esrahmengesetz, um die<br />
Rechtsungleichheit innerhalb des B<strong>und</strong>esgebietes zu beenden. /Denkschrift, S.<br />
375/ Eine zu diesem Zwecke im Jahre 1959 auf der Innenministerkonferenz der<br />
B<strong>und</strong>esländer eingesetzte Kommission, die einen Musterentwurf eines Landespressegesetzes<br />
entwerfen sollte, scheiterte an so gr<strong>und</strong>sätzlichen Fragen wie<br />
der Rechtmäßigkeit der Pflichtablieferung. Die oben zitierte Denkschrift wurde im<br />
September 1960 den Kultusministern der Länder <strong>und</strong> Senatoren der Stadtstaaten<br />
übersandt. Auch wenn das Presserecht den Innenministerien unterstand, so waren<br />
doch die Bibliotheken ein Ressort der Kultusminister <strong>und</strong> wurden im speziellen<br />
Fall als Ansprechpartner gewählt. Diese Entscheidung erwies sich im Nachhinein<br />
als erfolgreich, denn letztendlich konnte die inzwischen ebenfalls angedachte Aufhebung<br />
des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s abgewendet werden. /Kirchner 1961, S. 386/<br />
Seit dem Bestehen der B<strong>und</strong>esrepublik regelten die Länder das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
neu, jedoch nicht wie zwischen 1926 <strong>und</strong> 1948 selbständig, sondern als<br />
Teile der Pressegesetze. Diese zumeist aus der Zeit der faschistischen Machtübernahme<br />
stammenden autonomen <strong>und</strong> unpolitischen Gesetze galten als suspekt.<br />
/Barton 1990, S. 223/ Hessen hatte ja bereits 1949 das Hessische Gesetz<br />
über Freiheit <strong>und</strong> Recht der Presse erlassen. In den Ländern Baden-<br />
Württemberg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland,<br />
Rheinland-Pfalz, dem Land Berlin <strong>und</strong> Nordrhein-Westfalen wurden seit 1964<br />
nacheinander neue Pressegesetze verabschiedet, die sämtlich auf einem<br />
Modellentwurf eines Landespressegesetzes beruhten, welches von der Ständigen<br />
Konferenz der Innenminister der B<strong>und</strong>esländer in den Jahren 1959 bis 1963 ausgearbeitet<br />
wurde. /Will 1968, S. 279/ Dieser Modellentwurf war mit Rücksicht auf<br />
die verfassungsrechtlichen Bedenken (Vereinbarkeit mit Gr<strong>und</strong>gesetz) in seinen<br />
Forderungen eher verhalten. So wurde im Modellentwurf der ursprünglichen Ablieferungspflicht<br />
eine Anbietungspflicht vorgeschaltet <strong>und</strong> auch eine Entschädigungsmöglichkeit<br />
für die abgelieferten Werke eingeräumt. Der Entwurf wurde von<br />
den Ländern mit mehr oder weniger Abänderungen übernommen. Entschädigungen<br />
gewährten nur Berlin, Rheinland-Pfalz, das Saarland <strong>und</strong> ausnahmsweise<br />
auch Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg nutze den Ermessensspielraum<br />
des Entwurfes <strong>und</strong> kehrte aus finanziellen <strong>und</strong> arbeitsökonomischen Gründen zur<br />
früheren Ablieferungspflicht zurück. /Will 1968, S. 280/ Dagegen legten 1965 baden-württembergische<br />
Verleger Verfassungsbeschwerde beim B<strong>und</strong>esverfas-
- 26 -<br />
sungsgericht ein mit dem Ziel, „die unentgeltliche Ablieferungspflicht der Verleger<br />
auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gr<strong>und</strong>gesetz überprüfen zu lassen.“ /Haas-Träger,<br />
S. 20/ Sie zogen diese 1969 wieder zurück, da das Land Baden-Württemberg eine<br />
Abmilderung der Vorschriften von 1964 vornahm. Am 3. März 1976 verabschiedete<br />
Baden-Württemberg ein neues Gesetz zur Ablieferung von Pflichtexemplaren.<br />
3.3.2.4 <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
Einige Verwaltungs- <strong>und</strong> Pressejuristen sahen die unentgeltliche <strong>und</strong> portofreie<br />
Ablieferung von Pflichtexemplaren als unvereinbar mit dem Art. 14, Abs. 3 Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
(GG) an. Dort heißt es: „Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit<br />
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Gr<strong>und</strong> eines Gesetzes erfolgen,<br />
das Art <strong>und</strong> Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter<br />
gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit <strong>und</strong> der Beteiligten zu<br />
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg<br />
vor den ordentlichen Gerichten offen. “ /Gr<strong>und</strong>gesetz, S. 18/<br />
Der bekannteste Gegner des geltenden <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s, insbesondere der<br />
unentgeltlichen Ablieferung, war der führende Kommentator des Presserechts<br />
<strong>Martin</strong> Löffler. Er kommentierte zum Reichspreßgesetz: Die Ablieferungspflicht sei<br />
eine Enteignung, ein „gesetzlich geregeltes Beuterecht des Staates gegen seine<br />
eigenen Buchhändler“. Art. 14, Abs. 3 GG kenne eine Enteignung ohne Entschädigung<br />
nicht. Dagegen sehe § 30, Abs. 3 RPG „ausdrücklich eine entschädigungslose<br />
Abgabe“ vor. In der Pflicht zur kostenlosen Abgabe von Freiexemplaren<br />
sei nach Standpunkt aller Lehrmeinungen eine Enteignung zu sehen. Demzufolge<br />
seien § 30 Abs. 3 RPG <strong>und</strong> die auf ihn gegründeten landesrechtlichen Vorschriften<br />
ungültig. /Löffler, <strong>Martin</strong> 1955, S. 452 - 453/<br />
Unstrittig ist hierbei, dass Enteignungen lt. GG nur gegen Entschädigung zulässig<br />
sind. Ebenso ist unstrittig, dass Gesetze, die eine entschädigungslose Ablieferung<br />
anordnen, ebenfalls gemäß GG nicht rechtswirksam sind. „Entscheidend für die<br />
Gültigkeit ist daher die Rechtsnatur der Ablieferungspflicht. So wird die Verpflichtung<br />
zur Ablieferung . als Fall einer Naturalsteuer, als öffentliche Abgabe, als öffentliche<br />
Last, als Enteignung <strong>und</strong> auch als Eigentumsbeschränkung angesehen“ -<br />
dies eine Auswahl unterschiedlicher Rechtsauffassungen. /Jütte 1956, S. 84/ Jütte<br />
verwies weiterhin auf den Umstand, dass der Eigentumsbegriff seit langem heftig<br />
umstritten sei. Letzten Endes wies Jütte nach, dass die von Löffler verwendeten<br />
„Zitate keineswegs in der von Löffler aufgefaßten Weise verstanden werden können“.<br />
/Kirchner 1982, S. 82/ Jütte bezeichnete die Darstellung insgesamt als<br />
„mißglückt“. /Jütte 1956, S. 100/ Das hinderte Löffler aber nicht, an seinen Anschauungen<br />
auch in der 2. Aufl. des kommentierten Presserechts festzuhalten.<br />
/Löffler, <strong>Martin</strong> 1968, S. 262 - 264/ Im gleichen Jahr wie Löffler stellte sich Erich<br />
Will der Frage nach der Rechtmäßigkeit der unentgeltlichen Abgabe von Pflicht-
- 27 -<br />
exemplaren. Er setzte sich mit der im GG fehlenden Definition des Begriffs „Enteignung“<br />
auseinander <strong>und</strong> kam letztendlich zum Schluss, dass . „die Weitergeltung<br />
der Vorschriften der Pflichtexemplargesetze . durch Artikel 14 Absatz 3 Satz<br />
2 GG nicht berührt“ werden. /Will 1955, S. 69/ Dies war der Beginn einer langjährigen<br />
Debatte.<br />
Die ungeklärte Rechtslage erschwerte den Landesbibliotheken den Vollzug der<br />
Gesetze. Eine Erleichterung gab es insofern, als auf Gr<strong>und</strong> einer Empfehlung des<br />
Verlegerverbandes die meisten Verleger doch ablieferten - allerdings unter der<br />
Option des Vorbehalts, um bei entsprechender Entscheidung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichtes<br />
eine spätere Verrechnung erwirken zu können. Umgekehrt waren<br />
die Bibliotheken ermächtigt worden, in Härtefällen bis zur Höhe der Selbstkosten<br />
zu entschädigen. /Will 1968, S. 285 - 286/ Das in dieser Zeit o. g. anhängige<br />
Rechtsverfahren führte aber nicht zur allseits gewünschten Klärung, da die Verfassungsbeschwerde<br />
1969 zurückgezogen worden war. So vergingen zwölf weitere<br />
Jahre bis zur endgültigen Klärung der Rechtsunsicherheit, ausgelöst durch<br />
die Klage eines hessischen Verlegers gegen die pflichtexemplarberechtigte Bibliothek.<br />
In mehreren Instanzen verhandelt führte erst der Beschluss vom 14. Juli<br />
1981 des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts zu einem Ende des Rechtsstreits. /Pflug, S.<br />
311 - 315/ Es erkannte die Ablieferungspflicht zu Gunsten öffentlicher Bibliotheken<br />
an. Dagegen hielt es „das Fehlen jedweder Entschädigungsregelungen auch<br />
für Härtefälle als verfassungsrechtlich nicht zulässig.“ /Kirchner 1982, S. 84/ Nunmehr<br />
bestand das Gebot, entsprechende Passagen in der Ländergesetzgebung<br />
zu ändern. So haben Bayern 1986, Hamburg 1988 <strong>und</strong> Nordrhein-Westfalen 1993<br />
ihr <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> von Gr<strong>und</strong> auf erneuert. Zwei Gesetze (B<strong>und</strong> 1969 <strong>und</strong><br />
Baden-Württemberg 1976) „hatten den Beschluß vorweggenommen.“ /Picard<br />
1996, S. 149/<br />
3.4 Die deutsche Einheit<br />
Die Wiedervereinigung vollzog sich im Pflichtexemplarbereich praktisch auf drei<br />
Ebenen: B<strong>und</strong>esebene, Länderebene <strong>und</strong> im Land Berlin.<br />
Die Vereinigung der Deutschen Bücherei Leipzig <strong>und</strong> der Deutschen Bibliothek<br />
Frankfurt am Main samt der Abteilung Deutsches Musikarchiv in Berlin zur Anstalt<br />
Die Deutsche Bibliothek (DDB) wurde mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober<br />
1990 rechtsverbindlich. Die Vereinigung wurde im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer 1990<br />
vorbereitet <strong>und</strong> „sollte sich in der Tat innerhalb kurzer Zeit als die sachlich richtige<br />
<strong>und</strong> zukunftsweisende Entscheidung für die Nationalbibliothek des vereinigten<br />
Deutschland herausstellen.“ /Busse, S. 68/ Heute sammelt <strong>und</strong> archiviert Die<br />
Deutsche Bibliothek „das in Deutschland verlegte Schrifttum bzw. die in Deutschland<br />
veröffentlichten Medienwerke“ /Walter, S. 51/, außerdem (als Belegstücke<br />
oder im Kaufverfahren) deutschsprachige Werke, die im Ausland erschienen sind<br />
<strong>und</strong> die sog. Germanica (im Ausland erschienene Übersetzungen deutschspra-
- 28 -<br />
chiger Werke <strong>und</strong> der dort veröffentlichten Literatur über Deutschland). Außerdem<br />
ist sie Deutschlands zentrales Musikarchiv; nationalbibliographisches <strong>und</strong> nationales<br />
musikbibliographisches Informationszentrum; öffentliche Präsenzbibliothek<br />
in Leipzig <strong>und</strong> Frankfurt am Main <strong>und</strong> - speziell für Musikliteratur <strong>und</strong> Tonträger -<br />
in Berlin u. v. m. /Busse, S. 68/<br />
Die Wiedervereinigung Deutschlands erforderte eine Neuordnung des zentralen<br />
Pflichtexemplarwesens der ehemaligen DDR. Die fünf entstandenen B<strong>und</strong>esländer<br />
mussten neue Pflichtexemplarregelungen in ihrem jeweiligen Hoheitsbereich<br />
einführen. Mit den Landespressegesetzen von Thüringen <strong>und</strong> Sachsen-Anhalt<br />
wurden 1991 die heutigen Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für diese Länder gelegt. Die Länder<br />
Sachsen (1992), Brandenburg <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern (1993) folgten. „Die<br />
Rückkehr der fünf neuen Länder zu dem früher in der alten B<strong>und</strong>esrepublik üblichen<br />
Vorgehen, die Ablieferungspflicht in den - rechtssystematisch ganz andere<br />
Ziele verfolgenden - Pressegesetzen zu behandeln, sollte man dennoch nicht als<br />
Unterbewertung auslegen. Eher erfolgte dies aus der Notwendigkeit, in kurzer Zeit<br />
sehr viele Rechtskreise neugestalten zu müssen.“ /Picard 1996, S. 149 - 150/<br />
Auch in den alten B<strong>und</strong>esländern erfolgten Novellierungen der Pflichtexemplarvorschriften.<br />
Ausnahmen bildeten Bayern <strong>und</strong> Hamburg, die bereits über autonome<br />
Pflichtexemplargesetze neueren Datums (1986 <strong>und</strong> 1988) verfügten <strong>und</strong> Nordrhein-Westfalen,<br />
das 1993 ein neues Gesetz in Form eines ebenfalls autonomen<br />
Pflichtexemplargesetzes erlassen hatte.<br />
Die Entwicklung in Berlin war besonders interessant, da sich hier die Wiedervereinigung<br />
im „Kleinen“ vollzog.<br />
Während der Teilung Berlins übernahmen mehrere Bibliotheken arbeitsteilig die<br />
regionalbibliothekarischen Aufgaben: die Berliner Stadtbibliothek, die Bibliothek<br />
der Freien Universität <strong>und</strong> die Amerika-Gedenkbibliothek. Die 1901 gegründete<br />
Berliner Stadtbibliothek besaß von 1960 bis zur Wiedervereinigung Berlins am 3.<br />
Oktober 1990 für Ost-Berlin das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>. Seit diesem Tag erstreckte<br />
sich das West-Berliner Landesrecht auch auf Ost-Berlin. /Lehmann, Hans Georg,<br />
S. 438/ In der Zeit bis zum Inkrafttreten des Pflichtexemplargesetzes für Berlin<br />
1994 erfolgte die Ablieferung an die Berliner Stadtbibliothek auf freiwilliger Basis.<br />
Dagegen stand der 1954 eröffneten Amerika-Gedenkbibliothek (West-Berlin) in<br />
Kooperation mit der Bibliothek der Freien Universität Berlin seit 1965 nur eine Anbietungspflicht<br />
der Berliner Verlage mit der Option des käuflichen Erwerbs der<br />
Verlagsproduktion zum halben Ladenpreis zu. /Lux, S. 186/<br />
Eine neues Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren vom 29. November<br />
1994 vereinte die Pflichtexemplar-Erfahrungen beider Stadtteile. Im Gesetz<br />
wird die Berliner Stadtbibliothek als empfangsberechtigte Bibliothek ausgewiesen.<br />
Dessen ungeachtet stand die Zusammenlegung von Berliner Stadtbibliothek <strong>und</strong><br />
der Amerika-Gedenkbibliothek bevor. Dieser ging eine gründliche Planungsphase
- 29 -<br />
voraus, in die auch die Mitarbeiter einbezogen waren. Mehrere Vereinigungsmodelle<br />
der beiden wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken standen zur Diskussion.<br />
Es galt, die jeweils gleichen Fächer aus Ost <strong>und</strong> West zusammenzulegen <strong>und</strong><br />
den zukünftigen Standort festzulegen. Heute ist das Haus Berliner Stadtbibliothek<br />
Standort für die Naturwissenschaften, Recht <strong>und</strong> historische Sondersammlungen.<br />
Im Haus Amerika-Gedenkbibliothek sind die Geisteswissenschaften untergebracht.<br />
Circa eine Million Bände mussten in des jeweils andere Haus transportiert<br />
werden. Besonders in personeller Hinsicht war ein feinfühliges Management erforderlich,<br />
schließlich waren mit der Fächerkonzentration ggf. auch Umzüge des<br />
Personals von Ost nach West <strong>und</strong> umgekehrt erforderlich. Einige Mitarbeiter zogen<br />
mit „ihrem Fach“ in den anderen Stadtteil, andere blieben in ihrem Stammhaus<br />
<strong>und</strong> machten sich mit neuen Arbeitsaufgaben vertraut.<br />
Am 1. Oktober 1995 wurde die neue Zentral- <strong>und</strong> Landesbibliothek Berlin aus der<br />
Berliner Stadtbibliothek <strong>und</strong> der Amerika-Gedenkbibliothek als eine Stiftung des<br />
öffentlichen Rechts errichtet.<br />
4 Die Arbeit der heutigen Pflichtexemplarstelle der ULB in<br />
Halle<br />
An der ULB Halle wurden unter dem neuen Direktor Dr. Heiner Schnelling viele<br />
Bibliotheksabläufe neu organisiert. Die beiden Dienststellen Erwerbung <strong>und</strong> Titelaufnahme<br />
wurden zur „Integrierten Buchbearbeitung“ zusammengeschlossen.<br />
Für die Pflichtbearbeitung an der ULB Halle bedeutet das, dass von der Akzession<br />
bis zur Titelaufnahme alle Arbeiten von einer einzigen Kollegin bewältigt werden.<br />
Es werden ca. 3000 Pflichttitel einschließlich amtlicher Druckschriften pro Jahr<br />
eingearbeitet. Damit gehört Sachsen-Anhalt zu den Ländern mit relativ wenig<br />
Verlagen <strong>und</strong> sonstigen Ablieferungspflichtigen.<br />
In Sachsen-Anhalt besteht Ablieferungspflicht. Gesammelt werden alle Publikationsformen.<br />
Allerdings werden die Non-Print-Medien (z. B. Videos, CDs), sofern<br />
nicht „freiwillig“ geliefert, nur bei wissenschaftlicher Relevanz angefordert. (Einzelheiten<br />
zu den gesetzlichen Bestimmungen sind im Kapitel 6 aufgeführt.)<br />
Die Zeitschriftenstelle arbeitet Pflicht-Zeitschriften <strong>und</strong> -Zeitungen ein. Die ULB<br />
sammelt sämtliche Tageszeitungen inklusive der Regionalausgaben vollständig.<br />
Elektronische Publikationen (Netzpublikationen) werden in der EDV-Abteilung<br />
konserviert <strong>und</strong> unterliegen einem Sondergeschäftsgang.<br />
Die ULB Halle ist in den Gemeinsamen Bibliotheksverb<strong>und</strong> (GBV) integriert. Nach<br />
Eingang der Publikationen <strong>und</strong> Dublettencheck erfolgt die Signaturvergabe nach<br />
Numerus currens. Auf Gr<strong>und</strong> des bei Pflichtliteratur besonders häufig vorkommenden<br />
Kleinschrifttums werden viele Stücke gekapselt, meist nach Erscheinungsort<br />
in Städtekapseln. Für die größeren Städte Sachsen-Anhalts existieren<br />
separate Städtekapseln, die anderen Orte werden nach Buchstabengruppen in<br />
den Kapseln gebündelt. Für Institutionen mit reicher Publikationstätigkeit wurden
- 30 -<br />
einzelne Ministerien-, Landesbehörden-, Verlags- <strong>und</strong> Betriebskapseln angelegt.<br />
Sämtliche Pflichtliteratur wird i. d. R. formal <strong>und</strong> sachlich erschlossen. Eine Ausnahme<br />
bilden die Betriebskapseln (z. B. der Halleschen Verkehrs-AG, Opernhaus).<br />
Diese werden nur einmalig bei Anlegen der Kapsel formal <strong>und</strong> sachlich erschlossen.<br />
Der Nachweis der einzelnen Stücke der Betriebskapseln erfolgt lediglich<br />
im lokalen Bibliothekssystem ACQ.<br />
Nach der Signaturvergabe erfolgen Inventarisierung im lokalen System <strong>und</strong> Anlegen<br />
von Geschäftsgangsexemplaren bzw. Titelaufnahmen im zentralen System.<br />
Der sachlichen Erschließung (per Notationen, Schlagwörtern, Basisklassifikationen)<br />
durch die Fachreferenten schließt sich die Abschlußaufnahme im PICA-<br />
Verb<strong>und</strong> an. Vor Schlußstelle <strong>und</strong> Magazinierung durchlaufen die Pflichtexemplare<br />
ggf. noch Regionalbibliographie <strong>und</strong> Buchbinderei.<br />
Seit dem 1. Januar 2001 arbeitet die Regionalbibliographie im PICA-Verb<strong>und</strong> mit.<br />
So kann sie die Titelaufnahmen des Verb<strong>und</strong>es nutzen <strong>und</strong> muss nur noch die<br />
Innenaufnahmen (unselbstständig erschienene Werke) anfertigen. Durch die Teilnahme<br />
am Verb<strong>und</strong> haben sich auch die Recherchemöglichkeiten für die Benutzer<br />
enorm verbessert. Die gedruckte Version der Regionalbibliographie wird mit<br />
der Bibliothekssoftware ABACUS-PIEWEN erstellt. Diese Weiterentwicklung von<br />
ABACUS befindet sich gegenwärtig in der Testphase.<br />
Die Zusammenarbeit von räumlich <strong>und</strong> organisatorisch getrennter Regionalbibliographie<br />
<strong>und</strong> Pflichtstelle ist gut. Die Mitarbeiter der Regionalbibliographie werten<br />
täglich die Regionalzeitungen aus können somit die Pflicht-Bearbeiterin bei der bibliographischen<br />
Recherche der Pflichttitel unterstützen. Ebenfalls unterstützt wird<br />
sie durch die Fachreferenten, die die wöchentlichen Verzeichnisse der Deutschen<br />
Nationalbibliographie Reihe A <strong>und</strong> B auswerten. Hinzu kommt die Auswertung der<br />
gesetzlich geforderten Verlagsverzeichnisse durch die Pflicht-Bibliothekarin. Auch<br />
negative Leihscheine <strong>und</strong> Zufallstreffer z. B. auf Privatreisen sind geeignet,<br />
Pflichtexemlar-Lücken zu schließen.<br />
Ein großer Teil der Publikationen wird ohne Aufforderung geliefert. Die Ein-<br />
Monats-Frist wird kaum eingehalten. Da die Ablieferungspflichtigen den Versand<br />
selbst finanzieren müssen warten sie lieber, bis sich mehrere Pflichtexemplare<br />
angesammelt haben. Einige Verlage werden der Forderung nach Vorankündigung<br />
gerecht <strong>und</strong> schicken Verlagsverzeichnisse. Die außerhalb des Buchhandels<br />
Verlegenden wissen oft nichts von der Ablieferungspflicht <strong>und</strong> auch nichts von der<br />
Ankündigungspflicht. Auf Wunsch erfolgt das Zusenden einer formlosen Empfangsbestätigung.<br />
Erhält die ULB Halle Kenntnis von einem ablieferungspflichtigen Werk, so wird der<br />
Verpflichtete auf die Ablieferungspflicht telefonisch oder schriftlich hingewiesen<br />
bzw. daran erinnert. Die Praxis hat gezeigt, dass sich die Verpflichteten im persönlichen<br />
Gespräch eher von Sinn <strong>und</strong> Zweck ihrer Ablieferungspflicht überzeugen<br />
lassen. Der Vorgang wird abgeheftet <strong>und</strong> in unregelmäßigen Abständen (ca.
- 31 -<br />
alle zwei bis drei Monate) gemahnt. Führen auch wiederholte Mahnungen <strong>und</strong><br />
Appelle nicht zum Erfolg, versucht die Bibliothek, dass Pflichtexemplar anderweitig<br />
zu beschaffen. Zwangsmaßnahmen wie Ersatzvornahme oder Zwangsgeld werden<br />
nicht angewendet, ebenso wenig wie die Verfolgung als Ordnungswidrigkeit.<br />
5 Geltende Pflichtexemplargesetze, Verordnungen <strong>und</strong> Richtlinien<br />
5.1 B<strong>und</strong>esrecht<br />
Gesetz über die Deutsche Bibliothek vom 31. 3. 1969, geändert durch Einigungs-<br />
vertrag vom 31. 8. 1990 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 12/<br />
Verordnung über die Pflichtablieferung von Druckwerken an die Deutsche Bibliothek<br />
(Pflichtstückverordnung - PflStV) vom 14. Dezember 1982 mit Änderung vom<br />
25. Oktober 1994 /Bibliotheksrechtliche; [Nr.] 505/<br />
Richtlinie für die Gewährleistung von Zuschüssen bei der Ablieferung von Pflichtstücken<br />
an Die Deutsche Bibliothek in der Fassung vom 27. Oktober 1992<br />
/Bibliotheksrechtliche; [Nr.] 506/<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken: Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main<br />
Deutsche Bücherei Leipzig<br />
Deutsches Musikarchiv der Deutschen Bibliothek<br />
(Musiknoten <strong>und</strong> -tonträger)<br />
5.2 Landesrecht<br />
5.2.1 Baden-Württemberg (BAW) 1<br />
Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren an die Badische Landesbibliothek<br />
in Karlsruhe <strong>und</strong> die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart vom<br />
3. März 1976, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 7. 1993<br />
/Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 527/<br />
3. Verordnung des Kultusministeriums zur Durchführung des Gesetzes über die<br />
Ablieferung von Pflichtexemplaren an die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe<br />
<strong>und</strong> die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart vom 26. März 1976<br />
/Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 528/<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken: Badische Landesbibliothek (BLB) Karlsruhe<br />
Württembergische Landesbibliothek<br />
(WLB) Stuttgart<br />
1<br />
Die Länderkennungen entstammen Dittrich 1995, S. 95. Die Verfasserin bittet um Verständnis,<br />
dass wegen der sehr häufigen Aufzählungen in Kap. 6 die Kennungen statt Ländernamen verwendet<br />
werden.
5.2.2 Bayern (BAY)<br />
- 32 -<br />
Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken - Pflichtstückgesetz (PflStG) vom<br />
6. August 1986 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 535/<br />
Richtlinien für die Gewährung von Entschädigungen bei der Ablieferung von<br />
Pflichtstücken an die Bayerische Staatsbibliothek nach Art. 4 des Gesetzes über<br />
die Ablieferung von Pflichtstücken (PflStG) vom 6. August 1986 in der Fassung<br />
vom 1. Mai 1993 („Amtlich nicht veröffentlicht.“) /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 536/<br />
Sammlung der Pflichtstücke nach dem Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken<br />
: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministers für Unterricht <strong>und</strong><br />
Kultus vom 11. November 1986 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 535/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Bayerische Staatsbibliothek (BSB) München<br />
Weitere Bibliotheken erhalten von der BSB ein Pflichtexemplar (regionale bzw.<br />
fachliche Zuordnung):<br />
Staats- <strong>und</strong> Stadtbibliothek Augsburg<br />
Staatsbibliothek Bamberg<br />
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg<br />
Universitätsbibliothek München<br />
Bibliothek der Technischen Universität <strong>und</strong> Zweigbibliothek Weihenstephan München<br />
Hochschule für Musik München<br />
Staatliche Graphische Sammlung München<br />
Staatliche Bibliothek Passau<br />
Staatliche Bibliothek Regensburg<br />
Universitätsbibliothek Würzburg /Dittrich, S. 10 - 15/<br />
5.2.3 Berlin (BER)<br />
Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren (PlfExG) vom 29. November<br />
1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 540/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: lt. Presserecht Stadtbibliothek Berlin, diese seit<br />
1. Oktober 1995 Zentral- <strong>und</strong> Landesbibliothek<br />
(ZLB) Berlin<br />
5.2.4 Brandenburg (BRA)<br />
Pressegesetz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Landespressegesetz<br />
-BbgPG) vom 13. Mai 1993 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 546/<br />
Richtlinien des Ministeriums . für die Gewährung von Entschädigungen . vom 29.<br />
September 1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 547a/<br />
Verordnung des Ministers für Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Kultur zur Durchführung<br />
des Brandenburgischen Landespressegesetzes über die Ablieferung von<br />
Pflichtexemplaren an die Stadt- <strong>und</strong> Landesbibliothek Potsdam vom 29. September<br />
1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 547/
- 33 -<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Stadt- <strong>und</strong> Landesbibliothek (StLB) Potsdam<br />
5.2.5 Bremen (BRE)<br />
Gesetz über die Presse (Pressegesetz) vom 16. März 1965, zuletzt geändert<br />
durch Gesetz vom 16. 12. 1997 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 548/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek (SUB) Bremen<br />
5.2.6 Hamburg (HAM)<br />
Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren : Pflichtexemplargesetz - PEG<br />
vom 14. September 1988 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 553/<br />
Verwaltungsanordnung zur Durchführung des Pflichtexemplargesetzes vom 21.<br />
September 1989 („Amtlich nicht veröffentlicht.“) /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 554/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg<br />
Carl von Ossietzky<br />
5.2.7 Hessen (HES)<br />
Hessisches Gesetz über Freiheit <strong>und</strong> Recht der Presse in der Fassung der Be-<br />
kanntmachung vom 20. November 1958, zuletzt geändert durch Gesetz von 21. 9.<br />
1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 556/<br />
18. Verordnung über die Abgabe von Druckwerken vom 12. Dezember 1984, ge-<br />
ändert durch Beschluss vom 1. 10. 1991 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 557/<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken (nach Regionen):<br />
Hessische Landes- <strong>und</strong> Hochschulbibliothek (HLB) Darmstadt<br />
Stadt- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek (StUB) Frankfurt am Main<br />
Hessische Landesbibliothek (HLB) Fulda<br />
Gesamthochschul-Bibliothek (GHB) Kassel - Landesbibliothek <strong>und</strong> Murhardsche<br />
Bibliothek der Stadt Kassel<br />
Hessische Landesbibliothek (HLB) Wiesbaden<br />
5.2.8 Mecklenburg-Vorpommern (MEC)<br />
Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) vom 6.<br />
Juni 1993 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 562/<br />
Verordnung über die Ablieferung von Druckwerken (Druckwerkablieferungsverordnung)<br />
vom 20. März 1996 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 563/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Landesbibliothek (LB) Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Schwerin)<br />
5.2.9 Niedersachsen (NIE)<br />
Niedersächsisches Pressegesetz vom 22. März 1965, zuletzt geändert durch Gesetz<br />
vom 3. 7. 1994 /Presserecht, S. 94 - 101/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Niedersächsische Landesbibliothek (NLB) Hannover
5.2.10 Nordrhein-Westfalen (NRW)<br />
- 34 -<br />
Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren (Pflichtexemplargesetz) vom<br />
18. Mai 1993 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 570/<br />
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Ablieferung von Pflichtexemplaren<br />
vom 29. Juni 1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 571/<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken (nach Regionen):<br />
Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek (ULB) Bonn<br />
Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf<br />
Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek (ULB) Münster<br />
5.2.11 Rheinland-Pfalz (RPF)<br />
Landesgesetz über die Presse (Landespressegesetz) vom 14. Juni 1965, zuletzt<br />
geändert durch Gesetz vom 29. 7. 1997 /Presserecht, S. 113 - 123/<br />
24. Landesverordnung zur Durchführung des § 12 des Landespressegesetzes<br />
vom 13. Juni 1966 mit Änderungen vom 1. Juli 1972 <strong>und</strong> 10. Juli 1992<br />
/Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 583/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Universitätsbibliothek Mainz<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken für zweites Exemplar (nach Regionen):<br />
Stadtbibliothek (StB) Mainz<br />
Pfälzische Landesbibliothek (LB) Speyer<br />
Rheinische Landesbibliothek (LB) Koblenz<br />
Stadtbibliothek (StB) Trier<br />
5.2.12 Saarland (SAR)<br />
Saarländisches Pressegesetz (SPresseG) vom 12. Mai 1965, zuletzt geändert<br />
durch Ges. vom 5. 2. 1997 /Presserecht, S. 126 - 136/<br />
27. Verordnung zur Durchführung des § 12 des Saarländischen Pressegesetzes<br />
(SPresseG) vom 3. Dezember 1965 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 588/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Bibliothek der Universität (ULB) des Saarlandes<br />
in Saarbrücken<br />
5.2.13 Sachsen (SAX)<br />
Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) vom 3. April 1992<br />
/Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 589/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Sächsische Landesbibliothek - Staats- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek<br />
(SLB) Dresden<br />
5.2.14 Sachsen-Anhalt (SAA)<br />
Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz) vom 14. August<br />
1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 1. 1994 /Bibliotheksrechtliche,<br />
[Nr.] 590/
- 35 -<br />
Verordnung über die Durchführung der Ablieferungspflicht von Druckwerken vom<br />
12. Juni 1996 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 590a/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek (ULB) Sachsen-Anhalt<br />
Halle<br />
5.2.15 Schleswig-Holstein (SCH)<br />
Gesetz über die Presse (Landespressegesetz) vom 19. Juni 1964, zuletzt geändert<br />
vom 19. 12. 1994 /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 591/<br />
Empfangsberechtigte Bibliotheken:<br />
Universitätsbibliothek (UB) Kiel<br />
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek (LB) Lübeck<br />
Stadtbibliothek (StB) Lübeck<br />
5.2.16 Thüringen (THU)<br />
Thüringer Pressegesetz (TPG) vom 31. Juli 1991, geändert durch Ges. vom 17. 5.<br />
1994 /Presserecht, S. 162 - 168/<br />
Empfangsberechtigte Bibliothek: Thüringer Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek<br />
(ULB) Jena<br />
6 Inhalt des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s <strong>und</strong> seine Durchsetzung in<br />
den Ländern<br />
6.1 Statistische Angaben aus 23 Pflichtexemplarbibliotheken<br />
Um die Bibliotheken miteinander vergleichen zu können, wurde in Frage 2 des<br />
Fragebogens /Anlage 3/ die Anzahl der eingearbeiteten Titel der letzten fünf Jahre<br />
erfragt. Diese Zahlen lassen sich aber nur bedingt vergleichen, da in den einzelnen<br />
Bibliotheken je nach rechtlichen Bestimmungen <strong>und</strong> interner Organisation des<br />
Geschäftsgangs Amtsdruckschriften bzw. Zeitschriftenbände in den Zahlen enthalten<br />
sind - oder auch nicht /Anlage 4/. Die durchschnittliche Anzahl der jährlich<br />
eingearbeiteten Pflicht-Titel wurde grafisch dargestellt /Anlage 5/. Die Grafik liefert<br />
somit einen Überblick über den Umfang der Sammeltätigkeit. Fehlende Angaben<br />
wurden der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) entnommen. /Deutsche 1996, S.<br />
80 - 83; 1997, S. 80 - 83; 1998, S. 80 - 83/ (Andererseits sind nicht alle Bibliotheken<br />
in der DBS aufgeführt, so dass die Befragung der Bibliotheken nach der Anzahl<br />
der jährlichen Pflicht-Titel sinnvoll war.)<br />
Die Zahl der durchschnittlich eingearbeiteten Pflichttitel reicht von 286 an der HLB<br />
Fulda über 10839 in der ULB Bonn bis zu 34710 an der BSB München. Die BSB<br />
München, die WLB Stuttgart <strong>und</strong> die BLB Karlsruhe nehmen eine Sonderstellung<br />
ein. München sammelt sämtliches Schrifttum aus Bayern. Das ist ein Unterschied<br />
zu den anderen Flächenländern, die das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> i.d.R. nach Regierungsbezirken<br />
aufteilen. Auch Baden-Württemberg weist ebenfalls auffallend hohe
- 36 -<br />
Zahlen auf. Hier ist das Land zwar in zwei Regierungsbezirke mit jeweiliger Landesbibliothek<br />
aufgeteilt, aber die Bibliotheken des anderen Bezirkes bekommen<br />
ebenfalls ein Pflichtexemplar.<br />
Die jährlich eingearbeiteten Pflicht-Titel wurden durch die personelle Ausstattung<br />
der Pflichtexemplarstelle (Frage 6) ergänzt. Die HLB Fulda machte dazu keine<br />
Angaben. Die ULB Bonn <strong>und</strong> die ULB Düsseldorf hätten gern mehr Personal zur<br />
Verfügung (Frage 14).<br />
Bibliothek Integrierter<br />
Geschäftsgang<br />
Erwerbung<br />
<strong>und</strong> Titelaufnahmevoneinandergetrennt<br />
Zeitschriftenstellearbeitet<br />
auch<br />
Pflichtzeitschriften<br />
ein<br />
Sonstiges:<br />
BLB Karlsruhe x x x<br />
WLB Stuttgart x<br />
BSB München x x<br />
ZLB Berlin x x<br />
StLB Potsdam x x<br />
SUB Bremen x<br />
HLB Darmstadt teilw. teilw. x<br />
StUB Frankfurt x x<br />
HLB Fulda x x<br />
GHB Kassel x x<br />
HLB Wiesbaden x x<br />
LB Schwerin x x<br />
NLB Hannover ab 2001 x<br />
ULB Bonn x x<br />
ULB Düsseldorf x x<br />
StB Mainz x x<br />
LB Speyer x<br />
ULB Saarbrücken x x<br />
SLB Dresden x x<br />
ULB Halle x x<br />
LB Kiel ab 2001<br />
StB Lübeck x x<br />
ULB Jena x x<br />
Gesamt 11 13 19 1<br />
47,83% 56,52% 82,61% 4,35%<br />
Tabelle 1<br />
Die Frage 5 stellt die Frage nach der Organisationsform des Geschäftsgangs:<br />
integrierter Geschäftsgang oder in Erwerbung <strong>und</strong> Titelaufnahme getrennte<br />
Dienststellen. Beide Organisationsformen sind üblich.<br />
Mit Ausnahme der WLB Stuttgart, der SUB Bremen <strong>und</strong> LB Speyer übernehmen<br />
in den übrigen Bibliotheken die Zeitschriftenstellen die Einarbeitung der Pflicht-<br />
Zeitschriften. Von der LB Kiel lag dazu keine Aussage vor.
- 37 -<br />
Bis auf 2 Bibliotheken erarbeiten alle eine Regionalbibliographie. Da sich die Auf-<br />
gaben von Pflichtexemplarstelle <strong>und</strong> Regionalbibliographie z. T. überschneiden,<br />
ist es aufschlussreich zu sehen, inwieweit sie zusammenarbeiten. In der HLB<br />
Darmstadt, GHB Kassel, ULB Bonn <strong>und</strong> LB Speyer sind sie räumlich <strong>und</strong> organisatorisch<br />
miteinander verb<strong>und</strong>en. Nur in der StUB Frankfurt haben die beiden<br />
Dienststellen keine Berührungspunkte.<br />
Bibliothek Zusammenarbeit<br />
Pflichtexemplarstelle <strong>und</strong> Regionalbibliographie<br />
räumlich organisatorisch<br />
nur teilweise keine<br />
BLB Karlsruhe x<br />
WLB Stuttgart x<br />
BSB München x<br />
StLB Potsdam x<br />
HLB Darmstadt x x<br />
StUB Frankfurt x<br />
GHB Kassel x x<br />
HLB Wiesbaden x<br />
LB Schwerin x<br />
ULB Bonn x x<br />
ULB Düsseldorf x<br />
StB Mainz x<br />
LB Speyer x x<br />
ULB Saarbrücken x<br />
SLB Dresden x<br />
ULB Halle x<br />
StB Lübeck x<br />
ULB Jena x<br />
Gesamt 4 6 11 1<br />
Tabelle 2<br />
6.2 Rechtliche Einbindung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s<br />
In elf Ländern ist das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> Bestandteil des Presserechts, auch in<br />
den neuen Ländern. Eigene gesetzliche Bestimmungen gibt es seit 1969 für den<br />
B<strong>und</strong>, seit 1976 für Baden-Württemberg, seit 1986 für Bayern, seit 1988 für Hamburg,<br />
seit 1993 für Nordrhein-Westfalen <strong>und</strong> seit 1994 für das Land Berlin.<br />
Die Einbindung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s in das Presserecht wird aufgr<strong>und</strong> der<br />
unterschiedlichen Rechtsmaterie in der B<strong>und</strong>esrepublik seit mindestens vierzig<br />
Jahren in der Literatur von Juristen <strong>und</strong> Bibliothekaren kritisiert. Kirchner sieht den
- 38 -<br />
Ursprung im Reichspreßgesetz von 1874, das „nicht nur die Angelegenheit der<br />
Tagespresse, also der Zeitungen <strong>und</strong> Illustrierten regeln“ sollte, „sondern alles,<br />
was mit der Presse des Buchdruckers zusammenhängt.“ Dazu zählten auch Urheberrecht<br />
<strong>und</strong> Verlagsrecht, die inzwischen durch besondere Gesetze geregelt<br />
seien. Heute sei der Begriff Presse auf „Tagesjournalistik“ beschränkt <strong>und</strong> das<br />
Presserecht nicht der richtige Ort, wo das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> angesiedelt werden<br />
sollte. Dies sollte sich im Falle des Verschwindens des Reichspreßgesetzes<br />
ändern. /Kirchner 1961, S. 386/<br />
Das Reichspreßgesetz verschwand in den sechziger Jahren.<br />
Die Verfasserin stellte die These auf, dass die Ansiedlung des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s<br />
an das Presserecht Ursache dafür sei, dass die Ablieferungspflicht so wenig<br />
bekannt ist. Deshalb bezog sich Frage 13 auf ebendiese Problematik. 88 %<br />
der Bibliotheken mit im Presserecht verankerter Pflichtexemplarregelung bestätigten<br />
die These, dass die Pflichtablieferung relativ unbekannt ist. Dagegen verneinten<br />
3 (50 %) Bibliotheken aus den Ländern mit autonomem Pflichtablieferungsgesetz<br />
einen Zusammenhang zwischen diesem Spezialgesetz <strong>und</strong> Öffentlichkeitswirksamkeit<br />
/Anlage 6/. Dessen ungeachtet wünschen vier Bibliotheken<br />
ein autonomes bzw. gr<strong>und</strong>sätzlich neues Pflichtexemplargesetz (Frage 14). Bezeichnenderweise<br />
stammen alle aus den neuen B<strong>und</strong>esländern mit Ausnahme<br />
der LB Schwerin.<br />
6.3 Anbietungs- <strong>und</strong> Ablieferungspflicht<br />
6.3.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
Die Mehrzahl der LPG <strong>und</strong> Nebengesetze <strong>und</strong> das Gesetz über DDB sieht die<br />
Verpflichtung zur Ablieferung vor.<br />
Anbietungspflicht: Die Länder BRA, BRE, RPF, SAR <strong>und</strong> SCH haben der Ablieferungspflicht<br />
eine Anbietungspflicht vorgeschaltet. In der Regel erfolgt das Anbieten<br />
durch eine Mitteilung des Verlegers. Anhand der eingegangenen Mitteilungen<br />
entscheidet die Bibliothek, welche Titel geliefert werden sollen. /Wenzel, S. 713/<br />
BRA verlangt generell ein Ansichtsexemplar, das ggf. zurückgeschickt wird; dieses<br />
Verfahren wird im SAR dem Verpflichteten freigestellt.<br />
Verfahren bei der Ablieferung: DDB verlangt einen bibliographischen Begleitzettel<br />
zum „Pflichtstück“. Dieser muss die erforderlichen Angaben zur bibliographischen<br />
Verzeichnung enthalten. BRA fordert ebenfalls einen - nicht so ausführlich - ausgefüllten<br />
Begleitzettel. Die Ablieferungspflichtigen erhalten in BRA eine Empfangsbestätigung,<br />
dies von DDB <strong>und</strong> in BAW auf Wunsch.<br />
In SAA ist das Erscheinen eines Druckwerks mit dem Termin der voraussichtlichen<br />
Auslieferung anzukündigen, HES wünscht erst im Nachhinein auf Verlangen<br />
ein Verzeichnis der im letzten Jahr erschienenen Titel.
- 39 -<br />
Fristen: Außer für BRE <strong>und</strong> SCH finden sich in allen Bestimmungen Fristen zum<br />
Anbieten bzw. Abliefern. Die Fristen beginnen „nach Beginn der Verbreitung“ oder<br />
„nach Erscheinen“. Es herrscht Variantenvielfalt: „mit Beginn der Verbreitung“<br />
(BRA, HES, THU); Ein-Wochen-Fristen (DDB, BAW, NRW); Zwei-Wochen-Fristen<br />
(BAY, BER, HAM); Ein-Monatsfristen (MEC, NIE, SAX, SAA). Das SAR wünscht<br />
Anbietung „bei Erscheinen“ <strong>und</strong> ein „unverzügliches Zusenden“ auf Verlangen der<br />
Bibliothek. In RPF kann bei Ausreizen der Fristen leicht ein viertel Jahr vergehen,<br />
bis das gewünschte Ablieferungsgut in die Bibliothek gelangt: Anbietung des<br />
Pflichtexemplars bis zum 15. des Folgemonats nach Erscheinen, Entscheidung<br />
der Bibliothek innerhalb von sechs Wochen über das Angebot, weitere sechs Wochen<br />
Zeit für den Verleger bis zur Ablieferung, sofern mit der Bibliothek kein späterer<br />
Zeitpunkt vereinbart ist.<br />
Wird ein Text einzeln auf Anforderung verlegt, so gilt in beim B<strong>und</strong>, in BAY, HES<br />
<strong>und</strong> NRW das allgemeine Angebot, dass von der Vorlage auf Bestellung Einzelstücke<br />
hergestellt werden, als Erscheinungstermin.<br />
Periodische Druckschriften: Für diese gelten in den Ländern mit Anbietungspflicht<br />
folgende Vorschriften: Anbietungspflicht bei Erscheinen <strong>und</strong> zu Beginn jedes Kalenderjahres<br />
(BRA, BRE, RPF, SCH), im SAR nur bei erstmaligem Erscheinen.<br />
Anzahl der Exemplare: In der Regel ist ein Exemplar abzuliefern, aber auch zwei<br />
(DDB, BAW, BAY, RPF, SAR, SCH). Die entschädigungslose Ablieferung von<br />
zwei Exemplaren erfolgt nur in DDB <strong>und</strong> BAY. In SCH (Anbietungspflicht an drei<br />
empfangsberechtigte Bibliotheken) gilt folgende Regelung: die UB Kiel <strong>und</strong> die LB<br />
Kiel teilen sich das Pflichtexemplar. /Fligge: Schleswig-Holstein, S. 94/ Außerdem<br />
ist der StB Lübeck ein Stück anzubieten, so dass höchstens zwei Exemplare abzuliefern<br />
sind.<br />
6.3.2 Auswertung des Fragebogens<br />
Von den fünf Bibliotheken in den Ländern mit vorgeschalteter Anbietungspflicht<br />
wünschen die SUB Bremen, die ULB Saarbrücken <strong>und</strong> die UB Kiel die direkte Ablieferungspflicht.<br />
Dagegen wünscht die Bibliothekarin der BSB München eine vorgeschaltete<br />
Anbietungspflicht.<br />
Die LB Fulda würde gern auf der Gr<strong>und</strong>lage zugeschickter Verlagsverzeichnisse<br />
arbeiten.<br />
Die Überprüfung der Einhaltung von Anbietungs- bzw. Ablieferungspflicht bedeutet<br />
für die Bibliotheken einen großen Arbeitsaufwand (Fragebogen: Frage 9). Auf<br />
jeden Fall ist eine große Eigeninitiative der Bibliotheken zwecks Pflichttitel-<br />
Recherche nötig. Die ULB Düsseldorf muss mangels Personal darauf verzichten.<br />
Vier Bibliotheken haben die technischen Voraussetzungen für einen elektronischen<br />
Datenabgleich mit DDB.
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
- 40 -<br />
Wie erhalten Sie Kenntnis vom Erscheinen ablieferungspflichtiger Dokumente?<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
100,00%<br />
Lieferung ohne<br />
Aufforderung<br />
Diagramm 1<br />
6.3.3 Diskussion<br />
34,78%<br />
Lieferung ohne<br />
Aufforderung wie<br />
angekündigt<br />
43,48%<br />
Lieferung nach<br />
Ankündigung <strong>und</strong><br />
Aufforderung<br />
17,39%<br />
Elektronischer<br />
Datenabgleich mit<br />
DDB<br />
95,65%<br />
Bibliotheksmitarbeiter<br />
durchforsten<br />
diverse Quellen<br />
39,13%<br />
Die vorgeschaltete Anbietungspflicht ist im Gr<strong>und</strong>e genommen nicht mit dem kulturpolitischen<br />
Auftrag des Pflichtexemplars vereinbar. Es herrscht vielerorts Einigkeit<br />
über die Kritik an der Anbietungspflicht. Ohne diese würden klare Verhältnisse<br />
bestehen <strong>und</strong> Lücken im gesetzlich vorgeschriebenen Bestandsaufbau vermieden<br />
werden.<br />
Die Empfängerbibliotheken stehen der Anbietungspflicht durchaus ambivalent gegenüber.<br />
Zum einen bringt die positiv beschiedene Anbietungspflicht der Bibliothek<br />
zusätzlichen Verwaltungsaufwand. „Anbietung, die gr<strong>und</strong>sätzlich als positiv<br />
vorausbeschieden gilt, ist ohnehin eine Farce.“ /Barton 1990, S. 225/<br />
Zum anderen erleichtert die Anbietungspflicht den Empfängerbibliotheken den<br />
Verzicht auf weniger wichtige Werke, was den Bibliotheksaufwand vermindert.<br />
(Aber wer kann heute reinen Gewissens beurteilen, was später einmal für die Forschung<br />
interessant bzw. weniger wichtig sein wird?) Barton kritisiert: „Die pflichtexemplarberechtigten<br />
Bibliotheken dürfen ja völlig legal auf die „lästigen“, weil<br />
platzaufwändigen <strong>und</strong> in der Bestandsverwaltung arbeitsintensiven Zeitungen, die<br />
sie früher sammeln mussten, verzichten.“ /Barton 1990, S. 225/ Diesen Vorteil der<br />
Anbietungspflicht würde die BSB München gern für sich nutzen.<br />
Sonstiges
- 41 -<br />
Diese Thematik wird im Kapitel 5.6 „Ausnahmen von der Ablieferungspflicht“ eingehend<br />
behandelt.<br />
Die Forderung nach zwei Exemplaren hält Pohley für verfassungsrechtlich unbedenklich.<br />
Das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht gehe davon aus, dass die Vermögensbelastung<br />
des Verlegers i.d.R. bei Ablieferung eines Pflichtexemplares, dass in<br />
größerer Auflage erscheint, nicht wesentlich ins Gewicht falle. Man könne davon<br />
ausgehen, dass dies auch auf die Ablieferung von zwei Stücken übertragen werden<br />
könne. /Pohley, S. 11 - 12/ In diesem Sinne argumentiert auch Sinogowitz, da<br />
„die in Härtefällen gewährte Entschädigung unzumutbare Belastungen verhindert.“<br />
/Sinogowitz 1987, S. 261/<br />
6.4 Die Verpflichteten<br />
6.4.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
Verleger im Sinne des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>es ist, „wer die Tätigkeit des Vervielfältigens<br />
<strong>und</strong> Verbreitens tatsächlich ausübt, gleichgültig, ob dies für einen Dritten<br />
oder für sich selbst (Selbstverleger), auf eigene Rechnung oder fremde Rechnung<br />
(Kommissionsverleger), gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig, urheberrechtlich<br />
berechtigt oder nicht berechtigt geschieht. Die dem Verleger obliegende Tätigkeit<br />
umfasst Planung <strong>und</strong> Durchführung der Vervielfältigung <strong>und</strong> Verbreitung. Verlagsort<br />
ist der Ort, wo diese Tätigkeit vorgenommen wird; er kann, braucht sich aber<br />
nicht mit dem Ort der geschäftlichen Niederlassung des Verlages zu decken. /Will<br />
1968, S. 287/<br />
Nach allen geltenden Bestimmungen ist der Verleger, der seinen Sitz im Geltungsbereiches<br />
des Gesetzes hat, zum Anbieten bzw. Abliefern verpflichtet. In einigen<br />
gesetzlichen Bestimmungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass<br />
dies auch gilt, wenn noch andere Verlagsorte im Werk genannt sind (BER, HAM,<br />
MEC, SAA). In NRW ist dagegen nur der „Hauptsitz bzw. der an erster oder hervorgehobener<br />
Stelle im Text genannte Sitz maßgeblich.“ /Bibliotheksrechtliche,<br />
[Nr.] 570/<br />
Im Gesetz über die DDB <strong>und</strong> in einigen Ländern (BAW, BAY, BER, HAM, z. T.<br />
HES, NRW) ist ausdrücklich geregelt, dass dazu auch Selbstverleger oder Herausgeber<br />
eines Druckwerkes gehören, ebenso Kommissions- <strong>und</strong> Lizenzverleger,<br />
sofern sie im Werk genannt sind.<br />
Ist in dem Werk kein Verleger genannt, trifft die Ablieferungspflicht in BAW, BRA,<br />
BRE, MEC, NIE, RPF, SAR, SAX, SAA <strong>und</strong> SCH den Drucker, zusätzlich den<br />
sonstigen Hersteller in BAW, BER, NIE, SAA.<br />
BRA, BRE, RPF, SAR, SAX, SCH fordern Anbietung bzw. Ablieferung auch dann<br />
vom Drucker, wenn das Druckwerk „keinen Verleger hat oder außerhalb des Geltungsbereiches<br />
dieses Gesetzes verlegt wird.“ /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 546/
- 42 -<br />
Ist kein Verleger genannt, verpflichtet BAY „diejenige natürliche oder juristische<br />
Person, in deren Auftrag der Text vervielfältigt wird“, HES die „Vorstände juristischer<br />
Personen des öffentlichen <strong>und</strong> des privaten Rechts für die von diesen herausgegebenen<br />
Druckwerke“.<br />
Im Gesetz über DDB <strong>und</strong> in den landesrechtlichen Regelungen von HAM <strong>und</strong><br />
NRW ist bei Tonträgern der Hersteller zur Ablieferung verpflichtet; nach dem Gesetz<br />
über DDB derjenige Hersteller, der auch das Recht zur Verbreitung hat.<br />
6.4.2 Auswertung des Fragebogens<br />
Die StLB Potsdam, die StB Mainz <strong>und</strong> die LB Speyer fordern die Entlastung des<br />
Druckers von der Abgabepflicht.<br />
6.4.3 Diskussion<br />
Die Anbietungspflicht des Druckers ist umstritten. Ausgangspunkt für die alternative<br />
Abgabepflicht des Druckers ist der Verlegerbegriff. Im Sinne des Verlagsrechts<br />
gibt es Druckwerke, die keinen Verleger haben; so ist danach ein Selbstverleger<br />
kein Verleger, da er nicht für einen Dritten, sondern für sich selbst verlegt. Der<br />
Verlegerbegriff im Sinne des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s dagegen bezieht Selbstverleger<br />
mit ein, so dass es praktisch keine Druckwerke ohne Verleger gibt. Die Bibliotheken<br />
praktizieren auch entsprechend <strong>und</strong> fordern Pflichtexemplare vom<br />
Selbstverleger. Neben den bibliographischen Mühen, einen Drucker <strong>und</strong> seine<br />
Druckwerke ausfindig zu machen <strong>und</strong> die Ablieferung zu kontrollieren gibt es insbesondere<br />
rechtliche Bedenken. Erstens hat der Drucker kein Recht an dem von<br />
ihm hergestellten Druckwerk. Er könnte nur auf Kosten seines Auftraggebers abliefern.<br />
Zweitens müsste er das Druckwerk zu einem Zeitpunkt abliefern, wo es<br />
von Seiten des Verlegers noch gar nicht erschienen ist. Drittens würde das zu einer<br />
Mehrfachabgabe führen, falls der Verleger seinen Sitz in einem anderen B<strong>und</strong>esland<br />
hat. /Will 1968, S. 291 - 294/ Picard bezeichnet die Ablieferungspflicht<br />
des Druckers, sofern kein Verleger genannt ist, als „befremdlich“. /Picard 1996, S.<br />
152/ Einige Länder gehen sogar noch weiter <strong>und</strong> verlangen Pflichtexemplare vom<br />
Drucker, wenn der Verleger außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes seinen<br />
Sitz hat. In diesem Falle könnte Picard Recht haben mit seiner Äußerung, „die<br />
Länder wollten sich kostenlos bedienen.“ /Picard 1996, S. 152/<br />
Bayern hat entsprechend reagiert <strong>und</strong> bestimmt, dass bei Fehlen eines Verlegers<br />
nicht der Drucker, sondern diejenige Person, in deren Auftrag der Text vervielfältigt<br />
wird, abliefern muss. Auch der B<strong>und</strong> verzichtet auf die Ablieferungspflicht des<br />
Druckers.
- 43 -<br />
6.5 Umfang der Ablieferungspflicht<br />
6.5.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich unterliegen alle Druckwerke, die im Geltungsbereich des betreffenden<br />
Landes verlegt werden, dem <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>.<br />
Druckwerke im Sinne der landesrechtlichen Bestimmungen sind „alle mittels der<br />
Buchdruckerpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung geeigneten Vervielfältigungsverfahrens<br />
hergestellten <strong>und</strong> zur Verbreitung bestimmten Schriften,<br />
besprochenen Tonträger, bildlichen Darstellungen mit <strong>und</strong> ohne Schrift, Bildträger<br />
<strong>und</strong> Musikalien mit Text oder Erläuterungen.“ /Wenzel, S. 714/ Diese ggf. etwas<br />
abweichende Definition findet sich i. d. R. in den Pressegesetzen <strong>und</strong> im Gesetz<br />
von BAW. Lediglich SAX muss völlig auf eine Definition des Druckwerks verzichten<br />
<strong>und</strong> wartet seit Jahren auf eine - bereits mehrmals angemahnte - Rechtsverordnung.<br />
Zudem werden periodische Druckwerke aufgeführt. In den Pressegesetzen von<br />
RPF, SAA , SCH <strong>und</strong> THU werden auch die sog. Pressedienste mit genannt. (In<br />
NRW fallen diese unter Ausnahmen von der Ablieferungspflicht.)<br />
HES fordert per Gesetz „Druckerzeugnisse sowie alle anderen zur Verbreitung<br />
bestimmten Vervielfältigungen von Schriften <strong>und</strong> bildlichen Darstellungen mit oder<br />
ohne Text .“, dazu Landkarten, Ortspläne, Atlanten <strong>und</strong> Kalender.<br />
Das Pressegesetz von SAX enthält keine Definition von Druckwerken.<br />
Die autonomen Pflichtexemplargesetze (außer BAW) definieren Druckwerke als<br />
alle „mittels eines Vervielfältigungsverfahrens hergestellten <strong>und</strong> zur Verbreitung<br />
bestimmten Texte“ (BAY, BER, HAM <strong>und</strong> NRW).<br />
Damit sei der „Sammelauftrag so eingeschränkt“, dass darüber hinausgehend<br />
gewünschtes Sammelgut extra aufgezählt werden müsse. Das sei zwar präzise,<br />
aber umständlich <strong>und</strong> lasse für flexiblere Auslegungen keinen Raum. /Walter, S.<br />
52/ Dementsprechend werden in diesen Gesetzen ergänzend aufgeführt:<br />
• Texte ohne Rücksicht auf die Art des Textträgers <strong>und</strong> des Vervielfältigungsverfahrens<br />
(BAY <strong>und</strong> NRW)<br />
• Texte in verfilmter oder elektronisch aufgezeichneter Form, besprochene Tonträger,<br />
Notendrucke <strong>und</strong> andere graphische Musikaufzeichnungen, Landkarten,<br />
Ortspläne <strong>und</strong> Atlanten sowie bildliche Darstellungen, wenn sie mit einem erläuternden<br />
Text verb<strong>und</strong>en sind (NRW)<br />
• Daten- oder Tonträger, bildliche Darstellungen mit <strong>und</strong> ohne Schrift <strong>und</strong> Musikalien<br />
(BER)<br />
• Landkarten, Ortspläne, Atlanten, Tonwerke <strong>und</strong> Tonträger sowie Bildwerke,<br />
falls sie mit einem erläuternden Text verb<strong>und</strong>en sind (HAM).<br />
Diese Länder „verzichten bezeichnenderweise auf all jene Druckwerke, die keinen<br />
Text im herkömmlichen Sinn enthalten, also auf Noten <strong>und</strong> Musikalien ohne Text,<br />
reine Instrumentalmusik <strong>und</strong> bildliche Darstellungen ohne Text, es sei denn, dass
- 44 -<br />
sie, wie im Bayerischen Pflichtexemplargesetz, doch wieder eigens eingeführt<br />
werden.“ /Walter, S. 52/<br />
„Druckwerke im Sinne“ des Gesetzes über DDB „sind alle Darstellungen in<br />
Schrift, Bild <strong>und</strong> Ton, die im Vervielfältigungsverfahren hergestellt <strong>und</strong> zur Verbreitung<br />
bestimmt sind.“ /Wenzel, S. 708/<br />
Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Ausführungen in den einzelnen Pflichtexemplargesetzen:<br />
Beilagen <strong>und</strong> andere zum Hauptwerk gehörende Materialien: Nach dem Berliner<br />
PflExG § 2 (2) umfasst die Ablieferungspflicht „sämtliche erkennbar zum<br />
Hauptwerk gehörenden Beilagen sowie zu Zeitschriften, Lieferungswerken <strong>und</strong><br />
ähnlichen Veröffentlichungen gehörige Einbanddecken, Sammelordner, Titelblätter,<br />
Inhaltsverzeichnisse, Register <strong>und</strong> andere Materialien, die der Vervollständigung<br />
des Hauptwerkes dienen.“ Die Regelungen der einzelnen Länder entsprechen<br />
dem in etwa. (DDB, BAW, BAY, BRA, HES, NRW).<br />
Einbandarten: Von mehreren Einbandarten ist das Pflichtexemplar in der dauerhaftesten<br />
Form abzuliefern, ausgenommen sind Vorzugs- <strong>und</strong> Luxusausgaben.<br />
(DDB, BAW, BER, HES, MEC, NRW).<br />
Neuauflagen: Veränderte <strong>und</strong> unveränderte Auflagen einschließlich höherer Tausender<br />
sind i. d. R. gr<strong>und</strong>sätzlich abzuliefern, sofern sie als solche im Druckwerk<br />
unverschlüsselt gekennzeichnet sind (DDB, BAW, HES). Die Bibliothek kann aber<br />
auch ggf. darauf verzichten (z. T. BAW, HES, MEC). BAY <strong>und</strong> HAM verzichten auf<br />
unveränderte Neuauflagen.<br />
Verschiedene Ausgaben: Existieren verschiedene Ausgaben, die sich nicht nur<br />
durch den Einband unterscheiden (z. B. Dünndruck-, Studien- oder Luxusausgabe),<br />
genügt die Normalausgabe (DDB, BAW, BAY, NRW, SAA), BAW <strong>und</strong> BER<br />
verlangen die Ausgabe in der dauerhaftesten Form.<br />
Mikroformausgabe: Erscheint ein Text inhaltlich identisch in einer Papier- <strong>und</strong> anderen<br />
Ausgabe, so ist in DDB, BAY <strong>und</strong> NRW die Papierausgabe abzuliefern.<br />
SAA wünscht die Ablieferung von allen Ausgabeformen („elektronische Publikation“,<br />
„Papier- oder andere Ausgabeform“). NRW bevorzugt bei Zeitschriften die<br />
Mikroformausgabe gegenüber Papier.<br />
Verschiedenartige Tonträgerausgaben: In DDB <strong>und</strong> NRW ist die Ausgabe mit<br />
längster Haltbarkeit abzuliefern.<br />
Elektronische Publikationen: SAA<br />
6.5.2 Auswertung des Fragebogens<br />
Diagramm 2 /entspricht Anlage 4/ bezieht sich auf den Sammelumfang (Frage 3).<br />
Von der LB Kiel lagen zu dieser Frage keine Antworten vor.
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
82,61%<br />
amtliche<br />
Druckschriften<br />
Diagramm 2<br />
- 45 -<br />
Was wird zusätzlich zum Buchhandelsschrifttum noch gesammelt?<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
100,00% 100,00%<br />
graue Literatur<br />
78,26%<br />
Videos<br />
82,61%<br />
Audio-<br />
Kassetten<br />
78,26%<br />
Musik-CDs<br />
86,96%<br />
CD-ROMs <strong>und</strong><br />
Computerdisketten<br />
Zeitschriften<br />
95,65%<br />
Zeitungen<br />
52,17%<br />
elektronische<br />
Publikationen<br />
Die Nicht-Buch-Materialien werden von den meisten Bibliotheken gesammelt, oft<br />
in Auswahl. Vorsicht ist geboten bei den elektronischen Publikationen: Es ist<br />
möglich, dass darunter von den Bibliotheken solche in physischer Form verstanden<br />
wurden. Das machten Kommentare in einigen Fragebögen deutlich, in denen<br />
die Sammlung dieser Kategorie verneint wurde. Gemeint sind Online- oder Netzpublikationen.<br />
Da im sachsen-anhaltischen Pressegesetz der Begriff „elektronische<br />
Publikation“ explizit genannt ist <strong>und</strong> im Fragebogen CD-ROMs <strong>und</strong> Computerdisketten<br />
alternativ aufgeführt sind, war der Verfasserin diese Gefahr nicht bewusst.<br />
Weitere Erörterungen zu elektronischen Publikationen folgen im Kap. 6.5.3.3.<br />
Interessant ist der Vergleich der Sammelpraxis der fünf hessischen Pflichtexemplarbibliotheken,<br />
da ihnen das gleiche Gesetz zu Gr<strong>und</strong>e liegt. Die Spannbreite<br />
reicht vom völligen Verzicht auf die Sammlung von Nicht-Buch-Materialien (StUB<br />
Frankfurt) bis hin zur Sammlung sämtlicher Publikationsformen (HLB Wiesbaden)<br />
/s. Anlage 4/.<br />
6.5.3 Diskussion<br />
6.5.3.1 Begriff Druckwerk<br />
Die Diskussion entspannt sich im Wesentlichen um die juristische Definition der<br />
Sammelobjekte, ergo den Begriff des Druckwerkes. Es steht die Frage, inwieweit<br />
moderne Publikationsformen - insbesondere Videos <strong>und</strong> Online-Publikationen -
- 46 -<br />
per Definition erfasst werden <strong>und</strong> demzufolge auch der Ablieferungspflicht unterliegen.<br />
„Sowohl der Begriff „Druckwerk“ als auch der Begriff „Text“ erlauben durchgehend<br />
in allen Ländern die Sammlung von Mikroformen <strong>und</strong> physisch verbreiteten elektronischen<br />
Publikationen, da sie alle die Art des Vervielfältigungsverfahrens offen<br />
lassen, obwohl in einigen Ländergesetzen Datenträger sicherheitshalber eigens<br />
erwähnt werden.“ /Walter, S. 52/<br />
Zustimmung findet der im Gesetz über die Deutsche Bibliothek (§ 3 Abs. 1) verwendete<br />
weite Begriff des Druckwerks.: „Die Druckwerke im Sinne des Gesetzes<br />
sind alle Darstellungen in Schrift, Bild <strong>und</strong> Ton, die im Vervielfältigungsverfahren<br />
hergestellt <strong>und</strong> zur Verbreitung bestimmt sind.“ /Bibliotheksrechtliche; [Nr.] 12/<br />
„Bemerkenswert ist der für die Deutsche Bibliothek zur Anwendung kommende<br />
weite Begriff des Druckwerks. Dazu gehören außer den konventionellen Druckwerken,<br />
Landkarten <strong>und</strong> Ortsplänen auch Musiknoten., Mikroformen, Musik- <strong>und</strong><br />
Worttonträger, Dia-Serien <strong>und</strong>, soweit physisch verbreitet, elektronische Veröffentlichungen.<br />
/Wenzel, S. 723/<br />
Dazu Walter: „Diese Begriffsdefinition setzt einen materiellen Körper voraus, der<br />
Träger des Textes, Bildes oder Tons ist. Sie erlaubt, woran man bei der Wahl des<br />
Terminus in keinem Fall hatte denken können, ihre Ausdehnung auch auf elektronische<br />
Publikationen. Die Deutsche Bibliothek sah sich deshalb in der vorteilhaften<br />
Lage, elektronische Publikationen seit dem Augenblick, da sie auf dem Markt<br />
erscheinen, auch sammeln zu können. Erst mit der Entwicklung von Online-<br />
Publikationen steht sie vor einer Schranke, die nicht mit der gegenwärtigen Gesetzeslage<br />
zu überwinden ist.“ /Walter, S. 49 - 50/<br />
6.5.3.2 Ton- <strong>und</strong> Bildtonträger<br />
Wenzel erläutert zum Druckwerk im Sinne der Pressegesetze der Länder:<br />
„Auch Ton- oder Bildtonträger unterliegen also der Ablieferungspflicht. Das gilt<br />
insbesondere für Schallplatten, CD, Videokassetten usw.“ /Wenzel, S. 714/ Videos<br />
unterliegen nur dann nicht der Ablieferungspflicht, wenn sie im jeweiligen<br />
Gesetz ausdrücklich von der Ablieferungspflicht ausgenommen werden. Das ist in<br />
nur drei Gesetzen der Fall: nämlich im Gesetz über DDB <strong>und</strong> den Gesetzen von<br />
BAY <strong>und</strong> BER. BAY sammelt seinem Pflichtstückgesetz zum Trotz Videos. /vgl.<br />
Kap. 5.5.2/<br />
Walter bedauert, dass die Pflichtexemplarregelungen der Länder nicht über das<br />
Gesetz der Deutschen Bibliothek hinausgehen <strong>und</strong> behauptet: „Sie verzichten auf<br />
Video-Veröffentlichungen <strong>und</strong> erst recht auf Online-Publikationen. Sie warten ab,<br />
welche Erfahrungen Die Deutsche Bibliothek in der Zwischenzeit sammelt, wie sie<br />
die Probleme löst <strong>und</strong> wie sie ihre Ergebnisse in Gesetzesform bringen wird.“<br />
/Walter, S. 52/ Walter unterschätzt die Eigeninitiative der Länder bzw. Bibliotheken.<br />
In einigen Bibliotheken wird in Auswahl auch über die gesetzlichen Bestim-
- 47 -<br />
mungen hinaus gesammelt /vgl. Kap. 5.5.2, Diagramm 2/. Wenn auch das Bedauern<br />
Walters über den Verzicht der Bibliotheken auf Videos in seiner Absolutheit<br />
unbegründet ist, so besteht doch dringender Handlungsbedarf, die Sammlung<br />
von Videoproduktionen zentral zu regeln.<br />
Die „Tragfähigkeit <strong>und</strong> Flexibilität“ des Gesetzes über Die Deutsche Bibliothek hat<br />
sich dreißig Jahre lang „auch dort bewährt, wo die neue Informationstechnologie<br />
Anforderungen an seine Auslegungsmöglichkeit gestellt hat, die damals in keiner<br />
Weise voraussehbar waren.“ /Walter, S. 49/ Aber auf Gr<strong>und</strong> der neuen Technologien<br />
ist eine Novellierung vonnöten. Ein Entwurf liegt bereits vor. Der neue Terminus<br />
wird „Medienwerk“ lauten - damit sind alle möglichen Publikationsformen<br />
abgedeckt. Voraussichtlich wird die Definition lauten: „Medienwerke im Sinne dieses<br />
Gesetzes sind alle körperlichen <strong>und</strong> nichtkörperlichen Darstellungen in Schrift,<br />
Bild <strong>und</strong> Ton, die im Vervielfältigungsverfahren hergestellt <strong>und</strong> zur Verbreitung<br />
bestimmt sind.“ /Walter, S. 50/ Auch Publikationen mit bewegten Bildern (Videomaterialien<br />
<strong>und</strong> Filmwerke) werden demnächst in die Abgabe-, Sammel-, Archivierungs-<br />
<strong>und</strong> Nachweispflicht einbezogen werden.“ /Wenzel, S. 723/ Allerdings wird<br />
DDB auch in Zukunft keine Radio- <strong>und</strong> Fernsehprogramme - dafür gibt es eigene<br />
Archivierungsregeln - <strong>und</strong> keine Kinofilme sammeln. Es wird überlegt, dem B<strong>und</strong>esarchiv<br />
in Koblenz, das bereits u. a. deutsche Kinofilme sammelt, die systematische<br />
Sammlung aller deutschen Spielfilme zu übertragen. /Walter, S. 50/ Das<br />
wäre auch im Sinne der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Filmbibliotheken, die<br />
auf ihrem dritten Treffen 1997 ein Gesetz zur Pflichtabgabe von Videos an DDB<br />
forderte, da die Sammlung von Videoproduktionen noch immer von keiner zentralen<br />
Stelle übernommen werde. /Sarnowski, S. 2390/<br />
6.5.3.3 Elektronische Publikationen<br />
„Netzpublikationen (Nichtkörperliche Medienwerke) im Sinne des Sammelauftrags<br />
sind alle Darstellungen in Schrift, Bild <strong>und</strong> Ton, die zur Verbreitung über Datennetz<br />
bestimmt sind.“ /Lehmann, Klaus-Dieter, S.35/<br />
Lediglich in der sachsen-anhaltischen Verordnung über die Durchführung der Ablieferungspflicht<br />
von Druckwerken sind „ausdrücklich auch elektronische Veröffentlichungen<br />
in die Ablieferungspflicht eingeschlossen.“ /Walter, S. 52/ Walter<br />
bezieht sich offenbar auf § 2, Abs. 1 o. g. Verordnung: „Erscheint ein Druckwerk<br />
als elektronische Publikation, in einer Papier- oder in einer anderen Ausgabeform,<br />
ist dieses in allen Ausgabeformen abzuliefern.“ /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 590a/<br />
Damit sei Sachsen-Anhalt den anderen Ländern um einen Schritt voraus <strong>und</strong><br />
könne von Beginn an Online-Veröffentlichungen dokumentieren <strong>und</strong> sichern.<br />
Der Begriff „elektronische Publikation“ im Sinne der sachsen-anhaltischen Verordnung<br />
ist als Synonym zu „Netzpublikationen“ oder auch „Online-Publikationen“ zu<br />
verstehen.
- 48 -<br />
Da Netzpublikationen einem physischen Verfall unterliegen, müssen sie zwecks<br />
Langzeitarchivierung auf physische Datenträger kopiert werden.<br />
Das Gesetz über DDB umfasst „Darstellungen in Schrift, Bild <strong>und</strong> Ton, die im Vervielfältigungsverfahren<br />
hergestellt <strong>und</strong> zur Verbreitung bestimmt sind“, das ermöglicht<br />
die Einbeziehung elektronischer Publikationen auf physischen Trägern (CD-<br />
ROMs, Disketten, Magnetbänder), ,jedoch nicht die Pflichtablieferung von Netzpublikationen.<br />
Die dafür notwendige Gesetzesnovellierung wurde von Bibliothekaren,<br />
Verlegern, DDB <strong>und</strong> Regierungsvertretern diskutiert. Man ist sich einig, dass<br />
Netzpublikationen in den Sammelauftrag DDB eingeschlossen werden sollen. Der<br />
„signifikant andere Charakter von Netzpublikationen, der rasche technologische<br />
Wandel <strong>und</strong> Überlegungen zu sinnvollen Absprachen bei der Aufgabenverteilung<br />
zwischen den Partnern der Informationskette“ lassen es jedoch sinnvoll erscheinen,<br />
„zunächst mit einer Vereinbarung anstatt mit einem Gesetz zu beginnen,“<br />
/Lehmann, Klaus-Dieter, S. 36/<br />
Vereinbarungen oder Gesetzesnovellierungen der Länder werden folgen.<br />
6.6 Ausnahmen von der Ablieferungspflicht<br />
6.6.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
In den gesetzlichen Bestimmungen der Länder werden folgende Kategorien von<br />
der Ablieferung ausgeschlossen:<br />
• Amtliche Druckschriften, soweit sie ausschließlich amtliche Mitteilungen ent-<br />
halten. Die Pflichtablieferung amtlicher Druckschriften ist in gesonderten gesetzlichen<br />
Bestimmungen geregelt.<br />
• „Akzidenzdrucksachen, die sog. „harmlosen“ Druckwerke, also nur zu Zwecken<br />
des Gewerbes <strong>und</strong> Verkehrs, des häuslichen <strong>und</strong> geselligen Lebens dienenden<br />
Druckwerke wie Formulare, Preislisten, Werbedrucksachen, Familienanzeigen,<br />
Geschäfts-, Jahres <strong>und</strong> Verwaltungsberichte <strong>und</strong> dergleichen sowie Stimmzettel<br />
für Wahlen.“ /Presserecht 1997, S. 715/<br />
„Sofern das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> innerhalb der LPG geregelt ist, greifen die Beschränkungen<br />
ein, die sich aus den Begriffsbestimmungen ergeben .“ /Wenzel, S.<br />
715/ Die Begriffsbestimmungen des „Druckwerks“ sämtlicher Landespressegesetze<br />
schließen o. g. Kategorien aus. Pressegesetze, in die die Pflichtexemplarabgabe<br />
integriert ist, gelten in den Ländern BRA, BRE, HES, MEC, NIE, RPF,<br />
SAR, SAX, SAA, SCH <strong>und</strong> THU. Eine Ausnahme bildet SAX insofern, als es keine<br />
Definition des Druckwerks bietet.<br />
„Ist das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> sonderrechtlich geregelt, gelten diese Ausnahmen<br />
nicht automatisch. Die sondergesetzlich <strong>und</strong> im Verordnungswege geregelten<br />
Ausnahmen umfassen unterschiedliche Bereiche.“ /Wenzel, S. 715/ So ist im<br />
Pflichtexemplargesetz von NRW die Ausnahme der Ablieferung von amtlichen<br />
Druckschriften nicht explizit aufgeführt.
- 49 -<br />
Weitere Ausnahmen von der Anbietungs- <strong>und</strong> Ablieferungspflicht sind unterschiedlich<br />
geregelt:<br />
• Filmwerke, Laufbilder, Tonbildschauen <strong>und</strong> Einzellichtbilder (DDB)<br />
• Film- <strong>und</strong> Videoproduktionen (BAY, BER),<br />
• Laufbilder <strong>und</strong> Fotografien (BER)<br />
• Geschäfts-, Jahres- <strong>und</strong> Verwaltungsberichte, soweit sie nur unter Personen<br />
verbreitet werden, für die sie nach Gesetz oder Satzung bestimmt sind (DDB,<br />
BAY, HAM)<br />
• Schriften, die lediglich gewerblichen, geschäftlichen oder innerbetrieblichen<br />
Zwecken, der Verkehrsabwicklung oder dem häuslichen oder geselligen Leben<br />
dienen (DDB)<br />
• Schriften, die mit nicht abzuliefernden Druckwerken o. ä. erscheinen <strong>und</strong> ohne<br />
diese nicht verständlich sind (DDB),<br />
• Offenlegungs-, Auslege- <strong>und</strong> Patentschriften (DDB, BAW, BAY, BER, HAM),<br />
• Sonderdrucke aus Zeitungen, Zeitschriften <strong>und</strong> Sammelwerken, soweit sie kein<br />
eigenes Titelblatt haben (BAW), Sonderdrucke aus Druckwerken, die bereits<br />
abgeliefert worden sind (MEC), Sonderdrucke <strong>und</strong> Vorabdrucke, soweit sie<br />
nicht vom Verleger verbreitet werden (DDB, HAM),<br />
• Listen von Ausstellungsstücken ohne weiteren Text (DDB, BAW, HAM),<br />
• Referenten- <strong>und</strong> Schulungsmaterialien mit Manuskriptcharakter (BAW, NRW),<br />
• Vordrucke, Eintragungsbücher, Malbücher ohne Text, Modellbaubögen (DDB,<br />
BAW),<br />
• Texte, die in einer geringeren Auflage als zehn bzw. zwanzig Exemplare erscheinen,<br />
sofern es sich nicht um veröffentlichte Hochschul-Prüfungsarbeiten<br />
oder um Texte handelt, die einzeln auf Anforderung verlegt werde (DDB, BAY,<br />
HAM, NRW bzw. BER)<br />
• Bildliche Darstellungen auf Einzelblättern ohne Text (auch Mappen) (BAY)<br />
• Dissertationen, sofern sie nicht im Buchhandel erschienen sind (BER, MEC,<br />
NRW),<br />
• laufende Pressedienste (NRW),<br />
• Druckwerke mit bis zu vier Seiten Umfang - gilt nicht für Karten u. dgl. (DDB)<br />
• Original-Kunstmappen, ohne Titelblatt <strong>und</strong> Text (DDB)<br />
• Plakate, Wandzeitungen, Flugblätter (DDB, HAM)<br />
• Veranstaltungsprogramme ohne Abbildungen <strong>und</strong> Text (DDB, HAM)<br />
• Tageszeitungen, sofern sie nicht angefordert werden (DDB)<br />
• Reproduktionen von Bildern ohne Text (HES)<br />
In BAY ist die zuständige Landesbibliothek per Gesetz befugt, in Zweifelsfällen zu<br />
entscheiden.<br />
In den Ländern BAW, BAY, BER, BRA, HES, SAX <strong>und</strong> THU behält sich die zuständige<br />
Verwaltungsbehörde vor, auf weitere Gattungen von Texten, an deren<br />
Sammlung, Inventarisierung <strong>und</strong> bibliographischer Aufzeichnung kein öffentliches
- 50 -<br />
Interesse besteht, zu verzichten. Derartige Entscheidungen trifft in NRW die zuständige<br />
Bibliothek im Einvernehmen mit dem Kultusministerium des Landes. In<br />
HAM, MEC <strong>und</strong> NIE ist die zuständige Bibliothek zur Festlegung von Ausnahmen<br />
berechtigt.<br />
6.6.2 Diskussion<br />
Es herrscht auch unter den Bibliothekaren keine einhellige Meinung über die Notwendigkeit<br />
einer vollständigen Sammlung der Pflichtexemplare. Entsprechend der<br />
Gr<strong>und</strong>satzentscheidung des BVG aus dem Jahr 1981 stellt sich die Vollständigkeit<br />
der Schrifttumssammlung als oberstes Ziel des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s dar.<br />
/Sinogowitz 1987, S. 245/ Das Schrifttum soll für Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Forschung gesammelt <strong>und</strong> für spätere Generationen archiviert<br />
werden. Niemand kann heute voraussagen, welche Literatur einst für die Forschung<br />
interessant sein wird. Deshalb müsse die Sammlung auch den „Ballast“,<br />
also “sehr viel unnütze Literatur“ mit umfassen. Demnach dürfte den Bibliotheken<br />
kein generelles Recht eingeräumt sein, auf bestimmte Literaturgattungen zu verzichten.<br />
/Sinogowitz 1987, S. 246/<br />
Dagegen steht die Meinung, aus bibliotheksorganisatorischen Gründen auf die<br />
Sammlung von Druckwerken zu verzichten, an deren Erfassung „ein wissenschaftliches<br />
oder öffentliches Interesse nicht besteht“. /Lohse, Hartwig 1985, S.<br />
227 <strong>und</strong> 234 - 235/ Dem wurde in den gesetzlichen Bestimmungen mehr oder<br />
weniger entsprochen, z. B. durch Ausschluss der Akzidenzdrucksachen. Lohse<br />
denkt weiterhin an Großdruckbücher, „Taschenbuchausgaben von Werken des<br />
gleichen Verlages bzw. von anderen Verlagen im Pflichtbereich“, Groschenhefte,<br />
„Anleitungen aller Art (Hobbyliteratur)“, Prüfungsanleitungen, Erbauungsliteratur,<br />
Dissertationen, Pressedienste, Loseblattwerke. /Lohse, Hartwig 1985, S.<br />
235 - 238/ Lohse stellt die Frage, ob es wirklich notwendig ist, Loseblattwerke regional<br />
<strong>und</strong> an der Deutschen Bibliothek nachzulegen <strong>und</strong> die veralteten Blätter<br />
aufzubewahren. Lohse schlägt außerdem vor, auch andere potentielle Sammler,<br />
z. B. universitäre <strong>und</strong> kommunale Archive, in die Sammlung mit einzubeziehen.<br />
/Lohse, Hartwig 1985, S. 233 - 234/ Er denkt dabei z. B. an „hochschulpolitische<br />
Periodika studentischer Gruppen“ <strong>und</strong> „graue Literatur der Hochschulen“, ebenso<br />
wie Raub. /Raub, S. 82/ Auch fünf Jahre später stellt Lohse die Rationalität der<br />
juristischen Begründung für die doppelte (heute sogar dreifache) Sammlung in<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern in Frage. Er meint, der B<strong>und</strong> wäre in erster Linie an der bibliographischen<br />
Erfassung, weniger an der Archivierung des gesamten Schrifttums<br />
seines „Wertes“ wegen interessiert. Lohse hat als langjähriger Direktor der UB<br />
Bonn offensichtlich viele Erfahrungen mit Selbstverlegern sammeln können <strong>und</strong><br />
gibt zu bedenken, dass „es i.d.R. jedem Schenker größtes Vergnügen bereitet,<br />
sein Buch, für das er keinen Verleger gef<strong>und</strong>en hat, in einer Bibliothek zu wissen.“<br />
/Lohse, Hartwig 1990, S. 368/ In der Tat führen die neuen technischen Möglich-
- 51 -<br />
keiten (Kopierer, einfache Bindeverfahren, Netzpublikationen) dazu, dass Verlegertätigkeit<br />
praktisch für jedermann zu bewerkstelligen ist. Die immer größer werdende<br />
Publikationsflut stellt die Bibliotheken vor Probleme, die durch die Diskussion<br />
der Sammelgr<strong>und</strong>sätze zu klären sind.<br />
6.7 Vergütungsregelung<br />
6.7.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
Bis zur Entscheidung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts vom 14. Juli 1981 war die<br />
Vergütungsfrage besonders umstritten. Das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht hat entschieden,<br />
dass eine entschädigungslose Ablieferung verfassungskonform sei.<br />
Dem entsprechen das Gesetz über die Deutsche Bibliothek <strong>und</strong> die Ländergesetze.<br />
Mit Ausnahme von SAR <strong>und</strong> RPF wird die Kostenerstattung gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
ausgeschlossen. Im SAR hat der Verleger bzw. Drucker Anspruch auf angemessene<br />
Entschädigung, diese umfasst auch die Kosten der Versendung. In RPF<br />
kann der Verleger bzw. Drucker „bei Anlieferung eine Entschädigung in Höhe seiner<br />
Selbstkosten fordern“. /Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 583/<br />
In BAW gilt folgende Sonderregelung: das zweite abzuliefernde Exemplar wird<br />
vergütet, das erste nur im Falle der Unzumutbarkeit zu fünfzig Prozent des Ladenpreises.<br />
Die entschädigungslose Ablieferung ist nach der Entscheidung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts<br />
allerdings nicht für mit großem Kostenaufwand <strong>und</strong> in kleiner<br />
Auflage hergestellten Druckwerke zulässig. /Wenzel, S. 716/ Demzufolge gelten<br />
folgende Vergütungsregelungen wegen Unzumutbarkeit auf Gr<strong>und</strong> hoher Herstellungskosten<br />
<strong>und</strong>/oder bei kleiner Auflage: Es werden entweder die Selbstkosten<br />
(Herstellungskosten) erstattet (BRA, HAM, HES, NRW, THU), eine angemessene<br />
Entschädigung gewährt (BER) oder bis zur Hälfte des Ladenpreises erstattet<br />
(DDB, BAW, BAY, MEC, NIE, SAX, SAA).<br />
Von der Unzumutbarkeit einer entschädigungslosen Ablieferungspflicht ist nach<br />
der Entscheidung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts auszugehen, wenn die Unentgeltlichkeit<br />
wegen der hohen Herstellungskosten <strong>und</strong> der niedrigen Auflage eine<br />
wesentlich stärkere Belastung des Verlegers bedeutet als im Normalfall. In einigen<br />
Ländern sind keine gesetzlichen Maßgaben vorgesehen, in den anderen gelten<br />
folgende unterschiedlichen Maßstäbe:<br />
• Auflage bis zu 500 Exemplaren <strong>und</strong> Herstellungskosten ab 100 DM pro Exemplar<br />
der Auflage : BRA<br />
• Auflage bis zu 500 <strong>und</strong> Kosten ab 200 DM: NIE, SAA<br />
• Auflage bis zu 500 <strong>und</strong> Kosten ab 150 DM bzw. 45 DM bei natürlichen, nicht<br />
gewerbsmäßigen Personen: DDB, BAY<br />
• Auflage unter 300 <strong>und</strong> Kosten über 300 DM : NRW<br />
• Auflage bis zu 300 <strong>und</strong> Kosten über 200 DM: HAM
- 52 -<br />
Die Entschädigung setzt einen schriftlich begründeten Antrag voraus, der in BER,<br />
MEC, NIE, SAX, SAA innerhalb eines Monats bzw. vier Wochen nach Ablieferung<br />
zu stellen ist, in BRA, HAM <strong>und</strong> THU nach 2 Wochen, in DDB, BAY <strong>und</strong> NRW mit<br />
Lieferung. Ein fristloser Antrag genügt in BAW <strong>und</strong> HES.<br />
Die Herstellungskosten werden nicht erstattet, wenn die Herstellung des Druckwerks<br />
aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde in DDB, BAY, BRA, HES, NIE <strong>und</strong><br />
SAA.<br />
BRE <strong>und</strong> SCH haben keine gesetzliche Regelung getroffen.<br />
6.7.2 Auswertung des Fragebogens<br />
Frage 14: Die LB Speyer bevorzugt eine Entschädigung erst ab einem definierten<br />
Betrag, so wie es ja überwiegend üblich ist.<br />
Die ZLB Berlin vermisst eine Durchführungsbestimmung: „Alle Gesetzestexte sind<br />
eine Frage der Auslegung.“ So beantragen fast alle kleineren Verlage Kostenerstattung<br />
nach § 5 PflExG. Dieser Paragraph besagt, dass eine Entschädigung<br />
gewährt wird, wenn „die unentgeltliche Abgabe wegen der hohen Herstellungskosten<br />
<strong>und</strong> der kleinen Auflage des Werkes unzumutbar“ ist. Die ZLB orientiert sich<br />
dabei an den Gepflogenheiten DDB (Bezuschussung von maximal 50 % des Ladenpreises<br />
bei einer Auflage von bis zu 500 Exemplaren), was aber gesetzlich für<br />
Berlin noch nicht geregelt ist.<br />
6.7.3 Diskussion<br />
Um das Vorliegen einer unzumutbaren Belastung beurteilen zu können, muss der<br />
Verleger einen Antrag auf Entschädigung stellen. In diesem hat er die Herstellungskosten,<br />
Auflagenhöhe <strong>und</strong> Ladenpreis anzugeben. Die Herstellungskosten<br />
umfassen „Aufwendungen für Satz, Papier, Druck, Einband <strong>und</strong> Autorenhonorar“.<br />
/Pohley, S.14/<br />
Es könnte schwierig werden, die Entschädigung bei Texten, die auf Bestellung<br />
verlegt werden, zu bewerkstelligen, da nicht feststeht, welche Auflage einst erreicht<br />
werden wird. Im Falle eines Entschädigungsantrages „bliebe in der Praxis<br />
nur die Möglichkeit, über den Antrag erst zu entscheiden, wenn die Auflagenhöhe<br />
mit einiger Sicherheit abzusehen ist.“ /Pohley, S.14/<br />
6.8 Durchsetzung der Verpflichtung<br />
6.8.1 Gesetzliche Bestimmungen<br />
6.8.1.1 In den Ländern<br />
„Die Durchsetzung der Anbietungs- bzw. Ablieferungspflicht ist auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
des jeweils auzuwendenden Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG) möglich.<br />
Anzuwenden ist das in dem jeweiligen Lande geltende VwVG.“ /Wenzel, S.<br />
717/ Im Bereich des <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>es kommen die Ersatzvornahme <strong>und</strong> die
- 53 -<br />
Festsetzung eines Zwangsgeldes als adäquate Mittel des Verwaltungszwangs in<br />
Betracht. /Pohley, S. 16; Sinogowitz 1987, S. 263/<br />
Unter Ersatzvornahme ist die anderweitige Beschaffung des Pflichtexemplars auf<br />
Kosten des Ablieferungspflichtigen zu verstehen. /Wenzel, S. 717/ Wenn Ersatzvornahme<br />
nicht möglich ist, kann Zwangsgeld verhängt werden. Die Festsetzung<br />
eines Zwangsgeldes „dient dazu, den Pflichtigen zur Vornahme der geschuldeten<br />
Handlung anzuhalten.“ /Giemulla, S. 297/<br />
Ordnungswidrigkeit: Darüber hinaus bedeutet die Nichterfüllung der Anbietungsbzw.<br />
Ablieferungspflicht in den meisten Ländern (außer DDB, BAW, BAY, BRE,<br />
NIE, SAX, THU) eine Ordnungswidrigkeit. Das Pflichtexemplargesetz von NRW<br />
bestimmt: „(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verpflichtung<br />
zur Ablieferung von Pflichtexemplaren . nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt.“<br />
Ein entsprechender Passus findet sich auch in den gesetzlichen Bestimmungen<br />
von BER, BRA, HAM, HES, MEC, NRW, RPF, SAR, SAA, SCH. Lediglich<br />
in NRW wird explizit darauf verwiesen, dass der Verleger „zur Beschaffung <strong>und</strong><br />
Nachlieferung eines Ersatzexemplars verpflichtet“ bleibt. „Kommt er dieser Verpflichtung<br />
auch nach Aufforderung innerhalb eines Monats nicht nach, so handelt<br />
er ordnungswidrig.“ In den meisten Ländern wird die Zuwiderhandlung gegen die<br />
Anbietungs- bzw. Ablieferungspflicht theoretisch schon bei Fahrlässigkeit geahndet,<br />
in RPF nur bei vorsätzlichem Handeln.<br />
Geldbuße: I. d. R. kann die Ordnungswidrig mit einer Geldbuße geahndet werden.<br />
Der Betrag differiert in den nachfolgend aufgeführten Landesregelungen: bis zu<br />
10 000 DM (BER, HES, NRW, RPF, SAR, SAA, SCH); bis zu 50 000 DM (BRA);<br />
bis zu 100 000 DM (MEC). In HAM ist kein finanzieller Rahmen festgelegt.<br />
Zuständige Verwaltungsbehörde: entsprechend den Gesetzen über Ordnungswidrigkeiten<br />
sind das: Regierungspräsidium (HES, NRW); Landräte <strong>und</strong><br />
(Ober-)Bürgermeister der kreisfreien Städte (BRA, MEC, SCH); Bezirksregierung<br />
(RPF, SAA); untere staatliche Verwaltungsbehörden der allgemeinen Landesverwaltung<br />
(SAR).<br />
Verjährung: die Verfolgung der o. g. Ordnungswidrigkeiten verjährt in drei Monaten<br />
(BRA, HES, MEC, NRW, SAR, SAA) bzw. in sechs Monaten (BER, RPF). Die<br />
Frist beginnt mit Veröffentlichung oder Verbreitung des Druckwerks. Wird das<br />
Druckwerk in Teilen veröffentlicht oder verbreitet oder wird es neu aufgelegt, so<br />
beginnt die Verjährung erneut (BRA, SAR, SAA, SCH).<br />
6.8.1.2 In Sachsen-Anhalt<br />
Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen ist im Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br />
des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) vom 23. Juni 1994 /Gesetz 1994, S.<br />
710 - 722/ <strong>und</strong> im Gesetz über die öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung des Landes<br />
Sachsen-Anhalt (SOG LSA) /Gesetz 2000, S. 595 - 622/ neu gefasst am 16. November<br />
2000 geregelt.
- 54 -<br />
Voraussetzung zur Anwendung des Verwaltungszwanges ist, dass ein Verwaltungsakt<br />
(förmlicher Bescheid) zu Gr<strong>und</strong>e liegt. Dieser darf nur von einer selbstständigen<br />
Behörde, also einer Körperschaft, die den Status einer juristischen Person<br />
innehat, durchgeführt werden. Will eine Bibliothek einen Bescheid verschikken,<br />
muss sie dazu von ihrem Träger bevollmächtigt worden sein.<br />
Bevor ein Zwangsverfahren eingeleitet wird, muss der Verpflichtete förmlich mit<br />
Terminsetzung aufgefordert werden, die Publikation abzuliefern.<br />
Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten übernimmt die Bezirksregierung.<br />
Das ist im § 14 (4) LPG geregelt.: „Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1<br />
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bezirksregierung.“<br />
/Bibliotheksrechtliche, [Nr.] 590/ (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten<br />
regelt, dass die Verwaltungsbehörde zuständig ist, welche<br />
durch Gesetz bestimmt wird. /Schönfelder, [Nr.] 94, S. 14/) Da der Ordnungswidrigkeitstatbestand<br />
schon drei Monaten nach Veröffentlichung oder Verbreitung des<br />
Druckwerks verjährt ist, kommt ihm kaum eine bibliothekspraktische Relevanz zu.<br />
6.8.2 Auswertung des Fragebogens<br />
Kein Bibliothekarin <strong>und</strong> kein Bibliothekar besuchte Qualifikations- <strong>und</strong> Fortbildungslehrgänge<br />
zum Verwaltungsrecht (Frage 7). Zehn Bibliotheken (45%) können<br />
auf einen Juristen im Hause zurückgreifen (Frage 8). Ein Zusammenhang mit<br />
Zwangsmaßnahmen ist jedoch nicht signifikant (Fragen 10 <strong>und</strong> 11). Verwaltungszwang<br />
wird angewendet in der WLB Stuttgart, der LB Speyer; der BSB München<br />
<strong>und</strong> der StUB Frankfurt (das entspricht 21 %). Vier Bibliotheken schalten einen Juristen<br />
ein (WLB Stuttgart, StUB Frankfurt, LB Schwerin <strong>und</strong> LB Speyer), die mit<br />
Ausnahme der WLB Stuttgart ggf. auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten<br />
(13 %).
Bibliothek keine weiteren<br />
Maßnahmen<br />
Kauf<br />
- 55 -<br />
Verfahren bei Nichtablieferung<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
Tausch<br />
Geschenk<br />
Mahnung<br />
Weiterleitung an den<br />
Hausjuristen<br />
Verwaltungszwang (z.B.<br />
Zwangsgelder,<br />
Bußgelder)<br />
Sonstiges<br />
Nichtablieferung<br />
als Ordnungswidrigkeit<br />
geahndet<br />
BLB Karlsruhe x x x x<br />
WLB Stuttgart x x x x<br />
BSB München x x x<br />
ZLB Berlin x x x x<br />
StLB Potsdam x x x x x x<br />
SUB Bremen x x x x<br />
HLB Darmstadt x x<br />
StUB Frankfurt x x x<br />
HLB Fulda x x<br />
GHB Kassel x x x<br />
HLB Wiesbaden x x<br />
LB Schwerin x x x<br />
NLB Hannover x x<br />
ULB Bonn x x x x<br />
ULB Düsseldorf x x x<br />
StB Mainz x x<br />
LB Speyer x x x x<br />
ULB Saarbrücken x x x<br />
SLB Dresden x x<br />
ULB Halle x x x x x<br />
LB Kiel x x x<br />
StB Lübeck x x<br />
ULB Jena x x x<br />
Gesamt 3 8 2 4 23 4 4 2 3 20 0<br />
Tabelle 3<br />
13,04%<br />
34,78%<br />
8,70%<br />
17,39%<br />
In dreizehn (56,5 %) Bibliotheken enden die Bemühungen um Eintreibung des<br />
Pflichtexemplars mit einer oder mehreren Mahnungen (Frage 10). Auch die Ersatzbeschaffung<br />
kommt häufig zur Anwendung, jedoch wird diese dem Säumigen<br />
i.d.R. nicht in Rechnung gestellt. Widersprüchlich ist das Verfahren an der BLB<br />
Karlsruhe, die zwar den Verwaltungszwang anwendet, indem sie bei Ersatzbeschaffung<br />
durch Kauf die Kosten dem Säumigen in Rechnung stellt, bei vergriffenen<br />
Titeln aber die Kosten für eine Ersatzbeschaffung als Kopie selbst trägt. Insgesamt<br />
ist festzustellen, dass selten versucht wird, die Durchsetzung der Ablieferungspflicht<br />
mit juristischen Mitteln durchzusetzen. Gründe dafür können Unsicherheit<br />
über Verfahrensweisen <strong>und</strong> hoher Verwaltungsaufwand sein.<br />
Vier Bibliotheken (17%) bejahten, dass der Anspruch auf ein Pflichtexemplar<br />
schon einmal nicht geltend gemacht werden konnte, weil die Verjährungsfrist ab-<br />
100,00%<br />
17,39%<br />
21,05%<br />
8,70%<br />
= keine Angaben<br />
ja<br />
13,04%<br />
nein<br />
86,96%<br />
weiß nicht<br />
0,00%
- 56 -<br />
gelaufen war. Sechzehn Bibliotheken (70 %) verneinten dies, drei (13%) wussten<br />
es nicht (Frage 12).<br />
Die StB Mainz hätte gern ein Instrumentarium für Zwangsverfahren. Eine Verlängerung<br />
der Verjährungsfrist wird in den ULB Düsseldorf <strong>und</strong> Halle <strong>und</strong> der StB<br />
Mainz gewünscht (Frage 14).<br />
6.8.3 Diskussion<br />
6.8.3.1 Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Mahnungen<br />
Die Voraussetzung der Ablieferung von Pflichtexemplaren ist, dass die gesetzlichen<br />
Bestimmungen den Verpflichteten auch bekannt sind. Viele Verpflichtete<br />
kennen ihre Pflichten nicht <strong>und</strong> liefern nach Inkenntnissetzung, z. B. durch die<br />
empfangsberechtigte Bibliothek. Es bleibt zu wünschen, dass das kulturpolitische<br />
Ziel des Pflichtexemplares „einer möglichst breiten Öffentlichkeit bewusst werden<br />
würde.“ /Pohley, S. 16/ So wurden in Brandenburg R<strong>und</strong>schreiben „an alle Ämter,<br />
Institutionen, Verlage <strong>und</strong> Drucker in Brandenburg versandt.“ /Bornemann, S. 2/<br />
Für Hessen stehen Informationen zum Pflichtexemplar im Internet.<br />
/<strong>Pflichtexemplarrecht</strong>es/ Eine praktikable Lösung zum Erreichen aller Verpflichteten<br />
scheint ein in größeren Zeitabständen erfolgender Hinweis auf die Pflichtexemplargesetzgebung<br />
in Massenmedien, z. B. in der regionalen Tagespresse, zu<br />
sein.<br />
Dessen ungeachtet sind Mahnungen die wichtigste <strong>und</strong> wirkungsvollste Maßnahme,<br />
um Nichtablieferungen zu verhindern.<br />
6.8.3.2 Verwaltungszwang <strong>und</strong> Verfolgung als Ordnungswidrigkeit<br />
Es sind Verwaltungszwang (Ersatzvornahme, Zwangsgeld) <strong>und</strong> Verfolgung als<br />
Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden kann, zu unterscheiden.<br />
„Das Zwangsverfahren vollzieht sich im Regelfall in drei aufeinanderfolgenden<br />
Stufen: Androhung, Festsetzung <strong>und</strong> Anwendung des Zwangsmittels. Zuständig<br />
ist die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat.“ /Giemulla, S. 305/ Das<br />
kann eine selbstständige Bibliothek oder eine Bibliothek sein, die von ihrem Träger<br />
dazu bevollmächtigt wurde.<br />
Zwangsgeld <strong>und</strong> Bußgeld unterscheiden sich. Das Zwangsgeld ist „ein reines<br />
Beugemittel“, also ein „Mittel zur Erzwingung künftigen Verhaltens“, keine Strafe.<br />
Bußgeld dagegen ist eine Sanktion für begangenes Unrecht. Zwangsgeld kann<br />
neben Bußgeld verhängt werden. /Giemulla, S. 298/<br />
Der B<strong>und</strong> <strong>und</strong> die Länder BAW, BAY, BRE, NIE, SAX <strong>und</strong> THU verzichten in ihrer<br />
Gesetzgebung auf die Schaffung des Tatbestands Ordnungswidrigkeit, der mit<br />
Bußgeld belegt werden kann. Der bayerische Gesetzgeber hielt „die Möglichkeit<br />
der Beitreibung ausstehender Pflichtstücke auf dem Wege des Verwaltungszwangs<br />
für ausreichend“. /Sinogowitz 1987, S. 263/ Die Verfolgung <strong>und</strong> Ahndung
- 57 -<br />
als Ordnungswidrigkeit wird kaum praktiziert, ihre Nennung im Gesetz hat überwiegend<br />
eine psychologische Wirkung. /Picard 1980, S. 6/ Picard stimmt Raubs<br />
Äußerung zu: „Dies Schwert des Gesetzes war von Anfang an stumpf.“ /Raub, S.<br />
74/<br />
In keinem Gesetz wird auf die Möglichkeit der zwangsweisen Durchsetzung der<br />
Verpflichtung per Ersatzvornahme oder Zwangsgeld hingewiesen, obwohl das<br />
schon 1980 viele Bibliotheken für „dringend geboten“ hielten. /Picard 1980, S. 6/<br />
Auch Raub empfahl für künftige Gesetzesnovellierungen eine entsprechende Erweiterung.<br />
/Raub, S. 92/ Einige Vorgängergesetze der heute gültigen Pflichtexemplarbestimmungen<br />
verwiesen auf die Möglichkeit der zwangsweisen Durchsetzung<br />
der Verpflichtung. Jedoch entstammten diese Gesetzte der DDR bzw. dem Dritten<br />
Reich <strong>und</strong> sind wohl mit Ressentiments behaftet 2 .<br />
Einigen Pflicht-Bibliothekaren dürfte der juristische Unterschied zwischen Verwaltungszwang<br />
nach dem Verwaltungsvollstreckungsrecht <strong>und</strong> der Verfolgung als<br />
Ordnungswidrigkeit nicht geläufig sein. Das verw<strong>und</strong>ert nicht, denn kein Bibliothekar<br />
ist verwaltungsrechtlich geschult, nicht jeder Bibliothek steht ein Jurist zur<br />
Verfügung. Selbst wer rechtlichen Beistand sucht, wird mitunter unzureichend beraten:<br />
Exemplarisch sei hier eine Bibliothekarin aus der StB Mainz zitiert.: „$ 21<br />
Ordnungswidrigkeiten so ändern, dass die Bibliotheken tatsächlich etwas in der<br />
Hand haben. Nach Auskunft des Rechtsamts der Stadt Mainz (25.9.1996) verjährt<br />
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 22,2 bereits sechs Monate<br />
nach Veröffentlichung des Werks. Bedenkt man, dass die Bibliothek manchmal<br />
erst mit Verzug von einer Neuerscheinung erfährt, muss sie eigentlich in unüblich<br />
kurzen Rhythmen . mahnen, um die Chance für ein Ordnungswidrigkeitsverfahren<br />
nicht zu verlieren. Man kann zwar davon ausgehen, dass ca. 90 % der Verleger in<br />
unserem Zuständigkeitsbereich ordentlich abliefern. Für den Rest wünscht man<br />
sich jedoch manchmal die Möglichkeit, härter „drohen“ <strong>und</strong> dann auch handeln zu<br />
können.“ /Anlage 7/ Die Bibliothek wurde zwar in Sachen Ordnungswidrigkeiten<br />
korrekt beraten, aber dass die Alternative Verwaltungszwang den Mainzer Bibliothekaren<br />
auch bekannt ist, darf bezweifelt werden. Offenbar ist die Auffassung<br />
verbreitet, dass mit Ablauf der Verjährungsfrist auch die Frist für Zwangsmaß-<br />
2 In der DDR z. B. galt die Anordnung (Nr. 1) über die Ablieferung von Pflichtexemplaren vom 4.<br />
Juli 1960. In ihr ist das Erheben einer Verzugsgebühr bei nicht fristgerechter Lieferung vorgesehen.<br />
Weiter heißt es dort: „Wird die Ablieferungspflicht trotz Mahnung nicht erfüllt, kann der Empfangsberechtigte<br />
auf Kosten des Ablieferungspflichtigen an Stelle der nicht gelieferten Pflichtexemplare<br />
gleiche Exemplare beschaffen oder ... Ersatzexemplare ( z. B. Reproduktionen, Fotokopien) anfordern<br />
oder herstellen lassen. Die ... Maßnahmen sind erst zulässig, wenn nach einer Androhung eine<br />
Frist von vier Wochen verstrichen ist.“ /Rechts-ABC, S. 262/<br />
Das Hamburger Freistückegesetz von 1934 verwies in § 5 auf die Möglichkeiten von Verwaltungs<br />
zwang <strong>und</strong> Ersatzvornahme, in § 6 auf die Strafbestimmung. /Will 1955, S. 135/
- 58 -<br />
nahmen abgelaufen ist. (Folgte man diesem Ansatz, so wären Ersatzvornahme<br />
<strong>und</strong> Zwangsgeld de facto unmöglich, da die Verjährungsfrist schon nach wenigen<br />
Monaten abgelaufen ist.) Die Praxis an der ULB Halle jedenfalls bestätigt dies.<br />
Im Gr<strong>und</strong>e ist es nicht einzusehen, dass Bibliotheksmitarbeiter Pflichtexemplare<br />
„erbetteln“. Das zeigt aber auch das Dilemma, in dem viele Bibliothekare stecken:<br />
verwaltungsrechtlich nicht geschult, sind ihnen die Instrumentarien für weitere<br />
Maßnahmen nicht bekannt. Sie müssen den Vorgang an kompetente Mitarbeiter,<br />
ggf. einen Juristen im Hause, oder den Träger weitergeben, damit diese Verwaltungszwang<br />
oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Angriff nehmen können.<br />
Diese Maßnahmen werden jedoch kaum angewendet. Eine Alternative könnte<br />
sein, im Bedarfsfalle externe juristische Beratung anzunehmen, wie sie Haager für<br />
Bibliotheken empfiehlt. /Haager, S. 281 - 286/<br />
7 Schlussfolgerungen<br />
„Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> hat noch keinen für alle Seiten akzeptierbaren Stand erreicht.“<br />
/Barton 1990, S. 226/ Diese Aussage hat auch heute noch seine Gültigkeit,<br />
das bestätigen 19 der 23 befragten Bibliotheken (83 %, Frage 1).<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> ist nach wie vor umstritten. Während einige gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Fragen ausdiskutiert sind, so z. B. die kulturpolitische Berechtigung des<br />
Pflichtexemplars oder die Vereinbarkeit mit dem Gr<strong>und</strong>gesetz, kommen andere<br />
Probleme seit Jahrzehnten nicht aus dem Stadium fachlicher Debatten heraus<br />
<strong>und</strong> es stellt sich die Frage, warum die parlamentarisch-juristische Umsetzung<br />
nicht in Gang kommt. Dennoch: Änderungen im kulturpolitischen Bereich lassen<br />
sich durchsetzen. Das gelte um so mehr, wenn sich die Länder zu einer gemeinsamen<br />
Konzeption zusammenfinden müssten. Bevor überhaupt daran gedacht<br />
werden könne, an die Regierungen <strong>und</strong> die Parlamente heranzutreten, müsse zuerst<br />
unter den Bibliothekaren ein Konsens erzielt werden. Kann dieser erreicht<br />
werden, so bleibt es der Zukunft überlassen, wann die Gunst der St<strong>und</strong>e es erlaubt,<br />
diese Vorstellungen durchzusetzen. /Kirchner 1989, S. 555/ Allerdings besteht<br />
die Gefahr, die Gunst der St<strong>und</strong>e zu verpassen: So sind sich zwar die Experten<br />
einig, dass das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> nicht in das Presserecht gehört, trotzdem<br />
haben Anfang der neunziger Jahre alle neuen Länder diese Rechtsform gewählt.<br />
Auch die Uneinheitlichkeit der Rechtsvorschriften wird immer wieder kritisiert.<br />
Schon vor Jahren bestand die Forderung, sich „bei künftigen Novellierungen auf<br />
eine gemeinsame, sorgfältig durchdachte Optimalregelung“ festzulegen.<br />
/Sinogowitz 1987, S. 251/ In diesem Sinne auch Barton: Es ginge den Bibliotheken<br />
heute nicht mehr um größtmögliche Ausweitung ihres Rechtsanspruchs, sondern<br />
um sinnvolle Anwendung <strong>und</strong> Einheitlichkeit innerhalb der Länder. „Nur bei<br />
moderater <strong>und</strong> ländereinheitlicher Behandlung des Pflichtexemplareinzugs wer-
- 59 -<br />
den die Auseinandersetzungen nachlassen. Davon ist man zur Zeit weit entfernt.“<br />
/Barton 1990, S. 225/<br />
Während in Deutschland Pflichtexemplarexperten um Konsens ringen, haben sich<br />
die Rahmenbedingungen um die Jahrtausendwende derart verändert, dass die<br />
Bibliotheken ihren Standpunkt neu bestimmen müssen. Dazu gehören die rasante<br />
Ausbreitung der elektronischen Medien, die immer noch stark ansteigende Buchproduktion<br />
in der Welt, „ein explodierendes <strong>und</strong> alle bisher gegebenen Grenzen<br />
überschreitendes Informationsangebot zu teilweise drastisch steigenden Preisen.<br />
Dagegen steht die Strukturkrise der öffentlichen Haushalte in Deutschland. Lösungsansätze<br />
zu Gunsten des Bildungswesens sind nicht in Sicht. In dieser Zeit<br />
sind die Aufgaben von Regionalbibliotheken zu überdenken <strong>und</strong> einer kritischen<br />
Öffentlichkeit neu darzustellen, .“/Dittrich 1998, S. 100/<br />
Diese breite Öffentlichkeit schließt Europa mit ein. Auf der Internationalen Konferenz<br />
„Lokal - Global. Bibliotheksgesetzgebung in Regionalen <strong>und</strong> Förderativen<br />
Systemen“ in München 1999 wurde der Schutz des in Bibliotheken aufbewahrten<br />
geistigen Erbes in einer Empfehlung für eine Bibliotheksgesetzgebung in Europa<br />
thematisiert: Der Zweck von Pflichtabgabegesetzen sollte die „Sammlung nationaler<br />
Bestände zur Bewahrung, Vermittlung <strong>und</strong> Entwicklung der nationalen Kultur<br />
für künftige Generationen; die Zusammenstellung <strong>und</strong> Veröffentlichung der nationalen<br />
Bibliographie; der Zugang zu archivierten Veröffentlichungen“ sein. Weitere<br />
Empfehlungen mit besonderem Bezug zu Deutschland sind z. B.: die Sammlung<br />
aller Kategorien von Veröffentlichungen, effiziente bibliographische Dienste <strong>und</strong><br />
Zugang zu den Pflichtexemplaren vorzugsweise durch automatisierte Netzwerke,<br />
ein vernünftiges Maß an Printmedien (3 - 5 Exemplare, gemäß dem nationalen<br />
Bedarf), Vermeidung der Überschneidung der Pflichtabgabe für Tonträger, audiovisuelle<br />
Medien, Film- <strong>und</strong> elektronisches Material wegen der hohen Konservierungskosten,<br />
Ahndung der Nichtablieferung durch finanzielle <strong>und</strong> andere Sanktionen,<br />
weiterhin Analyse <strong>und</strong> Förderung modellhafter Kooperation zwischen Pflichtexemplarbibliotheken,<br />
Klärung der rechtlichen, technischen <strong>und</strong> finanziellen<br />
Aspekte der Pflichtablieferung von elektronischen Publikationen. /Entwurf, S. 6/<br />
Bleibt nur zu wünschen, dass die Empfehlungen Gehör finden.
8 Literaturverzeichnis<br />
- 60 -<br />
Badekow, Helmut:<br />
Kassel entscheidet: Verleger Huber muß nicht abliefern / Helmut Badekow<br />
In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurter Ausgabe. - ISSN 0340-<br />
7373. - 44 (1988), 30, S. 1277<br />
Barton, Walter:<br />
Pflichtexemplar - Zeitung - Bibliothek / Walter Barton<br />
In: Zeitung <strong>und</strong> Bibliothek. - Pullach bei München, 1974. - S. 74 - 76<br />
Barton, Walter:<br />
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / Walter Barton<br />
In: Medienrecht. - 2. Aufl. - Neuwied [u.a.], 1990. - S. 222 - 226<br />
Befehle der Sowjetischen Militärischen Administration in Deutschland<br />
In: Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen. - Halle (Saale). - 2 (1946), 37, S. 402<br />
Beger, Gabriele:<br />
Agenda : Präsentation der Gr<strong>und</strong>sätze / Gabriele Beger<br />
In: Bibliotheksgesetzgebung in Europa. - Bad Honnef, 2000. - S. 79 - 80<br />
Beger, Gabriele:<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> : vom Schrifttum zum digitalen Werk ; eine juristische<br />
Betrachtung / Gabriele Beger<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2000. - S. 36 - 52. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Berz, Ernst-Ludwig:<br />
Pflichtexemplargesetzgebung in der BRD / Ernst-Ludwig Berz<br />
In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurter Ausgabe. - ISSN 0340-<br />
7373. - 28 (1972), 56, S. 1594 - 1597<br />
Bethge, Sigrid:<br />
Aufgaben <strong>und</strong> Verfahrensweisen einer regionalen Pflichtexemplarstelle, dargestellt<br />
am Beispiel der empfangsberechtigten Bibliotheken der Länder Schleswig-Holstein<br />
<strong>und</strong> Berlin / vorgelegt von Sigrid Bethge. - Hamburg, 1978. - 65 Bl.<br />
Hamburg, Fachhochsch., Diplomarbeit, 1978<br />
Bibliotheken ‘93 : Strukturen, Aufgaben, Positionen. - Berlin [u.a.], 1994. - VI, 182<br />
S.<br />
Bibliotheksrechtliche Vorschriften : mit Bibliographie zum Bibliotheksrecht / hrsg.<br />
von Ralph Lansky. - Frankfurt : Klostermann. - Losebl.-Ausg.<br />
[Hauptbd.]<br />
1. - 3. Aufl. - 1980<br />
2. - 3. Aufl. - 1980<br />
Bornemann, Marlies:<br />
Pflichtexemplarregelung in Brandenburg / Marlies Bornemann<br />
In: http://hub.ib.hu-berlin.de/Weitblick/v2/h2t3a.htm//10.06.00
- 61 -<br />
Busse, Gisela von:<br />
Das Bibliothekswesen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland : ein Handbuch. - 3., völlig<br />
neubearb. Aufl. des durch Gisela von Busse <strong>und</strong> Horst Ernestus begr. Werkes/ von<br />
Engelbert Plassmann <strong>und</strong> Jürgen Seefeld. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1999. - XII,<br />
510 S. : Ill., Kt.<br />
Denkschrift des Vereins Deutscher Bibliothekare über Notwendigkeit <strong>und</strong> Berechtigung<br />
des deutschen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - Frankfurt am Main - 7<br />
(1960), S. 375 - 380<br />
Deutsche Bibliotheksstatistik<br />
Teil B : Wissenschaftliche Bibliotheken<br />
Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut.<br />
1996 (1997)<br />
1997 (1998)<br />
1998 (1999)<br />
Dietsch, Heide:<br />
Aus der Arbeit der Pflichtexemplarstelle der Thüringer Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek<br />
/ Heide Dietsch<br />
In: Mitteilungen / Thüringer Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Jena. - 3 (1993), 6,<br />
S. 47 - 50<br />
Dittrich, Wolfgang:<br />
Aufgaben <strong>und</strong> Bedeutung von Regionalbibliotheken in der heutigen Zeit / von Wolfgang<br />
Dittrich<br />
In: De officio bibliothecarii. - Köln : Greven, 1998. - S. 100 - 115<br />
Dittrich, Wolfgang:<br />
Bibliotheken mit Pflichtexemplar in Deutschland / zsgest. von Wolfgang Dittrich. -<br />
Berlin : Deutsches Bibliotheksinst., 1995. - 97 S.<br />
Elias, Regina:<br />
Rechtskommission des DBI : Herbstsitzung 1998 / Regina Elias<br />
In: Bibliotheksdienst. - ISSN 0006-1972. - 33 (1999), 1, S. 110 - 113<br />
Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht / hrsg. von der Rechtskommission<br />
des Deutschen Bibliotheksinstituts ... - Berlin : Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinst.,<br />
2000. - 656 S. - (Dbi-Materialien ; 197)<br />
Entwurf einer Empfehlung für eine Bibliotheksgesetzgebung in Europa<br />
In: http://www.goethe.de/z/30/biblkonf/deempf.htm//26.02.01<br />
Flemming, Alfred:<br />
Das Recht der Pflichtexemplare / Alfred Flemming. - München : Beck, 1940. - VII,<br />
175 S.<br />
Zugl.: München, Univ., Diss., 1940<br />
Fligge, Jörg:<br />
Bibliothek der Hansestadt Lübeck / Jörg Fligge<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2000. - S. 101 - 106.<br />
- (Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)
- 62 -<br />
Fligge, Jörg:<br />
Schleswig-Holstein <strong>und</strong> Hamburg / Jörg Fligge<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2000. - S. 91 - 95. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Franke, Johannes:<br />
Die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckerzeugnissen mit besonderer Berücksichtigung<br />
Preußens <strong>und</strong> des Deutschen Reiches : unter Benutzung archivalischer<br />
Quellen / von Johannes Franke. - Berlin : Asher, 1889. - XIII, 234 S. - (Sammlung<br />
bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten ; 3)<br />
Galler, Heinz-Peter:<br />
Die <strong>Martin</strong>-<strong>Luther</strong>-Universität Halle-Wittenberg <strong>und</strong> ihre Bibliothek, die Universitäts<strong>und</strong><br />
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt : strukturelle Voraussetzungen <strong>und</strong> künftige<br />
Aufgaben / Heinz-P. Galler ; Heiner Schnelling<br />
In: Mitteilungsblatt der Bibliotheken in Niedersachsen <strong>und</strong> Sachsen-Anhalt. - ISSN<br />
0940-0133. - 107/108 (1998), S. 7 - 12<br />
Gattermann, Günter:<br />
Neues Pflichtexemplargesetz in Nordrhein-Westfalen / Günter Gattermann<br />
In: Bibliotheksdienst. - Berlin. - 27 (1993), 8, S. 1213 - 1215<br />
Gattermann, Günter:<br />
Zum Pflichtexemplargesetz / Günter Gattermann<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. -<br />
ISSN 0042-3629. - N.F. 43 (1993), 3, S. 321 - 322<br />
Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt.- Magdeburg<br />
5 (1994)<br />
11 (2000)<br />
Gesetzblatt der Provinz Sachsen-Anhalt<br />
Teil 1<br />
Halle (Saale)<br />
1 (1947)<br />
Gesetzsammlung für Anhalt. - Dessau<br />
(1926), 8<br />
Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten. - Berlin<br />
(1825), 1<br />
Giemulla, Elmar:<br />
Verwaltungsrecht : ein Basisbuch / von Elmar Giemulla ; Nikolaus Jaworsky ; Rolf<br />
Müller-Uri. - 6., erw. <strong>und</strong> überarb. Aufl. - Köln : Heymann, 1998. - XXXIV, 534 S.<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz für die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland : Textausgabe. - Stand: 15. November<br />
1994. - Bonn : B<strong>und</strong>eszentrale für Polit. Bildung, 1994. - 96 S.<br />
Haager, Michael:<br />
Externe juristische Beratung für Bibliotheken / Michael Haager<br />
In: Bibliothek. - ISSN 0341-4183. - 24 (2000), 3, S. 281 - 286
- 63 -<br />
Haas-Traeger, Evelyn:<br />
Eigentum <strong>und</strong> Verfassung : die Ablieferung von Pflichtexemplaren an Landesbibliotheken<br />
im Licht des Art. 14 GG / Evelyn Haas-Traeger<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - Frankfurt am Main. - 27<br />
(1980), 1, S. 20 - 30<br />
Hartwig, Otto:<br />
Die Pflicht-Exemplare der deutschen Buchhändler / Otto Hartwig<br />
In: Neuer Anzeiger für Bibliographie <strong>und</strong> Bibliothekswesen. - Dresden. - (1880), S.<br />
164 - 166 <strong>und</strong> S. 193 - 196<br />
Herzog, Rainer:<br />
400 Jahre Pflichtexemplar an der UB Jena / Rainer Herzog<br />
In: Mitteilungen / Thüringer Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Jena. - 3 (1993), 6,<br />
S. 43 - 46<br />
Jütte, Werner:<br />
Bibliotheksrecht / Werner Jütte<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - Frankfurt am Main. - 15<br />
(1978), S. 128 - 129<br />
Jütte, Werner:<br />
Zur Gültigkeit des deutschen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s : eine Entgegnung / Werner<br />
Jütte<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - Frankfurt am Main. - 3<br />
(1956), S. 83 - 101<br />
Karstedt, Peter:<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / Peter Karstedt<br />
In: Probleme des Wiederaufbaus im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. - Hamburg,<br />
1947. - S. 59 - 78<br />
Kaspers, Heinrich:<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / von Heinrich Kaspers<br />
In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurter Ausgabe. - 17 (1961),<br />
22, S. 373 - 379<br />
Kaspers, Heinrich:<br />
Zum <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> in Nordrhein-Westfalen / Heinrich Kaspers<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. -<br />
ISSN 0042-3629. - N.F. 10 (1960), S. 139 - 143<br />
Kirchner, Hildebert:<br />
Beschluß des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts vom 14. Juli 1981 - 1 BvL 24/78 - zum<br />
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / Hildebert Kirchner<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 29<br />
(1982), 2, S. 82 - 84<br />
Kirchner, Hildebert:<br />
Bibliotheks- <strong>und</strong> Dokumentationsrecht / von Hildebert Kirchner. - Wiesbaden : Reichert,<br />
1981. - XI, 410 S. - (Elemente des Buch- <strong>und</strong> Bibliothekswesens ; 8)
- 64 -<br />
Kirchner, Hildebert:<br />
Gedanken über Pflichtexemplare / Hildebert Kirchner<br />
In: Das Buch in Praxis <strong>und</strong> Wissenschaft. - Wiesbaden, 1989. - S. 553 - 567<br />
Kirchner, Hildebert:<br />
Notwendigkeit <strong>und</strong> Berechtigung des deutschen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s : (zur Denkschrift<br />
des Vereins Deutscher Bibliothekare vom 5. 9. 1960) ; Vortrag auf dem Bibliothekartag<br />
1961 in München) / Hildebert Kirchner<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 8 (1961),<br />
S. 380 - 387<br />
Kittel, Peter:<br />
Die neue Anordnung über die Ablieferung von Pflichtexemplaren vom 4. Juli 1960 /<br />
von Peter Kittel <strong>und</strong> Heinz Werner<br />
In: Zentralblatt für Bibliothekswesen. - Leipzig. - 75 (1961), 8, S. 348 - 353<br />
Krieg, Werner:<br />
Landesbibliotheks-Aufgaben in Nordrhein-Westfalen / Werner Krieg. - Köln : Greven,<br />
1979. - 66 S. - (Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen ; 2)<br />
Kühl, Kristian:<br />
§ 22 LPG : Presse-Ordnungswidrigkeiten / Kristian Kühl<br />
In: Presserecht. - 4., neubearb. <strong>und</strong> erw. Aufl. - München, 1997. - S. 940 - 967<br />
Kühl, Kristian:<br />
§ 24 LPG : Verjährung von Presse-Verstößen / Kristian Kühl<br />
In: Presserecht. - 4., neubearb. <strong>und</strong> erw. Aufl. - München, 1997. - S. 1020 - 1047<br />
Kunze, Horst:<br />
Die Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) / [Text:<br />
Horst Kunze]. - Leipzig : Harrassowitz, 1949. - 29 S. : Ill. - (Schriften zum Bibliotheks-<br />
<strong>und</strong> Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 1)<br />
Kunze, Horst:<br />
Gr<strong>und</strong>züge der Bibliothekslehre / Horst Kunze. - 4., neubearb. Aufl. - Leipzig,<br />
1976.- 602 S.<br />
Langer, Manfred:<br />
Das neue <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> in Sachsen-Anhalt / Manfred Langer<br />
In: Wissenschaftliche Bibliotheken nach der Wiedervereinigung Deutschlands. -<br />
Halle (Saale), 1996. - (Arbeiten aus der Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt<br />
in Halle a. d. Saale ; 42). - S. 187 - 200<br />
Lehmann, Hans Georg:<br />
Deutschland-Chronik : 1945 bis 1995 / Hans Georg Lehmann. - Bonn : B<strong>und</strong>eszentrale<br />
für Politische Bildung, 1995. - 574 S. : Ill. - (Schriftenreihe / B<strong>und</strong>eszentrale<br />
für Politische Bildung ; 332)<br />
Lehmann, Klaus-Dieter:<br />
Das elektronische Pflichtexemplar - die Rolle der Nationalbibliothek / Klaus-Dieter<br />
Lehmann<br />
In: Bibliotheken <strong>und</strong> Verlage als Träger der Informationsgesellschaft. - Frankfurt am<br />
Main, 1999. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ;<br />
74). - S. 33 - 43
- 65 -<br />
Lehmann, Klaus-Dieter:<br />
Verabschiedung von Dr. Bertold Picard / Klaus-Dieter Lehmann<br />
In: Dialog mit Bibliotheken. - ISSN 0936-1138. - 10 (1998), 3, S. 59 - 60<br />
Löffler, Klaus:<br />
Leserbrief zu den „Weiteren Gedanken über Pflichtexemplare“ von Hartwig Lohse /<br />
Klaus Löffler<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. -<br />
ISSN 0042-3629. - N.F. 41 (1991), S. 198<br />
Löffler, <strong>Martin</strong>:<br />
Die Gr<strong>und</strong>satzentscheidung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts zur Ablieferung von<br />
Pflichtexemplaren an staatliche Bibliotheken / <strong>Martin</strong> Löffler<br />
In: Festschrift Hans Joachim Faller. - München, 1984. - S. 435 - 442<br />
Löffler, <strong>Martin</strong>:<br />
Handbuch des Presserechts / begr. von <strong>Martin</strong> Löffler <strong>und</strong> Reinhart Ricker. - 4., neu<br />
bearb. Aufl. / von Reinhart Ricker. - München : Beck, 2000. - XLVI, 705 S.<br />
Löffler, <strong>Martin</strong>:<br />
Presserecht : Kommentar / <strong>Martin</strong> Löffler. - 2., völlig neu bearb <strong>und</strong> erw. Aufl. -<br />
München : Beck<br />
Bd. 2. Die Landespressegesetze der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. - 1968. - VIII,<br />
631 S.<br />
Löffler, <strong>Martin</strong>:<br />
Presserecht : Kommentar zum Reichsgesetz über die Presse <strong>und</strong> zum Presserecht<br />
der Länder sowie zu den sonstigen die Presse betreffenden Vorschriften / von <strong>Martin</strong><br />
Löffler. - München [u.a.] : Beck, 1955. - XXIII, 853 S.<br />
Lohmeier, Dieter:<br />
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel / Dieter Lohmeier<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2000. - S. 96 - 100<br />
Lohse, Helmut:<br />
Pflichtexemplar / Helmut Lohse<br />
In: Lexikon des Bibliothekswesens. - 2., neubearb. Aufl. - Leipzig. - 2 (1974), Sp.<br />
1083 - 1086<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Ausleihbeschränkungen bei Pflichtexemplaren / Hartwig Lohse<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. -<br />
ISSN 0042-3629. - N.F. 34 (1984), S. 81 - 82<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Die Zusammenlegung der beiden deutschen Nationalbibliotheken in Frankfurt a. M.<br />
<strong>und</strong> Leipzig <strong>und</strong> daraus resultierende Konsequenzen für das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong><br />
in B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern / Hartwig Lohse<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.<br />
V. - ISSN 0042-3629. - N.F. 41 (1991), 2, S. 166 - 169
- 66 -<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Kulturpolitische Bedeutung <strong>und</strong> Sammlungsprinzipien des regionalen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong>s:<br />
eine Antwort an Bertold Picard, auch „aus bibliothekarischer Sicht“ /<br />
Hartwig Lohse<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 32<br />
(1985), 6, S. 478 - 489<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Pflichtexemplar / H. Lohse<br />
In: Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2., völlig neubearb. Aufl. - Stuttgart. - 5<br />
(1999), S. 623 - 624<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Pflichtexemplar <strong>und</strong> Benutzung : Überlegungen aus der Sicht der UB Bonn / Hartwig<br />
Lohse<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. -<br />
ISSN 0042-3629. - N.F. 34 (1984), S. 261 - 270<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Über Namen von Bibliotheken : aktuelle <strong>und</strong> historische Betrachtungen zur Umbenennung<br />
der Universitätsbibliotheken Bonn, Münster <strong>und</strong> Düsseldorf in Universitäts-<br />
<strong>und</strong> Landesbibliotheken / Hartwig Lohse<br />
In: Impulse für Bibliotheken. - Essen, 1995. - (Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek<br />
Essen ; 19). - S. 145 - 154<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Vollständigkeit im <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> : Betrachtungen zum Sammelauftrag regionaler<br />
Pflichtbibliotheken unter besonderer Berücksichtigung der Frage, wann „kein<br />
wissenschaftliches oder öffentliches Interesse“ besteht / Hartwig Lohse<br />
In: Festschrift für Hildebert Kirchner zum 65. Geburtstag. - München, 1985. - S. 227<br />
- 231<br />
Lohse, Hartwig:<br />
Weitere „Gedanken über Pflichtexemplare“ / Hartwig Lohse<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.<br />
V. - ISSN 0042-3629. - N.F. 40 (1990), 4, S. 365 - 369<br />
Lohse, Helmut:<br />
Das Modell eines Pflichtexemplargesetzes auf der Gr<strong>und</strong>lage der gesetzlichen Regelungen<br />
sozialistischer Staaten / Helmut Lohse. Unter Mitarb. von Horst Halfmann.<br />
- Leipzig : Deutsche Bücherei, 1981. - 31 Bl.<br />
Lohse, Helmut:<br />
Probleme der Pflichtexemplargesetzgebung in sozialistischen Ländern / Helmut<br />
Lohse<br />
In: Bestandsaufbau, Pflichtexemplar, Schriftentausch. - Berlin, 1981. - S. 149 - 158<br />
Lux, Claudia:<br />
Im Veränderungsprozeß : die neue Zentral- <strong>und</strong> Landesbibliothek Berlin / Claudia<br />
Lux<br />
In: Buch <strong>und</strong> Bibliothek. - ISSN 0340-0301. - 51 (1999), 3, S. 186 - 190
- 67 -<br />
Meyer, Karl-Friedrich:<br />
Das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> aus juristischer Sicht / Karl-Friedrich Meyer<br />
In: Mitteilungen / Arbeitsgemeinschaft für Juristisches Bibliotheks- <strong>und</strong> Dokumentationswesen.<br />
- ISSN 0300-0990. - 13 (1983), S. 61 - 70<br />
Müller, Harald:<br />
Bibliotheksrelevante Gesetzgebung in Deutschland / Harald Müller<br />
In: Bibliotheksgesetzgebung in Europa. - Bad Honnef, 2000. - S. 43 - 48<br />
Müller, Harald:<br />
Elektronisches <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> oder das Recht des Bürgers auf ungehinderten<br />
Zugriff zu elektronisch gespeicherten Informationen / Harald Müller<br />
In: Von Gutenberg zum Internet. - Frankfurt a. M., 1997. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen<br />
<strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 68). - S. 199 - 212<br />
Oberländer, Annette:<br />
Die Geschichte der Regionalbibliographie in Sachsen-Anhalt : von den Anfängen<br />
bis zur Gegenwart / vorgelegt von Annette Oberländer. - Leipzig, 1994. - 85 Bl.<br />
Leipzig, Hochschule für Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Kultur (FH), Diplomarbeit, 1994<br />
<strong>Pflichtexemplarrecht</strong> in Hessen <strong>und</strong> Rheinhessen<br />
In: http://www.hebis.de/index.html//30.4.01<br />
Pflug, Günther:<br />
Verfassungsrecht : Pflichtablieferung der Verleger / Günther Pflug<br />
In: Mitteilungsblatt / Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.<br />
V. - ISSN 0042-3629. - N.F. 29 (1979), S. 311 - 314<br />
Picard, Bertold:<br />
Das Pflichtexemplar aus bibliothekarischer Sicht / Bertold Picard<br />
In: Mitteilungen / Arbeitsgemeinschaft für Juristisches Bibliotheks- <strong>und</strong> Dokumentationswesen.<br />
- ISSN 0300-0990. - 13 (1983), S. 87 - 103<br />
Picard, Bertold:<br />
Ein Jahrzehnt neues regionales <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> in Deutschland / Bertold Picard<br />
In: Bibliothek als Lebenselexier. - Leipzig, 1996. - S. 149 - 153<br />
Picard, Bertold:<br />
Neue Pflichtstückverordnung für die Deutsche Bibliothek in Kraft / Bertold Picard<br />
In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. - Frankfurt, M. - 39 (1983), 14, S.<br />
408 - 410<br />
Picard, Bertold:<br />
Sammelgrenzen, neue Medien <strong>und</strong> Zeitungssicherung : eine Pflichtexemplar-<br />
Tagung in der Deutschen Bibliothek / Bertold Picard ; Kai Walter<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - Frankfurt am Main. - 37<br />
(1990), 2, S. 170 -179<br />
Picard, Bertold:<br />
Zur b<strong>und</strong>esdeutschen Pflichtexemplar-Praxis / Bertold Picard<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 27<br />
(1980), 1, S. 1 -17
- 68 -<br />
Picard, Bertold:<br />
Zur Tauglichkeit der gesetzlichen Bestimmungen über die Ablieferungspflicht von<br />
Druckwerken an die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main / Bertold Picard<br />
In: Gutenberg-Jahrbuch. - ISSN 0072-9094. - 57 (1982), S. 51 - 57<br />
Pohley, Hanns G.:<br />
Die Neuregelung der Pflichtstückrechts in Bayern / Hanns G. Pohley<br />
In: Mitteilungen / Arbeitsgemeinschaft für Juristisches Bibliotheks- <strong>und</strong> Dokumentationswesen.<br />
- ISSN 0300-0990. - 15 (1987), S. 3 - 16<br />
Preisendanz, Karl:<br />
Für das einheitliche deutsche Pflichtexemplar / Karl Preisendanz<br />
In: Zentralblatt für Bibliothekswesen. - Leipzig. - 51 (1934), S. 405 - 416<br />
Presserecht : die Pressegesetze der Länder mit Durchführungsverordnungen, die<br />
presserechtlichen Vorschriften im Gr<strong>und</strong>gesetz, in den Länderverfassungen <strong>und</strong> in<br />
sonstigen Gesetzen ; Textausgabe / von Heinz Stöckel. - 8., neubearb. Aufl.,<br />
Stand: 1. April 1999. - München : Beck, 1999. - XIV, 254 S. - (Beck’sche Textausgaben)<br />
Raub, Wolfhard:<br />
160 Jahre Pflichtexemplare für Bonn <strong>und</strong> Münster : Geschichte der Ablieferungspflicht<br />
von Druckwerken an Bibliotheken mit Vorschlägen für eine Neuregelung /<br />
von Wolfhard Raub. - Köln : Greven, 1984. - 101 S. : Ill. - (Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen<br />
; 9)<br />
Rechts-ABC für Bibliothekare. - Ausg. 1983, 1. Aufl. - Leipzig : Bibliograph. Inst.,<br />
1983. - 506 S.<br />
Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit. - 3., überarb. <strong>und</strong> erw. Aufl. - Berlin :<br />
Deutsches Bibliotheksinst., 1998. - XV, 794 S.<br />
Reinhardt, Werner:<br />
Kommission des DBI für Erwerbung <strong>und</strong> Bestandsentwicklung, Bereich wissenschaftliche<br />
Bibliotheken : Frühjahrssitzung 1996 in Chemnitz / Werner Reinhardt ;<br />
Margot Wiesner<br />
In: Bibliotheksdienst. - ISSN 0006-1972. - 30 (1996), 7, S. 1238 - 1241<br />
Richter, Franz Helmut:<br />
Rechtspflege <strong>und</strong> Verwaltung /Franz Helmut Richter<br />
In: Historische Landesk<strong>und</strong>e Mitteldeutschlands. - 3. Aufl. - Würzburg. - Sachsen-<br />
Anhalt<br />
(1991), S. 151 -169<br />
Ritter, Renate:<br />
An Pflichten muß manchmal erinnert werden : auf <strong>und</strong> ab im <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> /<br />
Renate Ritter<br />
In: SLUB-Kurier. - ISSN 0863-0682. - 11 (1997), 2, S. 6<br />
Römer, Gerhard:<br />
Landesbibliothek / G. Römer<br />
In: Lexikon des gesamten Buchwesens. - 2., völlig neubearb. Aufl. - Stuttgart. - 4<br />
(1992), S. 641
- 69 -<br />
Sarnowski, Daniella:<br />
Filmbibliotheken : 3. Treffen der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Filmbibliotheken<br />
/ Daniella Sarnowski<br />
In: Bibliotheksdienst. - ISSN 0006-1972. - 31 (1997), 12, S. 2389 - 2391<br />
Scheschonk, Brigitte:<br />
Die Entwicklung der Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle<br />
(Saale) von 1945 - 1983 / Brigitte Scheschonk. - Halle (Saale) : Universitäts- <strong>und</strong><br />
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1989. - 78 S. - (Arbeiten aus der Universitäts<strong>und</strong><br />
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a. d. Saale ; 34)<br />
Schneider, Gabriele:<br />
Anhaltische Landesbücherei Dessau / Gabriele Schneider<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland.-Frankfurt am Main, 2000. - S. 212 - 214<br />
Schneider, Gabriele:<br />
Anhaltische Landesbücherei Dessau / Gabriele Schneider<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland.-Frankfurt am Main, 2000. - S. 212 - 214. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Schnelling, Heiner:<br />
Sachsen-Anhalt / Heiner Schnelling<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland.-Frankfurt am Main, 2000. - S. 203 - 206. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Schnelling, Heiner:<br />
Universitäts- <strong>und</strong> Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle / Heiner Schnelling<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland.-Frankfurt am Main, 2000. - S. 207 - 211. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Schönfelder, Heinrich:<br />
Deutsche Gesetze : Sammlung des Zivil-, Straf- <strong>und</strong> Verfahrensrechts / begr. von<br />
Heinrich Schönfelder. - 14. - 72. Aufl., Stand: 20. Juli 1990. - München : Beck. - Losebl.-Ausg.<br />
[Hauptbd.]<br />
Schreiber, Klaus:<br />
Das neue Pflichtexemplargesetz für Baden-Württemberg / Klaus Schreiber<br />
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 23<br />
(1976), S. 237 - 241<br />
Schwarz, Volker:<br />
Bemerkungen zum <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> aus der Sicht eines Verlegers / Volker<br />
Scharz<br />
In: Mitteilungen / Arbeitsgemeinschaft für Juristisches Bibliotheks- <strong>und</strong> Dokumentationswesen.<br />
- ISSN 0300-0990. - 14 (1984), S. 42 - 46<br />
Sedelmeier, Klaus:<br />
§ 7 LPG : Druckwerke / Klaus Sedelmeier<br />
In: Presserecht. - 4., neubearb. <strong>und</strong> erw. Aufl. - München, 1997. - S. 422 - 454
- 70 -<br />
Sinogowitz, Bernard:<br />
Fortschritte im deutschen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> : die Karlsruher Entscheidung <strong>und</strong><br />
das neue bayerische Pflichtstückgesetz / Bernard Sinogowitz<br />
In: Bibliotheksforum Bayern. - ISSN 0340-000X. - 15 (1987), S. 241 - 268<br />
Sinogowitz, Bernhard:<br />
Gedanken zum bayerischen <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / von Bernhard Sinogowitz<br />
In: Aus der Arbeit des Bibliothekars. - Erlangen, 1960. - (Schriften der Universitäts-<br />
Bibliothek Erlangen ; 4). - S. 195 - 202<br />
Stachnik, Ingeborg:<br />
Besucherbefragungen in Bibliotheken / Ingeborg Stachnik. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst.,<br />
1995. - 119 S. - (Arbeitshilfen / Deutsches Bibliotheksinstitut)<br />
Syré, Ludger:<br />
Arbeitsgruppe Regionalbibliographie : Herbsttagung in Koblenz / Ludger Syré<br />
In: Bibliotheksdienst. - ISSN 0006-1972. - 27 (1993), S. 44 - 46<br />
Syré, Ludger:<br />
Typ <strong>und</strong> Typologie von Regionalbibliotheken / Ludger Syré<br />
In: Regionalbibliotheken in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2000. - S. 13 - 35. -<br />
(Zeitschrift für Bibliothekswesen <strong>und</strong> Bibliographie : Sonderhefte ; 78)<br />
Treplin, Heinrich:<br />
Bibliotheksrecht / von Heinrich Treplin <strong>und</strong> Hildebert Kirchner<br />
In: Handbuch der Bibliothekswissenschaft.- 2., verm. <strong>und</strong> verb. Aufl. - Leipzig. - 2<br />
(1961). - S. 762 - 818<br />
Vorstius, Joris:<br />
Gr<strong>und</strong>züge der Bibliotheksgeschichte / von Joris Vorstius. - 5., erw. Aufl. - Leipzig :<br />
Harrassowitz, 1954. - 138 S.<br />
Walter, Kai:<br />
Das Pflichtexemplar in der Gesetzgebung des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder / Kai Walter<br />
In: Bibliotheksgesetzgebung in Europa. - Bad Honnef, 2000. - S. 49 - 53<br />
Wenzel, Karl Egbert:<br />
§ 12 LPG : <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> / Karl Egbert Wenzel<br />
In: Presserecht. - 4., neubearb. <strong>und</strong> erw. Aufl. - München, 1997. - S. 702 - 723<br />
Will, Erich:<br />
Bemerkungen zum <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> der Landespressegesetze : am Beispiel<br />
von §12 des baden-württembergischen Gesetzes über die Presse (Landespressegesetz)<br />
vom 14. Januar 1964 / Erich Will<br />
In: Bibliothek <strong>und</strong> Wissenschaft. - Wiesbaden. - 5 (1968), S. 275 - 309<br />
Will, Erich:<br />
Die Abgabe von Druckwerken an öffentliche Bibliotheken : Recht <strong>und</strong> Praxis der<br />
deutschen Pflichtexemplare ; zugleich Materialsammlung für eine Neuregelung /<br />
von Erich Will. - Köln : Greven, 1955. - 193 S. - (Arbeiten aus dem Bibliothekar-<br />
Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen ; 10)
- 71 -<br />
Wolff, Hans Julius:<br />
Gr<strong>und</strong>sätze des Bibliotheks-Verwaltungsrechts / von Hans J. Wolff<br />
In: Bibliotheca docet. - Amsterdam, 1963, S. 279 - 286<br />
Zeßner-Spitzenberg, Josef:<br />
Die Bestimmungen des Mediengesetzes über die Anbietungs- <strong>und</strong> Ablieferungspflicht<br />
von „Bibliotheksstücken“ im Lichte der Bibliotheksstückeverordnung <strong>und</strong> im<br />
Vergleich zu den Regelungen anderer europäischer Länder / Josef Zeßner-<br />
Spitzenberg<br />
In: Biblos. - ISSN 0006-2022. - 31 (1982), S. 109 - 116
Fragebogen zu Pflichtexemplaren<br />
Anlage3<br />
Fragebogen zu Pflichtexemplaren 1/78<br />
1. Sind Sie der Meinung, dass das <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> in Ihrem B<strong>und</strong>esland verbesserungswürdig<br />
ist?<br />
ja nein weiß nicht<br />
2. Können Sie Angaben über die Anzahl der Pflichtexemplare machen, die Ihre Bibliothek in den letzten<br />
5 Jahren erhalten hat?<br />
ja<br />
nein<br />
(Bitte aus Vergleichsgründen keine Mehrfachexemplare<br />
mitzählen)<br />
- 1996: ................... Exemplare<br />
- 1997: ................... Exemplare<br />
- 1998: .................... Exemplare<br />
- 1999: .................... Exemplare<br />
- 2000: .................... Exemplare<br />
3. Was wird zusätzlich zum Buchhandelsschrifttum noch gesammelt?<br />
amtliche Druckschriften<br />
graue Literatur<br />
Videos<br />
Audio-Kassetten<br />
Musik-CDs<br />
CD-ROMs <strong>und</strong> Computerdisketten<br />
Zeitschriften<br />
Zeitungen<br />
elektronische Publikationen<br />
4. Erstellt Ihre Bibliothek eine Regionalbibliographie?<br />
ja (Bitte beantworten Sie die Zusatzfragen) nein<br />
Sind Regionalbibliographie <strong>und</strong> Plichtexemplarstelle miteinander verb<strong>und</strong>en?<br />
räumlich<br />
organisatorisch<br />
nur teilweise Zusammenarbeit<br />
(z.B. beim Aufspüren von Pflicht-Titeln)<br />
keine Zusammenarbeit
Fragebogen zu Pflichtexemplaren 2/78<br />
5. Wie ist der Pflichtexemplar-Geschäftsgang organisiert?<br />
„Integrierter Geschäftsgang“ (Erwerbung <strong>und</strong> Titelaufnahme werden von den selben Mitarbeitern<br />
bzw. in der selben Dienststelle erledigt)<br />
Erwerbung <strong>und</strong> Titelaufnahme voneinander getrennt<br />
Zeitschriftenstelle arbeitet auch Pflicht-Zeitschriften ein<br />
Sonstiges:<br />
.........................................................................................................<br />
6. Mit wieviel Mitarbeitern welcher Qualifikation werden die Pflichtexemplare bearbeitet? Bitte geben<br />
Sie den Stellenumfang an (z. B. 1 1 /2 Stellen)!<br />
Dipl.-Bibliothekare .......... Stellen<br />
Bibliotheks-Assistenten .......... Stellen<br />
Verwaltungsrechtlich geschultes Personal .......... Stellen<br />
Sonstige (z. B. ABM-Kräfte) .......... Stellen<br />
7. Besuchten die Bibliothekare <strong>und</strong> Bibliotheksassistenten Fortbildungs- <strong>und</strong> Qualifikationslehrgänge<br />
zum allgemeinen Verwaltungsrecht?<br />
ja nein zum Teil weiß nicht<br />
8. Steht Ihnen an Ihrer Bibliothek ein Jurist zur Verfügung?<br />
ja nein weiß nicht<br />
9. Wie erhalten Sie Kenntnis vom Erscheinen ablieferungspflichtiger Dokumente? (Mehrfachnennungen<br />
möglich)<br />
Ablieferungspflichtiger liefert ohne Aufforderung<br />
Ablieferungspflichtiger kündigt Erscheinen an <strong>und</strong> liefert ohne Aufforderung<br />
Ablieferungspflichtiger kündigt Erscheinen an <strong>und</strong> liefert nach Aufforderung<br />
Elektronischer Datenabgleich mit Der Deutschen Bibliothek<br />
Bibliotheksmitarbeiter durchforsten diverse Quellen (z.B. Deutsche Nationalbibliographie, Tagespresse,<br />
Buchmessen, Entdeckungen auf Privatreisen)<br />
Sonstiges:<br />
.....................................................................................................................<br />
10. Wie wird bei Nichtlieferung verfahren? (Mehrfachnennungen möglich)<br />
keine weiteren Maßnahmen<br />
anderweitiger Erwerb des Dokuments, wenn ja, welcher Art?<br />
Kauf Tausch Geschenk<br />
nach Aufforderung zur Ablieferung erfolgt Mahnung<br />
Weiterleitung an Hausjuristen<br />
Verwaltungszwang (z.B. Zwangsgelder, Bußgelder)<br />
Sonstiges:<br />
............................................................................................................................
Fragebogen zu Pflichtexemplaren 3/78<br />
11. Ist Ihnen bekannt, dass die Verletzung der Abgabepflicht schon einmal als Ordnungswidrigkeit<br />
geahndet wurde?<br />
ja nein weiß nicht<br />
Wenn ja, können Sie den Vorgang bitte stichpunktartig beschreiben?<br />
......................................................................................................................................................................<br />
......................................................................................................................................................................<br />
.................................................<br />
12. Ist es schon vorgekommen, dass die Bibliothek den Anspruch auf ein Pflichtexemplar nicht geltend<br />
machen konnte, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war?<br />
ja nein weiß nicht<br />
13. Wo ist die Ablieferung von Druckerzeugnissen geregelt?<br />
(Mehrfachnennungen möglich)<br />
Pressegesetz (beantworten Sie bitte Zusatzfrage A)<br />
Ablieferungsgesetz (beantworten Sie bitte Zusatzfragen B)<br />
Durchführungsverordnung (aktuelle Ausgabe datiert vom .............)<br />
bibliotheksinterne Vorschriften<br />
z.B. .....................................................................................................................<br />
A.<br />
...........................................................................................................................<br />
Hatten Sie ev. Rückmeldungen von Verlegern <strong>und</strong> herausgebenden Institutionen, dass ihnen<br />
durch die Verankerung der Abgabepflicht im Pressegesetz diese gar nicht bekannt war?<br />
ja nein weiß nicht<br />
B. Ist Ihnen aufgefallen, dass den Verlegern <strong>und</strong> herausgebenden Institutionen die Abgabepflicht<br />
seit Bestehen eines autonomen Ablieferungsgesetzes besser bekannt ist?<br />
ja nein weiß nicht
Fragebogen zu Pflichtexemplaren 4/78<br />
14. Welche Veränderungen im <strong>Pflichtexemplarrecht</strong> Ihres B<strong>und</strong>eslandes bzw. in der hausinternen Bearbeitung<br />
schlagen Sie vor?<br />
......................................................................................................................................................................<br />
......................................................................................................................................................................<br />
......................................................................................................................................................................<br />
......................................................................................................................................................................<br />
......................................................................................................................................................................<br />
...........................................................<br />
Lydia Krause<br />
Ernestusstr.5<br />
06114 Halle/Saale<br />
Rückantwort<br />
Abs.:..........................................................<br />
(Name)<br />
..........................................................<br />
(Straße)<br />
..........................................................<br />
(PLZ, Ort)<br />
..........................................................<br />
(Telefon)<br />
..........................................................<br />
(E-Mail)
Frage 3: Was wird zusätzlich zum Buchhandelsschrifttum noch gesammelt?<br />
Bibliothek amtlicheDruckschriften<br />
graue<br />
Literatur<br />
Videos Audio-<br />
Kassetten<br />
Musik-<br />
CDs<br />
CD-<br />
ROMs<br />
<strong>und</strong><br />
Disketten<br />
Zeitschriften<br />
BLB Karlsruhe x x x x x x x x<br />
WLB Stuttgart x x x x x x x x<br />
Anlage 4<br />
Zeitungen<br />
elektronischePublikationen<br />
BSB München x x x x x x x x<br />
ZLB Berlin x x x x x x<br />
StLB Potsdam x x x x x x x x<br />
SUB Bremen x x x x x<br />
HLB Darmstadt x x x x x x x<br />
StUB Frankfurt x x x<br />
HLB Fulda x x x x x x x x<br />
GHB Kassel x x x x x x x<br />
HLB Wiesbaden x x x x x x x x x<br />
LB Schwerin x x x x x x x x x<br />
NLB Hannover x x x x x x x<br />
ULB Bonn x x x x x x x x x<br />
ULB Düsseldorf x x x x x x x x<br />
StB Mainz x x x x x x x x x<br />
LB Speyer x x x x x x x x x<br />
ULB Saarbrükken<br />
x x x x x x x x<br />
SLB Dresden x x x x x x x x x<br />
ULB Halle x x x x x x x x x<br />
LB Kiel x x x<br />
StB Lübeck x x x x x x x x<br />
ULB Jena x x x x x x x x x<br />
Gesamt 19 23 18 19 18 20 23 22 12<br />
D:\Armin\opus\Dplmtext.doc/Jan. 02/15
D:\Armin\opus\Dplmtext.doc/Jan. 02/15<br />
BLB Karlsruhe<br />
WLB Stuttgart<br />
BSB München<br />
ZLB Berlin<br />
StLB Potsdam<br />
SUB Bremen<br />
HLB Darmstadt<br />
StUB Frankfurt<br />
HLB Fulda<br />
GHB Kassel<br />
HLB Wiesbaden<br />
LB Schwerin<br />
NLB Hannover<br />
ULB Bonn<br />
ULB Düsseldorf<br />
StB Mainz<br />
LB Speyer<br />
ULB Saarbrücken<br />
SLB Dresden<br />
ULB Halle<br />
LB Kiel<br />
StB Lübeck<br />
ULB Jena<br />
0<br />
4,25<br />
3,25<br />
3,00<br />
2,04<br />
2,25<br />
1,32<br />
0,80<br />
0,75<br />
0,29<br />
0,00<br />
1,83<br />
1,00<br />
1,00<br />
2,28<br />
1,90<br />
5,50<br />
4,50<br />
4,53<br />
3,75<br />
3,37<br />
2,00<br />
2,44<br />
0,75<br />
1,80<br />
2,00<br />
2,13<br />
2,50<br />
1,50<br />
2,50<br />
1,00<br />
2,41<br />
1,00<br />
0,57<br />
1,00<br />
1,49<br />
1,75<br />
5<br />
3,87<br />
4,45<br />
4,67<br />
7,41<br />
7,19<br />
6,75<br />
10<br />
10,84<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
29,25<br />
Bearbeitete Exemplare:<br />
Mittelwert aus 1996 - 2000 (x 1.000)<br />
31,47<br />
35<br />
34,71<br />
Gesamtpersonal Pflichtexemplarstellen<br />
40<br />
Vergleich bearbeitete Exemplare (Mittelwert aus 1996 bis 2000)<br />
Anlage 5
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0%<br />
In Ländern mit Pressegesetz:<br />
Hatten Sie ev. Rückmeldungen von Verlegern <strong>und</strong> herausgebenden<br />
Institutionen, dass Ihnen durch die Verankerung der Abgabepflicht<br />
im Pressegesetz diese gar nicht bekannt war?<br />
88,24%<br />
0,00%<br />
11,76%<br />
ja nein weiß nicht<br />
In Ländern mit autonomem Ablieferungsgesetz:<br />
Ist Ihnen aufgefallen, dass den Verlegern <strong>und</strong> herausgebenden<br />
Institutionen die Abgabepflicht seit Bestehen eines autonomen<br />
Ablieferungsgesetzes besser bekannt ist?<br />
16,67%<br />
50,00%<br />
33,33%<br />
ja nein weiß nicht<br />
Anlage 6<br />
D:\Armin\opus\Dplmtext.doc/Jan. 02/15