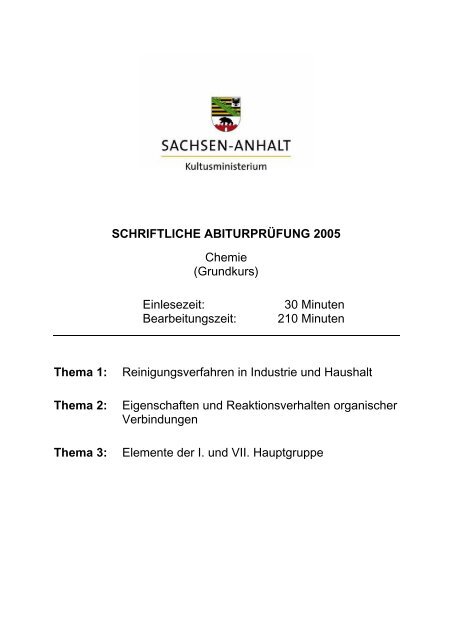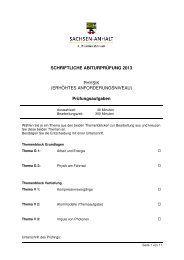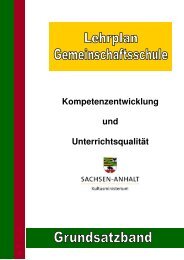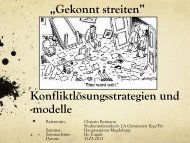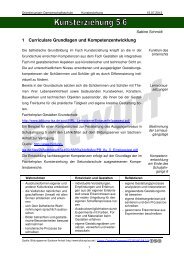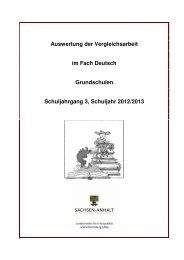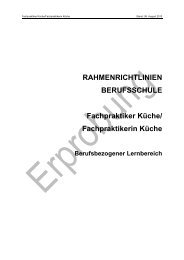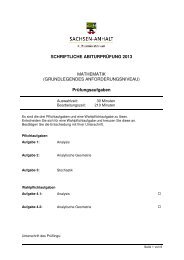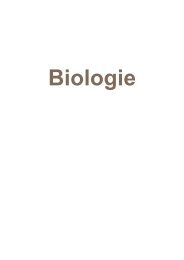SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2005 Chemie (Grundkurs ...
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2005 Chemie (Grundkurs ...
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2005 Chemie (Grundkurs ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong><br />
<strong>Chemie</strong><br />
(<strong>Grundkurs</strong>)<br />
Einlesezeit: 30 Minuten<br />
Bearbeitungszeit: 210 Minuten<br />
Thema 1: Reinigungsverfahren in Industrie und Haushalt<br />
Thema 2: Eigenschaften und Reaktionsverhalten organischer<br />
Verbindungen<br />
Thema 3: Elemente der I. und VII. Hauptgruppe
1<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
Thema 1: Reinigungsverfahren in Industrie und Haushalt<br />
1 Silberraffination – ein elektrochemisches Verfahren<br />
1.1 Silber, als ein Element der ersten Nebengruppe des Periodensystems der Elemente,<br />
ist ein wertvolles Edelmetall.<br />
Begründen Sie drei Eigenschaften des Metalls Silber.<br />
Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme des Textmaterials „Nanosilber schützt nachhaltig<br />
vor Bakterien“ drei Einsatzmöglichkeiten.<br />
1.2 In der Natur kommt Silber nur in geringen Mengen gediegen vor. In gebundenem<br />
Zustand kommt es in Form von Silbererzen oder silberhaltigen Erzen vor. Diese<br />
werden in Rohsilber umgewandelt, welches anschließend nach dem MÖBIUS-<br />
Verfahren gereinigt wird. Das Rohsilber wird dazu in 1 cm starke Platten gegossen und<br />
in salpetersaure Silbernitrat-Lösung gehängt. Als zweite Elektrode dient ein dünnes<br />
Blech aus rostfreiem Stahl. Bei der Elektrolyse wird an der Kathode das Silber<br />
abgeschieden, die Verunreinigungen an Kupfer und Blei gehen in Lösung, andere<br />
Verunreinigungen und Gold sammeln sich als Anodenschlamm.<br />
Entwickeln Sie eine beschriftete Skizze zu dem beschriebenen Reinigungsverfahren.<br />
Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen für die an Anode und Kathode ablaufenden<br />
Reaktionen und begründen Sie, dass eine Reinigung des Rohsilbers auf diesem Wege<br />
möglich ist.<br />
Berechnen Sie die Masse an Silber, die bei der Silberraffination in einer Stunde und bei<br />
einer Stromstärke I = 3 A aus einer Silbernitrat-Lösung abgeschieden werden kann.<br />
2 Haushaltsreiniger<br />
2.1 Ein Fensterputzmittel besteht aus ca. 50 % Wasser, 40 % Propanol, Ammoniak und<br />
Tensiden. Es soll Staub, Fettschmutz, Fliegendreck usw. beseitigen.<br />
Geben Sie die Eigenschaften von drei Bestandteilen des Fensterputzmittels an, auf<br />
denen die Reinigungswirkung basiert. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den<br />
genannten Eigenschaften und dem Bau dieser Stoffe dar.<br />
In den Anwendungshinweisen eines Fensterputzmittels steht: „Vorsicht, sollte nicht in<br />
die Augen gelangen, ansonsten ist mit viel Wasser nachzuspülen“.<br />
Begründen Sie diese Anweisungen.<br />
2.2 Ethansäure (Essigsäure) ist häufig in Haushaltsreinigern enthalten und gilt als<br />
umweltfreundliche Alternative zu vielen anorganischen Säuren.<br />
Nennen Sie weitere Verwendungsmöglichkeiten für Ethansäure.<br />
Begründen Sie einen Aspekt ihrer Umweltverträglichkeit mithilfe einer möglichen<br />
Herstellungsart. Entwickeln Sie auch für den biochemischen Abbau mit Luftsauerstoff<br />
eine mögliche Reaktionsgleichung. Vergleichen Sie die Ethansäure mit der ebenfalls in<br />
Reinigungsmitteln verwendeten Methansäure hinsichtlich ihrer Wirkung als Säure unter<br />
Einbeziehung von Strukturbetrachtungen.
2<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
2.3 Experiment<br />
Identifizieren Sie aus den vorgegebenen vier farblosen Lösungen A – D (es handelt<br />
sich um Methansäure, Ethansäure, Chlorwasserstoffsäure und Wasser) die<br />
Ethansäure.<br />
Entwickeln Sie zunächst einen Plan und fordern Sie die notwendigen Nachweismittel<br />
an.<br />
Werten Sie Ihre Beobachtungen in einem Kurzprotokoll aus. Ordnen Sie alle<br />
Reaktionen den entsprechenden Reaktionsarten zu.<br />
3 Textilreinigungsmittel<br />
In der Textilreinigung wird z. B. Tetrachlorethen eingesetzt. Es ist eine farblose<br />
etherisch riechende Flüssigkeit, die eine Schmelztemperatur ϑ = -22,4 °C besitzt und in<br />
Wasser unlöslich ist.<br />
Beschreiben Sie die Struktur und die chemischen Bindungen dieses Moleküls.<br />
Technisch gewinnt man diesen Stoff durch eine Hochtemperaturmethanchlorierung,<br />
wobei Methan bei Temperaturen bis 700 °C mit Chlor umgesetzt wird. Neben Tetrachlorethen<br />
entstehen auch Tetrachlormethan, Hexachlorethan und Hexachlorbenzol.<br />
Entwickeln Sie für die Bildung zweier dieser Produkte je eine mögliche<br />
Reaktionsgleichung und bestimmen Sie die Reaktionsart.<br />
Textmaterial: Nanosilber schützt nachhaltig vor Bakterien<br />
Könige aßen und tranken aus Silbergeschirr als Ausdruck von Reichtum und Macht. Das<br />
Edelmetall schützte zudem die feinen Damen und Herren auch vor Infektionen, denn Silber<br />
wirkt antimikrobiell. Die antiseptische Wirkung von Silber ist seit 3000 Jahren bekannt. Silber<br />
und Silberverbindungen wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur aktiven Behandlung<br />
von Brandwunden und zur Desinfektion eingesetzt. Unsere Urgroßmütter wussten das<br />
Edelmetall im Haushalt zu schätzen. Sie legten eine Silbermünze in die Blechkanne, damit<br />
sich die Milch länger hielt.<br />
Mit der Entwicklung von Antibiotika geriet das alte Hausmittel in Vergessenheit. Heute<br />
werden die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber wieder genutzt. Metallisches Silber<br />
wird in die Oberfläche von medizinischen Geräten integriert. Die winzigen Nanosilberpartikel<br />
geben kontinuierlich ausreichend Ionen ab. An mehreren Stellen der Bakterienzellen greifen<br />
die Nanoteilchen gleichzeitig an. Sie zerstören Enzyme, destabilisieren die Zellmembran,<br />
das Zellplasma oder die Zellwand und stören Zellteilung und –vermehrung. Diesen geballten<br />
Angriff überleben die Bakterien nicht. Mit Silber beschichtete medizinische Geräte bleiben<br />
daher bakterienfrei. Der Wirkungsgrad von Silber ist breiter als der von Antibiotika.<br />
Die antibakteriellen Eigenschaften sind für viele Produkte besonders in hygieneintensiven<br />
Bereichen der häuslichen Pflege, in Schwimmbädern oder allgemein zugänglichen Toiletten<br />
bedeutsam. Des Weiteren bestehen Einsatzmöglichkeiten in der Lebensmittelproduktion, im<br />
Haushalt oder in der Kosmetik, beispielsweise in Textilfasern für Heftpflaster, Unterwäsche<br />
oder als Werkstoff für Filter und Dichtungen.<br />
Die neue Faser soll bei Neurodermitis helfen oder vor allem bei Berufskleidung vor<br />
unerwünschten Mikroben schützen. Da sie waschbeständig antimikrobiell ist, lassen sich in<br />
der Krankenhauswäscherei Desinfektionsmittel einsparen.
3<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
Thema 2: Eigenschaften und Reaktionsverhalten organischer Verbindungen<br />
1 Kettenförmige Kohlenwasserstoffe<br />
1.1 Zwischen den physikalischen und chemischen Eigenschaften verwandter<br />
Verbindungen und ihrem Bau (Art, Anordnung, Zusammenhalt der Teilchen) besteht<br />
ein enger Zusammenhang.<br />
Geben Sie für die in Tabelle 2.1 „Siedetemperaturen von Kohlenwasserstoffen“ aufgeführten<br />
Verbindungen die Strukturformeln an.<br />
1.2 Vergleichen Sie einerseits die Siedetemperaturen der Stoffe mit der gleichen Anzahl<br />
von Kohlenstoffatomen und andererseits die Siedetemperaturen der aufgeführten<br />
n-Alkane.<br />
Erklären Sie die erkennbaren Unterschiede in beiden Vergleichen.<br />
Kohlenwasserstoff Siedetemperatur ϑS in °C<br />
n-Butan - 0,5<br />
2,2-Dimethylbutan 49,7<br />
2,2-Dimethylpropan 9,5<br />
n-Hexan 68,7<br />
2-Methylbutan 27,9<br />
2-Methylpentan 63,3<br />
2-Methylpropan - 11,7<br />
n-Pentan 36,2<br />
Tab. 2.1: Siedetemperaturen von Kohlenwasserstoffen<br />
1.3 Unter geeigneten Reaktionsbedingungen reagiert Propen mit Brom.<br />
Erläutern Sie unter Einbeziehung der chemischen Zeichensprache und mithilfe von<br />
Strukturformeln einen Reaktionsmechanismus, der zur Bildung eines möglichen Produktes<br />
bei der genannten Reaktion führt. Benennen Sie das Produkt und den<br />
Reaktionsmechanismus. Ordnen Sie Reaktionsbedingungen zu, die diesen Mechanismus<br />
begünstigen.<br />
2 Kettenförmige Kohlenwasserstoffe mit funktionellen Gruppen<br />
2.1 Bei drei klaren Flüssigkeiten A, B und C handele es sich um Ethanol, Ethansäure und<br />
Ethanal.<br />
Erstellen Sie einen begründeten Plan zur Identifizierung der drei Stoffe, wenn dafür nur<br />
Universalindikator und Schwefelsäure zur Verfügung stehen. Geben Sie zwei<br />
Reaktionsgleichungen an.
4<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
2.2 Experiment<br />
Stellen Sie zuerst das Nachweismittel ammoniakalische Silbernitrat-Lösung frisch her.<br />
Versetzen Sie dazu Silbernitrat-Lösung mit verdünnter Ammoniak-Lösung bis sich die<br />
Trübung wieder auflöst. Teilen Sie diese Lösung auf zwei Reagenzgläser auf.<br />
a) Versetzen Sie nacheinander kleine Stoffproben Ethanol, Butanol und Methansäure<br />
jeweils mit Wasser und anschließend mit Universalindikator-Lösung.<br />
b) Erhitzen Sie eine Rolle aus Kupferdrahtnetz so, dass sich an der Luft eine<br />
schwarze Oberfläche bildet und tauchen Sie diese heiß in einen Erlenmeyerkolben<br />
mit Ethanol. Wiederholen Sie diesen Vorgang unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen<br />
einige Male.<br />
Vermischen Sie das so behandelte Ethanol zu gleichen Teilen mit<br />
ammoniakalischer Silbernitrat-Lösung. Schütteln Sie kurz und geben Sie das<br />
Reagenzglas in ein heißes Wasserbad (Hinweis: im Wasserbad nicht mehr<br />
schütteln).<br />
c) Erhitzen Sie eine Rolle aus Kupferdrahtnetz so, dass sich an der Luft eine<br />
schwarze Oberfläche bildet und tauchen Sie diese heiß in einen Erlenmeyerkolben<br />
mit Methansäure. Wiederholen Sie diesen Vorgang unter Einhaltung der<br />
Sicherheitsbestimmungen einige Male.<br />
d) Vermischen Sie Methansäure zu gleichen Teilen mit ammoniakalischer Silbernitrat-<br />
Lösung. Schütteln Sie kurz und geben Sie das Reaganzglas in ein heißes<br />
Wasserbad (Hinweis: im Wasserbad nicht mehr schütteln).<br />
Erklären Sie unter Berücksichtigung der Beobachtungen die ablaufenden<br />
Reaktionen und formulieren Sie mögliche Reaktionsgleichungen. Gehen Sie für die<br />
Reaktionen mit ammoniakalischer Silbernitrat-Lösung vereinfachend von Silber-<br />
Ionen in alkalischer Lösung aus.<br />
Begründen Sie mithilfe von Betrachtungen zur Struktur das Reaktionsverhalten der<br />
Methansäure gegenüber wässriger Universalindikator-Lösung und gegenüber<br />
Silber-Ionen.<br />
2.3 Erläutern Sie ausführlich das Wesen einer Säure-Base-Reaktion am zutreffenden<br />
Beispiel aus Aufgabe 2.2 a).<br />
3 Ringförmige Kohlenwasserstoffe<br />
3.1 Erläutern Sie den Bau des Benzolmoleküls.<br />
3.2 Der pH-Wert einer Benzolcarbonsäure-Lösung (Benzoesäure) der Konzentration<br />
c = 0,01 mol/L wurde experimentell mit pH = 3,1 bestimmt.<br />
Berechnen Sie aus diesen Angaben die Säurekonstante unter der Annahme, dass die<br />
Benzoesäure eine schwache Säure ist.
5<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
Thema 3: Elemente der I. und VII. Hauptgruppe<br />
1 Struktur und Reaktivität<br />
1.1 Wasserstoff, Chlor und Chlorwasserstoff sind praktisch bedeutsame Molekülsubstanzen.<br />
Begründen Sie die unterschiedlichen Siedetemperaturen von Wasserstoff und Chlor<br />
sowie von Wasserstoff und Chlorwasserstoff mit Betrachtungen zum Bau (Art,<br />
Anordnung und Zusammenhalt) der Teilchen.<br />
Vergleichen Sie unter Einbeziehung der chemischen Zeichensprache das Verhalten<br />
von Chlorwasserstoff und Natriumchlorid gegenüber Wasser.<br />
1.2 Chlorwasserstoff kann in einem zweistufigen Prozess aus Natriumchlorid gewonnen<br />
werden. Dabei wird das Salz mit konzentrierter Schwefelsäure zu Chlorwasserstoff und<br />
Natriumhydrogensulfat umgesetzt. Aus diesem bilden sich unter Zusatz von weiterem<br />
Natriumchlorid bei hohen Temperaturen Natriumsulfat und Chlorwasserstoff.<br />
Entwickeln Sie die Gleichungen für die beschriebenen Reaktionen. Vergleichen Sie am<br />
Beispiel der Reaktion der ersten Prozessstufe und am Beispiel der Reaktion von Chlor<br />
mit Natrium die zwei entsprechenden Reaktionsarten unter den Gesichtspunkten<br />
Teilchenübergang, Donatoren und Akzeptoren.<br />
1.3 Ein Gemisch aus Chlor und Wasserstoff reagiert bei Belichtung explosionsartig zu<br />
Chlorwasserstoff. Es handelt sich um eine Kettenreaktion, die durch Photolyse von<br />
Chlormolekülen gestartet wird.<br />
Beschreiben Sie den Mechanismus dieser Reaktion mithilfe von Formeln in<br />
Elektronenschreibweise.<br />
Wird Chlorwasserstoff mit Wasser zur Reaktion gebracht, bildet sich Chlorwasserstoffsäure.<br />
Berechnen Sie den pH-Wert der entstehenden Lösung, wenn unter Normbedingungen<br />
400 mL Chlorwasserstoffgas in Wasser gelöst werden und nach dem Auffüllen ein<br />
Gesamtvolumen V = 1 L vorliegt.<br />
Beschreiben Sie eine Möglichkeit zur experimentellen Bestimmung der Konzentration<br />
einer Chlorwasserstoffsäure.<br />
2 Phänomene<br />
2.1 Experiment<br />
Legen Sie einen Streifen Filterpapier auf einen Objektträger und tränken Sie das<br />
Papier mit einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung, die mit einigen Tropfen<br />
Phenolphthalein versetzt wurde. Befestigen Sie links und rechts am so präparierten<br />
Objektträger zwei Krokodilklemmen, die über zwei Verbindungsleiter ein bis zwei<br />
Minuten lang mit einer Gleichspannungsquelle (U = 6 V) verbunden werden.<br />
Geben Sie durch Auswertung Ihrer Beobachtung(en) die Polung der Gleichspannungsquelle<br />
an.
6<br />
<strong>SCHRIFTLICHE</strong> <strong>ABITURPRÜFUNG</strong> <strong>2005</strong> CHEMIE (GRUNDKURS)<br />
2.2 Halogene lösen sich gut in Benzin. Eine Benzin-Chlor-Lösung ist gelbgrün, eine<br />
Benzin-Brom-Lösung rotbraun und eine Benzin-Iod-Lösung violett gefärbt.<br />
Begründen Sie die gute Löslichkeit von Chlor, Brom und Iod im Lösungsmittel Benzin.<br />
In einem Praktikum wurde in einer Versuchsreihe jeweils eine wässrige Halogenid-<br />
Lösung (V = 2 mL) mit einer wässrigen Lösung eines Halogens (V = 1 mL) versetzt und<br />
anschließend mit Benzin (V = 1 mL) geschüttelt.<br />
Bei der Verwendung von Kaliumbromid-Lösung und Chlorwasser färbte sich die<br />
Benzinschicht rotbraun.<br />
Erklären Sie die beschriebene Beobachtung unter Einbeziehung der chemischen<br />
Zeichensprache.<br />
Entscheiden Sie in den folgenden Fällen begründet, welche Farbe die Benzinschicht<br />
aufweist, wenn unter den beschriebenen Versuchsbedingungen<br />
a) Kaliumiodid mit Chlorwasser und<br />
b) Kaliumchlorid mit Bromwasser zum Einsatz kommen.<br />
2.3 Chlor wirkt in Gegenwart von Wasser bleichend. Bei der Reaktion dieser beiden Stoffe<br />
bilden sich Chlorwasserstoffsäure und hypochlorige Säure (HClO). Diese zerfällt in<br />
Sauerstoff und Chlorwasserstoffsäure. Der entstehende Sauerstoff oxidiert die Farbstoffe.<br />
Geben Sie Gleichungen für die beiden Reaktionen bis zur Bildung von Sauerstoff an.<br />
Ordnen Sie die erste Reaktion begründet zwei verschiedenen Reaktionsarten zu.<br />
3 Organische Chlorverbindungen<br />
Organische Chlorverbindungen kommen in großer Anzahl und einige in erheblichen<br />
Mengen vor. So werden zum Beispiel von Meeresalgen etwa 5 Millionen Tonnen<br />
Monochlormethan pro Jahr gebildet und zum Teil in die Atmosphäre abgegeben.<br />
Beschreiben Sie die Molekülstruktur des Monochlormethans im Vergleich zu der des<br />
Methans und der des Tetrachlormethans mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells.