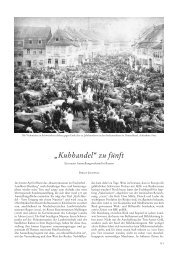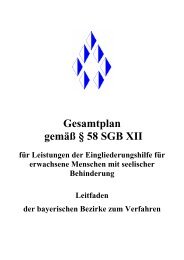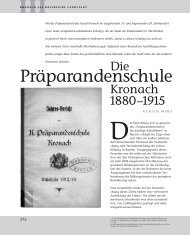Redwitz ist ein reines adeliches [...] Filial ... - Bezirk Oberfranken
Redwitz ist ein reines adeliches [...] Filial ... - Bezirk Oberfranken
Redwitz ist ein reines adeliches [...] Filial ... - Bezirk Oberfranken
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Beiträge zur Geschichte der Juden in <strong>Redwitz</strong><br />
<strong>Redwitz</strong> <strong>ist</strong> <strong>ein</strong> r<strong>ein</strong>es <strong>adeliches</strong> [...] <strong>Filial</strong>-Kirchdorf, das sich lediglich<br />
nur durch s<strong>ein</strong>e Handelsjudenschaft zu irgend<strong>ein</strong>er Bedeutenheit<br />
in Beziehung auf Bevölkerung, Gewerb und Consumtion erhoben<br />
hat. 1 Diesen Satz schrieb im Jahr 1834 der Marktgem<strong>ein</strong>de-Ausschuss von<br />
Marktzeuln, als er zum Antrag der <strong>Redwitz</strong>er Stellung nehmen sollte, Markt<br />
zu werden. Ähnlich wie Marktzeuln äußerten sich weitere Orte, und auch<br />
der Lichtenfelser Landrichter schrieb in s<strong>ein</strong>em Gutachten an die Regierung:<br />
<strong>Redwitz</strong> <strong>ist</strong> <strong>ein</strong> mittelmäßiges Kirchdorf und nur durch den Handel der dortigen<br />
Juden in das nahe Sachsen von <strong>ein</strong>iger Bedeutung 2 . Die Juden waren<br />
demnach offenbar die bestimmende wirtschaftliche Kraft im <strong>Redwitz</strong> des<br />
frühen 19. Jahrhunderts.<br />
Bei der folgenden Darstellung der Geschichte der jüdischen Gem<strong>ein</strong>de <strong>ist</strong> zu<br />
berücksichtigen, dass die zugrundeliegenden Daten großteils aus amtlichen<br />
Quellen stammen (und selbst diese sind nicht vollständig ausgewertet). Wir<br />
sehen die <strong>Redwitz</strong>er Juden also weitgehend mit den Augen der Beamten in<br />
<strong>Redwitz</strong>, Lichtenfels und Bayreuth, und wir hören fast nur dann von den<br />
Juden, wenn es Veränderungen oder Aus<strong>ein</strong>andersetzungen gab; von ihrem<br />
alltäglichen Leben erfahren wir bestenfalls auf indirektem Weg etwas.<br />
Die Juden 3 hatten im Hochmittelalter <strong>ein</strong>e führende Position im Fernhandel;<br />
ferner trieben sie weitgehend konkurrenzlos Geldgeschäfte. Vor allem im<br />
Spätmittelalter blieben den Juden dann auch rechtlich nur noch diese Möglichkeiten<br />
des Broterwerbs; denn Handwerk und Landwirtschaft verschlossen<br />
sich ihnen im zunehmenden Maß. So ließen sich die Juden in den Städten<br />
nieder, wo gehandelt und Geldgeschäfte gemacht wurden. In Bamberg<br />
lassen sich Juden schon im 11. und 12. Jahrhundert nachweisen, in den kl<strong>ein</strong>eren<br />
Städten in unserer Umgebung – Lichtenfels, Burgkunstadt, Weismain<br />
– im späten 13. Jahrhundert 4 .<br />
Seit dem ersten Kreuzzug 1095/96 waren die Juden immer wieder von Verfolgungen<br />
bedroht 5 . Durch das Gerücht, Juden hätten konsekrierte Hostien<br />
geschändet, stachelte 1298 <strong>ein</strong> Ritter namens Rintfleisch die Öffentlichkeit<br />
auf 6 ; es rotteten sich Chr<strong>ist</strong>en zusammen und brachten Juden um: etwa 135<br />
in Bamberg, fünf in Burgkunstadt, elf im Amt Niesten. In Lichtenfels wurde<br />
der Lehrer verbrannt. In der Folge rissen Übergriffe der durch soziale Umbrüche<br />
verunsicherten Chr<strong>ist</strong>en auf Juden nicht ab.<br />
Günter Dippold<br />
Adliger Judenschutz<br />
143<br />
143
144 144<br />
144<br />
144 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Im 13. Jahrhundert wandelte sich endgültig die Rechtsstellung der Juden:<br />
Sie galten als schutzbedürftige Kammerknechte des Königs. Damit hatten<br />
sie <strong>ein</strong>en eigentümlichen Rechtsstatus zwischen Freiheit und Knechtschaft.<br />
Dieses Verhältnis hatte <strong>ein</strong>e finanzielle Seite: Der König ließ sich s<strong>ein</strong>en<br />
Schutz teuer bezahlen, obwohl er ihn oft genug gar nicht ausübte, wie die<br />
Pogrome des 14. und 15. Jahrhunderts belegen. Nach dem Zerfall des<br />
Stauferreichs bekamen viele Fürsten den Judenschutz in ihre Hand, so der<br />
Bischof von Bamberg, schließlich auch die Niederadligen.<br />
Im Spätmittelalter, besonders im 15. Jahrhundert waren die jüdischen Gem<strong>ein</strong>den<br />
nicht nur von kl<strong>ein</strong>eren oder größeren Pogromen bedroht, sondern<br />
auch vom Entzug des Schutzes durch den Landesherrn, mit anderen Worten:<br />
von der Ausweisung. Fast aus allen deutschen Reichsstädten wurden im 15.<br />
Jahrhundert die Juden vertrieben 7 . Die eigentliche Ursache hierfür waren<br />
wirtschaftliche Veränderungen: Chr<strong>ist</strong>liche Kaufleute beteiligten sich immer<br />
stärker an Handel und Geldgeschäften; die jüdischen Händler und Bankiers<br />
wurden entbehrlich.<br />
1478 wies der Bischof – nachdem <strong>ein</strong> Bekehrungsversuch gescheitert war – die<br />
Juden aus dem Hochstift Bamberg aus 8 . Erst nach über 150 Jahren, während<br />
des Dreißigjährigen Krieges und danach, gelang es den Juden wieder in größerer<br />
Zahl, sich unter bischöflichem Schutz niederzulassen, z. B. in Lichtenfels,<br />
wo sich 1677 Jacob aus <strong>Redwitz</strong> erfolgreich darum bemühte 9 .<br />
Viele vertriebene Juden wanderten im Spätmittelalter nach Osteuropa aus.<br />
Andere zogen ins benachbarte Ausland, so ins Brandenburgische 10 , wieder<br />
andere auf adligen Anwesen oder in adlige Dörfer. Dass Ritter den Judenschutz<br />
ausübten, <strong>ist</strong> für das Hochstift Bamberg schon im ausgehenden Mittelalter<br />
belegt. Bis ins 19. Jahrhundert lebte der überwiegende Teil der fränkischen<br />
Juden in ritterschaftlichen Dörfern.<br />
Mit Hilfe ihrer adligen Schutzherren konnten sich manche Juden sogar in<br />
den hochstiftischen Städten noch länger halten: In Staffelst<strong>ein</strong> lebten auf den<br />
Lehen der Freiherren von Schaumberg noch bis 1506 Juden 11 ; ähnlich verhielt<br />
es sich offenbar in Burgkunstadt. Später, im 16. und 17. Jahrhundert<br />
finden wir Juden vor allem in ritterschaftlichen Dörfern: 1588 sind Juden in<br />
Mitwitz genannt 12 , 1589 in Schney hinter den Schaumberg und in Schwürbitz<br />
hinter den <strong>Redwitz</strong> zu Tüschnitz 13 . Auch auf adligen Lehen in Uetzing 14 ,<br />
Kleukheim 15 , Rothwind 16 und Altenkunstadt 17 wohnten um 1600 Juden. In
Küps sind seit 1622 redwitzische Schutzjuden in schriftlichen Quellen nachzuweisen<br />
18 , und der älteste nachweisbare St<strong>ein</strong> auf dem zerstörten jüdischen<br />
Friedhof von Küps datierte von 1611 19 .<br />
Juden in <strong>Redwitz</strong> werden erstmals 1595 in <strong>ein</strong>em Weismainer Gerichtsbuch<br />
genannt 20 .<br />
Die Adligen nahmen die Juden natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit<br />
auf, sondern um handfester materieller Interessen willen. Die adligen Schutzjuden<br />
waren durch Abgaben schwer belastet.<br />
Die besonderen Auflagen fingen beim Zuzug an: Wollte <strong>ein</strong> Jude sich in<br />
<strong>Redwitz</strong> niederlassen, musste er <strong>ein</strong> doppelt so hohes Einzugsgeld zahlen<br />
wie <strong>ein</strong> Chr<strong>ist</strong>; so bestimmte es die Dorfordnung von 1721 21 . Ferner musste<br />
der Jude <strong>ein</strong>en Schutzbrief erwerben. In <strong>ein</strong>er Rechnung des Ritterguts vom<br />
Ende des 18. Jahrhunderts heißt es: Wenn <strong>ein</strong> fremder Jud <strong>ein</strong>ziehet oder <strong>ein</strong><br />
hießiger Juden Sohn [...] aus des Vaters Brod tritt, so muß er sich den Schutz<br />
und den dazu gehörigen Schutzbrief lößen. Die Höhe des dafür zu zahlenden<br />
Geldes hängt von der herrschaftl[ich]en Willkühr ab und wird gem<strong>ein</strong>iglich<br />
[...] nach den Vermögen des schutzlößenden Judens reguliret 22 . Darüber hinaus<br />
musste jede Familie <strong>ein</strong> jährliches Schutzgeld zahlen: <strong>ein</strong> vollständiger<br />
Haushalt 6 Reichstaler, <strong>ein</strong>e Witwe 3. Von den 33 Judenhaushalten nahm das<br />
Rittergut <strong>Redwitz</strong> 1797 insgesamt 213 Gulden an Schutzgeld <strong>ein</strong> 23 – das<br />
entsprach dem Wert <strong>ein</strong>es kl<strong>ein</strong>en Wohnhauses.<br />
Nicht nur die adligen Schutzherren zogen ihren Nutzen aus den Juden. So<br />
gab es den Leibzoll, die lästigste und erniedrigendste Abgabe, wie Adolf<br />
Eckst<strong>ein</strong> schreibt 24 . Spätestens seit 1496 mussten die Juden an allen Zollschranken<br />
im Hochstift Zoll zahlen für sich selbst, danach gestaffelt, ob sie<br />
im jeweiligen Ort Handel treiben oder nur durchreisen wollten 25 . 1667 verweigerte<br />
<strong>ein</strong> <strong>Redwitz</strong>er Jude in Lichtenfels den Zoll, ja er verlangte sogar<br />
Einsicht in die Stadtordnung, um die Rechtsgrundlage zu prüfen. Dieses selbstsichere<br />
Auftreten brachte ihm jedoch nur <strong>ein</strong>e Geldstrafe <strong>ein</strong> 26 . Selbst für die<br />
Leiche <strong>ein</strong>es Juden erhob man Zoll, wenn sie auf dem Weg zum Friedhof<br />
<strong>ein</strong>e Zollschranke passierte. Die entehrenden Zollvorschriften hob erst die<br />
bayerische Regierung im Jahr 1808 auf 27 .<br />
Obendr<strong>ein</strong> mussten die Juden Neujahrsgelder an den zuständigen Ortspfarrer<br />
zahlen. Man argumentierte so: Wenn Juden in <strong>ein</strong> Haus zogen, das bisher<br />
Chr<strong>ist</strong>en bewohnt hatten, entgingen dem Pfarrer Einkünfte, die Stolgebühren,<br />
Günter Dippold<br />
145<br />
145
146 146<br />
146<br />
146 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Das Wachsen der<br />
jüdischen Gem<strong>ein</strong>de<br />
<strong>Redwitz</strong><br />
die Zahlungen für von ihm vorgenommene Taufen, Trauungen, Beerdigungen<br />
etc. Dafür hatten die Juden den Pfarrer durch <strong>ein</strong>e alljährliche Pauschalzahlung<br />
zu entschädigen. Da für <strong>Redwitz</strong> der evangelische Pfarrer von Obr<strong>ist</strong>feld<br />
und der katholische Pfarrer von Altenkunstadt zuständig waren, mussten<br />
die Juden an beide Ge<strong>ist</strong>liche zahlen, an den Obr<strong>ist</strong>felder Pfarrer z. B. seit<br />
1749 1 /3 Reichstaler pro Haushalt und Jahr 28 . Ferner hatten sie an die chr<strong>ist</strong>lichen<br />
Schulen in <strong>Redwitz</strong> entsprechende Zahlungen zu le<strong>ist</strong>en.<br />
1852 beantragte die <strong>Redwitz</strong>er israelitische Gem<strong>ein</strong>de anlässlich <strong>ein</strong>es Pfarrerwechsels<br />
in Obr<strong>ist</strong>feld, die Neujahrsgelder zu streichen, doch ihr Gesuch<br />
wurde abgelehnt 29 . Erst 1881 wurden die Neujahrsgelder durch Gesetz aufgehoben,<br />
was – wie 1909 <strong>ein</strong> evangelischer Pfarrer schrieb – für alle Beteiligten<br />
<strong>ein</strong>e Erlösung war 30 .<br />
Die Juden waren durch die besonderen Abgaben stark belastet. Denn<br />
Schutzbriefgebühr, Schutzgeld, Leibzoll, Totenzoll, Neujahrsgelder mussten<br />
zusätzlich zu den Steuern und Abgaben bezahlt werden, die auch die Chr<strong>ist</strong>en<br />
zu entrichten hatten. Dass sich trotzdem viele Juden in ritterschaftlichen<br />
Dörfern ansiedelten, hatte <strong>ein</strong>en <strong>ein</strong>fachen Grund: In bischöflichem oder<br />
markgräflichem Schutz waren ebenfalls derartige Abgaben zu bezahlen, und<br />
überdies wurde in ritterschaftlichen Orten den Juden die Ansiedlung leichter<br />
gewährt. Denn die Niederadligen waren weit stärker als Fürsten auf die verschiedenen<br />
Abgaben der Juden und angewiesen. So sahen viele Adlige den<br />
Zuzug von Juden recht gern, wie überhaupt manche fränkische Reichsritter<br />
die Einwohnerzahl – und damit die Steuerkraft – ihrer Dörfer im 18. Jahrhundert<br />
nach Möglichkeit erhöhten.<br />
In <strong>Redwitz</strong> erinnerte sich 1739 der älteste Einwohner, es seien ehedem in der<br />
Gem<strong>ein</strong>d und Dorff <strong>Redwitz</strong> nicht mehr alß vier Haußhaltung von Juden<br />
bewohnet gewesen 31 . 1675 lebten zwölf Juden in <strong>Redwitz</strong> 32 . In <strong>ein</strong>em Lehensverzeichnis<br />
von 1716 ersch<strong>ein</strong>en fünf jüdische Haushalte mit Hausbesitz 33 ,<br />
im Urbar von 1734 bereits acht 34 . In der Folgezeit stieg diese Zahl immer<br />
weiter, wie sich auch andernorts beobachten lässt 35 . Besonders Alexander<br />
H<strong>ein</strong>rich von <strong>Redwitz</strong> (1676–1745) sch<strong>ein</strong>t die Ansiedlung von Juden mit<br />
Wohlwollen betrachtet zu haben. Kurz nach s<strong>ein</strong>em Tod empörte sich der<br />
Obr<strong>ist</strong>felder Pfarrer, die Judenschaft zu <strong>Redwitz</strong> [sei] von zwey biß drey
Haußhaltungen in kurtzen auf 16 bis 17 angewachsen, mithin <strong>ein</strong> Chr<strong>ist</strong>enhauß<br />
nach den andern an sich gekaufft, daß dieser Judenköpffe in <strong>Redwitz</strong><br />
über hundert hinnaus sich erstrecken 36 . (Der Pfarrer zielte in diesem<br />
Schreiben auf die Erhöhung der Neujahrsgelder.) Wie er bei anderer Gelegenheit<br />
erwähnte, bildeten Juden 15 der über 90 <strong>Redwitz</strong>er Haushalte 37 ; die<br />
Juden machten damals also rund <strong>ein</strong> Sechstel der Bevölkerung aus. Ihre Zahl<br />
stieg und stieg. 50 Jahre später, 1797, zählte man 33 Judenhaushalte in <strong>Redwitz</strong><br />
38 , 1813 schließlich 38 39 . 1829 lebten 196 Einwohner jüdischen Glaubens;<br />
sie stellten damit 23 Prozent der Einwohnerschaft von <strong>Redwitz</strong> 40 .<br />
Wo in <strong>Redwitz</strong> die Juden wohnten, zeigt das Häuser- und Rustikal-Steuer-<br />
Kataster von 1810 41 . Damals besaßen Juden folgende Häuser:<br />
Bärl<strong>ein</strong> Seligmann Nr. 25a Kronacher Straße 12<br />
Märla, Witwe [Flankauer] Nr. 25b Kronacher Straße 12<br />
Isaac Schneibel Nr. 26 Kronacher Straße 10<br />
Scholum Meier [Kares] Nr. 27a Kronacher Straße 8<br />
Salomon Mayer Nr. 27b Kronacher Straße 8<br />
Bonum David [Hopfmann] Nr. 32a Am Markt 6<br />
Bonum Moses [Lust] Nr. 32b Am Markt 7<br />
„Vorsingers-Wohnung“ Nr. 34 ?<br />
Synagoge Nr. 35 ?<br />
Hirsch Jonas [Cotta] Nr. 36a Hauptstraße 1<br />
Salomon Hirsch [Philo] Nr. 36b Hauptstraße 1<br />
Löb Abraham Nr. 43a Hauptstraße 15<br />
Salomon Baruch [Midas] Nr. 43b Hauptstraße 15<br />
Salomon Abraham Nr. 44 ?<br />
Henoch Marx [Gütermann] Nr. 49 Hauptstraße 29<br />
Samuel Hirsch Nr. 62a Hauptstraße 36<br />
Salomon Baruch Nr. 62b Hauptstraße 36<br />
Kronum Marx Nr. 63 Hauptstraße 32<br />
Wolf Marx [Gütermann] Nr. 68 Hauptstraße 18<br />
Isack Moses [Hallo] Nr. 72a Hauptstraße 2<br />
Kronum Moses [Hallo] Nr. 72b Hauptstraße 2<br />
Wolf Moses [Hallo] 42 Nr. 72c Hauptstraße 2<br />
Jacob Moses [Hallo] Nr. 74 Am Markt 5<br />
Günter Dippold<br />
147<br />
147
148 148<br />
148<br />
148 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Hauptstraße1937 mit<br />
Hausnummer 15 Schreibwaren<br />
Brode früherer<br />
Besitzer Löb Abraham und<br />
Salomon Baruch<br />
Hirsch Michel [Kuh] Nr. 103 Kronacher Straße 3<br />
Kila Hirsch Nr. 106 ?<br />
Wolf Rindskopf Nr. 108a Kronacher Straße 5<br />
Bendert Wolf [Kastor] Nr. 108b Kronacher Straße 5<br />
Seligmann Löser [Wald] Nr. 109a Kronacher Straße 7<br />
Michael Gutmann Nr. 109b Kronacher Straße 7<br />
Aron Wolf [Gosser] Nr. 111a Kronacher Straße 11<br />
Abraham Jacob [Kann] Nr. 111b Kronacher Straße 11<br />
Meier Wolf [Dinon] Nr. 112 Hauptstraße 4<br />
Keela, Kaiums Witwe [Pictor] Nr. 114 ?<br />
Helena, Isacks Witwe Nr. 115 Gässla 1<br />
Es gab <strong>ein</strong>ige Stellen im Dorf, wo viele, andere, wo k<strong>ein</strong>e Juden wohnten,<br />
aber räumlich abgegrenzt waren sie k<strong>ein</strong>eswegs. Die Wohnverhältnisse der<br />
Juden waren sehr beengt. 1810 besaßen nur neun Juden <strong>ein</strong> ganzes Haus;<br />
fünf davon waren Tropfhäuser ohne Garten oder Hofraum. 19 Juden dagegen<br />
mussten sich mit <strong>ein</strong>er Hälfte <strong>ein</strong>es Hauses, zwei gar mit <strong>ein</strong>em Viertel<br />
begnügen. Das heißt: In zehn Häusern – sieben davon Tropfhäuser – lebten<br />
21 Familien. Oft dürfte dann <strong>ein</strong>e Familie im Erdgeschoss, die andere im 1.<br />
Stock gewohnt haben. Weitere sieben Familien, die sich aufgrund der Schutzgeldzahlungennachweisen<br />
lassen, sind im Kataster<br />
nicht genannt; sie<br />
wohnten wohl zur Miete.<br />
Vor 1813 trieben die <strong>Redwitz</strong>er<br />
Juden offenbar fast<br />
ausschließlich Handel.<br />
Diese Einseitigkeit hatte<br />
vor allem zwei Gründe:<br />
Die bürgerlichen Gewerbe,<br />
sprich: Handwerke<br />
waren ihnen weitgehend<br />
verschlossen 43 . Dass es im
18. Jahrhundert in Burgkunstadt und Ebneth jüdische Buchbinder gab 44 , dass<br />
1755 <strong>ein</strong> jüdischer Glaser in Oberlangenstadt saß 45 und dass 1804 in Pretzfeld<br />
<strong>ein</strong> jüdischer Siegel- und Wappenstecher lebte 46 , sind bemerkenswerte Ausnahmen.<br />
Landwirtschaft zu treiben, war mangels der nötigen Acker- oder<br />
Weideflächen nicht möglich. Von den fünf jüdischen Familien, die 1716 in<br />
<strong>Redwitz</strong> nachzuweisen sind, besaß nur <strong>ein</strong>e über ihr Wohnhaus hinaus Grundbesitz<br />
47 .<br />
Im Übrigen waren die finanziellen Auflagen von Seiten des Schutzherrn zu<br />
decken; die Juden mussten, wollten sie unbehelligt leben, Geld verdienen,<br />
und das war im Handel eher – wenn auch risikoreicher – möglich als im<br />
Handwerk. Hinzu kam die Tradition: Wenn die Vorfahren sich, oft schon<br />
über Jahrhunderte, durch Handelsgeschäfte ernährt hatten, dann lag es eben<br />
nahe, dass der Sohn auch Handel trieb.<br />
Womit die <strong>Redwitz</strong>er Juden handelten, wissen wir nur in wenigen Fällen.<br />
Einige kauften und verkauften Getreide. Der <strong>Redwitz</strong>er Jude Gerst erwarb<br />
1691 zusammen mit <strong>ein</strong>em Lichtenfelser Juden vom dortigen bischöflichen<br />
Kastner 200 Simra Weizen 48 – das sind 250 bis 300 Zentner. 1693 schrieb<br />
Gerson Levi – wohl mit dem genannten Gerst identisch – <strong>ein</strong>en Brief an den<br />
Amtmann von Sonnefeld, in dem es um Ankauf von Mehl und Getreide ging 49 .<br />
Mit demselben Amtmann machte auch <strong>ein</strong> anderer <strong>Redwitz</strong>er, Moses Hirsch,<br />
Geschäfte. 1695 forderte er brieflich die versprochenen 10 Simra Korn <strong>ein</strong><br />
für s<strong>ein</strong>e mühsamen undt, ohne Ruhm, fleißigen Verrichtungen wegen des<br />
bewusten Getreidtighandels 50 . Moses hatte hier offenbar als Makler gewirkt.<br />
Pretiosen konnte Jonas Abraham liefern: Die Schlossherrschaft kaufte 1763<br />
bei ihm <strong>ein</strong>e Sackuhr, im folgenden Jahr silberne Löffel 51 .<br />
Jakob Bonum kaufte 1738 von <strong>ein</strong>em Erlanger Kommerzienrat rund 64 Zentner<br />
Eisen. Der Preis betrug knapp 200 Reichstaler – <strong>ein</strong> kl<strong>ein</strong>es Vermögen.<br />
Von diesem Geschäft wissen wir nur, weil Jakob Bonum das Geld nicht fr<strong>ist</strong>gerecht<br />
erlegen konnte. Aus den Verhandlungen wird der Grund deutlich:<br />
Jakob besaß kaum Bargeld, denn er hatte Geld an Adlige der Umgebung<br />
verliehen, so an die Freiherren von Künsberg zu Nagel und an die Freiherren<br />
von <strong>Redwitz</strong> zu Theisenort, und diese ließen sich mit der Rückzahlung Zeit 52 .<br />
Offenbar gab Jakob Kredite in größerem Umfang. Schon <strong>ein</strong> halbes Jahrhundert<br />
zuvor hatten <strong>Redwitz</strong>er Juden geschäftliche Beziehungen zu ritterschaftlichen<br />
Familien unterhalten 53 . Ferner handelte Jakob mit Immobi-<br />
Günter Dippold<br />
Zur wirtschaftlichen<br />
Struktur der <strong>Redwitz</strong>er<br />
Judenschaft im<br />
18. und frühen 19.<br />
Jahrhundert<br />
149<br />
149
150 150<br />
150<br />
150 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Hauptstraße ca.1920<br />
Das erste Haus rechts<br />
(heute Hauptstraße 29)<br />
gehörte 1810 Henoch<br />
Marx (Gütermann).<br />
1873/74 besaß es Johann<br />
Georg Dressel. In dessen<br />
Lager war das Petroleum<br />
ausgelaufen, das den<br />
<strong>Redwitz</strong>ern den Spitznamen<br />
„Ölpumper“ <strong>ein</strong>brachte<br />
lien; es <strong>ist</strong> belegt, dass Alexander H<strong>ein</strong>rich von <strong>Redwitz</strong> ihm gestattete, die<br />
Sölde <strong>ein</strong>es verschuldeten Chr<strong>ist</strong>en zu kaufen und zu zerschlagen 54 , d. h. die<br />
zum Anwesen gehörigen Grundstücke <strong>ein</strong>zeln zu veräußern.<br />
Von allen <strong>Redwitz</strong>er Juden hatte Jakob Bonum den größten Grundbesitz: Er<br />
nannte 1734 zwei Häuser mit Stadel, Stall, Hofraum und Garten s<strong>ein</strong> eigen;<br />
auf s<strong>ein</strong>em Grundstück stand die Synagoge. Dazu besaß er <strong>ein</strong> Feld 55 . Es <strong>ist</strong><br />
demzufolge anzunehmen, dass er auch Landwirtschaft trieb. Zu s<strong>ein</strong>em<br />
Schutzherrn, dem Major Alexander H<strong>ein</strong>rich von und zu <strong>Redwitz</strong>, sch<strong>ein</strong>t er<br />
<strong>ein</strong> gutes Verhältnis gehabt zu haben; der Obr<strong>ist</strong>felder Pfarrer Georg Adam<br />
Kümmelmann schrieb 1747, Jakob habe den Herrn Major sehr <strong>ein</strong>ge- und<br />
sich sonsten viel unternommen 56 , und <strong>ein</strong>mal, 1742, wird er als Hoffactor<br />
bezeichnet 57 . Jakob Bonum war wohl die herausragende Gestalt unter den<br />
<strong>Redwitz</strong>er Juden s<strong>ein</strong>er Zeit.<br />
1670 besuchte <strong>ein</strong> <strong>Redwitz</strong>er Jude die Bamberger Messe; wir erfahren nur<br />
deshalb davon, weil er auf dem Rückweg ermordet wurde 58 . 1706, 1713 und<br />
1714 zog Bonum Jakob, der Vater des oben erwähnten Jakob Bonum, auf die<br />
Leipziger Messe 59 . Regelmäßig re<strong>ist</strong>e später Wolf Marx (gest. 1760/61 60 ),<br />
der 1747 zusammen mit Jakob Bonum als Vertreter der jüdischen Gem<strong>ein</strong>de<br />
<strong>Redwitz</strong> auftrat 61 , nach Leipzig: Von 1731 bis 1759 kam er mit <strong>ein</strong>er Ausnahme<br />
alljährlich zur Messe,<br />
in den letzten Jahren oft<br />
begleitet von <strong>ein</strong>em s<strong>ein</strong>er<br />
Söhne oder s<strong>ein</strong>er Frau.<br />
Drei s<strong>ein</strong>er Söhne – Isaak,<br />
Lazarus (Löser) und<br />
Marcus (Marx) – sch<strong>ein</strong>en<br />
das Geschäft ab 1760 weitergeführt<br />
zu haben. Vermutlich<br />
handelten sie vornehmlich<br />
mit Textilien.<br />
Große Geschäfte fanden<br />
eben am ehesten Niederschlag<br />
in den Quellen.<br />
Insgesamt gesehen waren<br />
reiche Juden aber Aus-
nahmeersch<strong>ein</strong>ungen in den jüdischen Landgem<strong>ein</strong>den Frankens 62 . Wenn auch<br />
in <strong>Redwitz</strong> erstaunlich viele wohlhabende Juden lebten, so schlug sich die<br />
Mehrzahl doch armselig durch. 1810 notierte der Banzer Landrichter sogar:<br />
Die Juden zu Redwiz sind sämmtlich Kl<strong>ein</strong>händler 63 . Noch in den 1820er<br />
Jahren hatten neun der 39 <strong>Redwitz</strong>er Judenfamilien gar k<strong>ein</strong> Vermögen, weitere<br />
elf besaßen weniger als 500 Gulden 64 . In früheren Jahren dürfte es im<br />
Verhältnis noch mehr Arme gegeben haben.<br />
Sie ernährten sich vom Kl<strong>ein</strong>-, vom Vieh-, vom Hausier-, vom Lumpenhandel<br />
oder vom Taglohn. Über Maier Wolf Dinon heißt es 1824: Naehrt<br />
sich vom Lumpenhandel, kann sich aber nach s<strong>ein</strong>en Angaben s<strong>ein</strong> Brod<br />
nicht ferner mehr davon verdienen. Abraham Moses Binder, der, hochbetagt<br />
und verwitwet, um dieselbe Zeit in <strong>Redwitz</strong> wohnte, lebte theils von <strong>ein</strong>em<br />
unbedeutenden Viehhandel, theils von Unterstüzzung guter Leute 65 .<br />
Für die Ärmsten der Armen, vagierende jüdische Bettler 66 , bestand <strong>ein</strong>e Herberge,<br />
die sich 1794 nachweisen läßt 67 ; um dieselbe Zeit <strong>ist</strong> <strong>ein</strong>e derartige<br />
Einrichtung auch in M<strong>ist</strong>elfeld erwähnt 68 . Im frühen 19. Jahrhundert wurden<br />
die Herbergen wohl geschlossen, verfügte doch die Landesdirektion Bamberg<br />
im Januar 1807: Betteljuden sollen nirgend in das Land gelassen, sondern<br />
überall, wo sie betreten werden, über die Gränze geliefert werden. 69<br />
Das Ende des Hochstifts Bamberg 1802, die Übernahme der Herrschaft durch<br />
Bayern, die Mediatisierung der Reichsritterschaft bis 1806 blieben nicht ohne<br />
Einfluss auf das Leben der Juden. Das für den jüdischen Alltag grundlegende<br />
Gesetz war das Edikt die Verhältnisse der jüdischen Glaubensgenossen<br />
im Königreiche Baiern betreffend vom 10. Juni 1813 70 , in der Forschung als<br />
„Judenedikt“ bezeichnet. Den Juden wurde unter anderem geboten, <strong>ein</strong>en<br />
festen Familiennamen anzunehmen 71 . Bis dahin hatten die Juden in <strong>Redwitz</strong><br />
wie in vielen anderen Dörfern in der Regel nur ihren (Vor-)Namen und den<br />
Namen des Vaters getragen, also z. B. Moses Isaak, d. h. Moses Sohn des<br />
Isaak.<br />
Die Namenswahl war den Juden im großen und ganzen freigestellt. In <strong>Redwitz</strong><br />
ersch<strong>ein</strong>en in den 1820er Jahren die Familiennamen Auriel, Kares, Cotta,<br />
Kastor, Geta, Gütermann, Dinon, Endimion, Flankauer, Gosser, Gutmann,<br />
Kuh, Hallo, Hopfmann, Kann, Korn, Lust, Midas, Philo, Pausan (später<br />
Pauson), Pictor, Rindskopf, Schnebel, Wald und Zinn. Wieso gerade diese<br />
Günter Dippold<br />
Veränderungen durch<br />
das Judenedikt von<br />
1813<br />
151<br />
151
152 152<br />
152<br />
152 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Landflucht und<br />
Auswanderung: Das<br />
Schrumpfen der<br />
Gem<strong>ein</strong>de<br />
Namen gewählt wurden, <strong>ist</strong> im Einzelfall kaum zu klären. Einige griffen auf<br />
Namen zurück, die sie bereits vor 1813 geführt hatten (Schnebel, Gutmann,<br />
Rindskopf, Auriel). Auffällig sind die antiken Anklänge etlicher <strong>Redwitz</strong>er<br />
Namen: Cotta und Geta sind B<strong>ein</strong>amen bekannter römischer Familien,<br />
Endimion <strong>ist</strong> wohl aus dem Griechischen abgeleitet (,endemios‘ = der Einheimische),<br />
ebenso Kastor (Bieber), Philo (,philos‘ = Freund) und vielleicht<br />
Dinon (vielleicht von ,dino‘ = tanzen); König Midas <strong>ist</strong> <strong>ein</strong>e mythologische<br />
Gestalt; Pictor kommt aus dem Lat<strong>ein</strong>ischen (,Maler‘).<br />
Ferner bestimmte das Judenedikt von 1813, dass die Polizeibehörden sog.<br />
Juden-Matrikeln anzulegen hatten. In diese Matrikel musste sich jede jüdische<br />
Familie mit ihrem neuen Namen und unter Vorlage ihres alten Schutzbriefs<br />
<strong>ein</strong>tragen lassen.<br />
Durch die Matrikel sollte die Zahl der Juden am jeweiligen Ort festgeschrieben<br />
werden. In der Regel durften k<strong>ein</strong>e zusätzlichen Familien zuziehen. Wenn<br />
<strong>ein</strong> Jude mit s<strong>ein</strong>er Familie dennoch in <strong>ein</strong>en anderen Ort umziehen wollte,<br />
oder wenn er an s<strong>ein</strong>em Heimatort <strong>ein</strong>e Familie gründen wollte, musste er<br />
warten, bis am jeweiligen Ort <strong>ein</strong>e Matrikelstelle freigeworden, d. h. bis <strong>ein</strong>e<br />
andere Familie fortgezogen oder verstorben war. Der Zweck dieser Vorschrift<br />
wird im Edikt ausdrücklich genannt: Die Zahl der Judenfamilien an den<br />
Orten, wo sie dermal bestehen, darf in der Regel nicht vermehrt werden, sie<br />
soll vielmehr nach und nach vermindert werden, wenn sie zu groß <strong>ist</strong>. In<br />
<strong>Redwitz</strong> lebten im Stichjahr 1813 38 Familien; folglich gab es fortan 38<br />
Matrikelstellen.<br />
Diese Vorschriften waren bis 1861 in Kraft; erst von da an hatten Juden in<br />
Bayern dieselbe Freizügigkeit wie Chr<strong>ist</strong>en. Gleichwohl veränderte sich die<br />
Zahl der jüdischen Einwohner von <strong>Redwitz</strong> in dieser Zeit: 1829 wohnten im<br />
Dorf 196 Juden (23,4 Prozent der Einwohner); 35 Jahre später waren es nur<br />
noch 81 (10,4 Prozent) 72 .<br />
1856 notierte der <strong>Redwitz</strong>er Rabbiner: Die Gem<strong>ein</strong>de zählte vor ungefähr 15<br />
Jahren 40 Mitglieder [d. h. Familienvorstände], gegenwärtig sind es kaum<br />
20 mehr, und wenn wiederum 15 Jahre herum sind, werden es kaum 10 mehr<br />
s<strong>ein</strong>, da die me<strong>ist</strong>en Mitglieder betagte Leute sind, <strong>ein</strong>e neue Ansäßigmachung<br />
aber höchst selten vorkommt. 73 Moses Gutmann behielt Recht.<br />
Einen Grund für das Schrumpfen der Gem<strong>ein</strong>de bildete wohl die schwierige
Erwerbslage auf dem Land. Besonders die Handeltreibenden zog es in die<br />
Städte. Andere wollten auswandern 74 , namentlich in die USA, wo Juden die<br />
vollen bürgerlichen Rechte genossen. All<strong>ein</strong> zwischen 1848 und 1854 emigrierten<br />
mindestens 20 all<strong>ein</strong>stehende junge Juden nach Nordamerika 75 :<br />
1837 Bernhard Rindskopf, Schuhmacherme<strong>ist</strong>er, mit s<strong>ein</strong>er Ehefrau<br />
1848 Ludwig Wald<br />
1848 H<strong>ein</strong>rich Zinn<br />
1848 Simon Gütermann<br />
1850 Bernhard Kann<br />
1850 Sigmund Zinn<br />
1850 Rettel Kuh<br />
1850 Martin Gütermann, Schneiderlehrling<br />
1851 Martin Gutmann<br />
1851 Isidor Castor<br />
1852 Sigmund Castor<br />
1852 Alexander Gütermann<br />
1853 Kerl Kuh und Jakob Hallo<br />
1853 Franz und Jette Pausan, Geschw<strong>ist</strong>er<br />
1853 Abraham Kuh<br />
1853 Joel Hallo, Schr<strong>ein</strong>erme<strong>ist</strong>er<br />
1853 Wilhelm Kastor<br />
1854 Babette Pictor<br />
1854 Babette Kuh<br />
Die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848 beschleunigten und verstärkten<br />
die Landflucht und die Tendenz zur Auswanderung. Nachdem am 12. März<br />
1848 von <strong>ein</strong>er aufgebrachten Menge das Amtshaus geplündert war, zogen<br />
Trupps vor die von Juden bewohnten Häuser, schrien, schlugen Fenster und<br />
Türen <strong>ein</strong>. Einige Familien versuchten, sich und ihre Habe zu retten, indem<br />
sie Geld oder andere Wertsachen aus dem Fenster warfen. Der Familie des<br />
Kaufmanns Marx Gütermann nötigte man den Ladenschlüssel ab und plünderte<br />
den Warenbestand, 1500 Gulden wert. Nur als <strong>ein</strong>ige Männer die Ladentür<br />
von Koppel Gütermann (1792–1868) aufbrechen wollten, schritten<br />
die Nachbarn <strong>ein</strong> und verjagten die Täter 76 .<br />
Günter Dippold<br />
153<br />
153
154 154<br />
154<br />
154 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Hauptstraße 2, hier lebten<br />
1810 Isack Moses (Hallo)<br />
Kronum Moses (Hallo) und<br />
Wolf Moses (Hallo)<br />
Wie den <strong>Redwitz</strong>er Juden nach den Schrecken jener Nacht zumute war, illustriert<br />
der Brief, den der <strong>Redwitz</strong>er D<strong>ist</strong>riktsrabbiner Moses Gutmann (1805–<br />
1862) am 21. März 1848 an die Regierung von <strong>Oberfranken</strong> schrieb. Er bat<br />
darin, s<strong>ein</strong>en Wohnsitz nach Lichtenfels verlegen zu dürfen, und erinnerte in<br />
diesem Zusammenhang daran, welche arge Ruhestörungen in hiesigem Orte<br />
stattfanden, wie namentlich die Israliten von Seiten des rohen Pöbels mißhandelt,<br />
ihr Eigenthum zum Theil geplündert worden, ja selbst ihr Leben<br />
von großer Gefahr bedroht gewesen sei, wenn sie den verübten Gewaltthätigkeiten<br />
Widerstand gele<strong>ist</strong>et hätten. In Folge dessen, und da bei der<br />
herrschenden Erbitterung <strong>ein</strong>es Theiles der chr<strong>ist</strong>lichen Bevölkerung über<br />
die militärische Besetzung des Ortes noch immerfort die heftigsten Drohungen<br />
gegen die jüdischen Einwohner laut werden, sind viele, und gerade die<br />
angesehensten jüdischen Familien entschlossen, den hiesigen Ort zu verlaßen,<br />
wo sie ihr Eigenthum und ihr Leben nicht mehr für sicher halten. Einige<br />
haben diesen Entschluß bereits ausgeführt. Die israelitische Kultusgem<strong>ein</strong>de<br />
drohe wenn nicht ganz, doch großentheils <strong>ein</strong>zugehen 77 .<br />
Tatsächlich konstatierten Ende 1849 Vertreter der jüdischen Gem<strong>ein</strong>de: Durch<br />
die betrübenden Vorfälle im hiesigem Orte im März des vorigen Jahres sind<br />
[...] mehrere, und zwar<br />
von den reichsten Familien<br />
im Begriffe, sich anderswo<br />
ansäßig zu machen<br />
78 .<br />
Wie verbittert die Juden<br />
waren, spürt man, wenn<br />
man den 1850 gestellten<br />
Antrag des aus <strong>Redwitz</strong><br />
kommenden Marx Gütermann<br />
auf das Bamberger<br />
Bürgerrecht liest: Bis zum<br />
Jahre 1848 betrieb m<strong>ein</strong>e<br />
Handlung zu <strong>Redwitz</strong><br />
schwunghaft und verlegte<br />
mich vorzüglich auf den<br />
En-gros-Handel mit
Tuchwaaren. [...] Die bekannten Ereigniße zu <strong>Redwitz</strong> und in der dortigen<br />
Gegend im Jahre 1848 unterbrachen m<strong>ein</strong> Geschäft und veranlaßten mich,<br />
mit m<strong>ein</strong>er Familie hieher zu ziehen, weil zu jener Zeit dort weder Person<br />
noch Eigenthum sicher war. Obwohl ich stets mit den Bewohnern zu <strong>Redwitz</strong><br />
freundlich zusammen lebte und dieselben durch m<strong>ein</strong> Geschäft nur Vortheile<br />
zogen, so wurde doch auch m<strong>ein</strong> Laden aus Habgier mit geplündert. Dieß<br />
hat es mir verleitet, jemals wieder nach <strong>Redwitz</strong> zu ziehen. 79<br />
Gütermann war k<strong>ein</strong> Einzelfall. Die Plünderungen von 1848 bewogen viele<br />
Juden dazu, ihren Wohnsitz an <strong>ein</strong>en sichereren Ort zu verlegen. So wollte<br />
der Bamberger Armenpflegschaftsrat 1852 seit <strong>ein</strong>iger Zeit beobachtet haben,<br />
daß Israeliten aus allen benachbarten Gegenden sich in die hiesige<br />
Stadt drängen 80 . In <strong>Redwitz</strong> sank die Zahl der Juden von 189 im Jahr 1832<br />
auf 76 im Jahr 1867 81 und 67 im Jahr 1869 82 .<br />
Dennoch wurde dem Rabbiner nicht gestattet, s<strong>ein</strong>en Amtssitz nach Lichtenfels<br />
zu verlegen, wo die Gem<strong>ein</strong>de ihre Größe etwa hielt. S<strong>ein</strong> 1848 gestellter<br />
Antrag wurde abgelehnt. Als 1856 <strong>ein</strong>e jüdische Schule in <strong>Redwitz</strong> gegründet<br />
wurde, erfuhr der Rabbiner <strong>ein</strong>e finanzielle Einbuße, hielt er doch<br />
fortan nicht mehr den Religionsunterricht. Deshalb wollte er nach Lichtenfels<br />
übersiedeln, denn dort habe er Gelegenheit, durch Sprachen-Unterricht<br />
so viel zu verdienen, als mir durch den Verlust der Religionslehrersstelle<br />
entgeht 83 . Doch die Gem<strong>ein</strong>den im <strong>Bezirk</strong>samt Kronach und die <strong>Redwitz</strong>er<br />
Juden protestierten, und so verweigerte die Regierung ihm wiederum den<br />
Umzug nach Lichtenfels 84 .<br />
Da gerade die jüngeren Gem<strong>ein</strong>demitglieder in die Städte, besonders nach<br />
Lichtenfels und Bamberg, oder nach Nordamerika übersiedelt waren, war<br />
die <strong>Redwitz</strong>er Gem<strong>ein</strong>de offenbar überaltert. Denn den Fortziehenden standen<br />
nur ver<strong>ein</strong>zelt Zuwanderer gegenüber, wie etwa Max Fleischmann, der<br />
im Sommer 1890 s<strong>ein</strong> Tuch- und Manufakturwaaren-Geschäft von Oberlangenstadt<br />
nach <strong>Redwitz</strong> verlegte 85 .<br />
1875 lebten noch 51 Juden in <strong>Redwitz</strong>, 1880 nur mehr 26 86 . Ihr Anteil an der<br />
Gesamtbevölkerung sank seit 1864 von 10,4 auf 2,5 Prozent. <strong>Redwitz</strong> stand<br />
mit dieser Entwicklung nicht all<strong>ein</strong> da 87 : In Küps wohnten um 1810 weit<br />
über 100 Juden; 1900 zog die letzte Familie jüdischen Bekenntnisses fort 88 .<br />
In Altenkunstadt machte 1837 die 400 Personen starke israelitische Kultusgem<strong>ein</strong>de<br />
die Hälfte der Einwohner aus; 1900 gab es noch ganze 65 Juden<br />
Günter Dippold<br />
155<br />
155
156 156<br />
156<br />
156 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Karoline Lust geb. Kürschner<br />
(1792–1864)<br />
Haustür zum früheren<br />
Anwesen von Bonum Moses<br />
(Lust), Am Markt 7<br />
am Ort. In Horb lebten 1824 48 Juden, 1900 nur mehr <strong>ein</strong>er 89 . Das Ausbluten<br />
der Landgem<strong>ein</strong>den <strong>ist</strong> in ganz Franken zu beobachten. Lebte z. B. in Mittelfranken<br />
1855 erst <strong>ein</strong> Drittel der Juden in Städten, so waren es 1910 80,5<br />
Prozent, Tendenz weiter steigend 90 .<br />
Familiengeschichtliche Studien belegen, wie rasant innerhalb <strong>ein</strong>er Generation<br />
die jüdische Gem<strong>ein</strong>de <strong>Redwitz</strong> Mitglieder verlor, und zwar zuerst<br />
Angehörige der wohlhabenderen Familien. Vier Fälle mögen dies verdeutlichen:<br />
Samuel Marx Gütermann hatte aus zwei Ehen acht Kinder 91 . K<strong>ein</strong>es davon<br />
starb in <strong>Redwitz</strong>. Mehrere Söhne lebten zuletzt als Hopfenhändler in<br />
Bamberg; der älteste, Koppel, zog über Wien nach Agram in Kroatien<br />
(das heutige Zagreb), wo er 1868 starb. Zwei Söhne wanderten in die<br />
USA aus; sie wohnten dort in Steubenville, Ohio. Enkel Gütermanns finden<br />
wir in Bamberg, im mittelfränkischen Georgensgmünd, in Frankfurt<br />
am Main, in Wien, in Agram (Zagreb), in verschiedenen nordamerikanischen<br />
Städten, wobei besonders häufig Cincinnati als Wohnort gewählt<br />
wurde. Einige Enkel von Samuel Marx Gütermann konvertierten zum<br />
Chr<strong>ist</strong>entum, darunter der Seidenfabrikant Maximilian Gütermann, der<br />
den evangelischen Glauben annahm. 92<br />
Ein weiteres Beispiel bildet die Familie Lust. Der wohlhabende Viehhändler<br />
Bonum Lust, gestorben 1855, hatte 13 Kinder, die das<br />
Erwachsenenalter erreichten, und mindestens 46 Enkel. Von s<strong>ein</strong>en<br />
Kindern blieben nur drei bis zu ihrem Tod in <strong>Redwitz</strong> wohnen. Die<br />
übrigen finden wir in Frankfurt, Fürth, Mühlhausen in Thüringen,<br />
Bamberg, Altenkunstadt, Reckendorf bei Baunach und Nürnberg. K<strong>ein</strong><br />
Enkelkind von Bonum Lust starb in <strong>Redwitz</strong>. Dagegen lassen sich<br />
Enkel nachweisen in Bamberg, Memmelsdorf, Fürth, Nürnberg, Regensburg,<br />
München, Aschaffenburg, Frankfurt, Mainz, Darmstadt, Eisenach,<br />
Berlin und Meran. In Paris lebte der Kaufmann Bertrand Lust,<br />
in Brüssel <strong>ein</strong> anderer Enkel. Mehrere Kindeskinder von Bonum Lust<br />
wanderten in die USA aus – bevorzugt wurde New York –, und <strong>ein</strong>e<br />
Enkelin verzog vor 1887 nach Melbourne in Australien. Die überwiegende<br />
Mehrzahl der Nachkommen von Lust bzw. ihre Ehepartner<br />
ernährten sich durch kaufmännische Berufe. In der Enkelgeneration<br />
finden wir lediglich <strong>ein</strong>e Ausnahme: den Rechtsanwalt Herrmann Lust
in Nürnberg, dem der Titel Justizrat verliehen wurde. Ein Urenkel führte <strong>ein</strong><br />
Anwaltsbüro am Broadway in New York; <strong>ein</strong> anderer war Chefingenieur in<br />
Aachen 93 .<br />
Der 1862 verstorbene Rabbiner Moses Gutmann hinterließ fünf Söhne und<br />
<strong>ein</strong>e Tochter 94 . Ein Sohn starb drei Jahre später als Advokat in Bamberg, die<br />
anderen vier lebten als Kaufleute in Nordamerika. Die Tochter Rosalie (1838–<br />
1912) war mit dem jüdischen Lehrer Moses Vogel von Altenkunstadt verheiratet;<br />
von ihren fünf Söhnen wurde <strong>ein</strong>er, Justin Vogel, Arzt, wohl in Würzburg<br />
95 , <strong>ein</strong> anderer, Ignaz Vogel (1871–1922), Professor für Bakteriologie in<br />
Leipzig 96 .<br />
Der Trend in die Städte und nach Amerika setzte sich noch im späten 19. und<br />
frühen 20. Jahrhundert fort. Als der Korbhändler Emanuel Gutmann 1909<br />
starb, hinterließ er elf Kinder im Alter zwischen 33 und 6 Jahren. Schon<br />
damals lebte die älteste Tochter in den USA, genauer: in Brooklyn. Zwei<br />
weitere Töchter wohnten in bzw. bei Frankfurt am Main. Von den sieben<br />
Kindern aus zweiter Ehe fiel <strong>ein</strong> Sohn im Ersten Weltkrieg, <strong>ein</strong> anderer Sohn,<br />
Metzger, von Beruf, zog vor 1922 nach Nürnberg. Nur sechs von elf Kindern<br />
hatten in den 20er Jahren noch ihren Wohnsitz in <strong>Redwitz</strong> 97 .<br />
Mit dem Judenedikt von 1813 traf die bayerische Regierung nicht nur Anordnungen<br />
über Zahl und Wohnorte der Juden, sondern auch und vor allem<br />
über ihre Berufe. Die damit verbundene Zielsetzung findet in § 15 ihren<br />
Ausdruck: Um die Juden von ihren bisherigen ebenso unzureichenden als<br />
gem<strong>ein</strong>schädlichen Erwerbsarten abzuleiten und ihnen jede erlaubte [...]<br />
Erwerbsquelle zu eröffnen, sollen dieselben zu allen bürgerlichen Nahrungszweigen,<br />
als: Feldbau, Handwerken, Treibung von Fabriken und Manufakturen<br />
und des ordentlichen Handels [...] zugelassen, dagegen der gegenwärtig<br />
bestehende Schacherhandel allmählich, jedoch so bald immer möglich,<br />
ganz abgestellt werden. Dazu durften die Juden nun Grundbesitz erwerben;<br />
Handwerksberufe standen ihnen offen. Handel durfte treiben, wer das nötige<br />
Kapital und Wissen besaß und Bücher in deutscher Sprache führte. Dem<br />
Hausieren, überhaupt dem Kl<strong>ein</strong>handel sagte die Regierung dagegen den<br />
Kampf an. Freilich konnte man ihn nicht von <strong>ein</strong>em Tag auf den anderen<br />
verbieten, hätte dies doch unzähligen Familien die Ex<strong>ist</strong>enzgrundlage entzogen.<br />
So bestimmte das Edikt in § 20: Nur von denjenigen hierauf schon<br />
Bonum Lust<br />
(1777–1855)<br />
Günter Dippold<br />
Wandlungen der<br />
wirtschaftlichen<br />
Struktur im<br />
19. Jahrhundert<br />
157<br />
157
158 158<br />
158<br />
158 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Kronacher Straße 12.<br />
Dieses Haus gehörte 1810<br />
Bärl<strong>ein</strong> Seligmann und der<br />
Witwe Märla (Flankauer),<br />
später war hier die Polize<strong>ist</strong>ation<br />
untergebracht.<br />
Besitzer war die Firma<br />
Goldmüller, Kronach<br />
ansässigen jüdischen Hausvätern, welche sich dermal auf andere Art zu ernähren<br />
nicht vermögen, darf derselbe noch insolange fortgesetzt werden, bis<br />
sie <strong>ein</strong>en anderen ordentlichen Erwerbszweig erlangt haben werden.<br />
Männer, die sich von jeher durch Hausieren ernährt hatten, durften dies also<br />
fortsetzen. Die jüngeren unverheirateten Juden aber wurden angehalten, <strong>ein</strong><br />
Handwerk zu erlernen. In der <strong>Redwitz</strong>er Judenmatrikel finden sich hierfür<br />
etliche Beispiele. Bernhard Rindskopf, geboren 1798, Sohn <strong>ein</strong>es Schnittwarenhändlers,<br />
trieb die Handelsgeschäfte s<strong>ein</strong>es Vaters in Sachsen. In den<br />
20er Jahren teilte ihm die zuständige Polizeibehörde mit: Will Bernhardt<br />
der<strong>ein</strong>st in Baiern [sich] ansäßig machen oder geduldet seyn will, so muß er<br />
<strong>ein</strong> gebilligtes Gewerbe erlernen. Er wurde daraufhin 1825 nolens volens<br />
Schuhmacherlehrling 98 . Abraham Zinn, geboren 1786, handelte ebenfalls in<br />
Sachsen. In die Matrikel notierte der Landrichter: Abraham <strong>ist</strong> zum Gewerbestand<br />
anzuhalten, widrigenfalls er als Müßiggänger zu<br />
behandeln <strong>ist</strong>. Zinn zog es vor, sich in Plauen, außerhalb<br />
Bayerns, niederzulassen 99 .<br />
Damit war er aber <strong>ein</strong>e Ausnahme. Die me<strong>ist</strong>en jungen<br />
Juden erlernten auf den staatlichen Druck hin <strong>ein</strong> Handwerk;<br />
andere taten dies freiwillig. Sie wurden Schuhmacher,<br />
Gerber, Seifensieder, Schr<strong>ein</strong>er, Metzger, Korbmacher.<br />
Besonders beliebt war die Textilproduktion.<br />
<strong>Redwitz</strong>er Juden ergriffen den Beruf des Webers, des<br />
Seiden- und Baumwollwebers.<br />
Eine Stat<strong>ist</strong>ik aus dem Jahr 1832 100 zeigt die Auswirkungen<br />
des Edikts. Damals gab es in <strong>Redwitz</strong> 45 jüdische<br />
Familien, sieben davon außerhalb der eigentlichen<br />
Matrikelzahl. Drei ernährten sich durch Großhandel, 16<br />
durch Handwerk, zwei durch Landwirtschaft. Also hatten<br />
gerade erst 21 Familien <strong>ein</strong>en Broterwerb nach dem<br />
Wunsch des Staates, darunter allerdings die me<strong>ist</strong>en jungen<br />
Familien. Von den übrigen 24 lebten fünf von Detailhandel,<br />
zehn vom Hausieren, vier vom Viehhandel;<br />
fünf waren Taglöhner.<br />
Das Edikt setzte sich also schleppend durch. Vor allem<br />
aber scheiterte s<strong>ein</strong> eigentliches Vorhaben, die Juden
langfr<strong>ist</strong>ig vom Handel wegzuführen. Der Gem<strong>ein</strong>deausschuss <strong>Redwitz</strong> stellte<br />
1832 fest: Wenn sich die Juden auch auf Gewerbe ansäßig machen, so lassen<br />
sie solche öfters ganz liegen oder treiben wenigstens nebenbei den Handel<br />
als Hauptnahrungszweig, weil dabei eher etwas verdient wird. 101 In den<br />
fränkischen Gem<strong>ein</strong>den <strong>ist</strong> zu beobachten, dass die jüdischen Handwerker<br />
nicht selten entweder ihr Gewerbe zu <strong>ein</strong>er Fabrik erweiterten oder zu <strong>ein</strong>em<br />
Handelsunternehmen ausbauten 102 . Die Tuchmacher Moritz Hallo und Marx<br />
Wald arbeiteten um 1830 mit mehreren Gesellen und waren auf dem Weg,<br />
ihren Betrieb in <strong>ein</strong>e Fabrik zu verwandeln, nicht anders der Seifensieder<br />
und Wachszieher Seligmann Gütermann. Die Korbmacher wurden zu Korbhändlern:<br />
Baruch Zinn, geboren 1792 als Sohn <strong>ein</strong>es Schnittwarenhändlers,<br />
erlernte bei <strong>ein</strong>em chr<strong>ist</strong>lichen Me<strong>ist</strong>er das Korbmacherhandwerk; später hatte<br />
er übrigens umgekehrt chr<strong>ist</strong>liche Lehrlinge. Seit 1855 wird er als Korbhändler<br />
bezeichnet; aber er hatte wohl schon 1845 s<strong>ein</strong>en 17jährigen Sohn auf<br />
Handelsreise nach Nordamerika geschickt. Salomon<br />
Pausan (1809–1869), der – Sohn <strong>ein</strong>es armen Viehhändlers<br />
– das Korbmacherhandwerk auf staatlichen Druck hin<br />
ergriff, war der Begründer <strong>ein</strong>es bedeutenden Handelshauses.<br />
Auch s<strong>ein</strong> Bruder Moses (1806–1869) sch<strong>ein</strong>t von<br />
der Korbmacherei zum Korbhandel übergegangen zu s<strong>ein</strong>.<br />
Die bestimmende wirtschaftliche Kraft im <strong>Redwitz</strong> des<br />
frühen 19. Jahrhunderts waren die Gütermann. Marx<br />
Wolf, der 1801 starb, hatte mindestens vier Söhne – Wolf<br />
(1763–1839), Samuel (1771–1841), Henoch (1773–<br />
1850), Kronum – sowie zwei sicher nachweisbare Töchter.<br />
Die vier Brüder legten sich, dem Judenedikt gemäß,<br />
<strong>ein</strong>en Familiennamen – nämlich Gütermann – zu.<br />
Ihr Haupterwerbszweig war der Großhandel mit Textilien,<br />
die sie offenbar größtenteils aus Sachsen bezogen. Ihre<br />
Hauptabsatzgebiete waren wohl Altbayern und Württemberg;<br />
sie besuchten aber auch Messen und Märkte, vom<br />
Zeulner Krammarkt bis zur Leipziger Messe 103 . Zur Bamberger<br />
Herbstmesse des Jahres 1833 brachte Samuel Marx<br />
Gütermann über 33 Zentner Woll- und Baumwollwaren.<br />
Günter Dippold<br />
Am Markt 6,<br />
1810 Anwesen von<br />
Bonum David (Hopfmann)<br />
159<br />
159
160 160<br />
160<br />
160 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Daneben waren die Gütermann Bankiers. Aus dem Geschäftsbuch des Korbhändlers<br />
Harthan 104 wissen wir, dass er in den 1820er bis 40er Jahren mehrfach<br />
Kredite von ihnen erhielt. 1831 sind die Brüder als Besitzer des <strong>Redwitz</strong>er Zehnten<br />
nachzuweisen; sie nahmen als solche von den Grundeigentümern des Ortes<br />
pro Jahr Getreide und Gemüse im Wert von ca. 450 Gulden <strong>ein</strong> 105 .<br />
1817 kauften Henoch und Samuel Marx Gütermann <strong>ein</strong>e Glasfabrik in Kronach<br />
106 . Als 1836 in <strong>Redwitz</strong> unter Federführung des Karl Sigmund von <strong>Redwitz</strong><br />
<strong>ein</strong>e Zuckerfabrik gegründet wurde, hielten Samuel Gütermann und s<strong>ein</strong> Sohn<br />
Koppel vier der 14 Anteile in der Fabrikgesellschaft. Und als die Fabrik schon<br />
1844 scheiterte, übernahm <strong>ein</strong> jüngerer Sohn Samuels, der Tuchhändler Marx<br />
Gütermann, die Anlagen, ohne sie allerdings weiter zu betreiben. S<strong>ein</strong>em Schwiegersohn<br />
Löb Friedmann in Burgkunstadt ermöglichte Samuel Marx Gütermann<br />
die Einrichtung <strong>ein</strong>er – allerdings wohl nur kurzlebigen – Essigfabrik 107 .<br />
Auch im Handwerk war die Familie erfolgreich. Seligmann Gütermann, <strong>ein</strong><br />
Neffe Henochs, erlernte das Handwerk des Seifensieders und Lichterziehers.<br />
Er war für den Landgerichtsassessor Thomas Rübl<strong>ein</strong> 1831 neben den Webern<br />
und Tuchmachern der <strong>ein</strong>zige erwähnenswerte Gewerbetreibende in<br />
<strong>Redwitz</strong>. Er arbeitete im großen Stil, mit mehreren Gesellen und Lehrlingen.<br />
Samuel Marx sch<strong>ein</strong>t die herausragende Gestalt gewesen zu s<strong>ein</strong>; er war<br />
nach Ausweis der in den 1820er Jahren angelegten Judenmatrikel auch der<br />
reichste <strong>Redwitz</strong>er Jude. Im Dorf genoss er offenbar <strong>ein</strong>iges Prestige; als<br />
1811 die Brüder Philipp Anton und Karl Sigmund von <strong>Redwitz</strong> <strong>ein</strong>en Vertrag<br />
über den Besitz am Rittergut schlossen, unterzeichnete neben dem Küpser<br />
Pfarrer als Zeuge Samuel Marx auß <strong>Redwitz</strong> 108 .<br />
Wir finden ihn – teils all<strong>ein</strong>, teils zusammen mit s<strong>ein</strong>en Brüdern, namentlich<br />
Henoch – in mancherlei Geschäfte verwickelt, ob es Fabrikgründungen,<br />
Geldgeschäfte, Textil- oder Immobilienhandel waren. Als 1826 die Alte Abtei,<br />
<strong>ein</strong> rund 90 Meter langer Bau, im Kloster Langheim versteigert wurde,<br />
erhielt er den Zuschlag; allerdings verhinderte <strong>ein</strong> Nachgebot des Lichtenfelser<br />
Frühindustriellen Joseph Felix Silbermann, dass das dre<strong>ist</strong>öckige Gebäude<br />
tatsächlich in Gütermanns Besitz überging 109 .<br />
Am Ende s<strong>ein</strong>es Lebens – er starb 1841 – verfügte Samuel Marx trotz wirtschaftlicher<br />
Rückschläge zu Beginn der 1830er Jahre über <strong>ein</strong> beträchtliches<br />
Vermögen, so dass er es sich le<strong>ist</strong>en konnte, jedem s<strong>ein</strong>er acht Kinder 4000<br />
Gulden zu vererben.
Der <strong>ein</strong>zige Sohn Samuels aus s<strong>ein</strong>er ersten Ehe mit Edel Koppel aus Burgkunstadt,<br />
deren Familie sich später Thurnauer nannte 110 , war Koppel Gütermann<br />
(1792–1868). Dieser heiratete die um zehn Jahre jüngere Mina Brüll<br />
(1802–1883) aus Lichtenfels, die Tochter <strong>ein</strong>es wohlhabenden Viehhändlers.<br />
Als zweites Kind aus dieser Ehe wurde am 12. Oktober 1828 im Haus<br />
Nr. 74 (Am Markt 5) Marx Gütermann geboren, der sich später Maximilian<br />
nannte. Unter diesem Namen heiratete er am 22. Mai 1854, offenbar in<br />
Lichtenfels, s<strong>ein</strong>e Cousine Sophia Kohn aus Seubelsdorf 111 .<br />
Damals hatte sich Maximilian Gütermann schon in Wien niedergelassen, wo<br />
er uns 1859 erstmals als Geschäftsmann entgegentritt: Er gründete zusammen<br />
mit s<strong>ein</strong>em jüngeren Bruder Sigmund <strong>ein</strong> Unternehmen unbekannter Art; es<br />
bestand noch 1872, aber nicht mehr 1874 112 . Maximilian Gütermann kam, zum<br />
evangelischen Glauben konvertiert, über Rafz in der Schweiz nach Gutach in<br />
Baden, wo er 1867 <strong>ein</strong>e Nähseidenfabrik errichtete. Hier<br />
arbeiteten 1878 fünfzig Personen 113 . Noch zu Lebzeiten<br />
des Gründers – er starb 1896 – erlangte dieses Unternehmen,<br />
zu dem ab 1884 <strong>ein</strong>e Seidenkämmerei in Perosa bei<br />
Turin gehörte, Weltruf; um 1900 beschäftigte die Firma<br />
Gütermann & Co. rund 1000 Menschen 114 .<br />
Neben den Gütermann gab es in <strong>Redwitz</strong> noch weitere,<br />
kl<strong>ein</strong>e Textilhändler. Sie und die Textilproduzenten waren<br />
die maßgeblichen wirtschaftlichen Kräfte, der Motor<br />
der frühen Industrialisierung in <strong>Redwitz</strong>. Um die<br />
Jahrhundertmitte, genauer: 1848 oder kurz danach zogen<br />
die me<strong>ist</strong>en dieser Familien fort in die Städte, vor<br />
allem nach Bamberg. Die Gütermann gaben dort ihren<br />
Tuchhandel auf und widmeten sich dem Hopfenhandel.<br />
Hopfenhandlungen Gütermann gab es in Bamberg, in<br />
Nürnberg und im nordböhmischen Saaz – kurz: an zentralen<br />
Hopfenumschlagplätzen. Auch die Textilproduzenten<br />
Michael Schnebel und Georg Lust 115 gingen<br />
nach Bamberg; sie gehörten hier zu den reichsten Juden<br />
116 . Lust wandte sich wie die Gütermann dem Hopfenhandel<br />
zu.<br />
Günter Dippold<br />
Hauptstraße 1<br />
1810 gehörte dieses Anwesen<br />
Jonas Hirsch (Cotta)<br />
und Salomon Hirch (Philo),<br />
heute <strong>ist</strong> hier der türkischislamische<br />
Kulturver<strong>ein</strong><br />
zuhause, der das Haus von<br />
den Erben der Schr<strong>ein</strong>erei<br />
Alberth ersteigert hatte<br />
161<br />
161
162 162<br />
162<br />
162 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Zum religiösen Leben<br />
in der jüdischen<br />
Gem<strong>ein</strong>de<br />
In der zweiten Jahrhunderthälfte bestimmten in <strong>Redwitz</strong> die jüdischen Korbhändler<br />
das Bild. Zu den bereits erwähnten Zinn und Pausan kam in den 40er<br />
Jahren der Kaufmann Salomon Gosser. 1867 zog ferner der aus Schwebheim<br />
stammende Emanuel Gutmann hier zu. Korbhändler war auch Theodor<br />
Greif, der mit der Familie Gosser verschwägert war und in den 70er Jahren<br />
hier lebte; später verzog er nach Nürnberg 117 .<br />
Die jüdischen Korbhändler waren sehr erfolgreich. So erhielt 1862 Samuel<br />
Zinn, der Sohn des Firmengründers Baruch, auf der Weltausstellung in London<br />
<strong>ein</strong>e Medaille, Salomon A. Gosser 1873 in Wien. Doch zwischen 1870<br />
und 1880 zogen die Familien Zinn und Pauson mit ihren Handelshäusern<br />
nach Lichtenfels. Gosser betrieb s<strong>ein</strong> Geschäft bis zu s<strong>ein</strong>em Tod 1879 in<br />
<strong>Redwitz</strong>; s<strong>ein</strong> Sohn Arnold jedoch war bereits seit 1867 als Korbhändler in<br />
Lichtenfels ansässig. In <strong>Redwitz</strong> blieb von den jüdischen Firmen nur Gutmann<br />
zurück.<br />
Die israelitische Gem<strong>ein</strong>de unterhielt <strong>ein</strong>en Kultusdiener, den Vorsänger.<br />
Neben s<strong>ein</strong>en Aufgaben im Gottesdienst fungierte der Vorsänger als Schächter.<br />
Das führte zu Konflikten mit den chr<strong>ist</strong>lichen Metzgern. Anfang des 18. Jahrhunderts<br />
beschwerten sich diese, daß sie das Dorff unmöglichen mit Fleisch<br />
stetig versehen und <strong>ein</strong>halten könnten, weiln die Juden mit ihren Schäch[t]en<br />
denenselben allzu grosen Inhalt machten, und [...] causirten, daß ihnen öffters<br />
das Fleisch stinkend würde. Was die Juden nicht äßen, würden sie – wohl<br />
billiger als die Metzger – an ihre chr<strong>ist</strong>lichen Nachbarn verkaufen. Der Gutsherr<br />
verbot daraufhin 1721 den Juden, alles Schächten und Fleischverkaufen.<br />
Damit aber die Juden zu koscherem Fleisch kamen, mussten die Metzger für<br />
sie die notwendige Menge schächten lassen 118 . Erst im frühen 19. Jahrhundert<br />
erlangten die <strong>Redwitz</strong>er Viehhändler das Recht, zu schächten und Fleisch<br />
zu verkaufen, woraufhin sie sogar begannen, damit zu hausieren 119 .<br />
Eine weitere kultische Aufgabe hatte der Beschneider; dieses Amt übte um<br />
1830 der Hausierer Aron Gosser (1759–1835) aus 120 . Ihm folgte der Korbmacher<br />
und -händler Baruch Zinn (1792–1858) 121 .<br />
Die Toten der Gem<strong>ein</strong>de begrub man auf dem Judenfriedhof bei Burgkunstadt,<br />
am Ebnether Berg 122 . Er war ursprünglich 46 Meter breit und 30 Meter<br />
lang; ab 1679 musste er immer wieder erweitert werden, denn nach jüdischen<br />
Ritus darf <strong>ein</strong>e Grabstelle k<strong>ein</strong> zweites Mal belegt werden. Verwaltet
wurde der Leichenacker durch <strong>ein</strong>en Beerdigungsver<strong>ein</strong>, dessen Vorsteher<br />
stellvertretend damit belehnt wurde, und zwar von der Stadt Burgkunstadt.<br />
Der erste bekannte Vorsteher war <strong>ein</strong> <strong>Redwitz</strong>er Jude namens Hirsch, der<br />
1687 starb; s<strong>ein</strong> Nachfolger war ebenfalls <strong>ein</strong> <strong>Redwitz</strong>er, Jakob Gerson 123 .<br />
Erwähnenswert <strong>ist</strong> die Bildung der <strong>Redwitz</strong>er Juden. Während viele Chr<strong>ist</strong>en,<br />
vor allem ärmere Leute, noch bis ins 19. Jahrhundert nicht oder kaum<br />
lesen und schreiben konnten, gab es unter den Juden fast k<strong>ein</strong>e Analphabeten.<br />
Das mag exemplarisch <strong>ein</strong> Protokoll aus dem Jahre 1827 verdeutlichen,<br />
das die Orginalunterschriften von 34 – also fast allen – jüdischen Familienvorständen<br />
trägt 124 : 26 unterzeichneten in Deutsch, wobei es in der Schriftqualität<br />
erhebliche Unterschiede gibt, sieben in hebräischer Kursive, und<br />
nur <strong>ein</strong>e Witwe war des Schreibens nicht mächtig; sie bestätigte den Beschluss<br />
nicht – wie chr<strong>ist</strong>liche Analphabeten – mit drei Kreuzen, sondern mit drei<br />
Kreisen. Wo und wie die <strong>Redwitz</strong>er Kinder jüdischen Glaubens aber ihre<br />
schulische Ausbildung erhielten, bleibt unklar. Reichere Juden beschäftigten<br />
wohl Hauslehrer; so <strong>ist</strong> 1812 Michel Küpßer aus Küps als Privatlehrer in<br />
<strong>Redwitz</strong> erwähnt 125 .<br />
Das Judenedikt von 1813 befasste sich ausführlich mit der Einsetzung von<br />
Rabbinern. Die Rabbiner waren bis dahin k<strong>ein</strong>e Ge<strong>ist</strong>lichen im chr<strong>ist</strong>lichen<br />
Sinn, sondern Gelehrte der Thora und des Talmud. Ihre Aufgabe bestand<br />
<strong>ein</strong>erseits im Lehren; daneben übten sie in vielen Territorien – auch im Hochstift<br />
Bamberg – die Zivilgerichtsbarkeit<br />
unter den Juden aus 126 . Die bischöflichen<br />
und die ritterschaftlichen Schutzjuden<br />
im Bereich des Hochstifts Bamberg<br />
bildeten seit dem 17. Jahrhundert<br />
<strong>ein</strong>e Korporation, die Landjudenschaft,<br />
die den Rabbiner wählte und besoldete<br />
127 ; ihm waren vier Unterrabbiner zur<br />
Seite gestellt, von denen <strong>ein</strong>er s<strong>ein</strong>en Sitz<br />
in Burgkunstadt hatte 128 .<br />
Durch das Judenedikt von 1813 nahm<br />
die bayerische Regierung den Rabbinern<br />
jegliche Richterfunktion, da sie<br />
Sondergerichte außerhalb der staatli-<br />
Günter Dippold<br />
Poststation ca. 1905<br />
Besitzer 1810 waren Samuel<br />
Hirsch und Salomon<br />
Baruch. Heute gehört das<br />
Haus der Familie Krötenheerdt<br />
163<br />
163
164 164<br />
164<br />
164 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
chen Zuständigkeit nicht duldete. Das Edikt bestimmte ferner, dass, wenn in<br />
<strong>ein</strong>em bestimmten Verwaltungsbezirk mindestens 50 jüdische Familien lebten,<br />
diese <strong>ein</strong>e Synagoge und <strong>ein</strong>en Rabbiner haben dürften. Außer dem Rabbiner<br />
oder s<strong>ein</strong>en vom Staat bestätigten Vertreter war k<strong>ein</strong>em anderen erlaubt,<br />
in der Synagoge kirchliche Verrichtungen aus[zu]üben.<br />
Für <strong>Redwitz</strong> stand das Edikt zehn Jahre lang nur auf dem Papier. Erst 1823<br />
ergriffen die staatlichen Stellen hier Maßnahmen, als man erfuhr, dass in<br />
<strong>Redwitz</strong> dem Edikt zuwider gehandelt würde, genauer: daß die Juden ihren<br />
Gottesdienst jetzt noch wie ehedem in der Synagoge ausüben, und daß dabei<br />
die Stelle des Religionslehrers <strong>ein</strong> unwissender, nicht <strong>ein</strong>mal der deutschen<br />
Sprache kundiger [...] Schaechter versiehet. Ein Rabbiner war nicht angestellt.<br />
Nun griff die Regierung des Obermainkreises durch: Die <strong>Redwitz</strong>er wurden<br />
angewiesen, binnen 2 Monaten <strong>ein</strong>en vorschriftsmäßig befähigten Rabbiner<br />
in Vorschlag zu bringen, sonst würde die Synagoge geschlossen. Anfang<br />
1824 machte die Regierung ihre Drohung wahr, nicht nur in <strong>Redwitz</strong>, sondern<br />
auch in Lichtenfels, in M<strong>ist</strong>elfeld und in Horb, also mit allen Synagogen<br />
im Landgericht Lichtenfels. Trotz vielfacher Bitten wurden sie nicht<br />
geöffnet, nicht <strong>ein</strong>mal zum Laubhüttenfest. Erst müsse <strong>ein</strong> Rabbiner <strong>ein</strong>gesetzt<br />
werden. Das stellte die Gem<strong>ein</strong>den vor Probleme, denn es war nicht<br />
damit getan, <strong>ein</strong>e geeignete Persönlichkeit vorzuschlagen; er musste von den<br />
Angehörigen des Rabbinats auch besoldet werden. So erklärten 1825 die<br />
Mitglieder der israelitischen Kultusgem<strong>ein</strong>den in den Landgerichten Lichtenfels<br />
und Kronach – ausgenommen vorerst die Kronacher Juden –, sich dem<br />
Rabbinat <strong>Redwitz</strong> anschließen zu wollen. Die Besoldung war gesichert. 129<br />
Es ging nun um die Besetzung der Rabbinerstelle. Verhandlungen hierüber<br />
nahmen die Gebrüder Gütermann, genauer: Samuel und Henoch sowie dessen<br />
Sohn Seligmann in die Hand. Sie versuchten, den Berliner Prediger Dr.<br />
Isaak Levi Auerbach, <strong>ein</strong>en prominenten Vertreter der jüdischen Reformbewegung,<br />
als Rabbiner zu gewinnen 130 .<br />
Die Reformer versuchten, vom Ge<strong>ist</strong> der Aufklärung beseelt, althergebrachte,<br />
aber rational nicht zu rechtfertigende Formen aus dem religiösen Leben<br />
zu beseitigen. Dadurch sollte auch die kulturelle Trennung von der Außenwelt<br />
beseitigt werden. In der Praxis sollte etwa die deutsche Sprache als<br />
Gebetssprache im Gottesdienst <strong>ein</strong>geführt werden.
Dr. Auerbach wurde im Juli 1826 von den Vertretern der Kultusgem<strong>ein</strong>den<br />
des Rabbinats tatsächlich gewählt, wenn auch mit knapper Mehrheit. Er lehnte<br />
die Wahl jedoch ab, da ihm die Gem<strong>ein</strong>den als zu un<strong>ein</strong>ig erschienen und das<br />
Gehalt nicht s<strong>ein</strong>en Vorstellungen entsprach.<br />
Nun schrieb man die Stelle in Zeitungen aus, auch in überregionalen Blättern;<br />
so sind die Annoncen im Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten<br />
erhalten. Fünf Bewerbungen gingen <strong>ein</strong>. Am qualifiziertesten<br />
erschien den Gem<strong>ein</strong>devertretern Moses Gutmann. Ihn wählten sie am 20.<br />
November 1826 <strong>ein</strong>stimmig zu ihrem Rabbiner, woraufhin ihn die Regierung<br />
des Obermainkreises am 20. April 1827 ernannte 131 .<br />
Gutmann war 1805 in Baiersdorf als Sohn <strong>ein</strong>es jüdischen Gelehrten geboren.<br />
Er hatte nicht nur, wie üblich, die Talmudschule in Fürth 132 besucht,<br />
sondern auch ab April 1824 fünf Semester an der Universität Erlangen Philosophie<br />
studiert 133 . Damit dürfte er der erste Rabbiner mit akademischer<br />
Bildung in Bayern gewesen s<strong>ein</strong> 134 . Obendr<strong>ein</strong> beherrschte er <strong>ein</strong>e Reihe<br />
toter und moderner Sprachen; er fertigte neben s<strong>ein</strong>er Amtstätigkeit <strong>ein</strong>e kommentierte<br />
Übersetzung des Flavius Josephus und der Apokryphen des Alten<br />
Testaments 135 . Als Sprachenlehrer verdiente er sich <strong>ein</strong> Zubrot zu s<strong>ein</strong>em<br />
magerem Rabbinergehalt. Nach s<strong>ein</strong>er Wahl absolvierte er die Anstellungsprüfung<br />
als Rabbiner bei der Regierung mit der Note sehr gut, fast vorzüglich.<br />
S<strong>ein</strong>er Obhut waren neben <strong>Redwitz</strong> die Kultusgem<strong>ein</strong>den in Lichtenfels,<br />
M<strong>ist</strong>elfeld, Horb, Oberlangenstadt, Küps, Friesen, Mitwitz und Kronach<br />
unterstellt.<br />
Gutmann war Reformer, ebenso wie s<strong>ein</strong>e Rabbiner-Kollegen Dr. Joseph<br />
Aub in Bayreuth, Samson Wolf Rosenfeld in Bamberg, Bär Levi Kunreuther<br />
in Burgebrach oder Leopold St<strong>ein</strong> in Burgkunstadt 136 . Er gehörte dem Ver<strong>ein</strong><br />
jüdischer Gelehrter an 137 und verfasste <strong>ein</strong>e Reihe von Aufsätzen und Gutachten<br />
zu Fragen der Reform 138 . Doch beschränkte er sich nicht auf die Theorie.<br />
So führte Gutmann schon bald nach s<strong>ein</strong>er Einsetzung deutsche Predigten<br />
<strong>ein</strong>. Der <strong>Redwitz</strong>er Patrimonialrichter lobte im Juni 1828, Gutmann habe<br />
an allen Sabbath- und Festtagen theils hier, theils in auswärtigen Synagogen<br />
[...] Predigten in deutscher Sprache gehalten, die in moralischer und<br />
religioeser Hinsicht vielen Beifall gefunden haben 139 . Er habe <strong>ein</strong>ige der<br />
unnöthigen, dem Zweck der Gottesverehrung gar nicht entsprechende<br />
Gebraeuche abgeschafft. Jeder erwachsene männliche Jude durfte der Ge-<br />
Günter Dippold<br />
165<br />
165
166 166<br />
166<br />
166 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
m<strong>ein</strong>de aus der Thora vortragen. Früher war das Recht, am jeweiligen Tag<br />
vorzulesen, in der Synagoge versteigert worden, vermutlich zugunsten karitativer<br />
Zwecke. Gutmann beseitigte diese Praxis; künftig trug jeder in festem<br />
Turnus vor 140 . Obendr<strong>ein</strong> begann Gutmann deutsche Gebete und Gesänge<br />
<strong>ein</strong>zuführen. Spätestens dadurch aber wurde die Frage nach dem Vorsänger<br />
wieder laut 141 . Denn der alte Vorsänger Israel Auriel, seit 1794 im Dienst<br />
der <strong>Redwitz</strong>er, war – so das Landgericht – des Lesens und Schreibens in<br />
deutscher Sprache unkundig. Er konnte deshalb am schriftlichen Teil der in<br />
Bayreuth abgehaltenen Vorsänger-Prüfung nicht teilnehmen und galt folglich<br />
als unqualifiziert. 1828 wurde er s<strong>ein</strong>es Amtes enthoben 142 .<br />
Deutsche Predigten und Gebete, die Absetzung des langjährigen Vorsängers<br />
– das spaltete die Gem<strong>ein</strong>de. Einige, die der Reform zugeneigt waren, freuten<br />
sich, hatten sie doch selbst die Amtsenthebung des alten Vorsängers gewünscht.<br />
Diese Gruppe wurde offenbar angeführt von Samuel und Henoch<br />
Gütermann, dessen Sohn Seligmann, Isaak Hallo, der mit <strong>ein</strong>er Gütermann<br />
verheiratet war, s<strong>ein</strong>em Bruder Wolf Hallo und dem Korbmacherme<strong>ist</strong>er<br />
Baruch Zinn.<br />
Ihnen stand <strong>ein</strong>e Reihe vor allem älterer Juden gegenüber, die am Überkommenen<br />
festhalten wollten. Zu ihnen gehörten der älteste Gütermann-<br />
Bruder, Wolf, der Beschneider Aron Gosser, der reiche Viehhändler Bonum<br />
Lust, der Strumpfwirker Marx Wald und s<strong>ein</strong>e Brüder. Baruch Zinn und<br />
Henoch Gütermann beklagten sich bei der Regierung bitter über diese Gem<strong>ein</strong>demitglieder:<br />
Sie versuchten, andere theils durch abergläubische und<br />
schwärmerische Alberheit, theils aber auch durch Bosheit vom Guten abzulenken<br />
[...], damit so Alles nach ihrem alten Schlendrian und ihrer Hyperorthodoxie<br />
beybehalten und fortgeführt werde. [...] Ja, so scheuen und verbannen<br />
sie jeden Sinn für’s Bessere, daß sie nicht <strong>ein</strong>mal zum Gottesdienste<br />
kommen, wenn vom Rabbiner Vorträge in deutscher Sprache gehalten werden,<br />
die doch von jedem andern Zuhöhrer, sey er, wer er wolle, mit vielem<br />
Beyfalle aufgenommen werden. Daher gingen sie auch an unserm Neujahrsfest,<br />
Bustage und Laubhüttenfeste in die Synagoge zu Horb und Oberlangenstadt,<br />
wo sie nur ungestört schreyen und kräuschen konnten, während in der<br />
hiesigen Synagoge Ordnung herrschte und sechs Predigten in deutscher Sprache<br />
gehalten wurden. 143<br />
Immer wieder brachen die Konflikte auf: 1829 beschwerte sich Gutmann,
dass <strong>ein</strong>ige Juden ohne s<strong>ein</strong>e Erlaubnis <strong>ein</strong>en Privatgottesdienst in der Synagoge<br />
gefeiert hatten. Darüber vernommen, bestätigte der abgesetzte Vorsänger<br />
– aus s<strong>ein</strong>er Sicht – die Spaltung der Gem<strong>ein</strong>de: Die <strong>Redwitz</strong>er Juden<br />
sind tolle Köpfe, es besuchen mehrere von ihnen, seitdem ich nicht mehr<br />
vorbeten darf, den Gottesdienst gar nicht. 144<br />
1828 sollte in <strong>Redwitz</strong> <strong>ein</strong> eigener Judenfriedhof angelegt werden, sehr zum<br />
Gefallen der reformfreundlichen Juden. Ein passendes Grundstück war bald<br />
gekauft. Doch die Orthodoxen hingen am Burgkunstadter Friedhof, wo ihre<br />
Eltern und Vorfahren begraben lagen, und brachten die Gem<strong>ein</strong>de gegen den<br />
Plan auf: Dieß mache <strong>ein</strong>en so starken Kostenaufwand, daß sie am Ende ihre<br />
Häuser noch verkaufen müssen 145 . Die Sache verschleppte sich, und schließlich<br />
blieb alles beim Alten. 1834 erklärten die Gem<strong>ein</strong>demitglieder, k<strong>ein</strong>en<br />
neuen Leichenhof dahier zu errichten 146 .<br />
Sogar über den Leichentransport nach Burgkunstadt gab es Streit. Gutmann<br />
bestimmte, <strong>ein</strong> Leichenwagen oder <strong>ein</strong>e -bahre sei anzuschaffen und der<br />
Leichenzug habe sich ordentlich in Zweierreihe zu formieren. Die Orthodoxen<br />
dagegen erklärten nach den Worten des Rabiners, daß sie weder von der<br />
Anschaffung <strong>ein</strong>es Leichenwagens noch von <strong>ein</strong>er anständigen Todtenbahre<br />
etwas wißen wollten, sondern daß sie ihre Todten wie bisher [...] auf Stangen<br />
fortschleppen und dabey weder <strong>ein</strong>en anständigen Anzug noch <strong>ein</strong>en geordneten<br />
Gang beobachten würden; kurz: es solle Alles beym Alten bleiben 147 .<br />
In den 30er Jahren sch<strong>ein</strong>en sich die Parteien <strong>ein</strong>igermaßen auf<strong>ein</strong>ander zu<br />
bewegt zu haben. Der 1828 abgesetzte Vorsänger Isaak Auriel durfte s<strong>ein</strong><br />
Amt wieder ausüben, wohl ohne dass die Behörden etwas davon wussten.<br />
Nach s<strong>ein</strong>em Tod im Jahr 1840 versah der D<strong>ist</strong>riktsrabbiner das Vorbeteramt;<br />
zur Aushülfe dient <strong>ein</strong> dazu geeignetes unbescholtenes Gem<strong>ein</strong>deglied 148 .<br />
Erst nach Einrichtung <strong>ein</strong>er jüdischen Schule im Herbst 1856 fungierte der<br />
jeweilige Lehrer 149 als Vorsänger: von 1856 bis 1857 Eisenmann Frank aus<br />
Schondra, von 1858 bis 1861 Phineas Seligsberger aus Fuchsstadt, von 1863<br />
bis 1869 Simon Dachauer, zuvor Lehrer in Heiligenstadt, von 1869 bis 1875<br />
Benjamin Freudenthal, zuvor in Neuhaus, von 1875 bis 1879 schließlich<br />
Jonas Nordhäuser (1848–1907) aus Wüstensachsen a. d. Rhön.<br />
Nachdem den Lehrern lange untersagt gewesen war, die Funktion <strong>ein</strong>es<br />
Schächters auszuüben, galt dies in den 1870er Jahren wieder als zulässig. So<br />
schlachtete der <strong>Redwitz</strong>er Lehrer Freudenthal in Oberlangenstadt, wo er seit<br />
Günter Dippold<br />
167<br />
167
168 168<br />
168<br />
168 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
1871 Religionsunterricht erteilte, Vieh auf die vorgeschriebene Weise. Die<br />
Gem<strong>ein</strong>de <strong>Redwitz</strong> dagegen besoldete <strong>ein</strong>en gesonderten Schächter 150 . Dabei<br />
handelte es sich wohl um den 1878 als Metzger genannten Viehhändler<br />
Hermann Pictor (1840–1903) 151 .<br />
Erwähnenswert <strong>ist</strong> aus diesen Jahren auch die Einrichtung <strong>ein</strong>es rituellen<br />
Tauchbads, <strong>ein</strong>er Mikwe, 1830. Die Regierung, um die Volksgesundheit besorgt,<br />
ordnete an, alle Quellenbäder sollten erwärmbar s<strong>ein</strong>. Daraufhin baute<br />
man <strong>ein</strong> neues Bad – wo sich das alte befand, <strong>ist</strong> unbekannt – im Erdgeschoss<br />
des Vorsängerhauses 152 .<br />
Über das Verhältnis von Chr<strong>ist</strong>en und Juden in dieser Zeit liegen die unterschiedlichsten<br />
Äußerungen vor. 1832 beschwerten sich die chr<strong>ist</strong>lichen<br />
<strong>Redwitz</strong>er über die Störung der Sonntagsruhe durch die Juden. Der Patrimonialrichter<br />
beklagte, dass bei <strong>ein</strong>em großen Teil der ärmeren chr<strong>ist</strong>lichen<br />
Bevölkerung noch grundlose Vorurteile herrschten, wie etwa das, es<br />
sei Juden von ihrem Religionsgesetz her erlaubt, Nicht-Juden zu betrügen<br />
153 .<br />
Es gab aber auch Zeichen wachsender Toleranz. So <strong>ist</strong> anzunehmen, dass<br />
der evangelische Pfarrer Wolfahrt von Obr<strong>ist</strong>feld <strong>ein</strong>ige Male die Synagoge<br />
besuchte 154 . Als sich 1845 der Verweser der Pfarrei Küps darüber erregte,<br />
dass Gutmann in Oberlangenstadt <strong>ein</strong>e Leichenrede auf offener Straße<br />
vor dem Haus <strong>ein</strong>es Verstorbenen gehalten habe, rechtfertigte sich der Rabbiner<br />
gegenüber dem Landgericht Lichtenfels wie folgt: Ich bin bereits 18<br />
Jahre Rabbiner in <strong>Redwitz</strong>, und habe seitdem hier alle Trauerreden vor<br />
den Häusern der Verstorbenen gehalten [...]. Daß auch Chr<strong>ist</strong>en diese Leichenreden<br />
mit anhören, das wird doch wohl nichts Anstößiges haben. Es<br />
kommen nicht selten auch Chr<strong>ist</strong>en in die Synagoge, um dort die Predigt<br />
mit anzuhören, so wie auch Juden zuweilen in die Kirche gehen, um die<br />
Predigt des Pfarrers zu hören. Dieß möchte sogar die gute Folge haben,<br />
daß dadurch beide Religionspartheien Gelegenheit finden, sich zu überzeugen,<br />
daß in der Synagoge wie in der Kirche <strong>ein</strong>e r<strong>ein</strong>e Moral und ächte<br />
Humanität gelehrt werden, wodurch die gegenseitige Abneigung, welche<br />
hie und da noch besteht, verdrängt und die finstere Intoleranz verscheut<br />
werden können und müßen. 155<br />
Am 1. Februar 1862 verstarb D<strong>ist</strong>riksrabbiner Moses Gutmann im 57. Lebens-<br />
und 35. Dienstjahr. Auf dem Burgkunstadter Friedhof wurde er bei-
gesetzt. Der Nachruf in der ALLGEMEINEN ZEITUNG DES JUDENTUMS endet mit<br />
den Worten: So <strong>ist</strong> <strong>ein</strong> seltener Mann von uns geschieden, dessen Name die<br />
Geschichte des Judenthums mit Verehrung nennen wird. 156 Im LICHTENFELSER<br />
WOCHENBLATT wurde Gutmanns Tod mit k<strong>ein</strong>er Silbe erwähnt.<br />
Die Stelle des <strong>Redwitz</strong>er D<strong>ist</strong>riktsrabbiners wurde nicht mehr besetzt, da die<br />
Gem<strong>ein</strong>den stark geschrumpft waren. Deshalb ver<strong>ein</strong>igte man das Rabbinat<br />
<strong>Redwitz</strong> mit dem Rabbinat Burgkunstadt.<br />
Immer kl<strong>ein</strong>er wurden die Landgem<strong>ein</strong>den. Der Verfall des Gem<strong>ein</strong>delebens<br />
war die Folge: Die jüdische Schule von <strong>Redwitz</strong>, erst 1856 eröffnet, wurde<br />
um die Jahreswende 1861/62 aufgelöst; die Eltern wollten ihre Kinder fortan<br />
in die katholische Schule schicken. Doch weil Anfang 1862 Rabbiner Gutmann<br />
starb und s<strong>ein</strong>e Stelle nicht wieder besetzt wurde, <strong>ein</strong> Rabbiner als<br />
Religionslehrer also nicht mehr zur Verfügung stand, wurde die Schule wiedergegründet.<br />
Endgültig beantragte die Kultusgem<strong>ein</strong>de ihre Schließung 1879,<br />
als Lehrer Nordhäuser nach Altenkunstadt versetzt worden war. Im Vorjahr<br />
hatten fünf Kinder die Schule besucht: zwei aus <strong>Redwitz</strong>, drei aus Hochstadt,<br />
unter letzteren <strong>ein</strong> Chr<strong>ist</strong> als Volontair. 1879 wurde das <strong>ein</strong>zige schulpflichtige<br />
Kind jüdischen Glaubens in <strong>Redwitz</strong> der katholischen Schule zugewiesen.<br />
157<br />
Ende 1884 verkaufte die israelitische Kultusgem<strong>ein</strong>de ihr Schulhaus und<br />
das ehemalige Vorsängerhaus. Nur die Synagoge blieb vorerst in Gem<strong>ein</strong>debesitz<br />
158 .<br />
Im Januar 1863 wurden die Juden zu Horb am Main der Kultusgem<strong>ein</strong>de<br />
<strong>Redwitz</strong> <strong>ein</strong>verleibt 159 ; die vor 1870 von Horb nach Hochstadt verzogene<br />
Familie des Kaufmanns Abraham Reuter (1827–1904) 160 zählte ebenfalls<br />
zur <strong>Redwitz</strong>er Gem<strong>ein</strong>de. Umgekehrt aber wiesen die <strong>Redwitz</strong>er Juden<br />
1910 die behördlicherseits erhobene Forderung zurück, sie sollten sich<br />
<strong>ein</strong>er anderen Kultusgem<strong>ein</strong>de anschließen. In <strong>Redwitz</strong>, Horb und Hochstadt<br />
lebten damals insgesamt 18 Juden. Darunter waren nur sechs Männer<br />
über 13 Jahre; zum Gottesdienst aber waren zehn vonnöten. Es <strong>ist</strong><br />
demnach k<strong>ein</strong> Wunder, dass die Regierung von <strong>Oberfranken</strong> feststellte:<br />
In der Synagoge in <strong>Redwitz</strong> wird seit mehreren Jahren k<strong>ein</strong> Gottesdienst<br />
mehr abgehalten. Ein Ritualbad <strong>ist</strong> nicht vorhanden, ebensowenig <strong>ein</strong>e<br />
Religionsschule. Die 5 vorhandenen Schulkinder erhalten den Religions-<br />
Günter Dippold<br />
Das Ende der jüdischen<br />
Gem<strong>ein</strong>de<br />
<strong>Redwitz</strong><br />
169<br />
169
170 170<br />
170<br />
170 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Am Markt 5<br />
1810 Anwesen von Jacob<br />
Moses, heute Gutmann;<br />
bis vor wenigen Jahren<br />
Verwaltung der Firma<br />
Gutmann<br />
unterricht in Oberlangenstadt durch den Religionslehrer Wetzler von<br />
Kronach. Aber die Kultusgem<strong>ein</strong>de blieb auf ihren ausdrücklichen Wunsch<br />
hin selbständig; sie wollte sich weder Oberlangenstadt noch Burgkunstadt<br />
anschließen 161 .<br />
Erst nach dem Ersten Weltkrieg kam das Aus für die israelitische Kultusgem<strong>ein</strong>de<br />
<strong>Redwitz</strong>. Die Regierung von <strong>Oberfranken</strong> genehmigte am 13. August<br />
1921 die Ver<strong>ein</strong>igung mit der Kultusgem<strong>ein</strong>de Burgkunstadt. Damals<br />
gehörten zur Gem<strong>ein</strong>de <strong>Redwitz</strong>: die drei ledigen Geschw<strong>ist</strong>er Reuter in<br />
Hochstadt, Clotilde Gebhard in Marktzeuln 162 , Fanny Kuh in <strong>Redwitz</strong>, die<br />
später zu ihrer Tochter nach Nürnberg verzog 163 , sowie die Korbhändlerswitwe<br />
Karolina Gutmann und deren Kinder, ebenfalls in <strong>Redwitz</strong>.<br />
Das letzte Kind aus <strong>ein</strong>er jüdischen Familie, das in <strong>Redwitz</strong> zur Welt kam,<br />
war wohl die am 8. Juli 1924 geborene Edith Gutmann, deren Eltern – der<br />
Korbhändler Siegfried Gutmann (geb. 1893) und s<strong>ein</strong>e aus Hessen stammende<br />
Ehefrau Ida Goldschmidt (geb. 1895) – mit ihr 1932 nach Lichtenfels<br />
zogen und 1937 in die USA auswanderten 164 .<br />
1925 waren in <strong>Redwitz</strong> noch zehn Juden ansässig 165 . Die seit langem unbenutzte<br />
Synagoge verkaufte<br />
man 1927 an den Büttner<br />
Friedmann, der sich<br />
darin s<strong>ein</strong>e Werkstatt <strong>ein</strong>richten<br />
wollte 166 .<br />
1933 lebte in <strong>Redwitz</strong> nur<br />
noch <strong>ein</strong> <strong>ein</strong>ziger Jude: der<br />
mit <strong>ein</strong>er Chr<strong>ist</strong>in verheiratete<br />
Korbhändler Ludwig<br />
Gutmann (geb. 1891).<br />
Er starb am 2. August<br />
1936 im Krankenhaus zu<br />
Hochstadt. Mit s<strong>ein</strong>em<br />
Tod endet die jahrhundertelange<br />
Geschichte der<br />
<strong>Redwitz</strong>er Juden.<br />
Auch wenn in <strong>Redwitz</strong><br />
wohnhafte Juden dem
Morden der Nationalsozial<strong>ist</strong>en nicht zum Opfer fielen, so waren doch unter<br />
den Nürnberger Opfern fünf gebürtige <strong>Redwitz</strong>er 167 :<br />
Martin Fleischmann (geb. 1895) 168 , 1937 nach Dachau deportiert,<br />
gestorben 1941 in Cholm bei Lublin<br />
Max Hopfmann (geb. 1868) 169 , 1942 nach Theresienstadt deportiert,<br />
1945 für tot erklärt<br />
Ida Kuh verh. Blüml<strong>ein</strong> (geb. 1891) 170 , 1942 nach Theresienstadt<br />
deportiert, verschollen in Auschwitz<br />
Frieda Kuh verh. Fichtelberger (geb. 1895), 1941 nach Riga-<br />
Jungfernhof deportiert, 1945 für tot erklärt<br />
Emma Midas verh. Gerngroß (geb. 1862) 171 , 1942 nach Theresienstadt<br />
deportiert, verschollen in Minsk<br />
*<br />
Die sichtbaren Spuren der Juden in <strong>Redwitz</strong> sind bescheiden. Einen Friedhof<br />
gab es nie; Synagoge, Vorsängerhaus, Ritualbad sind verschwunden. Nicht<br />
<strong>ein</strong>mal <strong>ein</strong> Straßenname zeugt von den bedeutenden jüdischen Familien: Es<br />
gibt k<strong>ein</strong>e Moses-Gutmann-Straße, k<strong>ein</strong>e Gütermann-Straße, k<strong>ein</strong>e Zinn- und<br />
k<strong>ein</strong>e Pauson-Straße. Die <strong>Redwitz</strong>er Juden hätten <strong>ein</strong> solches Andenken verdient.<br />
Günter Dippold<br />
171<br />
171
172 172<br />
172<br />
172 KAPITEL 5<br />
Eine jüdische Gem<strong>ein</strong>de im ritterschaftlichen Dorf<br />
Gasthof von Johann Eckert<br />
„Weißes Lamm“ ca. 1925<br />
Hauptstraße 36<br />
Anwesen Krötenheerdt mit<br />
Poststation und Kolonialwarengeschäft<br />
1912


![Redwitz ist ein reines adeliches [...] Filial ... - Bezirk Oberfranken](https://img.yumpu.com/2076434/1/500x640/redwitz-ist-ein-reines-adeliches-filial-bezirk-oberfranken.jpg)