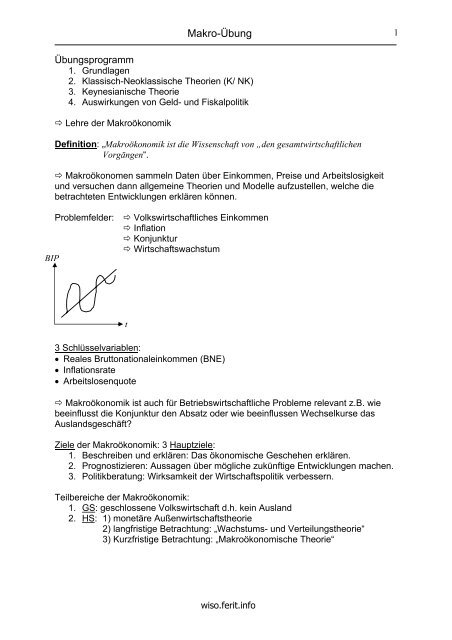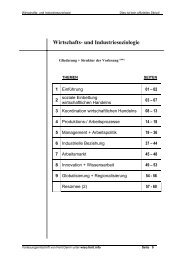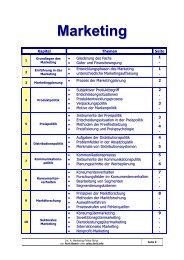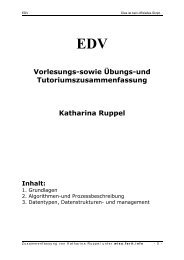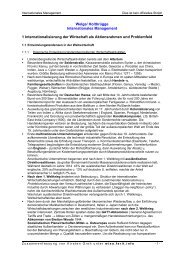Makro-Übung
Makro-Übung
Makro-Übung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
<strong>Übung</strong>sprogramm<br />
1. Grundlagen<br />
2. Klassisch-Neoklassische Theorien (K/ NK)<br />
3. Keynesianische Theorie<br />
4. Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik<br />
Lehre der <strong>Makro</strong>ökonomik<br />
Definition: „<strong>Makro</strong>ökonomik ist die Wissenschaft von „den gesamtwirtschaftlichen<br />
Vorgängen“.<br />
<strong>Makro</strong>ökonomen sammeln Daten über Einkommen, Preise und Arbeitslosigkeit<br />
und versuchen dann allgemeine Theorien und Modelle aufzustellen, welche die<br />
betrachteten Entwicklungen erklären können.<br />
Problemfelder: Volkswirtschaftliches Einkommen<br />
Inflation<br />
Konjunktur<br />
Wirtschaftswachstum<br />
BIP<br />
t<br />
3 Schlüsselvariablen:<br />
• Reales Bruttonationaleinkommen (BNE)<br />
• Inflationsrate<br />
• Arbeitslosenquote<br />
<strong>Makro</strong>ökonomik ist auch für Betriebswirtschaftliche Probleme relevant z.B. wie<br />
beeinflusst die Konjunktur den Absatz oder wie beeinflussen Wechselkurse das<br />
Auslandsgeschäft?<br />
Ziele der <strong>Makro</strong>ökonomik: 3 Hauptziele:<br />
1. Beschreiben und erklären: Das ökonomische Geschehen erklären.<br />
2. Prognostizieren: Aussagen über mögliche zukünftige Entwicklungen machen.<br />
3. Politikberatung: Wirksamkeit der Wirtschaftspolitik verbessern.<br />
Teilbereiche der <strong>Makro</strong>ökonomik:<br />
1. GS: geschlossene Volkswirtschaft d.h. kein Ausland<br />
2. HS: 1) monetäre Außenwirtschaftstheorie<br />
2) langfristige Betrachtung: „Wachstums- und Verteilungstheorie“<br />
3) Kurzfristige Betrachtung: „<strong>Makro</strong>ökonomische Theorie“<br />
1
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Abgrenzung zwischen Mikro- und <strong>Makro</strong>ökonomie:<br />
Mikro: Ausgangspunkt ist das einzelne Wirtschaftssubjekt<br />
→ basiert auf dem ökonomischen Prinzip, d.h. Konsumenten und . .<br />
Produzenten verhalten sich als optimaler<br />
→ Nutzen- bzw. Gewinnmaximierung<br />
Problemkreis: Allokation, d.h. Verteilung knapper Ressourcen<br />
<strong>Makro</strong>: betrachtet nicht das einzelne Wirtschaftssubjekt, sondern „Aggregate“,<br />
d.h. alle Haushalte (HH) und alle Unternehmen zusammen<br />
→ HH-Sektor / Unternehmenssektor<br />
Problemkreis: Konjunktur, Beschäftigung, Wachstum<br />
2
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
VGR: makroökonomische, periodenbezogene, buchhalterische und zahlenmäßige<br />
ex post-Darstellung des Einkommensverlaufs.<br />
Aufgabe 1 (VGR)<br />
a) Nennen Sie die beiden Größen, die das Bruttonationaleinkommen (BNE)<br />
beschreibt. Wie kann das BNE zwei Größen gleichzeitig beschreiben?<br />
Haushalte HH Unternehmen U<br />
Ein Produkt: Brot<br />
Produktionsfaktor: Arbeit Strom: Größe im Zeitverlauf<br />
Bestand: Größe im Zeitpunkt<br />
HH<br />
Löhne/Gewinne<br />
Arbeit<br />
Brot<br />
Ausgaben<br />
• Vermögen HH vs. Einkommen /Ausgaben → Stromgröße<br />
Haushaltsdefizit vs. Staatsschulden<br />
Stromgröße Bestandsgröße<br />
BNE: Gesamtheit der Einkommen, Summe der Ausgaben<br />
U<br />
3
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Welche alternativen Einkommenskonzepte zum BNE kennen Sie und welche<br />
Bedeutung haben diese für die makroökonomische Analyse<br />
BNE: Summe der volkswirtschaftlichen Endprodukte<br />
Summe der wertschöpfenden Prozesse einer Gesamtwirtschaft<br />
Vier Merkmale:<br />
• Brutto vs. Netto → Y N = Y B – D<br />
• Inlandsprodukt [innerhalb der Ländergrenzen] vs. Nationalprodukt [von<br />
einer Volkswirtschaft, z.B. Transrapid in China]<br />
• Nominalprodukt vs. Realprodukt<br />
Realprodukt:<br />
Nominalprodukt wenn steigt, keine Aussage über Mengen oder Preisänderung<br />
Preisindex<br />
steigt wegen Mengenänderung / konstante Preise<br />
indirekte Steuern<br />
• Faktorpreise vs. Marktpreise<br />
Einkommen zu Marktpreisen = Einkommen zu Faktorpreisen + Tind . – Subventionen<br />
Nettonationaleinkommen zu Faktorpreisen: „Volkseinkommen“<br />
Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen: BNEM<br />
BNEM – Abschreibungen(D) = NNEM – Tind . + Subventionen = NNEF = Volkseinkommen<br />
Oder:<br />
BNE<br />
% Abschreibungen(<br />
D)<br />
NNEM<br />
% Tind.<br />
+ Subventionen<br />
NNE = Volkeinkommen(<br />
V.<br />
E.)<br />
F<br />
M<br />
zu Faktorpreisen<br />
4
Aufgabe 2 (VGR)<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
a) Erläutern sie, wie das volkswirtschaftliche Einkommen von der<br />
Entstehungsseite, der Verwendungsseite und der Verteilungsseite berechnet<br />
werden kann.<br />
Entstehungsseite (Konzentration auf Produktion)<br />
∑ der Produktionswerte aller Sektoren<br />
Bruttoproduktionswert(BPW)= ∑der jährlichen Umsätze-Lagenrbestandsänderungen<br />
Nettoproduktionswert(NPW)= BPW – Vorleistungen<br />
Verteilungsseite<br />
setzt sich zusammen aus: Konsum<br />
Investitionen<br />
Staatsaugaben<br />
Außenbeitrag (Exp.-Imp.)<br />
Y:= C+I+G+(Exp.-Imp.) → Definition: Y= BNE<br />
Verteilungsseite<br />
beruht auf der personellen Gliederung<br />
Definition: E + E = VE<br />
NNEF = uns U / Vermögen<br />
Euns Lohnquote =<br />
VE<br />
M<br />
5
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Es sei angenommen, dass Inlandsprodukt und Nationaleinkommen identisch<br />
sind. Gegeben sind folgende Größen:<br />
Subventionen 70<br />
Direkte Steuern und Sozialabgaben 1200<br />
Bruttoanlageinvestitionen 850<br />
Exporte 1320<br />
Arbeitnehmerentgelt 2120<br />
Importe 1310<br />
Staatsverbrauch 750<br />
Transferzahlungen 750<br />
Abschreibungen 590<br />
Konsumausgaben 3000<br />
Indirekte Steuern und Abgaben 480<br />
Vorratsveränderungen 50<br />
Berechnen Sie die private Ersparnis und das Unternehmens- und<br />
Vermögenseinkommen.<br />
Annahme: BIP= BSP<br />
⇒ exakt: BIP= BSP:„Saldo Erwerbs- und Vermögenseinkommen zwischen Inund<br />
Auszahlungen“<br />
⇒ Ausgaben: Mrd. Euro<br />
Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher VBR:<br />
⇒ USA: Y=C+I+G+(Ex.-Im)<br />
⇒ BDR: Y= + C + I + I + ( Ex.<br />
− Im.)<br />
CStaat priv.<br />
Staat priv<br />
Ziel: Berechnung von Ersparnis ( S pr )<br />
<br />
S = E − C<br />
pr.<br />
verfüg.<br />
pr.<br />
1.Schritt: Berechnung des BNE über die Verwendungsweise:<br />
BNEM<br />
= Konsumausgaben +(Bruttoanlage+ Vorratsveränderungen )+( Exporte - Importe )<br />
BNE =3000+(850+50)+(1320-1310)=3910 Mrd. Euro<br />
M<br />
2.Schritt: Berechnung des VE ( NNEF<br />
):<br />
NNEF NNE<br />
BNEM<br />
VE ( )= - Abschreibungen- indirekte Steuern und Abgaben+ Subventionen<br />
VE ( F )=3910-590-480+70=2910 Mrd. Euro<br />
3.Schritt: Berechnung des verfügbaren Einkommens ( E ):<br />
verfüg.<br />
E verfüg.<br />
= VE –Anteil des Staates- direkte Steuern und Sozialabgaben + Transferzahlungen<br />
E verfüg.<br />
=2910-0-1200+750=2460 Mrd. Euro<br />
S = E − C<br />
pr.<br />
verfüg.<br />
pr.<br />
S pr.<br />
=2460-(3000-750)=2460-2250=210 Mrd. Euro<br />
Berechnung des Unternehmens- und Vermögenseinkommens:<br />
VE = E uns + EU<br />
/ Vermögen ⇒ E U / Vermögen = VE - Euns( →Arbeitsnehmerentgelt)<br />
=2910-2120=790 Mrd. Euro<br />
E U /<br />
Vermögen<br />
6
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 4(Modelle)<br />
a) Die Bäcker einer Stadt stellen seit einiger Zeit fest, dass sie weniger Brot als<br />
zuvor verkaufen können. Woran könnte das liegen?<br />
• „Modelle sind vereinfachte Theorien und zeigen die wesentlichen<br />
Beziehungen zwischen ökonomischen Variablen. Die exogenen<br />
Variablen sind diejenigen Größen, die außerhalb des Modells bestimmt<br />
werden. Die endogenen Variablen werden durch das Modell erklärt. Das<br />
Modell zeigt, wie sich die Veränderungen einer exogenen Variablen auf<br />
alle exogenen Variablen auswirken.“ (Makrw., <strong>Makro</strong>ökonomik, S.8)<br />
• exogene Variablen vs. endogene Variable<br />
exogene Variablen endogene Variable<br />
von außen gegebene Werte/<br />
Variablen<br />
im Modell nicht veränderbar<br />
Änderungen nur von außen möglich<br />
im Modell beeinflussbar und<br />
werden dort bestimmt<br />
• Gleichgewicht<br />
(nur methodisch): Zeitlicher Zustand mit Beharrungsvermögen.<br />
→ im Laufe der Zeit wird sich GG-Zustand nicht verändern,<br />
wenn exogene V. nicht verändert werden.<br />
• Stabilitäten<br />
stabil indifferent instabil<br />
bei Störung kehrt<br />
das System zum<br />
GG alleine zurück<br />
<br />
altes GG wird nicht<br />
von alleine erreicht<br />
• Statik, komparative Statik, Dynamik<br />
Störung bewirkt<br />
weitere Entfernung<br />
vom GG<br />
Statik kompar. Statik Dynamik<br />
Zeit als Konstante Zeit als Parameter Zeit als Variable<br />
• ex-ante vs. ex-post<br />
<br />
2<br />
N 1<br />
!<br />
N 0<br />
N<br />
2<br />
0<br />
<br />
7
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Beobachtung : NF ↓<br />
- Warum? →Veränderung exogener Größen (Einkommen, Preis<br />
für Substitut ( Müsli) oder Kompliment. .<br />
• Ziel: Aufstellung eines Modells zur Erklärung.<br />
geplante NF-Funktion:<br />
geplante AN-Funktion:<br />
GG - Bedingung:<br />
p<br />
p<br />
p<br />
∗<br />
0<br />
∗<br />
1<br />
ÜA<br />
•<br />
•<br />
s<br />
Q<br />
Q<br />
Q<br />
d<br />
s<br />
d<br />
= Q ( PBrot<br />
, PMüsli<br />
, PWurst<br />
)<br />
s<br />
= Q ( PBrot<br />
, PMehl<br />
)<br />
s d<br />
Q = Q<br />
Anpassungsprozess (Dynamik):<br />
Veränderung von exogenen Variablen (Lageparameter)<br />
→ Parameterverschiebung betreffender Kurve<br />
→ Veränderungen von endogenen Variablen<br />
→ Bewegung auf der Kurve<br />
b)Wegen einer schlechten Ernte ist der Mehlpreis gestiegen. Welche<br />
Auswirkungen könnte das auf den Brotpreis haben?<br />
• Mehl ist Produktionsinput Kostensteigerung ( pMehl ↑ )<br />
Rückgang des Angebots zu jeden Preis<br />
exogene Veränderung eines Parameters verschiebt<br />
die Angebotskurve<br />
p<br />
p<br />
p<br />
∗<br />
1<br />
∗<br />
0<br />
∗<br />
Q1<br />
• • •<br />
ÜNF<br />
∗<br />
Q0<br />
•<br />
∗<br />
Q 0<br />
∗<br />
Q 1<br />
s<br />
Q1 d<br />
Q1 s<br />
Q0 Q d<br />
0<br />
Q<br />
d<br />
Q<br />
Q<br />
∗<br />
1<br />
+<br />
−<br />
−<br />
+<br />
d<br />
1<br />
−<br />
p ↓ , mit Q bewegt man sich aus GG<br />
∗ ∗ ∗<br />
Kompr. Statik: Q Q , p ↑ p , d.h.<br />
0<br />
↓ 1<br />
Preiserhöhung ist zu erwarten →<br />
Rückgang der verkauften Menge<br />
Dynamik erklären:<br />
∗<br />
→ ÜNF bei p ; NFer unterbieten sich<br />
⇒ p<br />
↑ ; aufgrund der steigenden Preise<br />
⇒ höheres Angebot<br />
0<br />
0<br />
∗<br />
1<br />
8
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 5 (Wirtschaftsubjekte und Märkte)<br />
a) Nennen Sie die Wirtschaftsubjekte in der makroökonomischen Analyse und<br />
die ihnen zugeordneten Aktivitäten.<br />
Unternehmen: produzieren Güter<br />
o fragen Arbeitskräfte nach<br />
o investieren<br />
Haushalte: konsumieren Güter<br />
o bieten Arbeitskräfte an<br />
o bilden Ersparnisse<br />
Staat: konsumiert und investiert (fragt Güter nach)<br />
o erhebt direkte Steuern<br />
o nimmt Kredite auf<br />
b) Beschreiben Sie die in <strong>Makro</strong>ökonomik betrachteten Märkte.<br />
d<br />
Arbeitsmarkt: Geplante Arbeitsnachfrage N trifft auf das geplante Arbeitsangebot<br />
→ Nominallohn w als Geldpreis der Arbeit N<br />
s<br />
Gütermarkt: Geplantes GüterangebotY<br />
trifft auf die geplante Güternachfrage d<br />
Y<br />
→ Preisniveau p als Geldpreis von Y<br />
Kapitalmarkt: Geplante Ersparnis S trifft auf geplante Kapitalnachfrage I<br />
→ Zins i Handel von Wertpapieren<br />
Kein Geld<br />
Geldmarkt: Untersuchung von Geldangebot / -Nachfrage<br />
s<br />
N<br />
9
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 6 (Klassisch-Neoklassischer Arbeitsmarkt)<br />
a) Leiten Sie die Nachfrage nach Arbeit unter der Annahme des<br />
Gewinnmaximierungskalküls bei vollständiger Konkurrenz her.<br />
1.Produktionsfunktion:<br />
• U. produzieren das Gut Y (homogene Produktion)<br />
Y wird in Gütereinheiten gemessen, d.h. Y ist eine reale Größe Input<br />
Faktoren Arbeit N und Kapital K.<br />
Kapital:= alle reproduzierbaren Güter, die zur Produktion anderer<br />
Güter dienen.<br />
in der makroökonomischen Abstraktion: Kapital ist ein homogenes<br />
Gut, das mit dem produzierten Gut Y identisch ist.<br />
• Aggregierte Produktionsfunktion: Y= F(N, K)<br />
Zusammenhang zwischen Faktoreinsatz und Ausbringungsmenge<br />
• Annahme: Y=F(N, K ), d. h. das Kapital ist konstant ⇒ Y=F(N)<br />
so gesehen betrachten wir eine partielle Faktorvariation!<br />
neoklassische Produktionsfunktion<br />
∆ Y1 < ∆ Y 2<br />
Y geht durch Ursprung<br />
∆Y 2<br />
∂Y<br />
positive Grenzproduktivität ( )<br />
∂N<br />
∆Y 1<br />
(jede Erhöhung des Arbeitseinsatzes bewirkt<br />
eine Produktionssteigerung)<br />
⇒ 1. partielle Ableitung >0<br />
N<br />
fallende Grenzproduktivitäten<br />
⇒ 2. partielle Ableitung
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
3.Reaktion auf Änderung der Preise<br />
• wegen Annahmen an die Produktionsfunktion gilt: die<br />
Arbeitsnachfragefunktion ist eine fallende Funktion des Reallohns w<br />
p<br />
• ( w ∂F<br />
) steigt ⇒ muss steigen, damit die Maximierungsbedingung<br />
p<br />
∂N<br />
erfüllt ist.<br />
• Aufgrund der Annahme, dass ∂ F mit wachsendem Arbeitseinsatz sinkt<br />
∂N<br />
(d.h.<br />
∂F<br />
steigt mit sinkendem Arbeitseinsatz) muss der Arbeitseinsatz<br />
∂N<br />
d d w<br />
sinken. ⇒ N = N ( )<br />
p<br />
w<br />
p<br />
d<br />
N<br />
−<br />
Wenn U. mehr für Arbeitskraft bezahlen<br />
muss, stellt er weniger ein<br />
b) Warum steigt das Arbeitsangebot der Haushalte mit steigendem Reallohn?<br />
• bei der Wahl seines Arbeitsangebots wägt der HH die Vorteile der<br />
Einkommenserhöhung gegen die Nachteile eines Verzichts auf Freizeit<br />
ab. → Grenznutzen vs. Grenzleid<br />
w<br />
• pro Arbeitseinheit erhält der Arbeiter den Lohnsatz w, mit dem er<br />
p<br />
Gütereinheiten kaufen kann.<br />
w<br />
• mit steigendem Reallohn ( ) wird Arbeit gegenüber Freizeit<br />
p<br />
lohnender, d.h. der Grenznutzen nimmt zu, daher mehr Arbeit<br />
angeboten. ( ⇒ Substitutionseffekt)<br />
s s w w<br />
⇒ N = N ( )<br />
p p<br />
+<br />
s<br />
N<br />
11
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
c) Wie wird das Gleichgewicht auf dem Klassisch-Neoklassischem Arbeitsmarkt<br />
erreicht?<br />
d w s w ∗<br />
• GG-Bedingung: N ( ) = N ( ) = N<br />
p p<br />
⇒2 Gleichungen, 2 Unbekannte<br />
• Im Arbeitsmarktgleichgewicht sind die Pläne der Haushalte und U.<br />
kompatibel, d.h. miteinander vereinbar.<br />
• Vollbeschäftigung ist im makroökonomischen Sinne nicht gleich<br />
statistischer Vollbeschäftigung.<br />
→ es kann freiwillige AL geben, nämlich wenn ein HH<br />
w ∗<br />
den Reallohn ( ) subjektiv als zu niedrig empfindet!<br />
p<br />
w<br />
p<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
∗<br />
0<br />
AÜ<br />
ÜNF<br />
∗<br />
N<br />
s<br />
N<br />
d<br />
N<br />
N<br />
d<br />
,<br />
⇒ Fazit: Im Arbeitsmarkt-GG des K-NK-Modells gibt es keine unfreiwillige<br />
Arbeitslosigkeit<br />
s<br />
N<br />
⇒ Was passiert bei einer Abweichung?<br />
• w w<br />
d s<br />
∗<br />
( ) > ( ) ⇒ Übernachfrage nach Arbeit: N > N<br />
p p<br />
→ Unternehmer unterbieten sich gegenseitig, solange bis<br />
das Niveau<br />
w ∗<br />
( ) erreicht ist.<br />
p<br />
• w w<br />
d s<br />
∗<br />
( ) < ( ) ⇒ Überangebot an Arbeit: N < N<br />
p p<br />
→Arbeitslose unterbieten sich gegenseitig, solange bis<br />
w ∗<br />
(<br />
) erreicht wird.<br />
p<br />
12
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 7 (Klassisch- Neoklassischer Kapitalmarkt)<br />
a) Leiten Sie den Verlauf der neoklassischen Investitionsfunktion her.<br />
Kapitalnachfrager sind alle U mit ihrer Investitionsnachfrage I.<br />
∗<br />
Berechnung des optimalen Kapitalstocks K<br />
∏<br />
d = F N,<br />
K)<br />
∗ p − w ∗ N − i ∗ p ∗ K<br />
( _<br />
wieder sind w, p, i gegeben (→ vollkommene Konkurrenz)<br />
⇒ ableiten um Gewinn zu maximieren!<br />
∂ ∏ ∂F<br />
!<br />
∂ F<br />
= p ∗ − 0 − i ∗ p = 0 ⇔ p ∗ = i ∗ p<br />
∂K<br />
∂K<br />
∂ K<br />
∂F<br />
⇔ = i<br />
∂K<br />
Im Optimum gilt, dass die Grenzproduktivität des Kapitals dem Zins i entspricht.<br />
U hat Kapitalstock K 0 und mit dieser Investition, die ich tätige, möchte ich zu<br />
∗<br />
K kommen.<br />
<br />
∗<br />
Die Investition führt zum optimalen Kapitalstock K<br />
⇒ I= ∗<br />
K - K = vorhandener Kapitalstock<br />
K 0<br />
0<br />
∗<br />
K = optimales Kapitalstock<br />
Wie hergeleitet hängt die Höhe des optimalen Kapitalstocks von Zins i.<br />
Behauptung: Der gewünschte Kapitalstock ist umso höher, je niedriger der<br />
Zinssatz i ist.<br />
∂F<br />
Begründung: wie beim Arbeitseinsatz gilt auch beim Kapitaleinsatz: > 0<br />
∂K<br />
2<br />
∂ F<br />
< 0 2<br />
∂K<br />
∂F<br />
Je höher der Zins i ist, desto höher muss auch die Grenzproduktivität i = des<br />
∂K<br />
Kapitals sein.<br />
Y<br />
I 1<br />
I 2<br />
∗<br />
1<br />
I 2<br />
K<br />
I<br />
Eine höhere Grenzproduktivität erfordert einen geringeren<br />
optimalen Kapitalstock. Dieses bedeutet eine niedrigere<br />
Investition (I= ∗<br />
K - K )<br />
<br />
K<br />
Umgekehrt: Je niedriger der Zins i, desto größer ist die Investitionsnachfrage I<br />
⇒ I = I(<br />
i)<br />
−<br />
(negativ korreliert)<br />
<br />
Y<br />
Sei K 0 =0 (d.h. kein Anfangskapital) ⇒ I= ∗<br />
K<br />
I K<br />
i<br />
1<br />
∗<br />
i 1<br />
∗<br />
i 2<br />
∗<br />
K 2<br />
0<br />
Die Investition steigt, da der Zinssatz sinkt!<br />
13
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Begründen Sie den Verlauf der neoklassischen Sparfunktion.<br />
Kapitalanbieter sind die Haushalte mit ihrer Ersparnis S<br />
Ersparnis S bringt Zins i als Risikoprämie<br />
Verhaltensannahme: Mit steigenden Zins i steigt die Ersparnis S der HH.<br />
(Argument: Opportunitätskosten des Konsums)<br />
⇒ S = S(<br />
i)<br />
(positiv korreliert)<br />
+<br />
i<br />
i<br />
i 1<br />
∗<br />
i<br />
i<br />
i<br />
i<br />
∗<br />
S<br />
c)Wie wird das Gleichgewicht auf dem Klassisch-Neoklassischen Kapitalmarkt<br />
erreicht?<br />
2<br />
ÜA<br />
S ( i )<br />
+<br />
I(<br />
i)<br />
−<br />
∗ ∗<br />
I , S I , S<br />
S ( i )<br />
+<br />
ÜNF<br />
I ( i)<br />
−<br />
∗ ∗<br />
I , S I , S<br />
∗ i 1 >i :ÜA an Kapital, d.h. S>I<br />
∗<br />
⇒ Sparer unterbieten den Marktzins bis i=i<br />
∗ i 2
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 9. (Klassisch- Neoklassischer Geldmarkt)<br />
a) Definieren Sie Geld und beschreiben Sie ihre Funktionen.<br />
Definition nicht eindeutig<br />
Unter Geld versteht man Aktiva (Vermögen), mit denen marktliche Transaktionen<br />
abgewickelt werden können.<br />
Unterschiedliche Abgrenzungen möglich, z.B. nach den Liquiditätsaspekt:<br />
M 1=<br />
Bargeld + Sichtguthaben (Girokonto)<br />
M 2 = 1 + kurzfristig kündbare Guthaben<br />
M<br />
M 3 = 2 + Spareinlagen<br />
M<br />
Geldmengendefinition für das neoklassische Modell nicht von Bedeutung (d.h. es<br />
wird nicht zwischen Gelddefinitionen unterschieden, sondern es gibt eine<br />
abstrakte Geldmenge M).<br />
Zur Erinnerung: Geld trägt im KNK-Modell keine Zinsen.<br />
Funktionen von Geld:<br />
1) Tauschmittelfunktion: Geld ermöglicht einen indirekten Tausch (keine<br />
doppelte Übereinstimmung der Wünsche mehr nötig,<br />
sondern nur einfache Übereinstimmung).<br />
2) Rechenmittelfunktion: Geld dient als optimales Wertmassstab (sonst wären<br />
relative preise nötig → also die paarweise<br />
Austauschverhältnisse der Güter zueinander)<br />
3) Wertaufbewahrungsfunktion: Geld verliert sein Wert nicht (Kritik: Inflation).<br />
Im K-NK-Modell ist die 3. Funktion nur eingeschränkt interpretierbar, da Geld dort<br />
kein Zins trägt.<br />
b) Erläutern Sie die Quantitätstheorie des Geldes.<br />
.<br />
bisher: Realanalyse (z.B. Arbeitsmarkt: Reallohn, Arbeitseinsatz)<br />
jetzt: monetäre Analyse!<br />
mit der Quantitätstheorie kann das Preisniveau erklärt werden.<br />
• Preisniveau (hier): gibt als Ø-Preis aller Güter deren Austauschverhältnis zum Geld<br />
an<br />
→ Betrachte Geldangebot und Geldnachfrage um das Preisniveau zu<br />
bestimmen<br />
Geldangebot: Annahme: Die Zentralbank gibt das nominale Geldangebot<br />
. . exogen vor. s<br />
M =M (Einheit: Geldeinheit)<br />
Konstante, jedoch immer noch eine Fkt!<br />
⇒ sehr unrealistische Annahme<br />
. (z.B. Kreditschöpfungsprozess der Kreditinstitute in der<br />
. modernen Geldmarktwirtschaft)<br />
Geldnachfrage: Transaktionsvolumen (Wertangabe aller in einer Periode<br />
. abgesetzten Güter) einer Volkswirtschaft in einer. Periode: p ∗ Y<br />
Annahme: Ø Kassenhaltungsdauer ist exogen gegeben<br />
. (Zahlungsgewohnheiten);<br />
1<br />
Einheit: bezogen auf ein Jahr (z.B. = k → immer
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
!<br />
GG-Bedingung für den Geldmarkt: M s d<br />
= M ⇔ M = k∗ p∗ Y (Cambridge-Gleichung)<br />
• M und k sind per Annahme exogen<br />
• Y bestimmt sich vom Arbeitsmarkt durch die Produktionsfunktion<br />
⇒ nur p ist variabel!<br />
M<br />
p =<br />
k ∗Y<br />
Reale Geldmenge:<br />
M<br />
p<br />
= k ∗Y<br />
Interpretation für k=1: Die reale Geldmenge entspricht dem Gegenwert in<br />
Gütereinheiten.<br />
c) Erläutern Sie den Cambridge-Effekt.<br />
Frage mit Blick auf Cambridge-Gleichung: Was passiert wenn M steigt?<br />
M = k∗ p∗ Y AAntwort: p muss ebenfalls steigen, damit der Geldmarkt im GG<br />
bleibt<br />
• Also: Verdopplung der Menge ⇒ Verdopplung des Preisniveaus<br />
Der Cambridge-Effekt liefert dafür eine ökonomische Erklärung:<br />
⎯ Wenn M exogen wird, haben die Konsumenten mehr Geld als vorher.<br />
⎯ Das zusätzliche Geld wird für zusätzliche Güternachfrage verwendet<br />
∗<br />
M<br />
⎯ Weil das Güterangebot fix ist bei Y , steigen die Preise bis gilt p =<br />
k ∗ Y<br />
⎯ Alternativ: p erhöht sich solange, bis der reale Kassenbestand M<br />
p<br />
sein ursprünglichen Niveau erreicht hat.<br />
d) Was versteht man unter „Neutralität des Geldes“?<br />
Auf dem Arbeitsmarkt (realer Sektor) wird der Reallohn w bestimmt.<br />
p<br />
w<br />
Der Nominallohn (monetärer Sektor) ergibt sich aus ( ) ∗ p = w,<br />
wobei p gemäß<br />
p<br />
der Quantitätstheorie bestimmt wird.<br />
• „ Dichotomie“: ⎯ der monetäre Sektor bestimmt also lediglich den<br />
Nominallohn<br />
⎯ Mengen und relative Preise bestimmen sich im realen<br />
Sektor.<br />
Merksatz: das Güterangebot hängt nur von realen Größen ab.<br />
⇒ Neutralität des Geldes.<br />
⇒ Geld legt nur einen „Schleier“ über die realen Vorgänge:<br />
Geld hat keinen intrinsischen (inneren) Wert, es wird<br />
lediglich als Zahlungsmittel akzeptiert.<br />
16
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 10 (Klassisch-Neoklassisches Gesamtmodell)<br />
a) Stellen Sie das Klassisch-Neoklassische Modell graphisch dar und erläutern Sie<br />
die Kurvenverläufe.<br />
• Arbeitsmarkt:<br />
• Produktionsfunktion:<br />
• Geldmarkt:<br />
N s<br />
w w<br />
( ) und N ( )<br />
p p<br />
d<br />
treffen aufeinander →<br />
(+ )<br />
_<br />
(−)<br />
Y = F(<br />
N,<br />
K)<br />
, K konstant →<br />
⇒ Y ergibt sich durch Einsatz von N<br />
⇒ N ergibt sich wiederum vom Arbeitsmarkt<br />
M<br />
p = (Quantitätstheorie) →<br />
k ∗Y<br />
∗<br />
• Kapitalmarkt: S ( i ) = I(<br />
i )<br />
→ S ,<br />
( + ) ( −)<br />
Der Kapitalmarkt ist unabhängig von allen anderen Märkten!<br />
w<br />
(<br />
p<br />
)<br />
p<br />
Im GG ergibt sich:<br />
w ∗<br />
,<br />
)<br />
( p<br />
∗<br />
N<br />
_<br />
17<br />
∗ ∗<br />
∗<br />
Y = F(<br />
N , K)<br />
= F(<br />
N )<br />
(VB-Einkommen per Definition)<br />
∗ w ∗ ∗<br />
w = ( ) ∗ p<br />
p<br />
(Isoquante des Nominallohns)<br />
Nominallohn Geldmarkt<br />
w Kapitalmarkt<br />
1w<br />
i<br />
2<br />
∗<br />
w<br />
∗<br />
p<br />
w ∗ Y<br />
∗<br />
Y<br />
S, I<br />
( )<br />
p<br />
s<br />
N<br />
∗<br />
N<br />
d<br />
N<br />
N<br />
M<br />
p =<br />
k ∗Y<br />
F(N)<br />
Arbeitsmarkt Produktionsfunktion<br />
M d M<br />
p = ⇔Y<br />
=<br />
k ∗Y<br />
k ∗Y<br />
∗<br />
I ,<br />
∗<br />
i<br />
S<br />
I
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Welche Auswirkungen hat es, wenn die Sparneigung der Bevölkerung steigt?<br />
i<br />
∗<br />
i 0<br />
∗<br />
i 1<br />
ÜA<br />
S ↑<br />
∗ ∗<br />
0 , I 0 S ∗ ∗<br />
S 1 , I 1<br />
S 0<br />
S, I<br />
S1<br />
• Erhöhte Sparneigung → Rechtsverschiebung der Sparkurve:<br />
So erhöht sich auf S1<br />
→ bei jedem Zins wird mehr gespart<br />
∗<br />
• Anpassungsprozess: bei i : ÜA an Ersparnissen<br />
0<br />
⇒ S, I steigen → Die erhöhte Sparneigung hat keine<br />
Auswirkungen auf die anderen Märkte!<br />
c) Welche Auswirkungen hat es, wenn zu jedem Reallohnsatz mehr Arbeit angeboten<br />
wird?<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
p<br />
Nominallohn<br />
w 1w<br />
2<br />
∗<br />
w 0<br />
w<br />
Geldmarkt<br />
s<br />
N 0<br />
s<br />
N1 Arbeitsmarkt<br />
w ∗ w ∗<br />
( ) 0(<br />
) 1<br />
p p<br />
ÜA<br />
∗<br />
1<br />
p<br />
p<br />
N<br />
N<br />
∗<br />
0<br />
∗<br />
1<br />
∗<br />
0<br />
∗<br />
1<br />
d<br />
N<br />
N<br />
∗<br />
Y0<br />
Y<br />
∗<br />
1<br />
F(N)<br />
M<br />
p =<br />
k ∗Y<br />
Produktionsfunktion<br />
Y<br />
18<br />
• Erhöhtes Arbeitsangebot, z.B. durch<br />
Änderung der Präferenz oder der<br />
Arbeitsmoral<br />
• s w<br />
N ( ) verschiebt sich nach unten, denn<br />
p<br />
bei jedem Reallohn wird mehr Arbeit<br />
angeboten<br />
• ÜA an Arbeit → Unterbietungsprozess<br />
→ w ∗<br />
( ) sinkt, ∗<br />
∗<br />
N steigt auf 0<br />
N 1<br />
p<br />
∗<br />
Dadurch steigt Y auf Y<br />
Preisniveau sinkt auf<br />
0<br />
∗<br />
1<br />
∗<br />
p1<br />
• Formale Begründung M k p Y<br />
d<br />
= ∗ ∗<br />
Wenn Y steigt, steigt die Geld-NF. Das<br />
nominale Geld-AN M ist exogen<br />
gegeben. Deshalb muss p sinken,<br />
damit die Geld-NF wieder sinkt.<br />
• Ökonomische Veranschaulichung: Weil<br />
das Güter-AG im GG gestiegen ist,<br />
sinken die Preise. Reale Geldmenge<br />
ist im GG größer als vorher.<br />
• Im neuen GG ist der Nominallohn auf<br />
∗<br />
w gesunken.<br />
1
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 11 (Klassisch-Neoklassisches Gesamtmodell)<br />
a) In der Klassisch-Neoklassischen Modellökonomie gelte:<br />
M = 8<br />
w<br />
N<br />
p<br />
s<br />
= 16<br />
k =<br />
1<br />
6<br />
I = 1-10i<br />
0,<br />
5<br />
Y = N<br />
S = 15i<br />
Berechnen Sie die Gleichgewichtswerte für den Reallohn, das Preisniveau, den<br />
Nominallohn, den Realzins und den realen Konsum.<br />
gesucht:<br />
w ∗ ∗ ∗ ∗<br />
, p , w , i ,<br />
)<br />
( p<br />
∗<br />
C<br />
s w d w<br />
Gesamtmodell: (i) N ( ) = N ( )<br />
p p<br />
( + )<br />
( −)<br />
_<br />
(ii) Y = F(<br />
N,<br />
K)<br />
→<br />
w , N<br />
→ ∗<br />
( )<br />
p<br />
∗<br />
Y<br />
∗<br />
(iii) S ( i ) = I(<br />
i )<br />
→ S ,<br />
( + ) ( −)<br />
(iv) M = k ∗ p ∗Y<br />
w<br />
(v) w = ( ) ∗ p<br />
p<br />
→<br />
d<br />
→ Herleitung der Arbeitsnachfrage ( N ) aus dem Gewinnmaximierungskalkül der U<br />
F<br />
N<br />
! ∂<br />
=<br />
∂<br />
w<br />
p<br />
⇒ Y=F= N<br />
0,<br />
5<br />
⇒<br />
∂F<br />
1<br />
= ∗ N<br />
∂N<br />
2<br />
2<br />
1<br />
d<br />
N<br />
w<br />
= ⇔ 2<br />
p<br />
→ GG auf dem Arbeitsmarkt<br />
s w<br />
N ( ) = N<br />
p<br />
d<br />
1<br />
−<br />
2<br />
N<br />
d<br />
=<br />
w w<br />
( ) ⇔ 16<br />
p p<br />
→ N = ∗ = = N<br />
s 1<br />
16 4<br />
4<br />
∗ → Y =<br />
∗<br />
N = 2<br />
→ GG auf dem Kapitalmarkt: S ( i ) = I(<br />
i )<br />
15 !<br />
( + ) ( −)<br />
1<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
∗<br />
i = 1−<br />
10i<br />
⇔ 25i<br />
= 1 ⇒ i<br />
∗ 15 3<br />
→ S = = = 0,<br />
6<br />
25 5<br />
→<br />
Y<br />
= C + S ⇔ C<br />
∗<br />
= Y<br />
∗<br />
∗<br />
⇔<br />
N<br />
1<br />
=<br />
w<br />
4 ∗ ( )<br />
p<br />
=<br />
− S<br />
1<br />
25<br />
∗<br />
=<br />
2<br />
⇔ C<br />
d<br />
∗<br />
p<br />
∗<br />
I ,<br />
1<br />
= ⇔<br />
w<br />
2 ∗ ( )<br />
p<br />
w<br />
⇔ 16 ∗ ( )<br />
p<br />
0,<br />
04<br />
∗<br />
=<br />
4%<br />
3<br />
=<br />
= 2 − 0,<br />
6 = 1,<br />
4<br />
∗<br />
∗<br />
i<br />
N d<br />
1<br />
4<br />
1<br />
=<br />
w<br />
4 ∗ ( )<br />
p<br />
w<br />
⇔ ( )<br />
p<br />
19<br />
Arbeitsnachfragefunktion<br />
3<br />
=<br />
2<br />
1<br />
64<br />
w<br />
⇔ ( )<br />
p<br />
∗<br />
=<br />
1<br />
4
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
→ Cambridge-Gleichung M = k ∗ p ∗Y<br />
1<br />
1<br />
∗<br />
8 = p ∗ 2 ⇔ 8 = p ⇔ p = 24<br />
6<br />
3<br />
→ Identität:<br />
w ∗ ∗ ∗ 1<br />
∗<br />
= ( ) ∗ p ⇔ w = ∗ 24 ⇔ w = 6<br />
p<br />
4<br />
w ⇒ So vorgehen wie im Modell!<br />
Nach Neoklassischer Theorie konvergieren wir langfristig immer zu einem GG auf<br />
dem Arbeitsmarkt 1929 (hohe Arbeitslosigkeit) Keynes: Was stimmt an diesem<br />
Modell nicht? Durch effektive Nachfrage, die auch zu niedrig sein kann, wird das<br />
effektive Angebot ebenfalls geringer Teufelkreis<br />
Die Neoklassik: Saysche Theorem: Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage<br />
⇒ hier bei Keynes auf dem Kopf gestellt!!!<br />
Vier wesentliche Abweichungen der Keynesianischen Theorie zur KNK-Theorie:<br />
• veränderte Konsumfunktion: C=C(Y)<br />
• modifizierte Investitionstheorie<br />
• Liquiditätstheorie des Zinses<br />
• Eventuelle Preis- und Lohnrigiditäten<br />
20
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 12 (Konsum- und Sparfunktion)<br />
a) Begründen Sie den Verlauf der makroökonomischen (keynesianischen<br />
Konsumfunktion.<br />
• Hypothese (von Keynes): Abhängigkeit des Konsums vom laufenden<br />
Realeinkommen (absolute Einkommenshypothese)<br />
• funktionaler Zusammenhang in der keynesianischen Konsumfunktion:<br />
⎯ C=C(Y)<br />
⎯ C und Y sind reale Größen, gemessen in Gütereinheiten<br />
• Beachte: Y ist hier die einzige bedeutsame Bestimmungsgröße für C<br />
• Widerspruch zur keynesianischer Theorie<br />
⎯ dort: simultane Planung von Konsum und Arbeitsangebot (und damit<br />
des Realeinkommens) gemäß Präferenzen und Preissignalen.<br />
⎯ dort: Zusammenhang von Konsum und Realeinkommen nur über die<br />
Budgetbeschränkung Y=C+S<br />
⎯ dort: Zins i ist die zentrale Determinante der Konsum-<br />
Sparentscheidung ( C = C(<br />
i)<br />
, denn C = Y − S(<br />
i)<br />
)<br />
( −)<br />
( + )<br />
Eigenschaften der Konsumfunktion:<br />
fundamental psychologisches Gesetz:<br />
⎯ Zunahme des Konsums bei Einkommenserhöhung<br />
⎯ Absolute Konsumzunahme stets geringer als zugrunde liegender<br />
Einkommensanstieg<br />
dC<br />
→ C =<br />
dY<br />
' dC<br />
mit 0 < < 1 (marginale Konsumquote)<br />
dY<br />
'<br />
Annahme: linearer Verlauf der Konsumfunktion C = Caut<br />
+ C ∗Y<br />
⎯ Änderung von Caut<br />
→ vertikale Verschiebung der Konsumfunktion<br />
'<br />
⎯ Änderung von C → Drehung der Konsumfunktion<br />
graphische Veranschaulichung<br />
C<br />
Caut<br />
C(<br />
Y )<br />
Y<br />
21<br />
Langfristig muss C allerdings Null sein, da<br />
aut<br />
sich die Ersparnisse aufbrauchen, wenn man<br />
kein Einkommen mehr hat.
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen Konsum- und Sparfunktion.<br />
Ansatz: Ermittlung der Sparfunktion über die Budgetrestriktion<br />
Y=C+S<br />
<br />
dY dC dS<br />
Ableitung nach Y<br />
= +<br />
dY dY dY<br />
' '<br />
1 = C + S<br />
'<br />
⇔ S<br />
'<br />
= 1− C<br />
<br />
→ marginale Konsum- und Sparquote addieren sich zu eins<br />
Interpretation: Eine zusätzliche Einkommenseinheit kann entweder für Konsum<br />
oder Ersparnis verwendet werden.<br />
<br />
'<br />
Herleitung der Sparfunktion → Y = Caut<br />
+ C ∗Y<br />
+ S<br />
'<br />
→ S = Y − C ∗Y<br />
− Caut<br />
'<br />
→ S = ( 1−<br />
C ) ∗Y<br />
− C<br />
graphische Veranschaulichung<br />
S<br />
Caut<br />
S(Y)<br />
Y<br />
S<br />
'<br />
aut<br />
22<br />
→ Wenn kein Einkommen, dann keine Ersparnis<br />
⇒ langfristig Caut<br />
durch Ursprung<br />
Bemerkung: Caut<br />
kann nicht als Existenzminimum interpretiert werden<br />
→ die Konsumfunktion ist bei niedrigem Realeinkommen<br />
nicht stabil<br />
→ langfristig muss C aut = 0 sein, da bei Null Produktion der<br />
Konsum durch reales Entsparen finanziert wird, die<br />
Ersparnis aber ist insgesamt aufgebracht.
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 13. (Einkommen-Ausgaben-Modell)<br />
Nehmen Sie an. Die gesamtwirtschaftliche Konsumfunktion habe die Form<br />
'<br />
C( Y ) = Caut<br />
+ C ∗Y<br />
und die Investitionsfunktion sei eine positive Konstante.<br />
a) Berechnen Sie den Gleichgewichtswert des Realeinkommens.<br />
• Annahme: konstante Investition und unausgelastete Kapazitäten (rezessive<br />
Situation)<br />
• effektive NF (ex-ante):<br />
D<br />
= C<br />
'<br />
+ C ∗Y<br />
+ I<br />
Y aut<br />
D<br />
• GG-Bedingung für Gütermarkt: Y = Y<br />
'<br />
• Einsetzen:<br />
Y = Caut<br />
+ C ∗Y<br />
+ I<br />
• auflösen nach Y: Y − C ∗Y<br />
= Caut<br />
+ I ⇒<br />
'<br />
'<br />
Y ( 1 − C ) = C aut +<br />
Caut<br />
+ I<br />
⇒ Y0<br />
= '<br />
1− C<br />
Erkenntnisse: GG auf dem Gütermarkt nur bei Y0<br />
∗<br />
höchstens zufällige Übereinstimmung von Y0<br />
und Y<br />
∗<br />
Erklärung unfreiwilliger Arbeitslosigkeit durch Y0 < Y<br />
( Rückgang der Produktion und der Beschäftigung trotz eventuell<br />
„richtiger“ Höhe des Einkommens)<br />
∗ VB<br />
möglich: ursprüngliche Produktion von Y ( = Y ) durch die U,<br />
aber wg. Mangelnder Arbeitslosigkeit, da effektive NF zu<br />
gering, Rückführung auf Y0<br />
(keine Lagerproduktion)<br />
w<br />
p<br />
d<br />
N<br />
s<br />
N<br />
Y<br />
I<br />
C<br />
aut<br />
∗<br />
N<br />
N<br />
D<br />
N 0<br />
AL<br />
Y0<br />
∗<br />
Y<br />
F(N)<br />
D<br />
Y = Y (GG-Bedingung)<br />
Y D<br />
C(Y<br />
)<br />
Y<br />
= C(<br />
Y ) + I<br />
I<br />
23<br />
Nur ein gleichgewichtiges<br />
Realeinkommen!
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
alternative Darstellung des Einkommen-Ausgaben-Modells:<br />
• effektive NF Y C(<br />
Y ) I(<br />
i)<br />
D<br />
= +<br />
• Budgetrestriktion Y = C + I<br />
•<br />
D<br />
GG-Bedingung Y = Y<br />
• Einsetzen C ( Y ) + I(<br />
i)<br />
= C(<br />
Y ) + S(<br />
Y ) ⇒ I ( i)<br />
= S(<br />
Y )<br />
S,I<br />
− Caut<br />
I<br />
∆I<br />
S(Y)<br />
Y 0<br />
Y<br />
I<br />
b) Was versteht man unter Multiplikatorprozess?<br />
einmalige Investitionserhöhung<br />
1 t t0 Zeit t<br />
Bemerkung: Je größer der autonome Konsum<br />
und die marginale Konsumquote,<br />
desto größer ist das<br />
gleichgewichtige Realeinkommen.<br />
Y<br />
∆I<br />
D<br />
Y0<br />
∆I<br />
Y = Y<br />
Y<br />
D<br />
Y D<br />
Y D<br />
24<br />
= C(<br />
Y ) + I + ∆I<br />
= C(<br />
Y ) + I<br />
•<br />
D<br />
in Y 0 erhöht sich die effektive NF auf Y + ∆I<br />
• die Unternehmen orientieren sich mit ihrer Produktion immer an der effektiven NF<br />
der Vorperiode<br />
• Y Y + ∆I (Produktion d. U)<br />
= 0<br />
• die effektive NF ist aber in dieser Periode wieder gesunder, da die Investitionen<br />
wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückgegangen sind.<br />
• ⇒ Y sinkt in der nächsten Periode wieder (und zwar in gleichem Masse, in dem<br />
die effektive NF in der Vorperiode gesunken ist)<br />
• ⇒ langfristig wird wieder das alte Realeinkommensniveau Y0<br />
erreicht<br />
⇒<br />
Strohfeuereffekt
I<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
dauerhafte Investitionserhöhung (Multiplikatorprozess)<br />
t 0<br />
Zeit t<br />
Y<br />
∆I<br />
D<br />
Y0<br />
∆I<br />
Y 00<br />
Y = Y<br />
•<br />
D<br />
Anstieg der Investitionsvolumens um ∆I (vertikale Verschiebung der Y -Kurve)<br />
• Primäreffekt: Erhöhung der effektiven NF um ∆I und dafür Erhöhung der<br />
Produktion um ∆I in der nächsten Periode: ∆ Y1<br />
= ∆I<br />
• Sekundäreffekt: Einkommensanstieg führt zu Erhöhung der Ausgaben für den<br />
'<br />
Konsum in Höhe von C ∗ ∆I<br />
⇒ effektive NF steigt noch einmal<br />
⇒ Produktion steigt (in folgender Periode) erneuert: ∆ = ∗ ∆I<br />
'<br />
Y C<br />
'<br />
⇒ kumulatives Prozess, der aber konvergiert, daC ∗∆<br />
Y immer<br />
'<br />
kleiner, denn C < 1<br />
⇒ wichtig: ∆Y tendiert gegen einen Mehrfacher von ∆I<br />
→ den Übergang von Y 0 nach Y00<br />
bezeichnet man als Multiplikatorprozess<br />
• Berechnung der Höhe des Multiplikators (wie sich Einkommen erhöht, wenn sich<br />
Investitionen um eine Einheit erhöhen)<br />
1 '<br />
Y0 = ( Caut<br />
+ I)<br />
1−<br />
C<br />
→ Ableitung nach I:<br />
dY<br />
dI<br />
0<br />
1<br />
=<br />
1−<br />
C<br />
'<br />
er hängt allein von der marginalen Konsumquote C ab.<br />
'<br />
2<br />
Y<br />
D<br />
Y D<br />
Y D<br />
25<br />
= C(<br />
Y ) + I + ∆I<br />
= C(<br />
Y ) + I<br />
Der elementare Multiplikator gibt an, wie stark<br />
das Realeinkommen auf eine Änderung der<br />
Investitions-NF reagiert<br />
Offenbar gilt: Je größer die marginale Konsumquote, desto größer ist der elementare<br />
Multiplikator (Ausgaben für Konsum sollen möglichst groß sein, damit<br />
Wirtschaft wächst)<br />
• ⇒ Sparen ist nicht mehr zwingend, gesamtwirtschaftlich wünschenswert<br />
(→ Erhöhung des Realeinkommens durch hohe Konsumquote)
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 14 (SAYsches Theorem)<br />
a) Was besagt das SAYsches Theorem?<br />
Aussage: Von der NF-Seite können langfristig keine Störungen des Güterangebots<br />
bzw. der Produktion ausgehen.<br />
• Salopp gesagt: „Jedes Angebot schafft sich seine NF“ d.h. die Summe aus<br />
geplanten Angebot und geplanter NF stimmen überein<br />
• Strenge Gültigkeit des Sayschen Theorems in einer Tauschwirtschaft (ohne Geld):<br />
AG=NF ist hier eine Identitätsgleichung, denn jedes Angebot der Ware A bedeutet<br />
im Tauschhandel zwangsläufig, dass der Anbieter eine andere Ware B eintauschen<br />
möchte, so dass Angebot und NF in der Summe identisch sind.<br />
• Problem in moderner Wirtschaft (mit Geld):<br />
→ das Einkommen der HH wird nur zum Teil nachfragewirksam (→ Konsum)<br />
→ Grund: Ersparnisbildung<br />
→ Wie kann S trotzdem nachfragewirksam werden?<br />
⇒ Durch eine Kompensation von S durch I<br />
⇒ notwendig wäre S = I. (→Kapitalmarkt)<br />
• Zentrale Frage bezüglich der Gültigkeit des Sayschen Theorems:<br />
Gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass der NF-Ausfall (Ersparnis) in<br />
Form von Investitionen nachfragewirksam wird?<br />
• Hier wird der Zusammenhang zwischen Güter- und Kapitalmarkt deutlich:<br />
Gütermarkt im GG ⇔ I = S ⇔ Kapitalmarkt im GG<br />
b) Vergleichen Sie die Gültigkeit des Sayschen Theorems im neoklassischen<br />
Modell und im Einkommen-Ausgaben-Modell (Keynes).<br />
Gültigkeit des Sayschen Theorems:<br />
KNK-Modell: → jedes Einkommen kann gleichgewichtig sein!<br />
• Gesamtes Einkommen ist NF-wirksam, da der Kapitalmarkt im GG ist, also S ( i ) = I(<br />
i )<br />
26<br />
( + ) ( −)<br />
• Entscheidend: Zinsmechanismus führt zum Kapitalmarkt-GG und damit gleichzeitig zum<br />
Gütermarkt-GG (nicht etwa ein Preismechanismus)<br />
→ das Saysche Theorem gilt<br />
• Kausalität im KNK-Modell (wie kommt dazu, dass das Saysche Theorem gilt):<br />
Arbeitsmarkt → Beschäftigung → Sozialprodukt ist GG-Einkommen wegen des S.T.<br />
E/A-Modell:<br />
• Das S.T. war im KNK-Modell eine Schlussfolgerung aus der Interpretation des<br />
Kapitalmarktes, d.h. die Ablehnung des S.T. erfordert die Kritik an der zinselastischen<br />
Spar- und/oder Investitionsfunktion.<br />
• Im Keynesianischen Modell: einkommensabhängige Konsum-/Sparfunktion!<br />
1 '<br />
.<br />
• Folge: Y0 =<br />
1−<br />
C<br />
( Caut<br />
+ I)<br />
→ nur ein einziges GG-Einkommen, dass von der NF<br />
•<br />
determiniert<br />
→ S.T. gilt nicht (denn dieses besagt, dass theoretisch jedes Güterangebot<br />
abgesetzt werden kann)<br />
Umkehrung der Kausalität:<br />
effektive NF → Güterangebot → dies ist GG-Sozialprodukt
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 15 (Keynesianische Investitionstheorie)<br />
a) Zeigen Sie, dass der Marktzins und die Investitionsnachfrage negativ korreliert sind.<br />
Wiederholung KNK-Modell:<br />
• In der Klassischen Theorie: I= ∗<br />
K -<br />
• Kriterium, dass die Höhe der Investitionen stimmt: Grenzproduktivität<br />
dY<br />
des Kapitals = i , somit I = I ( i)<br />
dK<br />
( −)<br />
Keynes: wieder I (i)<br />
, aber andere Begründung<br />
• Betrachte ein Investitionsprojekt<br />
• Anfangsauszahlung A<br />
0<br />
• erwartete EZÜ: , , … , Q (subjektive Größe)<br />
Q0 1 Q n<br />
• Investition bedeutet: Verzicht der Anlage des Kapitals zum Marktzins i (sichere<br />
Rendite)<br />
• Sei r die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals (interne Zinsfuß). Der Zinssatz bei<br />
dem der Barwert der EZÜ der Anfangsauszahlung A entspricht!<br />
der Barwert gibt den auf die Gegenwert bezogenen Wert der zukünftigen EZÜ an.<br />
Q1<br />
Q2<br />
Qn<br />
hier: Q0<br />
+ + + ... + 2<br />
n<br />
( 1+<br />
k)<br />
( 1+<br />
k)<br />
( 1+<br />
k)<br />
Berechnung der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals:<br />
Q<br />
!<br />
1 Qn<br />
− A 0 + Q0<br />
+ + ... + = 0 n<br />
( 1+<br />
r)<br />
( 1+<br />
r)<br />
• Die Investition wird durchgeführt, wenn der interne Zinsfuß r größer als der<br />
Marktzins i ist.<br />
• Bsp.: eine Maschine habe die erwartete Lebensdauer von 2 Jahren und kostet 1000<br />
€. Der Investor erwartet Nettoeinkommen von 500 € im laufenden Jahr und<br />
540 € im kommenden Jahr.<br />
540 ! 1 500<br />
Berechnung von r: −1000 + 500 + = 0 ⇔ = ⇔ r = 8%<br />
( 1+<br />
r)<br />
1+<br />
r 540<br />
Es wird eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 8% erwartet. Beläuft<br />
sich der Marktzins auf 7%, dann wird die Investition durchgeführt; beträgt er 9%, wird die<br />
Investition unterlassen.<br />
• Betrachte mehrere Investitionsprojekte<br />
• Alle Projekte mit r > i werden durchgeführt.<br />
• Das Projekt mit dem höchsten r wird als erstes, das Projekt mit r = i wird als<br />
i1<br />
i2<br />
i<br />
letztes durchgeführt. → Auflistung<br />
• Je höher i, desto weniger Projekte erfüllen die Bedingung r > i, desto niedriger ist<br />
also das Investitionsvolumen I.<br />
• I = I ( i)<br />
−<br />
I1<br />
•<br />
(<br />
)<br />
I2<br />
I<br />
( i)<br />
( − )<br />
I<br />
K<br />
0<br />
0<br />
27
i<br />
• Unterschied zum KNK-Modell:<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
• Erwartungen über zukünftige EZÜ sind entscheidend → d.h. die<br />
psychologische Komponente spielt eine entscheidende Rolle.<br />
• I = I ( i)<br />
nicht stabil:<br />
( −)<br />
• Bei sehr unsicheren Erwartungen spielt der Zins bei der<br />
Investitionsentscheidung keine Rolle mehr, d.h. falls die EZÜ sehr klein<br />
sind, dann gilt r < i<br />
• I ist dann nicht mehr zinsabhängig und man spricht von einer<br />
Investitionsfalle<br />
I<br />
b) Ein keynesianischer Investor erwartet für eine Investition mit dem Anschaffungswert<br />
von 210.000 € im laufenden und im kommenden Jahr einen konstaten Ertrag von<br />
110.000 €, der am Jahresanfang anfällt. Bei welchem Marktzins wird er investieren?<br />
Berechnung des internen Zinsflusses r:<br />
110.<br />
000 !<br />
110.<br />
000 1 100.<br />
000<br />
• − 210.<br />
000 + 110.<br />
000 + = 0 ⇔ −100.<br />
000 + = 0 ⇔ = ⇔ r = 10%<br />
( 1+<br />
r)<br />
( 1+<br />
r)<br />
( 1+<br />
r)<br />
110.<br />
000<br />
Interpretation: bei i < 10% wird investiert<br />
bei i = 10% ist der Investor indifferent<br />
bei i > 10% wird nicht investiert<br />
Aufgabe 16 (Keynesianische Kassenhaltungstheorie)<br />
a) Aus welchen Gründen hält ein Anleger in der keynesianischen Theorie Geld, obwohl<br />
es ihm keine Zinsen einbringt?<br />
Schrittweise Geld-NF herleiten<br />
• Drei Motive, Geld zu halten:<br />
• Transaktionsmotiv: = L Y ) = k * P * Y<br />
• Vorsichtsprinzip:<br />
LT T (<br />
( + )<br />
LV = LV<br />
( Y , i<br />
( + ) ( −)<br />
)<br />
• Spekulationsmotiv: (→ entscheidend zur Beantwortung dieser Frage)<br />
Wertpapierhaltung vs. Geldhaltung<br />
WP-Haltung: Vorteil ist die Verzinsung → Zinsertrag<br />
Nachteil ist das Kursrisiko<br />
Geldhaltung ist besser als WP-Haltung, wenn der erwartete<br />
Kursverlust größer ist als der Zinsertrag<br />
Betrachte festverzinsliche Wertpapiere mit unendlicher Laufzeit<br />
KW: Kurswert, d.h. der Preis zu dem das WP am Markt gehandelt<br />
wird.<br />
28
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Z: Verzinsung des Wertpapiers und zwar die nominale Verzinsung<br />
Bsp: NW =100 €, feste Verzinsung von 10 % => Z = 10 €<br />
i: Marktzins<br />
Berechnung des Kurswertes: Z = KW ∗i<br />
Bsp: Z = 5 €, NW = 100 €<br />
Z<br />
KW =<br />
i<br />
i = 4 % =><br />
KW ∗<br />
4<br />
= 5 ⇒ KW = 125€<br />
Z<br />
→ Der Kurswert KW und der Marktzins i verhalten sich invers (denn KW = )<br />
i<br />
<br />
e Z<br />
Erwarteter Kurswert: KW = e<br />
i<br />
Jeder Investor erwatet einen<br />
anderen Zins<br />
<br />
e Z Z<br />
erwarteter Kursverlust: KW − KW = − e<br />
i i<br />
<br />
Z Z<br />
Geldhaltung ist besser als WP-Haltung, falls Z e<br />
i i<br />
> −<br />
<br />
1 1 1<br />
Auflösen: − > 1|<br />
+<br />
e<br />
e<br />
i i i<br />
1 1<br />
i<br />
⇔ > 1+<br />
| ∗i<br />
⇔ 1 > i +<br />
e<br />
e<br />
i i<br />
i<br />
1<br />
⇔ 1 > i(<br />
1+<br />
) e<br />
i<br />
e<br />
e<br />
1+<br />
i i<br />
⇔ 1 > i(<br />
) ⇔ e<br />
e<br />
i 1+<br />
i<br />
e<br />
i<br />
> 1 ⇔ i < e<br />
1+<br />
i<br />
<br />
e<br />
i<br />
i<br />
i < und i e<br />
1+<br />
i<br />
i<br />
e<br />
> (statt i wird nach i<br />
1−<br />
e aufgelöst) sind äquivalent!<br />
Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann ist Geldhaltung besser als WP-<br />
Haltung.<br />
Intuition: Wenn i sehr niedrig ist, ist die Bedingung erfüllt, d.h. Geldhaltung<br />
ist besser als WP-Haltung, denn:<br />
wenn i sehr niedrig ist, dann sind die Kurswerte sehr hoch, d.h. das Risiko,<br />
dass die Kurse abstürzen ist sehr hoch, so dass die erwarteten Kursverluste<br />
extrem groß sind.<br />
b) Ein Anleger steht vor der Entscheidung, ein festverzinsliches Wertpapier mit<br />
unendlicher Laufzeit (Nennwert 100 €) zu einem aktuellen Marktkurs von 150 € zu<br />
kaufen. Dies würde ihm einen Zinsertrag von 15 € pro Periode bringen. Da ihm sein<br />
Anlagebetrag nur eine Periode zur Verfügung steht, würde er das erworbene Papier<br />
nach einer Periode wieder verkaufen. Der Investor erwartet am Ende der laufenden<br />
Anlageperiode eine Marktrendite von (i) 9% bzw. (ii) 11%.<br />
Wird er unter diesen Bedingungen das Wertpapier kaufen? Bei welchem Marktzins ist<br />
er gerade indifferent?<br />
NW =100 €, KW =150 €, Z =15 €<br />
Z Z 15<br />
KW = ⇔ i = ⇒ i = ⇒ i = 0,<br />
1 = 10%<br />
i KW 150<br />
i<br />
Geldhaltung wird präferiert, wenn i<br />
i<br />
e<br />
i<br />
> , also = 0,<br />
111 = 11,<br />
1%<br />
1−<br />
1−<br />
i<br />
die Bedingung ist sowohl für i e = 9%, als auch für i e = 11% verletzt<br />
Also wird kein Geld gehalten, sondern WP-Haltung wird präferiert<br />
100<br />
29
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Beachte: obwohl i e > i(im Fall (ii)) wird trotzdem kein Geld nachgefragt<br />
bei einem erwateten Zins etwas größer als 11% ist der Investor gerade indifferent.<br />
c) Warum verläuft die aggregierte Nachfrage nach Spekulationskasse fallend im<br />
Marktzins?<br />
i<br />
Bedingung für Geldhaltung: i<br />
i<br />
e<br />
e<br />
i<br />
> bzw. i < e<br />
1−<br />
1+<br />
i<br />
Anleger haben unterschiedliche Erwartungen über die zukünftige Zinsentwicklung<br />
i<br />
Wenn i steigt, steigt auch<br />
1−<br />
i<br />
Damit weiterhin Geld nachgefragt wird, muss auch i e steigen<br />
Dieses erwarten aber nur wenige Investoren, weshalb die Geldnachfrage aus dem<br />
Spekulationsmotiv zurückgeht<br />
i<br />
Für einen sehr niedrigen Zins imin gilt immeri<br />
i<br />
e<br />
> , d.h. alle Wirtschaftssubjekte<br />
1−<br />
fragen Geld nach. i<br />
imin<br />
Bei einem niedrigen Zinssatz wird<br />
viel Geld nachgefragt<br />
Aufgabe 17 (IS-Kurve)<br />
Gegeben seien die Konsumfunktion C = Caut + C’Y und die Investitionsfunktion<br />
I = Iaut – m ∗ i.<br />
a) Ermitteln Sie die IS-Kurve und stellen Sie sie graphisch dar.<br />
Kreditfinanzierte Staatsausgaben sind Teil der effektiven NF.<br />
jetzt: Zinsabhängige Investitionen, Zins ist hier aber endogen<br />
Analytische Lösung: Y d = C + I + G<br />
Y d = Caut + C’∗ Y + Iaut – m∗ i + G<br />
GG-Bedingung : Y = Y d Ist immer eine<br />
Gleichung<br />
i<br />
Y = Caut+ C’∗ Y+ Iaut – m∗ i + G<br />
Y - C’ ∗ Y = Caut<br />
+ Iaut – m∗ i + G<br />
1<br />
Y = ∗(<br />
Caut<br />
+ I aut − m∗<br />
i + G)<br />
→ IS − Kurve<br />
1−<br />
C'<br />
es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie i und Y gewählt werden können,<br />
damit der Gütermarkt im GG ist<br />
Gliederung der IS-Kurve: Y = Y ( i)<br />
( −)<br />
IS-Kurve<br />
Y<br />
LS<br />
30<br />
IS-Kurve immer<br />
Gütermarkt
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Interpretieren Sie die IS-Kurve und erläutern sie die Aussage von Punkten, die nicht<br />
auf der IS-Kurve liegen<br />
• Die IS-Kurve ist der geometrische Ort aller Realeinkommen-Zins-Kombinationen, bei denen<br />
der Gütermarkt im GG ist.<br />
• Anders im F./H.: Vergesst das mit dem Kapitalmarkt<br />
• Graphische Veranschaulichung: sei dazu G = 0<br />
Y d<br />
i<br />
i0<br />
i1<br />
S,I<br />
-Caut<br />
i0<br />
i<br />
i1<br />
B (I>S)<br />
Y0<br />
B<br />
Y0<br />
Y0<br />
Y0<br />
Y1<br />
A (S>I)<br />
Y1<br />
Y1<br />
A<br />
Y1<br />
IS-Kurve<br />
IS-Kurve<br />
Y1 d<br />
Y0 d<br />
d<br />
Y = Y<br />
= C Y)<br />
+ I(<br />
i )<br />
Y<br />
( 1<br />
= C(<br />
Y)<br />
+ I(<br />
i0<br />
)<br />
Y<br />
I(i0)<br />
I(i1)<br />
Y<br />
Y<br />
i1 > i0<br />
31<br />
• Die IS-Kurve fällt, denn mit<br />
steigendem Zins i sinkt die<br />
Investitions-NF, somit auch die<br />
aggregierte (effektive) NF und damit<br />
auch das GG-Einkommen Y.<br />
• Die alternative Herleitung der IS-<br />
Kurve: Y d = C(Y) + I(i)<br />
Budgetrestriktion: Y = C(Y) + S(Y)<br />
Y = Y d C(Y) + S(Y) = C(Y) + I(i)<br />
S(Y) = I(i)<br />
Die IS-Kurve fällt, denn mit steigendem<br />
Einkommen Y steigt auch die Ersparnis, so dass<br />
auch die Investitionen I steigen müssen, damit<br />
der Gütermarkt im GG bleibt. Dies erfordert einen<br />
fallenden Zins i.
i<br />
-1<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Ungleichgewicht auf dem Gütermarkt:<br />
• Merksatz: Ist man nicht auf der IS-Kurve, so erfolgt die Anpassung über das<br />
Realeinkommen Y! Der Zinssatz i ist hier exogen!<br />
• Punkt A: Y > Y0<br />
Interpretation 1: ÜA auf dem Gütermarkt → Rückgang der Produktion bzw.<br />
des Einkommens.<br />
Interpretation 2: S > I: Ersparnis S muss sinken, also muss das Einkommen<br />
Y sinken.<br />
• Punkt B: Y > Y1<br />
Interpretation 1: ÜNF auf dem Gütermarkt → Steigerung der Produktion<br />
bzw. des Einkommens<br />
Interpretation 2: I > S → Ersparnis S muss steigen, also muss das<br />
Einkommen steigen.<br />
• Das GG-Einkommen ist noch nicht eindeutig, da der Geldmarkt noch fehlt → LM-<br />
Kurve<br />
Aufgabe 18 (LM-Kurve)<br />
Die geplante volkswirtschaftliche Transaktions- und Vorsichtskasse LT + LV belaufe sich<br />
auf 50% des Realeinkommens. Für die geplante Spekulationskasse gelte: LS = 100 – 25i.<br />
Die Zentralbank stelle eine reale Geldmenge von 125 zu Verfügung<br />
a) Ermitteln Sie die LM-Kurve und stellen Sie sie graphisch dar.<br />
LT + LV = 50% des Realeinkommens [0,5 * Y]<br />
LS = 100 * 25i<br />
M<br />
P<br />
= 125<br />
Geld-NF<br />
Geld-AG<br />
LM-Kurve: Geldangebot auf dem Geldmarkt → Geldmarkt soll Aussage zum Zins i<br />
liefern!<br />
Darstellung: i in Abhängigkeit von Y. i ist endogen → LM-Kurve: i in Abhängigkeit von Y.<br />
Geld-NF aggregiert: L = LT + LV + LS (nur einsetzen)<br />
Hier: L = 0,5 * Y + 100 – 25i = Geld-NF (braucht auch Geldangebot)<br />
M<br />
Geldmarkt-GG: = L(<br />
Y , i ) Je höher der Zins, desto geringer die aggregierte Geld-NF<br />
P ( + ) ( −)<br />
Y<br />
1<br />
Hier: 125 = 0,5Y + 100 – 25i ⇒ − 25 = 25i<br />
⇒ i = Y −1<br />
= LM − Kurve<br />
2<br />
50<br />
Steigung 1<br />
50<br />
50<br />
LM<br />
Y<br />
32
i<br />
i1<br />
i0<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Interpretieren Sie die LM-Kurve und erläutern Sie die Aussage von Punkten, die nicht<br />
auf der LM-Kurve liegen<br />
Die LM-Kurve ist der geometrische Ort aller Y, i-Kombinationen, die ein GG auf dem Geldmarkt<br />
herstellen.<br />
Graphische Herleitung über den Geldmarkt:<br />
M<br />
P<br />
LY1<br />
LY0<br />
M<br />
L,<br />
P<br />
i<br />
i1<br />
i0<br />
(LM)<br />
LM-Kurve: GG auf dem Geldmarkt: Geld-Angebot und Geld-Nachfrage zeichnen und<br />
dann auf den Geldmarkt übertragen.<br />
→ Erhöhung der Geldnachfrage kann nur zurückgehen, wenn Nachfrage nach<br />
Spekulationskasse sinkt → Zins muss steigen.<br />
Die LM-Kurve steigt, dann wenn das Einkommen Y steigt, nimmt die Nachfrage<br />
nach Transaktions- und Vorsichtskasse zu, so dass die NF nach Spekulationskasse<br />
abnehmen muss, damit weiterhin ein GG auf dem Geldmarkt herrscht.<br />
Dazu muss der Zins steigen.<br />
Merksatz: Ist man nicht auf der LM-Kurve (liegt ein Ungleichgewicht auf dem Geldmarkt<br />
vor), so erfolgt die Anpassung über den Zins i.<br />
Beim Geldmarkt gibt es nur eine endogene Variable: Zins i !<br />
Punkt A: ÜNF nach WP → Kurse steigen → Zinsen sinken!<br />
Die Anpassung erfolgt über den Zinsmechanismus; „nicht“ über Y!<br />
Punkt B: ÜA an WP → Kurse sinken → Zinsen steigen!<br />
LM<br />
Y<br />
33
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 19 (IS-LM-Modell)<br />
Güter- und Geldmarkt seien über das Realeinkommen und den Zins miteinander<br />
verbunden.<br />
a) Stellen Sie das IS-LM-Modell graphisch dar und interpretieren Sie es.<br />
i<br />
i0<br />
• IS-Kurve: Y in Anhängigkeit von i Y(i)<br />
• LM-Kurve: i in Abhängigkeit von Y i(Y)<br />
• Jetzt: sowohl Y als auch i sind endogen<br />
• Die IS- und LM-Kurven bestimmen gemeinsam das GG-Einkommen und den GG-<br />
Zins. Das GG-Einkommen Y0 muss nicht mit dem VB-Einkommen Y*<br />
übereinstimmen<br />
Y0<br />
LM<br />
IS<br />
Y<br />
Bei (Y0, i0) sind sowohl Gütermarkt als auch Geldmarkt im<br />
GG.<br />
b) Leiten Sie eine LM-Kurve für die quantitätstheoretische Geldmarktbeziehung der<br />
neoklassischen Theorie her.<br />
i<br />
Neoklassischer Geldmarkt: Geld-NF ist zinsunabhängig denn M d = k ∗ p∗ Y<br />
M<br />
Quantitätsgleichung: M = k ∗ p ∗Y<br />
⇔ Y =<br />
k ∗ p<br />
d.h. die neoklassische LM-Kurve verläuft senkrecht<br />
LM<br />
M<br />
k ∗ p<br />
Y<br />
34
i0<br />
i<br />
i0 ’<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
c) Welchen Effekt hat eine Ausweitung der nominalen Geldmenge im keynesianischen<br />
und im neoklassischen Fall?<br />
1. Keynesianisches Modell<br />
• Wichtig für das IS-LM-Modell: Das Preisniveau ist fix (exogen). Sonst hätte die LM-<br />
Kurve keine eindeutig bestimmte Lage<br />
• d.h. eine nominale Geldmengenerhöhung impliziert eine Änderung der realen<br />
Geldmenge im gleichen Maße.<br />
M<br />
P<br />
M<br />
(<br />
P<br />
)'<br />
LY0<br />
M<br />
L,<br />
P<br />
i0<br />
i<br />
i0 ’<br />
Y0<br />
Y1<br />
M<br />
LM ( )<br />
P<br />
M<br />
LM (<br />
P<br />
• Durch die gestiegene reale Geldmenge verschiebt sich die LM-Kurve nach rechts<br />
• Insgesamt führt die Erhöhung der nominalen Geldmenge zu einem Anstieg des GG-<br />
Einkommens Y und zu einem sinken des GG-Zinses i.<br />
• Anpassungsprozess: Y steigt → NF nach LT und LV steigen (da die positiv irg. des<br />
Realeinkommens korreliert sind) → i steigt damit LS sinkt.<br />
2. Neoklassisches Modell Bei diesem Modell hat expansive Geldpolitik keine Wirkung<br />
• In der Neoklassik hängt die LM-Kurve vom Preisniveau ab.<br />
• Cambridge-Effekt: Wenn M steigt, steigt p in gleichem Ausmaß.<br />
• Dadurch sinkt die reale Geldmenge wieder auf das ursprüngliche Niveau.<br />
• Zuerst verschiebt sich die LM-Kurve nach rechts, da sich die nominale Geldmenge<br />
erhöht [ M<br />
↑ ], sobald sich die Preise erhöht haben (Cambridge-Effekt), verschiebt<br />
k ∗ P<br />
sie sich aber wieder in die Ausgangslage [ M<br />
↓ ].<br />
k ∗ P<br />
i<br />
LM<br />
M<br />
k ∗ p<br />
M ↑<br />
P<br />
↑<br />
Y<br />
Y<br />
)'<br />
35
Y d<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
d) Welchen Effekt hat eine Erhöhung kreditfinanzierter Staatsausgaben im<br />
keynesianischen Fall<br />
i<br />
i1<br />
i0<br />
Durch die Erhöhung kreditfinanzierter Staatsausgaben verschiebt sich die IS-Kurve<br />
nach rechts:<br />
Y0 Y1 Y1’<br />
Y0<br />
IS0<br />
Y1 Y1’<br />
IS1<br />
Y1 d<br />
Y2 d<br />
Y0 d<br />
Y<br />
LM<br />
Y<br />
Y=Y d<br />
= C ( Y ) + I ( i ) + G<br />
= C ( Y ) + I ( i ) + G<br />
= C ( Y ) + I ( i ) + G<br />
0<br />
1<br />
0<br />
Insgesamt: Durch die Erhöhung der kreditfinanzierten Staatsausgaben steigt das GG-<br />
Einkommen Y und der GG-Zins i.<br />
partielles Crowding Out [priv. Investitionen sinken aufgrund der Zinssteigerung].<br />
1<br />
1<br />
0<br />
G1 > G0<br />
Anpassungsprozeß:<br />
Y steigt Geld-NF steigt, da LT und LV steigen<br />
i muss steigen, damit die Geldnachfrage aus LS<br />
sinkt, damit man im GG bleibt<br />
die Investitionen sinken<br />
Y d ↓ Y sinkt<br />
Gütermarkt im GG, aber Geldmarkt nicht Zins ↑<br />
auf LM-Kurve kommen<br />
Realeinkommen zurück auf Y1<br />
36
Y d<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 20 (Investitions- und Liquiditätsfalle)<br />
Welche Auswirklungen hat es im IS-LM-Modell, wenn<br />
a) die Investitionen nicht vom Zinssatz abhängen?<br />
i<br />
i0<br />
i1<br />
Investitionsfalle (B-K = senkrecht!):<br />
• I reagiert im relevanten Bereich nicht auf Zinsänderungen, z.B. auf Grund<br />
pessimistischer Erwartung [bzw. der EZU der Investitionen] (sehr niedrige interne<br />
Verzinsung r)<br />
• I ist damit exogen<br />
Y0<br />
Y0<br />
IS<br />
Y<br />
Y=Y d<br />
d<br />
0<br />
Y<br />
Y<br />
d<br />
= C(<br />
Y ) * I(<br />
i0)<br />
= Y1<br />
= C(<br />
Y ) + I(<br />
i1)<br />
37
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) die Zinselastizität der Geldnachfrage unendlich groß ist?<br />
• Der Zinssatz sie fix bei imin<br />
• d.h. im relevanten Bereich ist der Zinssatz sehr gering<br />
• Spekulationsmotiv:<br />
Da der Zinssatz sehr niedrig ist, sind die Kurswerte sehr hoch<br />
es wird erwatet, dass die Kurse fallen<br />
der erwatete Kurswert übersteigt den Zinsertrag<br />
die Geldhaltung wird präferiert<br />
unendlich starke Reaktion der Geld-NF auf den Zins.<br />
• Die Geld-NF ist damit unendlich zinselastisch<br />
• Y hat keinen Einfluss auf die Geld-NF, die Spekulationskasse ist entscheidend.<br />
• Wirtschaftssubjekte nehmen jede Geldmengenerhöhung ohne Zinsänderung auf.<br />
i<br />
imin<br />
LY0<br />
L Y1<br />
M<br />
p<br />
LM i<br />
M<br />
L,<br />
p<br />
imin<br />
Y0<br />
Y1<br />
LM<br />
Y<br />
38
Y d<br />
p<br />
p0<br />
p1<br />
p2<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 21 (Gesamtwirtschaftliche Nachfragefunktion)<br />
a) Stellen Sie die gesamtwirtschaftliche Nachfragefunktion graphisch dar und erläutern<br />
Sie Ihre Aussage.<br />
• Im IS-LM-Modell: p fix<br />
→ Berechnung eines GG für ein gegebenes PN p<br />
• jetzt: Variation des Preisniveaus (PN) p<br />
• Interpretation: Y d -Kurve gibt das GGige Realeinkommen des US/LM-Modells bei<br />
verschiedenen Preisniveaus<br />
→ andere Interpretation als in Mikro: dort: Zahlungsbereitschaft von<br />
Wirtschaftssubjekten (Verhaltensaussagen)<br />
• Alternative Interpretation: Die gesamtw. NF-Funktion ist der geometrische Ort aller<br />
p,Y-Kombinationen, für die sowohl der Geld- und WP-Markt, als auch die NF-Seite<br />
des Gütermarktes (EA-Modell) im GG sind.<br />
p<br />
Y d<br />
Y<br />
b) Leiten Sie die gesamtwirtschaftliche Nachfragefunktion graphisch aus dem IS-LM-<br />
Modell her.<br />
graphische Herleitung:<br />
Y0<br />
Y1<br />
Y2<br />
LM(p0)<br />
Y d<br />
IS<br />
Y<br />
LM(p1)<br />
Y<br />
LM(p2)<br />
p0 > p1 > p2<br />
• Der Keynas-Effekt liefert die ökonomische<br />
Erklärung für eine Bewegung auf der Y d -<br />
Kurve, d.h. er liefert den Zusammenhang<br />
zwischen p und Y d<br />
• Keynes-Effekt:<br />
( 1.)<br />
( 2.)<br />
M<br />
d<br />
d<br />
p ↓ → ↑→ B ↑→ KW ↑→ i ↓ → I ↑→ Y ↑<br />
p<br />
• Der Keynes-Effekt ist 2-fach störanfällig:<br />
(1.) Liquiditätsfalle<br />
(2.) Investitionsfalle<br />
39
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
c) Leiten Sie die gesamtwirtschaftliche Nachfragefunktion analytisch her, wenn<br />
folgendes Modell gegeben ist:<br />
L(Y,i) = 1,5Y – 100i S(Y) = 0,2Y I(i) = 4-40i M = 24<br />
analytische Herleitung:<br />
IS-Kurve: S( Y ) = I(<br />
i ) ⇔ 0,<br />
2Y<br />
= 4 − 40i<br />
⇔ Y = 20 − 200i<br />
um einsetzen<br />
zu können<br />
( + )<br />
( −)<br />
0,<br />
2Y<br />
− 4<br />
⇒ i = oder: i = 0, 1−<br />
0,<br />
005Y<br />
− 40<br />
M<br />
24<br />
24<br />
LM-Kurve: L( Y,<br />
i)<br />
= ⇔ 1,<br />
5Y<br />
−100i<br />
= ⇔ −100i<br />
= −1,<br />
5Y<br />
p<br />
p<br />
p<br />
24 1,<br />
5 1,<br />
5Y<br />
24<br />
⇔ i = + Y ⇔ i = −<br />
−100<br />
p 100 100 100 p<br />
Y d -Kurve:<br />
24<br />
24<br />
1 , 5Y<br />
− 100(<br />
0,<br />
1−<br />
0,<br />
005Y<br />
) = ⇒1,<br />
5Y<br />
−10<br />
+ 0,<br />
5Y<br />
=<br />
p<br />
p<br />
24<br />
d<br />
12<br />
2 Y = + 10 ⇒ Y = + 5<br />
p<br />
p<br />
40
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 22 (Gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion)<br />
Ermitteln Sie graphisch den Verlauf der gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion bei<br />
a) flexiblem Nominallohn<br />
• Zusammenhang zwischen Güterangebot (Produktion) und Preisniveau p<br />
• Produktion ist über die Produktionsfunktion mit der Beschäftigung verbunden (wie<br />
im KNK-Modell)<br />
w<br />
• Die Beschäftigung hängt aber vom Reallohn ab.<br />
p<br />
• Zwei Fälle:<br />
a) w flexibel<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
(analog zur Neoklassik) flexibler Nominallohn w.<br />
Reallohn konstant auf VB-Niveau; w passt sich an, d.h.<br />
w<br />
∆ p = ∆w,<br />
somit gilt: ∆ = 0 !<br />
p<br />
Y = Y(N) konstant<br />
starrer Nominallohn w<br />
w<br />
wenn p sich ändert, muss sich ändern.<br />
p<br />
Änderung von p hat Auswirkung auf die Beschäftigung:<br />
N<br />
d<br />
_<br />
d w d<br />
= N ( ) = N ( p)<br />
p<br />
( + )<br />
( −)<br />
Output hängt von p ab: Y = Y p)<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
*<br />
w0<br />
w1<br />
N d<br />
N<br />
p<br />
p0<br />
p1<br />
N *<br />
(<br />
(+ )<br />
Y S<br />
Y *<br />
Y<br />
Y =<br />
F K,<br />
N)<br />
( _<br />
41
) starrem Nominallohn<br />
w<br />
p<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
0<br />
N S<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
*<br />
_<br />
w<br />
w<br />
( ) 1<br />
p<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
N d<br />
p<br />
p1<br />
p*<br />
p0<br />
N *<br />
N<br />
Merke: Die kürzere Seite beschränkt die<br />
Beschäftigung<br />
Y S<br />
Y *<br />
( _<br />
Y<br />
F K,<br />
N)<br />
42
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 23 (Allgemeines Keynesianisches Modell)<br />
a) Stellen Sie das allgemeine Keynesianische Modell graphisch dar und interpretieren Sie<br />
es.<br />
• Bei F/H: „allgemeines Modell“ = VB-Fall<br />
aber: der VB-Fall ist nur ein Spezialfall<br />
besser: „keynesianisches Totalmodell“<br />
• Dieses umfasst alle Fälle:<br />
Keine Investitionsfalle, keine Liquiditätsfalle, flexible Löhne (es herrscht<br />
immer VB)<br />
Investitionsfalle<br />
Liquiditätsfalle<br />
Starre Löhne<br />
• Das Totalmodell bringt gesamtwirtschaftliche Angebots- und<br />
Nachfragefunktionen zusammen<br />
p ist endogen (im Gegensatz zum IS/LM-Modell)<br />
• Gemeinsame Betrachtung aller Märkte (vgl. Neoklassisches Gesamtmodell):<br />
Gütermarkt<br />
Geld- und Wertpapiermarkt<br />
Arbeitsmarkt<br />
• „Neoklassische Synthese“, d.h.<br />
Angebotsseite ist analog zur Neoklassik<br />
Nachfrageseite ist Keynesianisch (IS-LM-Modell, Y d -Kurve)<br />
a) VB-Fall<br />
•<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
*<br />
w*<br />
N d<br />
i*<br />
i<br />
p<br />
p*<br />
N<br />
N *<br />
Y*<br />
Y S<br />
Y *<br />
( _<br />
LM(p*)<br />
IS<br />
F K,<br />
N)<br />
Y<br />
Y d<br />
Y<br />
43
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
• im IS/LM: → Geld-NF ist zinselastisch, d.h. keine Liquiditätsfalle<br />
→ Investitions-NF ist zinselastisch, d.h. keine Investitionsfalle<br />
Y d hat fallenden Verlauf [ökonomisch: Der Keynes-Effekt ist nicht<br />
unterbrochen].<br />
• Arbeitsmarkt: → Angebot und NF bestimmen den Reallohn (fix)<br />
→ Nominallohn ist flexibel und passt sich an jedes Preisniveau an<br />
• senkrechter Verlauf der Y S -Kurve<br />
Interpretation: Unter den getroffenen Annahmen:<br />
• Bestimmt der Arbeitsmarkt das Beschäftigungsniveau und den Reallohn (wie im<br />
neoklassichen Fall)<br />
• keine Unterbeschäftigung möglich<br />
• durch die Beschäftigung ist über die Produktionsfunktion das Produktionsniveau<br />
(= Realeinkommen Y) festgelegt.<br />
• Die Y d -Kurve bestimmt das Preisniveau → dieses Preisniveau legt die Lage der<br />
LM-Kurve eindeutig fest, so dass Y s = Y d<br />
• Die Kausalität ist analog zum neoklassischen Modell<br />
• Das Says’sche Theorem gilt<br />
44
w<br />
p<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
b) Ermitteln Sie graphisch die Gleichgewichtswerte der endogenen Variablen im<br />
allgemeinen keynesianischen Modell<br />
(i) beim Vorliegen einer Investitionsfalle,<br />
(ii) beim Vorliegen einer Liquiditätsfalle,<br />
(iii) bei starrem Nominallohn.<br />
Unterbeschäftigungsfälle:<br />
• Unterbeschäftigung kann, muss aber nicht auftreten<br />
• Zwei Möglichkeiten:<br />
1) Y d vertikal (preisunelastisch)<br />
2) Y s preiselastisch (starrer Nominallohn)<br />
1. Fall: Y d -Kurve vertikal:<br />
N S<br />
N d<br />
p<br />
N<br />
N0<br />
N *<br />
Y0<br />
AL<br />
Y d<br />
F K,<br />
N)<br />
( _<br />
Y*<br />
Y S<br />
Y<br />
45<br />
• Es kommt zu (unfreiwilliger) AL,<br />
da die gesamtwirtschaftliche NF<br />
zu gering ist (Y0 < Y*)<br />
• U stellen nicht mehr Arbeiter als<br />
nötig um Y0 zu produzieren ein.<br />
Saysches Theorem gilt nicht!<br />
Die NF auf dem Gütermarkt<br />
bestimmt die BEschäftigung
2. Fall: Y s -Kurve preiselastisch:<br />
w<br />
p<br />
i<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
N S<br />
0<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
_<br />
w<br />
*<br />
N d<br />
p<br />
p*<br />
p0<br />
N<br />
N0<br />
N *<br />
Y d<br />
AL<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Y0<br />
Y S<br />
Y*<br />
Y<br />
F K,<br />
N)<br />
( _<br />
46<br />
• Preiselastische Y S bei fixiertem<br />
_<br />
w<br />
Nominallohn<br />
•<br />
w<br />
kann sich nicht mehr<br />
p<br />
unabhängig von p auf dem<br />
Arbeitsmarkt bilden!<br />
• Y S würde sich zurückkrümmen<br />
•<br />
w<br />
p<br />
_<br />
ist umgekehrt proportional<br />
zum PN p<br />
• Da die Beschäftigung vom Reallohn ( w ) abhängt, hängt sie hier von p ab.<br />
p<br />
Output hängt vom Preisniveau p ab. (d.h. steigender Verlauf der Y S -Kurve)<br />
nur für ein Preisniveau gilt Y S = Y d<br />
Begründung für eine vertikal verlaufende Y d -Kurve:<br />
Investitionsfalle: Liquiditätsfalle:<br />
p<br />
p0<br />
p1<br />
IS<br />
Y0 =Y1<br />
Y d<br />
Y0 =Y1<br />
LM(p0) LM(p1)<br />
Y<br />
Y<br />
i<br />
p<br />
p0<br />
p1<br />
IS<br />
Y d<br />
Y0<br />
Y0<br />
LM(p0) = LM(p1)<br />
Y<br />
Y
i<br />
LY L 0 Y1<br />
M<br />
M M i,<br />
p<br />
p 0<br />
p1<br />
i<br />
imin<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Y0<br />
LM(p0) = LM(p1)<br />
• Bei Investitions- und Liquiditätsfalle ist der Keynes-Effekt unterbrochen.<br />
kein Zusammenhang zwischen p und Y d .<br />
Y1<br />
Y<br />
47
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Aufgabe 24 (Geldpolitik)<br />
Diskutieren Sie die folgende These:<br />
Eine expansive Geldpolitik in Form einer Erhöhung der nominalen Geldmenge führt bei<br />
keynesianischer Unterbeschäftigung zu einer Erhöhung des Realeinkommens und damit<br />
zu einem Beschäftigungszuwachs.<br />
expansive Geldpolitik in Form einer Erhöhung der nominalen Geldmenge, d.h. M↑<br />
Geldpolitik im keynesianischen Totalmodell:<br />
→ VB-Fall (1)<br />
→ Investitionsfalle I<br />
→ Liquiditätsfalle (2) II<br />
→ starre Löhne III<br />
(1) Anmerkung: weitereichende Parallelen zum KNK-Modell!<br />
Anpassungsprozess:<br />
1.) M↑ → LM-Kurve verschiebt<br />
sich nach rechts<br />
2.) i↓ → I↑<br />
→gesamtwirtschaftliche NF↑<br />
3.) ÜNF auf Gütermarkt → p↑<br />
4.) p↑ → M ↓<br />
p 1<br />
5.) → LM-Kurve verschiebt sich<br />
nach links.<br />
w<br />
p<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
N S<br />
*<br />
w1<br />
i0 p↑<br />
i1<br />
p<br />
w*<br />
N d<br />
Y S<br />
LM0<br />
M↑<br />
→ Der Prozess dauert so lange, bis die LM-Kurve wieder ihre alte Lage erreicht<br />
→ Keynes-Effekt leistet genau das, was der Cambridge-Effekt in der Neoklassik leistet<br />
(M∗ 2 => p∗ 2)<br />
→ Geldpolitik hat keine realen Auswirkungen:<br />
w M<br />
M↑, p↑, w↑ aber: Y, , bleiben konstant<br />
p p<br />
→ Genau wie in Neoklassik<br />
i<br />
p1<br />
p*<br />
N<br />
N *<br />
Y *<br />
_<br />
IS<br />
F(<br />
N,<br />
K)<br />
LM1<br />
Y<br />
Y d Y<br />
0<br />
d 1<br />
48
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
→<br />
(2) Fälle mit potentieller Unterbeschäftigung<br />
I) Investitionsfalle<br />
Anpassungsprozess:<br />
1. expansive Geldpolitik verschiebt die LM-Kurve nach rechts<br />
2. IS-Kurve bestimmt alleine das Realeinkommen Y → i↓ =/=> I↑<br />
Keynes-Effekt ist unterbrochen; Zinssenkungen haben keinen Einfluss auf die<br />
Investitions-NF und damit auch keinen Einfluss auf Y d .<br />
es gibt keine Möglichkeit, die Y d durch expansive Geldpolitik nach rechts zu<br />
verschieben → Geldpolitik ist unwirksam!<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
N d<br />
i<br />
AL<br />
p<br />
N<br />
N0<br />
NVB<br />
IS<br />
Y d<br />
Y0<br />
MT<br />
Y S<br />
YVB<br />
LM1<br />
LM0<br />
Y<br />
_<br />
F<br />
( N,<br />
K)<br />
Y<br />
49
i<br />
imin<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
II) Liquiditätsfalle (nur IS-LM-Modell, Rest bleibt gleich!)<br />
(Totalmodell wie bei Investitionsfalle)<br />
Fazit: Geldpolitik ist bei Investitions- und Liquiditätsfalle unwirksame, da der Keynes-<br />
Effekt unterbrochen ist.<br />
III) Starre Löhne<br />
w<br />
p<br />
LM0<br />
IS M T<br />
w<br />
( ) 0<br />
p<br />
w<br />
( ) VB<br />
p<br />
N S<br />
_<br />
w<br />
N d<br />
LM1<br />
Anpassungsprozess:<br />
1.) M↑ → M → LM-Kurve verschiebt sich nach rechts<br />
↑<br />
p<br />
2.) i↓ → I↑ → Y d ↑ [Y d 0 → Y d 1]<br />
Y<br />
• Expansive Geldpolitik <br />
50<br />
M LM-Kurve<br />
↑<br />
p<br />
verschiebt sich nach rechts.<br />
Aber:<br />
→ Keynes-Effekt ist unterbrochen<br />
→ Wirtschaftssubjekte halten zusätzliche<br />
Kasse ohne Wertpapiere nachzufragen<br />
(Absolute Liquiditätspräferenz).<br />
→ Dadurch ändert sich der Zins nicht!<br />
→ Keine Änderung des Realeinkommens,<br />
obwohl die Investitionen prinzipiell<br />
zinselastisch sind.<br />
i LM LM1<br />
IS<br />
M↑<br />
p<br />
N<br />
N0<br />
Y d<br />
NVB<br />
Y0<br />
YVB<br />
Y1<br />
Y S<br />
p↑<br />
Y d 1<br />
Y<br />
Y0 YVB Y<br />
_<br />
F(<br />
N,<br />
K)
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
3.) durch steigende NF nimmt das PN zu.<br />
w<br />
4.) Flexible Reallöhne: p↑ → ↓ → Gütermarktangebot nimmt zu<br />
p<br />
5.) → GG-Einkommen steigt<br />
→ durch die Erhöhung des PN verschiebt sich die LM-Kurve wieder etwas nach<br />
links.<br />
→ Geldpolitik ist wirksam (Y↑), wird aber durch höhere Preise bzw. geringere<br />
Reallöhne „erkauft“<br />
→ monetäre Änderungen haben reale Auswirkungen, d.h. ergibt hier keine<br />
Dichotomie mehr.<br />
→ AL kann hier bekämpft werden, dadurch dass die nominale Geldmenge erhöht<br />
wird.<br />
51
Zusammenfassung zur Fiskalpolitik<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
w<br />
( )<br />
p<br />
*<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
_<br />
w<br />
N d<br />
i<br />
i0<br />
p<br />
p0<br />
p*<br />
N<br />
N*<br />
p↑<br />
Y S<br />
GG<br />
ÜNF<br />
Y*<br />
LM1<br />
IS0<br />
_<br />
F ( N,<br />
K)<br />
Y d 0<br />
Y d<br />
LM0<br />
VB-Fall → kreditfinanzierte Fiskalpolitik<br />
1) Ausgangssituation zeichnen<br />
2) G stiegt: Was bedeutet das für die IS-Kurve?<br />
Y = Caut + C’∗ Y + I(i) + G<br />
Caut<br />
+ I(<br />
i)<br />
+ G<br />
Y ( 1−<br />
C'<br />
) = Caut<br />
+ I(<br />
i)<br />
+ G ⇔ Y =<br />
das ist die neue IS-Kurve<br />
1−<br />
C<br />
∆Y<br />
1<br />
1<br />
= ⇔ ∆Y<br />
= ∗ ∆G<br />
∆G<br />
1−<br />
C'<br />
1−<br />
C'<br />
Elementarer Multiplikator<br />
3) IS-Kurve verschieben, Zins konstant halten, man gelangt zu Punkt 1<br />
4) Kein GG: i muss steigen! Begründung: G↑ → Y↑ → LT↑ → i↑, damit LS↓<br />
I wird hierdurch verdrängt, so dass Y sinkt<br />
→ man wandert zu Punkt 2 → IS-LM-GG<br />
5) Bei altem PN gilt neues Realeinkommen aus dem IS-LM-Modell<br />
→ Y d -Kurve verschiebt sich nach rechts (um weniger als IS-Kurve, da durch die<br />
Zinssteigerung Investitionen verdrängt werden)<br />
→ Man ist in Punkt 3<br />
IS1<br />
Y<br />
52
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
6) ÜNF auf dem Gütermarkt → p steigt → man wandert zum Punkt GG<br />
7) Da p steigt, verschiebt sich die LM-Kurve nach links<br />
→ neues IS-LM-GG bei Punkt GG.<br />
8) Also: Y konstant, i steigt, p steigt, w steigt, Investitionen werden verdrängt, C bleibt<br />
konstant.<br />
53
Steuerfinanzierte Fiskalpolitik<br />
Was passiert jetzt mit der IS-Kurve?<br />
C = C<br />
Y = C<br />
+ C'<br />
( Y − T )<br />
Caut<br />
+ I(<br />
i)<br />
Y = + G<br />
1−<br />
C'<br />
∆Y<br />
= 1 ⇔ ∆Y<br />
= ∆G<br />
∆G<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Y = C + I + G,<br />
T = G,<br />
verfügbaresEinkommen<br />
: Y − T<br />
aut<br />
aut<br />
+ C'<br />
( Y − G)<br />
+ I(<br />
i)<br />
+ G ⇔ ( 1−<br />
C'<br />
) Y = C<br />
aut<br />
+ G(<br />
1−<br />
C'<br />
) + I(<br />
i)<br />
→ Verschiebung der IS-Kurve im selben Ausmaß wie ∆ G nach rechts.<br />
→ siehe Zeichnung: anstatt G<br />
C ∆ ∗<br />
1<br />
nur noch ∆ G !!!<br />
1−<br />
'<br />
Zeichnung funktioniert analog, allerdings schwächeres Ausmaß der Verschiebung der<br />
IS-Kurve.<br />
Insgesamt: Wirkungen sind analog zur Kreditfinanzierung, aber es wird auch Konsum<br />
verdrängt und die Erhöhung von i und p ist schwächer.<br />
Grund für die Verschiebung der Y d ∆G<br />
= 1<br />
-Kurve (hier die effektive NF-K.): wenn<br />
∆T<br />
= 1<br />
→ Güter-NF steigt um eine Einheit → NF sinkt um C’<br />
→ Nettoeffekt ist positiv<br />
54
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Investitionsfalle, Unterbeschäftigung, kreditfinazierte Fiskalpolitik<br />
• IS-Kurve verschiebt sich um G<br />
C ∆ ∗<br />
1<br />
nach rechts<br />
1−<br />
'<br />
• Neues IS/LM-GG bei einem höheren Zins und höherem Realeinkommen<br />
• Neues Y bei konstantem PN<br />
→ Y d -Kurve verschiebt sich nach rechts und zwar im selben Maß wie IS,<br />
da die Investitionen nicht auf die Zinssenkung reagieren<br />
• Es kann mehr Arbeit eingesetzt werden, um das höhere Y zu produzieren<br />
• Also: Fiskalpolitik, es kommt zu Zinssteigerungen<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
N d<br />
N<br />
i<br />
p<br />
N0<br />
AL<br />
Y d<br />
IS<br />
Y0<br />
G<br />
C ∆ ∗<br />
1<br />
1−<br />
'<br />
Y*<br />
Y S =Y d<br />
LM<br />
Y<br />
_<br />
F ( N,<br />
K)<br />
Y<br />
55
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
Investitionsfalle, Unterbeschäftigung, steuerfinanzierte Fiskalpolitik<br />
• IS-Kurve verschiebt sich um ∆ G [nicht um G<br />
C ∆ ∗<br />
1<br />
!] nach rechts<br />
1−<br />
'<br />
→ Y d und Y steigen um ∆ G .<br />
→ Haavelmo Theorem<br />
• Ingesamt: Fiskalpolitik wirksam, es kommt zu Zinssteigerungen<br />
Liquiditätsfalle, Unterbeschäftigung<br />
i<br />
IS<br />
IS1<br />
LM<br />
Y<br />
• Analoges Prinzip zur<br />
Investitionsfalle<br />
• Hier: i ändert sich nicht,<br />
deshalb keine Verdrängung<br />
der Investitionen<br />
• Keditfinanzierte Fiskalpolitik<br />
wirkt stärker<br />
56
Starre Nominallöhne<br />
<strong>Makro</strong>-<strong>Übung</strong><br />
• LM-Kurve verschiebt sich nach links → man kommt zum Punkt GG<br />
• Grund für steigendes Y: Durch gestiegenes PN sinkt der Reallohn<br />
→ also wird mehr Arbeit nachgefragt<br />
→ Güterangebot steigt<br />
w<br />
• Also: N steigt, Zins steigt, p steigt, sinkt<br />
p<br />
• „Höhere Beschäftigung durch Inflation“.<br />
w<br />
p<br />
N S<br />
_<br />
w<br />
N d<br />
N<br />
i<br />
p<br />
Y d<br />
N0<br />
IS<br />
Y d 1<br />
Y*<br />
GG<br />
Wirtschaftlichkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen<br />
Y*<br />
1<br />
p↑<br />
2<br />
LM1<br />
Y S<br />
LM<br />
IS1<br />
Y0 Y<br />
_<br />
F(<br />
N,<br />
K)<br />
Geldpolitik<br />
Steuerfinanzierte<br />
Fiskalpolitik<br />
Kreditfinanzierte<br />
Fiskalpolitik<br />
KNK-Modell ○ ○ ○<br />
VB ○ ○ ○<br />
IF<br />
LF<br />
○<br />
○<br />
++<br />
++<br />
Haavelmo<br />
Theorem<br />
+++<br />
+++<br />
SL ++ + ++<br />
Y<br />
57