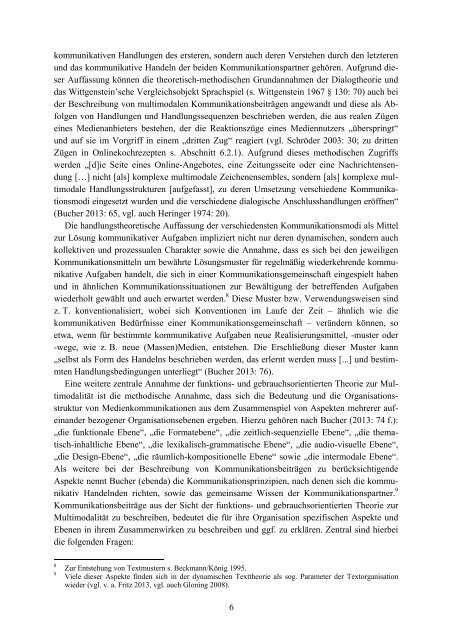Beitrag als PDF-Dokument herunterladen. - Festschrift Gerd Fritz
Beitrag als PDF-Dokument herunterladen. - Festschrift Gerd Fritz
Beitrag als PDF-Dokument herunterladen. - Festschrift Gerd Fritz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kommunikativen Handlungen des ersteren, sondern auch deren Verstehen durch den letzteren<br />
und das kommunikative Handeln der beiden Kommunikationspartner gehören. Aufgrund dieser<br />
Auffassung können die theoretisch-methodischen Grundannahmen der Dialogtheorie und<br />
das Wittgenstein’sche Vergleichsobjekt Sprachspiel (s. Wittgenstein 1967 § 130: 70) auch bei<br />
der Beschreibung von multimodalen Kommunikationsbeiträgen angewandt und diese <strong>als</strong> Abfolgen<br />
von Handlungen und Handlungssequenzen beschrieben werden, die aus realen Zügen<br />
eines Medienanbieters bestehen, der die Reaktionszüge eines Mediennutzers „überspringt“<br />
und auf sie im Vorgriff in einem „dritten Zug“ reagiert (vgl. Schröder 2003: 30; zu dritten<br />
Zügen in Onlinekochrezepten s. Abschnitt 6.2.1). Aufgrund dieses methodischen Zugriffs<br />
werden „[d]ie Seite eines Online-Angebotes, eine Zeitungsseite oder eine Nachrichtensendung<br />
[…] nicht [<strong>als</strong>] komplexe multimodale Zeichenensembles, sondern [<strong>als</strong>] komplexe multimodale<br />
Handlungsstrukturen [aufgefasst], zu deren Umsetzung verschiedene Kommunikationsmodi<br />
eingesetzt wurden und die verschiedene dialogische Anschlusshandlungen eröffnen“<br />
(Bucher 2013: 65, vgl. auch Heringer 1974: 20).<br />
Die handlungstheoretische Auffassung der verschiedensten Kommunikationsmodi <strong>als</strong> Mittel<br />
zur Lösung kommunikativer Aufgaben impliziert nicht nur deren dynamischen, sondern auch<br />
kollektiven und prozessualen Charakter sowie die Annahme, dass es sich bei den jeweiligen<br />
Kommunikationsmitteln um bewährte Lösungsmuster für regelmäßig wiederkehrende kommunikative<br />
Aufgaben handelt, die sich in einer Kommunikationsgemeinschaft eingespielt haben<br />
und in ähnlichen Kommunikationssituationen zur Bewältigung der betreffenden Aufgaben<br />
wiederholt gewählt und auch erwartet werden. 8 Diese Muster bzw. Verwendungsweisen sind<br />
z. T. konventionalisiert, wobei sich Konventionen im Laufe der Zeit – ähnlich wie die<br />
kommunikativen Bedürfnisse einer Kommunikationsgemeinschaft – verändern können, so<br />
etwa, wenn für bestimmte kommunikative Aufgaben neue Realisierungsmittel, -muster oder<br />
-wege, wie z. B. neue (Massen)Medien, entstehen. Die Erschließung dieser Muster kann<br />
„selbst <strong>als</strong> Form des Handelns beschrieben werden, das erlernt werden muss [...] und bestimmten<br />
Handlungsbedingungen unterliegt“ (Bucher 2013: 76).<br />
Eine weitere zentrale Annahme der funktions- und gebrauchsorientierten Theorie zur Multimodalität<br />
ist die methodische Annahme, dass sich die Bedeutung und die Organisationsstruktur<br />
von Medienkommunikationen aus dem Zusammenspiel von Aspekten mehrerer aufeinander<br />
bezogener Organisationsebenen ergeben. Hierzu gehören nach Bucher (2013: 74 f.):<br />
„die funktionale Ebene“, „die Formatebene“, „die zeitlich-sequenzielle Ebene“, „die thematisch-inhaltliche<br />
Ebene“, „die lexikalisch-grammatische Ebene“, „die audio-visuelle Ebene“,<br />
„die Design-Ebene“, „die räumlich-kompositionelle Ebene“ sowie „die intermodale Ebene“.<br />
Als weitere bei der Beschreibung von Kommunikationsbeiträgen zu berücksichtigende<br />
Aspekte nennt Bucher (ebenda) die Kommunikationsprinzipien, nach denen sich die kommunikativ<br />
Handelnden richten, sowie das gemeinsame Wissen der Kommunikationspartner. 9<br />
Kommunikationsbeiträge aus der Sicht der funktions- und gebrauchsorientierten Theorie zur<br />
Multimodalität zu beschreiben, bedeutet die für ihre Organisation spezifischen Aspekte und<br />
Ebenen in ihrem Zusammenwirken zu beschreiben und ggf. zu erklären. Zentral sind hierbei<br />
die folgenden Fragen:<br />
8 Zur Entstehung von Textmustern s. Beckmann/König 1995.<br />
9 Viele dieser Aspekte finden sich in der dynamischen Texttheorie <strong>als</strong> sog. Parameter der Textorganisation<br />
wieder (vgl. v. a. <strong>Fritz</strong> 2013, vgl. auch Gloning 2008).<br />
6