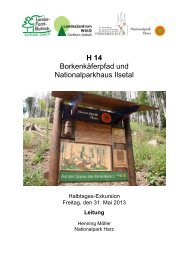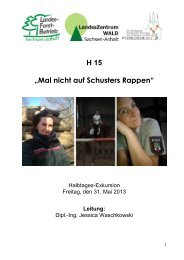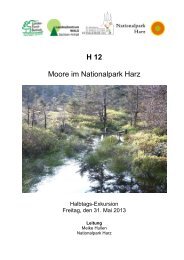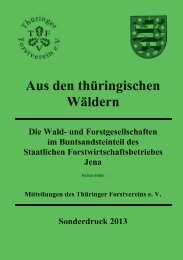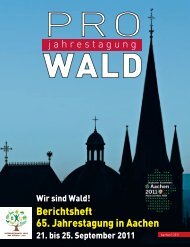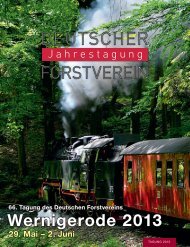Der Weg zur erfolgreichen Tannenwirtschaft - Deutscher Forstverein
Der Weg zur erfolgreichen Tannenwirtschaft - Deutscher Forstverein
Der Weg zur erfolgreichen Tannenwirtschaft - Deutscher Forstverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ein Zeitzeuge berichtet:<br />
<strong>Der</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zur</strong> <strong>erfolgreichen</strong> <strong>Tannenwirtschaft</strong> –<br />
Analysen, Strategien und Maßnahmen.<br />
I. Die Pforzheimer Tagung des <strong>Forstverein</strong>s 1979<br />
Vor 30 Jahren behandelte der baden-württembergische <strong>Forstverein</strong> auf seiner Jahrestagung in<br />
Pforzheim das Thema: "Die Tanne eine verlorene Baumart?" (1)<br />
Hintergrund der Fragestellung - manche hielten das Fragezeichen für überflüssig - waren der stetige<br />
Rückgang des Tannenanteils in den Wäldern des Landes, die geringen Erfolge der<br />
Tannenverjüngung trotz vieler Zäune und das heraufziehende Problem der Tannenerkrankung.<br />
Entsprechend war das Tagungsprogramm gestaltet:<br />
Prof. Dr. H. Mayer, Waldbauprofessor der Universität Wien, sprach "Zur waldbaulichen<br />
Bedeutung der Weißtanne im mitteleuropäischen Bergwald" und nannte die Entwicklung des<br />
Tannenanteils ist in vielen Regionen ihres natürlichen Verbreitungsgebiets besorgniserregend: "Bei<br />
gleichbleibender Entwicklung ist, von lokalen Ausnahmen abgesehen, die Tanne eine verlorenen<br />
Baumart".<br />
Als Ursachen des Tannenrückgangs bezeichnete Prof. H. Mayer vor allem<br />
- die unzweckmäßige waldbauliche Behandlung und<br />
- jagdwirtschaftliche Schalenwilddichten. "Heute ist das Wild des Übels größtes<br />
beim Tannenrückgang". Ohne die nachhaltige und eindeutige Lösung der Wildfrage stirbt im<br />
alpinen Bergwald die Tanne weitgehend aus.<br />
Die Tanne muss aus dem Kreis der standortsheimischen Baumarten jedoch nicht abgeschrieben<br />
werden, wenn standorts- und bestandesangepasste Verjüngungs- und Bestandespflege-Maßnahmen<br />
ergriffen werden und die Wildfrage gelöst wird.<br />
Eine intensive, der Tanne angepasste Waldpflege ist auch die beste Prophylaxe gegen das<br />
Tannensterben.<br />
Dr. F. Kälble, Leiter der Forstdirektion Karlsruhe, referierte über<br />
"Die <strong>Tannenwirtschaft</strong> auf standörtlicher Grundlage in Baden-Württemberg".<br />
Er bezeichnete die Tanne als prädestinierte Nadelbaumart auf Pseudogleyen bei geeignetem<br />
Regionalklima, als ideale Mischbaumart mit stabilisierender und bodenmeliorierender Wirkung.<br />
Mischbestände aus Tanne, Fichte und Buche erbringen hohe Erträge und erfüllen Schutz- und<br />
Erholungsfunktionen optimal.<br />
Als entscheidende Faktoren beim Rückgang der Tannen werden Fehler bei der waldbaulichen<br />
Behandlung (viel zu schwache Eingriffe und Niederdurchforstung) sowie überhöhte<br />
Schalenwildbestände angesehen.<br />
Kälble schlägt vor, die waldbauliche Behandlung der Tanne am Plenterprinzip aus<strong>zur</strong>ichten. Ohne<br />
großflächige Naturverjüngung geht die Tanne verloren.<br />
Dr. G. Petri, Waldbau- und Jagdreferent der Forstdirektion Karlsruhe, vertiefte das<br />
Schalenwildproblem in seinem Vortrag "<strong>Der</strong> Einfluss des Schalenwilds auf die Tannennachzucht<br />
im Schwarzwald". Er verglich die Entwicklung der Schalenwildbestände und der Tannenanteile im<br />
Schwarzwald und kommt zum Schluss, dass das Wild heute Hauptursache des Tannenverlustes ist.<br />
Hohe Abschüsse und umfangreiche Zäunungen in einzelnen Forstämtern zu Beginn der 1960er<br />
Jahre haben gezeigt, dass der Teufelskreis von überhöhtem Wildbestand, starkem Verbiss und<br />
1<br />
1
mangelnder Äsung durchbrochen werden kann. Dann ist es möglich, nach Öffnung der Zäune die<br />
Tanne auf der Großfläche ohne Zaunschutz wieder natürlich zu verjüngen.<br />
Tannenverluste im fortgeschrittenen Bestandesalter sind auf die unterschiedliche Wuchsdynamik<br />
und falsche Behandlung der Tanne im Mischbestand <strong>zur</strong>ückzuführen. Biotische Schäden und<br />
Umwelteinflüsse können zudem mitwirken.<br />
Dr. E. König und Dr. F-H. Evers, beide Abteilungsleiter der FVA, berichteten über die noch<br />
jungen und vorläufigen Erkenntnisse <strong>zur</strong> Tannenerkrankung (1) und wiesen auf einen<br />
wahrscheinlichen Ursachenkomplex biotischer und abiotischer Natur hin, eine Hypothese, die von<br />
der FVA in der Folge nie verlassen wurde.<br />
Die Referenten der Pforzheimer Tagung 1979 waren sich also weitgehend einig:<br />
Die unzweckmäßige waldbauliche Behandlung der Tanne und überhöhte Schalenwildbestände sind<br />
die wesentlichen Ursachen des Rückgangs der Tannen.<br />
<strong>Der</strong> Einfluss der Luftschadstoffe bedarf noch der Klärung.<br />
II. Analyse<br />
Wenn wir in der Waldbauliteratur etwas weiter <strong>zur</strong>ückblättern, dann finden wir ähnliche<br />
Erklärungen des Tannenrückgangs durch frühere Waldbauexperten:<br />
E. Zentgraf (2), ehemaliger Freiburger Waldbauprofessor, nennt vier Faktoren: Wildverbiss,<br />
Krankheiten, Veränderungen des Bodenzustandes und Fehler in der waldbaulichen Behandlung.<br />
Für die Tanne existenzbedrohend sind nach seiner Meinung<br />
- der gleichaltrige Reinbestand<br />
- die rasche Abdeckung der Verjüngung und<br />
- die Durchpflanzung der Verjüngung mit Fichten.<br />
Tannen in älteren Mischbeständen sind meist 2-3 Jahrzehnte älter als Fichten und Buchen. "<strong>Der</strong><br />
Tannenanteil unserer Altbestände (v.a. im Schwarzwald) besteht aus ehemaligen Vorwüchsen".<br />
Von diesen auch heute noch (wieder) gültigen Vorstellungen wich sein Nachfolger im Amt des<br />
Waldbauprofessors in Freiburg, F. W. Bauer (3), deutlich ab. Er schrieb als damaliger Leiter der<br />
Forstdirektion Freiburg in den Waldbaugrundsätzen 1948: "Die Tanne ist und bleibt die<br />
Charakterbaumart des Schwarzwaldes. Sie soll in den oberen Lagen Hauptholzart bleiben. <strong>Der</strong><br />
badische Waldbau strebt grundsätzlich Naturverjüngung an. Eine wesentliche Ausdehnung des<br />
Femelbetriebes wäre unter den in Baden gegebenen Bedingungen weder wirtschaftlich noch<br />
betriebstechnisch zu rechtfertigen“.<br />
M. Scheifele (5) stellte als Waldbaureferent der baden-württembergischen Landesforstverwaltung<br />
bei einer Fortbildungsveranstaltung 1965 seine Grundgedanken und waldbaulichen Ziele vor und<br />
sagte zum Thema "Tanne":<br />
Die LFV betrachtet die Erhaltung und Wiedereinbringung der Tanne als einen Schwerpunkt ihrer<br />
Arbeit. <strong>Der</strong> Rückgang der Tanne ist neben dem Wild v. a. auch der falschen waldbaulichen<br />
Behandlung zuzuschreiben. Statt Verjüngungshetze ist ein Verjüngungszeitraum von 20-30 Jahren<br />
vorzusehen. Das eng begrenzte saumbetonte Vorgehen soll aufgegeben und <strong>zur</strong> frühzeitigen,<br />
großflächigen Verjüngung unter Schirm, meist nach Zäunung übergegangen werden. Die besten<br />
Verhältnisse zu ihrem Gedeihen findet die Tanne bei Ungleichaltrigkeit, Stufigkeit und Mischung,<br />
möglichst mit Buche und Fichte.<br />
Dieser durchaus tannenfreundlichen Haltung steht dann eine für die Tanne gefährliche Aussage<br />
entgegen: "Die Fichte ist weiterhin der Brotbaum. <strong>Der</strong> Fichte ist die standörtlich maximal<br />
mögliche Fläche zuzuweisen. Auf das große Betriebsrisiko ist Rücksicht nehmen, i.d.R. durch<br />
Mischbestände“.<br />
2<br />
2
Wichtige Hinweise zum Tannenrückgang liefert auch die fernere Waldbaugeschichte:<br />
Beachtenswert ist die Tatsache, dass die großflächigen Exploitationshiebe im 18. Jahrhundert,<br />
die damals hohen Rotwildbestände und die intensive Waldweide den Tannenanteil im<br />
Nordschwarzwald nicht <strong>zur</strong>ückwarfen. Bei der ersten systematischen Waldzustandserhebung im<br />
württembergischen Staatswald (dem so genannten Forstetat von 1778) wurde - wohlgemerkt: nach<br />
der säkularen Waldverwüstung - ein Tannenanteil von etwa 40 % ermittelt (6). Das entspricht etwa<br />
den Verhältnissen im Naturwald. <strong>Der</strong> Tannennachwuchs hat demnach unter dem damaligen rüden<br />
Holzeinschlag mit nachfolgender Köhlerei, und unter dem starken Verbiss durch Weidevieh und<br />
Wild offensichtlich wenig gelitten, weil man mit der ankommenden Naturverjüngung noch<br />
allgemein zufrieden war. Die fehlende Konkurrenz durch die Fichte dürfte dafür entscheidend<br />
gewesen sein, eine These, die bisher selten erwähnt und diskutiert wurde.<br />
Seit etwa 1830 erfolgte ein systematischer Aufbau der devastierten Wälder. Die Großkahlschläge<br />
und die ungeregelte Plenterung wurden unter dem Einfluss von Hartig durch den Großschirmschlag<br />
mit Naturverjüngung ersetzt. Die Weiderechte wurden abgelöst, die hohen Wildbestände reduziert<br />
und nach 1848 war das Schalenwild weitgehend ausgerottet. Saat und Pflanzung von Fichten und<br />
Forchen, spielten dann in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine zunehmend größere Rolle. Aber<br />
noch immer galt das Ziel, die Tanne im Schwarzwald zu erhalten und zu fördern.<br />
Mit Erfolg: 1900 sind immer noch 40 % der Fläche des württembergischen Staatswaldes im<br />
Schwarzwaldes mit Tannen, 38 % mit Fichten bestockt (7). Einen ähnlich hohen Tannenanteil<br />
ermittelte Petri (8) für das Jahr 1880 im Staatswald des Nordschwarzwalds mit 41 %, und Gerwig<br />
(9) schätzt den Tannenanteil im badischen Schwarzwald 1868 auf 30 %.<br />
Fazit: <strong>Der</strong> Tannenanteil blieb im 19. Jahrhundert trotz zunehmender Fichtenkonkurrenz, aber dank<br />
spürbarer Entlastung vom Verbiss durch Wild- und Weidevieh relativ konstant.<br />
Anders verlief die Entwicklung in Sachsen und Thüringen, wo Kahlschlagsbetrieb und<br />
Fichtenpflanzung (rationelle sächsische Kahlschlagswirtschaft) die Tanne innerhalb einer<br />
Waldgeneration nahezu ausrotteten.<br />
Um 1900 war der Wiederaufbau der devastierten Wälder vollzogen. Mit steigendem<br />
Holzvorrat sank rein rechnerisch die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Die Faustmänner und<br />
Bodenreinerträgler, die von Sachsen kommend auch in Süddeutschland ihre Nachfolger fanden,<br />
erreichten mit ihren Rechenmodellen, dass die alten Wälder, die "faulen Gesellen", verschwanden.<br />
Das Renditedenken gewann die Oberhand, die Fichte war zum Brotbaum der Forstwirtschaft<br />
geworden. Immer noch waren Naturverjüngung und Mischbestände hier im Land wichtige Ziele.<br />
Wagner in Württemberg und Philipp in Baden entwickelten Waldbausysteme, mit deren Hilfe<br />
diese Ziele erreicht werden sollten. Es half aber alles nichts. Die Verjüngung am Saum und das<br />
hohe Verjüngungstempo begünstigten die Fichte (im Südschwarzwald auch die Buche). Die Tanne<br />
blieb <strong>zur</strong>ück und verlor im Lauf des Bestandeslebens immer mehr an Boden. Insgesamt hat die<br />
Tanne im Lauf des 20. Jahrhunderts mehr als die Hälfte ihrer Fläche verloren.<br />
Einen wissenschaftlichen Nachweis der Gefährdung der Tanne durch die Fichte erbrachte Hink<br />
1971 (10). Er untersuchte das Wachstum von Fichte und Tanne auf den wichtigsten<br />
Standortseinheiten des EWB´s "Flächenschwarzwald" und fand, dass die Tanne auf keiner der<br />
untersuchten Flächen zu irgendeiner Zeit ihrer Entwicklung die Höhe der (gleichalten) Fichte<br />
erreicht. Die Höhe der Tanne im Alter 100 liegt im Mittel um 4,2 m unter der Fichte. Je schwieriger<br />
der Standort, umso geringer ist zwar die Differenz, aber unter durchschnittlichen Verhältnissen<br />
wurde die Tanne bei den damals herrschenden Verjüngungs- und Pflegeverfahren von der Fichte<br />
überwachsen.<br />
3<br />
3
Auch die FE-Statistiken zeigen diesen Prozess der andauernden Verdrängung der Tannen. Im Lauf<br />
von 20 Jahren gehen beim Vergleich einer Altersklasse mit den Werten der nächsthöheren<br />
Altersklasse erhebliche Tannenflächen verloren.<br />
So sinkt zum Beispiel der Tannenanteil von der II. AK (1961/70) <strong>zur</strong> III. AK (1981/90) von 16 auf<br />
13 % (grün markiert). Dadurch erklären sich der Rückgang der Tanne im AK-Wald um etwa 2<br />
Prozentpunkte pro Jahrzehnt (blau markiert). Die Übersicht zeigt auch (rot markiert) den Zeitraum<br />
des geringsten Tannennachwuchses in den Kriegs- und Nachkriegsjahren.<br />
Übersicht<br />
Tannen und Altersklassen im Staats- und Körperschaftswald ( Wuchsgebiet Schwarzwald in %)<br />
I II III IV V VI VII u. älter AK-Wald PLW<br />
1961/70 15 16 22 25 29 32 30 22 57<br />
1971/80 16 12 17 22 27 28 28 20 55<br />
1981/90 18 11 13 19 23 26 24 18 49<br />
1991/00 21 14 10 16 20 24 23 17 35<br />
Verschärft wurde diese Entwicklung durch die Folgen des Reichsjagdgesetzes 1934. Die Reh- und<br />
Rotwildbestände wuchsen in Zeitkürze auf ein Vielfaches ihres natürlichen und waldverträglichen<br />
Bestandes heran. Sie erreichten bereits in den 1950er Jahren eine Höhe, die den Waldbau hinter<br />
Zäune verbannte und großflächig gute waldbauliche Ergebnisse verhinderte (11).<br />
Mit den Überhieben der Kriegs- und Nachkriegszeit hielt auch der Großkahlschlag wieder Einzug<br />
im Land und das unverzagte Bemühen um Mischwälder auf den Kahlflächen endete trotz großer<br />
Zäune überwiegend beim Fichtenwald. Dies war, wie schon erwähnt, die Zeit der stärksten<br />
Tannenverluste (12).<br />
In den 1980er Jahren verlangte der „kranke Wald“ große Aufmerksamkeit und band viele Kräfte.<br />
Die Unsicherheit über die Ursachen und die weitere Entwicklung der neuartigen Waldschäden, wie<br />
das ursprüngliche Tannensterben später genannt wurde, war groß. Die Intensivierung der<br />
Erforschung der Ursachen stand im Vordergrund. Die Forschungskapazität der FVA wurde<br />
ausgeweitet, in Karlsruhe wurde 1983 das „Europäische Forschungszentrum für Maßnahmen <strong>zur</strong><br />
Luftreinhaltung (PEF)“ gegründet und mit reichlichen Forschungsmitteln von Land und Bund<br />
sowie der Europäischen Gemeinschaft ausgestattet.<br />
Das seit 1977 bestehende Netz von Dauerbeobachtungsflächen wurde erweitert und, nachdem seit<br />
1982 auch Fichten und Laubbäume, Krankheitssymptome zeigten, wurde 1983 eine landesweite<br />
Schadensinventur auf Stichprobenbasis und eine Befliegung mit Infrarot-Farbfilm-Filmen<br />
durchgeführt. Die Auswertung des umfangreichen Datenmaterials durch die FVA führte zu der<br />
Hypothese, dass die Luftverschmutzung ein maßgeblicher Verursacher der Walderkrankung ist.<br />
Schöpfer und Hradetzky haben 1984 über diesen "Indizienbeweis" berichtet (13).<br />
In den Medien fand die Walderkrankung große Beachtung. Horrorszenarien bestimmten das Bild.<br />
Es war nicht leicht, forstpolitisch und waldbaulich Kurs zu halten.<br />
Die Landesforstverwaltung vertrat, gestützt durch die Beratung der FVA, (die bei Minister Weiser<br />
eine hohe Wertschätzung genoss), die These vom vielfältigen Ursachenkomplex. In der Broschüre<br />
"Walderkrankung und Immissionseinflüsse" des MLR wurde 1983 die forstliche Praxis und die<br />
Öffentlichkeit über mögliche Kausalketten beim "Waldsterben" informiert.<br />
4<br />
4
Moosmayer wies frühzeitig und andauernd auf das vielfältige Wirkungsgefüge hin:<br />
"Verantwortlich ist ein Ursachenkomplex aus abiotischen und biotischen Faktoren, unter denen die<br />
Luftschadstoffe eine entscheidende Rolle spielen (14).<br />
In der Konsequenz hat die Landesregierung eine schnelle und wesentliche Reduktion der<br />
Luftschadstoffe gefordert und partiell auch erreicht.<br />
Fassen wir das Ergebnis der Analyse zusammen,<br />
so ergibt sich, dass der Rückgang der Tanne sich im 20. Jahrhundert ereignete.<br />
Sie hat in diesem Zeitraum über die Hälfte ihrer Fläche verloren.<br />
Die treibenden Kräfte waren:<br />
- Ein nicht tannengemäßer Waldbau, insbes. durch kurzfristige Verjüngungen,<br />
wie sie für Saumhiebe aller Art typisch sind und im 20. Jahrhundert üblich waren. Dadurch<br />
wurden v. a. die Fichten begünstigt und die Tannen im Mischbestand <strong>zur</strong>ückgedrängt.<br />
Verschlimmert wurde die Lage durch großflächige Kahlhiebe (Forstreservefondhiebe,<br />
kriegsbedingte Überhiebe, F- und E-Hiebe) und schließlich gegen Ende des Jahrhunderts<br />
durch die Jahrhundertstürme. Mitverantwortlich war auch eine un<strong>zur</strong>eichende<br />
Bestandespflege.<br />
- Über ein halbes Jahrhundert lang haben zudem überhöhte Rehwildbestände die<br />
Tannenverjüngung weitgehend verhindert oder den Waldbau hinter Zäune verbannt und<br />
insofern nur kleinkarierte Erfolge zugelassen.<br />
- Die Walderkrankung hat nicht zu den befürchteten großflächigen Waldverlusten<br />
in den Hochlagen geführt. <strong>Der</strong> beschleunigte Abbau erkrankter älterer<br />
Tannenbestände konnte aber durch den Tannennachwuchs nicht kompensiert<br />
werden. Insofern gingen auch dadurch Tannenflächen verloren.<br />
III. Strategie<br />
Auf diesen Erfahrungen konnte, ganz im Sinne der bei der Pforzheimer Tagung von 1979<br />
vorgeschlagenen Maßnahmen, ein <strong>Weg</strong> zu einer erfolgreicheren <strong>Tannenwirtschaft</strong> eingeschlagen<br />
werden. Ich darf jedoch betonen, dass es eine eigenständige Strategie für die <strong>Tannenwirtschaft</strong> -<br />
wie das Thema vorgibt - jedoch nicht gab. Die Bewirtschaftung der Tannenwälder war<br />
eingebunden in das Konzept „Naturnahe Waldwirtschaft“, das in Anlehnung an die vielen<br />
Veröffentlichungen, vor allem von Prof. Leibundgut/Zürich, entwickelt und Schritt für Schritt<br />
umgesetzt wurde. <strong>Der</strong> im Vergleich <strong>zur</strong> gängigen Praxis der Nachkriegszeit wesentlich veränderte<br />
Waldbau wurde weder aus einem Guss entwickelt, noch wurde er der Praxis per Dekret<br />
übergestülpt. Schlechte Beispiele mit verordneten Betriebssystemen zu Anfang des 20.<br />
Jahrhunderts verboten ein solches Vorgehen. Vielmehr wurde seit Ende der 1970er Jahre ein breit<br />
angelegter Diskurs über das veränderte waldbauliche Vorgehen eröffnet, mit der Praxis und der<br />
Wissenschaft diskutiert, in Aus- und Fortbildungsveranstaltungen v. a. an die jüngeren Jahrgänge<br />
vermittelt und in der Regel durch die Forsteinrichtung in die Betriebes übertragen.<br />
Wir alle zusammen waren eine lernende Institution.<br />
In diesem Rahmen galt es, einen tannengemäßen Waldbau nicht nur zu propagieren, was in der<br />
Vergangenheit selten versäumt wurde, sondern ihn endlich mit den nötigen Konsequenzen<br />
umzusetzen und die Haupthindernisse zu beseitigen.<br />
5<br />
5
Die Tanne wurde aus dem Prokrustesbett der strengen räumlichen Ordnung mit festgelegten<br />
Hiebszügen und Schlagreihen entlassen. Kahl- und Saumhiebe in Tannen-Mischbeständen, der<br />
sogenannte „Wursträdlesbetrieb“ (häufig mit nachfolgender Fichten- oder Douglasienpflanzung),<br />
wurde aufgegeben und dafür vorsichtige Schirmhiebe auf der Bestandesfläche geführt. Die<br />
Endnutzung wurde deutlich <strong>zur</strong>ückgefahren und damit de facto die Umtriebszeit erhöht. Dafür<br />
wurden Pflege und Durchforstung intensiviert. Aus der Vorratspflege heraus sollten sich<br />
Verjüngungsvorräte der Schattbaumarten unter Schirm bilden. Wo nötig wurden Tannen und<br />
Buchen vorgebaut. Räumungshiebe über fertigen Verjüngungen sollten sich am langfristigen<br />
Femelschlag orientieren, soweit nicht Dauerwald in Frage kam.<br />
Und: <strong>Der</strong> regelmäßige Zaunbau sollte auf Ausnahmefälle reduziert werden.<br />
Von zentraler Bedeutung war also die schnelle Reduktion der maßlos überhöhten Reh- und<br />
Rotwildbestände, die gezielt angegangen wurde. Die Bedingungen im Land waren günstig, weil<br />
kein maßgeblicher Politiker des Landes Jäger war und die Führungsmannschaft der LFV<br />
geschlossen und eindeutig das Ziel „Wald vor Wild“ vertrat. Scheifele informierte anlässlich der<br />
Herbstdienstbesprechungen 1975 die Forstamtsleiter, dass Wildschäden, insbesondere in staatlichen<br />
Jagden, künftig nicht mehr als Kavaliersdelikt angesehen, sondern als dienstliche Verfehlung<br />
geahndet werden.<br />
IV. Maßnahmen und Programme<br />
Die mir <strong>zur</strong> Verfügung stehende Zeit verbietet es, auf personelle und lokale Besonderheiten<br />
einzugehen. <strong>Der</strong> Schwerpunkt meiner Ausführungen liegt auf den Aktivitäten, die vom<br />
Ministerium ausgingen, die aber in enger Verbindung mit der FVA und den Forstdirektionen<br />
entwickelt und umgesetzt wurden. Daneben dürfen auch die wertvollen Initiativen von Kollegen<br />
auf den Forstämtern nicht vergessen werden. So wurden z. B. im Nordschwarzwald auf großen<br />
Flächen Fichten aus Naturverjüngungen entfernt und dadurch der Tannennachwuchs entscheidend<br />
gefördert. (Etwas umständlich habe ich damit den brutalen, aber gängigen Begriff der Entfichtung<br />
umschrieben). Die Aktion hat Geld gekostet, aber sie hat sich als höchst wirkungsvoll erwiesen.<br />
1979 erging, in Anlehnung an Vorarbeiten der Forstdirektion Nordwürttemberg, ein Erlass <strong>zur</strong><br />
Begründung der wichtigsten Betriebzieltypen (15). In den einleitenden Grundsätzen steht an<br />
erster Stelle: "Die Möglichkeit der Naturverjüngung ist in verstärktem Maße sinnvoll auszunutzen"<br />
und: "<strong>Der</strong> Regulierung des Wildbestandes auf ein tragbares Maß ist vorrangig Aufmerksamkeit zu<br />
schenken. Die Hauptbaumarten müssen sich in der Regel ohne Zaunschutz verjüngen lassen".<br />
1980 wurden Möglichkeiten <strong>zur</strong> Steigerung der Naturverjüngung untersucht, wuchsgebietsweise<br />
kommentiert und die Verdoppelung des (erbärmlich niedrigen) Naturverjüngungsanteils von etwa<br />
20 % im Staatswald eingefordert.<br />
Bei der Forstlichen Fakultät der Uni Freiburg wurde angeregt, die ertragskundliche Forschung auf<br />
Mischbestände und Naturverjüngung auszudehnen.<br />
Die FVA wurde angewiesen, dazu Versuchsflächen anzulegen, um der Praxis wissenschaftlich<br />
abgesicherte Daten <strong>zur</strong> Verfügung zu stellen.<br />
In diese Zeit 1979/80 fällt auch die Intensivierung des Tannen- und Buchen- Vorbaus <strong>zur</strong><br />
Umwandlung reiner Fichtenbestände in Mischbestände und die Aufnahme des Vorbaus in das<br />
Förderprogramm des Landes (16, 17).<br />
Damit waren erste Pflöcke auf dem <strong>Weg</strong> zum naturnahen Waldbau eingeschlagen.<br />
Waldbaulich beste Absichten bleiben Makulatur, wenn Reh- und Rotwildbestände nicht den<br />
natürlichen Bedingungen angepasst sind sind. Daran ist die Nachkriegs-Generation gescheitert.<br />
Deshalb wurden 1979 "Richtlinien für die Hege und Abschussregelung des Rehwildes für die<br />
staatseigenen Jagden" erlassen (18). Sie basieren ebenfalls auf einem Vorentwurf der<br />
6<br />
6
Forstdirektion Nordwürttemberg unter Federführung des Ltd. FDir. F. Rau (19). Zentral war<br />
wiederum das Ziel, dass die in einem bestimmten Gebiet vorkommenden Hauptbaumarten sich<br />
ohne Schutzmaßnahmen verjüngen lassen. Die Höhe des Abschusses soll sich zukünftig nicht mehr<br />
an fragwürdigen Schätzungen des Wildbestandes, sondern am Zustand der Vegetation und der<br />
Kondition des Wildes orientieren. Solange diese Ziele nicht erreicht sind, ist der Abschuss zu<br />
erhöhen.<br />
In Fortbildungsveranstaltungen mit dem Thema "Wildbewirtschaftung nach ökologischen<br />
Gesichtspunkten" (20) wurden 1979 die forstlichen Beisitzer in den Kreisjagdämtern sowie die<br />
Leiter größerer Staatsjagdreviere mit den neuen Vorstellungen vertraut gemacht. Wesentliche<br />
Ideengeber waren die Wildbiologen Eisfeld und Ellenberg, die <strong>zur</strong> Nahrungsphysiologie und zu<br />
den Regulierungsmechanismen des Rehwildes referierten. Schonungslos wurden die Wildschäden,<br />
ihre Ursachen und Folgen angesprochen und auf dienstrechtliche Konsequenzen hingewiesen. Die<br />
Forsteinrichter hatten den Auftrag, den Einfluss des Schalenwildes auf die Naturverjüngung<br />
sorgfältig zu begutachten. Bei Örtlichen Prüfungen <strong>zur</strong> Forsteinrichtung wurde bilanziert und<br />
abgerechnet.<br />
1981 folgte eine Rotwild-Richtlinie. Mit dem LJV wurde Übereinstimmung erzielt, dass eine<br />
weitere Reduktion des Rotwildbestands durchgeführt werden muss, bis die Schälschäden auf ein<br />
tragbares Maß <strong>zur</strong>ückgegangen sind (21).<br />
Die Verwendung der Vegetationsweiser <strong>zur</strong> Beurteilung der relativen Höhe des<br />
Rehwildbestandes verlangte ein einfaches und doch aussagekräftiges Verfahren <strong>zur</strong> Beurteilung der<br />
Wald-Wild-Situation. 1981 wurde ein erster Versuch mit dem "Ökologischen Gutachten zum<br />
Abschussplan" gestartet. Die Forstämter wurden aufgefordert, die jagdliche, waldbauliche und<br />
ökologische Situation in den Jagdbezirken ihres Gebietes zu beurteilen und dem forstlichen<br />
Beisitzer im Kreisjagdamt konkrete Informationen zu liefern.<br />
Versehen mit harten Fakten <strong>zur</strong> Wald-Wild-Situation konnte der forstliche Beisitzer im<br />
Kreisjagdamt kompetent in die Gestaltung der Abschusspläne in den gemeinschaftlichen<br />
Jagdbezirken eingreifen und die Belange des Waldes handfest vertreten. <strong>Der</strong> Landesjagdverband<br />
erkannte schnell die Wirksamkeit des Verfahrens und protestierte sowohl gegen den Alleingang der<br />
Forstverwaltung als auch gegen die gutachterlichen Tätigkeit der Forstämter in den<br />
gemeinschaftlichen Jagdbezirken. <strong>Der</strong> Versuch, das Projekt auf der politischen Schiene zu<br />
verhindern, blieb ohne Erfolg. In zähen Verhandlungen gelang es, 1985 zu dem mit der Jägerschaft<br />
abgestimmten "Forstlichen Gutachten zum Abschussplan" zu kommen.<br />
Es wird seit 1986 in dreijährigem Abstand erhoben (22).<br />
Angesichts der Tatsache, dass die Verwaltungsjagd in Baden-Württemberg nur 8 % der<br />
Landesfläche und 18 % der Waldfläche umfasst, war <strong>zur</strong> Lösung des Wald-Wild-Konflikts eine<br />
enge Kooperation mit der Jägerschaft unabdingbar. Es wurde Wert darauf gelegt, dass diese auf<br />
allen Verwaltungsebenen intensiv praktiziert wird. In regelmäßigen Besprechungen zwischen den<br />
Spitzen der LFV und dem Präsidium des LJV, in den Jagdbeiräten der oberen Jagdbehörden, in den<br />
Kreisjagdämtern und in unzähligen Waldbegehungen der Forstämter mit Hegeringen wurden die<br />
forstlichen Ziele und jagdlichen Konsequenzen erläutert und <strong>Weg</strong>e <strong>zur</strong> Zielfindung besprochen.<br />
Ein nicht zu unterschätzender Druck auf die Jägerschaft ging auch von der öffentlichen Diskussion<br />
um das Waldsterben aus. Mit dem Schlagwort des "Waldsterbens von unten" fanden sich die Jäger<br />
unversehens in der Rolle der Mitverantwortlichen eines massiven Umweltproblems.<br />
Mit der VwV - Rehwild 1985 gelang es, die bisher nur für die staatseigenen Jagden geltende<br />
Rehwildrichtlinie von 1979 in leicht modifizierter Form für alle Jagden verbindlich zu machen.<br />
7<br />
7
Zugleich wurden zwischen dem Ministerium und dem Landesjagdverband Empfehlungen <strong>zur</strong><br />
Bejagung von Reh- und Rotwild vereinbart (23).<br />
Wer heute dieses Operat liest und sich über den Seiltanz wundert, was bei der Rehwildjagd gerade<br />
noch und schon nicht mehr erlaubt ist, muss wissen, dass in jenen Jahren der Bundesjagdverband<br />
ernsthaft versuchte, Treibjagden auf Reh- und Rotwild und das Ankirren von Wild als Verstöße<br />
gegen die "anerkannten Grundsätze der deutschen Waidgerechtigkeit" zu diskretitieren und<br />
gesetzlich verbieten zu lassen. Es war Handlungsbedarf angesagt und inzwischen sind diese von<br />
Baden-Württemberg ausgegangenen Impulse bundesweit unbestrittene Praxis.<br />
Weitere Erleichterungen der Abschusserfüllung konnten damals nicht durchgesetzt werden und<br />
sind bis heute noch nicht erreicht worden, z. B.<br />
- ein Fütterungsverbot für Rehwild,<br />
- die Verlängerung der Bockjagd bis zum 31.Januar, und<br />
- der <strong>Weg</strong>fall des Verbots der Nachtjagd auf Rehwild.<br />
Im Hinblick auf die waldbaulichen Konsequenzen des „Waldsterbens“ wurde zu keiner Zeit ein<br />
genereller Wechsel zu immissionsresistenten Baumarten erwogen, wie er im Erzgebirge vollzogen<br />
wurde. Leitlinie war, dass die Emissionen mit vorhandenen technischen Mitteln so zu reduzieren<br />
sind, dass auch die empfindlichen Tannen überleben und ihre Funktionen voll erfüllen können (25).<br />
Die Hoffnung auf eine Verringerung der Luftschadstoffe ruhte auf den weit reichenden<br />
Beschlüssen der Bundesregierung <strong>zur</strong> Verschärfung der Grenzwerte der Technischen Anleitung <strong>zur</strong><br />
Reinhaltung der Luft (TA-Luft) und der Großfeuerungsanlagen-VO, beide von 1983. Sie haben in<br />
unerwarteter Zeitkürze <strong>zur</strong> Reduktion der SO2-Belastung der Luft geführt, was nicht nur der SO2empfindlichen<br />
Tanne gut bekommen ist.<br />
Die Tanne hat sich in der Tat seit Ende der 1980er Jahre deutlich erholt. Innerhalb der letzten 10<br />
Jahre ist ihr Kronenzustand im Gegensatz zu anderen Hauptbaumarten äußerst konstant geblieben.<br />
Selbst nach der extrem heißen und trockenen Witterung im Jahr 2003 wurden bei der Tanne keine<br />
anhaltenden Schädigungen beobachtet (26). In jüngster Zeit haben Zuwachsuntersuchungen<br />
bekräftigt, dass die verminderte Belastung durch schwefelhaltige Immissionen neben anderen<br />
Faktoren maßgeblich den verbesserten Gesundheitszustand der Tanne bewirkt haben (27).<br />
Zur Dämpfung der negativen Folgen der Walderkrankung beschloss die Landesregierung 1986 ein<br />
"Waldbauliche Sonderprogramm" mit der finanziellen Förderung von Vorbau,<br />
Meliorationskalkung und Wiederaufforstung abgestorbener Bestände im Nichtstaatswald. Auch<br />
diese Aktion hat der Tanne geholfen.<br />
Um der flächigen Auflösung der Wälder in den Hochlagen des Schwarzwaldes zu begegnen (der<br />
Schwarzwald bekam zunehmend eine Glatze), wurde 1989 eine "Richtlinie für die waldbauliche<br />
Behandlung schwer geschädigter Bestände und Freiflächenaufforstung in den Hochlagen des<br />
Schwarzwaldes" erlassen.<br />
Vorgesehen waren insbesondere:<br />
- Meliorationsdüngung <strong>zur</strong> Steigerung der Vitalität der Bestände und zum Schutz des Bodens,<br />
- Umwandlung der Fichtenreinbestände in Mischbestände, auf Freiflächen unter dem Vorwald der<br />
natürlich ankommenden Pioniere, und<br />
- scharfe Bejagung des Schalenwildes sowie Fütterungsverbot in den Hochlagen.<br />
Nach Abklingen der hektischen Diskussionen um das Waldsterben und noch vor den Orkanen 1990<br />
wurden 1988 Ziele und Maßnahmen auf dem <strong>Weg</strong> zum naturnahen Waldbau präzisiert:<br />
In der AFZ, die damals auch an alle Revierleiter ausgeliefert wurde, erschien mein Aufsatz mit dem<br />
Titel "Grundsätze künftigen Waldbaus am Beispiel der LFV Baden-Württemberg" (28). Ein Jahr<br />
danach wurden die waldbaulichen Ziele in der Schriftenreihe der LFV (29) nochmals dargestellt<br />
8<br />
8
und mit der waldbaulichen Entwicklung nach Plan und Vollzug verglichen. Dadurch konnte die<br />
bisherige Entwicklung an den künftigen Zielen gemessen, Schwachstellen analysiert und<br />
Kurskorrekturen vorgenommen werden.<br />
Die wesentlichen Ziele und die tragenden Säulen der "Naturnahen Waldwirtschaft" sind Naturnähe,<br />
Vielfalt und Stabilität. Die natürlichen Abläufe sollen als biologische Automation verstärkt genutzt<br />
werden. Wo sinnvoll und möglich, soll Dauerwald angestrebt werden. Ansonsten sollen bei der<br />
Verjüngung der Wälder abrupte Räumungen mit nachfolgender Pflanzung vermieden und fließende<br />
Übergänge von einer Waldgeneration <strong>zur</strong> anderen angestrebt werden (30).<br />
Logische Konsequenz dieser Entwicklung war der Plenterwalderlass von 1993, mit dem die<br />
Forsteinrichter angewiesen wurden, verstärkt Dauerbestockungen auszuweisen. Die hierfür<br />
notwendigen Voraussetzungen waren günstig, weil durch den weitgehenden Verzicht auf<br />
Räumungshiebe im vergangenen Jahrzehnt und die erfolgreiche Regulierung der Rehwildbestände<br />
Verjüngungsvorräte auf großen Flächen entstandenen waren. Im Schutz einer dauernden<br />
Überschirmung ist die Tanne unschlagbar, während sie auf der Kahlfläche von den meisten<br />
Baumarten überwachsen wird. Die einzelstammweise Nutzung bietet v. a. in Tannenwäldern zudem<br />
die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Aufwendungen hohe Erträge zu erzielen, ohne<br />
andere Waldfunktionen zu beeinträchtigen.<br />
Mit der Richtlinie landesweiter Waldentwicklungstypen von 1999 wurde der Plenterwalderlass<br />
weiterentwickelt (31). Das Entwicklungsziel des WET Tannen-Mischwald wird beschrieben als ein<br />
"in seiner Artenzusammensetzung und Struktur naturnaher, im Regelfall als Plenterwald<br />
bewirtschafteter Dauerwald, der den Bodenschutz dauerhaft gewährleistet, mit wesentlichen<br />
Anteilen von starken Tannen und Fichten hoher Qualität".<br />
Schlussbemerkung<br />
30 Jahre sind seit der Pforzheimer Tagung des baden-württembergischen <strong>Forstverein</strong>s vergangen.<br />
Eine lange Zeit im menschlichen Leben. Die damaligen Teilnehmer befinden sich überwiegend im<br />
Ruhestand oder sind verstorben. Die Mehrzahl der heutigen Zuhörer wird die Pforzheimer Tagung<br />
wahrscheinlich nicht erlebt haben.<br />
30 Jahre sind dagegen eine kurze Zeit für unsere Tannenwälder. Dieser Zeitraum hat sich in der<br />
Vergangenheit als zu kurz erwiesen für eine erfolgreiche Verjüngung von Tannenbeständen.<br />
Die vergangenen 30 Jahre waren eine spannungsgeladene Zeit mit tiefgreifenden Umwälzungen,<br />
mit einem unverkennbaren Bedeutungsverlust der Forstverwaltung, mit heftigen Attacken auf die<br />
Stabilität des Wald durch Klimaveränderung, Walderkrankung, Jahrhundertstürme (wobei der<br />
Orkan Erwin m. E. der schlimmste war), und mit schweren wirtschaftlichen Krisen, die zu<br />
Einsparungen mit Substanzverlust führten und mit Gefahren für die Nachhaltigkeit verbunden sind.<br />
Am deutlichsten wird das Gebot der Nachhaltigkeit (das forstliche Grundgesetz) beim forstlichen<br />
Nachwuchs verletzt. Die personelle Verjüngung - übrigens auch ein Thema der Pforzheimer<br />
Tagung - ist inzwischen ins Stocken geraten wie vordem die Tannenverjüngung. <strong>Der</strong> Waldbau<br />
treibende Mensch ist wohl bereits aus dem Mittelpunkt der Waldbewirtschaftung verdrängt worden.<br />
Die Zukunft der Tanne mag - dank der reichlichen Vorausverjüngung - für eine absehbare Zeit<br />
noch gesichert sein. Ich befürchte aber, dass eine nachhaltige, tannengemäße Waldbewirtschaftung<br />
unter den derzeitigen und den sich abzeichnenden künftigen Rahmenbedingungen langfristig nicht<br />
durchgehalten wird.<br />
Hoffentlich täusche ich mich.<br />
9<br />
9
Quellenverzeichnis<br />
1 Tagungsberichte der Hauptversammlung des Baden-Württembergischen <strong>Forstverein</strong>s 1979<br />
2 E. Zentgraf: Die Edeltanne; AFJZ 1949/50; S. 7<br />
3 F. W. Bauer: Betriebsgrundsätze; Erlass der FD Südbaden 1948<br />
4 Erlass des Reichsforstamtes vom 15.5.1943 zum Schutz der Weißtanne<br />
5 M. Scheifele: Vortragstext bei einer Fortbildungsveranstaltung 1965; unveröffentlicht<br />
6 Mitteilungen des Vereins für Forstliche Standortskunde... Nr. 44/2006<br />
P. Weidenbach: <strong>Der</strong> Neuenbürger Forstetat 1778; S. 79<br />
A. Ott: <strong>Der</strong> Altensteiger Forstetat von 1778; S.91<br />
G. Schulz: Die Ergebnisse des Forstetats von 1778 für den Kameralwald des Oberforstes<br />
Freudenstadt; S. 95<br />
7 F. Graner: Die Forstverwaltung Württemberg; Kohlhammerverlag Stuttgart; 1910, S. 23<br />
8 G. Petri: <strong>Der</strong> Einfluß des Schalenwildes auf die Tannennachzucht im Schwarzwald; FuH Nr. 16<br />
9 F. Gerwig: Die Weißtanne im Schwarzwald; Berlin 1868<br />
10 V. Hink: Das Wachstum von Fichte und Tanne auf den wichtigsten Standortseinheiten des<br />
Einzelwuchsbezirks "Flächenschwarzwald"; Dissertation 1971<br />
11 P. Weidenbach: Gegenwärtige Rehwildbewirtschaftung in Ba-Wü; AFZ 35/1984; S. 868<br />
12 P. Weidenbach und M. Reger: Zur Lage der Weißtanne im Nordschwarzwald; AFZ 16/1997; S. 852<br />
13 W. Schöpfer und J. Hradetzky: <strong>Der</strong> Indizienbeweis: Luftverschmutzung maßgebliche Ursache der<br />
Walderkrankung; FWiss. Cbl. Heft 4-5/1984.<br />
14 H.-U. Moosmayer: Stand der Forschung über das Waldsterben; AFZ 1988, S. 1365<br />
15 P. Weidenbach: <strong>Der</strong> Betriebzieltypenerlass; AFZ 26/1979; S.693<br />
16 H. Peck: Intensivierung des Vorbaus in baden-württembergischen Wäldern; AFZ 49/1980; S.1380<br />
17 P. Weidenbach: Vorbau von Tanne und Buche - ein <strong>Weg</strong> zu besseren waldbaulichen Ergebnissen;<br />
AFZ 45/1985; S. 1212<br />
18 P. Weidenbach: Neue <strong>Weg</strong>e in der Rehwildhege; AFZ 17/18/1979; S. 462<br />
19 F. Rau: Waldgerechte Rehwildhege im Tannenrevier am Beispiel des Staatswaldes im Forstamt<br />
Lorch/Württ.; AFZ 17/18/1979; S. 459<br />
20 MELUF: Wildbewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten; Broschüre EM -22- 80<br />
21 P. Weidenbach: Zur Regulierung des Schalenwildes und Erhaltung bedrohter Wildarten in Baden-<br />
Württemberg; AFZ 7/1982; S. 198<br />
22 P. Weidenbach: Ergebnisse der Auswertung des Forstlichen Gutachtens 1986; AFZ 19/1987; S. 475<br />
23 P. Weidenbach: Fortschritte bei der Schalenwildhege in Ba-Wü; AFZ 11/1986; S. 231<br />
24 P. Weidenbach: Die jagdlichen Ziele der Landesforstverwaltung nach den Stürmen 1990; AFZ<br />
19/1991; S. 992<br />
25 P. Weidenbach: Waldbauliche Konsequenzen des Waldsterbens; <strong>Deutscher</strong> <strong>Forstverein</strong>,<br />
Jahresbericht 1984; S. 145<br />
26 FVA Baden-Württemberg 2007, 2008: Waldzustandsberichte<br />
27 Elling,W., Heber, U., Polle, A., Beese, F.: Schädigung von Waldökosystemen. Auswirkungen<br />
anthropogener Umweltveränderungen und Schutzmaßnahmen. 422 Seiten; Elsevier Spektrum<br />
Akademischer Verlag, München-Heidelberg; 2007<br />
28 Grundsätze künftigen Waldbaus am Beispiel der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg; AFZ<br />
51-51/1988 S. 1405<br />
29 P. Weidenbach, J. Schmidt, K.Karius: Waldbauliche Ziele und Forsteinrichtungsergebnisse im<br />
öffentlichen Wald in Baden-Württemberg; Schriftenreihe der LFV Band 69/1989<br />
30 Ministerium für ländlichen Raum Baden-Württemberg: Wald, Ökologie und Naturschutz; Broschüre<br />
MLR - 31/1993<br />
31 Landesforstverwaltung Baden-Württemberg: Richtlinie landesweiter Waldentwicklungstypen;<br />
Januar 1999.<br />
10<br />
10



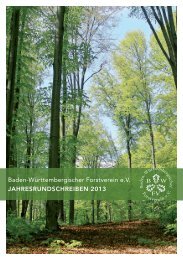
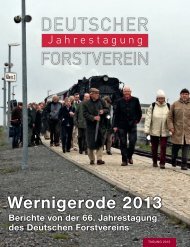
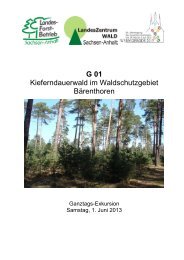
![Vortrag_Ullrich_warendorf_20130305 [Kompatibilitätsmodus]](https://img.yumpu.com/22691664/1/184x260/vortrag-ullrich-warendorf-20130305-kompatibilitatsmodus.jpg?quality=85)