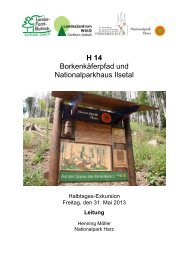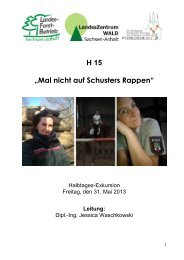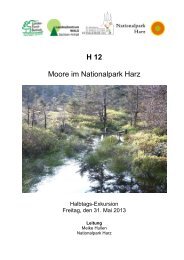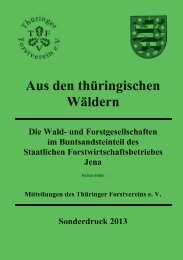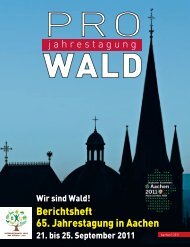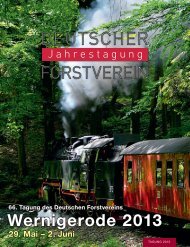Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2011
Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2011
Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2011
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong><br />
<strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong><br />
<strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
<strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Jahr</strong><br />
<strong>2011</strong>
Impressum:<br />
Zusammenstellung der<br />
Beiträge und<br />
Redaktionelle Bearbeitung: Horst Geisler<br />
Druck und Buchbinderische<br />
Weiterverarbeitung ID Wald Göttingen<br />
ISSN: 0943 - 7304<br />
Eine geringe Anzahl <strong>des</strong> <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong>es kann neben der<br />
kostenlosen Abgabe an die Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
e.V. gegen eine Schutzgebühr von 5,00 € bezogen werden.<br />
© 2012<br />
1
Inhaltsverzeichnis:<br />
Vorwort <strong>des</strong> Vorsitzenden <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Herr Hagen Dargel Seite: 5<br />
Protokoll der Mitgliederversammlung <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. am 12. April <strong>2011</strong> in Erfurt<br />
Revisionsbericht zu den Kassengeschäften <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
<strong>Forstvereins</strong> e.V. in der Zeit vom 04.10. 2007 bis 31.12. 2110<br />
3<br />
Seite: 8<br />
Seite: 11<br />
Frühjahrsveranstaltung am 12. April <strong>2011</strong> in Erfurt:<br />
„Zukunftsorientierte Organisation und Steuerung von<br />
Forstbetrieben“<br />
Tagungsbericht: Herr Dr. Andreas Niepagen Seite: 13<br />
<strong>Jahr</strong>esexkursion <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. vom 23 bis 25 Juni<br />
<strong>2011</strong> in <strong>das</strong> sächsische Erzgebirge<br />
Herr Frank Wittau Seite: 42<br />
Neue Chancen <strong>für</strong> den Wald im mittleren Erzgebirge<br />
Herr Dr. Klaus Dittrich Seite: 54<br />
Seniorentreffen <strong>2011</strong> <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. und <strong>des</strong> BdF<br />
Thüringen in Erfurt<br />
Frau Uta Krispin Seite: 66<br />
<strong>Thüringer</strong> Forstverein begrüßt die Verabschiedung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
Gesetzes über die Reform der Forstverwaltung<br />
(Pressemitteilung)<br />
Herr Dr. Andreas Niepagen Seite: 70
Beiträge zur Forstgeschichte<br />
Bericht zur Ausstellung in Paulinzella:<br />
„Harzung in Deutschland von 1917 bis 1989“<br />
„Das Harz – einst Gold <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>“<br />
Herr Michael Kolbe Seite: 71<br />
Dr. Wolfgang Henkel 80 <strong>Jahr</strong>e<br />
Herr Prof. Dr. Martin Heize Seite: 78<br />
Jubilare <strong>2011</strong> Seite: 80<br />
Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
Aktuelles Mitgliederverzeichnis per 31.12. <strong>2011</strong> Seite: 84<br />
4
Vorwort zum <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Liebe Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V.,<br />
<strong>das</strong> <strong>Jahr</strong> <strong>2011</strong> wird sicherlich als ein Meilenstein in die thüringische<br />
Forstgeschichte eingehen, ähnlich wie <strong>das</strong> Gründungsjahr der neuen <strong>Thüringer</strong><br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung 1991. Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts mit<br />
Namen „THÜRINGENFORST“ wurde vom <strong>Thüringer</strong> Landtag per Gesetz<br />
beschlossen und die Anstalt hat mit Beginn <strong>des</strong> <strong>Jahr</strong>es 2012 ihre Arbeit<br />
aufgenommen. Und wir als <strong>Thüringer</strong> Forstverein können mit Stolz sagen, wir<br />
sind dabei gewesen! Trotz aller Skepsis zu Beginn ob dieser einschneidenden<br />
Rechtsformänderung haben wir uns von den Möglichkeiten, die diese<br />
Anstaltslösung bietet, überzeugen lassen. Das Wichtigste <strong>für</strong> uns war und bleibt,<br />
auch in der neuen Rechtsform <strong>das</strong> Gemeinschaftsforstamt in Thüringen zu<br />
erhalten. Und <strong>das</strong> stand sozusagen als Überschrift über allen Diskussionen.<br />
Vorstand und Geschäftsführung war es wichtig, beim Gesetzgebungsverfahren<br />
intensiv mitzuwirken, um der Anstalt in unserem Sinne von Anfang an gute<br />
Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dazu gab es schriftliche<br />
Stellungnahmen und zahlreiche Gespräche mit Abgeordneten <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
Landtags; alles in allem ein Stück Arbeit mit erheblichem Einsatz und<br />
Zeitaufwand aller Beteiligten. Ich denke aber, <strong>das</strong>s es diesen Einsatz wert war,<br />
denn <strong>das</strong> Ergebnis in Form <strong>des</strong> Errichtungsgesetzes kann sich sehen lassen. Noch<br />
kein Referentenentwurf ist in den letzten 20 <strong>Jahr</strong>en so intensiv geändert worden,<br />
wie der zur Gründung der AöR (nach Angabe <strong>des</strong> Ausschusses 155<br />
Änderungsanträge, davon 94 angenommen). Der TFV war daran nicht<br />
unbeteiligt. So haben wir es gemeinsam mit unseren Partnern geschafft, <strong>das</strong>s der<br />
AöR die Waldflächen als „Forstgrundstock“ ins Eigentum übertragen werden<br />
und <strong>das</strong> sogenannte „doppelte Vetorecht“ <strong>des</strong> Finanzministeriums gestrichen<br />
worden ist. Auf unsere Anregung hin ist die Kann-Bestimmung zur Bildung<br />
einer Rücklage in eine Sollvorgabe geändert worden und auch die Federführung<br />
<strong>für</strong> die Jagdnutzungsanweisung liegt nach unserem Vorschlag jetzt bei der AöR.<br />
Das alles sind Regelungen, die bei der AöR eine eigenverantwortliche,<br />
betrieblich orientierte und erfolgreiche Arbeit ermöglichen. Wir konnten auch<br />
den Begriff <strong>des</strong> „Forstamts“ im Gesetz erhalten um unseren Partnern hierbei eine<br />
gewisse thüringische Konstanz zu beweisen.<br />
5
Nun ist zu Beginn <strong>des</strong> neuen <strong>Jahr</strong>es 2012 der Verwaltungsrat zu seiner<br />
konstituierenden Sitzung zusammengekommen und hat die ersten Beschlüsse<br />
gefasst. Wünschen wir der neuen Forstanstalt auf ihrem Weg viel Erfolg und ein<br />
langes Bestehen. Und hoffen wir, <strong>das</strong>s auch die Forstanstalt die Arbeit <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> Wert schätzt und uns als Partner <strong>für</strong> ihre Arbeit mit dem<br />
Wald und <strong>für</strong> den Wald aller Eigentumsformen in Thüringen sieht, so wie es die<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung seit ihrer Neugründung 1991 getan hat.<br />
Liebe Mitglieder, lassen Sie mit der Lektüre <strong>des</strong> vorliegenden <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong>s <strong>das</strong><br />
vergangene <strong>Jahr</strong> nochmals Revue passieren.<br />
Erster Höhepunkt war unsere Frühjahrstagung im Waldhaus bei Erfurt. Mit dem<br />
Tagungsthema und der Referentenliste ist es uns gelungen, nicht nur viele<br />
Mitglieder anzusprechen. Wir hatten auch eine rege Beteiligung aller Parteien<br />
<strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Landtags, die sich in Grußworten äußerten und aus den Vorträgen<br />
und der Diskussion sicherlich viele Anregungen <strong>für</strong> Ihre parlamentarische Arbeit<br />
mitgenommen haben. Vor allem unsere Tagung war wohl auch der Auslöser <strong>für</strong><br />
die Aussage von Dr. Augsten (MdL, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) bei der<br />
zweiten Lesung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Gesetzes zur Reform der Forstverwaltung im<br />
<strong>Thüringer</strong> Landtag, der den Forstverein als „tollen Verein“ bezeichnet hat, der<br />
sehr gut mit den Abgeordneten zusammengearbeitet hätte. Und tatsächlich, auch<br />
ich schätze die Zusammenarbeit bei dieser Gesetzesnovelle mit unseren<br />
Landtagsabgeordneten als sehr erfolgreich ein (s.o.). Alles in allem kann diese<br />
Tagung wohl insgesamt als erfolgreichste der letzten <strong>Jahr</strong>e angesehen werden.<br />
Zweiter Höhepunkt war unsere Exkursion nach Sachsen, die uns im Hinblick auf<br />
den in Thüringen wiederum verstärkt auf der Agenda stehenden Waldumbau<br />
verschiedene Eindrücke hinterlassen hat. Einerseits ist es eindrucksvoll, im<br />
Forstbezirk Marienberg die wieder satt grün stehenden Nadelwälder am Kamm<br />
<strong>des</strong> Erzgebirges zu sehen, die viele von uns noch als absterbende traurige Reste<br />
aus der Zeit vor 1990 in Erinnerung hatten. Dort ist es den Kollegen gelungen,<br />
selbst auf den großflächig vergrasten Flächen den Wald als Ökosystem zu<br />
erhalten und man beginnt jetzt wieder mit dem Umbau in standortgerechtere<br />
Wälder. Andererseits konnten wir uns im Forstbezirk Eibenstock anhand hervorragender<br />
Waldbilder mit fast vollflächigen Voranbauten (darunter großflächigen<br />
Weißtannen-Voranbauten) bzw. Saaten, davon überzeugen, welche<br />
waldbaulichen Möglichkeiten bestehen, wenn man nicht unter dem Diktat<br />
unangepasster Wildbestände steht.<br />
6
Anspruchsvolle Mischungen verschiedenster Baumarten, die in der Zukunft<br />
stabilere, gestufte Bestände mit hohem Vorrat und wirtschaftlich diversen<br />
Nutzungsmöglichkeiten erwarten lassen und gleichzeitig auch <strong>für</strong> den<br />
Naturschutz und die Erholungsnutzung von großer Qualität sind, offerieren einen<br />
größeren gesellschaftlichen Gesamtnutzen, als die reinen Fichtenbestände<br />
vordem, die <strong>für</strong> die Mittelgebirge Thüringens und Sachsens so lange prägend<br />
waren und zum Teil noch sind. Der eine oder andere Waldbesitzer oder<br />
Forstmann unter uns ist schon etwas frustriert nach Hause gefahren. Doch sollte<br />
uns <strong>das</strong> eher Ansporn sein, die historische Aufgabe Waldumbau wieder mit<br />
neuem Elan anzugehen. Schade eigentlich, <strong>das</strong>s nicht mehr aktive Revierleiter<br />
dieses Angebot genutzt haben, sich unweit Thüringens Anregungen <strong>für</strong> eine<br />
zukunftsfähige Forstwirtschaft im Mittelgebirge zu holen.<br />
Fotos von der Exkursion sind im Internet unter:<br />
https://picasaweb.google.com/anieForst/<strong>2011</strong>_06_2325_TFVExkursion_Sachsen<br />
_Geisler# zu finden.<br />
Auch die diesjährige Tagung <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> in Aachen hätte eine<br />
bessere Beteiligung aus Thüringen verdient. Fanden doch in der alten Kaiserstadt<br />
Karls <strong>des</strong> Großen die verschiedensten forstlichen Aspekte in interessanten<br />
Diskussionen inmitten eines kulturhistorisch höchst spannenden Ambientes statt<br />
und wurden durch vielfältige Exkursionen ins Umfeld ergänzt. Die Anreise hätte<br />
sich mit Sicherheit <strong>für</strong> Jeden gelohnt. Vielleicht haben die Tagungskosten unsere<br />
Mitglieder abgeschreckt, sie waren aber in jedem Fall angemessen. Hoffen wir in<br />
zwei <strong>Jahr</strong>en auf bessere Beteiligung in Wernigerode, <strong>das</strong> sollten zumin<strong>des</strong>t<br />
unsere Nordthüringer quasi als Heimspiel <strong>für</strong> sich einplanen bzw. sich schon<br />
Gedanken <strong>für</strong> anspruchsvolle Exkursionsangebote nach Thüringen machen.<br />
Abschließend möchte ich allen aktiven Mitgliedern <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
danken. Mein besonderer Dank gilt in diesem <strong>Jahr</strong> unserer Geschäftsstelle. Dr.<br />
Andreas Niepagen und Carmen Walzog sowie unsere Schatzmeisterin Petra<br />
Beck, sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Sei es bei der Organisation der<br />
Frühjahrstagung aber besonders auch bei einer sehr aktiven Öffentlichkeitsarbeit<br />
<strong>für</strong> unseren Verein. Unsere Beteiligung am Gesetzgebungsverfahren der AöR<br />
war so auch <strong>für</strong> unsere Mitglieder stets erlebbar und hat gezeigt, wie aktiv der<br />
Forstverein bei Anspannung aller Kräfte sein kann.<br />
Ihr Vorsitzender<br />
Hagen Dargel<br />
7
Protokoll der Mitgliederversammlung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
e. V. am 12. April <strong>2011</strong> in Erfurt<br />
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit<br />
Der Vorsitzende Hagen Dargel begrüßte die anwesenden Mitglieder und<br />
eröffnete die Mitgliederversammlung. Gegen Form und Frist der Einladung gab<br />
es keine Einwände.<br />
Er stellte fest, <strong>das</strong>s die Mitgliederversammlung mit 62 stimmberechtigten<br />
Mitgliedern beschlussfähig ist (siehe Anlage Anwesenheitsliste).<br />
TOP 2: Bericht <strong>des</strong> Vorsitzenden<br />
Der amtierende Vorstand wurde im Oktober 2007 gewählt, er hat sich seitdem zu<br />
19 Vorstandssitzungen getroffen und 3 Mitgliederversammlungen organisiert. Zu<br />
den inhaltlichen Aktivitäten wurde auf die <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong>e verwiesen. Die Erneuerung<br />
der Satzung sowie Erarbeitung von Beitrags- und Wahlordnung<br />
wurden vom Vorstand vorbereitet.<br />
TOP 3: Bericht <strong>des</strong> Schatzmeisterin<br />
In Vertretung der erkrankten Schatzmeisterin Petra Beck erläuterte<br />
Geschäftsführer Andreas Niepagen den von ihr erstellten Bericht. Der Verein hat<br />
zurzeit 309 Mitglieder. Für die <strong>Jahr</strong>e 2007 bis 2010 ergeben sich folgende<br />
Abschlüsse:<br />
<strong>Jahr</strong> Einnahmen Ausgaben Saldo<br />
2007 28.650,50 28.828,02 -177,52<br />
2008 26.496,85 24.621,38 1.875,47<br />
2009 32.774,50 30.547,92 2.226,58<br />
2010 28.950,50 30.108,92 -1.158,42<br />
Kontostand per 31.12.10: + 13.945,16 €<br />
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer<br />
Der Bericht der Kassenprüfung ist als Anlage beigefügt.<br />
TOP 5: Diskussion der Berichte<br />
Die Berichte wurden kurz diskutiert<br />
8
TOP 6: Entlastung <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong><br />
Kassenprüfer Jochen Ichtershausen beantragte die Entlastung <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong>.<br />
Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.<br />
TOP 7: Beschluss der Wahlordnung<br />
Der Entwurf der Wahlordnung wurde mit der Einladung versandt.<br />
Die Wahlordnung wurde mit 61 Ja-Stimmen und einer Enthaltung durch die<br />
Mitgliederversammlung beschlossen und trat damit sofort in Kraft.<br />
TOP 8: Wahl <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong><br />
Zum Wahlleiter bestimmte die Mitgliederversammlung Wolf-Dieter Hermann.<br />
Er führte die Wahl nach der neuen Wahlordnung durch.<br />
Der bisherige Vorstand nach § 6 b der Satzung <strong>des</strong> TFV stellte sich zur<br />
Wiederwahl:<br />
• Vorsitzender: Hagen Dargel<br />
• Stellvertreter: Martin Heinze<br />
• Stellvertreter: Wolfgang Heyn<br />
• Geschäftsführer: Andreas Niepagen<br />
• Schatzmeisterin: Petra Beck<br />
Da keine weiteren Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kamen, konnte im<br />
Block abgestimmt werden. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.<br />
Für den erweiterten Vorstand nach § 6 c bzw. § 10 der Satzung <strong>des</strong> TFV wurden<br />
vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgeschlagen:<br />
• Ausbildung: Anka Nicke<br />
• Öffentlichkeitsarbeit: Horst Geisler<br />
• Forstpolitik u. Reisen: Uli Klüßendorf<br />
• Forstgeschichte: Elke Sattler<br />
Da keine weiteren Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kamen, konnte im<br />
Block abgestimmt werden. Der erweiterte Vorstand wurde einstimmig gewählt.<br />
Als Kassenprüfer wurden vorgeschlagen:<br />
• Jochen Ichtershausen und<br />
• Claus-Jürgen Ahbe<br />
Sie wurden einstimmig gewählt.<br />
9
TOP 9:Sonstiges<br />
Es wurde <strong>das</strong> Programm der <strong>Jahr</strong>esexkursion bekannt gegeben.<br />
gez. Niepagen gez. Dargel<br />
(Protokollführer) (Vorsitzender)<br />
10
Jochen Ichtershausen, Gotha<br />
Heiko Buse, Ilmenau Manebach<br />
11<br />
Erfurt, den 12. April <strong>2011</strong><br />
Revisionsbericht zu den Kassengeschäften<br />
<strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e .V. in der Zeit vom 4.10.2007 bis 31.12.2010<br />
Der TFV e.V. unterhält zwei gebührenfreie Konten und eine Handkasse, die <strong>für</strong><br />
den Berichtszeitraum von den beiden, auf der letzten Wahlveranstaltung am<br />
2. Oktober 2007 gewählten Vereinsmitgliedern Jochen Ichtershausen und Heiko<br />
Buse als Revision geprüft wurden.<br />
Die Prüfungen fanden gestaffelt statt am 1. Juli 2009 und am 15. März <strong>2011</strong>. Die<br />
Bilanzen wurden <strong>für</strong> <strong>das</strong> Rumpfjahr 2007 und alle drei folgenden, vollen<br />
Geschäftsjahre geprüft und befanden sich in vollständigen, ordnungsgemäßem,<br />
sauber gegliederten und nachvollziehbarem Zustand. Die Handkasse wies den<br />
gebuchten Bestand an Bargeld auf: Einzelbelege wurden jahresweise<br />
stichprobenartig nach dem Zufallsprinzip geprüft. Alle Belege waren<br />
ordnungsgemäß vorhanden, gut deklariert, vollständig und wieder auffindbar in<br />
den Bilanzen.<br />
Die Notwendigkeit zweier Konten wird auch aus Sicht der Revision weiter<br />
vollumfänglich gestützt, weil eines, <strong>das</strong> sogenannte „Vereinskonto“ (Endziffer<br />
...1358) <strong>das</strong> vielfältige Vereinsleben mit seinen Einnahmen und Ausgaben<br />
widerspiegelt, wogegen <strong>das</strong> andere, als "Reisekonto" bezeichnete (Endziffer<br />
...1498), hauptsächlich dem Zahlungsverkehr der <strong>Jahr</strong>esexkursionen vorbehalten<br />
bleibt. Die Trennung erleichtert <strong>das</strong> anspruchsvolle und aufwändige Ehrenamt<br />
der Schatzmeisterin Frau Beck erheblich, erhöht die Transparenz der<br />
satzungsgemäßen Verwendung der Mittel und verursacht selbst wegen der<br />
Gebührenfreiheit beider Konten keine Mehrkosten: Zur besseren<br />
Veranschaulichung unternimmt die Schatzmeisterin dementsprechende<br />
Umbuchungen vor, wenn versehentlich falsch eingezahlt wurde oder<br />
behelfsweise vom anderen Konto abgebucht werden musste.<br />
Leider sind die circa 200 Lastschrift-Einzugsverfahren, mit denen die Mitglieder<br />
dem Einzug ihrer <strong>Jahr</strong>esmitgliedsbeiträge zugestimmt haben, seit 2009 wieder<br />
alljährlich händisch auszufüllen, erschwerend mit zwei Unterschriften <strong>für</strong> immer<br />
einen Sammeleinzug je zehn Mitglieder. Hier empfiehlt auch die Revision dem<br />
Vorstand, nach einer sicheren Lösung zu suchen; um den Aufwand hier<strong>für</strong> zu<br />
verringern.
Die Revision empfiehlt abschließend der Mitgliederversammlung der<br />
Schatzmeisterin und dem Vorstand <strong>für</strong> den vorgelegten Kassenbericht<br />
Ent1astung zu erteilen.<br />
Ich bedanke mich <strong>für</strong> Ihre Aufmerksamkeit.<br />
gez. J. Ichtershausen gez. H. Buse<br />
12
Bericht von der Tagung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Forstverein e. V.<br />
„Zukunftsorientierte Organisation und<br />
Steuerung von Forstbetrieben“<br />
am 12.04.<strong>2011</strong> im Waldhaus Erfurt<br />
von ANDREAS NIEPAGEN<br />
Der Vorsitzende <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> Hagen Dargel freute sich, neben<br />
über 160 Gästen auch vier Abgeordnete <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Landtages im vollen Saal<br />
begrüßen zu können. Diese rege Beteiligung ist der bevorstehenden<br />
Umwandlung der <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen<br />
Rechts geschuldet. In diesem Zusammenhang Informationen und Raum <strong>für</strong><br />
Diskussionen zu geben, war ein Ziel der Veranstaltung.<br />
Der vollbesetzte Saal dokumentiert <strong>das</strong> rege Interesse an der Tagung.<br />
Weiterhin ehrte Dargel im Rahmen seiner Begrüßung den <strong>Jahr</strong>gangsbesten<br />
Absolventen <strong>des</strong> Studienganges Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement der<br />
Fachhochschule Erfurt, Alexander Hopf (zurzeit Anwärter im Forstamt<br />
Stadtroda) mit der GOTTLOB-KÖNIG-Medaille in Bronze.<br />
13
Der Vorsitzende <strong>des</strong> TFV Hagen Dargel ehrt Alexander Hopf.<br />
Grußworte kamen von den Landtagsabgeordneten:<br />
Egon Primas (CDU), Thilo Kummer (Die Linke),<br />
14
Dr. Frank Augsten (Bündnis90/Die Grünen) und Dirk Bergner (FDP)<br />
Die Abgeordneten hatten danach Gelegenheit, sich mit Grußworten an <strong>das</strong><br />
Auditorium zu wenden.<br />
Egon Primas von der CDU-Fraktion erklärte, <strong>das</strong>s der initiierte Rechtsformwechsel<br />
der Forstverwaltung vom Landtag grundsätzlich mitgetragen wird.<br />
Dabei darf <strong>das</strong> Prinzip <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes nicht in Frage gestellt<br />
werden. „Der Kleinprivatwald muss jederzeit auf den staatlichen Revierförster<br />
zurückgreifen können“, forderte Primas.<br />
Von den Oppositionsparteien hielt als erster Thilo Kummer von der Fraktion<br />
„Die Linke“ sein Grußwort. Er beklagte, <strong>das</strong>s bezüglich Anstaltsbildung,<br />
Flächenstilllegung und Waldumbau aktuell mehr Fragen offen sind, als <strong>das</strong>s<br />
Antworten gegeben werden. Deshalb sei auch der Saal so stark gefüllt. Seiner<br />
Ansicht nach wäre mehr Effizienz auch im Regiebetrieb möglich, wenn<br />
genügend Menschen im Wald tätig sein könnten.<br />
Ähnlich äußerte sich auch Dr. Frank Augsten von der Fraktion „Bündnis90/Die<br />
Grünen“. Seiner Meinung nach müssen ausscheidende Waldarbeiter durch junge,<br />
leistungsfähige Kollegen ersetzt werden. Er macht sich Sorgen, <strong>das</strong>s durch die<br />
anstehende Reform der gute Ruf der <strong>Thüringer</strong> Forstverwaltung Schaden<br />
nehmen könnte.<br />
Dirk Bergner von der FDP-Fraktion hob in seinem Grußwort die wirtschaftliche<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Clusters Forst und Holz hervor. Die FDP wird die<br />
Anstaltsbildung im Landtag kritisch begleiten, sie sieht aber auch Chancen in der<br />
Veränderung. Der Wald als Kulturgut müsse erhalten bleiben.<br />
15
Den ersten Vortrag <strong>des</strong> Tages hielt<br />
Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne,<br />
Abteilungsleiter Forsten und Naturschutz im<br />
<strong>Thüringer</strong> Ministerium <strong>für</strong> Landwirtschaft,<br />
Forsten, Umwelt und Naturschutz,<br />
er referierte zum Thema<br />
„ThüringenFORST im Wandel – Wie soll es weitergehen?“<br />
In seiner Analyse der Ausgangssituation und Rahmenbedingungen stellte er fest,<br />
<strong>das</strong>s in Thüringen die Einheitsforstverwaltung in Form <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes<br />
am besten die gleichzeitige Erfüllung von Nutz-, Schutz- und<br />
Erholungsfunktion gewährleistet und Garant <strong>für</strong> wirtschaftliche Wertschöpfung<br />
und Gemeinwohl ist. Die Branche Forst und Holz stellt im strukturschwachen<br />
ländlichen Raum 40.000 Vollzeitarbeitsplätze und ist damit größter „ländlicher“<br />
Arbeitgeber in Thüringen. 100 Festmeter Holz garantieren 1,2 Arbeitsplätze und<br />
jeder Festmeter, der in Thüringen eingeschlagen und verarbeitet wird, generiert<br />
über die Verarbeitungskette ein nicht bereinigtes Steueraufkommen von rund<br />
110.- €. Die größten Holzreserven sind noch im Kleinprivatwald zu finden, die<br />
durch <strong>das</strong> Projekt „Privatwaldmobilisierung“ erschlossen werden sollen. 90<br />
Prozent <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Rohholzaufkommens werden im Freistaat weiterverarbeitet.<br />
Mit einem jährlichen Umsatzvolumen von 2 Mrd. Euro ist die Branche einer der<br />
wichtigsten Wirtschaftsmotoren in Thüringen. Davon verbleiben etwa 250 Mio.<br />
Euro als Steueraufkommen in den Kassen <strong>des</strong> Freistaates. Thöne beschrieb<br />
weiterhin die zunehmende Bedeutung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> aus Sicht <strong>des</strong> Naturschutzes<br />
als aktive Daseinsvorsorge zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen. So sind<br />
aktuell 64 % der Waldflächen mit einer Schutzkategorie (einschl. Natura 2000)<br />
belegt, 1990 waren es nur 2,9 %.<br />
Unter Totalschutz stehen mit Stand 2010 in Thüringen fast 9.400 ha (= 1,7 % der<br />
Waldfläche), 1990 waren es nur etwas mehr als 1.000 ha. „Im deutschlandweiten<br />
Ländervergleich erzielt die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung Spitzenleistungen“,<br />
bilanzierte Thöne und führte als weitere Belege da<strong>für</strong> die Marktführerschaft<br />
der <strong>Thüringer</strong> Sägewerke und den vergleichsweise hohen<br />
16
Beförsterungs- sowie Zusammenschlussgrad im Privat- und Kommunalwald an.<br />
Diese Leistungen hat die Forstverwaltung mit immer weniger Personal erbracht,<br />
so sank die Anzahl der Beschäftigten von 2.556 im <strong>Jahr</strong> 1991 auf 1.597 im <strong>Jahr</strong><br />
2010.<br />
Abb.: Personalentwicklung in der <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung<br />
Die Zahl der Forstämter wurde in dem Zeitraum von 60 auf 28 und die<br />
Revieranzahl von 487 auf 299 reduziert. Obwohl im Vergleich mit anderen<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltungen die Beschäftigungsquote im Verwaltungsbereich (ohne<br />
Waldarbeiter) in Thüringen schon jetzt vergleichsweise gering ist, sieht der<br />
Abbaupfad aus der Behördenstrukturreform 2005 einen weiteren Personalabbau<br />
auf 1.375 Stellen im <strong>Jahr</strong> 2021 vor. Und auch die aktuelle Lan<strong>des</strong>regierung hat<br />
die Streichung von 5.200 Stellen im Lan<strong>des</strong>dienst angekündigt, von dem auch<br />
der Geschäftsbereich <strong>des</strong> TMLFUN betroffen sein wird. Um die Forstverwaltung<br />
zukunftsfähig zu gestalten, wurde ein Gesetz über die Reform der<br />
Forstverwaltung entwickelt, <strong>das</strong>s am 15. März <strong>2011</strong> ins Kabinett eingebracht<br />
wurde im Laufe <strong>des</strong> Sommers <strong>das</strong> parlamentarische Verfahren durchlaufen soll.<br />
Ziel ist es, die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen<br />
Rechts (Lan<strong>des</strong>forstanstalt) zu überführen.<br />
Mit diesem Rechtsformwechsel sind folgende Ziele verbunden:<br />
● Erhalt <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit allen Aufgaben,<br />
● keine zusätzliche Belastung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>haushalts,<br />
● Defizitabbau/Reduzierung der Finanzzuführung<br />
● höhere Flexibilität, wirtschaftlicheres Handeln,<br />
● bedarfsgerechte Neueinstellungen,<br />
● Umsetzung von Effizienzpotenzialen.<br />
17
In die zu gründende Lan<strong>des</strong>forstanstalt sollen alle staatlichen Forstämter einschl.<br />
Sonderaufgaben, der Nationalpark Hainich, die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>anstalt <strong>für</strong><br />
Wald, Jagd und Fischerei sowie Teile <strong>des</strong> Ministeriums übergehen. Der<br />
Personalübergang erfolgt unter Wahrung <strong>des</strong> Besitzstan<strong>des</strong> per Gesetz. Die<br />
Anstalt soll Tarif- und Dienstherrenfähigkeit erhalten. Im Anstaltsgesetz sollen<br />
auch die Finanzzuführungen bis 2018 festgeschrieben werden, sie werden von<br />
knapp 44 Mio. Euro im Bezugsjahr 2010 auf 32 Mio. Euro nach 2018 sinken. Es<br />
wird davon ausgegangen, <strong>das</strong>s im betrieblichen Ausgabenbereich bis 2018<br />
zumin<strong>des</strong>t kostendeckend gearbeitet kann, so <strong>das</strong>s die Lan<strong>des</strong>forstanstalt 32 Mio.<br />
Euro <strong>für</strong> ihre hoheitlichen Aufgaben erhalten wird. Die Reduzierung der<br />
Zuführung um 12 Mio. Euro von 2010 bis 2018 soll durch Erhöhung der<br />
Wirtschaftlichkeit, der Erschließung neuer Geschäftsfelder und Strukturoptimierungen<br />
erreicht werden.<br />
Entsprechende Kalkulationen unterstellen dabei Neueinstellungen von Personal<br />
in der Größenordnung von 16 Personen je <strong>Jahr</strong> (5 Waldarbeiter, 5 mittlerer u. 5<br />
gehobener Dienst, 1 höherer Dienst).<br />
In den kommenden Monaten und <strong>Jahr</strong>en will die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung<br />
folgende Strukturoptimierungen prüfen und umsetzen:<br />
● Zentralisierung von Aufgaben an Schwerpunktforstämtern bzw. in der<br />
Zentrale,<br />
● Deregulierung von Fördervorschriften,<br />
● Erhöhung <strong>des</strong> Leistungsanteils forstlicher Lohnunternehmer, ggf. mehr<br />
Stockverkauf,<br />
● Reduzierung betrieblicher Ausbildungsstätten <strong>für</strong> Forstwirte, mehr<br />
überbetriebliche Ausbildung im 1. Ausbildungsjahr am Forstlichen<br />
Bildungszentrum Gehren (FBZ),<br />
● Optimierung <strong>des</strong> Personaleinsatz z. B. durch Übertragung höherwertiger<br />
Tätigkeiten (Durchlässigkeit Laufbahngruppen) oder Erschließung<br />
anderer Einsatzbereiche im Lan<strong>des</strong>dienst,<br />
● Optimierung der Reviergrößen unter Berücksichtigung der jetzigen<br />
Unterschiede in der Flächengröße (Hoheitsfläche 783 bis 5.949 ha,<br />
Bewirtschaftungsfläche 324 bis 2.345 ha), Zusammenfassung kleinerer<br />
Staatswaldflächen in den Revieren (< 10 % Staatswald) zur<br />
Verringerung <strong>des</strong> Mischeigentums in den Revieren, dient der<br />
Konzentration und Spezialisierung,<br />
● Weiterentwicklung von Bestverfahren, Prozessoptimierung (z.B. fotooptische<br />
Poltervermessung sScale).<br />
Vorgeschaltet bzw. parallel zur Forststrukturreform wird die 5. DVO zum<br />
<strong>Thüringer</strong> Waldgesetz, die die Beratung und Betreuung <strong>des</strong> Kommunal- und<br />
18
Privatwal<strong>des</strong> regelt, novelliert. Ein Kernpunkt dieser Novelle ist Anpassung der<br />
von den Waldbesitzern zu zahlenden Kostensätze.<br />
Nach den Ausführungen von Thöne sollen als weitere Ziele erreicht werden:<br />
● die schrittweise Reduzierung <strong>des</strong> Verwaltungsaufwands,<br />
● die Einsparung von Personal und Kompensation von Personalabgängen,<br />
● die Erhöhung der Eigenverantwortung <strong>des</strong> Waldbesitzers,<br />
● die Unterstützung <strong>des</strong> forstlichen Zusammenschlusswesens sowie<br />
● die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum (Eigenbeförsterung,<br />
Management, Vermarktung, Buchführung).<br />
Neben der Weiterführung <strong>des</strong> Gesetzgebungsverfahrens stehen als weitere<br />
Schritte die Erarbeitung eines Nutzungsüberlassungsvertrages <strong>für</strong> die<br />
Liegenschaften, die Entwicklung einer Unternehmensstrategie (Zielkatalog) und<br />
die Erarbeitung einer Satzung <strong>für</strong> die AöR an.<br />
Als zweiter Vortragender referierte<br />
Prof. Max Krott,<br />
Professor <strong>für</strong> Forst- und Naturschutzpolitik an<br />
der Universität Göttingen,<br />
über die<br />
„Entwicklung von ThüringenFORST aus Sicht eines<br />
wissenschaftlichen Beraters“.<br />
An Hand eines Netzdiagramms stellte er die Leistungen der <strong>Thüringer</strong><br />
Forstverwaltung dar und diskutierte die erwarteten Entwicklungen unter den<br />
Bedingungen einer Anstalt öffentlichen Rechts.<br />
19
Abb.: Leistungen von ThüringenFORST heute (rote Linie) und erwartet unter<br />
den Bedingungen einer Anstalt öffentlichen Rechts (blaue Pfeile).<br />
Unter dem Stichpunkt „Märkte“ analysierte Krott <strong>das</strong> Holzaufkommen im<br />
Freistaat Thüringen. Dabei hob er den Erfolg <strong>des</strong> Projektes<br />
„Privatwaldmobilisierung“, <strong>das</strong> die Steigerung der Nutzung in den<br />
nichtstaatlichen Wäldern zum Ziel hat, hervor. Der Staatswald war in Thüringen<br />
bisher ein sehr gemeinwohlorientierter Marktpartner, der im Rahmen <strong>des</strong><br />
Gemeinschaftsforstamtes auch <strong>das</strong> Holz aus dem Betreuungswald<br />
gleichberechtigt vermarktet hat. Der Wissenschaftler erwartet, <strong>das</strong>s sich eine<br />
AöR marktorientierter verhalten wird. Eigene Potentiale werden besser<br />
ausgeschöpft werden. Möglicherweise könnte eine AöR auch mit dem<br />
Privatwald konkurrieren; in diesem Fall müsste nach Krott der Verwaltungsrat<br />
seiner Aufsichtspflicht nachkommen.<br />
In Bezug auf „Neue Märkte“ wird die Lan<strong>des</strong>forstanstalt versuchen, diese zu<br />
erschließen. Der Energieholzmarkt ist derzeit der wichtigste neue Markt. Aber<br />
nur weil man <strong>das</strong> Produkt hat, kann man nach Meinung von Krott nicht<br />
automatisch in diesen Markt einsteigen. Großmärkte zu erschließen bedarf Kraft<br />
und Professionalität und ist eigentlich auch nicht Aufgabe <strong>des</strong> Staates. Insofern<br />
hat er Zweifel, ob die Anstalt <strong>das</strong> machen wird. Anhand der Betriebsergebnisse<br />
konnte Krott belegen, <strong>das</strong>s ThüringenFORST bisher keinen „Gewinn“<br />
erwirtschaftet hat.<br />
Die Anstalt wird in dieser Beziehung eine andere Zielrichtung haben, wobei<br />
Gewinn auch kein Indikator <strong>für</strong> die Leistungen eines Gemeinschaftsforstamtes<br />
ist. Die Gemeinwohlaufgaben machen die Betriebsführung schwieriger als in<br />
20
einem reinen Wirtschaftsbetrieb. Mit der Gewinnorientierung in der Anstalt wird<br />
auch die „Kosteneffizienz“ zunehmen.<br />
Die gesetzlich geregelten Gemeinwohlziele werden in Thüringen durch <strong>das</strong><br />
Gemeinschaftsforstamt sehr effizient erbracht, was insbesondere auch <strong>das</strong><br />
Fachgutachten aus dem <strong>Jahr</strong> 1997 bestätigt hat. Krott be<strong>für</strong>chtet, <strong>das</strong>s der<br />
gesetzliche Auftrag allein nicht ausreichen wird, diese auch zukünftig zu<br />
gewährleisten. So haben sich beispielsweise die Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten<br />
bei flauem Holzmarkt mehr den Gemeinwohlaufgaben gewidmet, dieses<br />
Engagement bei anziehendem Holzmarkt jedoch wieder zurück genommen. Zu<br />
den Kernkompetenzen der Gemeinwohlorientierung gehört die Gewährleistung<br />
der „Forstlichen Nachhaltigkeit“ durch die Forsteinrichtung, so existieren im<br />
Harz schon seit 400 <strong>Jahr</strong>en Forsteinrichtungspläne. Hier wird die Anstalt sicher<br />
die bisherige Arbeit fortsetzen.<br />
Die <strong>Thüringer</strong> Forst-Minister waren in den letzten 20 <strong>Jahr</strong>en starke „Sprecher der<br />
Forstwirtschaft“. Krott erwartet, <strong>das</strong>s sich die Lan<strong>des</strong>anstalt moderater verhalten<br />
wird, denn „ein Kaufmann wird es sich mit niemand verderben“. Er warnt vor<br />
einem Vakuum, da insbesondere der Privatwald in den neuen Ländern diese<br />
Aufgabe noch nicht wahrnehmen kann. Weiterhin ist eine Herausforderung,<br />
„Mediator <strong>für</strong> alle im Wald“ zu bleiben. Wenn die Förster dieses Aufgabenfeld<br />
verlassen, werden es andere machen (z. B. Raumplaner, Naturschutz).<br />
Um gerade auch die Gemeinwohlorientierung unter den Bedingungen einer<br />
Anstalt öffentlichen Rechts zu sichern, schlägt Krott zum Abschluss seines<br />
Vortrages eine Leistungssicherung durch Benchmarking vor. Dazu sollen alle 5<br />
<strong>Jahr</strong>e die in dem Vortrag diskutierten Leistungen neu bewertet werden. Das wäre<br />
auch in Europa ein neuer, innovativer Ansatz.<br />
21
„Thüringen hat die beste Forstverwaltung,<br />
aber Niedersachsen ist <strong>das</strong> beste<br />
Forstunternehmen“, mit dieser Aussage<br />
eröffnete<br />
Dr. Klaus Merker,<br />
Präsident der Niedersächsischen<br />
Lan<strong>des</strong>forsten (NLF),<br />
seinen Vortrag<br />
„Von der Verwaltung zum Unternehmen – Erfahrungen der<br />
Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten“.<br />
Bis 1996 war die Niedersächsische Lan<strong>des</strong>forstverwaltung eine 3-stufige<br />
Verwaltung mit zuletzt 80 Forstämtern und 451 Revieren. Während 1955<br />
Gewinnmaximierung <strong>das</strong> offizielle Ziel war, musste schon wenige <strong>Jahr</strong>e später<br />
die Forstverwaltung mit immer höheren Beträgen bezuschusst werden. Im <strong>Jahr</strong>e<br />
1993 war ein Tiefpunkt erreicht, der dazu führte, selbst die Initiative zu ergreifen<br />
und eine Änderung herbei zu führen.<br />
Mit den Reformen 1997 und 2000 erfolgte die Umstellung auf eine 2-stufige<br />
Verwaltung sowie eine Reduktion von 80 Forstämtern mit 451 Revieren auf 45<br />
Forstämter mit 340 Revieren.<br />
Im Zuge der Reform der Allgemeinen Verwaltung im <strong>Jahr</strong> 2004 wurde die<br />
Ausgliederung der Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forste aus der unmittelbaren<br />
Lan<strong>des</strong>verwaltung als Anstalt öffentlichen Rechts mit der Betriebszentrale in<br />
Braunschweig vorgenommen.<br />
Die Zahl der Forstämter wurde abermals auf 26, die Zahl der Revierförstereien<br />
auf 274 reduziert. Als Servicestellen gehören zur Anstalt <strong>das</strong> Nds.<br />
Forstplanungsamt in Wolfenbüttel und <strong>das</strong> Nds. Forstliche Bildungszentrum in<br />
Münchehof.<br />
Mit dieser Reform wurden folgende Ziele verbunden:<br />
● Effiziente Verwaltungsstrukturen im Forstwesen, Trennung von Hoheit<br />
(Ministerium, Landkreise, Landwirtschaftskammer) und Betrieb (NLF)<br />
● Nutzung kaufmännischer Freiheiten als öffentliches Unternehmen/<br />
Ausgliederung der NLF als rechtsfähige AöR<br />
22
● Beitrag zur Haushaltskonsolidierung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
■ Verkauf von Liegenschaften der NLF (132 Mio. € bis 2014) bei<br />
vollständiger Eigentumsübertragung aller Liegenschaften<br />
■ Kostendeckung <strong>des</strong> Forstbetriebes der NLF bis 2008<br />
(04: - 20 Mio. €)<br />
■ Einfrieren <strong>des</strong> Budgets <strong>für</strong> die Dienstleistungen<br />
(PB 2 – 5,25 Mio. €)<br />
Das Fazit nach 11 <strong>Jahr</strong>en Reformen in der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung plus 6 <strong>Jahr</strong>e<br />
Niedersächsische Lan<strong>des</strong>forsten fällt laut Merker positiv aus. Alle Ziele wurden<br />
schneller erreicht als geplant und teilw. übertroffen (u. a. Kostendeckung im<br />
Forstbetrieb nach 45 <strong>Jahr</strong>en in 2006 erreicht, vollständige Abführung der Erlöse<br />
aus Liegenschaftsverkäufen schon 2012).<br />
Abb.: Ergebnisse der Forstreformen in Niedersachsen<br />
Die Strategie <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>, die Lan<strong>des</strong>forsten organisatorisch als öffentliches<br />
Unternehmen neu aufzustellen, hat sich bewährt. Hauptgründe <strong>für</strong> <strong>das</strong> Gelingen<br />
waren die richtige Strategie und vor allem die engagierte Umsetzung durch alle<br />
Mitarbeiter/innen. Für die NLF bedeutet die hart erarbeitete Konsolidierung eine<br />
gute Ausgangslage <strong>für</strong> eine eigenverantwortliche Gestaltung der zukünftigen<br />
Entwicklungen.<br />
23
Sehr ausführlich ging Merker in seinen Vortrag auf die Erfolgsfaktoren ein.<br />
Unter der Überschrift „Eigentum & Vermögen“ bilanzierte er ein „Naturkapital“<br />
von 342.000 ha Waldeigentum, wovon 306.000 ha Produktionsfläche sind, dazu<br />
kommen 80.000 ha von den NLF betreute Körperschaftswälder.<br />
Der Holzvorrat beträgt 256 Vfm/ha, der Hiebssatz liegt bei etwa 1,75 Mio. Efm.<br />
Der Hiebssatz ist in 6 <strong>Jahr</strong>en durch Verkauf und Management-Pläne um 150.000<br />
FM gesunken. Trotzdem gehören zum „Naturkapital“ selbstverständlich auch die<br />
Naturschutzflächen.<br />
Die NLF haben ihre gewerblichen Tätigkeiten in eine NLF-Services-GmbH<br />
ausgegliedert, weiterhin ist sie an einem Holzkraftwerk beteiligt. Im <strong>Jahr</strong> 2008<br />
wurde aus Gewinnen eine Stiftung zur Wahrnehmung von Gemeinwohlaufgaben<br />
gegründet.<br />
Folgende betriebswirtschaftliche Kennzahlen beschreiben die<br />
Vermögenssituation:<br />
● Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten:<br />
■ Bilanzsumme: 1 Mrd. €<br />
■ <strong>Jahr</strong>esumsatz: 130 Mio. €<br />
■ Nettowertschöpfung: 60 Mio. €<br />
■ Unternehmerleistungen: 30 Mio. €<br />
■ Operativer Gewinn (2010): 12 Mio. €<br />
■ Rücklage: 24 Mio. €<br />
● NLF-Services-GmbH:<br />
■ Eigenkapital 25.000 €<br />
■ <strong>Jahr</strong>esumsatz 1,6 Mio. €<br />
■ Gewinn (2010) 0,35 Mio. €<br />
● Stiftung Zukunft Wald:<br />
■ Kapitalstock 2 Mio. €<br />
■ Zustiftungen, Spenden 100.000 €/<strong>Jahr</strong><br />
Das Prinzip „Verantwortung“ ist ein wichtiger Erfolgsfaktor <strong>für</strong> Merker. Zur<br />
Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der NLF bedarf es Mitarbeiter, die gerne und<br />
engagiert Verantwortung übernehmen. Mitarbeiter übernehmen gerne Verantwortung,<br />
wenn sie die notwendigen Entscheidungen treffen können.<br />
Merker sagte: „Für die Prozesse und Weichenstellungen, <strong>für</strong> die wir nicht die<br />
notwendigen Entscheidungen treffen können, können wir dementsprechend auch<br />
keine Verantwortung übernehmen. Je besser die Übereinstimmung über die<br />
gemeinsamen Vorstellungen ist, <strong>des</strong>to leichter trägt sich Verantwortung und<br />
führt es sich. Dies gilt <strong>für</strong> <strong>das</strong> Zusammenspiel von Politik und Ministerium mit<br />
24
der NLF genauso wie NLF-intern.“ Der Gestaltung der Aufbau- und<br />
Ablauforganisation folgte eine Leitbilddiskussion unter Einbeziehung aller<br />
Mitarbeiter. Präsident und Vizepräsident der NLF haben dazu innerhalb eines<br />
<strong>Jahr</strong>es alle Dienststellen bereist.<br />
Dieser Prozess wurde 2009 abgeschlossen, er führte zu folgenden Kernaussagen:<br />
● Wald als Quelle <strong>des</strong> nachwachsenden Rohstoffs Holz, als natürlicher<br />
Lebensraum <strong>für</strong> Tiere und Pflanzen und als Umwelt <strong>für</strong> die Menschen<br />
sowie unser Grundeigentum sind bedeutende Ressourcen.<br />
● Wir erhalten und entwickeln dieses uns anvertraute Vermögen den<br />
Prinzipien einer umfassenden Nachhaltigkeit folgend <strong>für</strong> zukünftige<br />
Generationen.<br />
● Im Einklang damit entwickeln wir die Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten<br />
zu einem innovativen, wettbewerbsfähigen und erfolgreichen<br />
Unternehmen.<br />
Weiter untermauert wird <strong>das</strong> Leitbild durch die in der Satzung festgelegten<br />
Grundsätze und Ziele der Geschäftsführung. Dort heißt es u. a.: Die<br />
Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten gewährleisten eine nachhaltige Vermögensentwicklung<br />
<strong>des</strong> übertragenen Eigentums nach kaufmännischen Grundsätzen<br />
unter Berücksichtigung ausreichender Sicherheit (Naturnaher Waldbau, Risikomanagement,<br />
Risikorücklage – Ziel derzeit 30 Mio. Euro), Liquidität (halbes<br />
<strong>Jahr</strong> Personalaufwand) und Rentabilität („angemessener Gewinn“ – derzeit 10 %<br />
Umsatzrendite). Die NLF betreiben eine nachhaltige Umweltvorsorge, den<br />
Schutz der natürlichen Ressourcen und die Entwicklung <strong>des</strong> Erholungswertes<br />
entsprechend der Regelungen <strong>des</strong> Niedersächsischen Gesetzes über den Wald<br />
und die Landschaftsordnung. Die Bewirtschaftung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>wal<strong>des</strong> ist in<br />
besonderer Weise dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie richtet sich nach den<br />
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen und naturnahen Forstwirtschaft und dem<br />
Regierungsprogramm zur „Langfristigen Ökologischen Waldentwicklung in den<br />
Lan<strong>des</strong>forsten“ (LÖWE).<br />
In einem Exkurs stellte Merker die Frage, wie die Forderung <strong>des</strong> Naturschutzes<br />
nach Stilllegung von Wäldern aus Sicht der AöR zu bewerten ist? Die Forderung<br />
von BUND/NABU, 20 % im öffentlichen Wald stillzulegen, würde in den<br />
Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten die komplette Buchenwaldfläche von 68.000<br />
ha betreffen. Das wäre ein gigantischer Wertverlust und würde ca. 20 bis 30 %<br />
der Arbeitsplätze kosten.<br />
Dagegen ist die Zunahme an Artenvielfalt noch nicht definiert und nach<br />
Meinung von Merker mit LÖWE ähnlich wirkungsvoll zu sichern.<br />
Im <strong>Jahr</strong> 2010 hatten die Niedersächsischen Lan<strong>des</strong>forsten 1.230 Mitarbeiter, 16<br />
<strong>Jahr</strong>e vorher waren es noch 2.100. Der Personalabbau hat hauptsächlich<br />
Forstwirte und Beamte getroffen. Aber es wurde nicht nur abgebaut, seit 2005<br />
25
hat die NLF 92 neue Mitarbeiter eingestellt, davon 35 im <strong>Jahr</strong> 2010. Auch in<br />
Zukunft wird es Veränderungen geben, Merker sagte: „Organisation,<br />
Personalentwicklung und alle Veränderungsprozesse folgen den strategischen<br />
Notwendigkeiten – und die ändern sich beständig.“<br />
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess wurde vom Referenten <strong>für</strong> die<br />
Personal- und Organisationsentwicklung dargestellt. Ziele im Waldarbeitsbereich<br />
sind eine voranschreitende Höhermechanisierung (Ziel 70 %) sowie die<br />
optimale Verbindung von Eigenregie und ausgelagertem Unternehmereinsatz<br />
(Ziel 1/3 zu 2/3). Ein organisatorischer Kernprozess ist die Optimierung der<br />
Teilautonomen Arbeitsgruppe. Dieser wird unterstützt durch verschiedene<br />
Programme wie beispielsweise die Einführung eines Gesundheitsmanagements<br />
<strong>für</strong> Forstwirte, Optimierung der persönlichen Schutzausrüstung, Betriebsfahrzeuge<br />
<strong>für</strong> die Teilautonomen Arbeitsgruppen oder die Qualifikation von<br />
Forstwirten zu Angestellten. In den Revieren und Forstamtsbüros sind die<br />
Nutzung marktkonformer Konjunktur- und Preisvorteile bei Abkehr vom<br />
inversen Angebotsverhalten sowie Spezialisierung in bestimmten Arbeitsfeldern<br />
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutz, Logistik, Walderlebniseinrichtungen)<br />
Ziele der Personal- und Organisationsentwicklung. Als Programm dazu wurden<br />
die Einstellung von Spezialisten z. B. <strong>für</strong> EDV, Controlling, Steuer, der Abbau<br />
<strong>des</strong> Beförderungsstaus, die Konzeption zur Führungskräfteentwicklung, <strong>das</strong><br />
Konzept zur Arbeitsorganisation auf Revierebene sowie die private Nutzung von<br />
Firmenwagen vom Präsidenten der NLF genannt.<br />
26
Zum Thema Holzpreise und finanzielle Erwartungen an die Anstalt stellte<br />
Merker zwei Aussagen nebeneinander:<br />
● Vorher (2005): „Die Lan<strong>des</strong>forsten werden ihre Vorräte und den nachhaltigen<br />
Hiebssatz übernutzen, um die überhöhten finanziellen Vorgaben zu erfüllen.“<br />
Holzpreisentwicklung in Niedersachsen<br />
● Nachher (heute): „Bei den Holzpreisen ist die Entwicklung doch kein<br />
Wunder.“<br />
Abb.: Hiebssatz und Einschlag NLF<br />
Mit zwei Darstellungen konnte er diese Aussagen jedoch widerlegen. So stieg<br />
zwar der Holzdurchschnittspreis von ca. 38 Euro/fm 2005 auf nunmehr über 50<br />
Euro/fm an, aber er liegt damit immer noch unter dem Preisniveau von fast 60<br />
Euro/fm, <strong>das</strong> vor 10 <strong>Jahr</strong>en erreicht wurde. Auch der Einschlag der NLF lag, mit<br />
Ausnahme <strong>des</strong> Kyrill-<strong>Jahr</strong>es 2007, im Rahmen <strong>des</strong> Hiebssatzes. Neben den<br />
Geschäftsfeldern Holz und Jagd sind die NLF in vier neuen Geschäftsfeldern<br />
tätig, <strong>das</strong> sind Energiewende/Bioenergie, gewerbliche Arbeiten (Bündelung in<br />
der NLF Services-GmbH), Naturdienstleistungen (Kompensationspools) und<br />
Immobilienmanagement (Entwicklung <strong>des</strong> Grundeigentums).<br />
Merker beendete seinen überzeugenden Vortrag mit einem Fazit, <strong>das</strong> er in vier<br />
Thesen zusammenfasste:<br />
1. Die „Idee“, der geschaffene Rahmen und die Strategien befinden sich<br />
bei der NLF seit sechs <strong>Jahr</strong>en in guter Übereinstimmung.<br />
27
2. Gestaltungsfreiraum und Verantwortungsbewusstsein erzeugen<br />
Dynamik und gute Lösungen.<br />
3. Die NLF ist auf dem Weg zu einem innovativen, wettbewerbsfähigen<br />
und erfolgreichen Unternehmen ein gutes Stück vorangekommen.<br />
4. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung <strong>des</strong> eingeschlagenen Weges<br />
erlaubt sehr positive Prognosen.<br />
Nach der Mittagspause trat<br />
Michael Selmikat,<br />
Sachgebietsleiter<br />
<strong>des</strong> Stadtforstes Wernigerode,<br />
ans Podium und sprach zu dem Thema<br />
„Multifunktionalität im kommunalen Forst – Ausgleich vielfältiger<br />
Interessen“<br />
Der im Harz gelegene Stadtwald Wernigerode hat eine Fläche von ca. 2.000 ha<br />
und verfügt über einen Holzvorrat von 210 Fm/ha. Der Zuwachs von über 9 Fm<br />
wird etwa zu 60 % genutzt. Die Wernigeröder haben eine <strong>Jahr</strong>hunderte lange,<br />
enge Beziehung zu ihrem Wald. Die erste urkundliche Erwähnung einer<br />
Holzung, die den Bürgern gehört, erfolgte schon vor über 600 <strong>Jahr</strong>en. Zu den<br />
Besonderheiten <strong>des</strong> Stadtwal<strong>des</strong> zählen eine starke topographische Gliederung<br />
mit einem großen Anteil an Steilhanglagen, naturschutzfachlich wertvolle<br />
Feuchtstandtorte und landschaftsprägende Bergwiesen. In einem kommunalen<br />
Wald spielt die Erholungsfunktion eine besondere Rolle. So ist in den stadtnahen<br />
Bereichen ein besonders hoher Besucherdruck zu verzeichnen. Neben<br />
ausgewiesenen Rad-, Mountainbike- und Skilanglaufstrecken gibt es zahlreiche<br />
Wanderwege, z. T. mit Themenbezug wie z. B. der Blinden-Wanderweg.<br />
Die Betriebs- und Revierleitung erfolgt durch <strong>das</strong> städtische Sachgebiet<br />
„Stadtforst“. Neben dem Sachgebietsleiter sind dort weiterhin eine Revierförsterin,<br />
eine Sachbearbeiterin und vier Waldarbeiter tätig.<br />
28
Das Sachgebiet muss die Vertretung städtischer Forstinteressen in einer Vielzahl<br />
von Planungsgremien und Arbeitskreisen absichern und erbringt Dienstleistungen<br />
<strong>für</strong> andere Bereiche der städtischen Verwaltung.<br />
Die inner- und überbetrieblichen Ziele bilden <strong>für</strong> den Stadtforst Wernigerode die<br />
Grundlage <strong>des</strong> Handelns. Zu den innerbetrieblichen Zielen gehören die<br />
betriebswirtschaftliche Nutzung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>, die langfristige Stabilisierung und<br />
Mischung der Waldbestände, die kontinuierliche Erhöhung der Holzvorräte, die<br />
Bewirtschaftung der Waldbestände auch bei schwierigen Geländebedingungen<br />
durch geeignete Verfahren, die Verringerung der überdurchschnittlich hohen<br />
Verjüngungsflächen, die Mobilisierung <strong>des</strong> nachwachsenden Rohstoffes Holz<br />
zur Nachfragebefriedigung und zur Entlastung <strong>des</strong> städtischen Haushaltes sowie<br />
die intensive Reduzierung der Wilddichte (Zitat Selmikat: „Ohne starke Jagd<br />
kein zukunftsfähiger Waldumbau“).<br />
Stück<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Schalenwildstrecke im Stadtwald<br />
Wernigerode<br />
Abb.: Schalenwildstrecke Stadtwald Wernigerode<br />
Als überbetriebliche Ziele nannte der Referent die Gestaltung und Pflege<br />
ökologischer Bereiche, den Erhalt der Schutzfunktionen, den Erhalt der<br />
Nichtholzbodenflächen (Bergwiesen, Wildäsung, Flächengliederung, Sportflächen),<br />
die Berücksichtigung der überdurchschnittlichen Beanspruchung durch<br />
verschiedenste Waldbesucher sowie ein ansprechen<strong>des</strong> Angebot an touristischer<br />
Infrastruktur.<br />
Die Umsetzung der städtischen Eigentümerinteressen erfolgt durch Beschlüsse<br />
<strong>des</strong> Stadtrates. Dabei ist die Waldordnung der Stadt Wernigerode wichtigste<br />
29<br />
Rotwild<br />
Rehwild<br />
Schwarzwild<br />
Muffelwild
Handlungs- und Rechtsgrundlage <strong>für</strong> den Forstbetrieb einschl. der jagdlichen<br />
Nutzung der Wälder.<br />
Sie wird ergänzt um die jährliche Beschlussfassung über den Finanzhaushalt<br />
sowie um Beschlüsse zur Umsetzung touristischer Nutzungsmöglichkeiten. In<br />
der praktischen Umsetzung ergeben sich immer wieder Handlungs-Alternativen,<br />
die bewertet und entschieden werden müssen.<br />
Von den zahlreichen Beispielen, die Selmikat aufführte, seinen zwei beispielhaft<br />
herausgegriffen:<br />
So ist bei der Walderschließung stets die touristische Nutzung als Rad- oder<br />
Wanderweg mit den Ansprüchen der Holzabfuhr abzuwägen.<br />
Auch im Rahmen <strong>des</strong> Biotopschutzes gilt es abzuwägen zwischen Aufforstung<br />
oder Erhalt von Nichtholzböden oder zwischen der Einstufung eines Baumes als<br />
Gefahr oder Biotop.<br />
Für den Sachgebietsleiter ist es wichtig, wenn möglich rechtzeitig zu agieren<br />
statt zu reagieren. Entscheidungen werden am besten vor Ort unter<br />
Berücksichtigung der Wünsche <strong>des</strong> „Kunden“ sowie unter Einbeziehung<br />
wirtschaftlicher Aspekte getroffen.<br />
Der Vertreter der Stadt Wernigerode beendete seine Ausführungen mit einer<br />
Auflistung von Planungsschwerpunkten sowie einigen Wünschen <strong>für</strong> die<br />
Zukunft. Bis 2019 sind 290 ha im Stadtwald zu verjüngen, die Einbringung von<br />
Mischbaumarten zu forcieren, Läuterungen auf 48 ha zu erbringen und die<br />
geplante Nutzung (75 % Vor- u. 25 % Endnutzung) umzusetzen, eine angepasste<br />
Wilddichte herzustellen und <strong>das</strong> Wegesystem zu vervollständigen. Dabei sind<br />
die Schutz- und Erholungsfunktion <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> zu erhalten.<br />
Weiterhin nannte Selmikat als Wünsche <strong>für</strong> die Zukunft die Stärkung <strong>des</strong><br />
Waldeigentums gegenüber der städtischen Planungshoheit, stabile Holzpreise auf<br />
hohem Niveau sowie Holz der kurzen Wege, starke Forstverwaltungen mit<br />
motiviertem Personal vor Ort und weniger Strukturveränderungen.<br />
30
Die Sicht <strong>des</strong> in forstwirtschaftlichen<br />
Vereinigungen organisierten Privatwal<strong>des</strong><br />
wurde bei dieser Tagung durch<br />
Josef Ziegler<br />
von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung<br />
Oberpfalz (Bayern) dargestellt,<br />
sein Vortrag war betitelt<br />
„Forstlicher Zusammenschluss – Gemeinsam Ziele<br />
im Privatwald verfolgen“.<br />
Ein Überblick über die Struktur <strong>des</strong> Waldbesitzes sowie die Organisation <strong>des</strong><br />
Privat- und Kommunalwal<strong>des</strong> in der Oberpfalz standen am Beginn seines<br />
Vortrages. Der Waldbesitz in der Oberpfalz gliedert sich in 65 % Privat- und 4 %<br />
Kommunalwald, der Rest verteilt sich auf die Bayerischen Staatsforsten und den<br />
Bun<strong>des</strong>forst. Die Ämter <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind <strong>für</strong> die<br />
Hoheit und Fachaufsicht <strong>für</strong> alle Waldbesitzarten zuständig. Ferner obliegen<br />
ihnen die Förderung sowie die Beratung im Privat- und Körperschaftswald, die<br />
Umsetzung von Natura 2000, Aufgaben in der Waldpädagogik und die<br />
Erstellung der Vegetationsgutachten.<br />
Die forstlichen Zusammenschlüsse – Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) und<br />
Waldbesitzervereinigungen (WBV) – haben in Bayern folgende Aufgaben:<br />
● Wirtschaftliche Beratung<br />
● Organisation von Holzeinschlag<br />
● Sammelbeschaffung<br />
● Waldbewirtschaftungsverträge<br />
● Holzvermarktung<br />
● Ab-Stock-Kauf<br />
● Forstliche Dienstleistung<br />
31
Die Forstwirtschaftliche Vereinigung (FV) ist der Dachverband aller Forstlichen<br />
Zusammenschlüsse in der Oberpfalz. Sie vertritt 25 FBG und WBV mit ca.<br />
22.000 Waldbesitzern und einer Fläche von 184.000 Hektar.<br />
Die gewählten Vorstände arbeiten i.d.R. ehrenamtlich und werden von einem<br />
hauptamtlichen Geschäftsführer unterstützt. Die Durchschnittsgröße der<br />
einzelnen Vereinigungen liegt bei ca. 7.500 ha, die ca. 900 Waldbesitzern<br />
gehören, wobei 80 % der organisierten Waldbesitzern 20 % der Waldfläche<br />
gehören.<br />
Abb.: Besitzstruktur FV Oberpfalz<br />
Die Hauptaufgaben der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberpfalz, die seit<br />
2010 in der Rechtsform als wirtschaftlicher Verein organisiert ist, sind die<br />
Koordination der Holzvermarktung über Rahmenverträge, die Information und<br />
Beratung der Mitglieder bzw. Mitgliedsvereine sowie die Öffentlichkeitsarbeit<br />
(einschl. politischer Lobbyarbeit).<br />
Rückblickend erinnerte Ziegler daran, <strong>das</strong>s mit dem Sammeln von Holz in den<br />
kleinen Privatwäldern die Beliebtheit der Vereinigungen bei den Sägewerken<br />
zugenommen hat. Nachdem sie nun eine gewisse Marktmacht haben, fällt die<br />
Einschätzung schon anders aus. Die FV Oberpfalz betreibt ein Holzmengenmanagement<br />
<strong>für</strong> die „Koalition der Willigen“ über eine Internet-Plattform. Dort<br />
sind Verträge, Lieferstände und Angebote einsehbar. Diskutiert wird auch eine<br />
künftige Holzvermarktung als Eigengeschäft. Über Rahmenverträge wurden im<br />
32
<strong>Jahr</strong> 2010 knapp 200.000 fm vermarktet, im Schnitt der letzten 5 <strong>Jahr</strong>e stieg die<br />
Menge auf 400.000 bis 600.000 fm. Zurzeit bestehen Verträge mit 19 Kunden,<br />
die Mengen zwischen 5.000 und 70.000 fm abnehmen. Neben den Rahmenverträgen<br />
der Forstwirtschaftlichen Vereinigung gibt es direkte Beziehungen der<br />
FBG/WBV mit regionalen Sägewerken.<br />
Für den Informationsfluss an die Waldbesitzer werden verschiedene Wege<br />
genutzt. Neben einem Newsletter in Briefform an die Vorsitzenden der<br />
angeschlossenen Waldbesitzervereinigungen gibt es ein Intranetportal, <strong>das</strong> sich<br />
in erster Linie an die Geschäftsstellen richtet. Ziegler beklagt die mangelnde<br />
politische Lobby <strong>des</strong> privaten Waldbesitzes in der Politik. Folgerichtig sieht er<br />
als ein Ziel den Aufbau einer leistungsfähigen Privatwald-Lobby aus eigener<br />
Kraft. Forstbeamte können diese Arbeit seiner Meinung nach nicht leisten, da sie<br />
weisungsgebunden sind. Weiterhin kritisierte der Vertreter <strong>des</strong> Privatwal<strong>des</strong> <strong>das</strong><br />
Ungleichgewicht zwischen der Vertretung <strong>des</strong> Naturschutzes und der<br />
Waldbesitzer zuungunsten <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> im politischen Raum.<br />
Er schloss mit der Aussage: „Der Wald braucht uns nicht, wir brauchen den<br />
Wald und seine Rohstoffe, daher keine Waldstilllegungen!“<br />
Als letzter Referent der Tagung ergriff<br />
Dr. Jens Borchers,<br />
Unternehmensberater und Betriebsleiter<br />
in einem großen Privatforstbetrieb, <strong>das</strong><br />
Wort.<br />
Sein Vortrag hatte den Titel<br />
„Kernelemente einer erfolgsorientierten Forstbetriebsorganisation“.<br />
Einleitend beschäftigte er sich mit den Fragen: Was heißt „optimale“<br />
Organisation und was sind die Kriterien <strong>für</strong> ihren Erfolg? Entscheidend <strong>für</strong> die<br />
Antwort sind seiner Ansicht nach die an eine Organisation gerichteten<br />
Erwartungen, welche auch die von der Organisation verfolgten Ziele bestimmen.<br />
33
Ohne Formulierung von Erwartungen und Zielen kann es keine<br />
Erfolgsbestimmung geben, hier<strong>für</strong> ist eine klar fixierte und vor allem langfristig<br />
stabile Eigentümerpositionierung erforderlich.<br />
Insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Forstbetrieben sieht Borchers als<br />
„Kernleiden“ einen Zielsetzungs- und Prioritätenwandel im Takt der<br />
Legislaturperioden bzw. der jeweiligen politischen Ausrichtung. Die Folgen<br />
davon sind Dauerreform, Ineffizienz und Unzufriedenheit. Als „Schlüssel zum<br />
Erfolg“ empfiehlt er eine möglichst parteiübergreifende Einigung auf langfristig<br />
durchhaltbare Zielsetzungen und Fixierung dieses Statuts an einer (<strong>für</strong> die<br />
Tagespolitik) unzugänglichen Stelle (Stiftungsakte, Hausgesetz u.a.).<br />
Um Organisationsalternativen zu betrachten stellte Borchers zunächst die Frage<br />
nach den Zielen, die eine Organisation verfolgt; <strong>für</strong> seine weiteren<br />
Betrachtungen wählte er drei grundsätzliche aus:<br />
1. Produktion von Gütern und Leistungen,<br />
2. Schaffung von Arbeitsplätzen,<br />
3. Generierung von Wertschöpfung bzw. von Unternehmergewinn.<br />
Besonders wichtig war Borchers der Hinweis, <strong>das</strong>s „Zielkombinationen ohne<br />
Vorfahrtsregeln im Organisations-Chaos enden“.<br />
Das Ziel 1 „Produktion von Gütern und Leistungen“ wird durch <strong>das</strong> Kriterium<br />
„produzierte Menge“ bzw. <strong>das</strong> feste Mengenziel dargestellt. Limitierende<br />
Faktoren dabei können beschränktes Finanzbudget, knappes Personal und<br />
beschränke Zeit sein. Unter diesen Bedingungen bildet sich eine<br />
„Zentralverwaltungswirtschaft“ als Organisationsform heraus; als Beispiel<br />
nannte Borchers militärische Organisationen. Ergebnis dieser Organisation<br />
können Verwaltung <strong>des</strong> Mangels, Schattenwirtschaft sowie extreme Ineffizienz<br />
sein. Sog. „Abwicklungs-“ oder „Pool-Organisationen“ nannte Borchers als<br />
Beispiel <strong>für</strong> Organisationen, die <strong>das</strong> Ziel 2 „Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
verfolgen. Das sich bildende System bezeichnete er als „Zentrale<br />
Sozialwirtschaft“, <strong>das</strong> auch mit begrenzten Finanzbudgets zu kämpfen hat. Das<br />
Ergebnis ist meist eine ineffiziente Organisation, voll mit unzufriedenen<br />
Menschen.<br />
Die Vor- und Nachteile dieser beiden Organisationsformen hat der Referent in<br />
der nachfolgenden Abbildung gegenübergestellt:<br />
34
Abb.: Vor- und Nachteile der Systeme Zentralverwaltungs- und Sozialwirtschaft<br />
Je größer diese Organisationen werden, umso größer muss auch die<br />
Betriebsleitung werden, um bei einer Führungs- und Kontrollspanne von 8-10<br />
MA je Führungsperson eine Einheitlichkeit im Hierarchiestrang zu<br />
gewährleisten; d. h. eine Forstorganisation mit 1.000 Mitarbeitern benötigt eine<br />
Betriebsleitung von 100 Mitarbeitern. Dem gegenüber stellt Borchers<br />
unternehmerisch ausgerichtete Forstorganisation, bei denen die Kongruenz von<br />
Kompetenz und Verantwortung auf dezentraler Ebene gegeben ist, die Hierarchie<br />
wird entsprechend flacher. In so einer dezentralen Unternehmensstruktur wird<br />
vornehmlich <strong>das</strong> 3. Ziel „Generierung von Wertschöpfung bzw. von<br />
Unternehmergewinn“ verfolgt und als Steuerungskriterium verwendet. Die<br />
knappen Finanzbudgets <strong>für</strong> im Ergebnis zu einem „Trial and Error System, über<br />
<strong>des</strong>sen Bestehen oder Vergehen der wirtschaftliche Erfolg bestimmt“.<br />
An einem Beispiel erläuterte Borchers die dezentrale Unternehmensstruktur in<br />
Forstorganisationen näher. Er verglich Betriebe mit unterschiedlicher Flächen-<br />
und Baumartenausstattung, unterschiedlicher Personaldichte sowie Unterschiede<br />
im Hiebssatz.<br />
Er diskutierte dann die Frage, welche Auswirkungen die Schaffung einer<br />
gemeinsamen Betriebsoberleitung haben könnte und kommt zu folgenden<br />
Schlüssen:<br />
● Flächengröße generiert i.d.R. keine Skaleneffekte (oft ist sogar <strong>das</strong><br />
Gegenteil der Fall …).<br />
35
● Es besteht keine Korrelation zwischen Einschlagshöhe und<br />
Personaldichte (Organisationen sind in dieser Beziehung flexibel).<br />
● Ob mit Regiewaldarbeitern oder mit Unternehmern gearbeitet wird ist<br />
eine Managementfrage, die unabhängig von Flächenausstattung,<br />
Einschlagshöhe und Baumartenverteilung betriebsindividuell<br />
unterschiedlich beantwortet wird.<br />
● Ein zentraler Kopf würde kein „Mehr“ an Wirtschaftlichkeit bringen,<br />
sondern nur persönliche Freiheitsgrade in den Betrieben abbauen<br />
(müssen), homogenisierend und damit demotivierend wirken<br />
Abb.: Vor- und Nachteile <strong>des</strong> System Dezentrale Unternehmensstruktur<br />
Bezüglich der Aufbauorganisation fasste Borchers seine Ausführungen wie folgt<br />
zusammen:<br />
● Organisationsentwicklung ist ein dynamischer Prozess mit unbekanntem<br />
Ausgang.<br />
● Heterogenität wird zugelassen, denn sie entspricht der Individualität <strong>des</strong><br />
Verantwortungsträgers und der jeweiligen Besonderheit der Aufgabe.<br />
● Bestimmungsgrößen <strong>des</strong> Wandels:<br />
■ naturaler Flächenzuschnitt (Größe, Belegenheit),<br />
■ Ansprüche der Aufgabe,<br />
■ Individualität <strong>des</strong> Verantwortungsträgers,<br />
■ praktischer Erfolg (trial and error).<br />
36
● Grundsätze der Organisationsentwicklung:<br />
■ dezentrale Zuständigkeit:<br />
Schaffung von Verantwortungsbereichen,<br />
■ Kongruenz von Kompetenz und Verantwortung,<br />
■ Betriebsleitung als Coach und Letztentscheider,<br />
■ Zentrale als Serviceeinheit,<br />
■ Teamarbeit und gegenseitige Hilfestellung wann immer<br />
möglich.<br />
Als nächstes stellte Borchers ausgewählte Methoden und Instrumente der<br />
Ablauforganisation aus seiner Praxis als Betriebsleiter vor. Um sich im Team<br />
abzustimmen, gibt es einen gemeinsamen Terminplaner im Internet (Google-<br />
Kalender), so <strong>das</strong>s jeder sehen kann was der andere macht bzw. vorhat.<br />
Die <strong>Jahr</strong>esplanung erfolgt mit einem <strong>Jahr</strong> Vorlauf und wird an die Langfrist-<br />
Partner weitergegeben. Die technische Optimierung der Einsätze (Witterung,<br />
Umsetzen, Maschinentyp, Unternehmer etc.) kann so vom Einsatzleiter im<br />
ständigen Gespräch mit dem Revierleiter vorgenommen werden. Interessant <strong>für</strong><br />
staatliche Förster war die Aussage von Borchers, <strong>das</strong>s keine Ausschreibungen<br />
von Leistungen stattfinden, sondern die Preise freihändig verhandelt werden.<br />
Jedoch darf im Forstbetrieb grundsätzlich kein Arbeitseinsatz ohne schriftlich<br />
formalisierten Arbeitsauftrag mit Kartenanhang erfolgen. So sind die<br />
Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt, die Arbeitsanweisung (z.B.<br />
Sortimentierung) ist unmissverständlich, die Flächenabgrenzung ist klar fixiert<br />
und Arbeitssicherheitsaspekte sind geregelt, <strong>das</strong> Arbeitsergebnis wird somit<br />
nachvollziehbar.<br />
Nach den Erfahrungen von Borchers hat neben Mobiltelefon und E-Mail-<br />
Kommunikation die konsequente Arbeit mit geographischen Informationssystemen<br />
(GIS) die Betriebssteuerung revolutioniert.<br />
Folgende Grundsätze sind bei dezentralem Einsatz <strong>des</strong> GIS auf Ebene <strong>des</strong><br />
Verantwortungsbereichs („Revier“) zu beachten:<br />
1. Einheitliche Verwendung im Betrieb sichert Anwendungseffizienz.<br />
2. Prinzipiell GIS-gestützt erstellte Arbeitsaufträge ermöglichen<br />
unmissverständliche Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskontrolle.<br />
3. Lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten (Naturalvollzug) ersetzt<br />
„Buchung“ auf Flächeneinheiten.<br />
4. Rollierende überjährige Planung entlastet die <strong>Jahr</strong>esplanungs-phase.<br />
5. Die Vision vom permanenten Planungswerk wird Realität.<br />
6. Der Planungsteil der Forsteinrichtung wird obsolet – übrig bleibt die auf<br />
Stichproben basierende Inventur.<br />
37
Ein Versuch, die organisatorischen Vorteile der dezentralen, GIS-gestützten<br />
Betriebsorganisation zu monetarisieren, ergab eine (konservativ geschätzte)<br />
Einsparung 28 €/ha p.a. Bei den derzeit in Deutschland üblichen<br />
Verwaltungskosten (p.a. 150 €/ha z.B. im Staatswald Baden-Württemberg)<br />
bedeutet <strong>das</strong> ein Potential von rund 20 %.<br />
Zu den Kernaufgaben der Forstorganisation zählt Borchers <strong>das</strong> Jagdmanagement.<br />
Die Bedeutung der Jagd <strong>für</strong> den Forstbetrieb ist begründet durch die Folgen <strong>des</strong><br />
Wildverbisses und der Schäle, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit <strong>des</strong><br />
Forstbetriebs erheblich reduzieren können<br />
(20 % Naturverjüngungs“schwund“ ca. 20 % DB -Verlust,<br />
40 % Naturverjüngungs“schwund“ ca. 30 % DB 3-Verlust,<br />
3 % jährliche Neuschäle ca. 50 % DB 3-Verlust,<br />
Verlängerung der Umtriebszeit,<br />
Kalamitätsanfälligkeit wird erhöht u. a. m).<br />
Selbst im ländlichen Raum abseits der Ballungsräume besitzt <strong>das</strong> Jagdrecht<br />
wirtschaftliches Potential, <strong>das</strong> je nach Holzpreisniveau bis zu 10 % <strong>des</strong><br />
Betriebsumsatzes erreichen kann.<br />
Wirksamer Forstschutz gegen Wild (erfolgreiches Jagdmanagement) und<br />
serviceorientierte Vermarktung <strong>des</strong> Jagdrechts können nur verbunden werden,<br />
wenn <strong>das</strong> Jagdausübungsrecht beim Eigenjagdbesitzer bleibt. Es geht weder<br />
ohne – sowohl zahlende als auch helfende – Jagdpartner noch ohne die<br />
persönliche Jagdausübung <strong>des</strong> Forstpersonals als Pflichtaufgabe (v. a. der<br />
Revierleiter).<br />
Im nachhaltig gemanagten Wirtschaftswald gilt „Wald-vor-Wild“ als Regelfall.<br />
Bei hohen Erwartungen <strong>des</strong> Eigentümers an Jagdservice ist jedoch eine<br />
Segregation unvermeidbar; „Wild-vor-Wald“ als Sonderfall auf<br />
(extensivierbaren) Spezialjagdflächen mit einer Funktionalisierung der<br />
Jagdzuständigkeit (inkl. Führung, Wildbretveredelung u.a.m). Im<br />
Wirtschaftswald muss die Betriebsleitung die klare Prioritätenlage auch<br />
persönlich „vorleben“ (Jagdleitung, persönliche Beteiligung am Abschuss<br />
weiblichen Schalenwil<strong>des</strong>, Verbisskontrollen, „Einnorden“ der Jagdpartner,<br />
Durchsetzen von Wildschadensersatz u. a. m.).<br />
Der Revierleiter ist da<strong>für</strong> zuständig, <strong>das</strong>s wildbedingter „Schwund“ der Naturverjüngung<br />
oder Verbiss an Pflanzungen nicht unbemerkt bleibt und die<br />
zuständigen Jäger zur Verantwortung gezogen werden. Im Zweifelsfall muss er<br />
auf seiner Fläche persönlich jagdlich präsent und beim Abschuss erfolgreich<br />
sein.<br />
38
Zum Schluss seines Referates widmete sich Borchers der Organisation <strong>des</strong><br />
Holzverkaufs als dem zentralen Prozess der betrieblichen Leistungserbringung<br />
Kurz und mittelfristig entscheidet der Holzverkauf über Erfolg oder Misserfolg<br />
<strong>des</strong> forstbetrieblichen Handelns. Neben der nur langfristig spürbaren Steuerung<br />
der biologischen Produktion auf der Fläche genießt daher die Optimierung <strong>des</strong><br />
Holzverkaufsmanagements absolute Priorität im Rahmen der forstlichen<br />
Unternehmensentwicklung. In dem von Borchers geleitetem Forstbetrieb war bis<br />
1970 der Holzverkauf dezentral ausgerichtet und von zunächst 7, später 3<br />
Forstämtern verantwortet. Aus Gründen der Verwaltungsrationalisierung wurde<br />
der Holzverkauf Schritt <strong>für</strong> Schritt zentralisiert und z. T. über Holzhöfe<br />
abgewickelt. Seit 2001 erfolgt der Holzverkauf in Form einer durch die<br />
Betriebsleitung moderierten Kombination aus dezentraler und zentraler<br />
Zuständigkeit in Abhängigkeit von der Marktsituation.<br />
Abb.: Holzverkauf als Geschäftsprozess<br />
Die Grundsätze <strong>für</strong> <strong>das</strong> Holzverkaufsmanagement in dem Betrieb von Borchers<br />
sind:<br />
● Weitmöglichste Orientierung an den Kundenwünschen!<br />
● Die Wertschöpfung erfolgt am einzelnen Stamm:<br />
■ Die Aushaltung ist in erster Linie kundenorientiert und<br />
nur in zweiter Linie verfahrensorientiert (bedeutet vielfach<br />
Priorität <strong>für</strong> Langholzaushaltung).<br />
39
■ Hochwertige Sondersortimente genießen besondere<br />
Beachtung (Masten, Blöcke).Das Objekt der<br />
Wertschöpfung muss im Prozess erkennbar bleiben.<br />
● Prioritäten:<br />
■ Nahkunden rangieren vor Fernkunden,<br />
■ Stammkunden rangieren vor Spotmarktkunden,<br />
■ Bevorzugung zuverlässiger Partner.<br />
● Für die Arbeitsteilung zwischen Revier und Zentrale gelten folgende<br />
Regeln:<br />
■ Die Zentrale versteht sich als Dienstleister <strong>für</strong> die Reviere.<br />
■ Wer den Kunden bringt (und hält), macht <strong>das</strong> Geschäft.<br />
■ Die Abwicklung folgt klaren und einheitlichen Normen<br />
(FF-AVZ) und Verfahrensschritten (Prozessen).<br />
■ Eine permanente Kommunikation zwischen Zentrale und<br />
Revieren ist dabei Erfolgsvoraussetzung.<br />
Folgende Erfahrungen aus den letzten 10 <strong>Jahr</strong>en mit seinem System der<br />
Holzvermarktung listete Borchers auf:<br />
● Extern verhandelt werden Preise, intern gesteuert werden Erlöse.<br />
● Auf der Ertragsseite ist (doch) mehr zu verlieren, als auf der<br />
Kostenseite gewonnen werden kann.<br />
● Überblick über laufende Holzmengen und -qualitäten muss im Revier<br />
und in der Zentrale jederzeit gegeben sein, sonst wird es extrem teuer.<br />
● Skalenerträge können nur bei funktionierender Steuerung generiert<br />
werden.<br />
● Optimierter Holzverkauf im Nahbereich schafft in Kombination mit<br />
Service und Zuverlässigkeit Mehrwert <strong>für</strong> Kunden und Lieferanten.<br />
● Dabei bringt nicht alles was modern klingt messbaren Fortschritt<br />
(Beispiele):<br />
■ Stockverkauf/Selbstwerbung versus Regieverkauf,<br />
■ überregional agierende „Key-accounts“ versus regionale/lokale<br />
Nachfrager als Stammkunden,<br />
■ Werksmessung versus Holzliste,<br />
■ Kurzholz- versus Langholzaushaltung,<br />
■ Energieholzgewinnung aus Kronenmaterial<br />
(„StammholzPlus“).<br />
Damit erfolgsorientierte Organisationen nicht Vision oder gar Illusion bleiben,<br />
fasste Borchers seine wichtigsten Aussagen abschließend wie folgt zusammen:<br />
1. Dezentrale Organisation ermöglicht die Einrichtung<br />
eigentümerzielangepasster, heterogener Betriebseinheiten.<br />
40
2. Klare Eigentümerzielvorgaben ermöglichen ein zielorientiertes Führen<br />
(und Sanktionieren!) der Betriebe mit minimalem Overhead<br />
(„Finanzholding“).<br />
3. Dezentral, mit klarer Zielvorgabe geführte Organisationseinheiten<br />
können mit hohen Freiheitsgraden im operativen Geschäft ausgestattet<br />
werden.<br />
4. Hohe Freiheitsgrade (im Führungsbereich) setzen Motivation,<br />
Kreativität und Leistung frei.<br />
Die abschließende Diskussion wurde von Prof. Krott moderiert.<br />
Ein zentrales Thema war die aktuelle Debatte um die Forderung nach Einstellung<br />
der Nutzung aus Gründen <strong>des</strong> Naturschutzes. Von der überwiegenden Mehrheit<br />
der Teilnehmer wurden Flächenstilllegungen eindeutig zurückgewiesen.<br />
Als weiteres Thema wurde die Lieferung von Holz frei Werk durch den<br />
Forstbetrieb diskutiert. In diesem Zusammenhang wies Ziegler darauf hin, <strong>das</strong>s<br />
die Frei-Werk-Lieferung auch eine Methode ist, um Kundendaten zu schützen.<br />
Auf die Frage, was er anders gemacht hätte bei der Abfassung <strong>des</strong> niedersächsischen<br />
Anstalts-Gesetzes, antwortete Dr. Merker, <strong>das</strong>s er die Möglichkeit<br />
eines Leistungsentgeltes gleich ins Gesetz formuliert hätte.<br />
In seiner Zusammenfassung stellte Prof. Krott zunächst die Charaktere der<br />
vertretenen Forstbetriebe gegenüber. Der (Groß-)Privatwald gibt sich bei<br />
dezentraler Organisation dynamisch und gewinnorientiert, wobei der Chef ein<br />
wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Den Kommunalwald dagegen zeichnet<br />
Eigeninitiative und Geduld in nicht immer einfachen Abstimmungsprozessen auf<br />
kommunalpolitischer Ebene aus.<br />
Die forstwirtschaftliche Vereinigung mit einer Vielzahl von Mitgliedern braucht<br />
zunächst ein gutes internes Mitgliedermanagement. Zum Wohl der Mitglieder<br />
gilt es, ein aktives Kundenmanagement mit der Holzindustrie aufzubauen und zu<br />
pflegen. Ferner wird eine stärkere forstpolitische Vertretung angestrebt. Die<br />
Anstalt öffentlichen Rechts bietet neue Handlungsmöglichkeiten <strong>für</strong> einen<br />
staatlichen Forstbetrieb, wie <strong>das</strong> Beispiel Niedersachsen zeigt.<br />
Das Leitbild könnte auch auf Thüringen passen, aber die Ausrichtung im<br />
Freistaat ist stärker gemeinwohlorientiert. Daher soll auch in der Anstalt <strong>das</strong><br />
Gemeinschaftsforstamt erhalten bleiben, Thüringen geht einen innovativen Weg.<br />
Trotzdem bleiben Sorgen, wie der Erhalt der Hoheit und die Betreuungsqualität<br />
gewährleistet werden können. Jedoch hat die Politik die Wichtigkeit dieser<br />
Fragen erkannt. Die Einbindung von Politik und Waldbesitzern in den Prozess ist<br />
daher wichtig, diese Tagung leistet dazu einen Beitrag.<br />
Wichtig ist allen Akteuren, <strong>das</strong>s die Vor-Ort-Präsenz <strong>des</strong> Försters erhalten bleibt.<br />
Fotos: H. Geisler<br />
41
<strong>Jahr</strong>esexkursion <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
vom 23.06. bis 25.06. <strong>2011</strong> in <strong>das</strong> Sächsische Erzgebirge<br />
Nachdem am 23.06. in der Frühe <strong>das</strong> Gepäck im schon gewohnten Bus in<br />
Gehren verpackt und der allen vertraute Ruf <strong>des</strong> Fahrers „Sind alle an Bord?“<br />
mit einem noch etwas verschlafenen „Ja.“ beantwortet war, hieß es „Auf zu den<br />
Kollegen nach Sachsen“ zu unserer diesjährigen <strong>Jahr</strong>esexkursion in <strong>das</strong><br />
Erzgebirge.<br />
Nach einer Begrüßung und kurzen Vorstellung <strong>des</strong> Forstbezirkes Marienberg<br />
durch Herrn Ingo Reinhold an der Talsperre Rauschenbach, führte uns der erste<br />
Tag der Reise in die Kernbereiche <strong>des</strong> ehemaligen Rauchschadgebietes. 1990<br />
waren rund 282.000 ha Wald in Sachsen immissionsgeschädigt. Das waren 62<br />
Prozent der gesamten Waldfläche. Rund ein Zehntel befanden sich in der<br />
Schadzone I, waren also extrem geschädigt, bzw. abgestorben.<br />
Die Lebenserwartung der Fichte betrug hier kaum 20 <strong>Jahr</strong>e. Die Ursachen waren<br />
vor allem Schwefeleinträge aus den Braunkohlekraftwerken und dem Hausbrand.<br />
Mehr als 30.000 ha Wald fielen allein im Erzgebirge dem Sauren Regen zum<br />
Opfer.<br />
Das Waldsterben im Erzgebirge war damals eine der größten Umweltkatastrophen<br />
in ganz Mitteleuropa. Schwerpunkte der Rauchschäden waren die<br />
Kammlagen zwischen Olbernhau und Altenberg, der Fichtelberg und die Region<br />
zwischen Klingenthal und Johanngeorgenstadt. Bereits in den 1980er <strong>Jahr</strong>en<br />
wurde auf rund 2.500 ha Kahlflächen in den heutigen Forstbezirken Marienberg<br />
42
und Bärenfels ein umfassen<strong>des</strong> Aufforstungsprogramm mit sogenannten<br />
„rauchharten“ Baumarten, wie Blau- und Omorikafichten, Murraykiefern oder<br />
Lärchen gestartet.<br />
Nach der Deutschen Einheit wurde <strong>das</strong> Wachstum der Pflanzen durch die rasche<br />
Verminderung der Luftschadstoffe begünstigt. Infolge umfangreicher<br />
Sanierungsmaßnahmen in der Industrie und den Wohnhäusern sowie durch den<br />
Einsatz von Filteranlagen in den Kraftwerken konnten innerhalb weniger <strong>Jahr</strong>e<br />
die Immissionen drastisch gesenkt werden. So ist seit 1990 der Schwefeldioxid-<br />
Ausstoß in Sachsen um 98 Prozent zurückgegangen.<br />
Dr. Dittrich und Herr Reinhold erläuterten uns an Hand von Grafiken und<br />
Zahlen, <strong>das</strong>s kaum an einem anderen Ort in Sachsen so deutlich zu erkennen ist,<br />
welche positiven Auswirkungen die letzten 20 <strong>Jahr</strong>e <strong>für</strong> diesen Wald hatte.<br />
43
Von einer Region deren abgestorbene Bäume <strong>das</strong> Gebiet wie düstere<br />
Mondlandschaften erscheinen ließen bis hin zu einer Landschaft, die heute<br />
wieder die Bezeichnung Wald verdient. Derzeit ist der Waldumbau eine der<br />
wichtigsten forstlichen Aufgaben.<br />
Die Interimsbestockungen sollen wieder in Wälder mit heimischen und an den<br />
Standort angepassten Baumarten umgewandelt werden. Im Erzgebirge sind <strong>das</strong><br />
vor allem Fichten-Bergwälder und Bergmischwälder aus Fichten, Tannen und<br />
Buchen. Gegenwärtig werden etwa fünf Hektar pro <strong>Jahr</strong> im Lan<strong>des</strong>wald <strong>des</strong><br />
Forstbezirkes Marienberg in standortgerechte Bestände umgewandelt.<br />
44
Auf einer sich anschließenden Wanderung durch <strong>das</strong> ehemalige Revier<br />
Deutscheinsiedel tauschten sich <strong>Thüringer</strong> und Sachsen neben dem Waldumbau<br />
auch über die Besonderheiten der Forstwirtschaft in Wintersportgebieten, die<br />
Lebensräume von Rauhfußhühnern und den Umgang mit entwässerten<br />
Hochmoorstandorten aus.<br />
Der zweite Tag der Exkursion führte uns in den benachbarten Forstbezirk<br />
Eibenstock.<br />
Die von Herrn Stephan Schusser vorbereiteten Übersichten mit den wichtigsten<br />
Karten und Tabellen trotzten dem Regen auf einer zwischen zwei Bäumen<br />
45
gespannten Leine gut mit Wäscheklammern befestigt. Historisch bedingt<br />
dominieren in Sachsen instabile Altersklassenwälder aus Nadelhölzern mit<br />
einem hohen Betriebsrisiko.<br />
Der Waldumbau in stabile Wälder ist erklärtes Ziel <strong>des</strong> Sächsischen<br />
Waldgesetzes. Herr Schusser wies aber immer wieder darauf hin, <strong>das</strong>s neben<br />
vielen positiven Ansätzen zur Wildbestan<strong>des</strong>regulierung eingeschätzt werden<br />
muss, <strong>das</strong>s der Waldumbau in weiten Teilen Sachsens an stark überhöhten<br />
Schalenwildbeständen scheitert.<br />
Die uns an diesem Tag von den sächsischen Kollegen vorgestellten Ziele und<br />
Beispiele, wie naturnahe Bergmischwälder, Fichtenwertholz, Freilandsaaten mit<br />
Weißtanne, Fichtenfemelwald oder Tannenvoranbau fordern nicht nur engagierte<br />
Forstleute sondern auch eine den Zielen angepasste Jagdstrategie in der<br />
Gesellschaft insgesamt. Im Forstbezirk Eibenstock führten Sommersturm,<br />
Eisbruch, Kyrill, Emma und Folgeschäden durch den Buchdrucker in den<br />
vergangenen 6 <strong>Jahr</strong>en zu einem Schadholzanfall von über 1 Mio. fm. Teilweise<br />
mussten von einzelnen Revierleitern täglich bis zu 1.000 fm Holz aufgenommen<br />
werden. Da Forstschutzprobleme eine Aufarbeitung auch unter schwierigsten<br />
Bodenbedingungen erzwangen, wurden allein 2007 und 2008 über 4 Mio € an<br />
Wegebaumitteln investiert. Parallel dazu stand man vor 1.000 ha Blößen und vor<br />
über 3.000 ha instabilem Wald, in dem kein aktiver Holzeinschlag mehr geplant<br />
werden konnte.<br />
46
Vordringliche Aufgabe in Eibenstock war die Aufforstung der Blößen unter<br />
Einbeziehung der Naturverjüngung und einer Vorwaldbegründung. Im 16.<br />
<strong>Jahr</strong>hundert nahmen Tanne und Fichte je ein Drittel der Fläche ein. Ein weiteres<br />
Viertel beanspruchte damals die Buche, den Rest teilten sich Kiefer, Birke und<br />
Berg-Ahorn.<br />
Auf unserer Wanderung durch die Reviere Carlsfeld und Eibenstock verweilten<br />
wir immer wieder unter Alttannen, unter denen wir über die vergleichsweise<br />
hohe Trockentoleranz dieser Baumart sprachen und <strong>das</strong> diese Eigenschaft bei<br />
sich verringernden Sommerniederschlägen im Zuge <strong>des</strong> Klimawandels einmal<br />
überlebenswichtig <strong>für</strong> sie sein könnte.<br />
47
Wegen ihrer guten Wuchs- und Holzeigenschaften hat die Weißtanne außerdem<br />
einen hohen Ertrags- und Nutzwert. Gegenwärtig gibt es in Sachsen noch zirka<br />
2.000 Weißtannen, die älter als 60 <strong>Jahr</strong>e alt sind. 274 von ihnen stehen im<br />
Forstbezirk Eibenstock,<br />
In den letzten 20 <strong>Jahr</strong>en wurden hier im Rahmen <strong>des</strong> Waldumbaus 2.400 ha mit<br />
Buche, Tanne, Eiche und Esche aktiv verjüngt.<br />
48
Die Kollegen setzen hier auch auf Saat als alternatives Verjüngungsverfahren,<br />
<strong>das</strong> durch ein ungestörtes Wurzelwachstum entscheidende Stabilitätsvorteile<br />
bietet. Immer wieder führte uns unsere Wanderung an diesem Tag in die vielen<br />
Beispielbestände <strong>für</strong> den Waldumbau der letzten <strong>Jahr</strong>e.<br />
Zwischen Tannensämlingen, kleineren Buchen und Ahornen und herrlichen<br />
Altbäumen betonte Herr Schusser zum Abschluss noch einmal, <strong>das</strong>s Willen,<br />
Schweiß und Hartnäckigkeit auf dem Waldboden mit der bisherigen<br />
Jagdgesetzgebung noch immer im Widerspruch stehen. Notwendig wäre eine<br />
echte Modernisierung der Gesetzgebung, die eine effektive Bejagung, mit dem<br />
Ziel der Bestan<strong>des</strong>absenkung, <strong>des</strong> verbeißenden Schalenwil<strong>des</strong> erlaubt, die<br />
Belange der Grundeigentümer und der Gesellschaft in den Vordergrund stellt<br />
und die Ziele der Jägerschaft entsprechend unterordnet.<br />
Der dritte Tag der diesjährigen <strong>Jahr</strong>esexkursion führte uns auf Sonderstandorte<br />
<strong>des</strong> schon am Vortag besuchten Forstamtsbezirkes und hier zum Moorgebiet<br />
Kleiner Kranichsee.<br />
49
Das Moorgebiet befindet sich südwestlich von Johanngeorgenstadt im<br />
Erzgebirgskreis an der Grenze zur Tschechischen Republik und ist mit Teilen<br />
seines hydrologischen Einzugsgebietes als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es ist<br />
zudem Teil <strong>des</strong> Fauna-Flora-Habitat-Gebietes „Erzgebirgskamm am Kleinen<br />
Kranichsee“ und <strong>des</strong> europäischen Vogelschutzgebietes „Westerzgebirge“. Das<br />
Hochmoor „Kleiner Kranichsee“ ist ein Kammscheidenmoor, <strong>das</strong> nach Osten<br />
über Lehmergrundbach und Schwarzwasser in die Zwickauer Mulde und nach<br />
Süden über Buchschachtelgraben und Rohlabach in die Eger entwässert. Der<br />
Name <strong>des</strong> Moores leitet sich wahrscheinlich vom slawischen "granica" (Grenze)<br />
und der früheren Bezeichnung "Seihe" oder "Sehe" <strong>für</strong> mooriges Gebiet ab.<br />
50
Das Moorgebiet Kleiner Kranichsee umfasst etwa 19 ha und gliedert sich von<br />
innen nach außen in die offene Hochmoorweite mit den schlenkenreichen<br />
Torfmoos-Wollgras-Rasen, den umgebenden Bergkiefern-Moorwald sowie den<br />
Fichten(moor)-Randwald. Im Westen und Osten <strong>des</strong> Hochmoores befinden sich<br />
größere Torfabbauflächen mit deutlichen Regenerationserscheinungen.<br />
Es existieren einige Gräben zur Entwässerung <strong>des</strong> Gebietes, darunter auch ein<br />
Kunstgraben, der 1928 vertieft wurde.<br />
Durch Torfabbau und Entwässerungsgräben, die insbesondere die<br />
Hangwasserspeisung aus dem hydrologischen Einzugsgebiet verhindern,<br />
breiteten sich die Moorwälder zu ungunsten der offenen Hochmoorbereiche stark<br />
aus. Trotzdem zählt es zu den besterhaltenen Mooren <strong>des</strong> Erzgebirges. Zum<br />
hydrologischen Einzugsgebiet gehört auch der östliche Kernbereich <strong>des</strong><br />
Butterwegmoores, <strong>das</strong> uns von den sächsischen Kollegen an diesem Tag als<br />
Beispiel <strong>für</strong> eine Moorrenaturierung vorgestellt wurde.<br />
Unsere Exkursion endete am gleichen Tag nicht weit entfernt von der Stelle, von<br />
der die Einwohner von Carlsfeld im Sommer 1997 berichteten, <strong>das</strong>s am späten<br />
Vormittag Luft und Himmel gelb wurden und ein gewaltiger Sturm einsetzte, der<br />
jedoch nur wenige Minuten andauerte.<br />
51
Das Zentrum <strong>des</strong> Sturms befand sich im Bereich der Talsperre Carlsfeld und<br />
hinterließ eine breite Schneise umgebrochener Bäume. Gerade zu dieser Zeit<br />
wurde auch die Talsperre Weiterswiese rekonstruiert. Glück im Unglück hatte<br />
ein Kranführer, <strong>des</strong>sen Kran sich bei dem Wirbelsturm im Kreis drehte, aber<br />
standhielt.<br />
Im Gasthaus "Zur Talsperre" verabschiedeten wir uns nach dem gemeinsamen<br />
Mittag bei den sächsischen Forstleuten und dankten Ihnen <strong>für</strong> die gute<br />
Vorbereitung und die herzliche Atmosphäre.<br />
52
Der Besuch <strong>des</strong> Raumfahrtmuseums in Rautenkranz bildete den Schluss der<br />
diesjährigen <strong>Jahr</strong>esexkursion in <strong>das</strong> Sächsische Erzgebirge, <strong>für</strong> die sich der<br />
Verfasser an dieser Stelle noch einmal im Namen aller Teilnehmer bei denen<br />
bedanken möchte, die zu diesen gelungenen drei Tagen beitrugen.<br />
Frank Wittau<br />
Fotos: Horst Geisler<br />
Literatur:<br />
DITTRICH, K. (2006): Neue Chancen <strong>für</strong> den Wald im Mittleren Erzgebirge. In:<br />
Forst und. Holz, 61. Jg., Nr. 3: S. 89 – 94.<br />
KÄSTNER, M. & W. FLÖSSNER (1933): Die Pflanzengesellschaften der<br />
erzgebirgischen Moore.<br />
RUDOLPH, K. & F. FIRBAS (1924): Die Hochmoore <strong>des</strong> Erzgebirges. Beih.<br />
Bot. Cbl. 41/2: 2-162.<br />
SCHREIBER, H. (1923):. Die Moore Nordwestböhmens. Prag.<br />
53
Vertiefend zum Thema unserer <strong>Jahr</strong>esexkursion <strong>2011</strong> ein Artikel der<br />
Zeitschrift „Forst und Holz“, Nr. 3 vom März 2008:<br />
Veröffentlichung im <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V mit<br />
freundlicher Genehmigung <strong>des</strong> Verfassers, Herrn Dr. K. Dittrich<br />
Neue Chancen <strong>für</strong> den Wald im mittleren Erzgebirge<br />
Bewältigung der Folgen extremer Immissionsschäden bei<br />
Deutscheinsiedel<br />
Von Klaus Dittrich<br />
Der Waldort Deutscheinsiedel auf dem Kamm <strong>des</strong> Mittleren Erzgebirges direkt<br />
an der böhmischen Grenze, wurde in den vergangenen 50 <strong>Jahr</strong>en zum Zentrum<br />
einer ökologischen Katastrophe die in Folge allzu freizügiger Nutzung fossiler<br />
Energieträger (Braunkohle) ein ca. 120.000 ha umfassen<strong>des</strong> Waldschadensgebiet<br />
in den sächsischen Mittelgebirgen bewirkte. Etwa 27.000 ha Wald haben<br />
starke und extreme Immissionsschäden erfahren, rund 10.400 ha Fichtenwald<br />
(1962 - 1991: 8.800 ha. 1996: 1.600 ha) starben total ab. Noch wesentlich umfangreicher<br />
sind die Waldschadensflächen in der angrenzenden nordböhmischen<br />
Region.<br />
Was ist passiert - eine Reminiszenz<br />
Carbochemie und Energieerzeugung im nordböhmischen Egertal, östlich der<br />
Neiße, und, im mitteldeutschen Braunkohlerevier nahmen etwa seit der Mitte <strong>des</strong><br />
19. <strong>Jahr</strong>hunderts die Wälder <strong>des</strong> Mittleren u Osterzgebirges. der Sächsisch-<br />
Böhmischen Schweiz, <strong>des</strong> Oberlausitzer Berglan<strong>des</strong> und <strong>des</strong> Zittauer Gebirges<br />
zunehmend in die Zange. Die Immissionsbelastung speziell im Erzgebirge<br />
resultierte im zeitlichen Mittel etwa zu drei Vierteln aus den Emissionen der nur<br />
wenige Kilometer entfernt am Südrand <strong>des</strong> Erzgebirges gelegenen Quellen. Etwa<br />
ein Viertel der Immissionsbelastung wurde zudem aus dem mitteldeutschen<br />
Braunkohlerevier zuzüglich regionaler Quellen, herangetragen. Die spezielle<br />
Orographie der nordböhmisch – sächsischen Grenzregion beförderte<br />
Schaddisposition und Schadentwicklung. Klimaextreme, bspw. während der<br />
Winter 1929/30, 1955/56, 1962/63, 1978/79 und 1995/96 bewirkten, <strong>das</strong>s aus<br />
chronischen Waldschäden in kürzester Zeit akute Schäden wurden – zunächst auf<br />
forstlichen Extremstandorten, später dann auf großer Fläche.<br />
Mit zunehmender industrieller Tätigkeit vor und vor allem auch nach<br />
dem 2. Weltkrieg war es eine Frage der Zeit bis erste Waldflächen von den<br />
Immissionen gezeichnet waren. Im Waldgebiet bei Deutscheinsiedel löste der<br />
54
krasse Temperaturverlauf im Winter 1955/56 (Extremfrost im Februar nach<br />
mildem Winterbeginn) <strong>das</strong> Absterben <strong>des</strong> Fichtenwal<strong>des</strong>, zunächst auf<br />
organischen und mineralischen Nassstandorten aus. KLUGE (1993) hat diesen<br />
Leidensweg <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> um Deutscheinsiedel ausführlich beschrieben. Die<br />
großräumige Entwicklung der Waldschadflächen und -intensitäten erkennbar an<br />
der Entwicklung der etwa ab 1960 immer wieder neu erhobenen und präzisierten<br />
Immissionsschadzonen auf der Basis bestan<strong>des</strong>weiser Schadstufen (Fichte ab<br />
Alter 60 <strong>Jahr</strong>e) – verlief räumlich und zeitlich stark differenziert.<br />
Neben den Schadstoffarten und –mengen sowie dem realen forstlichen<br />
Standort als den Primärfaktoren war auch <strong>das</strong> Gefüge sekundärer Schadfaktoren<br />
vor allem biotischer Art, wesentlich. So lag <strong>das</strong> Maximum der<br />
Schädigungsintensität zwischen dem Winter 1978/79 (wiederum Extremfrost im<br />
Januar nach mildem Winterbeginn) und dem <strong>Jahr</strong>1984 – einem Höhepunkt der<br />
Gradation u. a. <strong>des</strong> Buchdruckers (Ips typographus). Rasant schnell starben<br />
damals große Fichtenwälder total ab. – z.B. Teile <strong>des</strong> Zittauer Gebirges (u.a.<br />
Jonsberg 1979/80) im Isergebirge obere Lagen im Riesengebirge (1983-85) und<br />
auch im Osterzgebirge (z.B. die Kohlhaukuppe 1983-84) In dem Deutscheinsiedeler<br />
Revier war zu jener Zeit bereits fast jegliche über 30-jährige Fichtenbestockung<br />
abgestorben. Lediglich jüngere Fichten überlebten mehr oder<br />
weniger vital. Interessanter weise gab es immer wieder Exemplare, deren<br />
überdurchschnittliche Vitalität auffiel. Somit bestand Hoffnung, die offenbar<br />
verschiedenartige, vielleicht genetisch bedingte Disposition der Baumindividuen<br />
zu nutzen, um auf züchterischem Weg rauchresistentere Arten in wirtschaftlich<br />
nutzbarer Menge zu bekommen – eine Hoffnung, die leider unerfüllt blieb.<br />
Auffällig waren von jeher die Abhängigkeit der Schadentwicklung vom<br />
örtlichen Windeinfluss, eine verminderte Frosthärte besonders der<br />
Fichtenkulturen und -jungwüchse, aber auch die Tatsache, <strong>das</strong>s die<br />
Wuchsklassen „starkes Stangenholz“ bis „schwaches Baumholz“ bevorzugt<br />
betroffen wurden. Die Fruktifikation aller Baumarten war vermindert.<br />
Die Situation im Deutscheinsiedeler Revier <strong>des</strong> Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes<br />
Marienberg/Oberförsterei, Hirschberg dokumentieren die<br />
Aufnahmen 1 bis 3, die der Verfasser im Frühjahr 1977 aufnahm.<br />
Die Lage erschien damals ausweglos. So hatte z.B. die Konferenz von<br />
Flaje 1978 eine „volkswirtschaftlich notwendige“ Steigerung der Immissionen in<br />
Nordböhmen bis zum <strong>Jahr</strong> 2020 avisiert. Auch mitteldeutsche und südwestpolnische<br />
Emittenten waren auf Zuwachs programmiert Eine wirksame<br />
Abgasreinigung dieser Größenordnung war zunächst technisch unmöglich, später<br />
– in den 80er <strong>Jahr</strong>en schlichtweg zu teuer und damit „unwirtschaftlich“.<br />
55
Die Folgekosten dieser Strategie blieben weitgehend unbeachtet, wirkten jedoch<br />
noch lange nach. Wesentlicher Schadstoff war stets Schwefeldioxid, jedoch kam<br />
es zusätzlich auch zur Deposition enormer Mengen basischer Flugaschen<br />
(wirkten zunächst neutralisierend), von Stickstoffverbindungen (Problem<br />
verminderter Frosthärte der Nadelgehölze bei gleichzeitiger<br />
Wachstumsbeschleunigung), von Fluoriden, Schwermetallen u. a. m.<br />
Waldboden.<br />
Ertragskundliche Untersuchungen der Gegenwart weisen ein<br />
Zuwachstief um <strong>das</strong> <strong>Jahr</strong> 1980 herum <strong>für</strong> <strong>das</strong> Schadgebiet, aber auch darüber<br />
hinausgehend <strong>für</strong> Mitteleuropa, nach. Ob es da<strong>für</strong> bzw. <strong>für</strong> den bis Jetzt<br />
anhaltenden Zuwachsanstieg noch weitere Ursachen gibt, sei in Frage gestellt.<br />
So kommen Faktoren, wie die global und regional .ansteigende Temperatur oder<br />
die dynamische Entwicklung <strong>des</strong> Kohlendioxidgehaltes der Luft in Frage.<br />
Jedenfalls trat etwa ab 1985/86 eine zügige Besserung der Gesamtsituation<br />
(verminderter Schadfortschritt, verbesserte Vitalität, Wachstumsschub) ein ohne<br />
<strong>das</strong>s damals technische Maßnahmen zur Entschwefelung der Abgase<br />
umfangreich realisiert worden waren.<br />
Wie mit dieser umwelt- und letztlich lebensbedrohenden Situation in<br />
scheinbar aussichtsloser Lage umgegangen wurde, war zwar zwischenstaatlich<br />
und gesellschaftspolitisch abgestimmt, bei näherer Betrachtung aber doch auch<br />
eine Frage der Mentalität beiderseits der Grenze. So waren auf böhmischer Seite<br />
weite Teile <strong>des</strong> Mittleren Erzgebirges und östlich davon aufgegeben. Oberhalb<br />
<strong>des</strong> Eichen- und Buchenwaldgürtels über dem Egertal starb die Fichte rasant ab.<br />
Häufig setzte Versteppung ein, gemildert durch mehr oder weniger extensive<br />
Verjüngung mit zumeist standortswidrigen Interimsbaumarten (z. B. Birkensaat).<br />
Engagierten Forstleuten blieben Akzeptanz oder Resignation. Auf<br />
sächsischer Seite wurde der Sachverhalt offiziell weitgehend negiert wie<br />
Dokumente aus Forstwirtschaft und Forsteinrichtung es belegen. Im Hintergrund<br />
aber lief ein relativ wirksames forstliches Krisenmanagement ab – ein großes<br />
Bemühen um Schadensbegrenzung mit allen verfügbaren forstlichen Mitteln.<br />
Strategien wie die Verzögerung der Abnutzung, Riegelbildung, relative Kleinflächigkeit<br />
von Nutzung und Walderneuerung gemäß den Prinzipien von<br />
Walderhaltung und Risikostreuung haben sich aus heutiger Sicht bewährt,<br />
wenngleich es sich lediglich um ein Reagieren auf Symptome handelte.<br />
Möglichkeiten aktiver Einflussnahme bei den Verursachern bestanden kaum.<br />
Zusammengefasst ist der Sachstand u. a. in der „Richtlinie <strong>für</strong> die Bewirtschaftung<br />
immissionsgeschädigter Fichtengebiete“ in mehreren Fassungen<br />
(1970, 1985, 1989). Zugleich wurden die Betriebsregelungsanweisungen der<br />
Forsteinrichtung immer mehr den realen Erfordernissen angepasst. Hier<br />
offenbart sich der mittlerweile komplexe Charakter, mit dem die Problematik in<br />
Fachkreisen behandelt wurde.<br />
56
Was brachten die 90er <strong>Jahr</strong>e bis zur Gegenwart?<br />
Mit Blick auf Trends bei Emissionen bzw. Immissionen waren folgende<br />
Entwicklungen zu verzeichnen:<br />
Schließung großer Emittenten nach 1990 im Zuge wirtschaftlicher<br />
Neuordnung<br />
Verbesserte technische Möglichkeiten zur Minderung von<br />
Emissionen großindustrieller Anlagen seit Mitte der 80er <strong>Jahr</strong>e.<br />
Veränderung der Emissionsstruktur durch Wechsel der Energieträger,<br />
Zunahme regenerativer Energien (Wind, Sonne. Wasserkraft, Biostoffe)<br />
Senkung <strong>des</strong> absoluten und spezifischen Verbrauchs<br />
Grenzüberschreitende politische Willensbildung zu Umweltfragen.<br />
Bereitstellung zweckgebundener EU-Mittel bedeutender Größenordnung.<br />
Hinsichtlich der Luft- und Bodenchemie ergab sich zunächst eine Förderung <strong>des</strong><br />
Versauerungsprozesses durch Ausfiltern z. T. basischer Stäube bei noch hoher<br />
SO2-Belastung, verbunden mit einem reduzierten Schwermetalleintrag. Später<br />
kam es zu einem stetig reduzierten Säureeintrag (SO2) über Luft und<br />
Niederschläge, der heute. Auf ca. 20% <strong>des</strong> Eintrags der 80er<strong>Jahr</strong>e gesunken. ist.<br />
Mittlerweile sind auch rückläufige Säureausträge im Sickerwasser (steigende<br />
pH-Werte) zu verzeichnen. Ein Problem stellt, jedoch <strong>das</strong> „chemische Langzeitgedächtnis“<br />
der Waldstandorte dar: Die Pufferkapazität ist vielerorts erschöpft<br />
mit negativen Folgen <strong>für</strong> die Qualität <strong>des</strong> Trinkwassers, u. a. durch Mobilisierung<br />
von Schwermetallen. Weiterhin anhaltend ist die Überschreitung<br />
tolerierbarer Eintragsraten von Stickoxiden, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid,<br />
Kohlenwasserstoffen aus Landwirtschaft, Straßenverkehr und carbochemischer<br />
Industrie, speziell auch periodisch erhöhte Benzolbetastung. Heute besteht eine<br />
Dominanz <strong>des</strong> Stickstoffeintrages über den Schwefeleintrag, erkennbar am<br />
zunehmend erhöhten Stickstoffspiegel in Nadeln und Blättern mit Sättigungserscheinungen<br />
(Folgen: Übermäßiges Wachstum, gepaart mit verminderter<br />
Stabilität, Holzqualität und Frosthärte). Auch ist eine chronisch zu hohe Ozonbelastung<br />
von langfristig steigender Tendenz mit akuten Extremen (Folge u. a.<br />
„neuartige Waldschäden“ durch Photooxidantien) zu vermelden offen bleibt die<br />
Frage, wie lange und auf welche Weise die Waldbäume diesen Trend tolerieren<br />
und puffern können.<br />
Seit Mitte der 80er <strong>Jahr</strong>e, verstärkt in den 90er <strong>Jahr</strong>en, ist eine deutlich<br />
sichtbare Verbesserung <strong>des</strong> Waldzustan<strong>des</strong> im Süden Sachsens zu beobachten,<br />
häufig Revitalisierung mittelalter und alter Fichten- und Buchenbestände.<br />
Parallel dazu erscheint die bereits teilweise extreme Zuwachsentwicklung junger<br />
Bestände als ungesund. Ein Florenwandel im Unterstand hin zu einer<br />
artenreicheren Baum-, Strauch und Krautschicht durch <strong>das</strong> Novum<br />
wiederkehrender Samenjahre von Fichte (1992/2003) und Buche. geminderter<br />
57
Verbissdruck, Wirkungen von Stickstoffeintrag und Bodenschutzkalkung sind<br />
weitere typische Entwicklungen.<br />
Die Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften, sogar die<br />
Weißtanne, gedeihen wieder. Ein Beispiel da<strong>für</strong> bietet ein ca. 22 ha großer, 150jähriger<br />
Buchen-Altholzkomplex im Deutscheinsiedeler Wald, der als einziges<br />
geschlossenes Altholz einer Hauptbaumart auf ca. 800 m ü. den jahrzehntelangen<br />
Immissionen getrotzt hat. Fast nur noch aus absterbendem Derbholz bestehende<br />
Kronen haben wieder zahlreich ausgetrieben und bilden heute ein<br />
Kronenvolumen, dem man die Vorgeschichte nicht mehr ansieht. Fruktifikation<br />
führte zu flächiger Naturverjüngung, deren Wildlinge auch anderenorts im<br />
Waldgebiet vorangebaut wurden, zumal der Deutscheinsiedeler Buchenkomplex<br />
seit dem <strong>Jahr</strong> 2003 ein anerkannter Forstsaatgutbestand (Herkunft 81015) ist.<br />
Einen Rückschlag, wie ihn viele nicht mehr <strong>für</strong> möglich gehalten haben<br />
gab es im Winter 1995/96 besonders im Mittleren Erzgebirge beiderseits der<br />
Grenze. Nochmals verstärkte Immissionen, die spezielle Orographie <strong>des</strong><br />
Gebirges und die klimatische Situation (anhaltende Nebelfrostablagerungen)<br />
führten zum – hoffentlich letztmaligen – Totalverlust von 1.600 ha Fichtenwald<br />
mittleren Alters sowie zur Verlichtung umfangreicher Bestände auf ca. 50.000<br />
ha. Nahezu eine halbe Million Festmeter Schadholz und umfangreiche außerplanmäßige<br />
Verjüngungsflächen waren die Folge. Diese Erfahrung zeigt <strong>das</strong>s <strong>das</strong><br />
Kapitel „Immissionen“ noch nicht beendet ist. Neben der „Hypothek“ aus der<br />
Vergangenheit in Waldboden und -bestand haben sich lediglich der Umfang und<br />
Charakter <strong>des</strong> Risikos verändert.<br />
Stand und Erfahrungen <strong>des</strong> Umbaus der Interimsbestockungen<br />
Die forstliche Wirtschaftsstatistik belegt wie ein ehemals produktiver,<br />
buchenreicher Fichtenwald der Hochlagen <strong>des</strong> Erzgebirges (720 - 835 m ü. NN)<br />
durch zunehmende Immissionen, befördert durch Witterungsextreme und<br />
biotische Schadfaktoren, in relativ kurzer Zeit nahezu zur Totalschadfläche<br />
wurde. Baumarten- Alters- und Holzvorratsstruktur sind auf min<strong>des</strong>tens zwei<br />
<strong>Jahr</strong>hunderte hinaus empfindlich gestört<br />
(siehe Tabelle 1).<br />
58
Tab. 1 Waldzustands- und Planungsdaten der Forsteinrichtung per 1.1. 2000.<br />
59
Derartige Waldgebiete nachhaltig zu entwickeln bedeutet, auf der<br />
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen ein<br />
System vielfach auch unkonventioneller Maßnahmen In Gang zu setzen und dies<br />
der örtlichen Situation angepasst über <strong>Jahr</strong>zehnte konsequent fortzufahren. Die<br />
mitunter vertretene Ansicht, ob es nicht besser sei, die Interimsbaumarten<br />
wachsen zu lassen und sich zunächst jeglicher weiterer Investitionen zu enthalten<br />
(„ein ideales Wild-einstandsgebiet“) ist anhand der realen Waldentwicklung in<br />
Teilen <strong>des</strong> Privatwal<strong>des</strong>, besonders jedoch auf böhmischer Seite, widerlegt.<br />
Bodenvorbereitung<br />
Der Waldboden hat stark gelitten und gestattet keine schnelle Sanierung. Die<br />
rasche Wiederbewaldung mit Interimsbaumarten ist eindeutig positiv zu werten.<br />
Sie wirkt bodenpfleglich und dient dem lokalen Klimaschutz <strong>für</strong> eine neue<br />
(Dauer-) Waldgeneration. Eine nachgewiesen sehr wirksame investive<br />
Maßnahme ist die Bodenschutzkalkung. Beginnend in den 80er <strong>Jahr</strong>en wurden<br />
auf sächsischen Waldflächen aller Eigentumsarten kohlensaure, dolomitische<br />
Kalke in Dosierungen zwischen 3,5 und 4,5 t/ha In Zeitabständen von 6 – 10<br />
<strong>Jahr</strong>en zumeist aviochtechnisch ausbracht. Mittlerweile beträgt die Arbeitsfläche<br />
über 200.000 ha. Das Extremschadgebiet um Deutscheinsiedel ist bereits viermal<br />
dosiert gekalkt, anderenorts ist die zweite oder dritte Wiederholung realisiert.<br />
Die Kosten <strong>des</strong> Verfahrens betragen aviotechnisch ca. 75 €/t mit Bodentechnik<br />
ca. 55 €/t netto. Der Privat- und Körperschaftswald wird zu 100 % gefördert.<br />
Im Hinblick auf die mechanische Bodenvorbereitung sind geeignete<br />
Verfahren notwendig um effektiv und risikoarm zu kultivieren. In den 70er<br />
<strong>Jahr</strong>en war die Verfahrensweise tschechischer Staatsbetriebe auf Kahlflächen<br />
alle Vegetation und Humusauflagen bis auf den Mineralboden abzuschieben<br />
auch in Sachsen übernommen worden. Es entstanden Wälle deren Inhalt<br />
inzwischen verrottet ist. Sie sind licht mit Eberesche und Birke bestockt. Diese<br />
Radikalmaßnahme, der damaligen Situation (fehlende Arbeitskräfte und Technik<br />
<strong>für</strong> Walderneuerung) geschuldet, hat sich nicht bewährt. Die zwischen die Wälle<br />
gepflanzte Interimsbestockung kümmert, bildet allmählich einen neuen Humushorizont.<br />
Beim Umbau der Interimsbestockung ist es zwingend, <strong>das</strong> Humusdepot<br />
der Wälle wieder auf ganzer Fläche zu verteilen. Dieser enorme Mehraufwand ist<br />
Im Privatwald nicht förderfähig.<br />
Eine weitere Form von Bodenvorarbeiten sind Pflanzstreifen. Weder<br />
Vollumbruch, streifenweises Pflügen mit Scharpflug, noch streifenweises Fräsen<br />
(Pein-Plant-Technik) haben sich bewährt. Der Aufwand, der z. T. skeletthaltige<br />
Boden, vor allem jedoch die enorme Entwicklung der Gräser auf dem<br />
gelockerten, gelüfteten Oberboden sind Gründe da<strong>für</strong>. Auch Mäuse haben ein<br />
schnelles Fortkommen entlang der Pflanzstreifen. Bewährt hat sich schmaler, tief<br />
reichender Hakenpflug in Verbindung mit vorherigem Mulchen. Gepflanzt wird<br />
nicht in den Spalt, sondern daneben. Mitunter reichen auch plätzeweise<br />
60
Bodenvorarbeiten mittels Kleinbagger oder manuell aus, was jedoch relativ teuer<br />
wird. Selbst am Hang verrichten kleine Schreitbagger gute Arbeit. Dazu hat es<br />
sich bewährt, pro m Pflanzstreifen 1 kg bzw. pro Pflanzplatz 0,5 kg<br />
dolomitischen Kalk einzuarbeiten. Dies erfolgt mittels Anbaugeräten<br />
(Dosiereinrichtungen) im Zuge der Bodenvorarbeiten, meist in einem<br />
Arbeitsgang.<br />
Baumarteneignung<br />
Festzuhalten ist, <strong>das</strong>s sich die Wertung der Interimsbaumarten durch KLUGE<br />
(1993) und Hering (1999) weitgehend bestätigt hat. Bis 1990 war man bestrebt,<br />
anstelle der abgängigen Fichtenbestockung möglichst „rauchharte“, d. h.,<br />
Immissionstolerante, z. T. in Begasungskammern geprüfte Baumarten wie<br />
Stechfichte Picea pungens), Serbische Fichte (Picea omorica). Murraykiefer<br />
(Pinus contorta var. Murrayana). Europäische, Japanische und Hybridlärche<br />
(Larix spec.) u. a. m. im Schutze aller natürlich ankommenden Vorwaldbaum<br />
arten - z. B. Birkenarten (Betula spec.), Eberesche (Sorbus aucuparia) oder<br />
Weidenarten (Salix spec) - im Extremschadgebiet zu etablieren. Es herrschte<br />
zeitweilig ein Anbauverbot <strong>für</strong> die Gemeine Fichte (Picea abies). Mitunter<br />
wurden auch Birkenschneesaaten (i. d. R. Moorbirke) praktiziert.<br />
Das Risiko sollte gestreut werden, da die künftige Vitalität der<br />
Baumarten unter den gegebenen Bedingungen mittel und langfristig nicht<br />
abschätzbar war. Stechfichte erschien neben ihrer Rauch- und Wildresistenz<br />
besonders gut geeignet, da die breitwüchsige Baumart den Waldboden flächig<br />
deckt, ihn somit schützt. Auch die Bruch- und Wurfgefährdung ist gering. Mit 20<br />
- 30 <strong>Jahr</strong>en, manchmal auch von vornherein lässt <strong>das</strong> Wachstum jedoch rapide<br />
nach. Folglich rangiert Stechfichte nach den zumeist schon abgängigen<br />
Ebereschen und Gemeinen Birken generell an dritter, im Waldteil<br />
Deutscheinsiedel flächig an erster Stelle der Umbaudringlichkeit. Weniger<br />
umbaudringlich erweisen sich Murraykiefer, Lärchenarten und Omorikafichte.<br />
Die Murraykiefer entwickelt zum Teil enorme Kronenmassen und extreme<br />
Trieblängen, ist damit sehr schnee- und eisbruchgefährdet (Abb. 4 und 5).<br />
Diese vermutlich dem Stickstoffeintrag geschuldete Gefahr trifft aber<br />
auch andere Baumarten. z.B. die Umwandlungsbaumart Fichte. Selbst<br />
Hochlagenprovenienzen schieben ab dem Jungwuchsstadium Triebe von 60 cm<br />
Länge und mehr. Unter den Lärchenarten gelten einzelne Provenienzen<br />
Europäischer Lärche als wüchsig, stabil, geradschaftig und somit<br />
zukunftsträchtig. Andere Provenienzen neigen hingegen, wie auch die<br />
Japanlärche zu Krumm- und Breitwüchsigkeit sind also auch umbauwürdig.<br />
Hervorragend bewährt sich die Hybridlärche, die leider nicht hinreichend zur<br />
Verfügung stand. Omorikafichte, eine schlanke Gebirgsfichte <strong>des</strong> Balkans, zeigt<br />
sich seit ca. 35 <strong>Jahr</strong>en stabil, lediglich gegen Hallimasch anfällig und in der<br />
61
Produktivität hinter der Gemeinen Fichte weit zurück. Bewährt hat sich auch<br />
Moorbirke auf organischen/mineralischen Nassstandorten. Sie ist autochthon und<br />
i. d. R. durch Schneesaat flächig begründet. Wenn KLUGE (1993) sinngemäß<br />
schreibt, spätere Beurteiler sollten sich nicht „klüger dünken“, als es <strong>das</strong> Resultat<br />
der schnellen Wiederbewaldung hergibt, so ist dem vollauf zuzustimmen.<br />
Unter den gegebenen Bedingungen entstand ein strukturierter Interimswald mit<br />
Stärken und Schwächen der eine bestan<strong>des</strong>weise, differenzierte Rekonstruktion<br />
der natürlichen Waldgesellschaften mit Baumarten geeigneter Provenienz<br />
erlaubt. Mehr war in dieser Situation nicht möglich.<br />
Welche Baumarten werden in Zukunft geeignet sein? Die wesentlichste<br />
Baumart wird – auch unter Berücksichtigung <strong>des</strong> absehbaren Klimawandels –<br />
die Gemeine Fichte sein. Gepflanzt werden Provenienzen der<br />
westerzgebirgischen Hochlagen (84016). Unsicherheit hingegen herrscht<br />
hinsichtlich der Buche. Zwar hat diese die lange Kette an Schadereignissen wohl<br />
am besten überstanden und ist offenbar von hohem ökologischem und<br />
landschaftlichem Wert. Andererseits sind vor allem die jüngeren Wuchsklassen<br />
vielen Risiken ausgesetzt, wobei am Ende eine Holzqualität steht, die kaum mehr<br />
als Paletten- und Industrieholz ergibt. Nach mehreren <strong>Jahr</strong>en intensiven<br />
Voranbaus von Buchen-Wildlingen örtlicher anerkannter Forstsaatgutbestände<br />
ergab die Zwischenrevision der Forsteinrichtung eine verstärkte Hinwendung zur<br />
Hochlagenfichte bzw. eine stark eingeschränkte Verjüngung der Buche. Weitere<br />
Baumarten wie Bergahorn und Bergulme werden horstweise angebaut und<br />
gezäunt. Auf Weißtanne wird, von Versuchen abgesehen, verzichtet. Für sie gibt<br />
es bessere Standorte. Bergkiefer wird im Randbereich der Moore gepflanzt.<br />
Wesentliche Teile der Lärchenbestockungen, der Murraykiefer und<br />
Omorikafichte werden übernommen und erst später umgebaut. Eberesche ist als<br />
natürliche Mischbaumart <strong>des</strong> Fichtenbergwal<strong>des</strong> sehr erwünscht<br />
(Naturverjüngung) ebenso die Moorbirke auf den Mooren. Tabelle 2 zeigt <strong>das</strong><br />
Resultat der Waldverjüngung im Lan<strong>des</strong>wald Deutscheinsiedel im Zeitraum<br />
1991 bis 2005 in Regie <strong>des</strong> Sächsischen Forstamtes Olbemhau. Dabei ist zu<br />
bedenken <strong>das</strong>s es anfangs zumeist noch um den Anbau von Kahlflächen oder<br />
von misslungenem Vorwald – zum Teil mit Interimsbaumarten – ging.<br />
Zunehmend konzentrierte sich die Verjüngung auf den Umbau der<br />
Interimsbestockungen mit den Zukunftsbaumarten.<br />
62
Tab. 2: Verjüngung im Zeitraum 1991 bis 2005 (ohne Naturverjüngung<br />
/Sukzession).<br />
Verjüngungsfläche<br />
Verjüngungsbaumarten 1991 - 2005 2000 - 2005<br />
ha % ha %<br />
Fichten 99 49 76 68<br />
Kiefern 24 12 5 4<br />
Lärchen 16 8 < 1 < 1<br />
sonstige Baumarten 1 1 < 1 < 1<br />
Rotbuche 52 26 28 25<br />
sonst. Hart- u.<br />
Weichlaubholzarten<br />
9 4 2 2<br />
Gesamt<br />
201<br />
63<br />
100<br />
112<br />
100<br />
Somit wurden innerhalb von 15 <strong>Jahr</strong>en 40 % <strong>des</strong> rund 500 ha<br />
umfassenden Waldteils mit herkunftsgesicherten Baumarten, zumeist der<br />
natürlichen Waldgesellschaften, verjüngt. Nach sechs <strong>Jahr</strong>en sind bereits 80 %<br />
der <strong>für</strong> den Zeitraum 2000 – 2009 geplanten Verjüngungsflächen von 140 ha<br />
umgesetzt. Darunter gibt es qualitativ sehr befriedigende, aber auch fragwürdige<br />
Bilder. Während sich Fichte teils rasant entwickelt, hat die Buche Rückschläge<br />
vor allem durch Spätfrost (Mai 2004, Juni 2005), aber auch durch Konkurrenz<br />
der Bodenvegetation, Mäuse und Wildverbiss erlitten. Bei Pflanzzahlen von<br />
5.000 Stück/ha, wie bisher vorgesehen, kann ein Misserfolg schnell eintreten,<br />
wenn nicht intensiv nachgebessert wird. Eine wesentliche Erkenntnis ist <strong>des</strong>halb<br />
die Buche beschränkt, dann aber mit Pflanzenzahlen um 8.000 Stück/ha,<br />
voranzubauen. Trotz allem wird sie künftig in diesen Lagen mehr ökologische,<br />
denn wirtschaftliche Bedeutung haben.<br />
Verfahren <strong>des</strong> Waldumbaues<br />
Momentan sind nahezu vorgesehenen Totalschadflächen wieder aufgeforstet<br />
worden. Bodenarbeiten und Zusatzkalkung waren auf Kahlflächen unerlässlich.<br />
Wesentlich bleibt hingegen der Umbau von Interimsbestockungen. Ein<br />
reihenweiser oder doppelreihiger Abstand (i. d. R. 2 m), aber auch ein trupp- und<br />
gruppenweiser Umbau durch Entnahme der Vorwaldbaumarten und Voranbau ist<br />
wenig effektiv. Deshalb hat sich <strong>das</strong> Forstamt Olbernhau <strong>für</strong> folgen<strong>des</strong><br />
Verfahren entschieden und dieses bereits auf ca. 100 ha realisiert:<br />
Mulchen von jeweils 3 Reihen Stechfichte (andere Vorwaldbaumarten<br />
analog). Beiderseits verbleiben je zwei Reihen als Klimaschutzriegel. Der<br />
Mulcher muss ein leistungsfähiges Anbaugerät an Traktoren sein, die mit
Breitreifen ausgestattet sind. Das Mulchgut – organische Masse von 0,5 bis 5 cm<br />
Größe verbleibt ca. 15 cm hoch auf dem entstandenen, etwa 8 m breiten<br />
Arbeitsstreifen. Je nach vorgesehener Baumart werden per Hakenpflug 2 Reihen<br />
(Fichte) bzw. 3 Reihen (Buche) etwa 40 cm tief gelockert und zugleich 1 kg<br />
dolomitischer Kalk je Laufmeter dosiert zugegeben. Es ergeben sich 3.000<br />
lfdm/ha Mulchstreifen auf denen 2.000 lfdm/ha mit 1.333 Hochlagenfichten<br />
(Herkunft 84016 Verband 2 x 1,5 m bzw. 3.000 Rotbuchen Herkunft 81015,<br />
Verband 2 x 1 m) eingebracht werden. Gepflanzt wird knapp neben dem<br />
Pflugspalt mittels geeigneter Pflanzhacke und gut festgetreten. Zäunung und<br />
Verbissschutz können bei hinreichender Bejagung entfallen. Kulturpflege ist ggf.<br />
ab 3. Kulturjahr nötig. Jeder zweite doppelreihige Klimaschutzriegel kann später<br />
– nach Mulchen und Ansaat von Äsungspflanzen – als Arbeitsgasse (20 m<br />
Abstand) genutzt werden. Die verbleibenden Klimaschutzriegel sollen<br />
einwachsen, können jedoch auch gemulcht und noch angebaut werden, wenn der<br />
beschriebene Voranbau im Jungwuchsstadium ist. Dies fördert die Produktivität.<br />
der Fläche, auf der dann insgesamt 2.000 Fichten bzw. 4.000 Buchen/ha wachsen<br />
würden.<br />
Dieses Verfahren <strong>des</strong> Waldumbaus ist effektiv. Folgende Kosten entstehen<br />
(netto):<br />
Mulchen: ca. 500 €/ha (3000 Ifdm).<br />
Bodenvorarbeiten mit Kalkung: ca. 500 €/ha (Fichte) bzw. 750 €/ha (Buche).<br />
Pflanzung: ca.. 1200 €/ha (Fichte), Buche trotz höherer Pflanzenzahl ebenso, da<br />
eigene Wildlinge<br />
Gesamt: ca. 2200 €/ha (Achte) bzw. 2450 €/ha (Buche) ohne evtl. Kulturpflege,<br />
Wild- und Mäuseschutz und Weiterbehandlung der Klimaschutzriegel.<br />
Gut gemeinte Hinweise, doch die natürliche Sukzession der Gehölze<br />
auszunutzen, sind unter den gegebenen Bedingungen wenig realistisch. In der<br />
Mehrzahl der verhindern schnell zunehmende Konkurrenz durch Gräser<br />
(Calamagrosfis, Molinia spec.) sowie Mäuse, Wildverbiss, Fröste in bodennaher<br />
Luftschicht, blattschädigende Pilze und Insekten u. a. m. die Entwicklung hin zu<br />
brauchbaren Gehölzbestand. Natürliche Sukzession ist eine Ergänzung, jedoch<br />
keine planbare Größe auf dem Weg zur arten- und strukturreichen<br />
Wiederbewaldung der Immissionsschadflächen.<br />
Je weiter die Entwicklung <strong>des</strong> Vorwal<strong>des</strong> aus Interimsbaumarten,<br />
übernahmewürdiger Teile dieser ersten Generation sowie bereits<br />
zukunftsträchtiger Umwandlungsbaumarten voranschreitet, <strong>des</strong>to mehr rücken<br />
Pflegeprinzipien in den Mittelpunkt der forstlichen Arbeit. Diese sind im<br />
Wesentlichen:<br />
Interimsbaumarten, die alsbald voranzubauen sind (z. B. Stechfichte,<br />
Eberesche, Gemeine Birke) erhalten bis dahin hinreichend Standraum<br />
zwecks Stabilisierung, Kronenbildung und Bodendeckung.<br />
64
Erhaltenswerte Mischbaumarten (z. B. Rotbuche, Bergahorn) werden<br />
durch Bedrängerentnahme gefördert. Phänotypenauslese ist nicht<br />
Gegenstand der Pflege, da kein Sägeholz zu erwarten ist.<br />
Zunächst übernahmewürdige Bestände und Teile davon (z.B.<br />
Europäische Lärche. Omorikafichte. Murraykiefer) werden<br />
zweckbestimmt, differenziert und häufig (5 <strong>Jahr</strong>e) gepflegt. Standraum-<br />
und Mischungsregulierung sowie Phänotypenauslese gehen konform.<br />
Hauptproblem ist die fortwährende Stabilisierung gegen Schneedruck<br />
und Eisanhang, doch auch ein Arten und Strukturreichtum von Bäumen<br />
mit gewisser Qualitätserwartung wird angestrebt. Große Teile <strong>des</strong><br />
liegenden Restholzes wirbt die örtliche Bevölkerung als Brennholz.<br />
Für die zukunftsträchtigen Umwandlungsbaumarten, die sich zz. erst<br />
zum Jungwuchs entwickeln gilt <strong>das</strong> zuvor genannte Pflegeprinzip<br />
verschärft. Somit soll eine Waldgeneration entstehen, von der sowohl<br />
Volumenertrag als auch Wertertrag durch Holzqualität (mit<br />
Einschränkungen) erwartet werden darf.<br />
Schluss<br />
Die Strategie künftigen Handelns umfasst:<br />
Die Sicherung der Walderhaltung.<br />
Die arten- und strukturreiche Erziehung eines möglichst großen Anteils<br />
der ersten Waldgeneration nach dem Totalschadereignis und <strong>das</strong><br />
Hinausschieben bzw. Entbehrlich machen einer wiederholten Umwandlung<br />
auf ca. 2/3 der Waldfläche.<br />
Die Etablierung natürlicher, dem Standort angepasster Waldgesellschaften<br />
in der Betriebsart <strong>des</strong> Dauerwal<strong>des</strong>.<br />
Die bevorzugte Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen<br />
gegenüber den Nutzfunktionen die jedoch mit der Zeit wieder an<br />
Bedeutung gewinnen müssen.<br />
<br />
Die jahrzehntelange katastrophale Waldentwicklung im Mittleren Erzgebirge<br />
wandelt sich allmählich zum Besseren. Nicht nur wir Forstleute, sondern die<br />
ganze Region ist dankbar da<strong>für</strong>. So war es folgerichtig am 2. Oktober 2004 den<br />
Nestor <strong>des</strong> Deutscheinsiedeler Wal<strong>des</strong>, den Revierförster i. R. Helmut .KLUGE,<br />
kurz vor seinem 85. Geburtstag <strong>für</strong> <strong>des</strong>sen langjährige Verdienste um die<br />
Erhaltung dieses Waldgebietes öffentlich zu ehren.<br />
65
Seniorentreff <strong>2011</strong> beim mdr<br />
Liebe daheimgebliebene Senioren. Wieder einmal war es im August Zeit <strong>für</strong><br />
unser altbewährtes Seniorentreffen gemeinsam mit dem <strong>Thüringer</strong> Forstverein.<br />
In der Hoffnung, <strong>das</strong>s Sie gesund und munter die wunderbaren Herbsttage<br />
genießen können und <strong>das</strong>s wir es einfach aufgrund Ihres ausgefüllten Kalenders<br />
(ich meine nicht die Arzttermine ...) nicht geschafft haben, uns zu sehen, lassen<br />
Sie mich kurz erzählen:<br />
Als bodenständiger Mensch und Revierförsterin vor Ort lag mir die Mitte<br />
Thüringens, die Lan<strong>des</strong>hauptstadt Erfurt (der Schatz vor der eigenen Haustür<br />
sozusagen), am Herzen.<br />
Somit stand als erster Exkursionspunkt ein Besuch im modernen und<br />
großzügigen Gebäude <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>funkhauses <strong>des</strong> mdr an. Der persönliche<br />
Referent <strong>des</strong> dortigen Direktors sowie ein weiterer Kollege nahmen sich sehr viel<br />
Zeit, uns sowohl die Baugeschichte <strong>des</strong> Hauses als auch die Arbeit <strong>des</strong> Senders<br />
im Allgemeinen und natürlich im Speziellen während der Führungen vor Ort zu<br />
erläutern.<br />
66
Eine ganz andere Arbeitswelt als wir sie kennen, offenbarte sich uns (der ein<br />
oder andere Kollege äußerte sich im Nachhinein dankbar <strong>für</strong> seinen ehemaligen<br />
Arbeitsort Wald), und speziell während der Führungen relativierten sich manche<br />
laienhaften Bilder und Vorstellungen aus dem Hörfunk- und Fernsehbereich.<br />
Wussten Sie zum Beispiel, was ein Selbstfahrerstudio ist oder warum mdr Radio<br />
Thüringen immer nach den Nachrichten zuerst einen englischsprachigen Titel<br />
spielt?<br />
67
Im wohltemperierten Lan<strong>des</strong>funkhaus (Klimaanlage) lauschte die Teilnehmerschar<br />
nach dem Mittagessen sehr interessiert dem sich anschließenden Vortrag<br />
von Jürgen Holtz, der im Auftrag <strong>des</strong> TMLFUN und in Vertretung von Volker<br />
Gebhardt den aktuellen Stand zur Entwicklung der AÖR darlegte.<br />
Am heißesten Tag <strong>des</strong> <strong>Jahr</strong>es <strong>2011</strong> war der zweite Exkursionspunkt eine<br />
Herausforderung der besonderen Art.<br />
Ein Besuch der Kakteengärtnerei Haage stand auf dem Plan. Das ist die älteste<br />
Kakteenzucht der Welt, Gärtner seit 1685 und seit 180 <strong>Jahr</strong>en auf Kakteen<br />
spezialisiert (da kann man wohl von Nachhaltigkeit sprechen).<br />
Frau Haage sen. hatte sich extra Zeit von ihrem Mittagsschlaf abgeknipst, um<br />
uns zunächst im Schatten <strong>des</strong> betrieblichen Hauptgebäu<strong>des</strong> aus der bewegten<br />
Geschichte <strong>des</strong> traditionsreichen Familienbetriebes zu berichten.<br />
Trotz Schatten und keinerlei körperlicher Beanspruchung mussten wir -<br />
verständlicherweise - erste "Teilnehmerverluste" (keine Sorge - wir brauchten<br />
keine medizinische Hilfe) registrieren.<br />
Bei dem Besuch der Gewächshäuser fand dann die klimatische Herausforderung<br />
ihren absoluten Höhepunkt, der tatsächlich nur drei Besucherinnen gemeinsam<br />
mit der wackeren Frau Haage gewachsen waren ...<br />
Beeindruckend zu erleben, mit welcher Begeisterung Frau Haage von ihren<br />
stacheligen Burschen schwärmte und die Arbeit drumherum so angenehm<br />
erscheinen ließ.<br />
Diese Begeisterung <strong>für</strong> eine Sache, sei es der Familienbetrieb, sei es die Arbeit<br />
im Großraumbüro <strong>des</strong> mdr oder die Arbeit im Wald, dies ist unser wichtigstes<br />
68
Gut (Begeisterung/ Freude <strong>für</strong> den Beruf und körperliche/seelische Gesundheit),<br />
welches es zu erhalten und zu pflegen gilt.<br />
In unruhigen Zeiten wie diesen droht leider dem einen oder anderen Nachfolger<br />
von Ihnen, also den noch aktiven Kollegen, ein wenig von dieser Begeisterung<br />
zu entwischen. Hier appelliere ich an Sie, pflegen Sie Ihre Kontakte zu Ihren<br />
beruflichen Nachkommen, bringen Sie Ihre Lebenserfahrung, Ihre Begeisterung<br />
und Ihre Wertschätzung ein, es tut uns allen gut!<br />
Und übrigens, wenn es Sie tatsächlich interessiert, was ein Selbstfahrer-Studio<br />
ist oder warum ein englischsprachiger Titel nach den Nachrichten zuerst kommt,<br />
wir sehen uns spätestens nächstes <strong>Jahr</strong> in gesunder Frische zum nächsten<br />
Seniorentreff wieder. Dann besprechen wir <strong>das</strong>. Ich freue mich auf Sie.<br />
Bis dahin herzliche Grüße<br />
Ihre Uta Krispin<br />
Fotos: Gerhard Bleyer<br />
69
Pressemitteilung vom 14. Oktober <strong>2011</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> Forstverein begrüßt die Verabschiedung <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> Gesetzes über die Reform der Forstverwaltung<br />
Mit dem heutigen Landtagsbeschluss wurde die rechtliche Grundlage <strong>für</strong> den<br />
zukünftigen Weg der <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung geschaffen. Nun müssen<br />
nach Ansicht <strong>des</strong> Vorsitzenden <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e. V. Hagen Dargel in<br />
der jetzt beginnenden Gründungsphase die Voraussetzungen <strong>für</strong> einen guten<br />
Start geschaffen werden, damit sich eine wirtschaftlich solide und arbeitsfähige<br />
Lan<strong>des</strong>forstanstalt entwickeln kann. Während <strong>des</strong> langen<br />
Gesetzgebungsverfahrens wurden viele notwendige Personalmaßnahmen auf der<br />
örtlichen Ebene zurückgestellt, was zu zahlreichen Vertretungsregelungen<br />
geführt hat. Der in Kürze zu berufene Gründungsrat ist hier gefordert, eine<br />
Bestandaufnahme zu machen und klar zu entscheiden, welche Stellen<br />
wiederbesetzt werden und welche Reviere und Forstämter ggf. anders zu<br />
strukturieren sind. „Eine weitere Hängepartie ist den engagierten Mitarbeitern<br />
von ThüringenFORST nicht mehr zuzumuten. Sie warten darauf, <strong>das</strong>s mit<br />
Gründung der Anstalt <strong>das</strong> umgesetzt wird, was intern schon angekündigt wurde<br />
und somit wieder Gewissheit einzieht,“ meint Dargel.<br />
Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein hat sich wie viele andere Verbände mit<br />
Stellungnahmen und Gesprächen in <strong>das</strong> Gesetzgebungsverfahren eingebracht<br />
(wo<strong>für</strong> sich auch einige Abgeordnete im Plenum bedankt haben). Einige von den<br />
eingebrachten Punkten finden sich auch im endgültigen Gesetzestext wieder, was<br />
ein Beispiel <strong>für</strong> lebendige Demokratie ist. Bedauert wird, <strong>das</strong>s eine Stärkung der<br />
forstlichen Ausbildung durch einen festgeschriebenen Budgetanteil nicht so<br />
erfolgt ist, wie es vom Forstverein vorgeschlagen wurde.<br />
Dr. Andreas Niepagen<br />
(Geschäftsführer)<br />
70
„Das Harz – einst Gold <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>“<br />
Zum Tag <strong>des</strong> Baumes am 25.04.<strong>2011</strong> eröffnete im Beisein von Vertretern <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong>, der Abteilung Forsten sowie zahlreichen Gästen der<br />
Leiter <strong>des</strong> Forstamtes Paulinzella, Herrn Matthias Schwimmer, die Ausstellung<br />
„Harzung in Deutschland von 1917 bis 1989“.<br />
71
Grußworte wurden von Herrn Hagen Dargel, Vorsitzender <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
<strong>Forstvereins</strong>, Herrn Karl-Heinz Müller, Referatsleiter Forstpolitik der Abteilung<br />
Ländlicher Raum Forsten im <strong>Thüringer</strong> Ministerium <strong>für</strong> Landwirtschaft, Forsten,<br />
Umwelt und Naturschutz sowie dem Bürgermeister der Gemeinde Rottenbach<br />
Herrn Stein, anlässlich der Eröffnung überbracht.<br />
Abb. 1: Begrüßung der Gäste und Eröffnung der „Harz-Ausstellung“ vor dem Jagdschloss<br />
Paulinzella am 24.04.<strong>2011</strong> am Tag <strong>des</strong> Baumes <strong>2011</strong>.<br />
Foto: Michael Kolbe<br />
Abb. 2: Günther Haim führt anlässlich der Eröffnung die Gäste durch seine Ausstellung.<br />
Foto: Michael Kolbe<br />
72
Forstmeister a. D. Günther Haim hat in mehr als 10 <strong>Jahr</strong>en Exponate, Geräte und<br />
Informationen über die Harzgewinnung in Deutschland zusammengetragen und<br />
mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Lan<strong>des</strong>verband<br />
Brandenburg und dem Forsttechnikmuseum Brandenburg mit Sitz in<br />
Königswusterhausen zusammengestellt. Die Präsentation der Ausstellung im<br />
Jagdschloss Paulinzella war zu gleich eine Prämiere. Die Ausstellung wurde<br />
erstmals außerhalb <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg gezeigt.<br />
Alles hatte mit dem Aufbau einer Ausstellung zur Kiefernharzgewinnung in<br />
Brandenburg <strong>für</strong> <strong>das</strong> Forsttechnikmuseum Königs Wusterhausen begonnen.<br />
Zahlreiche Originalgeräte und Dokumente über die Harzgewinnung ließen die<br />
Ausstellung bald anwachsen.<br />
Abb. 3: Blick in die mit vielen Details ausgestattete Ausstellung<br />
Foto: Horst Geisler<br />
Forstmeister a. D. Günther Haim gliederte die Ausstellung chronologisch nach<br />
dem entsprechenden jahreszeitlichen Ablauf der Harzgewinnung und der<br />
geschichtlichen Bedeutung dieses Rohstoffes. Bereits in den zurückliegenden<br />
<strong>Jahr</strong>hunderten war Harz ein sehr gefragter und begehrter Rohstoff <strong>für</strong> Handwerk<br />
und <strong>für</strong> die sich entwickelnde Industrie. Schon in der Antike und im alten<br />
Ägypten stellte <strong>das</strong> Harz ein hohes Handelsgut dar. Zu jener Zeit verwendete<br />
man Harz, bedingt durch seine Anteile an ätherischen Ölen als Wund- und<br />
Heilmittel sowie zu religiösen Zwecken. In der Seefahrt der Antike wurde bereits<br />
Harz bzw. <strong>das</strong> daraus gewonnene Pech zum Abdichten der Schiffe verwendet.<br />
Mit der Besiedlung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> vor mehr als 1500 <strong>Jahr</strong>en machte sich der<br />
Mensch den Wald zu Nutze. Der Wald war eine wichtige Lebensgrund-lage <strong>des</strong><br />
Menschen. Im Laufe der Geschichte bildeten sich wichtige Waldnutzungs-<br />
73
formen heraus. In erster Linie diente der Wald früher wie auch heute als<br />
Holzlieferant. Holz war ein wichtiger Rohstoff <strong>für</strong> <strong>das</strong> Handwerk, <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />
Baugewerbe, der aufkommenden Industrie sowie auch Brennstoff <strong>für</strong> die Häuser<br />
der Bevölkerung. Neben dem Rohstoff Holz nutzte der Mensch andere Produkte<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>. Bereits in der Mitte <strong>des</strong> 18. <strong>Jahr</strong>hunderts unterteilten Forstmänner<br />
wie Carl Christoph Oettelt, Johann Matthäus Bechstein und andere die Produkte<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> in Haupt- und Nebenprodukte.<br />
Das Hauptprodukt war <strong>das</strong> Holz und zu den Nebenprodukten <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> zählten<br />
sie die Streu-, Gras- und Harznutzung. Das Harz wurde in Thüringen<br />
hauptsächlich von der Baumart Fichte aber auch von der Kiefer und Lärche, dort<br />
wo sie reichlich vorkamen, gewonnen.<br />
Die Wälder waren bis zum ausgehenden 18. <strong>Jahr</strong>hundert noch nicht umfangreich<br />
erschlossen. Holz wurde dort eingeschlagen, wo die Wälder <strong>für</strong> den Menschen<br />
zugänglich waren und der Abtransport <strong>des</strong> Holzes mit wenig Aufwand erfolgen<br />
konnte.<br />
Mit der zunehmenden Nutzung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> und seiner Produkte nahm auch die<br />
Nutzung <strong>des</strong> Harzes zu. Dort wo die Wälder schon ausgeplündert waren, man<br />
sprach vor mehr als 200 <strong>Jahr</strong>en sogar von einer Holzverknappung oder gar<br />
Holznot, war auch eine Harzgewinnung nicht mehr möglich. Die Harzgewinnung,<br />
insbesondere die Scharrharzgewinnung bei der Fichte verlagerte sich<br />
in die höheren Regionen der <strong>Thüringer</strong> Gebirge. Das gewonnene Harz konnte<br />
von dort besser abtransportiert werden, als <strong>das</strong> geerntete Holz.<br />
Der Ilmenauer Wild- und Forstmeister Carl Christoph Oettelt sprach bereits im<br />
<strong>Jahr</strong> 1789 sogar davon, <strong>das</strong>s mancherorts mit dem Harz mehr Geld<br />
eingenommen wurde, als durch den Verkauf <strong>des</strong> Holzes.<br />
Ein kurzer Rückblick über die Geschichte der Harzgewinnung in Deutschland<br />
mit Beginn <strong>des</strong> 1. Weltkrieges offenbarte, wie sehr Deutschland den Rohstoff<br />
Harz benötigte. Harz war ein begehrter und notwendiger Rohstoff, auf den<br />
Deutschland nicht verzichten konnte. Bis zum Ausbruch <strong>des</strong> Krieges importierte<br />
Deutschland Harz. Bedingt durch den Krieg wurden die Importe eingestellt und<br />
Deutschland ging dazu über, Harz aus den heimischen Kiefern- und<br />
Fichtenwälder zu gewinnen. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde die<br />
Harzgewinnung in Deutschland wieder zurückgefahren und auf Importe<br />
zurückgegriffen. Zu Beginn der 30iger <strong>Jahr</strong>e <strong>des</strong> 20. <strong>Jahr</strong>hunderts wurde durch<br />
wirtschaftliche Zwänge und der hohen Arbeitslosigkeit, welche Deutschland<br />
ausgesetzt war, wieder geharzt. Harzimporte, welche zwischen den beiden<br />
Weltkriegen getätigt wurden, brachen durch die Kriegswirren wieder weg. Für<br />
Deutschland taten sich somit erneut wirtschaftliche Zwänge auf.<br />
Nach Kriegsende und der erfolgten Teilung Deutschlands wurde in der<br />
Sowjetischen Besatzungszone und später in der ehemaligen DDR bedingt durch<br />
74
die permanente Devisenknappheit die Harzgewinnung fortgesetzt. Dabei wurde<br />
die Technologie der Harzgewinnung ständig vervollkommnet. Arbeitsnormen <strong>für</strong><br />
die Harzer und der sozialistische Wettbewerb waren ein Instrument zur<br />
Erhöhung der Leistungen <strong>für</strong> die Arbeiter in der Harzgewinnung. Beschäftigte in<br />
der Harzgewinnung hatten mitunter einen besseren Verdienst, als andere<br />
Waldarbeiter. Es soll auch vorgekommen sein, <strong>das</strong>s ein Harzer mehr verdient hat<br />
als der Leiter eines Staatsforstbetriebes.<br />
Einer der größten Abnehmer <strong>für</strong> Harz war die optische Industrie Carl Zeiß in<br />
Jena. Zu DDR Zeiten wurde <strong>für</strong> ein Kilo Kiefernharz ca. 5,17 M und <strong>für</strong> ein Kilo<br />
Lärchenharz ca. 155,00 M gezahlt.<br />
Abb.4 Lärchenharzung Foto: Horst Geisler<br />
Nach der politischen Wende in der ehemaligen DDR im <strong>Jahr</strong>e 1989 wurde auch<br />
die Harzgewinnung in Deutschlands Wäldern eingestellt.<br />
Die von Günther Haim gestaltete Ausstellung stellte diese Entwicklung der<br />
Harzgewinnung und Harznutzung anschaulich dar. Diese Ausstellung, welche im<br />
Jagdschloss Paulinzella präsentiert wurde, konnte dann vom 29.04. bis<br />
30.06.<strong>2011</strong> besucht werden. In dieser Zeit nahmen über 1.000 Besucher, von<br />
denen sich nur 564 in die Besucherliste bzw. in <strong>das</strong> Gästebuch eintrugen, diese<br />
Gelegenheit wahr.<br />
Unter den Gästen waren zahlreiche Interessenten aus dem Ausland. So besuchten<br />
Touristen aus Spanien, Schweden, Norwegen, Belgien und den Niederlanden<br />
75
diese Ausstellung. Aber auch Besucher von der Ostsee bis zu den Alpen, die als<br />
Gäste oder auf der Durchreise Paulinzella besuchten, ließen sich die Gelegenheit<br />
eines Besuchs dieser Ausstellung nicht entgehen.<br />
Abb. 5: Alte „Harzkollegen“ aus dem damaligen StFB Saalfeld folgten der Einladung <strong>des</strong><br />
Forstamtes Paulinzella zum Besuch der Ausstellung. Foto: Christine Schröpfer<br />
Abb. 6: Erfahrungsaustausch der anderen Art - mit großer Bewunderung betrachteten die<br />
Kollegen aus den ehemaligen Harzbrigaden die Darstellung der Geschichte der<br />
Harznutzung sowie die Arbeitsverfahren und Geräte. Foto: Christine Schröpfer<br />
76
Am 30.06.<strong>2011</strong>, dem letzten Tag dieser Ausstellung in Paulinzella, folgten 14<br />
ehemalige Harzarbeiter <strong>des</strong> damaligen Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes<br />
Saalfeld einer Einladung <strong>des</strong> Forstamtes Paulinzella zu einem Ausstellungsbesuch.<br />
Bei der Betrachtung der Ausstellung kamen bei den ehemaligen Kollegen alte<br />
Erinnerungen und ein reger „Erfahrungsaustausch“ setzte sich unter zur<br />
„Hilfenahme“ der Ausstellungsexponate in Gang. Man sah den alten Kollegen<br />
an, <strong>das</strong>s sie gern an ihre alte Tätigkeit zurückdachten.<br />
Abb. 7: Diese Ausstellung weckte bei den alten Kollegen zahlreiche Erinnerungen an die<br />
Zeiten der Harzgewinnung im damaligen Staatsforstbetrieb Saalfeld.<br />
Foto: Christine Schröpfer<br />
Wir mussten aber auch mit Bedauern feststellen, <strong>das</strong>s zu wenig Kollegen aus<br />
unserer Forstverwaltung den Weg nach Paulinzella in diese Ausstellung fanden.<br />
Am 30.06.<strong>2011</strong> schloss diese Ausstellung ihre Pforten und trat eine erneute weite<br />
Reise an. Diesmal ging die Reise in Richtung Norddeutschland, nach Hamburg<br />
in <strong>das</strong> „Loki-Schmidt-Haus“, wo sie <strong>für</strong> mehrere Monate präsentiert wird.<br />
Michael Kolbe<br />
FoA Paulinzella<br />
77
Dr. Wolfgang Henkel 80 <strong>Jahr</strong>e<br />
... und quicklebendig und der Zeit zugewandt wie immer! Er wurde am 4. Mai<br />
1931 in Neuhaus/Thüringen geboren. 1950, nach dem Abitur, begann er eine<br />
Lehre zum Forstfacharbeiter, die er 1952 beendete. Anschließend arbeitete er im<br />
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb (StFB) Neuhaus am Rennweg.<br />
1953 konnte er <strong>das</strong> Studium an der Forstwirtschaftlichen Fakultät in Eberswalde<br />
aufnehmen und 1957 als Diplom-Forstwirt abschließen.<br />
Von 1957 bis 1959 war er im StFB Sonneberg/Thür. beschäftigt. 1959 ging er als<br />
wissenschaftlicher Assistent an <strong>das</strong> Waldbau-Institut der Eberswalder<br />
Forstfakultät. Als diese 1963 geschlossen wurde, wechselte er in die Abteilung<br />
Waldbau <strong>des</strong> Instituts <strong>für</strong> Forstwissenschaften Eberswalde. Ab 1966 arbeitete er<br />
in leitenden Funktionen in der Zentrale der Vereinigung Volkseigener Betriebe<br />
Forstwirtschaft Suhl. 1969 nahm W. Henkel eine außerplanmäßige Aspirantur an<br />
der TU Dresden, Sektion Forstwirtschaft Tharandt, Wissenschaftsbereich<br />
Waldbau und Forstschutz auf und wurde 1973 mit "magna cum laude" zum<br />
Dr. rer. silv. promoviert.<br />
Von 1975 bis 1990 war er Mitarbeiter in der Abt. Forstwirtschaft <strong>des</strong> Rates <strong>des</strong><br />
Bezirkes Erfurt. 1991 wurde W. Henkel als Waldbaureferent in die neu<br />
78
gegründete <strong>Thüringer</strong> Forstliche Versuchsanstalt in Gotha übernommen. Dort<br />
war er bis zu seiner Pensionierung 1996 tätig.<br />
Henkels Spezialität ist der Waldbau. Dieses Fach hat er in Thüringen über seine<br />
tägliche berufliche Arbeit hinaus über <strong>Jahr</strong>zehnte wesentlich mitgeprägt. Er war<br />
von 1959 bis 1990 Mitglied der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft der DDR<br />
und an der internationalen Zusammenarbeit beteiligt, bis heute u.a. in der<br />
IUFRO-Arbeitsgruppe Ökologie und Waldbau der Weißtanne. Während <strong>des</strong><br />
Umbruchs 1989/90 bewies W. Henkel Mut und Weitblick, indem er mit weiteren<br />
Forstleuten die Initiative zur Wiedergründung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> (TFV)<br />
ergriff. Aus meiner persönlichen Sicht sei hervorgehoben, <strong>das</strong>s er zu den<br />
<strong>Thüringer</strong> Persönlichkeiten gehört, die sich beharrlich <strong>für</strong> den Erhalt der<br />
forstlichen Hochschulausbildung in Thüringen eingesetzt haben.<br />
1995 wurde W. Henkel zum Ehrenvorsitzenden <strong>des</strong> TFV gewählt. In den<br />
Themen seiner über 100 wissenschaftlichen Publikationen bilden die Rotbuche<br />
und die Weißtanne einen Schwerpunkt. Die Frage "Gibt es eine Trockentanne?"<br />
lässt ihn bis heute nicht los. So freut sich jeder, <strong>das</strong>s aus seinem Spitznamen, den<br />
er als Student 1954 bekam, auf den heutigen Tag sein Ehrenname wurde: der<br />
Tannen-Henkel!<br />
Wir wünschen Wolfgang Henkel, <strong>das</strong>s er in Wohlergehen die 90 ansteuere und<br />
uns mit Rat und Tat erhalten bleibe.<br />
Martin Heinze<br />
79
Jubilare <strong>2011</strong><br />
Wir gratulieren zum 50. Geburtstag<br />
Herrn Jörg Göring am 05.01.<br />
Herrn Dietrich Mackensen am 10.01.<br />
Herrn Gunter Börner am 13.02.<br />
Herrn Volker Gebhardt am 23.04.<br />
Herrn Uwe Zehner am 18.05.<br />
Herrn Matthias Marbach am 31.05.<br />
Herrn Lutz Helmboldt am 01.09.<br />
Herrn Andreas Reichenbächer am 07.09.<br />
Herrn Uli Klüßendorf am 14.10.<br />
Wir gratulieren zum 60. Geburtstag<br />
Herrn Wolf Wunder am 05.01.<br />
Frau Anita Hölzer am 30.09.<br />
Herrn Wolfgang Friedrich am 29.10.<br />
80
Wir gratulieren zum 65. Geburtstag<br />
Herrn Georg Ernst Weber am 08.04.<br />
Herrn Frank Wildenhayn am 07.08.<br />
Herrn Gerhard Schröder am 02.09.<br />
Herrn Harald Eckhardt am 03.10.<br />
Herrn Michael Freiherr von Truchseß am 29.10.<br />
Herrn Eckhard Stephan am 05.12.<br />
Wir gratulieren zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Josef Steiner am 06.07.<br />
Herrn Siegfried Wolfer am 12.08.<br />
Herrn Helmut Wehner am 29.12.<br />
81
Wir gratulieren zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Prof. Helmut Witticke am 15.02.<br />
Herrn Wolfgang Hellmann am 17.03.<br />
Herrn Wolfgang Alt am 06.05.<br />
Herrn Dieter Klüßendorf am 28.05.<br />
Herrn Hubertus Biehl am 01.08.<br />
Herrn Gerhard Linke am 24.11.<br />
Herrn Horst Fulge am 25.11.<br />
Wir gratulieren zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Dr. Wolfgang Henkel am 04.05.<br />
Herrn Prof. Dr. Erwin Klein am 08.07.<br />
Herrn Ingwart Ullrich am 29.09.<br />
82
Wir gratulieren zum 85. Geburtstag<br />
Herrn Prof. Dr. Günter Amelung am 18.04.<br />
Herrn Kurt Heyn am 23.07.<br />
Herrn Arno Engelhardt am 21.11.<br />
Herrn Friedolt Schubert am 16.12.<br />
83
Mitglieder der <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Stand: 31.12. <strong>2011</strong><br />
Name Vorname Ort<br />
A<br />
Aderhold Werner Steinach<br />
Ahbe Claus-Jürgen Marksuhl<br />
Ahbe Jörg Marksuhl<br />
Alt Wolfgang Crawinkel<br />
Amelung Prof. Dr. Günter Hameln/Weser<br />
Amthor Eberhard Jena<br />
Apel Jochen Lauscha<br />
Apel Jürgen Heringen/Werra<br />
Arand Marita Burgwalde<br />
Arenhövel Wolfgang Legefeld<br />
B<br />
Bach Herbert Wolfsburg-Unkeroda<br />
Bach Martin Tabarz<br />
Baier Dr. Ulf Ichtershausen<br />
Baldauf Carmen Mohlsdorf<br />
Baldauf Lutz Mohlsdorf<br />
Baldauf Reiner Mohlsdorf<br />
Baldauf Timo Greiz-Gommla<br />
Barfod Marcus Weimar<br />
Bartl Gerhard Neuhaus/Rwg.<br />
Bauer Michael Oberwind<br />
Baumgart Holger Schmiedefeld<br />
Beck Petra Creuzburg<br />
Beerhold Dr. med. Gerhild Bibra<br />
Behm Silvio Saalfeld<br />
Biehl Hubertus Mühlhausen<br />
Biehl Susann Langula<br />
Blaurock Helmut Bottrop<br />
84
Bleyer<br />
Ingrid und<br />
Gerhard<br />
Rudolstadt<br />
Böer Andrea Birkigt<br />
Böhmcker Wulf Zillbach<br />
Börner Gunter Eckhardtshausen<br />
Böttger Alexander Berka v.d.H.<br />
Böttger Otto Unterellen<br />
Brauer Andreas Schwerstedt<br />
Broska<br />
Annette und<br />
Eckhardt<br />
Uhlstädt-Kirchhhasel<br />
Burkhardt Sascha<br />
Gisela und<br />
Jena<br />
Buschold<br />
Reinhard Greiz<br />
Buse<br />
Susanne und<br />
Heiko<br />
Ilmenau, OT Manebach<br />
Butzert Ute Bad Berka<br />
C<br />
Clasen Christian Freising<br />
Coch Anette Katzhütte<br />
D<br />
Dahlke Jochen Großlohra 3<br />
Dargel Ines und Hagen Ilmenau, OT Manebach<br />
Deilmann Thomas Heldrungen<br />
Deiters Anette-Marina Gotha<br />
Dragoschy Eckhard Scheibe-Alsbach<br />
Dreiack Elke Meiningen<br />
Düring Jens Erfurt<br />
Düssel Dr. Volker Erfurt<br />
E<br />
Eberle Erich Bleicherode<br />
Eckardt Lutz Tonndorf<br />
Eckhardt Harald Kleinschmalkalden<br />
85
Ehrling Bernd Oberstadt<br />
Eichhorn Lutz Sondershausen<br />
Eichler Friedrich Weida<br />
Emmel Lothar Sonneberg<br />
Engelhardt Arno Sonneberg<br />
Erhardt Joachim Bibra<br />
Erteld Thomas Gospiteroda<br />
Eulenstein Jürgen Volkmannsdorf<br />
F<br />
Fahrig Bernhard Niederorschel<br />
Färber<br />
FBG Hermannsfeld,<br />
Jörg Bad Salzungen<br />
Vors. Kümpel Erich Rhönblick<br />
Fischer Fritz Suhl<br />
Fischer Kurt Lutter, OT Fürstenhagen<br />
Freudenberger Klaus<br />
Regina und<br />
Meiningen<br />
Friedrich<br />
Wolfgang Eineborn<br />
Fritze Eduard Wachstedt<br />
Froelich Dr. Bernhard Sondershausen<br />
Fulge Horst Kaltennordheim<br />
Funke Armin Riechheim<br />
G<br />
Gaudecker v. Leo Mechelroda<br />
Gebhardt Volker Weimar<br />
Gehringer Martin Hildburghausen<br />
Geisler Horst Uhlstädt-Oberkrossen<br />
Geitner Hans Lichtenbrunn<br />
Glaser Albrecht Kaltensundheim<br />
Gödel Harald Floh<br />
Goldacker Hubertus Frankenroda<br />
Göring Jörg Mechterstädt<br />
86
Göthe Klaus Jenaprießnitz<br />
Grade Wolfgang Bad Berka<br />
Grimm Armin Saalfelder Höhe<br />
Grimm<br />
Carola und<br />
Gerhard<br />
Wilhelmsdorf<br />
Grob<br />
Sonja und<br />
Karl-Heinz<br />
Neuhaus am Rwg.<br />
Günther Gerd Oppurg<br />
H<br />
Omnibusbetrieb<br />
Häfner Werner Struth-Helmershof<br />
Hähner Rudi Unterwirbach<br />
Hänsel Bernd Benshausen<br />
Harrweg Harry Bad Klosterlausnitz<br />
Harseim Lutz Eisenach<br />
Haudeck Thomas Bibra<br />
Heil Prof. Klaus Ilmenau<br />
Heinze<br />
Prof. Dr. Martin<br />
und Annerose<br />
Wolfersdorf<br />
Heinze Susanne Eibenstock<br />
Hellmann Wolfgang Bad Berka, OT Tannroda<br />
Hellmund Matthias Mertendorf<br />
Helmboldt Lutz Stadtilm<br />
Henkel Dr. Wolfgang Erfurt<br />
Henkel Heidi Oberweißbach<br />
Henkel Lutz Bad Blankenburg<br />
Hergenhan Klaus Kühndorf<br />
Hermann Wolf-Dieter Uder<br />
Herrnkind Jörg Oberhof<br />
Heuer Wolfgang Schmalkalden<br />
Heyn Kurt Leinefelde<br />
Heyn Wolfgang Ohrdruf<br />
Hilt Jerg Stuttgart<br />
Höfer Bernd Jena, OT Jenaprießnitz<br />
87
Hofmann Günther Drognitz<br />
Höhn Helmut Sonneberg<br />
Hölzer Anita Steinheid<br />
Huhn Joachim Bad Klosterlausnitz<br />
Huster Jacqueline Stadtroda<br />
I<br />
Ichtershausen Jochen Gotha<br />
J<br />
Jacob Ronald Erfurt<br />
Jäger Tobias Bischofrod<br />
Jarski Manfred Ifta<br />
Jendrusiak Axel Schmalkalden<br />
Jungklaus<br />
Traute und Hans-<br />
Joachim<br />
Schalkau<br />
K<br />
Kahlert Karina Ruhla<br />
Kammer Katja Bad Berka, OT Tannroda<br />
Kasper Bernd Gehren<br />
Kauffmann Martin Mittelstille, OT Breitenbach<br />
Kaufmann Horst Freienorla<br />
Kaul André Saalfeld/Saale<br />
Kettner Rolf Witzenhausen<br />
Kinne Eike Flarchheim<br />
Klein Prof. Dr. Erwin Freising<br />
Kliebe Günter Großbrüchter<br />
Klüßendorf Dieter Jena<br />
Klüßendorf Uli Sondershausen<br />
Knoll<br />
Ingeborg und<br />
Richard<br />
Rudolstadt<br />
Köber Artur Dorndorf<br />
Köhler Gerhard Volkenroda<br />
88
Krauss Wolfgang Schmalkalden<br />
Kreibich Eugen Dietzhausen<br />
Kreuter Florian Gotha<br />
Krüger Andreas Schmidtmühlen<br />
L<br />
Lange Iro Kospoda<br />
Langer Wolfgang Burgk<br />
Lanz Prof. Dr. Werner Hann. Münden<br />
Lapp Martin Benshausen<br />
Leber Roswitha Herschdorf<br />
Leiteritz Achim Steinach<br />
Lemke Ralf Wölferbütt<br />
Leonhardt Stefan Wiesenfeld<br />
Liebold Hartmut Quirla<br />
Lindner Wolfgang Weimar<br />
Linke Gerhard Liebengrün<br />
Lippmann Karl-Heinz Scheibe-Alsbach<br />
Lische Ursula und Klaus Sondershausen<br />
Listing Martin Göttingen<br />
Luc Ronny Langewiesen<br />
Lüpke Marion Landsendorf<br />
Lux Andreas Jena<br />
M<br />
Mackensen Dietrich Bad Salzungen<br />
Mandler Jürgen Eckhardts<br />
Mannhardt Andreas Viernau<br />
Marbach Matthias Fladungen<br />
Martens Günther Bad Lobenstein<br />
Meisgeier Dirk Schleiz<br />
Memmler Beate Haina<br />
Messerschmidt Roland Erfurt-Marbach<br />
Messner Clemens Bad Klosterlausnitz<br />
89
Meyer Markus Elxleben<br />
Meyer Thomas Paulinenaue<br />
Möller<br />
Ingeborg und<br />
Martin<br />
Sondershausen<br />
Müller Karl-Heinz Geschwenda<br />
Müller<br />
Monika und<br />
Hubertus<br />
Sonneberg<br />
Müller Rainer Leinefelde<br />
Müller Reinhard Mellenbach<br />
N<br />
Neumann Mathias Lengefeld<br />
Neumann Matthias Oberweißbach<br />
Neupert Jürgen Crawinkel<br />
Nicke Prof. Dr. Anka Schwarzburg<br />
Nicolai Hanspeter Saalfeld<br />
Niepagen<br />
Dr. Andreas und<br />
Heike<br />
Bleicherode<br />
Nothnagel Gert Gera<br />
O<br />
Oelschlegel Lutz Wurzbach<br />
P<br />
Paritzsch Wolfgang Nobitz, OT Klausa<br />
Pasold André Burgk<br />
Pätzold Markus Erfurt<br />
Pernutz Pier Schönberg<br />
Pimmer Reinhard Ipsheim<br />
Prasse Wolfgang Bad Klosterlausnitz<br />
Pur<strong>für</strong>st Manfred Suhl<br />
Puschmann Arnd-Eckart Gehren<br />
90
R<br />
Rahmig Frank Kleingölitz<br />
Ramm Achim Hohenfelden<br />
Rauscher Jochen Katzhütte<br />
Redel Holger Schleiz<br />
Reichenbächer Andreas Landsendorf<br />
Reinhardt Frank Uhlstädt-Kirchhasel<br />
Reinkober Andreas Neukloster<br />
Reitzenstein,<br />
Freiherr von<br />
Rupprecht Issigau<br />
Ressel<br />
Renate und<br />
Hartmut<br />
Leutenberg<br />
Riedel Rolf Gera<br />
Ripken Jörn Heinrich Georgenthal<br />
Rose Rolf Heubach<br />
Rother Reinhard Unterweißbach<br />
Rotter Peter Rohrbach<br />
S<br />
Sachsen-Weimar,<br />
Prinz v.<br />
Michael-<br />
Benedict Mannheim<br />
Sailer Eckart Berlin<br />
Sattler Elke Stotternheim<br />
Sauer Tino Gierstädt<br />
Schade Bettina Schirmberg, OT Martinfeld<br />
Schäfer Ronald Kranichfeld<br />
Schaller Norman Sebnitz<br />
Scheibe Kathrin und Olaf Merkers-Kieselbach<br />
Scherbaum Brita und<br />
Manfred<br />
Meiningen<br />
Schinkitz Jens Gehren<br />
Schleicher Sabine Gera-Ernsee<br />
Schmidt Heinrich Schwarzburg<br />
Schmidt Kati Jüchsen<br />
91
Schneider Achim Tabarz<br />
Schöler Andreas Großkochberg<br />
Schröder Gerhard Gössitz<br />
Schröder Karsten Hohenleuben<br />
Schubert Friedolt Leutenberg<br />
Schubert Hermann Langenbernsdorf<br />
Schulz<br />
Richarda und<br />
Bodo<br />
Wüstheuterode<br />
Schurg Uwe Heldburg<br />
Schwalbe Konrad Schwarzburg<br />
Schwimmer Matthias Rudolstadt<br />
Schwöbel Peter Wahlhausen<br />
Seidel Joachim Kranichfeld<br />
Seidel Verena Lobenstein<br />
Seifferth Udo Masserberg<br />
Simon Uwe Marksuhl<br />
Sklenar Dr. Volker Weimar<br />
Spinner Karsten Schwarzburg<br />
Stehle Peter Crispendorf<br />
Steiner Josef Hetschburg<br />
Stephan Eckhard Wiesenthal<br />
Stief Achim Suhl-Goldlauter<br />
Strohschein Anja Luisenthal<br />
Stubenrauch Kurt Erfurt<br />
Sturm Hagen Essleben<br />
Suhr Petra Georgenthal<br />
T<br />
Taubert Bernd Schwallungen<br />
Tenner Siegfried Kaltenwestheim/Rhön<br />
Thieme Manfred Kranichfeld<br />
Thöne, Prof. Dr. Karl-Friedrich Erfurt<br />
Truchseß, Freiherr<br />
von<br />
Michael Florstadt<br />
92
U<br />
Ullrich Ingwart Hildburghausen<br />
Unrein<br />
Dirk<br />
Topfstedt, OT<br />
Niedertopfstedt<br />
Uschmann Andreas Erfurt<br />
Uth Jörn Eisenach<br />
V<br />
Veckenstedt Torsten Hummelshain<br />
von Bockum Kasper Herringsen-Ostheide<br />
W<br />
Wächter Manuel Tharandt<br />
Wächter Rudolf Meiningen<br />
Wagner Hans-Jörg Tabarz<br />
Waldthausen v. Constantin Hannover<br />
Wanderer Otto Neuhaus/Rwg.<br />
Weber Georg Ernst Schleiz<br />
Wehner Helmut Seelingstädt<br />
Weide Klaus Schleiz<br />
Weidig Johannes Tharandt<br />
Weigand Martin Erfurt<br />
Weiner Erich Steinbach-Hallenberg<br />
Weller Eberhard Weida<br />
Wennrich Michael Meura<br />
Wermann Ernst Bad Honnef<br />
Weth, von der Bernd Schönbrunn<br />
Wiebke Torsten Suhl<br />
Wildenhayn Frank Hermannsfeld<br />
Wilhelm Bernd Zella-Mehlis<br />
Winzer Christiane Schnepfenthal<br />
Wittau Frank Sondershausen<br />
Wittenberg Stefan Gräfenthal<br />
Witticke Prof. Helmut Schwarzburg<br />
93
Wittig Karl-Heinz Eisenach<br />
Wohlleben Helga und Franz Judenbach<br />
Wolf Stefan Gotha<br />
Wolfer Siegfried Georgenthal<br />
Wunder Wolf Bad Blankenburg<br />
Wunderlich Gert Rudolstadt<br />
Z<br />
Zehner Ilona und Uwe Sonneberg<br />
Zeisberger André Breitungen<br />
Zeisberger Peter Breitungen<br />
Zenker v. Wolfgang Damelang<br />
Ziegenfuß Manfred Helmsdorf<br />
Ziermann Tobias Großneundorf<br />
Zimmer Joachim Erfurt<br />
94


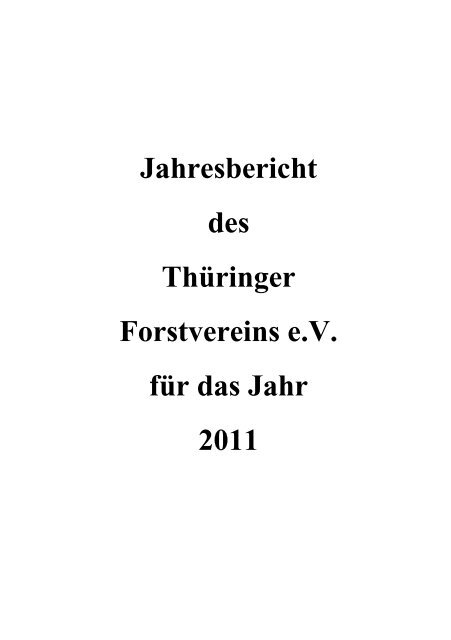
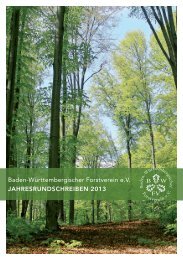
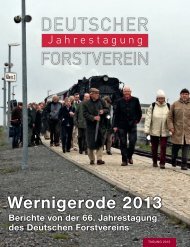
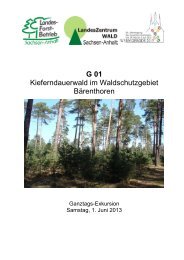
![Vortrag_Ullrich_warendorf_20130305 [Kompatibilitätsmodus]](https://img.yumpu.com/22691664/1/184x260/vortrag-ullrich-warendorf-20130305-kompatibilitatsmodus.jpg?quality=85)