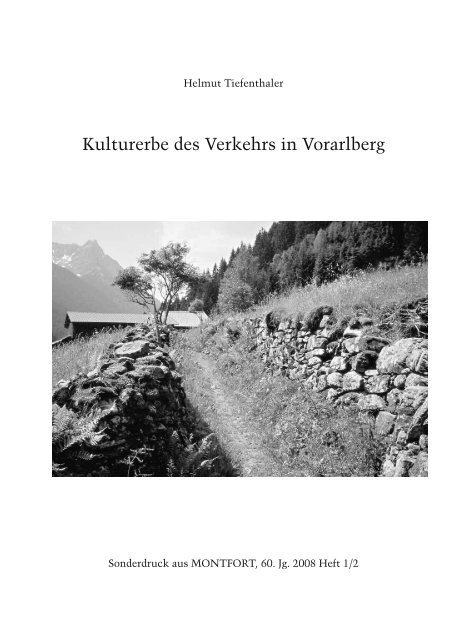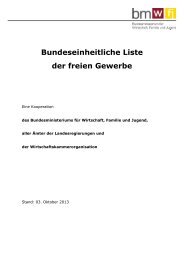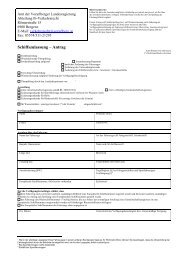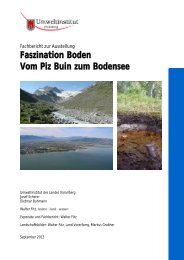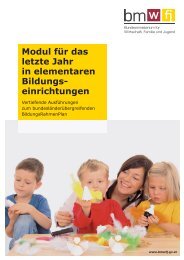Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )
Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )
Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Helmut Tiefenthaler<br />
<strong>Kulturerbe</strong> <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />
Sonderdruck aus MONTFORT, 60. Jg. 2008 Heft 1/2
<strong>Kulturerbe</strong> <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />
WELCHE ZUKUNFT FÜR ALTE WEGE, STRASSEN UND BAHNANLAGEN?<br />
VON HELMUT TIEFENTHALER<br />
1. Landschaftswerte der <strong>Verkehrs</strong>kultur<br />
Das Bild jeder Kulturlandschaft hat etwas zeitbed<strong>in</strong>gt<br />
Vorläufi ges an sich. Ihre Werte hängen im<br />
Alltagsleben wesentlich von ihrer momentanen<br />
Nützlichkeit ab. Das sieht man am deutlichsten<br />
bei der <strong>Verkehrs</strong><strong>in</strong>frastruktur. Bei dieser versteht<br />
es sich von selbst, dass ungenügend leistungsfähige<br />
Trassen ausgebaut oder durch Neuanlagen<br />
ersetzt werden. Die Frage nach so etwas wie „bleibendem<br />
Wert“ sche<strong>in</strong>t sich zu erübrigen. Dies erst<br />
recht, wenn die zu ersetzenden Bauten und<br />
An lagen ohneh<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e nennenswerten ästhetische<br />
Qualitäten an sich haben. Wo e<strong>in</strong>e Straße,<br />
Bahnanlage oder Freileitung <strong>in</strong> der Landschaft als<br />
störender E<strong>in</strong>griff auffällt, kann die ersatzlose<br />
Beseitigung sogar als Gew<strong>in</strong>n verstanden werden.<br />
Umgekehrt verhält es sich, wenn e<strong>in</strong>e <strong>Verkehrs</strong>anlage<br />
als Beispiel <strong>des</strong> Harmonierens von Natur<br />
und Kultur und zugleich als e<strong>in</strong> Beziehung<br />
stiften<strong>des</strong> Erbe e<strong>in</strong>er anderen Zeit erkannt wird.<br />
Was <strong>in</strong> der Landschaft das Erleben von Heimat<br />
ausmacht, besteht aus vielerlei Kle<strong>in</strong>elementen.<br />
Diese s<strong>in</strong>d Merkmale der Dauerhaftigkeit, deren<br />
Wert umso höher e<strong>in</strong>zuschätzen ist, je mehr unter<br />
e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en Beschleunigungs- und Veränderungsdruck<br />
die Orientierung an symbolstark<br />
Haltbarem verloren geht.<br />
Die Zeugnisse der <strong>Verkehrs</strong>kultur haben normalerweise<br />
nichts aufdr<strong>in</strong>glich Effekthascherisches<br />
an sich. Sie müssen als „historische <strong>Verkehrs</strong>wege“<br />
nicht e<strong>in</strong>mal besonders alt se<strong>in</strong> und können<br />
so schlicht anmuten wie e<strong>in</strong> gewöhnlicher Feldweg.<br />
Zu <strong>des</strong>sen Eigenart gehört das Anschmiegen<br />
an die natürlichen Geländeformen. Sie wird oft<br />
auch noch akzentuiert durch wegbegleitende<br />
Landschaftselemente, wie Hecken und Baumreihen,<br />
Mauern und Zäune, Bildstöcke und Wegkreuze.<br />
Dabei entstanden nebenbei vielerlei Kle<strong>in</strong>biotope,<br />
deren ökologischer Wert nicht zu unterschätzen<br />
ist.<br />
Je mehr Straßen asphaltiert werden, <strong>des</strong>to mehr wird e<strong>in</strong> alter Feldweg – hier e<strong>in</strong> Beispiel <strong>in</strong> Schnifi s – als wertvolle<br />
Bereicherung der Landschaft geschätzt.<br />
1
Der heutige verkehrstechnische Gebrauchswert<br />
solcher Wege mag ger<strong>in</strong>ger se<strong>in</strong> als der e<strong>in</strong>er<br />
perfekt asphaltierten Straße, doch die Erlebnisqualität<br />
e<strong>in</strong>es unverfälscht erhaltenen Erbstücks<br />
früherer <strong>Verkehrs</strong>kultur kann dennoch e<strong>in</strong> so<br />
hoher Wert se<strong>in</strong>, dass er auf Dauer e<strong>in</strong>e pfl egliche<br />
Erhaltung verdient.<br />
Für den Philosophen Mart<strong>in</strong> Heidegger ist so e<strong>in</strong><br />
Feldweg geradezu e<strong>in</strong> kennzeichnen<strong>des</strong> Merkmal<br />
für „die unerschöpfl iche Kraft <strong>des</strong> E<strong>in</strong>fachen“ und<br />
die „Pracht <strong>des</strong> Schlichten“. In se<strong>in</strong>er Sorge um<br />
die Zerstörung von etwas derart Symbolstarkem<br />
kommt er auch im übertragenen S<strong>in</strong>n zur Schlussfolgerung:<br />
„Der Mensch versucht vergeblich,<br />
durch se<strong>in</strong> Planen den Erdball <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ordnung<br />
zu br<strong>in</strong>gen, wenn er nicht dem Zuspruch<br />
<strong>des</strong> Feldweges e<strong>in</strong>geordnet ist. Die Gefahr droht,<br />
dass die Heutigen schwerhörig für se<strong>in</strong>e Sprache<br />
bleiben . . .“ 1<br />
Oft s<strong>in</strong>d es leicht zu übersehende Details der<br />
Landschaftswahrnehmung, die das unverdorben<br />
Authentische e<strong>in</strong>er Gegend zur Geltung br<strong>in</strong>gen.<br />
Das können Wegbegrenzungen mit Trockenmauern,<br />
Hohlwege, gepfl asterte Gässchen oder<br />
Treppensteige se<strong>in</strong>, die heute noch genauso aussehen,<br />
wie man sie schon vor e<strong>in</strong>em Jahrhundert<br />
oder seit noch längerer Zeit gekannt hat. Diese<br />
werden als Kulturdenkmale zwar eher selten<br />
gewürdigt, doch sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt höchst bedeutsame<br />
Bereicherungen <strong>des</strong> Orts- und Landschaftscharakters.<br />
Dasselbe gilt für <strong>Verkehrs</strong>bauten, die mitunter<br />
Sehenswürdigkeiten echter Baukunst s<strong>in</strong>d. Dies<br />
wird besonders bei zahlreichen Brückenbau -<br />
werken bewusst, bei denen neben den historisch<br />
beachtenswerten Objekten auch so manche<br />
gekonnt ausgeführte Neubauten auf Dauer e<strong>in</strong>e<br />
pfl egliche Erhaltung verdienen. In der lan<strong>des</strong>kundlichen<br />
Literatur wird solchen Denkmalen der<br />
<strong>Verkehrs</strong>- und Technikgeschichte aber immer<br />
noch verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt.<br />
So s<strong>in</strong>d etwa die Flexenstraße und die Wäldletobelbrücke<br />
der Arlbergbahn zwar Paradebeispiele<br />
überzeugender Ingenieurkunst, doch beide s<strong>in</strong>d<br />
im Zusammenhang mit der Baukultur der<br />
Geme<strong>in</strong>de Klösterle nicht e<strong>in</strong>mal im Dehio-Handbuch<br />
von <strong>Vorarlberg</strong> (1983) erwähnt.<br />
2<br />
2. Erhaltenswerte <strong>Verkehrs</strong>anlagen<br />
2.1 E<strong>in</strong>schätzung der Schutzwürdigkeit<br />
Wie bei allem <strong>Kulturerbe</strong> ist auch die Schutzwürdigkeit<br />
von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen von der<br />
E<strong>in</strong>schätzung ihrer Bedeutung und dem öffentlichen<br />
Interesse an ihrer Erhaltung abhängig.<br />
Dabei ist es wie allgeme<strong>in</strong> beim Denkmalschutz<br />
wesentlich, „ob und <strong>in</strong> welchem Umfang durch<br />
die Erhaltung <strong>des</strong> Denkmals e<strong>in</strong>e geschichtliche<br />
Dokumentation erreicht werden kann.“ 2 Vielfach<br />
lässt sich die Notwendigkeit der orig<strong>in</strong>algetreuen<br />
Erhaltung aber auch unabhängig vom historischen<br />
Dokumentationswert mit besonderen ästhetischen<br />
Qualitäten und von der Bedeutung<br />
bestimmter Anlagen für die zu erhaltende Eigenart<br />
<strong>des</strong> Orts- und Landschaftscharakters begründen.<br />
Der Nachweis <strong>des</strong> öffentlichen Interesses am<br />
Schutz solcher Anlagen ist derzeit noch kaum<br />
dokumentiert.<br />
Beim Lan<strong>des</strong>konservatorat für <strong>Vorarlberg</strong> s<strong>in</strong>d<br />
von den historischen <strong>Verkehrs</strong>anlagen lediglich<br />
e<strong>in</strong>ige Brücken und e<strong>in</strong>zelne aus dem 19. Jahrhundert<br />
erhaltene Bahnhofsgebäude als geschützte<br />
Baudenkmale registriert. Die historischen <strong>Verkehrs</strong>wege<br />
s<strong>in</strong>d als Gestaltungselemente der<br />
Kulturlandschaft normalerweise aber nicht als<br />
schutzwürdiges Kulturgut erfasst. H<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Altstraßen wurde unter Berufung auf e<strong>in</strong><br />
Erkenntnis <strong>des</strong> Verfassungsgerichtshofes vom<br />
19. März 1964 die Unzuständigkeit <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>denkmalamtes<br />
erklärt. 3<br />
Wie <strong>in</strong> anderen Belangen besteht auch zu Fragen<br />
nach der Schutzwürdigkeit von alten <strong>Verkehrs</strong>wegen<br />
das Problem, dass die meisten fachlichen<br />
Beurteilungen auf mehr oder weniger e<strong>in</strong>geschränkte<br />
fachspezifi sche Betrachtungsweisen<br />
angewiesen s<strong>in</strong>d. Beim Denkmalschutz s<strong>in</strong>d diese<br />
zumeist auf bau- und technikgeschichtliche sowie<br />
künstlerische Gesichtspunkte, im Naturschutz<br />
h<strong>in</strong>gegen vielfach nur auf Kriterien der ökologischen<br />
Funktionsfähigkeit e<strong>in</strong>geengt. So wertvoll<br />
fachlich fundierte und objektivierte Sachverhaltsdarstellungen<br />
s<strong>in</strong>d, Denkmal- und Naturschutz<br />
greifen zu kurz, „wenn die Erlebnisdimension,<br />
die Schönheiten und S<strong>in</strong>nlichkeiten e<strong>in</strong>er Landschaft<br />
respektive deren Verlust bei e<strong>in</strong>er geplanten<br />
Überbauung bewertet werden sollen“ (Erich Bierhals)<br />
4 .
Wenn sich Fachstellen zu wenig <strong>in</strong> der Lage<br />
sehen, sich auf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>igermaßen ganzheitliche<br />
Landschaftswahrnehmung e<strong>in</strong>zulassen, ist vor<br />
allem die Raumplanung gewissermaßen zur<br />
„Ersatzvornahme“ herausgefordert. Die Verpfl ichtung<br />
dazu ergibt sich aus § 5 <strong>des</strong> Raumplanungsgesetztes<br />
zur Grundlagenerhebung: „Das Land hat<br />
die Grundlagen für die überörtliche Raumplanung<br />
zu erheben sowie alle für die Raumplanung<br />
bedeutsamen Unterlagen zu sammeln und auf<br />
dem neuesten Stand zu halten.. 5 “ Bei e<strong>in</strong>er auf<br />
landschaftliche Kulturgüter bezogenen Grundlagenerhebung<br />
ersche<strong>in</strong>t es naheliegend, dass<br />
neben bau- und kunstgeschichtlich kompetenten<br />
Sachverständigen auch Historiker, Archäologen,<br />
Kulturgeografen, Architekten oder Landschaftsplaner<br />
beigezogen werden.<br />
2.2 Alte Straßen und Wege<br />
Wie sich die menschlichen Aktivitäten auf die<br />
Landschaft auswirken, erkennt man gewöhnlich<br />
schon im Blick auf das Straßen- und Wegenetz. Je<br />
schneller, massenhafter und anonymer die <strong>Verkehrs</strong>bewegungen<br />
ablaufen, <strong>des</strong>to mehr s<strong>in</strong>d breite<br />
Straßenfl ächen mit begradigten Trassen nach<br />
globalisierten Normen gefragt. Dann ist es auch<br />
normal, dass die Hauptadern <strong>des</strong> Individualverkehrs<br />
mit ihren auffälligen Bändern aus Asphalt<br />
und Beton im Bild der Landschaft etwas beziehungslos<br />
Fremdkörperhaftes an sich haben. Das<br />
lässt sich bei offenen Trassenführungen schwerlich<br />
vermeiden, solange die damit ermöglichte<br />
motorisierte Mobilität als etwas Notwendiges<br />
bejaht wird.<br />
Die das Land durchziehenden Hochleistungsstraßen<br />
mit ihren begleitenden Verlärmungsfl<br />
ächen verursachen als dom<strong>in</strong>ante Bauwerke<br />
e<strong>in</strong>er rasant beschleunigten und umweltbelastenden<br />
<strong>Verkehrs</strong>abwicklung allerd<strong>in</strong>gs auch e<strong>in</strong> mehr<br />
oder weniger bewusstes Unbehagen. Dieses weckt<br />
nebenbei Sehnsucht nach zivilisatorisch unverdorbenen<br />
Landschaften, selbst wenn für die Wege<br />
dorth<strong>in</strong> mitunter lange Autobahnfahrten <strong>in</strong> Kauf<br />
genommen werden müssen.<br />
In den abseits der großen Straßen gesuchten<br />
Kontrastlandschaften wird es als besonderer Reiz<br />
e<strong>in</strong>es Ortes empfunden, wenn e<strong>in</strong> <strong>in</strong>nerörtlicher<br />
Spaziergang durch altmodisch gepfl asterte Stra-<br />
Die meisten Hohlwege er<strong>in</strong>nern an e<strong>in</strong>e Zeit <strong>in</strong> die Vergangenheit<br />
zurückreichende Wegbenützung.<br />
ßen, verw<strong>in</strong>kelte Gässchen und über Treppenwege<br />
aus Naturste<strong>in</strong>platten führt. Wo die Routen <strong>in</strong><br />
unverbaute Gegenden führen, werden autofreie<br />
Fahrwege ohne Hartbelag oder e<strong>in</strong>stige Wirtschaftswege<br />
zwischen verwachsenen Trockenmauern<br />
als wohltuende Abwechslung erlebt.<br />
Solche alten Wege werden umso mehr geschätzt,<br />
je mehr sie <strong>in</strong> ihrer Andersartigkeit gewissermaßen<br />
wie Auswege aus dem langweilend<br />
genormten Erschließungsnetz herausführen. Dies<br />
erst recht, wenn an ihnen kulturgeschichtliche<br />
Er<strong>in</strong>nerungen an vergangene Zeiten haften. Dabei<br />
kommt es nicht so sehr auf den Nachweis e<strong>in</strong>er<br />
besonderen historischen Bedeutung an. Bereits das<br />
Flair von kultivierter Natur und naturnaher Kultur<br />
kann abseits e<strong>in</strong>er naturvergessenen Alltagswelt<br />
zum überraschenden Entdecken von „Heimat“<br />
ver helfen.<br />
3
Wege<strong>in</strong>fassung mit Trockenmauern an der e<strong>in</strong>stigen Säumerroute durch das Gargellental <strong>in</strong> Rüti.<br />
So lange solche Straßen und Wege auch <strong>in</strong><br />
Vorarl berg überall wie selbstverständlich <strong>in</strong> nächster<br />
Nähe zu fi nden waren, wurde e<strong>in</strong>er dauerhaften<br />
pfl eglichen Instandhaltung <strong>in</strong> ihrer jeweiligen<br />
Eigenart nicht viel Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Heute kann man bei den oft nur noch<br />
spärlich vorhandenen Relikten traditioneller<br />
Straßen und Wege mit dem Schweizer Planungsphilosophen<br />
Lucius Burckhardt h<strong>in</strong>gegen oft den<br />
E<strong>in</strong>druck bekommen: „Kulturlandschaft ist die<br />
Landschaft, <strong>in</strong> die man zu spät kommt, deren<br />
Reiz dar<strong>in</strong> besteht, dass man dar<strong>in</strong> gerade noch<br />
lesen kann, wie es e<strong>in</strong>mal war.“ 6 Das späte Erkennen<br />
der bereits entstandenen Verluste an alten<br />
Wegen und Straßen bietet immerh<strong>in</strong> noch die<br />
Chance, dass wenigstens bei den letzten Resten<br />
dieses kulturgeschichtlichen Erbes deren Erhaltung<br />
für die Nachwelt umso ernster genommen<br />
wird.<br />
4<br />
2.3 Historische Straßenbrücken<br />
Mehr als bei anderen <strong>Verkehrs</strong>bauten kommt bei<br />
Brücken das Wesen <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> durch die Überw<strong>in</strong>dung<br />
von H<strong>in</strong>dernissen symbolstark zum Ausdruck.<br />
Hier kann es besonderes Geschick erfordern,<br />
die Chancen der verkehrsgeografi schen<br />
Standortgunst zu nutzen und zugleich die Hochwassergefahren<br />
e<strong>in</strong>es Flusses so ger<strong>in</strong>g wie möglich<br />
zu halten. Durch den Bau von Brücken wurden<br />
sehr oft auch der Gang der Besiedlung und die<br />
Entwicklung von <strong>Verkehrs</strong>knoten bestimmt. Im<br />
historischen Rückblick zeigt sich das <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />
wohl am deutlichsten am Beispiel Feldkirch<br />
mit dem sehr alten Brückenkopf und <strong>Verkehrs</strong>stützpunkt<br />
Heiligkreuz. Hier machte schon der<br />
842 erwähnte Name Pontilles auf das frühe Vorhandense<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Illbrücke aufmerksam. Vor dem<br />
Bau der Heilig-Kreuz-Kapelle (1380) war Illbrugg
der gebräuchliche Ortsname. Diese ursprünglich<br />
den auf der Neuburg bei Koblach ansässigen<br />
Rittern von Thumb gehörende <strong>Verkehrs</strong>siedlung<br />
bestand bereits vor der Gründung der als Konkurrenz<br />
geplanten Montforterstadt. Die als „Heiligkreuzbrücke“<br />
bekannte alte Ste<strong>in</strong>bogenbrücke ist<br />
schon auf den ältesten Ansichten von Feldkirch<br />
zu sehen.<br />
Wie sehr Brückenbauten für die <strong>Verkehrs</strong>entwicklung<br />
und für den Verlauf der Straßen bestimmend<br />
wurden, ist <strong>in</strong> den anderen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
besonders ab dem 16. Jahrhundert festzustellen.<br />
Von da an wurden auch <strong>in</strong> den Bergtälern gedeckte<br />
Holzbrücken erbaut. Von den ältesten heute vor-<br />
Die gedeckte Holzbrücke über die Subersach wurde um<br />
1830 nach Plänen von Alois Negrelli erbaut.<br />
handenen Bauten dieser Art bestanden e<strong>in</strong>ige<br />
bereits im 18. Jahrhundert, wie die Kommabrücke<br />
<strong>in</strong> Hittisau, die Gießenbrücke <strong>in</strong> Krumbach, die<br />
Weißachbrücke Sulzberg – Riefensberg, die Lasanggabrücke<br />
<strong>in</strong> Raggal und die Tannbergbrücke <strong>in</strong><br />
Lech. 7 Die um 1830 zwischen L<strong>in</strong>genau und Großdorf<br />
errichete Gschwentobelbrücke über die<br />
Subersach hat den Ruhm, von Alois Negrelli<br />
ge plant worden zu se<strong>in</strong>, der vor allem als Planer<br />
<strong>des</strong> Suezkanals zu Ehren kam.<br />
Die erste Rhe<strong>in</strong>brücke – die Tardisbrücke bei<br />
Landquart – wurde zwar schon 1529 erbaut, doch<br />
bei den anderen Flussquerungen bestand bis <strong>in</strong> die<br />
zweite Hälfte <strong>des</strong> 19. Jahrhundert nur Fährbetrieb.<br />
Erst nach dem Bau von Hochwasserschutz dämmen<br />
entstanden 1867 – 1879 13 gedeckte Holzbrücken,<br />
von denen heute die 1871 fertiggestellte Brücke<br />
Vaduz – Sevelen als letzte erhalten ist. Die anderen<br />
Übergänge wurden im 20. Jahrhundert durch<br />
Neubauten <strong>in</strong> so verschiedenartigen Ausführungen<br />
ersetzt, dass der Alpenrhe<strong>in</strong> heute für<br />
bautechnisch Interessierte geradezu e<strong>in</strong> Freilichtmuseum<br />
<strong>des</strong> Brückenbaus zu bieten hat. Zum Teil<br />
wurde das Holz abgebrochener Rhe<strong>in</strong>brücken für<br />
andere Brückenbauten verwendet. So entstanden<br />
e<strong>in</strong>zelne Lustenauer Riedbrücken 1921 aus Überresten<br />
der Widnauer Rhe<strong>in</strong>brücke, 1981 die Illbrücke<br />
bei Nenz<strong>in</strong>g nach dem Abbruch der Rhe<strong>in</strong>brücke<br />
Mäder – Kriessern. 8<br />
2.4 Aufgelassene Eisenbahntrassen<br />
Durch die Stilllegung oder Neuanlage von Eisenbahnanlagen<br />
verloren <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> bereits mehrere<br />
Bahnstrecken ihre frühere <strong>Verkehrs</strong>funktion.<br />
Da die Zeit ihrer Erbauung bereits lange, meistens<br />
sogar mehr als e<strong>in</strong> Jahrhundert, zurückliegt, s<strong>in</strong>d<br />
sie den historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen zuzurechnen.<br />
Am <strong>in</strong>teressantesten s<strong>in</strong>d die früheren Bahn trassen<br />
der Arlbergbahn zwischen Langen und Wald am<br />
Arlberg (1914 Bahnverlegung <strong>in</strong> den Wildentobeltunnel,<br />
2003 <strong>in</strong> den Blisadonatunnel), die Bregenzerwaldbahntrasse<br />
sowie die früheren Betriebsbahnstrecken<br />
der Illwerke zwischen Schruns und<br />
dem Vermunt-Stausee.<br />
Ob und mit welcher Bedeutung ungenutzte<br />
Bahnkörper erhaltungswürdig s<strong>in</strong>d, bedarf wie bei<br />
den Altstraßen der Abklärung im E<strong>in</strong>zelfall. Auch<br />
wenn die Gleisanlagen normalerweise schon ent-<br />
5
fernt s<strong>in</strong>d, sollte für die Zukunft zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t der<br />
Trassenverlauf h<strong>in</strong>länglich erkennbar bleiben. Das<br />
Hauptaugenmerk wird im Allgeme<strong>in</strong>en auf die<br />
Instandhaltung von Kunstbauten, wie vor allem<br />
von Brücken, Viadukten, Aquädukten und Tunnelstrecken<br />
gerichtet. Auf Fragen nach der weiteren<br />
Verwendung von Bahnanlagen wird an anderer<br />
Stelle (Pkt. 6) noch zurückzukommen se<strong>in</strong>.<br />
2.5 Gebäude und Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />
Unter allen <strong>Verkehrs</strong>e<strong>in</strong>richtungen konzentriert<br />
sich das Interesse <strong>des</strong> amtlichen Denkmalschutzes<br />
vorrangig auf historisch bedeutsame Hochbauten.<br />
Torbau der Bregenzer Oberstadt.<br />
6<br />
Dazu gehören zum Beispiel die mittelalterlichen<br />
Stadttore von Bregenz, Feldkirch und Bludenz,<br />
Hospize, Poststationen, Gaststätten, Pfer<strong>des</strong>tälle,<br />
Zollhäuser und Umschlagplätze <strong>des</strong> früheren <strong>Verkehrs</strong>,<br />
soweit solche noch vorhanden s<strong>in</strong>d. In den<br />
Inventaren <strong>des</strong> Denkmalschutzes s<strong>in</strong>d auch e<strong>in</strong>zelne<br />
der ältesten Bahnhofsgebäude erfasst, nicht<br />
berücksichtigt s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen Galerien und andere<br />
Schutzbauten, selbst wenn diese als früheste Bauten<br />
dieser Art e<strong>in</strong>e nicht ger<strong>in</strong>ge geschichtliche<br />
Bedeutung haben. Als solche s<strong>in</strong>d beispielsweise<br />
die 1902 erbaute Law<strong>in</strong>engalerie im Frattetobel<br />
zwischen Schruns und St. Gallenkirch und die<br />
1849 errichtete Mauer zum Schutz der <strong>Verkehrs</strong>siedlung<br />
Stuben zu erwähnen.<br />
Auf die vielen Naturgefahren für den Verkehr<br />
machen neben den technischen Schutzvorkehrungen<br />
auch zahlreiche Bildstöcke und Kapellen<br />
aufmerksam. Bei den an alten Hauptwegen<br />
stehenden Kirchen s<strong>in</strong>d nicht selten Darstellungen<br />
von St. Christophorus, dem Schutzpatron der<br />
Reisenden, aufgemalt. Bei manchen Kirchen, wie<br />
etwa St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Lu<strong>des</strong>ch und St. Leonhard <strong>in</strong><br />
Bludenz-Rad<strong>in</strong>, s<strong>in</strong>d heute noch jahrhundertealte<br />
Kritzeleien von Pilgern an den Außenmauern zu<br />
sehen.<br />
Bei manchen Bauten ist die kulturgeschichtliche<br />
Bedeutung so augenfällig, wie beispielsweise<br />
beim Torbau der Bregenzer Oberstadt, sodass die<br />
Erhaltenswürdigkeit auf den ersten Blick als etwas<br />
Selbstverständliches erkannt wird. Anders verhält<br />
es sich bei unauffälligen Relikten der <strong>Verkehrs</strong>geschichte,<br />
bei denen sich die Erfahrung von Max<br />
Dvorák bestätigen lässt: „Das Ger<strong>in</strong>ge bedarf oft<br />
mehr <strong>des</strong> Schutzes als das Bedeutende“. 9<br />
3. Mangelnde Kenntnisse der Schutzwürdigkeit<br />
Bei Kulturdenkmalen <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> auf „Schutzwürdigkeiten“<br />
aufmerksam zu machen, hat wenig<br />
Wirksamkeit, wenn dazu konkrete und überzeugende<br />
Begründungen fehlen. Wo h<strong>in</strong>gegen von<br />
fundierten Expertisen ausgegangen werden kann,<br />
ist es im Spannungsfeld gegensätzlicher Interessen<br />
wesentlich leichter, die Verluste an solchen<br />
Kultur werten e<strong>in</strong>zudämmen. Das beweisen<br />
<strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> vor allem die Erfahrungen mit dem<br />
<strong>in</strong> den 1980er Jahren erarbeiteten Biotop<strong>in</strong>ventar.
Demgegenüber fehlt bis heute e<strong>in</strong> Inventar<br />
landschaftlicher Kulturwerte. Dieser Mangel wird<br />
besonders im Zusammenhang mit den Relikten<br />
der <strong>Verkehrs</strong>geschichte bewusst, für deren Schutz<br />
die Fachstellen für Denkmal- und Naturschutz<br />
wie auch für Heimatpfl ege nicht zuständig s<strong>in</strong>d.<br />
Auch andere Verwaltungsstellen zeigen <strong>in</strong> Österreich<br />
normalerweise wenig Bereitschaft, bei ihren<br />
Aufgaben der Interessenabwägung von sich aus e<strong>in</strong><br />
Augenmerk auf den Schutz von verkehrsgeschichtlichem<br />
Kulturgut zu legen. So liegt schon im<br />
„Mangel an Zuständigkeiten“ e<strong>in</strong> Hauptgrund für<br />
das mangelnde Engagement zum Erarbeiten entsprechender<br />
Dokumentationen als fundierten<br />
Argumentationshilfen.<br />
Das erklärt sich nicht nur aus der Tatsache, dass<br />
die mit „Lan<strong>des</strong>entwicklung“ befassten Stellen<br />
ihre Tagesgeschäfte nach den Prioritäten für dr<strong>in</strong>glichere<br />
Aufgaben auszurichten haben. Es fehlt vor<br />
allem auch an Impulsen von der wissenschaftlichen<br />
Forschung her. In den Forschungsfeldern<br />
von Geschichte und Geografi e ist die historischgeografi<br />
sche Lan<strong>des</strong>kunde seit langem an den<br />
Rand gedrängt. E<strong>in</strong>e Folge davon ist, dass auch zur<br />
historischen <strong>Verkehrs</strong>geografi e <strong>Vorarlberg</strong>s nur<br />
wenige kle<strong>in</strong>räumig konkretisierte Arbeiten vorliegen.<br />
Auch die Archäologie verhielt sich <strong>in</strong><br />
<strong>Vorarlberg</strong> bei der Altstraßenforschung sehr<br />
zurückhaltend, wenn Anreize unter dem Stichwort<br />
„römisch“ fehlten.<br />
Der Satz, dass Unwissenheit nicht vor Strafe<br />
schützt, kann unter diesen Umständen so verstanden<br />
werden, dass die Unwissenheit nicht vor der<br />
„Strafe“ <strong>des</strong> Verlustes an verkehrsgeschichtlichem<br />
<strong>Kulturerbe</strong> schützt. Mit Unkenntnis der Schutzwürdigkeit<br />
ist es jedenfalls leicht gemacht, die<br />
Zerstörung erhaltenswerter historischer <strong>Verkehrs</strong>anlagen<br />
fortzusetzen.<br />
In den anderen Bun<strong>des</strong>ländern stellt sich die<br />
Situation ähnlich dar. In der Schweiz gelang es<br />
h<strong>in</strong>gegen auf der Grundlage e<strong>in</strong>es Bun<strong>des</strong>auftrags<br />
an die Universität Bern, <strong>in</strong>nerhalb von zwanzig<br />
Jahren e<strong>in</strong> umfassen<strong>des</strong> Inventar historischer <strong>Verkehrs</strong>wege<br />
zu erstellen. Die Forschungsergebnisse<br />
<strong>des</strong> IVS (Inventar historischer <strong>Verkehrs</strong>wege der<br />
Schweiz) s<strong>in</strong>d sehr detailliert dokumentiert. Nach<br />
der Erfüllung <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>auftrags zum Jahresende<br />
2003 übernahm die neu gegründete Fachstelle<br />
ViaStoria als Zentrum für <strong>Verkehrs</strong>geschichte<br />
an der Universität Bern die Fortführung e<strong>in</strong>schlä-<br />
giger Forschungs- und Koord<strong>in</strong>ationsaufgaben.<br />
Über die thematischen Schwerpunkte orientiert<br />
die seit 2002 ersche<strong>in</strong>ende Zeitschrift Wege und<br />
Geschichte.<br />
Das Kennenlernen der <strong>in</strong> der Schweiz bereits<br />
weit fortgeschrittenen Forschungen zur <strong>Verkehrs</strong>geschichte<br />
und zur Erhaltung <strong>des</strong> verkehrsgeschichtlichen<br />
<strong>Kulturerbe</strong>s könnte dazu anregen,<br />
Aufgaben dieser Art auch <strong>in</strong> Österreich mehr als<br />
bisher ernst zu nehmen.<br />
4. Anhaltende Verluste an Kulturwerten<br />
Im Rahmen von Bestandsaufnahmen zur Realisierung<br />
<strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Wanderwegekonzeptes<br />
wurde immer wieder festgestellt, dass sehr viele<br />
alte Wege, die beispielsweise im Katasterplan von<br />
1857 e<strong>in</strong>getragen waren, heute nicht mehr vorhanden<br />
s<strong>in</strong>d. Zumeist verschwanden sie im Zuge von<br />
Ausbauten <strong>des</strong> Straßennetzes. E<strong>in</strong> Großteil der<br />
e<strong>in</strong>stigen ländlichen Wirtschaftswege g<strong>in</strong>g durch<br />
Nutzungsänderungen verloren und ist heute überbaut<br />
oder überwachsen. Von den früheren Erschließungen<br />
der Hanglagen s<strong>in</strong>d oft immerh<strong>in</strong> noch<br />
Hohlwege vorhanden, die aber zum Teil ebenfalls<br />
dem Verfall preisgegeben s<strong>in</strong>d. Durch diese Entwicklung<br />
wurde <strong>in</strong> den Naherholungsgebieten e<strong>in</strong><br />
früher attraktives Netz von Spazier- und Wanderwegen<br />
stark beschnitten.<br />
Auch wenn manche <strong>Verkehrs</strong>anlagen nach e<strong>in</strong>er<br />
geänderten Verwendung im Wesentlichen erhalten<br />
blieben, war der neue Gebrauch manchmal mit<br />
verunstaltenden Anpassungen verbunden. Dass<br />
die dadurch entstandenen Abwertungen <strong>des</strong><br />
Ersche<strong>in</strong>ungsbil<strong>des</strong> nicht immer unerlässlich<br />
waren, beweist das Beispiel der Wäldletobelbrücke<br />
<strong>in</strong> Klösterle. Diese 1882-83 erbaute Eisenbahnbrücke<br />
galt von Anfang an als e<strong>in</strong>e der besonderen<br />
Sehenswürdigkeiten der Arlbergbahn. Das war<br />
anlässlich der Eröffnung der Bahn im Jahre 1884<br />
auch e<strong>in</strong> Grund, dass der „Hofzug“ dort anhielt,<br />
um Kaiser Franz Josef die Besichtigung auf<br />
e<strong>in</strong>er eigens hergestellten Treppe zu ermöglichen.<br />
Diese wurde <strong>in</strong>zwischen als „Kaiserstiege“<br />
bekannt.<br />
Nach der im Jahre 2003 erfolgten Verlegung der<br />
Bahnstrecke Langen – Klösterle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en neuen<br />
Lehnentunnel wurde die Bahnbrücke zur Zufahrt<br />
für e<strong>in</strong>en mit Kraftfahrzeugen befahrbaren<br />
7
E<strong>in</strong> letzter Rest der historischen Walgaustraße zwischen<br />
Göfi s-Pfi tz und Schwarzem See <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Auf nahme von<br />
2004.<br />
Rettungszugang umgestaltet. Dabei wurde dieser<br />
Teil der historischen Trasse ohne echte Notwendigkeit<br />
mit Asphaltbelag und Straßenleitplanken<br />
versehen, wie sie an Autobahnen gebräuchlich<br />
s<strong>in</strong>d. Dieses Beispiel von technischer Überperfektionierung<br />
und ästhetisch unbedachter „Adaptierung“<br />
gibt nun immerh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Anlass, ganz<br />
allgeme<strong>in</strong> mehr als bisher über den Umgang mit<br />
verkehrsgeschichtlichen Kulturdenkmalen nachzudenken<br />
und für die Zukunft Konsequenzen zu<br />
ziehen.<br />
8<br />
Durch den Bau e<strong>in</strong>er Forststraße wurde dieses Bodendenkmal<br />
völlig zerstört (Aufnahme 2008).<br />
Das oben abgebildete Wegstück kann bewusst<br />
machen, dass die Zerstörung e<strong>in</strong>es historischen<br />
<strong>Verkehrs</strong>weges für Laien auf den ersten Blick<br />
nicht immer sehr auffällig se<strong>in</strong> muss. Im l<strong>in</strong>ken<br />
Bild lassen immerh<strong>in</strong> schon wenige freigelegte<br />
Ste<strong>in</strong>platten die Pfl asterung der e<strong>in</strong>stigen Walgaustraße<br />
erkennen, die größtenteils nur von e<strong>in</strong>er<br />
dünnen Erdschicht zugedeckt war. E<strong>in</strong>e rechtzeitige<br />
und ausreichende Dokumentation zur<br />
frühe ren Bedeutung dieses relativ gut erhaltenen<br />
Relikts hätte <strong>des</strong>sen Zerstörung vielleicht verh<strong>in</strong>dern<br />
können.
In Feldkirch wurde die jahrhundertealte Straßenverb<strong>in</strong>dung zwischen Stadtfriedhof und Elendbild (obere Aufnahme<br />
2002) vor allem als idyllischer Spazierweg geschätzt. Sie wurde im Zuge <strong>des</strong> Bahnhofumbaus mehr als nötig zerstört<br />
und konnte auch durch e<strong>in</strong>e Neuanlage (untere Aufnahme von 2007) <strong>in</strong> ihrer Eigenart nicht ersetzt werden.<br />
9
Die 1882–83 erbaute Wäldletobelbrücke war der Stolz der Bahnbau<strong>in</strong>genieure und diente bis zur Verlegung der Gleisanlagen<br />
<strong>in</strong> den Blisadonatunnel fast 120 Jahre dem Arlbergverkehr (Bild oben um 1895 nach Ölbild von Alois Sporeni).<br />
Beim Umbau der Wäldletobelbrücke zu e<strong>in</strong>er Tunnelzufahrt (Aufnahme 2007) wurde auf die besondere Schutzwürdigkeit<br />
dieses Kulturdenkmals offensichtlich völlig vergessen.<br />
10
5. Chancen der Erhaltungsnutzung<br />
Alles pfl egliche Bewahren von Kulturgut ist mit<br />
Kosten verbunden. Daher gilt für das <strong>Kulturerbe</strong><br />
der <strong>Verkehrs</strong>geschichte dasselbe wie für anderes<br />
Erbe der Vergangenheit: Wenn vom Schutz ke<strong>in</strong><br />
Nutzen erwartet werden kann, ist auch nicht mit<br />
nennenswertem Engagement zu rechnen. Bei den<br />
Fragen nach der Zukunft alter Wege, Straßen und<br />
Bahnanlagen gibt es immerh<strong>in</strong> Wahlmöglichkeiten.<br />
Am häufi gsten und schonendsten ist die<br />
Verwendung für kulturgeschichtlich akzentuierte<br />
Wanderangebote. Zur Nutzung dieser Möglichkeit<br />
enthält das <strong>Vorarlberg</strong>er Wanderwegekonzept<br />
unter Punkt 2.7 die Zielsetzung: Es ist zu erkunden,<br />
wo historisch bedeutsame Wegführungen<br />
bestehen, wie diese <strong>in</strong> ihrer Eigenart erhalten und<br />
<strong>in</strong> das Wanderwegenetz aufgenommen werden<br />
können. 10 Da bei den Erlebnis<strong>in</strong>teressen der Wanderer<br />
die kulturgeschichtlichen Qualitäten <strong>in</strong>zwischen<br />
an Bedeutung gewonnen haben, wurde<br />
darauf <strong>in</strong> den vergangenen Jahren mehr als bisher<br />
Bedacht genommen. Dies geschah <strong>in</strong> Form von<br />
Wanderfühern sowohl mit Routenvorschlägen für<br />
Tages- und Halbtagswanderungen 11 als auch im<br />
Zusammenhang mit Konzeptionen für regionale<br />
und überregionale Hauptrouten, die Reaktivierung<br />
alter Fernpilgerwege <strong>in</strong>begriffen. 12<br />
Dabei konnte zugleich die Chance genutzt werden,<br />
bei Gebirgsübergängen historische Säumersteige<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen. So führt zum Beispiel e<strong>in</strong><br />
zwischen dem Kle<strong>in</strong>walsertal und dem Rhe<strong>in</strong>tal<br />
quer durch <strong>Vorarlberg</strong> verlaufender Kulturweg<br />
über das Starzeljoch und das Furkajoch. Die <strong>in</strong>ter-<br />
Zur Ausgestaltung <strong>des</strong> überregionalen „Arlbergwegs“ wird die Chance genutzt, den <strong>in</strong> Passnähe wiederentdeckten<br />
gepfl asterten Saumweg archäologisch zu untersuchen und <strong>in</strong> die Wanderroute e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
11
nationale Via Alp<strong>in</strong>a überquert zwischen Hochtannberg<br />
und Großem Walsertal den Schadonapass,<br />
zwischen Prättigau und Gargellen das St.<br />
Antönier Joch. Die das Montafon mit dem Veltl<strong>in</strong><br />
verb<strong>in</strong>dende Via Valtell<strong>in</strong>a folgt der alten Säumerroute<br />
über das Schlapp<strong>in</strong>er Joch, <strong>in</strong> Graubünden<br />
über den Scalettapass und Bern<strong>in</strong>anpass. Am<br />
Arlberg bietet sich die Gelegenheit, zwischen<br />
Rauz und St. Christoph e<strong>in</strong> Teilstück <strong>des</strong> wieder<br />
entdeckten spätmittelalterlichen Saumwegs zu<br />
e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>teressanten Teilstück <strong>des</strong> Arlbergwegs als<br />
überregionaler Wander- und Pilgerroute zu<br />
machen.<br />
Bei aufgelassenen Eisenbahntrassen stellen sich<br />
zur weiteren Verwendung vor allem dreierlei Möglichkeiten<br />
zur Wahl. Die erste Variante ist der<br />
Betrieb e<strong>in</strong>er Museumsbahn, wie dies im Bregenzerwald<br />
zwischen Bezau und Schwarzenberg<br />
bereits geschieht. Andere alte Bahnstrecken können<br />
als Rad- und Fußwege genutzt werden. Dabei<br />
s<strong>in</strong>d vorhandene Kunstbauten und andere Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />
als Bereicherungen der Gesamtattraktivität<br />
willkommen. Im Klostertal s<strong>in</strong>d zwischen<br />
Langen und Wald am Arlberg zwei ehemalige<br />
Bahntrassen <strong>in</strong> den bereits erwähnten Arlbergweg<br />
<strong>in</strong>tegriert. Im Montafon verläuft der<br />
regionale Illweg zwischen St. Gallenkirch und<br />
Partenen auf dem Bahndamm der früheren<br />
Betriebsbahn der Illwerke. Im Bregenzerwald kann<br />
die Trasse der Bregenzerwaldbahn zwischen<br />
Andelsbuch und Doren-Bozenau <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e von<br />
Schoppernau bis zum Bodensee führende Hauptroute<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
Wo e<strong>in</strong>e Nutzung für Zwecke der Naherholung<br />
oder <strong>des</strong> Tourismus mit schwer lösbaren Problemen<br />
verbunden ist, bietet sich zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t die<br />
Möglichkeit, ungenutzte Bahntrassen der Rückeroberung<br />
durch die Natur zu überlassen. Wie das<br />
Beispiel Bregenzerwaldbahn im Schluchtbereich<br />
zwischen Rotachmündung und Kennelbach zeigt,<br />
kann e<strong>in</strong>e solche Variante zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t unter den<br />
Aspekten e<strong>in</strong>es wirksamen Naturschutzes e<strong>in</strong><br />
Gew<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>. Das schließt nicht aus, dass auf den<br />
alten Trassen Pfade für die „stille Erholung“ angeboten<br />
werden.<br />
Um die als Kulturgut erhaltenswerten Bahnanlagen<br />
noch rechtzeitig vor dem totalen Verfall zu<br />
retten, empfi ehlt Lothar Beer für die Trasse der<br />
Bregenzerwaldbahn die Erarbeitung e<strong>in</strong>es Gesamtkonzeptes.<br />
13<br />
12<br />
6. Grundlagenarbeiten als Orientierungshilfen<br />
Zum Erhalten von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen<br />
und für die fallweise erforderlichen Instand setzungs<br />
arbeiten s<strong>in</strong>d nicht immer genaue Kenntnisse<br />
der ursprünglichen kulturgeschichtlichen<br />
Bedeutung erforderlich. E<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum an Wissen<br />
über die früheren Funktionen ist jedoch zur<br />
Begründung von kostenaufwändigen Instandhaltungsmaßnahmen<br />
notwendig. Solche Kenntnisse<br />
können auch Fehle<strong>in</strong>schätzungen vermeiden<br />
helfen. Das mag zwar gelegentlich e<strong>in</strong> Abschiednehmen<br />
von e<strong>in</strong>em „Römerweg“ oder „Knappensteig“<br />
zur Folge haben, wenn man sich mit nicht<br />
haltbaren Vermutungen vorschnell zu derlei<br />
Bezeichnungen hatte verleiten lassen. Umgekehrt<br />
können das Studium von Geschichtsquellen und<br />
archäologische Untersuchungen Altstraßen entdecken<br />
helfen, deren Verlauf <strong>in</strong> Vergessenheit<br />
geraten ist.<br />
Für die öffentliche Hand ist es freilich grundsätzlich<br />
von Belang, wenn sich Aufwendungen für<br />
die Erhaltung von Kulturdenkmalen mit nachvollziehbaren<br />
Begründungen rechtfertigen lassen.<br />
Derzeit verfügen die meisten Geme<strong>in</strong>den über<br />
ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>igermaßen fundierten Orientierungshilfen,<br />
die es erlauben würden, wenigstens die aus<br />
Unkenntnis fortschreitenden Zerstörungen oder<br />
störende Veränderungen schutzwürdiger Zeugnisse<br />
der <strong>Verkehrs</strong>kultur zu unterb<strong>in</strong>den. Dazu<br />
könnte e<strong>in</strong>e lan<strong>des</strong>weite Inventarisierung historischer<br />
<strong>Verkehrs</strong>wege e<strong>in</strong>e wertvolle Hilfe se<strong>in</strong>.<br />
Auf die dazu erforderlichen Vorarbeiten und zu<br />
methodischen Fragen wurden bereits von verschiedenen<br />
Seiten Überlegungen angestellt und<br />
Erfahrungen gewonnen. Darauf bezieht sich auch<br />
e<strong>in</strong> 2004 im Jahrbuch <strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>museumsvere<strong>in</strong>s<br />
erschienener Beitrag, der e<strong>in</strong>en<br />
ersten Überblick vermitteln will. 14<br />
7. Maßnahmen zur pfl eglichen Erhaltung<br />
Bei den für Wanderrouten genutzten alten Wegen<br />
und Straßen kommt es im Wesentlichen auf dieselbe<br />
Betreuung wie bei anderen Spazier- und<br />
Wanderwegen an. Über die damit verbundenen<br />
Aufgaben <strong>in</strong>formiert das vom Amt der Lan<strong>des</strong>regierung<br />
2005 herausgegebene Handbuch Wander-<br />
Wege-Service. 15
Zu den wichtigsten laufenden Arbeiten gehören<br />
funktionsfähige Wasserableitungen und Rückschnitte<br />
von Bewuchs. Oft wird unterschätzt, <strong>in</strong><br />
wie kurzer Zeit defekte Wasserableitungen und<br />
am Wegrand aufwachsende Bäume selbst stabil<br />
ausgeführtes Mauerwerk brüchig werden lassen<br />
können. Solange die jährlich anfallenden Instandhaltungsarbeiten<br />
regelmäßig vorgenommen<br />
werden, hält sich der Arbeitsaufwand normalerweise<br />
<strong>in</strong> bescheidenen Grenzen. Vernachlässigung<br />
über lange Zeit kann h<strong>in</strong>gegen aufwendige Instandsetzungen<br />
erforderlich machen.<br />
Die Wegmacher früherer Zeiten hatten oft geradezu<br />
e<strong>in</strong>e Kunst entwickelt, Fahrstraßen und<br />
Fußwege mit e<strong>in</strong>fachen Mitteln, aber <strong>in</strong> haltbaren<br />
Ausführungen zu befestigen. Dies geschah zumeist<br />
mit verschiedenen Arten von Pfl asterungen oder<br />
durch den Bau von Trockenmauern zum Stabilisieren<br />
von Böschungen wie auch als E<strong>in</strong>fassungen<br />
zur Lenkung <strong>des</strong> Viehtriebs und zum Vermeiden<br />
von Flurschäden. Nicht selten s<strong>in</strong>d die Pfl asterungen<br />
und Mauern selbst nach mehr als e<strong>in</strong>em<br />
Jahrhundert noch <strong>in</strong> tadellosem Zustand.<br />
Mit Pfl asterungen von Straßen wird <strong>in</strong> alten<br />
Ortszentren heute noch mehr als früher e<strong>in</strong><br />
ansprechen<strong>des</strong> historisches Ambiente betont. Für<br />
Instandsetzungsarbeiten s<strong>in</strong>d zum Glück die nötigen<br />
handwerklichen Kenntnisse noch nicht verloren<br />
gegangen<br />
Anders verhält es sich bei Trockenmauern.<br />
Häufi g entstanden daran Schäden durch Verwitterung,<br />
Rutschungen, Wurzelsprengungen oder auch<br />
durch Nutzungsänderungen, Planierungen,<br />
Asphaltaufbr<strong>in</strong>gung und neue Straßenbauten. Das<br />
Trockenmauern am historischen Rieseweg <strong>in</strong> Röthis nach der 2004 begonnenen Wiederherstellung.<br />
13
Ausmaß solcher Verluste und die Schutzwürdigkeit<br />
<strong>des</strong> Vorhandenen wurden <strong>in</strong> der Schweiz vor<br />
allem durch das 1985-2003 erarbeitete Inventar<br />
historischer <strong>Verkehrs</strong>wege der Schweiz bewusst. 16<br />
Diese Grundlagenarbeit gab den Anstoß, im<br />
Rahmen kommunaler Konzepte der weiteren<br />
schleichenden Zerstörung agrargeschichtlich<br />
beachtenswerter Elemente der Kulturlandschaft<br />
entgegenzuwirken. Dazu bedurfte es aber auch auf<br />
örtlicher Ebene e<strong>in</strong>er entsprechenden Bewusstse<strong>in</strong>sbildung<br />
und der Konkretisierung <strong>des</strong> Handlungsbedarfs,<br />
wie dies zum Beispiel <strong>in</strong> den Schweizer<br />
Rhe<strong>in</strong>talgeme<strong>in</strong>den Grabs 17 und Trimmis 18<br />
geschah. Hier wurden nach der Erarbeitung von<br />
Trockenmauer<strong>in</strong>ventaren sehr umfangreiche<br />
Instandsetzungsarbeiten begonnen. Dabei ist<br />
neben dem ästhetischen Gew<strong>in</strong>n auch der Wert<br />
von Trockenmauern als Kle<strong>in</strong>biotope mitbedacht.<br />
Die meisten dieser Erneuerungsarbeiten wurden<br />
von der öffentlichen Hand und verschiedenen<br />
Stiftungen gefördert, wobei an den Arbeiten im<br />
Gelände Zivildienstleistende beteiligt waren. 19<br />
Instandsetzungsarbeiten an Trockenmauern<br />
erfolgten vere<strong>in</strong>zelt auch <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> mit Unterstützung<br />
<strong>des</strong> Naturschutzfonds, zum Teil auch<br />
unter Beteiligung <strong>des</strong> Arbeitsmarktservice mit<br />
E<strong>in</strong>satz von arbeitslosen Jugendlichen unter fachkundiger<br />
Anleitung. Erfahrungen mit e<strong>in</strong>em verhältnismäßig<br />
umfangreichen Projekt zur Sanierung<br />
alter Wege im Bereich e<strong>in</strong>es Rebbergs werden<br />
seit 2003 <strong>in</strong> Röthis gewonnen. Die <strong>in</strong> den<br />
vergangenen Jahren zu beobachtende Renaissance<br />
im Bau von Trockenmauern lässt hoffen, dass nun<br />
auch die weith<strong>in</strong> verloren gegangenen Fachkenntnisse<br />
wieder zurückgewonnen werden können.<br />
8. Beachtenswerte Neubauten<br />
Nicht wenige der heute als schützenswert geltenden<br />
Altbauten <strong>des</strong> Straßen- und Eisenbahnnetzes<br />
wurden zur Zeit ihrer Entstehung<br />
ke<strong>in</strong>eswegs als Bereicherungen der Landschaft<br />
empfunden. Das beste Beispiel dafür ist die Arlbergbahn,<br />
bei der im Eröffnungsjahr 1884 die <strong>in</strong><br />
die Berghänge gerissenen Landschaftswunden<br />
wesentlich auffälliger waren als die bautechnischen<br />
Sehenswürdigkeiten.<br />
Bei den Straßenbauten <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts war<br />
bis <strong>in</strong> die 1960er Jahre schon aus Sparsamkeits-<br />
14<br />
gründen fast überall e<strong>in</strong> Bemühen um landschaftsangepasste<br />
Trassenführungen zu erkennen.<br />
Bei den notwendig gewordenen Ausbauten der im<br />
19. Jahrhundert entstandenen „Kunststraßen“ war<br />
es allerd<strong>in</strong>gs unvermeidlich, dass deren historische<br />
Substanz größtenteils unkenntlich wurde.<br />
Wo Trassenverlegungen erfolgten, blieben oft noch<br />
Teilstrecken der ältesten Straßenbauten nahezu <strong>in</strong><br />
der ursprünglichen Ausführung erhalten, wie etwa<br />
bei der Bregenzer Klause, zwischen Hohenems<br />
und Götzis sowie zwischen Rauz und St. Christoph,<br />
Bei den Brückenbauten wurden <strong>in</strong> der ersten<br />
Hälfte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts beachtenswerte neue<br />
Maßstäbe mit Bauwerken aus Stahlbeton gesetzt.<br />
Von diesen ist die 1933-36 entstandene Tannbergbrücke<br />
<strong>in</strong> Schröcken am bekanntesten.<br />
Zum unbestrittenen Schaustück Nr. 1 <strong>des</strong><br />
modernen Brückenbaus wurde die 1965-68 errichtete<br />
Hochbrücke von L<strong>in</strong>genau mit 210 Metern<br />
Bogenspannweite. Besondere Herausforderungen<br />
stellte der fortgesetzte Ausbau der Flexenstraße<br />
mit neuen Galerien. Dabei war mit viel Geschick<br />
auf die Erhaltung der charakteristischen Eigenart<br />
zu achten.<br />
Bis zur Mitte der 60er Jahre verraten die Straßenbauten<br />
e<strong>in</strong> Bemühen um Anpassung an die<br />
Landschaft mit der Charakteristik e<strong>in</strong>er „Ästhetik<br />
der Sparsamkeit“. In den folgenden Jahren wurden<br />
die Straßenplanungen neben den Anpassungszwängen<br />
e<strong>in</strong>er rasant zunehmenden Motorisierung<br />
weitgehend von zeitbed<strong>in</strong>gten Baumoden<br />
bestimmt, durch die nicht wenige Straßenanlagen<br />
<strong>in</strong> störungsempfi ndlichen Landschaften als Fremdkörper<br />
auffallen. Dabei wurden etliche Brückenbauten<br />
– zum Beispiel <strong>in</strong> der Felsenau bei Feldkirch<br />
oder die Kehrenbrücken <strong>in</strong> Übersaxen und<br />
Schröcken – zu Zeugnissen e<strong>in</strong>es Zeitgeistes, bei<br />
dem das Zurschaustellen technischer Neuerungen<br />
wichtiger genommen wurde als das bisher<br />
gewohnte Bemühen um e<strong>in</strong> Harmonieren mit dem<br />
Landschaftsbild.<br />
Trotz <strong>des</strong> auffälligen Mangels an qualitätsbetonter<br />
„<strong>Verkehrs</strong>kultur“ fehlt es auch unter den<br />
neuen <strong>Verkehrs</strong>bauten nicht an Beispielen überzeugender<br />
Architektur. Solche Positivbeispiele<br />
s<strong>in</strong>d am häufi gsten bei Brückenbauten zu fi nden.<br />
Vermutlich gel<strong>in</strong>gt es bei weiteren Neubauten vor<br />
allem durch Wettbewerbe, e<strong>in</strong>e baukünstlerische<br />
Kreativität zu fördern, die auch künftig zu zeitgemäßen<br />
Bereicherungen der Kulturlandschaft
eiträgt. Vor allem müssten schon im kle<strong>in</strong>en die<br />
vielen Chancen für e<strong>in</strong>en landschaftsschonenden<br />
Wegebau genutzt werden, die <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den<br />
aber noch immer zu wenig erkannt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
Grund mehr, dass auf die Möglichkeiten entsprechend<br />
aufmerksam gemacht wird, wie dies schon<br />
bei früheren Gelegenheiten geschehen ist. 20<br />
9. Mangelnde Rücksicht auf verkehrsgeschichtliches<br />
<strong>Kulturerbe</strong> bei Bauprojekten<br />
Das <strong>Vorarlberg</strong>er Baugesetz enthält im § 17<br />
Bestimmungen zum Schutz <strong>des</strong> Orts- und Landschaftsbil<strong>des</strong>,<br />
die jedoch sehr allgeme<strong>in</strong> formuliert<br />
s<strong>in</strong>d. 21 Bei den im Abs. 2 enthaltenen Rücksichtnahmepfl<br />
ichten ist bei e<strong>in</strong>em bewilligungspfl ichtigen<br />
Vorhaben gemäß Erläuterung 22 „zu prüfen,<br />
ob das Bauwerk (oder die sonstige Anlage) sich <strong>in</strong><br />
das Landschafts- oder Ortsteilbild, dem das Bauwerk<br />
(oder die sonstige Anlage) zuzuordnen ist<br />
und das e<strong>in</strong>e erhaltenswerte Charakteristik aufweist,<br />
e<strong>in</strong>fügt oder ihm auf andere Art gerecht<br />
wird.“ Die Charakteristik gelte jedenfalls dann als<br />
erhaltenswert, „wenn es durch Objekte von kulturhistorisch<br />
oder architektonischem Wert – z.B.<br />
Klöster, Kirchen, Ensembles oder <strong>in</strong> Fachkreisen<br />
der Architektur anerkannte Bauwerke – geprägt<br />
wird. Darüber h<strong>in</strong>aus kann e<strong>in</strong> Ortsbild, das<br />
nicht durch die genannten Objekte geprägt wird,<br />
auch aus anderen Gründen erhaltenswert se<strong>in</strong>,<br />
z.B. weil es e<strong>in</strong>e ausgewogene gestalterische<br />
Charakteristik aufweist.“ Wie man sieht, steht<br />
hier die Rücksichtnahme auf vorhandene „Bauwerke“<br />
so sehr im Vordergrund, dass es leicht<br />
gemacht ist, auf andere landschaftliche Kulturwerte<br />
wie die von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen zu<br />
vergessen.<br />
Dies gilt noch mehr für das Gesetz über Naturschutz-<br />
und Landschaftsentwicklung. 23 Hier werden<br />
unter den Zielen von § 2 Abs. 3 „wichtige<br />
landschaftsgestaltende Elemente“ nur als „Naturwerte<br />
von besonderer Bedeutung“ berücksichtigt.<br />
Somit kann auch bei den unter § 33 genannten<br />
bewilligungspfl ichtigen Vorhaben der Schutz von<br />
kulturgeschichtlich bedeutsamen Landschaftselementen<br />
derzeit noch weitgehend unberücksichtigt<br />
bleiben.<br />
Wie überall spiegelt sich <strong>in</strong> der Gesetzgebung<br />
erkannter oder nicht erkannter Handlungsbedarf.<br />
So ist immer e<strong>in</strong> weiterentwickeltes Problembewusstse<strong>in</strong><br />
nötig, bis auch den bislang nicht<br />
erkannten Erfordernissen Rechnung getragen wird.<br />
Dies gilt im Blick auf die pfl egliche Erhaltung von<br />
historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen auch im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er zeit gemäßen Weiterentwicklung von örtlichen<br />
und überörtlichen Entwicklungszielen.<br />
10. Handlungsbedarf im Rahmen der<br />
Ortsentwicklung<br />
Zum Teil mag es an Defi ziten <strong>in</strong> der Ausbildung<br />
von Ortsplanern liegen, dass im Rahmen von<br />
Ortsplanungen, Maßnahmen zur Dorferneuerungen<br />
und anderen Konzepten zur Geme<strong>in</strong>deentwicklung<br />
auf den Kulturgüterschutz allzu oft<br />
vergessen wird. Da der Bedeutung historischer<br />
<strong>Verkehrs</strong>wege bisher auch auf überörtlichen Ebenen<br />
wenig Beachtung geschenkt wurde, wird das<br />
Problem der Vernachlässigung <strong>in</strong> diesem Bereich<br />
erst recht spürbar. Auf dieses <strong>in</strong> ganz Österreich<br />
feststellbare Manko hat Wolfang Schwarzelmüller<br />
bereits 1987 aufmerksam gemacht. Er erkannte<br />
auch und gerade im Rahmen der Dorferneuerung<br />
die Chance, Kulturdenkmale der <strong>Verkehrs</strong>geschichte,<br />
„für deren Unter-Schutz-Stellung und<br />
Bewahrung es <strong>in</strong> Österreich ke<strong>in</strong> ausreichen<strong>des</strong><br />
Rechts<strong>in</strong>strumentarium gibt, im Wege e<strong>in</strong>er freiwilligen<br />
Selbstb<strong>in</strong>dung der Geme<strong>in</strong>de oder e<strong>in</strong>er<br />
Zusammenlegungsgeme<strong>in</strong>schaft zu retten“ 24<br />
Maßnahmen <strong>in</strong> dieser Richtung erfordern allerd<strong>in</strong>gs<br />
M<strong>in</strong><strong>des</strong>tkenntnisse über die vorhandenen<br />
und gefährdeten Wege und Bauwerke und setzen<br />
e<strong>in</strong> entsprechen<strong>des</strong> Problemverständnis <strong>in</strong> der<br />
Öffentlichkeit voraus. Hierfür wären fundierte<br />
Grundlagenarbeiten auf örtlicher und überörtlicher<br />
Ebene e<strong>in</strong>e wertvolle Voraussetzung. Bei<br />
den hiefür nötigen Initiativen kommt es allerd<strong>in</strong>gs<br />
trotz der gebotenen Dr<strong>in</strong>glichkeit nicht auf übereilte<br />
Aktionen, sondern auf fachlich über zeugende<br />
Vorarbeiten an.<br />
15
1 Zit. bei Walter Strolz, Heideggers Denken und die<br />
heimatliche Überlieferung. In: Montfort, 1984, H. 1,<br />
S. 63.<br />
2 Denkmalschutzgesetz § 1 Abs. 2, BGBl I Nr. 170/I<br />
1999.<br />
3 Wolfgang Schwarzelmüller, Kulturgüterschutz als<br />
Beitrag zur umfassenden Ortserneuerung und Landschaftserhaltung<br />
am Beispiel historischer <strong>Verkehrs</strong>wege,<br />
Reihe „extras“ Nr. 18 <strong>des</strong> Instituts für Raumplanung<br />
und Agrarische Operationen der Universität<br />
für Bodenkultur, Wien 1987, S. 24.<br />
4 Erich Bierhals, Die falschen Argumente? – Naturschutz-Argumente<br />
und Naturbeziehung. In: Landschaft<br />
+ Stadt, 1984, 16, S. 117-126.<br />
5 Raumplanungsgesetz LGBl. Nr. 42/2007.<br />
6 Lucius Burckhardt, Landschaft ist transitorisch. – Zur<br />
Dynamik der Kulturlandschaft. In: Topos, H.6, 1994,<br />
S. 44.<br />
7 Dehio-Handbuch <strong>Vorarlberg</strong>, Wien 1983.<br />
8 Dehio-Handbuch (wie Anm. 7), S. 307 und 327.<br />
9 Max Dvorák, Katechismus der Denkmalpfl ege, Wien<br />
1915, S. 24.<br />
10 Amt der <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>regierung, Wanderwege-<br />
Konzept <strong>Vorarlberg</strong>, Bregenz 1995, S. 22; Regionale<br />
Wanderwegekonzepte – Leitl<strong>in</strong>ien für die Erarbeitung<br />
und Realisierung, Bregenz 1999, S. 7.<br />
11 Helmut Tiefenthaler, Wege <strong>in</strong> die Vergangenheit <strong>in</strong><br />
<strong>Vorarlberg</strong>, Innsbruck 2005 sowie Wege <strong>in</strong> die Vergangenheit<br />
im Alpenrhe<strong>in</strong>tal, Innsbruck 2007.<br />
12 Zusammenfassender Überblick bei Helmut Tiefenthaler,<br />
Weitwanderwege durch <strong>Vorarlberg</strong>, In: Montfort<br />
2005, H. 4, S. 363-380.<br />
13 Lothar Beer, E<strong>in</strong>e Bahn im Rhythmus der Zeit, Die<br />
Geschichte der Bregenzerwaldbahn-Museumsbahn,<br />
Hard 2007, S. 188.<br />
14 Helmut Tiefenthaler, Historische <strong>Verkehrs</strong>wege <strong>in</strong><br />
<strong>Vorarlberg</strong> – Handlungsbedarf zur pfl eglichen Erhaltung.<br />
In: Jahrbuch <strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>museumsvere<strong>in</strong>s<br />
2004, Bregenz 2005, S. 119-137.<br />
15 Amt der <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>regierung, WanderWege-<br />
Service – Handbuch für die Anlage und Betreuung<br />
von Wanderwegen, Bregenz 2005.<br />
16 Andriu Maissen, Die agrarische <strong>Verkehrs</strong><strong>in</strong>frastruktur<br />
– vielfältig geschützt und doch stark gefährdet. In:<br />
Wege und Geschichte, Hg. ViaStoria, Bern, 2005/1,<br />
S. 21-25.<br />
17 Röbi Küng, Trockenmauern am Grabserberg. Entwicklung<br />
und Bedeutung e<strong>in</strong>es verzweigten <strong>Verkehrs</strong>netztes<br />
<strong>in</strong> den Zeiten vor dem Straßenbau. In: Werdenberger<br />
Jahrbuch 1998, S. 130-138.<br />
18 Amt für Natur und Landschaft, Regionales Vernetzungskonzept<br />
Trimmis, Chur 2002-04.<br />
19 Hans Jakob Reich, Alte Kulturlandschaft gepfl egt. In:<br />
Werdenberger & Obertoggenburger, 31.8.2007.<br />
16<br />
20 E<strong>in</strong> gutes Beispiel ist die Broschüre von Johann Litzka<br />
und Wolf Juergen Reith, Wegebau <strong>in</strong> der Landschaft,<br />
Wien 1988.<br />
21 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001.<br />
22 45. Beilage im Jahre 2001 <strong>des</strong> XXVII. <strong>Vorarlberg</strong>er<br />
Landtages, S.61.<br />
23 LGBl. Nr. 22/1997<br />
24 Wolfang Schwarzelmüller (wie Anm. 3), S.5