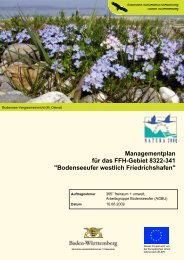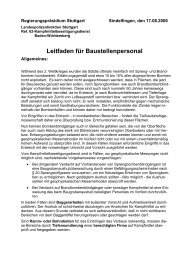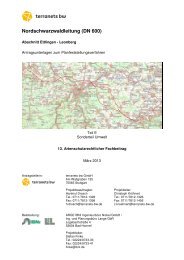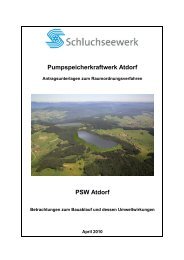rpk54.2_bkm_lafarge_eoet_130625 - Baden-Württemberg
rpk54.2_bkm_lafarge_eoet_130625 - Baden-Württemberg
rpk54.2_bkm_lafarge_eoet_130625 - Baden-Württemberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ABTEILUNG 5 – UMWELT<br />
Erörterungstermin<br />
zum Antrag der Firma<br />
Lafarge Zement Wössingen GmbH<br />
für die Erhöhung der Sekundärbrennstoffrate<br />
am Drehrohrofen des Zementwerks<br />
von derzeit genehmigten 60 % auf zukünftig 100 %<br />
23. April 2013<br />
in der Sport- und Mehrzweckhalle Walzbachtal-Wössingen<br />
Stenografisches Wortprotokoll
II<br />
Ort der Erörterung: Sport- und Mehrzweckhalle Walzbachtal-Wössingen<br />
Datum: 23. April 2013<br />
Seilerweg 5, 75045 Walzbachtal<br />
Erörterung von: 09:00 bis 18:36 Uhr<br />
Genehmigungsbehörde: Regierungspräsidium Karlsruhe,<br />
Referat 54.2, Markgrafenstr. 46,<br />
76133 Karlsruhe<br />
Verhandlungsleiter: Baudirektor Bernd Haller<br />
Vorhabensträger: Lafarge Zement Wössingen GmbH<br />
Wössinger Straße 2, 75045 Walzbachtal<br />
Protokollführung, Stenografen: Norbert Remke, Königswinter<br />
Ursula Dütsch, Saerbeck<br />
Die in blauer Schriftfarbe hervorgehobenen Textstellen weisen auf Verlinkungen zwischen Tages-<br />
ordnung, Redebeiträgen und Anlagen hin. Mit „STRG + Klicken“ können Sie den Links folgen.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
III<br />
Tagesordnung<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Seite<br />
I. Begrüßung und Einführung / Organisatorisches 7<br />
II. Darstellung des Verfahrensablaufs<br />
mit Umweltverträglichkeitsuntersuchung 8<br />
III. Vorstellung des Projektes durch die Antragstellerin 9<br />
IV. Erörterung der Einwendungen nach folgenden Themen: 13<br />
1. Klimaschutz / Energiekonzept 13<br />
Einsatz von Gas zur Erreichung der Luftreinhalte- und Klimaschutzziele<br />
der EU 13<br />
2. Sekundärbrennstoffe 21<br />
Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 21<br />
Einfluss der Sekundärbrennstoffe auf den Klinkerbrennprozess,<br />
die Produkteigenschaften des Zements sowie auf Altbeton 21<br />
Radioaktivität 31<br />
Qualitätssicherung/Fluff 33<br />
Tiermehl 27<br />
Andere Abfälle als beantragt 37<br />
3. Emission / Immission Luft 49<br />
Emissionen(-grenzwerte) an Staub, Feinstaub, Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid<br />
(SO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwermetalle, Dioxine und Furane 50<br />
Rauchgasreinigung (SNCR, Nasswäscher, Versuch zur Minimierung von<br />
Quecksilber 67<br />
Filtertechnik/Betriebsstörungen 81<br />
Vorbelastung, auch andere Industriebetriebe 49<br />
Überschreitung von Irrelevanzwerten 51<br />
Quecksilber im Schwebstaub 59<br />
Immissionsstundenwert von SO2 83<br />
Kaminhöhe 84<br />
Bodenwerte im Umkreis (Critical Loads) 85<br />
4. Emission / Immission Lärm 86<br />
Lärmbelastung in Walzbachtal/Bretten 86<br />
5. Sonstiges 89<br />
UVU / Ausgleichsmaßnahmen 89<br />
EU-Anforderungen 90<br />
V. Schlusswort 90
IV<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Seite<br />
Rednerliste 91<br />
Abkürzungen 91<br />
Protokollverantwortliche 91<br />
Anlagen 93<br />
Anlage 1: Vorstellung des Projektes, Lutz Weber<br />
Anlage 1-1: Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate auf 100 %“ 94<br />
Anlage 1-2: Inhalt 94<br />
Anlage 1-3: Lafarge Zement Wössingen 95<br />
Anlage 1-4: Die Rahmenbedingungen 95<br />
Anlage 1-5: Warum Sekundärbrennstoffe 96<br />
Anlage 1-6: Antragsumfang 96<br />
Anlage 1-7: Emissionsbericht 2012 97<br />
Anlage 1-8: Warum Dachpappe? 97<br />
Anlage 1-9: Warum HOK-Anlage? 98<br />
Anlage 1-10: Warum Neubewertung Lärm? 98<br />
Anlage 1-11: Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung 99<br />
Anlage 1-12: Umweltverträglichkeitsuntersuchung 99<br />
Anlage 1-13: Emissionsprognose 100<br />
Anlage 1-14: Immissionsvorbelastung 100<br />
Anlage 1-15: Immissionsprognose 101<br />
Anlage 1-16: Lärmgutachten 101<br />
Anlage 1-17: Betrachtung: diffuse Staubemissionen 102<br />
Anlage 1-18: Umweltverträglichkeitsuntersuchung 102<br />
Anlage 1-19: Information im Verfahren 103<br />
Anlage 1-20: Zusammenfassung 103<br />
Anlage 2: Einwendungen vom BUND, Harry Block<br />
Anlage 2-1: Antrag der Firma Lafarge Zement Wössingen GmbH 104<br />
Anlage 2.2: Beschluss der EU-Kommission 104<br />
Anlage 2-3: Vorbelastungen im Raum KA 105<br />
Anlage 2-4: Luftbild Karlsruhe - Walzbachtal 105<br />
Anlage 2-5: Quelle Bundesumweltamt: Anstieg der CO2-Emissionen 106<br />
Anlage 2-6: Kohlendioxidvergleich Gaskraftwerk/Kohlekraftwerk 106<br />
Anlage 2-7: CO2-Emissionen verschiedener Brennstoffe 107<br />
Anlage 2-8: Emission Gaskraftwerk/Kohlekraftwerk 107<br />
Anlage 2-9: Was ist im Müll enthalten? 108<br />
Anlage 2-10: Vorbelastung heute/neu 108<br />
Anlage 2-11: Emissionen beta- und gammastrahlender Aerosole 109
V<br />
(Fortsetzung Anlagen) Seite<br />
Anlage 2-12: Emissionsfrachten 109<br />
Anlage 2-13: Immissionszusatzbelastung 110<br />
Anlage 2-14: Foto Zementwerk 110<br />
Anlage 2-15: Foto Gasleitung 111<br />
Anlage 2-16: Problem bei Gas und Müll – Stickstoffdioxid (NOX) 111<br />
Anlage 2-17 a: Immissionsjahreszusatzbelastung 112<br />
Anlage 2-17 b: Immissionsjahreszusatzbelastung – u. a. Cadmium, Quecksilber 112<br />
Anlage 2-17 c: Immissionsjahreszusatzbelastung – u. a. Antimon, Arsen 113<br />
Anlage 2-17 d: Immissionsjahreszusatzbelastung – u. a. Dioxine, Furane 113<br />
Anlage 2-18: Feinstaub – Feinststaub 114<br />
Anlage 2-19: Vergleich: Feinststäube KA 114<br />
Anlage 2-20: Staubdeposition in mg/(m² x d) 115<br />
Anlage 2-21: PM10-Zusatzbelastung in der bodennahen Schicht 115<br />
Anlage 2-22 a: Emissionswerte Gesamtkohlenstoff, Chlorwasserstoff, Stickoxide 116<br />
Anlage 2-22:b: Emissionswerte Schwefeldioxid, Staub, Kohlenmonoxid 116<br />
Anlage 2-22 c:: Emissionswerte Quecksilber und seine Verbindungen, Ammoniak,<br />
anorganische gasförmige Fluorverbindungen 117<br />
Anlage 2-22 d: Emissionswerte Cadmium, Thallium, Antimon etc., Dioxine und<br />
Furane 117<br />
Anlage 3: CO2-Minderung durch den Einsatz alternativer Einsatzstoffe,<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter 118<br />
Anlage 4: Spurenelementgehalte in deutschen Normzementen,<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter 120<br />
Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mitverbrennung von Abfällen in<br />
Zementwerken auf die Schwermetallbelastung des Produkts im<br />
Hinblick auf die Zulässigkeit der Abfallverwertung, Dr.-Ing. Martin<br />
Oerter 121<br />
Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe, Tino Villano 126<br />
Anlage 7: Emissionsmessbericht für das Jahr 2011, Tino Villano 136<br />
Anlage 8: Tagesmittelwertverteilung: Hg-Emissionen Ofen, Tino Villano 137<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
VI<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
I. Begrüßung und Einführung/<br />
Organisatorisches<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Es ist 9:00 Uhr. Ich darf Sie hier heute, am 23.04.2013,<br />
zum Erörterungstermin begrüßen.<br />
Das Thema der heutigen Erörterung ist der Antrag der<br />
Firma Lafarge Zement Wössingen GmbH, und der Antragsgegenstand<br />
ist, wie Sie wissen, die Erhöhung der<br />
Sekundärbrennstoffrate von bisher 60 % auf zukünftig<br />
100 % bei der Herstellung von Zementklinker hier im Werk<br />
Wössingen.<br />
Eine ganz kurze Vorstellung meiner Person: Mein Name<br />
ist Bernd Haller. Ich bin Referatsleiter des Referats<br />
54.2 im Regierungspräsidium Karlsruhe.<br />
Rechts von mir sitzt Herr Schilling, unser Jurist, der<br />
das Verfahren von der rechtlichen Seite und den verwaltungsrechtlichen<br />
Abläufen her betreut.<br />
Links von mir sitzt Herr Essig, der die Firma Lafarge<br />
und das Verfahren fachlich und technisch begleitet.<br />
Dann haben wir hier von Seiten des Regierungspräsidiums<br />
noch den Herrn Lang, der die organisatorischen<br />
und verwaltungsmäßigen Dinge betreut.<br />
Hier vorne sitzen noch die Protokollanten, Frau Dütsch<br />
und Herr Remke, wobei ich hiermit gleich mitteile, dass für<br />
die ganze Veranstaltung ein Wortprotokoll geführt wird.<br />
Mein Dank gilt natürlich Ihnen, den Einwendern und<br />
den interessierten Bürgern, dass Sie so zahlreich heute<br />
Morgen erschienen sind, aber insbesondere der Gemeinde<br />
Walzbachtal. Ich darf noch kurz den Dank an Bürgermeister<br />
Burgey und Herrn Dehm weitergeben, die uns bei<br />
der Organisation und insbesondere beim unproblematischen<br />
Wechsel des Veranstaltungsortes von der alten<br />
Scheune hierher unterstützt haben. Wir haben uns dafür<br />
entschieden, weil die Resonanz so groß war, dass die<br />
Räumlichkeiten hier einfach besser passen.<br />
In dem Zusammenhang noch etwas zur Organisation:<br />
Die Gemeinde, Herr Dehm, hat das Mittagessen vororganisiert.<br />
Hier in der Halle besteht die Möglichkeit, das<br />
Mittagessen einzunehmen. Einige von Ihnen haben sich<br />
schon in der Liste eingetragen. Diejenigen, die es noch<br />
nicht getan haben, wenden sich bitte an Herrn Dehm.<br />
Jetzt kommen wir zum Tagesablauf. Wir wissen nicht,<br />
wie lange wir brauchen, aber wir nehmen uns alle Zeit, die<br />
wir benötigen. Organisatorisch nur so viel: Wir würden<br />
nach zwei Stunden eine kurze Pause von zehn Minuten<br />
vorsehen und dann eine Stunde Mittagspause. Die hängt<br />
aber davon ab, wie wir im Ablauf vorankommen.<br />
Getränke und Brezeln finden Sie hier vorne rechts; da<br />
kann sich jeder bedienen. Die Getränke hat Lafarge zur<br />
Verfügung gestellt. – Das als reine Information.<br />
Seite 7<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Zum Termin noch ein paar Worte von meiner Seite: Es<br />
handelt sich um einen öffentlichen Termin. Das heißt,<br />
jeder Interessierte ist willkommen. Rederecht haben nur<br />
die Einwender – sie haben sich hier vorne schon eingefunden<br />
– zu den von Ihnen fristgerecht vorgebrachten<br />
Einwendungen.<br />
Wir haben insgesamt 51 Einwendungen, und wir haben<br />
für das Abarbeiten dieser Einwendungen einen<br />
Fahrplan zusammengestellt. Sie sehen ihn an der Wand<br />
hinter mir. Er liegt aber auch bei Ihnen aus.<br />
Eine Bitte an die Einwender: Es gibt Anwesenheitslisten,<br />
in die Sie sich bitte eintragen möchten, soweit noch<br />
nicht geschehen.<br />
Wir wollen uns an diesem Fahrplan orientieren. Bitte<br />
melden Sie sich mit Ihren Punkten zu den einzelnen<br />
Themen! Benutzen Sie dann die Mikros vor Ihnen oder<br />
ggf. auch die Standmikros! Stellen Sie sich zu Beginn kurz<br />
vor mit Ihrem Namen und ggf. der Organisation, für die Sie<br />
sprechen! Dann bringen Sie bitte noch einmal kurz und<br />
ggf. erläuternd Ihre Einwendung vor! Das ist für uns ein<br />
großer Vorteil, weil wir damit die Zuordnung zu den<br />
schriftlich vorgetragenen Einwendungen herstellen können,<br />
aber auch prüfen können, welche Einwendungen<br />
abgearbeitet sind und welche nicht.<br />
Zum Schluss zur Erläuterung noch zwei, drei Punkte,<br />
worum es uns heute geht: Es gibt bei diesem Termin für<br />
Sie, für alle Anwesenden, insbesondere natürlich die<br />
Einwenderinnen und Einwender, noch einmal die Möglichkeit,<br />
sich umfassend über das Vorhaben zu informieren.<br />
Natürlich haben Sie auch die Gelegenheit, Ihre Einwendungen<br />
noch einmal vorzubringen und zu erläutern.<br />
Wir streben heute auch an – soweit dies im Rahmen<br />
der rechtlichen Möglichkeiten überhaupt machbar ist –,<br />
einen gewissen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen<br />
herbeizuführen. Aber dieser Termin dient insbesondere<br />
dazu, dass wir uns mit den relevanten Aspekten noch<br />
einmal umfassend beschäftigen können, um damit die<br />
Grundlage für unsere Entscheidung, die anstehen wird, zu<br />
verbessern.<br />
Jetzt noch eine Bitte am Schluss der Einführung an<br />
alle, um unnötige Störungen zu vermeiden – man erlebt<br />
das immer wieder –: Bitte schalten Sie Ihre Handys<br />
zumindest auf lautlos! Danke dafür.<br />
Gibt es noch Ergänzungen von unserer Seite? – Dann<br />
wären wir schon mit der Begrüßung und der Einführung<br />
am Ende.<br />
Ich möchte nun unseren Juristen Herrn Schilling bitten,<br />
zum Tagesordnungpunkt II kurz eine rechtliche Einstufung<br />
des Antrags und Erläuterungen zum Verfahrensablauf zu<br />
geben.
II. Darstellung des Verfahrensablaufs mit<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Auch von meiner Seite guten Morgen, meine Damen und<br />
Herren.<br />
Zum Verfahren kurz einführend einiges zur Erläuterung:<br />
Es handelt sich bei der Anlage, um die es heute<br />
geht, um ein Zementwerk mit einer Produktionskapazität<br />
von 2300 t am Tag. Das heißt, es ist eine Anlage nach Nr.<br />
2.3 Spalte 1 der Vierten Verordnung zum Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz.<br />
Den Gegenstand, der heute verhandelt wird, hat Herr<br />
Haller bereits kurz erklärt. Es geht um die Erhöhung des<br />
Anteils an Ersatzbrennstoffen von 60 % auf bis zu 100 %.<br />
Das stellt eine wesentliche Änderung dieser immissionsschutzrechtlichen<br />
Anlage dar, die nach § 16 Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftig ist.<br />
Nach Nr. 2.2.1 der Anlage 1 im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz<br />
bedarf eine solche Anlage auch einer<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies bedeutet, dass die<br />
Änderung der Anlage in unserem Falle konkret der Vorprüfung<br />
eines Einzelfalles nach § 3 e Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz<br />
bedurfte.<br />
Diese Vorprüfung brachte das Ergebnis, dass eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Daraufhin<br />
hat die Firma Lafarge am 17.10.2011 beim Regierungspräsidium<br />
Karlsruhe einen Antrag auf Durchführung eines<br />
Scopingtermins, also eines Termins, in dem der Untersuchungsrahmen<br />
für die Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
festgelegt wird, gestellt. Zugleich wurden die erforderlichen<br />
Unterlagen eingereicht. Wir nennen das kurz und<br />
bündig „Scopingpapier“.<br />
Auf diesen Antrag hin wurden am 20.10.2011 die Unterlagen<br />
an die Träger öffentlicher Belange versandt, an<br />
BUND, Landesnaturschutzverband und NABU, einschließlich<br />
der Einladung zum Termin am 30. November 2011.<br />
Im Anschluss an diesen Termin wurde am 7. Dezember<br />
2011 die Sitzungsniederschrift übersandt.<br />
Aufgrund des dort besprochenen Untersuchungsrahmens<br />
wurden die Antragsunterlagen erstellt, und der<br />
Antrag wurde dann am 6. Dezember 2012 seitens des<br />
Vorhabenträgers gestellt.<br />
Am 10.12.2012 ging der Antrag beim Regierungspräsidium<br />
Karlsruhe ein und wurde noch am gleichen Tage<br />
an die Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme<br />
gesandt. Die Frist für die Vollständigkeitsprüfung war<br />
Anfang Januar 2013, die Rückäußerung in der Sache war<br />
bis Mitte Januar 2013 erbeten.<br />
Nachdem sämtliche Stellungnahmen vorlagen, wurde<br />
der Antrag am 25. Januar 2013 im amtlichen Bekanntmachungsorgan<br />
des Regierungspräsidiums Karlsruhe, dem<br />
Staatsanzeiger <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> sowie in den Badi-<br />
Seite 8<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
schen Neuesten Nachrichten und im Internet des Regierungspräsidiums<br />
bekannt gemacht.<br />
Die Antragsunterlagen lagen dann gut eine Woche<br />
später, wie es das Gesetz vorsieht, ab dem 4. Februar<br />
2013 bis zum 4. März 2013 bei der Gemeinde Walzbachtal,<br />
bei der Stadt Bretten und im Regierungspräsidium<br />
Karlsruhe zur Einsichtnahme durch jedermann aus.<br />
Die Einwendungsfrist endete zwei Wochen nach Ende<br />
der Offenlagefrist, also am 18. März 2013. Bis zu diesem<br />
Zeitpunkt gingen 51 Einwendungen beim Regierungspräsidium<br />
unmittelbar oder eben über die Stellen, bei denen<br />
der Antrag offenlag, ein.<br />
Der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal befasste<br />
sich am 11. März 2013 mit diesem Antrag und gab eine<br />
Stellungnahme hierzu ab.<br />
Aufgrund der Vielzahl der Einwendungen sahen wir es<br />
als erforderlich an, den Veranstaltungsort der heutigen<br />
Erörterungsverhandlung zu verlegen. Diese Verlegung<br />
wurde am 3. April 2013 den Einwendern jeweils mittels<br />
Schreiben bekannt gegeben. Darüber hinaus wurde die<br />
Öffentlichkeit sowohl auf der Homepage des Regierungspräsidiums<br />
Karlsruhe als auch über die sonst üblichen<br />
Organe informiert.<br />
Es wurde bei dieser Gelegenheit auch darauf hingewiesen,<br />
dass die Einwendungen heute zusammengefasst<br />
erörtert werden, d. h. nicht Einwendung für Einwendung,<br />
sondern nach Themenblöcken, wie es § 18 Abs. 2 der<br />
Neunten Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
vorsieht. Darauf wurde in der Bekanntgabe hingewiesen.<br />
Die Tagesordnung wurde ebenfalls auf der<br />
Homepage des Regierungspräsidiums bekannt gegeben<br />
und liegt heute hier im Sitzungssaal aus.<br />
Noch kurz ergänzend zum Erörterungstermin – Herr<br />
Haller hat es vorhin bereits erwähnt –: Sinn und Zweck<br />
des heutigen Termins ist es, Ihre Einwendungen zu<br />
erörtern, zu besprechen und die Genehmigungsbehörde,<br />
sprich: uns, das Regierungspräsidium Karlsruhe, in die<br />
Situation zu versetzen, Ihre Einwendungen sachgerecht<br />
im Genehmigungsverfahren zu behandeln. Heute ist es<br />
nicht Gegenstand, über Ihre Einwendungen zu entscheiden.<br />
Das erfolgt in der endgültigen Entscheidung über den<br />
gestellten Antrag. – Vielen Dank.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ist noch etwas übriggeblieben?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir hätten eine Bitte. Wir hatten in Walzbachtal ein Treffen<br />
mit Bürgerinnen und Bürgern. Da kam der gleiche<br />
Wunsch, den wir an anderen Erörterungsterminen auch<br />
schon hatten, im Hinblick auf die Bürger, die jetzt nicht<br />
hier sein können, weil sie berufstätig sind. Wir mussten<br />
heute alle freinehmen. Wir sind hier eigentlich privat, wenn<br />
Sie so wollen.
Können wir um 17 Uhr ein Break machen – egal wo<br />
wir sind -, damit die Bürgerinnen und Bürgern, die das<br />
wollen, etwas sagen können? Das wird nicht erörtert,<br />
darüber wird nicht gesprochen, darauf braucht niemand zu<br />
antworten, und sie können sagen, was sie wollen. Vielleicht<br />
haben sie auch Einwendungen gemacht; das weiß<br />
ich nicht. Aber sie sind im Augenblick nicht da. Wir könnten<br />
um 17 Uhr ein Break machen und es um 17:30 Uhr<br />
beenden – oder früher. Wenn niemand etwas sagen will,<br />
dann machen wir es halt nicht. Aber wir würden uns<br />
wünschen, dass das so passiert.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, wir haben Ihren Wunsch gelesen. Ich hatte es<br />
vorhin deshalb nicht angesprochen, weil ich einfach<br />
abwarten wollte, wie der Tag verläuft. Aber wir haben das<br />
auf der Agenda. Wir warten jetzt einfach einmal ab, wo wir<br />
um 17 Uhr stehen, und dann stelle ich es noch einmal in<br />
den Raum.<br />
Aber eins ist klar: Das ist einfach nur die Möglichkeit,<br />
außerhalb jeder formalen verfahrenstechnischen Vorgabe<br />
solchen Dingen einen Raum zu geben: Wir machen es<br />
letztendlich auch davon abhängig, wie der Wunsch dann<br />
rückgekoppelt wird. Einverstanden? – Gut.<br />
Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt III. Da ist<br />
vorgesehen, dass Lafarge das Vorhaben kurz vorstellt.<br />
Deswegen gebe ich Herrn Weber oder Herrn Villano das<br />
Wort. – Herr Weber.<br />
III. Vorstellung des Projektes durch<br />
die Antragstellerin<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Danke schön, Herr Haller. – Wir haben eine kleine Präsentation<br />
mit einer Zusammenfassung zu diesen Antragsunterlagen<br />
geplant. Ich sehe hier ein großes Interesse<br />
daran. Herzlich willkommen an alle Besucher und alle<br />
Interessenten zu diesem Thema!<br />
(Schaubild: Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate<br />
auf 100 % - Anlage 1-1, S. 94)<br />
Die Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate auf 100 % ist<br />
ein wichtiges Thema für uns am Standort Wössingen, um<br />
nachhaltig und zukunftsorientiert zu agieren.<br />
(Schaubild: Inhalt – Anlage 1-2, S. 94)<br />
Die Präsentation ist so aufgebaut, dass ich zunächst<br />
auf das Werk und die Rahmenbedingung eingehe, also:<br />
Wo stehen wir bisher aktuell? Was ist das Werk selbst?<br />
Wir sind ein Zementhersteller – das ist wohl bekannt –,<br />
das ist auch unser Kerngeschäft. Anschließend spreche<br />
ich zum Antragsumfang. Es gibt vier Unterpunkte, auf die<br />
ich eingehen werde.<br />
Wesentlich sind die Genehmigungsvorbereitungen.<br />
Die UVP wurde schon angesprochen. Es sind unterschiedliche<br />
Gutachten eingegangen, und ein Unterpunkt<br />
Seite 9<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
ist die Information über den Verlauf des Verfahrens. Dann<br />
gibt es noch eine Zusammenfassung.<br />
(Schaubild: Lafarge Zement Wössingen –<br />
Anlage 1-3, S. 95)<br />
Lafarge Zement Wössingen kann bereits auf eine jahrzehntelange<br />
Historie zurückschauen. Der eine oder<br />
andere mag sich noch erinnern: Vor drei Jahren haben wir<br />
die 60-Jahr-Feier gehabt. Dort gab es den illuminierten<br />
Turm, eine wirkliche Sehenswürdigkeit damals.<br />
Wir haben aktuell eine Produktionskapazität von bis zu<br />
800.000 t Zement pro Jahr. Wir haben Produkte von bis zu<br />
zehn unterschiedlichen Produktsorten und können da auf<br />
eine sehr hohe Qualität zurückschauen.<br />
Diese hohe Qualität und unsere sehr starke Wettbewerbsfähigkeit<br />
aufgrund unserer Topqualitäten ist insbesondere<br />
dadurch erreicht worden, dass wir eine umfassende<br />
Modernisierung in 2008/2009 durchgeführt hatten.<br />
Das war jahrelang ein wesentliches Highlight.<br />
Lafarge hat immer darauf geachtet, sich anlagentechnisch<br />
zu verbessern, zu optimieren. Es ging in den 50er-<br />
Jahren los, als die ersten Schachtöfen gebaut wurden.<br />
Dann ging es in den 60er-Jahren weiter mit einem Lepolverfahren<br />
– das ist ein Halbtrockenverfahren –, über<br />
Umbau der Anlagen mit Nachrüstung von umwelttechnologischen<br />
Maßnahmen wie Elektrofilter, die damals Stand<br />
der Technik waren, bis hin zur Erweiterung der SNCR-<br />
Technologie 1995; das ist eine Technologie zur Reduktion<br />
von Stickstoffemissionen. Das war der Höhepunkt in den<br />
letzten Jahren mit einer erheblichen Investition von über<br />
60 Mio. € hier am Standort. Somit war das auch eine<br />
nachhaltige zukunftsorientierte Investition für den Standort<br />
Wössingen.<br />
Mit dieser Umstellung vom Halbtrockenverfahren auf<br />
das Trockenverfahren konnten wir nicht nur erhebliche<br />
Verbesserungen im Qualitätsbereich erreichen, nicht nur<br />
unsere Wettbewerbsfähigkeit signifikant steigern, sondern<br />
auch emissionsseitig wesentliche Fortschritte erzielen.<br />
Mit dem Umbau konnte eine CO2-Reduktion von ca.<br />
25 % erreicht werden. Auch die Emissionen, z. B. Staub<br />
am Filter, sind signifikant heruntergegangen Für Staub<br />
gibt es einen Grenzwert bei 60 % von 20 mg. Wir halten<br />
aktuell 1 bis 2 mg Staubemissionen ein.<br />
Zertifizierung ist immer ein wichtiges Thema für uns.<br />
Zertifizierung bedeutet auch, dass man systematisch<br />
arbeitet, dass man kontinuierlich arbeitet und kontinuierlich<br />
Verbesserungen erreicht. Sie sehen auf dieser Folie<br />
eine Auflistung unserer Zertifizierungen. Eingehen möchte<br />
ich nur auf "Sicher mit System", ein Siegel von der Berufsgenossenschaft,<br />
worauf wir sehr stolz sind, weil es ein<br />
Zeichen für eine sehr sichere und systematische Arbeit ist.<br />
(Schaubild: Die Rahmenbedingungen –<br />
Anlage 1-4 – S. 95)<br />
Diese Investition in Lafarge Zement Wössingen bedeutet<br />
natürlich auch eine Sicherung von Arbeitsplätzen. Wir
haben 135 permanente Arbeitsplätze einschließlich<br />
Fremdfirmen, zudem auch diskontinuierliche Arbeitsplätze.<br />
Damit wir zukunftsorientiert handeln, nachhaltig handeln<br />
und uns wettbewerbsfähig aufstellen können, haben wir<br />
den Antrag auf die Einsatzmöglichkeit von 100 % Sekundärbrennstoffen<br />
gestellt.<br />
Es ist bereits über zwei Jahre her, dass wir die ersten<br />
Diskussionen darüber mit dem Regierungspräsidium<br />
gestartet haben. Wir hatten uns damals von vornherein<br />
entschlossen: Wir möchten das mit Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
machen. Wie man an dem Termin heute sieht, ist<br />
das auch gut so gewesen. Das Interesse ist da, und somit<br />
ist das auch der richtige Schritt gewesen.<br />
Die Umweltverträglichkeitsprüfung – Herr Schilling hat<br />
es bereits erwähnt – ist genauso wie die Immissionsvorbelastungsmessung<br />
eine Besonderheit für uns in diesem<br />
Verfahren. Denn dies wurde zum ersten Mal an dem<br />
Standort Wössingen durchgeführt.<br />
Das Zementwerk kann bei dem Einsatz von Sekundärbrennstoffen<br />
auf eine Historie zurückschauen. Die<br />
ersten Erfahrungen liegen seit 1995 mit dem Einsatz von<br />
Altreifen vor. Dann gab es eine Erweiterung mit Tiermehl<br />
und technischen Gummiresten im Jahr 2001. Und vor über<br />
sieben Jahren ist der Einsatz von Fluff als aufbereitete<br />
Reststoffe aus industriellen Produktionen und aufbereitetem<br />
geschreddertem Sperrmüll genehmigt worden.<br />
Dies sind Brennstoffe, die sich auf dem Markt etabliert<br />
haben. Fluff – das steht für „flugfähige Feinfraktionen“ – ist<br />
ein Material, das nicht nur von der Zementindustrie eingesetzt<br />
wird, sondern sich auch in vielen anderen Industriezweigen<br />
inzwischen als Brennstoff bewährt hat.<br />
Mit diesem Antrag haben wir auch erklärt, dass wir<br />
NOX weiter staubreduzieren wollen. Man muss sehen: Bei<br />
60 % gab es einen NOX-Grenzwert von 500 mg. Mit<br />
diesem Antrag gehen wir auf 320 mg oder bei Staub von<br />
20 auf 10 mg.<br />
(Schaubild: Warum Sekundärbrennstoffe? –<br />
Anlage 1-5, S. 96 )<br />
Warum Sekundärbrennstoffe? Sekundärbrennstoff ist<br />
ein Brennstoff, der sich bewährt hat. Wie erwähnt, können<br />
wir da bereits auf eine gute Historie zurückschauen. Er<br />
gewährleistet eine Schonung fossiler Brennstoffe. Sein<br />
Einsatz bedeutet auch eine weitere Reduktion von CO2-<br />
Emissionen. Wie ich gerade erwähnt habe, konnten wir<br />
mit dem Umbau bereits eine CO2-Reduktion von 25 %<br />
erreichen. Mit diesem Projekt erwarten wir eine weitere<br />
Reduktion von CO2 um ca. 10 %.<br />
Entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ist nach<br />
der Vermeidung, der Vorbereitung oder dem Recycling als<br />
vierte Stufe auch die thermische Nutzung von Abfällen<br />
vorgesehen.<br />
Diese gerade genannten Ziele, die CO2-Reduktion und<br />
die Schonung fossiler Brennstoffe, sind ein wichtiges<br />
Thema für die Lafarge-Umweltpolitik. Es sind Umweltziele<br />
definiert, die besagen, dass Lafarge weltweit eine Reduk-<br />
Seite 10<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
tion der CO2-Emissionen von 1990 bis zum Jahr 2020 um<br />
33 % erreichen möchte, dabei aber auch die Schonung<br />
natürlicher Ressourcen bewirken möchte.<br />
Für Lafarge ist Umweltpolitik generell ein sehr wichtiges<br />
Thema. Er ist z. B. der einzige Baustoffhersteller, der<br />
in der Liste der 100 nachhaltigsten Unternehmen auf der<br />
Welt aufgeführt ist – er liegt sogar auf Rang 51 – oder<br />
Kooperationsvereinbarungen z. B. mit dem WWF hat.<br />
Neben unserem Tagesgeschäft ist hier auch noch zu<br />
erwähnen: Es gibt in der Umweltpolitik von Lafarge hohe<br />
Anforderungen, die immer wieder abgeprüft werden. Es<br />
sind 48 einzelne Standards einzuhalten. Das orientiert<br />
sich zunächst einmal an der ISO 14001, einem Umweltmanagementsystem.<br />
Aber weit darüber hinaus geht es<br />
auch um Dokumentation, Aktionspläneverfolgung etc.,<br />
weiterhin um Trainingsverantwortlichkeiten und insbesondere<br />
wiederkehrende Audits. Diese Audits werden durch<br />
externe Fachinstitute mit Begleitung interner Experten von<br />
Lafarge-Seite durchgeführt.<br />
(Schaubild: Antragsumfang – Anlage 1-6,<br />
S. 96)<br />
Beim Antragsumfang haben wir die Steigerung auf<br />
100 % erwähnt. Aber es gibt noch drei weitere Punkte.<br />
Das ist zum einen der Einsatz von Dachpappe als Sekundärbrennstoff,<br />
zum anderen der Betrieb einer HOK-Anlage<br />
– HOK steht für „Herdofenkoks“ - und eine Neubewertung<br />
von Lärm. Auf diese vier Punkte gehe ich jetzt im Einzelnen<br />
ein.<br />
(Schaubild: Emissionsbericht 2012 –<br />
Anlage 1-7, S. 97)<br />
Wir werden, wie erwähnt, mit der Steigerung der Ersatzbrennstoffrate<br />
auch strengere Vorgaben bekommen<br />
zu NOX-Emissionen, zu SO2, aber auch zu Staub. Der<br />
Staubgrenzwert wird von bei 60 % aktuell 20 mg auf<br />
10 mg reduziert werden.<br />
Bei NOX haben wir einen Grenzwert bei 60 % von<br />
500 mg und werden da einen Grenzwert von 320 mg mit<br />
einem Zielwert von 200 mg NOX eintragen. Auch bei<br />
Schwefeldioxidemissionen gibt es eine Reduktion von 295<br />
auf 150 mg.<br />
Um dies alles zu zeigen, haben wir einen Test beantragt<br />
mit einem Betrieb von bis zu 80 % Sekundärbrennstoffrate.<br />
Aktuell ist der neueste Emissionsbericht von<br />
2012 fertiggestellt worden. Er ist noch nicht veröffentlicht<br />
worden, er wurde gerade dem Regierungspräsidium zur<br />
Prüfung vorgelegt.<br />
Hier ist erfreulicherweise die deutliche Einhaltung der<br />
Grenzwerte zu sehen. Zum Beispiel haben wir aktuell<br />
einen NOX-Grenzwert von 350 mg, und erreicht haben wir<br />
in 2012 einen Jahresmittelwert von 325 mg. Auch die<br />
Einzelmessungen zeigen eine deutliche Unterschreitung<br />
der Grenzwerte. Bei Quecksilber kam es zu keiner einzigen<br />
Überschreitung der Tagesmittelwerte.
(Schaubild: Warum Dachpappe? – Anlage 1-8,<br />
S. 97)<br />
Zur Dachpappe. Es ist eine Ergänzung des Produktbrennstoffportfolios<br />
um Dachpappe geplant. Bei Dachpappe<br />
denkt man normalerweise – so geht es zumindest mir –<br />
in erster Linie an die Gartenhäuser, die mit Dachpappe<br />
geschützt sind. Aber Dachpappe gibt es auch bei Industriebauten,<br />
es gibt sie als Schutz unterhalb von Dächern,<br />
als zusätzliches Isoliermaterial. Das wird als sortenreiner<br />
Abfall aufgenommen und entsprechend aufbereitet.<br />
Es ist geplant, einen nicht gefährlichen Abfall zu verwenden.<br />
In erster Linie geht es darum, auf die Schwankungen<br />
im Brennstoffmarkt entsprechend zu reagieren. Dachpappe<br />
wird kein Hauptbrennstoff sein, sondern wir reden hier<br />
von ca. 5 bis 10 %, die wir ggf. einsetzen. Das entspricht<br />
in etwa dem Markt der geschredderten Altreifen, die mehr<br />
und mehr vom Markt verschwinden.<br />
(Schaubild: Warum HOK-Anlage? – Anlage 1-9,<br />
S. 98)<br />
HOK – Herdofenkoksanlage. Quecksilbereinträge gibt<br />
es über Brennstoffe, Quecksilbereinträge gibt es aber<br />
auch über Rohstoffe. Es kann durch diese beiden Einträge<br />
zu Spitzen kommen. Um diese Spitzen abzufangen und zu<br />
vermeiden, ist es unser Ziel, eine permanente Installation<br />
einer Herdofenkoksanlage zu haben. Diese soll, wie es im<br />
Fachjargon heißt, als "Polizeimaßnahme" eingesetzt<br />
werden, sprich: nur in Betrieb gehen, wenn es zu diesen<br />
Spitzen kommt.<br />
Diese Anlage haben wir getestet. Sie ist im Testbetrieb<br />
auf automatischen Betrieb eingestellt. Das heißt, schon<br />
bei einem Wert von 25 µg/Nm³, also unterhalb des aktuell<br />
gültigen Grenzwertes von 28 µg/Nm³, fangen wir bereits<br />
an einzudüsen. Dieser Wert ist niedriger als das, was die<br />
17. BImSchV vorschreibt.<br />
Diese Technik ist vielfach im Einsatz und hat sich bereits<br />
sehr bewährt. Der Staub wird über Ofenfilter abgeschieden<br />
und zu 100 % der Zementmahlung zugeführt.<br />
(Schaubild: Warum Neubewertung Lärm? –<br />
Anlage 1-10, S. 98)<br />
Warum eine Neubewertung Lärm? Ein sehr wichtiges<br />
Thema für uns ist auch das Beschwerdemanagement. Wir<br />
haben ein sehr intensives Beschwerdemanagement, wo<br />
wir nicht nur auf schriftliche Beschwerden eingehen,<br />
sondern auch jegliche mündliche Beschwerde aufnehmen.<br />
Vor vier Jahren haben wir beobachtet, dass vermehrte<br />
Beschwerden kamen. Wir haben Maßnahmen getroffen<br />
und z. B. eine Lärmkamera eingesetzt. Eine Lärmkamera<br />
macht Bilder, und diese Bilder heben farblich hervor, wo<br />
Lärmemissionen sind. Dunkelrot bedeutet, es ist dort<br />
lärmemittent. Die Stellen sind natürlich teilweise bekannt.<br />
Eine Maschine macht Lärm, ein Motor macht Lärm. Aber<br />
es ist interessant zu sehen, dass auch Kleinigkeiten<br />
auffallen wie ein Schlitz in einem Tor, das nicht ganz<br />
Seite 11<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
geschlossen ist, oder eine Türzarge, die nicht komplett<br />
verschlossen ist. Das sind Kleinigkeiten, bei denen man<br />
viel erreichen kann. Gerade diese Lärmquellen haben wir<br />
mit der Lärmkamera sichtbar machen können.<br />
Wir haben weiterhin Messungen durch die DEKRA<br />
durchführen lassen. An drei Messstellen wurde gemessen.<br />
Dabei wurde ermittelt, dass es an einer Stelle zu einer<br />
Überschreitung kam. Wir haben mit dem Regierungspräsidium<br />
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen,<br />
in dem wir uns verpflichtet haben, drei Maßnahmenpakete<br />
I bis III abzuarbeiten. Das bedingt eine Investition von<br />
über 300.000 €. Wir haben damit eine erhebliche Reduzierung<br />
der Lärmemissionen von über 3 dB(A) schaffen<br />
können.<br />
Wir befinden uns aber aufgrund dessen, dass in diesem<br />
Bereich direkt ein Wohngebiet ansiedelt ist und es<br />
somit kein Mischgebiet zwischen Werk und diesem<br />
Wohngebiet gibt, in einer Situation, dass wir zwar die<br />
Mischwerte für Dorfgebiete und Mischgebiete einhalten,<br />
aber noch nicht die eines Wohngebietes.<br />
Daher haben wir beantragt, dass wir einen Richtwert<br />
für Dorfgebiete bekommen. Das bedeutet für uns aber<br />
nicht, dass wir da aufhören wollen. Die ersten Maßnahmen,<br />
die Spitzen herauszuholen, sind einfach leichter. Je<br />
mehr man daran gearbeitet, umso kleiner werden die<br />
Spitzen. Das ist ein langwieriger Prozess, aber wir wollen<br />
daran Stück für Stück arbeiten.<br />
Wir haben auch viele andere Maßnahmen ergriffen.<br />
Zum Beispiel kaufen wir bei der Neuinstallation von<br />
Anlagen oder beim Umbau von Motoren anders ein, legen<br />
großen Wert auf das Thema Lärm und berücksichtigen<br />
das dementsprechend. – Dies zur Situation.<br />
(Schaubild: Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
– Anlage 1-11, S. 99)<br />
Jetzt kommt noch ein Ausblick zu den gesamten Gutachten<br />
und zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die stattgefunden<br />
hat. Am 30.11.2011 fand der Scopingtermin zu der<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung statt. Dies ist eine<br />
systematische Bewertung und Untersuchung nach klaren<br />
Vorgaben zur Umweltverträglichkeit des Verfahrens.<br />
Beteiligt waren daran die unterschiedlichsten Interessenverbände.<br />
Das geht vom Regierungspräsidium, die<br />
Gemeinden und Städte über den Landesnaturschutzverband,<br />
BUND, NABU bis hin zu den Fachgutachtern, die in<br />
diesem Scopingtermin die Aufgabe hatten, festzustellen,<br />
welche Untersuchungen in welchem Umfang stattfinden<br />
müssen.<br />
(Schaubild: Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
– Anlage 1-12, S. 99 )<br />
Auf dieser Folie sehen Sie die gesamte Umweltverträglichkeitsuntersuchung,<br />
den gesamten vereinbarten<br />
Umfang. Das geht von der Einbeziehung von Immissionen<br />
über die Betrachtung von Lärm und Schadstoffdepositionen<br />
bis hin zur Erfassung – das ist hier eine Besonderheit<br />
– der Hirschkäfer in unserer Region.
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
haben wir uns nach Rücksprache des Weiteren freiwillig<br />
dazu entschlossen, eine Immissionsvorbelastungsmessung<br />
zu machen. Eine Immissionsvorbelastungsmessung<br />
ist eine Messung der Immissionen, die in diesem Fall an<br />
den zwei Standorten Dürrenbüchig und Wössingen<br />
stattfindet und somit Fakten schafft.<br />
(Schaubild: Emissionsprognose – Anlage 1-13,<br />
S. 100)<br />
Die Emissionsprognose, d. h. das, was am Kamin als<br />
Emission gemessen wird, ist durch die TÜV-Gutachten der<br />
Organisation TÜV Süd durchgeführt worden. Es wurden<br />
hier die unterschiedlichen Brennstoffszenarien angesetzt<br />
und durchgerechnet. Das sind Maximalszenarien. Generell<br />
werden die ganzen Szenarien unter dem Gesichtspunkt<br />
„maximal“ durchgerechnet; auch die Emissionsprognose<br />
wurde so bearbeitet.<br />
Es geht darum, nicht die reellen Emissionen als Basis<br />
zu nehmen, wie ich gerade erwähnt habe. Wir haben z. B.<br />
bei 60 % Ersatzbrennstoff eine Genehmigung von Staubemissionen<br />
in Höhe von 20 mg/Nm³. Wir fahren hingegen<br />
die Anlage mit einem Wert unter 1 bis 2 mg/Nm³.<br />
Nicht diese 1 bis 2 mg/Nm³ werden angesetzt, sondern die<br />
Maximalwerte. Bei 100 % wären das 10 mg Staubemissionen.<br />
Mit diesen maximalen Werten werden diese Gutachten<br />
erstellt.<br />
Ergebnis dieser Gutachten war, dass alle Emissionswerte<br />
sicher und größtenteils auch deutlich unter den<br />
Grenzwerten eingehalten werden.<br />
(Schaubild: Immissionsvorbelastung – Anlage<br />
1-14, S. 100)<br />
Die Messungen der Immissionsvorbelastung haben,<br />
wie erwähnt, an zwei Standorten stattgefunden, einmal in<br />
Wössingen in der Bruchsaler Straße und zum Zweiten in<br />
Dürrenbüchig an der Dürrenbüchiger Straße. Es ist über<br />
eine Periode von neun Monaten gemessen worden – neun<br />
Monate deswegen, um die wärmeren, aber auch die<br />
kälteren Monate und somit beide klimatischen Bedingungen<br />
zu erfassen. Die Messpunkte wurden in einer gemeinsamen<br />
Begehung mit dem Regierungspräsidium,<br />
LUBW und den Gutachtern festgelegt und entsprechend<br />
durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Quecksilber,<br />
Dioxine und Furane deutlich unter den Grenz- und<br />
Zielwerten liegen. Auch das ist also ein sehr positives<br />
Ergebnis.<br />
(Schaubild: Immissionsprognose – Anlage<br />
1-15, S. 101)<br />
Zur Immissionsprognose. Die Immissionsvorbelastungsmessung<br />
zeigt die Ist-Situation; das wird real gemessen.<br />
Die Immissionsprognose, sprich: wie die Situation<br />
bei steigendem Brennstoffbedarf aussieht, wird rechnerisch<br />
ermittelt. Es sind sehr komplizierte Programme, die<br />
dort arbeiten, und sehr intensive Rechnungen, die dort<br />
durchgeführt werden müssen. Daher ist eine Erstellungs-<br />
Seite 12<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
dauer von bis zu sieben Monaten erforderlich, einfach weil<br />
der Aufwand sehr umfangreich ist. Hierin werden sowohl<br />
die Prognosewerte als auch die Vorbelastungswerte von<br />
der Immissionsvorbelastungsmessung berücksichtigt.<br />
Das Ergebnis auch dieser Immissionsprognose ist,<br />
dass die Gesamtbelastung für alle Parameter deutlich<br />
eingehalten wird.<br />
(Schaubild: Lärmgutachten – Anlage 1-16,<br />
S. 101)<br />
Das Lärmgutachten wurde durch den DEKRA-<br />
Umweltservice durchgeführt. Hier wurden wiederum die<br />
unterschiedlichen Szenarien durchgegangen. Man kam zu<br />
einer Erhöhung der Lkw-Anzahl um maximal vier Lkw pro<br />
Tag. Da andererseits unser Primärbrennstoff dann z. B.<br />
die Fluffmaterialien sein werden, wird unsere Anlage zum<br />
Mahlen des Petrolkoks weniger in Betrieb sein bzw.<br />
nahezu gar nicht. Bei der An- und Abfahrprozedur werden<br />
wir auf die fossilen Brennstoffe zurückgreifen.<br />
Insgesamt bedeutet das, dass die Mahlanlage weniger<br />
in Betrieb ist und damit eine weitere Reduktion der<br />
Lärmemissionen um ca. 0,3 dB(A) zu erwarten ist. Des<br />
Weiteren wird auch der innerbetriebliche Verkehr abnehmen,<br />
sodass keine Verschlechterung zu erwarteten ist.<br />
(Schaubild: Betrachtung: diffuse Staubemissionen<br />
- Anlage 1-17, S. 102)<br />
Diffuse Staubemissionen. Wir haben hier keine baulichen<br />
Maßnahmen, keine baulichen Änderungen der<br />
Anlage beantragt, sondern es werden lediglich die Brennstoffmengen<br />
geändert. Es werden die vorhandenen<br />
Anlagen genutzt, die gekapselt sind. Beim Tiermehl ist das<br />
komplett geschlossen: geschlossene Anlieferung, geschlossener<br />
Transport, geschlossene Lagerung.<br />
Wir werden durch die Reduzierung des Einsatzes von<br />
Petrolkoks eine Reduzierung des innerbetrieblichen<br />
Verkehrs und des Handlings mit diesem Material bekommen,<br />
sodass somit eine Verringerung diffuser Staubquellen<br />
zu erwarten ist.<br />
(Schaubild: Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
– Anlage 1-18, S. 102)<br />
Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung ist durch das<br />
Gutachterbüro AG.L.N in Blaubeuren durchgeführt worden<br />
und hat über einen Zeitraum von zwölf Monaten vom<br />
Scopingtermin bis zum Abschluss im November letzten<br />
Jahres gedauert. Es ist eine umfassende Bestandsaufnahme<br />
und Wirkungsanalyse durchgeführt worden. Das<br />
Ergebnis dieser Umweltverträglichkeitsanalyse, die, wie<br />
erwähnt, erstmalig hier am Standort Wössingen stattfand,<br />
ist, dass das Verfahren zusammenfassend als umweltverträglich<br />
einzustufen ist. – So weit zu den Gutachtern.<br />
(Schaubild: Information im Verfahren –<br />
Anlage 1-19, S. 103)<br />
Ich habe schon erwähnt: Wir haben uns für ein öffentliches<br />
Verfahren entschlossen, also dafür, dieses Verfahren<br />
mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu machen. Während
des Verfahrens haben wir hierauf sehr viel Wert gelegt.<br />
Wir haben immer den Dialog gesucht. Wir hatten Gespräche<br />
sowohl mit Politikern als auch mit persönlichen<br />
Interessenverbänden gesucht und geführt. Wir haben<br />
regelmäßig über unseren "Dialog" – das ist eine Zeitung,<br />
die vierteljährlich erscheint – über den Verlauf des Verfahrens<br />
und über die Situation der einzelnen Maßnahmen<br />
berichtet. Wir hatten ein Bürgertelefon eingerichtet.<br />
Außerdem haben wir – was ebenfalls sehr wichtig ist –<br />
regelmäßige Besichtigungen und regelmäßig Besucher im<br />
Werk. Im letzten Jahr waren es an die 700 Besucher, im<br />
Jahr davor sogar 1000 Besucher. Das ist für uns sehr<br />
hilfreich, damit wir verstehen: Was sind die Fragen, was<br />
sind die Themen? Auch für die Besucher ist es sehr<br />
hilfreich zu sehen: Wie funktioniert das? Was ist dort vor<br />
Ort? Wie stellt sich die Anlage dar?<br />
Ich möchte hier gerne noch einmal sagen: Kommen<br />
Sie vorbei, und nutzen Sie die Gelegenheit! Wir haben in<br />
unserer Zeitung "Dialog" hinten eine Karte aufgeklebt, wo<br />
man nur ein Kreuz machen muss bei "Interesse an einem<br />
Besuch". Sie werden dann von uns angesprochen, dass<br />
Sie bei der nächsten Möglichkeit unser Werk besichtigen<br />
können.<br />
(Schaubild: Zusammenfassung – Anlage 1-20,<br />
S. 103)<br />
Zusammenfassend möchte ich noch einmal erwähnen:<br />
Das Verfahren ist wichtig für die nachhaltige und zukunftsorientierte<br />
Entwicklung und für die Wettbewerbsfähigkeit<br />
des Standorts Wössingen. Es ist ein besonderes<br />
Verfahren für uns, da erstmalig eine Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
und eine Emissionsvorbelastungsmessung<br />
durchgeführt wurden.<br />
Wir werden mit diesem Verfahren sowohl eine weitere<br />
Reduktion der CO2-Emissionen und eine Schonung<br />
natürlicher Ressourcen schaffen als auch strengere<br />
Grenzwerte im Bereich NOX, SO2 wie auch Staub bekommen.<br />
Die UVP hat ergeben, dass es als ein als umweltverträglich<br />
einzustufendes Verfahren zu sehen ist. – Danke<br />
schön von meiner Seite.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke schön, Herr Weber. – Bitte, wir sind ja zum Erörtern<br />
hier.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ich habe eine Verständnisfrage zur Folie 13.<br />
(Schaubild: Emissionsprognose – Anlage 1-13,<br />
S. 100)<br />
Da steht: „Bei allen Szenarien liegen die Emissionswerte<br />
sicher und größtenteils deutlich unter den Grenzwerten.“<br />
Bezieht sich das "größtenteils" auf das "deutlich" oder<br />
"unter den Grenzwerten"? Heißt es „größtenteils unter den<br />
Grenzwerten“ – dann wären sie nämlich ab und zu über<br />
den Grenzwerten –, oder bezieht es sich auf „deutlich“?<br />
Seite 13<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Es bezieht sich auf „deutlich“.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Gut. Vielen Dank noch einmal.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Dann wären wir an dem Punkt, wo wir in die Erörterung<br />
der Einwendungen einsteigen können.<br />
IV. Erörterung der Einwendungen<br />
IV. 1. Klimaschutz/Energiekonzept<br />
Die Tagesordnung sieht vor, dass wir nach einem<br />
Fahrplan vorgehen. An erster Stelle steht das Thema<br />
Klimaschutz und Energiekonzept. Dazu gehört auch der<br />
Einsatz von Gas zur Erreichung der Luftreinhalte-<br />
und Klimaschutzziele der EU.<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Würden Sie bitte einmal meine Folien aufwerfen?<br />
(Schaubild: Antrag der Firma Lafarge Zement<br />
Wössingen GmbH – Anlage 2-1, S. 104)<br />
Wir haben ein Problem vorweg: Wir sind in einem Verfahren<br />
nach § 16 BImSchG. Dies als Erweiterung des Einsatzes<br />
von Sekundärbrennstoffen zu bezeichnen ist eine<br />
Verharmlosung, ist ein Euphemismus.<br />
Wir sprechen hier heute über eine Müllverbrennungsanlage.<br />
Zu 100 % wird Müll eingesetzt. Da ergibt sich für<br />
uns die Frage: Sehen Sie diese Anlage als Anlage zur<br />
Verwertung oder zur Entsorgung? Diese Frage wollen wir<br />
vorweg geklärt haben, bevor wir weiter einsteigen. Was für<br />
eine Anlage ist das hier?<br />
Die zweite Frage: Wo finde ich dies im Abfallgesetz<br />
des Landes <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> oder im Kreislaufwirtschaftsgesetz<br />
wieder? Die Anlage muss ja irgendwo<br />
angegeben sein. Wo finde ich das?<br />
Also erste Frage: Ist das eine Anlage zur Entsorgung<br />
oder zur Verwertung? Was ist das für eine Anlage?<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Zunächst zu Punkt 1: Wir sind ein Zementhersteller. „Zu<br />
100 % Mülleingang“ ist nicht richtig. 90 % unserer Materialien,<br />
die eingehen, sind Rohstoffe. Das sind Materialien<br />
zur Herstellung eines Zementes. Wir haben ein Verfahren,<br />
das für die Herstellung thermisch-energetische Brennstoffe<br />
braucht. Das ist keine Müllverbrennungsanlage.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir betrachten dies als Müllverbrennungsanlage. Das ist<br />
eine Entsorgung von Müll. Deswegen betrachten wir alle<br />
Werte, die hier erörtert werden, unter diesem Gesichtspunkt.<br />
– Erster Punkt.
Zweiter Punkt. Sowohl der Verwaltungsgerichtshof<br />
Mannheim als auch der EuGH haben diesem Punkt der<br />
Verwertung oder der Entsorgung erhebliche Bedeutung<br />
beigemessen.<br />
Für die Entsorgung z. B. von Altreifen gibt es spezifische<br />
Anlagen, die darauf ausgerichtet sind, z. B. Ludwigshafen.<br />
Wir sind der Ansicht, da gehört es auch hin. Denn<br />
die haben ganz andere Verbrennungsmethoden. Das<br />
haben Sie nicht erwähnt, aber es ist vielleicht ganz amüsant:<br />
Müllverbrennungsanlagen sind normalerweise<br />
Wirbelschichtöfen. Das sind völlig andere Konzeptionen,<br />
weil sie ganz andere Aufgaben haben als hier.<br />
Beim Fluff – das ist der größte Bluff dabei – wissen Sie<br />
gar nicht, was das ist. Im Prinzip ist es Hausmüll. Die<br />
Frage ist: Ist er als solcher noch erkenntlich? – In dem<br />
Fluff nicht mehr, aber vorher sicher. Die Maßgabe, die das<br />
RP prüfen muss, ist doch: Haben wir es hier eigentlich mit<br />
dem Abfallwirtschaftsgesetz zu tun? Wird hier Abfall – ich<br />
sage es rechtlich sicherlich falsch – sozusagen "illegal"<br />
auf einem falschen Weg entsorgt?<br />
Ich weise einmal auf das Bundesverwaltungsgerichtsurteil<br />
vom 26.04.2007 hin, Aktenzeichen 7 C 7.06. Das ist<br />
wichtig bei dieser Anlage und ist zu beachten. Deswegen<br />
dieses Vorwort. –<br />
(Verhandlungsleiter Bernd Haller und Wolfgang<br />
Schilling [RP Karlsruhe] besprechen<br />
sich leise.)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Machen Sie ruhig weiter.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Schilling, wenn Sie es beantworten können, wäre mir<br />
das recht. Das wäre natürlich toll, wenn Sie mir sofort<br />
sagen: Das ist diese oder jene Anlage. Das wäre schon<br />
toll.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vorher hat sich aber Lafarge zu Wort gemeldet.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Ich würde gerne zu Ihren Ausführungen ganz kurz meinen<br />
Standpunkt herüberbringen. Sie haben die Frage gestellt:<br />
Verwertung oder Beseitigung?<br />
Es ist völlig klar, dass das Zementwerk grundsätzlich<br />
eine Verwertung darstellt. Wenn Sie einen Blick in das<br />
Kreislaufwirtschaftsgesetz werfen und die einzelnen<br />
Stufen anschauen, erkennen Sie, dass das dort sehr<br />
schön beschrieben ist. Als Grundgedanke steckt dahinter,<br />
die anfallenden Abfälle in Deutschland nach der entsprechenden<br />
Hierarchie so weit wie möglich zu verwerten und<br />
erst ganz am Schluss – das kennen Sie –, in der fünften<br />
Stufe, wenn es nicht mehr anders geht, sie zu beseitigen.<br />
Wenn Sie sagen, da wird im Zementwerk einfach Müll<br />
verbrannt – „Hausmüll“ haben Sie gesagt –, dann muss<br />
ich ganz klar erwidern: So ist das nicht richtig.<br />
Seite 14<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Schauen Sie sich einmal die Prozesse an, die der<br />
Brennstoff durchläuft, bevor er im Zementwerk ankommt!<br />
Da gibt es einen wesentlichen Unterschied zu dem, was<br />
Sie mit Beseitigung, mit Müllverbrennung meinen. Da sind<br />
ganz andere Qualitätsstandards gesetzt. Es gibt auch nur<br />
sehr wenige, die hier in Deutschland diese Qualitätsstandards<br />
einhalten können und mit denen wir zusammenarbeiten.<br />
Ein großer Eigenanteil der von uns eingesetzten<br />
Brennstoffe entsteht z. B. aus Materialien, die aus dem<br />
DSD-System herauskommen. Sie kennen das DSD. Wir<br />
alle sind stolz darauf, wie gut wir in Deutschland unseren<br />
Müll trennen und weiterverarbeiten. Dort wird dafür gesorgt,<br />
dass die Rohstoffe zu einem sehr hohen Anteil dem<br />
Recycling zugeführt werden. Nur der letzte Rest, der in<br />
keiner Weise mehr recycelbar ist, steht dann gemäß dem<br />
Kreislaufwirtschaftsgesetz der thermischen Verwertung<br />
zur Verfügung.<br />
Das ist einer der wesentlichen Träger unseres hochwertigen<br />
Brennstoffs. Wir reden nicht davon, dass wir<br />
irgendwelchen Müll mit einem Heizwert zwischen 5 und 8<br />
Megajoule, wie es üblicherweise in den Müllverbrennungsanlagen<br />
gewünscht wird, annehmen und einfach<br />
verbrennen. – Das von meiner Seite. Danke.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Ganz generell, Herr Block: Beantworten kann ich Ihnen<br />
Ihre Frage jetzt nicht, und zwar aus einem ganz einfachen<br />
Grund: Wenn Sie mir heute ein Datum und das Aktenzeichen<br />
eines Urteils nennen, kann ich mir das nicht durchlesen.<br />
Sie müssen mir schon gestatten, dass ich das tue.<br />
Wir werden uns damit selbstverständlich auseinandersetzen.<br />
Dafür haben wir heute die Erörterungsverhandlung,<br />
damit wir das dann mitnehmen.<br />
Nur eines ganz generell: Ob Sie das jetzt als Beseitigungs-<br />
oder Verwertungsanlage ansehen, ist nicht das<br />
Maßgebliche. Maßgeblich ist, ob die Anforderungen, die<br />
im Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgeführt sind, insbesondere<br />
nach R 1 der Anlage 2 zu dem Gesetz, erfüllt sind.<br />
Genau das werden wir zu bewerten haben.<br />
Einem darf ich beipflichten, was hier eben gesagt wurde:<br />
Von Hausmüll als Einsatzstoff reden wir bei dieser<br />
Anlage nicht. Das geht aus den Antragsunterlagen hervor,<br />
die Ihnen sicher vorlagen. Eine Hausmüllverbrennungsanlage<br />
ist etwas anderes. Ich nehme an, dass Sie so eine<br />
schon einmal besichtigt haben, vielleicht in Mannheim<br />
oder sonst wo.<br />
Dann haben Sie uns vorhin gefragt, ob die Anlage im<br />
Landesabfallgesetz für <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> erwähnt ist.<br />
Sagen Sie mir bitte, wo dort im Landesabfallgesetz Abfallanlagen<br />
aufgezählt sind! Ich finde da keine einzige. Da<br />
sind die gesetzlichen Grundlagen, aber da ist kein Verzeichnis<br />
der zugelassenen Anlagen. Sind wir uns darin<br />
einig?
(Harry Block [BUND]: Ja, ja, schwerer Mangel!)<br />
Sie sagten vorhin, ich solle Ihnen sagen, wo das im<br />
Gesetz steht. Da steht keine einzige Anlage. Das kann<br />
auch nicht Gegenstand eines Gesetzes sein. Ein Gesetz<br />
enthält abstrakt generelle Regelungen, nach denen zu<br />
beurteilen ist, ob eine Anlage zugelassen werden kann<br />
oder nicht, und ähnliche Vorschriften. In Gesetzen finden<br />
Sie keine Auflistung von genehmigten Anlagen – in<br />
keinem Gesetz. Das ist nicht die Aufgabe eines Gesetzes.<br />
Es schafft die Grundlage für die Beurteilung der Zulassung.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Es geht ja um die Ausführung dieses Gesetzes, und das<br />
ist der Abfallwirtschaftsplan des Landes <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong>. Dort müsste es irgendwo aufgeführt sein,<br />
wenn es eine Anlage zur Entsorgung wäre. Er sagt ja, das<br />
sei sie nicht.<br />
Ich sage Ihnen einmal etwas zum Fluff; wir haben bei<br />
Fluff einmal nachgelesen. Sie haben gesagt, das sei<br />
industrieller Müll. Wir kommen nachher noch in einem<br />
eigenständigen Punkt dazu. Da war auch Sperrmüll<br />
aufgeführt. Was ist Sperrmüll anderes als Hausmüll? Das<br />
ist eine Hausmüllsammlung.<br />
Gucken Sie sich an, was in der Industrie an Industriemüll<br />
anfällt. Was ist Industrie? Ist das auch Gewerbe und<br />
Handel? Gucken Sie bei Karstadt in Karlsruhe herein: Das<br />
ist Hausmüll.<br />
Wir kennen Sortieranlagen. In Karlsruhe am Rheinhafen<br />
ist die größte hier in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Wir wissen,<br />
was die Reste sind. Der Rest ist Müll, nichts anderes als<br />
Müll. Natürlich wäre er mit geeigneten Maßnahmen noch<br />
weiter recycelbar. Das ist eine Frage des Geldes: Wie viel<br />
stecke ich in eine solche Anlage hinein?<br />
Ein anderes Thema ist die Zertifizierung. Sie haben<br />
hier in den Unterlagen einen Hamburger Betrieb angeführt.<br />
Den haben auch wir uns angeguckt. Sie wissen alle,<br />
was zertifiziertes Fleisch ist. Sie haben es ja jetzt in Ihrer<br />
Lasagne gehabt. Alles zertifiziert! – Also, wir glauben hier<br />
kein Wort, wenn wir es nicht sehen.<br />
Nur eines ist sicher: Dem Fluff sehen Sie nicht mehr<br />
an, was für ein Müll es ist. Das ist zugegebenermaßen der<br />
Trick bei der Geschichte.<br />
Für uns ist dies – das sage ich Ihnen klar – eine Anlage<br />
zur Verwertung und gehört nach dem Gesetz eigentlich<br />
in den Abfallwirtschaftsplan des Landes <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong>. Da ist es nicht drin. Wir haben hier eine<br />
neue Müllverbrennungsanlage vor Ort. So sehen wir das.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, danke für Ihren Standpunkt. – Der Punkt 1<br />
unserer Tagesordnung sieht das Thema Gaseinsatz vor.<br />
Seite 15<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Mir wäre es sehr recht, wenn wir uns an diese Tagesordnung<br />
halten würden. Wir kommen nachher noch einmal zu<br />
dem Thema der Ersatzbrennstoffe und speziell zum<br />
Thema Fluff.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Wiedenmann ist mein Name, ich bin Mitglied der Bürgerinitiative<br />
Müll und Umwelt Karlsruhe.<br />
Angesprochen wurde von Ihnen das Thema Energiekonzept<br />
und Klimaschutz. Herr Weber ist so stolz auf<br />
seine CO2-Bilanz. Ich habe in den Unterlagen eigentlich<br />
nichts über die CO2-Emissionen des Zementwerks finden<br />
können. Ich habe mich dann eigenständig kundig gemacht<br />
und habe einmal die CO2-Emissionen, die ein Zementwerk<br />
emittiert, mit den CO2-Emissionen des neuen Kohlekraftwerks<br />
in Karlsruhe verglichen. Pro Megawatt Feuerungswärmeleistung<br />
emittieren Sie etwa 11 % mehr CO2 als<br />
dieses moderne Kohlekraftwerk. Das heißt, Ihre Bilanz ist<br />
jetzt, wenn man das klimatechnisch sieht, wesentlich<br />
schlechter als ein Kraftwerk, das reine Kohle verbrennt.<br />
Sie würden also von der Klimatechnik her der Umwelt<br />
Besseres antun, wenn Sie Kohle verbrennen würden.<br />
Bei Ihnen kommt zusätzlich hinzu, dass schon bei der<br />
Herstellung der Stoffe, die Sie verbrennen, sowohl bei<br />
Dachpappe als auch Reifen als auch Fluff, CO2-<br />
Emissionen angefallen sind. Das heißt, es ist wesentlich<br />
mehr.<br />
Sie könnten doch jetzt Gas einsetzen. Wir wissen aus<br />
den Bilanzen von Karlsruhe, dass ein modernes Gaskraftwerk,<br />
verglichen mit einem Kohlekraftwerk, etwa die<br />
Hälfte CO2 emittiert.<br />
Das, was Sie mit Ihrem Verbrennungskonzept als<br />
Nachhaltigkeit für Ihren Standort Wössingen bezeichnet<br />
haben, ist nichts anderes als eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit<br />
für Ihre Firma. Aber für die Umweltbilanz und für die<br />
Bevölkerung ist das kontraproduktiv. Sie machen genau<br />
das Gegenteil.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Mein Name ist Martin Oerter, ich komme vom Forschungsinstitut<br />
der Zementindustrie aus Düsseldorf.<br />
Gestatten Sie mir eine Korrektur vorweg: In der Form,<br />
wie Sie die CO2-Emissionen des Zementwerkes mit denen<br />
des Kohlekraftwerkes vergleichen, haben Sie möglicherweise<br />
übersehen, dass zwei Drittel des CO2 tatsächlich<br />
aus der Entsäuerung des Rohmaterials stammt. Sprich:<br />
Die Zementindustrie ist ein wesentlicher Emittent von<br />
CO2-Emissionen; das ist bekannt. Aber ca. zwei Drittel der<br />
CO2-Emissionen kommen aus dem natürlichen Kalkstein.<br />
Die sind also überhaupt nicht zu vermeiden, egal mit<br />
welcher Energie Sie den Ofen betreiben.<br />
Es ist tatsächlich so, dass Sie die brennstoffbedingten<br />
fossilen CO2-Emissionen durch den Einsatz der Sekundärbrennstoffe<br />
nachhaltig mindern. Das hängt damit
zusammen, dass da eine gewisser Anteil an biogenen<br />
Kohlenstoffverbindungen enthalten ist. Deswegen führt<br />
das letztlich zu einer Reduktion der fossilen CO2-<br />
Emissionen.<br />
Ein zweiter Punkt. Sie haben angesprochen, dass<br />
auch die eingesetzten Sekundärbrennstoffe aufgrund des<br />
Herstellungsprozesses einen gewissen CO2-Rucksack<br />
tragen. Auch die Kohle, selbst das Gas muss gefördert<br />
werden und hat eine gewisse Vorkettenbelastung.<br />
Letztlich reden wir hier über die Verwertung der Sekundärbrennstoffe,<br />
Herr Block. Das ist mir ganz wichtig.<br />
Es ist ein Verwertungsprozess, der hier stattfindet, und<br />
das ist eine unmittelbare Substitution der primären Ressourcen,<br />
die eben nicht aus der Erde hervorgeholt werden<br />
müssen, die nicht transportiert werden müssen, die nicht<br />
aufbereitet werden müssen.<br />
Letztlich führt dieser Einsatz der Sekundärbrennstoffe<br />
dazu – das ist im Übrigen ein Konzept der gesamten<br />
deutschen und der europäischen Zementindustrie –, dass<br />
wir einen Industrieprozess aufrechterhalten können und<br />
gleichzeitig, wenn ich die Gesamtbetrachtung anstelle,<br />
Emissionen mindern.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Dr. Wiedenmann sprach das Energiekonzept an, ich<br />
fange noch ein Stück weiter vorne an.<br />
Wir betrachten bei Erörterungsterminen grundsätzlich<br />
nie nur die einzelne Anlage. Das ist für Sie bedauerlich,<br />
aber für uns ist es eine Notwendigkeit. Wir sind hier in<br />
einem Raum –später reden wir ja über die Immissionen –,<br />
und Sie sind sicherlich nicht für die Gesamtimmissionen<br />
dieses Raums zuständig. Das ist klar.<br />
(Schaubild: Beschluss der EU-Kommission<br />
– Anlage 2-2, S. 104)<br />
Jetzt gab es im Februar eine EU-Entscheidung, die für<br />
die Region Karlsruhe extrem wichtig ist. Die EU hat<br />
angeordnet, dass in 51 Regionen der Bundesrepublik<br />
Deutschland die dort geltenden Ausnahmeregelungen<br />
gestrichen werden, und zwar deswegen – jetzt kommt ein<br />
Vorwurf an die Landesregierung oder sogar an die RPs –,<br />
weil zu wenig gemacht wird, um die Luftqualitätsrahmen<br />
der EU einzuhalten.<br />
Darum hat der Kommissar, der dafür zuständig ist, angeordnet,<br />
dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid – um<br />
den geht es beispielsweise – nicht beibehalten wird, weil<br />
die Bundesrepublik Deutschland das gesteckte Ziel am<br />
1. Januar 2015 nicht erreichen wird. Explizit erwähnt ist<br />
die Region Karlsruhe.<br />
Daran sind nicht Sie schuld, sondern schuld daran<br />
sind natürlich andere, nämlich die:<br />
(Schaubild: Vorbelastungen im Raum KA –<br />
Anlage 2-3, S. 105)<br />
Seite 16<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wir haben zwei Kohlekraftwerke mit 1500 MW, ein Gaskraftwerk,<br />
wir haben die Papierfabrik Stora Enso – die hat<br />
Kohle und Müll, im Augenblick noch 60 %, demnächst<br />
wahrscheinlich auch 100 % –, wir haben MiRO mit einer<br />
Heizleistung von 1700 MW. Wir waren letzte Woche bei<br />
der MiRO. Das ist so groß wie die zwei Kohlekraftwerke<br />
hier zusammen. Wir haben 200.000 t Klärschlammverbrennung<br />
in Karlsruhe, wir haben zwei Heizkraftwerke in<br />
der Stadt Karlsruhe und noch einen ganzen Haufen mehr.<br />
All das diffundiert in unseren Raum.<br />
(Schaubild: Luftbild Karlsruhe - Walzbachtal<br />
– Anlage 2-4, S. 105)<br />
Sie sehen hier rechts Walzbachtal, und Sie sehen die<br />
Emittenten. Die Entfernung dazwischen ist etwa 15 km.<br />
Die Hauptwindrichtung geht im Bild von vorne links nach<br />
rechts, also Südwest. Das ist die Hauptwindrichtung. Dank<br />
der Hochschornsteinpolitik, die halt gemacht wurde –<br />
230 m sind die Kamine der Anlagen der Energie <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong> und zwischen 110 und 180 m die von der<br />
MiRO –, diffundieren diese Emittenten genau in unseren<br />
Raum. Deswegen haben wir eine hohe Immissionsvorbelastung.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ein Bitte: Wir haben eine Tagesordnung, einen<br />
Fahrplan gemacht.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Die Tagesordnung ist bei Kohlendioxid.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Halt! Ich wollte Sie nur darauf hinweisen: Nachher kommt<br />
der große Punkt Emission/Immission. Mir wäre es ganz<br />
wichtig, dass wir das konkrete Thema des Brennstoffs<br />
Gas im Zusammenhang mit CO2 unter diesem Tagesordnungspunkt<br />
abhandeln. Das hat im Ansatz auch schon<br />
stattgefunden. Das, was Sie jetzt ansprechen, kommt<br />
entsprechend unserer Tagesordnung, die Sie vielleicht<br />
noch nicht ganz angeschaut haben, an einer anderen<br />
Stelle.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, wenn man in ein Thema einsteigt und etwas<br />
punktuell betrachtet, wird es falsch. Ich will der Firma<br />
Lafarge nichts unterstellen. Deswegen habe ich absichtlich<br />
das Vorspiel gemacht, um zu sagen: Ihr seid nicht<br />
schuld dran, was da alles passieren kann und passieren<br />
wird. Nachher kommen dann die Argumente.<br />
Ich gehe jetzt gerne auf Sie ein und bleibe bei CO2.<br />
(Schaubild: Quelle Bundesumweltamt: Anstieg<br />
der CO2-Emissionen – Anlage 2-5, S.<br />
106)<br />
Hier sehen Sie die Anstiege der CO2–Emissionen. In der<br />
Bundesrepublik Deutschland bekommen wir jetzt zwei<br />
Kohlekraftwerke hinzu, eins in Karlsruhe, das noch nicht<br />
emittiert, also noch kein CO2 ausstößt. Ich brauche Ihnen
nicht zu zeigen, wie das global aussieht; wir brauchen<br />
darüber nicht zu diskutieren. Es geht um CO2.<br />
(Schaubild: Kohlendioxidvergleich Gaskraftwerk/<br />
Kohlekraftwerk – Anlage 2-6, S. 106)<br />
Hier habe ich die Zahlen von Karlsruhe: Das Gasturbinenkraftwerk<br />
hat 450 MW mit 1,5 Millionen Tonnen CO2<br />
pro Jahr, das neue Kohlekraftwerk hat 940 MW und<br />
6 Millionen Tonnen pro Jahr. Hier sehen Sie den Kohlendioxidvergleich:<br />
Ein Gaskraftwerk emittiert die Hälfte<br />
Kohledioxid im Vergleich zum Kohlekraftwerk.<br />
(Schaubild: CO2-Emissionen verschiedener<br />
Brennstoffe – Anlage 2-7, S. 107)<br />
Dann gab es die Frage der Ersatzbrennstoffe. Da sehen<br />
Sie die Tabelle der verschiedenen CO2-Ausstöße, die<br />
es gibt. Die Steinkohle ist in der Tat schlechter – oder<br />
besser, je nachdem, wie man das sieht. Unten haben Sie<br />
den Sekundärbrennstoff, den Sie benutzen. Sie sehen,<br />
dass die CO2-Bilanz bei Sekundärbrennstoffen eindeutig<br />
schlechter ist als bei Steinkohle.<br />
Sie sehen hier auch das Erdgas. Wenn Sie Erdgas<br />
benutzen, ist das CO2-Problem wirklich reduziert. Das<br />
betrifft jetzt nur das CO2; wir kommen nachher noch zu<br />
den anderen Stoffen. Das CO2 würde so massiv reduziert,<br />
würden Sie Gas benutzen.<br />
Ich sage Ihnen noch etwas: Für Sie ist dieser Sekundärbrennstoff<br />
natürlich kostengünstig zu bekommen. Es<br />
wird immer gesagt, Gas sei so teuer. Wir waren letzte<br />
Woche bei den Raffinerien. Gas ist zurzeit billiger als<br />
Kohle und Erdöl und wird es bleiben. Das hat mit Fracking<br />
zu tun in den Vereinigten Staaten, international und<br />
überhaupt. Aber Gas ist im Augenblick kostengünstiger als<br />
alle anderen fossilen Energieträger.<br />
Gas hat eben diesen geringeren Ausstoß von CO2.<br />
Gehen wir einfach von der Hälfte eines Kraftwerks aus –<br />
wir haben es jetzt nicht heruntergerechnet –: Es ist ein<br />
Viertel von Ihrem Ersatzbrennstoff – ein Viertel! – bei den<br />
Mengen, die Sie abgeben.<br />
Deswegen haben wir gesagt: Wir wollen Gas, und<br />
zwar nur aus einem Grund: CO2. Ich zeige es Ihnen<br />
nachher bei Stickoxiden, ich zeige es Ihnen bei Feinstäuben,<br />
ich zeige es Ihnen bei jedem anderen Punkt ganz<br />
genauso. Gegen diese Tabelle können Sie nicht an.<br />
(Schaubild: Emission Gaskraftwerk/ Kohlekraftwerk<br />
– Anlage 2-8, S. 107)<br />
Hier sehen Sie: Kohle und Müll emittieren pro Kilowattstunde<br />
750 g CO2, Gas nur 365 g CO2.<br />
Das heißt, Ihr Energiekonzept ist aus der Sicht des<br />
Kohlendioxids, des weltweiten Klimaschutzes und der<br />
Verantwortung, die wir erstens gegenüber der Europäischen<br />
Union und zweitens gegenüber der Welt haben,<br />
nicht verantwortbar. Deswegen sind wir für Gas.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Block.<br />
Seite 17<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Wenn Sie gestatten, zunächst eine persönliche Bemerkung:<br />
Ich finde es bemerkenswert, dass Sie ausgerechnet<br />
das Fracking zitieren, um letztlich den Brennstoff Gas als<br />
besonders günstig darzustellen. Abgesehen davon ist das<br />
eine Technologie, die sich bei uns derzeit noch in einer<br />
gewissen Diskussion befindet.<br />
Herr Block, Sie sagten, gegen die Tabelle kommt man<br />
nicht an. Dazu muss ich Ihnen ganz offen sagen: Ich kann<br />
diese Werte so nicht nachvollziehen. Insbesondere beim<br />
Ersatzbrennstoff sind die biogenen Anteile offensichtlich<br />
nicht berücksichtigt worden. Wir können uns gerne nachher<br />
in der Pause die Werte aus den offiziellen DEHSt-<br />
Dokumenten anschauen.<br />
Noch etwas zum Thema CO2, ohne den aktuellen Betrieb<br />
der Anlage in Wössingen irgendwie in Frage zu<br />
stellen: Insbesondere der Regelbrennstoff Petrolkoks<br />
zeichnet sich durch einen hohen CO2-Emissionsfaktor<br />
aus. Das heißt, Sie haben durch die Substitution des<br />
Petrolkoks durch die entsprechend geeigneten Ersatzbrennstoffe<br />
eine besonders hohe Minderung der spezifischen<br />
CO2-Emissionen, die durch die Brennstoffe hervorgerufen<br />
werden.<br />
(Anlage 3: CO2-Minderung durch den Einsatz<br />
alternativer Einsatzstoffe, S. 118)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Sie können nicht Krebs mit Cholera vergleichen. Ich<br />
vergleiche das mit etwas Gesünderem: mit Gas, nicht mit<br />
Petrolkoks. Für uns ist das eine wesentliche Änderung<br />
dieser Anlage. Sie gehen auf 100 % zu. Dann wäre es<br />
interessant zu wissen: Was nehmen Sie für die 100 %?<br />
Wir sagen Ihnen: Bei CO2 ist das so. Diesen Wert hier,<br />
die Tabelle, habe ich von der LUBW. Woher die sie<br />
haben, weiß ich nicht. Aber die haben das ja nicht zum<br />
Spaß da hineingeschrieben.<br />
Das Bundesumweltministerium und das Landesumweltministerium<br />
weisen darauf hin, dass, wenn Ersatzbrennstoffe<br />
eingesetzt werden, keine wesentliche Minimierung<br />
eintritt. Und sie sagen, bei CO2 und bei Stickoxiden<br />
kann das garantiert nicht eintreten. Das sagen beide<br />
unabhängig voneinander.<br />
Die Tabelle habe ich nicht erfunden, ich habe sie nicht<br />
gemacht, sondern ich habe sie nur übernommen. Und die<br />
stimmt. Das ist ein zertifizierter Ersatzbrennstoff. Das ist<br />
jetzt aus NRW gewesen. Aber in Nordrhein-Westfalen sind<br />
die Zertifizierung des Fluffs und der zertifizierte Brennstoff<br />
genauso wie in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>, denke ich.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Eine kurze Nachfrage von meiner Seite, Herr Block, damit<br />
es klar wird: Vorhin hieß es, die Tabelle wäre von der<br />
LUBW, jetzt war sie aus NRW.
(Harry Block [BUND]: Nein, der Ersatzbrennstoff!)<br />
- Der ist aus NRW. Aber diese Tabelle war von der<br />
LUBW?<br />
(Harry Block [BUND]: Aber diese Zertifizierung<br />
war in NRW!)<br />
Aber die LUBW kann zu der Tabelle nichts sagen? – Gut.<br />
Wäre jetzt schön gewesen.<br />
(Harry Block [BUND]: Sie haben sie ja!)<br />
Danke für die Erläuterung. – Herr Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich will jetzt diese Diskussion nicht fortführen, Herr Block,<br />
weil ich nicht glaube, dass sie zielführend ist. Aber es ist<br />
eindeutig belegbar, dass der Einsatz von sekundären<br />
Brennstoffen, so wie er hier beantragt ist, zu einer Minderung<br />
der brennstoffspezifischen CO2-Emissionen führt.<br />
Das gilt auch für den Standort Wössingen. Das ist so, und<br />
das kann ich Ihnen vorrechnen. Vielleicht können wir uns<br />
nachher in der Kaffeepause auch Zahlen von der DEHSt<br />
anschauen, der Deutschen Emissionshandelsstelle, die<br />
zumindest für die Braunkohle etwas andere Emissionsfaktoren<br />
angibt als die, die dort in der Tabelle sind.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, von unserer Seite noch eine Bitte: Die Tabelle<br />
kennen wir; die haben Sie im Rahmen Ihrer Einwendung<br />
auch schriftlich eingereicht. Hilfreich wäre jetzt nach der<br />
letzten Diskussion, wenn Sie uns die Quelle noch nachliefern,<br />
um die Tabelle als solche nachzuvollziehen, um<br />
nachzuvollziehen: Wo kommt sie her? Welche Stoffe sind<br />
berücksichtigt? Das ist, denke ich, für Sie kein großer<br />
Aufwand und für uns durchaus hilfreich. – Herr Weber<br />
noch einmal kurz.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Die Wirtschaftlichkeit von Gas wurde noch angesprochen.<br />
Ich würde gerne wissen, welche Kohle billiger ist als Gas.<br />
Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Wenn ich die<br />
Preise in Euro pro Gigajoule betrachte, wundert es mich,<br />
dass Sie Zahlen haben, dass Kohle günstiger sei als Gas.<br />
Das kann ich nicht so sehen.<br />
Die Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiges Thema, ohne<br />
Frage. Ein Einsatz von Gas würde eine signifikante<br />
Erhöhung der Kosten zur Folge haben. Die Preise, die wir<br />
für Gas zu entrichten haben, würden uns vollständig<br />
unwirtschaftlich machen, weil dann die Produktionskosten<br />
enorm ansteigen würden.<br />
Außerdem ist Kohle ist ein fossiler Brennstoff – das ist<br />
ebenfalls ein wichtiges Thema für uns –, den wir schonen<br />
wollen. Das ist eines unserer Ziele, die wir erreichen<br />
wollen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block<br />
Seite 18<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Oerter, ich hab nicht für das Fracking geredet, um<br />
Gottes willen! Die Gaspreise sind natürlich international.<br />
Ich war letzte Woche mit noch zwei anderen bei der<br />
MiRO. Dr. Löhr, der Chef der Raffinerie, redet nicht von 3<br />
m³ Gas, sondern der hat 1700 MW. Der verbrennt kein Öl,<br />
weil das zu teuer ist, sondern der nimmt Gas.<br />
Die Papierfabrik Palm oder das Heizkraftwerk von<br />
Daimler-Benz – vor 14 Tagen in Rheinland-Pfalz eröffnet;<br />
einmal 20 km, einmal nur 100 m über den Rhein – nehmen<br />
beide Gas, während man in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> bei<br />
Stora Enso Müll nimmt. Wir haben die gefragt, warum sie<br />
Gas nehmen, wenn Gas so teuer ist. – Das ist immer das<br />
Argument.<br />
Dann ist die Frage, von wem man das Gas bezieht.<br />
Bezieht man es von der Energie <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> oder<br />
von Gazprom? Auch bei Ihnen stellt sich die Frage: Von<br />
wem beziehen Sie das? Beim Gas kann man wechseln.<br />
Wir haben ja gesehen: 200 m weiter in Dürrenbüchig liegt<br />
eine Gasleitung.<br />
Wir haben uns erkundigt. Dr. Löhr hat das gesagt; Sie<br />
können nachfragen. Das ist so bei dem Gaspreis, der im<br />
Augenblick da ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Block. – Ich hätte in diesem Zusammenhang<br />
eine Frage an Herrn Dr. Oerter. Sie haben ja Kenntnis<br />
über Zementwerke bundesweit und, wenn auch nicht<br />
weltweit, doch wohl europaweit. Wie häufig ist aus Ihrer<br />
Sicht Gas bei Zementwerken im Einsatz?<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Vorneweg: Im Schnitt gut 60 % der Brennstoffenergie in<br />
deutschen Zementwerken werden schon jetzt durch diese<br />
aufbereiteten Ersatzbrennstoffe generiert.<br />
Wir reden über knapp 40 % Regelbrennstoffeinsatz,<br />
und das ist im Wesentlichen eine Mischung aus Steinkohle,<br />
Braunkohle und Petrolkoks. Die Anteile verschieben<br />
sich je nach Verfügbarkeit der Materialien. Das ist letztlich<br />
im gesamten europäischen Raum so, wobei dort die<br />
Substitutionsrate noch ein bisschen niedriger ist.<br />
Ungefähr 20 % der Brennstoffenergie werden in Europa<br />
durch Abfälle – es sind rechtlich gesehen Abfälle,<br />
selbst wenn sie hochwertig aufbereitet werden – generiert.<br />
Ansonsten ist der Petrolkokseinsatz in Europa noch etwas<br />
höher als in der Bundesrepublik. Aber die Regelbrennstoffe<br />
bestehen im Wesentlichen aus Steinkohle, Braunkohle<br />
und Petrolkoks.<br />
Gas wird überwiegend eingesetzt, um die Öfen anzufahren,<br />
um die Öfen zu zünden. Mir ist kein einziger Fall<br />
innerhalb Europas bekannt, wo ein Zementdrehofen mit<br />
Gas als Brennstoff betrieben wird. Das ist im Übrigen in<br />
dem aktuellen BVT-Papier entsprechend dargelegt. Das<br />
ist erst im Mai 2010 revidiert worden. Ich denke, das<br />
kennen Sie; das ist ja im Internet verfügbar. Auch dort
kann man den europäischen Brennstoffmix sehr schön<br />
und sehr klar nachverfolgen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Letzte Woche stand in den BNN, dass Ihr Mitbewerber<br />
HeidelbergCement auf Gas umsteigt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Erst einmal möchte ich Herrn Dr. Oerter noch für die<br />
Information danken. – Herr Block, deswegen habe ich<br />
gefragt. Wir sind für die Zementwerke im Regierungspräsidium<br />
zuständig. Dazu zählt auch HeidelbergCement mit<br />
dem Werk in Leimen. Da sollten wir wissen, welche<br />
Brennstoffe sie einsetzen. Die setzen derzeit an dem<br />
Standort Leimen kein Gas ein. Welches Werk von HeidelbergCement<br />
meinten Sie? Können Sie das konkretisieren?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich habe es in den BNN gelesen. Wenn Lafarge das<br />
Ökomäntelchen, das Greenwashing benutzt, macht es<br />
HeidelbergCement natürlich auch. Es geht ja auch um<br />
Produktinhalte; dazu kommen wir nachher noch. Das<br />
Produkt wird durch das, was wir hier einsetzen, wesentlich<br />
verändert. Die machen das ja nicht zum Spaß, denke ich.<br />
Ich habe in dem Artikel gelesen – Sie haben es sicherlich<br />
auch gelesen –, dass die das vorhaben bzw. dass ihre<br />
neuen Werke so sein werden.<br />
Ich sehe natürlich – und das müssten auch die Genehmigungsbehörden<br />
wissen –, dass bei den 40 genehmigten,<br />
glaube ich, und 30 zur Genehmigung anstehenden<br />
Anlagen mit Ersatzbrennstoffen in der Bundesrepublik<br />
die Zementwerke ganz oben stehen. Es sind energieintensive<br />
Betriebe, und die müssen natürlich sehen, dass<br />
sie ihre Energie irgendwo kostengünstig bekommen.<br />
Aber das ist nicht unser Interesse. Unser Interesse ist<br />
vorwiegend, die Emissionen und die Immissionen zu<br />
reduzieren, sowohl global als auch regional. Deswegen<br />
haben wir Ihnen Gas vorgeschlagen.<br />
Wenn HeidelbergCement dies tut, dann tut sie das sicherlich<br />
aus wirtschaftlichen Gründen. Ich habe Ihnen<br />
gesagt, die zwei neuen Anlagen drüben in Rheinland-Pfalz<br />
werden mit Gas betrieben. Das ist schon erstaunlich. Auch<br />
für mich ist ganz erstaunlich gewesen, dass sich ein<br />
Heizkraftwerk und eine Papierfabrik auf Gas beziehen.<br />
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit steht auch das Produkt<br />
Gas hoffentlich nur für eine Zwischentechnologie. Aber<br />
Gas ist der Brennstoff, der sich in allen Bilanzen – wir<br />
kommen nachher bei den Immissionen zu den ganz<br />
spezifischen Substanzen – nicht als negativ erweist.<br />
Deswegen ist er für uns die Alternative.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einmal an Lafarge.<br />
Seite 19<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Stefan Hüsemann (Antragstellerin):<br />
Mein Name ist Hüsemann. Ich bin von der BfU in Kassel.<br />
Ich bin Sachverständiger für Genehmigungsverfahren und<br />
für Treibhausgase, bin jetzt allerdings nicht in der Funktion<br />
des Sachverständigen für Treibhausgase hier.<br />
Ich denke, wir besprechen hier ein Dilemma, das auf<br />
einer ganz anderen Ebene stattfindet, nicht in Wössingen.<br />
Ich bin davon überzeugt, dass die Firma Lafarge aufgrund<br />
entsprechender wirtschaftlicher Abwägungen sehr genau<br />
weiß, welche Brennstoffe einsetzbar sind.<br />
Um dieses Thema CO2 noch einmal zu betrachten:<br />
Das CO2 wird ja eingepreist in alle wirtschaftlichen Berechnungen.<br />
Dafür haben wir in Europa einen Treibhausgas-Emissionshandel,<br />
und diesem Treibhausgas-<br />
Emissionshandel unterliegen auch alle Zementwerke.<br />
Das Dilemma an diesem Treibhausgas-Emissionshandel<br />
ist, dass die Tonne CO2 derzeit bei 3 bis 4 Euro<br />
liegt. Wäre die Tonne bei 20 oder 30 Euro, würde sich das<br />
sicherlich auf den Brennstoffmix auswirken können.<br />
Möglicherweise würde das Erdgas dann interessanter<br />
werden.<br />
Jetzt ist aber gerade in der letzten Woche auf EU-<br />
Ebene das Thema Backloading, ich sage einmal: vor die<br />
Wand geklatscht. Das heißt, man hat die Zertifikate nicht<br />
weiter verknappt, und der Preis ist der Gleiche geblieben.<br />
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt<br />
nicht politische Themen vermischen mit der Anlagengenehmigung,<br />
die heute zur Diskussion steht. – Das wollte<br />
ich dazu noch sagen. Danke.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Das ist kein<br />
politisches Thema!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir wollen jetzt auch keine politische Debatte. Wir denken<br />
tatsächlich global, anders als die Politiker, die dort falsch<br />
entschieden haben. Es war die CDU/FDP-Koalition aus<br />
Deutschland, die dafür gesorgt hat, dass diese falsche<br />
Richtung beibehalten wird. Man hätte es Ihnen und der<br />
Industrie einiges leichter gemacht, wenn es wirklich<br />
nachhaltig um die Standorte in Deutschland gegangen<br />
wäre. Wir haben hier halt Standorte, die sich durch hohe<br />
Emissionen auszeichnen. Wir leben leider in diesen<br />
Räumen mit hohen Emissionen. Das ist schade. Wir<br />
brauchen das nicht zu vertiefen.<br />
Sicherlich war auch für Lafarge das Geschäft mit CO2<br />
ein gutes – war! Ich weiß nicht, ob es noch ein gutes ist.<br />
Denn Sie bekommen natürlich Zuteilungen für CO2-Werte.<br />
Ich weiß nicht, wie viel Sie bekommen. Ich weiß nicht, ob<br />
die Zahl geheim ist. Sie können sie ja einmal nennen. Wie<br />
viel bekommen Sie dafür umsonst? Wie viel können Sie<br />
vielleicht sogar verkaufen, weil Sie sie gar nicht brauchen?
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ich möchte die Diskussion ungern abbrechen,<br />
aber wir haben, glaube ich, das Thema Gas jetzt wirklich<br />
ausführlich erörtert. – Herr Wiedenmann, noch dazu?<br />
Sonst würde ich nämlich den Vorschlag machen, wieder<br />
zur Tagesordnung zurückzufinden.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Es gibt offensichtlich Firmen – aus der Debatte konnte das<br />
jeder entnehmen –, die unabhängig von den rein wirtschaftlichen<br />
Erwägungen eine gewisse Vorbildfunktion<br />
einnehmen. Diese argumentieren anders als mit rein<br />
ökonomischer Nachhaltigkeit. Sie denken nicht nur an den<br />
Geldbeutel der eigenen Firma.<br />
Lafarge wird es nicht so schlecht gehen, dass sie alles<br />
einsetzen müssen, um die Kosten zu drücken. Sie sollten<br />
in der Nachhaltigkeitsdebatte auch die Bevölkerung im<br />
Fokus haben und sagen: Leute, wir haben noch andere<br />
Aufgaben, als möglichst günstig zu produzieren; wir leben<br />
hier in einer Region, die ökologisch noch einigermaßen<br />
intakt ist; wir sollten der Bevölkerung etwas Gutes tun und<br />
in einer Vorbildfunktion versuchen, die Emissionen und<br />
Immissionen weitgehend zu minimieren.<br />
Jetzt unabhängig von der Brennstoffdebatte: Am<br />
27. März war ein Artikel in der Zeitung zu lesen mit der<br />
Überschrift "HeidelbergCement untersucht neue Betonbindemittel",<br />
und zwar genau mit der Zielsetzung, CO2-<br />
Emissionen zu minimieren. Hier steht: Durch eine neue<br />
Technologie, die entweder schon entwickelt ist oder<br />
zurzeit entwickelt wird, können sie bei gleicher Produktionskapazität<br />
die CO2-Emissionen um 30 % reduzieren.<br />
Wie das Verfahren aussieht, ist hier kurz angedeutet. Aber<br />
da würden Sie sich besser auskennen als wir.<br />
Jetzt die Frage: Ist das im Fokus Ihrer Planungen für<br />
die Zukunft, zu sagen, wenn dieses Verfahren zugänglich<br />
ist und sich bewährt hat: „Leute, wir machen das!“?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Wiedenmann. – Kann oder will Lafarge direkt<br />
antworten? – Herr Dr. Oerter.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Herr Dr. Oerter kann anschließend global darauf eingehen.<br />
– Für Lafarge kann ich Ihnen sagen, dass es auch für<br />
uns ein Thema ist, dass wir uns dort entwickeln.<br />
Lafarge hat ein Forschungszentrum in Lyon, wo auch<br />
Zemente für die Zukunft untersucht werden. Es wird dort<br />
versucht, den Prozess der Zementherstellung so zu<br />
optimieren, dass weniger Wärmebedarf erforderlich ist und<br />
somit weniger CO2-Emissionen entstehen. Es gibt ein<br />
großes Projekt von Lafarge in einer Anlage in Frankreich,<br />
wo bereits Tests im industriellen Maßstab gelaufen sind.<br />
Dazu gab es auch Veröffentlichungen von unserer Seite.<br />
„Aether“ nennt sich dieses Produkt; das ist der Fachbegriff<br />
bei uns.<br />
Das Projekt befindet sich aber noch in der Entwicklungsphase.<br />
Ich bin nicht der Experte, der sagen könnte,<br />
Seite 20<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
wie lange diese Studie noch dauert. Sehr erfreulich ist<br />
aber, dass es ein europäisches Projekt ist, das von<br />
unterschiedlichen Ländern betreut und begleitet wird. Es<br />
entwickelt sich. Zur Zeitschiene kann ich nichts sagen.<br />
Aber ich glaube, es werden noch einige Jahre ins Land<br />
gehen.<br />
Das ist ein wichtiges Thema auch für Lafarge. Es wird<br />
sehr intensiv daran geforscht, um da für die Zukunft gut<br />
aufgestellt zu sein.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke. – Wollte Herr Dr. Oerter noch etwas sagen?<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das geht ein bisschen<br />
in die Richtung, was Sie eingangs im Zusammenhang<br />
mit der CO2-Bilanz fragten.<br />
Da geht es jetzt nicht um den Klinkerherstellungsprozess,<br />
sondern es geht um die Substitution des Klinkers<br />
durch andere, überwiegend sogar alternative Sekundärrohstoffe,<br />
also Stoffe, die schon aus industriellen Prozessen<br />
kommen, um letztlich den CO2-Rucksack des Zementes,<br />
der ja nur zu Teilen aus Klinker besteht, zu mindern.<br />
Ich habe dazu eine Folie, die, glaube die, ganz hilfreich<br />
ist.<br />
(Schaubild: CO2-Minderung durch den Einsatz<br />
alternativer Einsatzstoffe – Anlage 3,<br />
S. 118)<br />
Dieses Bild zeigt eine Abschätzung, eine Darstellung<br />
der CO2-Minderung durch den Einsatz alternativer Einsatzstoffe.<br />
Wir reden jetzt über die Zementherstellung,<br />
insbesondere über den Klinker. Das ist das energieintensive<br />
Zwischenprodukt, das aus den Drehrohröfen kommt.<br />
Das ist letztlich auch Gegenstand des Verfahrens. Der<br />
Ersatzbrennstoffeinsatz bzw. Alternativbrennstoffeinsatz<br />
bezieht sich ausschließlich auf die Klinkerproduktion.<br />
Aber Zement besteht aus Klinker plus anderen Zumahlstoffen.<br />
In der Tat – Herr Wiedenmann, deswegen<br />
war Ihre Frage durchaus berechtigt – kommen zwei Drittel<br />
der CO2-Emissionen des Klinkerherstellungsprozesses<br />
aus den Rohstoffen: aus dem natürlichen Kalkstein, aus<br />
dem Ton, aus dem Mergel.<br />
Deswegen ist es natürlich ein großes Ziel – ich beziehe<br />
mich jetzt wieder auf den Zement –, durch Klinkersubstitution<br />
den Klinkeranteil in dem Zement zu reduzieren.<br />
Darauf beziehen sich derzeit die großen Forschungsaktivitäten.<br />
In diese Richtung geht auch der Artikel von den<br />
Kollegen von HeidelbergCement.<br />
Sie sehen hier diesen ersten blauen Balken: CO2-<br />
Einsparung durch Klinkersubstitution. So hat man auf der<br />
Basis 2010 abgeschätzt, wie man die spezifischen CO2-<br />
Emissionen letztlich durch Substitution von Klinker –<br />
beispielsweise durch Hüttensand, also granulierte Hochofenschlacke<br />
– entsprechend mindern kann.
Dann sehen Sie den mittleren roten Balken: Kohle statt<br />
ABS. Ich betreibe meinen Klinkerbrennprozess – ich bin<br />
nun nicht mehr beim Zement, sondern beim Klinker –<br />
ausschließlich mit Kohle statt mir Alternativbrennstoffen.<br />
Wenn ich Alternativbrennstoffe einsetze, macht das eine<br />
weitere Einsparung von ca. gut 2 Millionen t CO2 pro Jahr<br />
aus, bezogen auf den Brennstoffmix, der sich aus Kohle<br />
zusammensetzt.<br />
In der Summe sehen Sie da die spezifischen Einsparungen.<br />
Sowohl für das Haus Heidelberg, für das ich nicht<br />
sprechen kann, als auch für das Haus Lafarge und für die<br />
gesamte deutsche Zementindustrie gilt, dass derzeit ein<br />
Großteil der Forschungsaktivitäten letztlich auf diesen<br />
linken blauen Balken gelegt wird, nämlich auf die Frage:<br />
Welche anderen Klinkerersatzstoffe kann ich zur Herstellung<br />
von Zement verwenden bei einer gleichzeitigen<br />
Beibehaltung der Produktqualität?<br />
Wir reden hier, Herr Block – die Diskussion haben wir<br />
häufiger geführt –, nicht über einen neuen Handy-Chip.<br />
Wenn der heute entwickelt wird, ist er morgen in aller<br />
Leute Handys. Wir reden hier über einen Baustoff, der<br />
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss, der bauphysikalische<br />
Eigenschaften erfüllen muss, der Sicherheitskriterien<br />
erfüllen muss. Die Substitution des Klinkers durch andere<br />
Stoffe erfordert einen immensen Aufwand: Das ist natürlich<br />
eine Hauptaufgabe nicht nur der deutschen, sondern<br />
auch der europäischen und letztlich der globalen Zementindustrie.<br />
Aber der Beitrag von HeidelbergCement bezieht sich<br />
eben nicht auf den Klinkerbrennprozess, sondern das ist<br />
diese Geschichte: Wir suchen nach geeigneten Klinkerersatzmaterialien<br />
für die Zementherstellung.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Wiedenmann.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Wenn Sie jetzt noch einen Balken hinzugefügt hätten:<br />
"CO2-Emissionen bei Einsatz von Gas als Brennstoff",<br />
dann wäre das vielleicht für alle eine sehr erleuchtende<br />
Darstellung gewesen.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Noch einmal: Die brennstoffbedingten CO2-Emissionen<br />
sind ungefähr ein Drittel des gesamten Klinkerherstellungsprozesses,<br />
und Erdgas ist derzeit keine Option für<br />
die Zementindustrie, nicht in Europa und nicht weltweit.<br />
(Dr. Rolf Wiedenmann [EW]: Das wissen wir<br />
ja!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Wiedenmann, ich fand die Darstellung sehr interessant.<br />
Ich hätte gerne, weil es eine Folie vom VDZ war, die<br />
Quelle dazu. Das ist ja eine Studie, die läuft oder ausgewertet<br />
ist. Können Sie uns die zukommen lassen?<br />
(Dr.-Ing. Martin Oerter [AS]: Die bekommen<br />
Sie gerne!)<br />
Seite 21<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
So wie beim Herrn Block auch. – Herr Block, noch konkret<br />
dazu?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Der erste Besuch des Ministerpräsidenten Kretschmann in<br />
Karlsruhe galt der Zementproduktion. Er ging ins KIT Nord<br />
und hat sich dort das Celitement-Projekt angeschaut. Da<br />
geht es genau um diesen Punkt, dass man andere Zemente<br />
hat.<br />
Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass geforscht<br />
wird. Ich würde es gut finden, man würde das Ganze, was<br />
da geforscht wird, einmal zusammenfassen, damit es<br />
wirklich vorwärtsgeht.<br />
Als ich diese Tabellen sah, habe ich mich gefragt: Warum<br />
forschen die an zehn verschiedenen Stellen? Jede<br />
Firma macht ihr eigenes Ding. Das verstehe ich auch: Es<br />
gibt ja Konkurrenz – wie bei den Chips: Der eine entwickelt<br />
dies und der andere das. Aber man könnte doch die<br />
allgemeine Forschung in Deutschland – nicht die, die von<br />
Ihnen finanziert wird, sondern diejenige, die an Universitäten<br />
stattfindet – einmal zusammenfassen.<br />
Das Celitement-Projekt scheint mir schon erfolgreich<br />
zu sein, gerade was das hier anbelangt. Es geht nicht nur<br />
um CO2, sondern um viel mehr.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das Stichwort "grüner Zement" – in Anführungsstrichen<br />
bitte –taucht in diesem Kontext immer wieder auf; das<br />
haben auch wir im Blick.<br />
Ich meine, dieser Appell eben war eine richtige Botschaft<br />
am Ende dieser Diskussion zum Einsatz von<br />
Erdgas.<br />
Ich möchte jetzt wieder zur Tagesordnung überleiten,<br />
und zwar zum TOP 2, Sekundärbrennstoffe, wenn Sie<br />
damit einverstanden sind.<br />
IV. 2. Sekundärbrennstoffe<br />
Da steht als erster Unterpunkt:<br />
Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz<br />
Herr Block, wir hatten genau diesen Punkt vorhin bei<br />
Ihrer Einwendung zum Einstieg in das Thema Verwertung/Entsorgungsanlage<br />
behandelt. Wenn Sie da jetzt<br />
keine Ergänzung hätten – oder einer der anderen Einwender<br />
–, würden wir den als erörtert betrachten und den<br />
nächsten Punkt nehmen, der auf der Tagesordnung steht:<br />
Einfluss der Sekundärbrennstoffe auf<br />
den Klinkerbrennprozess, die Produkteigenschaften<br />
des Zements sowie auf Altbeton<br />
Herr Block.
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, ich weiß nicht, warum Sie so in Hektik machen.<br />
Das ist doch gar nicht notwendig.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist dann falsch verstanden worden.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Es ist schon wichtig, dass man sich über die Brennstoffe<br />
unterhält, die hier eingesetzt werden. Das spielt nachher<br />
auch eine große Rolle bei der Frage: Wie kommt es zu<br />
den Immissionen? Da muss man schon wissen, was drin<br />
ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt haben Sie mich, glaube ich, missverstanden. Wir<br />
wollen nicht nicht über die Brennstoffe reden, die eingesetzt<br />
werden.<br />
(Harry Block [BUND]: Doch?)<br />
- Genau darüber wollen wir reden. Sie haben gesagt: Wir<br />
wollen nicht darüber reden. Aber wir wollen genau das<br />
tun. Aber über die Einordnung, ob es jetzt Verwertung<br />
oder Entsorgung ist – das ist der erste Tiret, der erste<br />
Unterpunkt von diesem Tagesordnungspunkt –,<br />
(Harry Block [BUND]: Ach so!)<br />
hatten wir vorhin schon gesprochen. Bitte, das war überhaupt<br />
keine Hektik. Aber darüber hatten wir vorher schon<br />
einmal gesprochen. Das war Ihr Einstieg in die Veranstaltung.<br />
Da wollte ich nur sagen: Das thematisieren wir jetzt<br />
nicht noch einmal, sondern wir betrachten diesen Punkt<br />
quasi als erledigt, wenn Sie damit einverstanden sind.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ja, natürlich. Aber wenn wir über diese Sekundärbrennstoffe<br />
reden, geht es für mich darum, dass das eine<br />
Beseitigungsanlage ist. Das ist eine Müllverbrennungsanlage.<br />
Deswegen ist die Frage des Brennstoffs, der da<br />
eingesetzt wird, hochinteressant.<br />
Der Fluff wird nach diesen Unterlagen mit bis zu 85 %<br />
hier eingesetzt. Das heißt, er ist ein wesentlicher Teil bei<br />
der ganzen Geschichte.<br />
Ich sage Ihnen noch einmal zur Zertifizierung: Die Zertifizierer<br />
garantieren Ihnen nur zwei Sachen: Erstens<br />
prüfen Sie, ob die radioaktiven Stoffe raus sind; das<br />
müssen sie prüfen. Als Zweites prüfen sie, dass das PCB<br />
so weit wie möglich herausgenommen worden ist. Aber<br />
alles andere bleibt drin. Das ist das Einzige, was garantiert<br />
kontrolliert wird.<br />
Das bedeutet für uns nichts anderes als Hausmüll. Der<br />
Fluff ist Hausmüll. Er ist damit von der Definition her, was<br />
drin ist, nicht fassbar. Da können Hunderttausende von<br />
Stoffen drin sein. Das zeigt sich dann eindeutig am Emissionsspektrum.<br />
Wenn wir uns nämlich angucken - -<br />
Seite 22<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Halt! Ganz kurz: Der Fluff ist nicht von der Tagesordnung<br />
verschwunden, sondern steht unter IV. 2. Unterpunkt 4.<br />
Wir haben die Tagesordnung bewusst so gewählt, dass<br />
wir das Stück für Stück abarbeiten. Da steht z. B. auch<br />
das Thema Tiermehl drauf; wir haben dazu einen Kollegen<br />
von den Veterinären hier.<br />
Ich würde Sie bitten: Lassen Sie uns das anhand der<br />
Tagesordnung abarbeiten! Wenn das für Sie ein Problem<br />
ist, müssen wir uns verständigen; dann finden wir sicher<br />
eine Lösung. Aber die Einwendungen, die hier aufgelistet<br />
wurden, kamen ja. Eine davon war der Einfluss der<br />
Sekundärbrennstoffe auf den Klinkerbrennprozess. Den<br />
hätten wir jetzt gerne als Nächstes abgehandelt.<br />
(Harry Block [BUND]: „Qualitätssicherung/Fluff“<br />
steht hier!)<br />
- Aber doch nicht als nächster Punkt.<br />
(Roland Lang [RP Karlsruhe]: Da sind wir<br />
noch nicht!)<br />
Entschuldigung, wir sind noch zwei obendrüber. „Fluff“<br />
steht an Stelle vier. Wir sind jetzt eigentlich, nachdem wir<br />
uns verständigt haben, dass die Stelle eins abgearbeitet<br />
ist, an Stelle zwei. Meine Bitte wäre, diese Reihenfolge<br />
einzuhalten.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Schwierig!<br />
Diese Tagesordnung haben wir nicht!)<br />
Es ist zwar wegen der Sonne etwas schwierig zu lesen –<br />
das sehe ich ein –, aber ich bitte, immer wieder den Blick<br />
nach vorne zu werfen: Da steht es noch einmal. Außerdem<br />
versuche auch ich es Ihnen nahezubringen. – Frau<br />
Vangermain.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Es ist ein bisschen schwierig, wenn Sie von der „Tagesordnung<br />
Punkt 4“ sprechen -<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller: Nein, Unterpunkt 4.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
- und die Tagesordnung, die Sie uns hier ausgelegt haben<br />
und die auch im Internet stand, eine andere ist, als Sie da<br />
oben an der Wand zeigen. Eine solch detaillierte haben<br />
wir nicht vorliegen. Deswegen ist ein Hinweis von Ihnen<br />
auf „4“ für uns immer etwas vage.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt, denke ich, ist das geklärt ist. Gemeint sind jetzt die<br />
Unterpunkte.<br />
(Harry Block [BUND]: Okay, ich habe es<br />
verstanden, Herr Haller! Es ist geklärt! Wir<br />
brauchen jetzt nicht in die Details zu gehen!)<br />
– Ich wollte Sie nicht abblocken. Denn das ist ja das<br />
zentrale Thema bei uns.
(Harry Block [BUND]: Das schaffen Sie<br />
auch nicht! – Heiterkeit)<br />
– Das wollen wir auch nicht. – Das zentrale Thema,<br />
warum wir heute hier zusammensitzen, sind die Sekundärbrennstoffe.<br />
Mir geht einfach um Folgendes: Der Fluff<br />
ist zentral; da gebe ich Ihnen völlig recht: Aber im Moment<br />
möchten wir gerne versuchen, die Struktur anhand dieser<br />
Punkte aufrechtzuerhalten. Dann wär das nächste Thema,<br />
das ansteht, der Einfluss der Brennstoffe auf den Klinker.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Okay, einverstanden. Ich habe es verstanden.<br />
Zum Einfluss der Sekundärbrennstoffe auf das Produkt<br />
–ich mache es jetzt ein bisschen drastisch –: Sie haben<br />
drei Möglichkeiten, Ihre Schadstoffe abzulagern. Die erste<br />
ist ein Filter; das wär die beste Methode. – Oder sie gar<br />
nicht entstehen zu lassen wäre die allerbeste Methode. Es<br />
gibt also vier Methoden.<br />
Die erste Methode, dass sie gar nicht entstehen, wäre<br />
der Einsatz von Gas. Die zweite wäre, dass Sie hervorragende<br />
Filter haben; dann geht das in die Filter. Die dritte<br />
Methode ist leider die übliche: Die Schadstoffe gehen in<br />
die Luft, damit gehen sie in unsere Lungen, in den Boden<br />
und bei Ihnen auch in das Produkt.<br />
(Schaubild: Was ist im Müll enthalten? –<br />
Anlage 2-9, S. 108)<br />
Hier sehen Sie die Schadstoffe, die in dem Produkt<br />
enthalten sind.<br />
Verwunderlich finde ich die Werte für die Altreifen. Ich<br />
war beim Erörterungstermin von Michelin. Alle Reifen von<br />
Michelin werden in Karlsruhe gemacht. Weil ich bei dem<br />
Erörterungstermin war, habe ich mich natürlich mit Reifen<br />
beschäftigen müssen und habe dabei festgestellt, dass<br />
immer, wenn das Thema kam, was denn in dem Reifen<br />
drin ist, uns gesagt wurde: Betriebsgeheimnis. Sie wissen<br />
es wahrscheinlich auch nicht. Derjenige, der diese Tabelle<br />
gemacht hat – ich reiche es Ihnen nach, woraus ich sie<br />
entnommen habe –, wusste anscheinend, was in den<br />
Altreifen drin ist.<br />
Alles das, was da drin ist – Cadmium, Quecksilber,<br />
Blei, Zink –, befindet sich auch in dem Produkt. Unsere<br />
Behauptung ist deshalb: Ein Teil der Senke von Schadstoffen<br />
befindet sich auch in Ihrem Produkt. Oder anders<br />
gesagt: Das, was nicht in die Luft geht, was nicht im Filter<br />
drin ist, was nicht im Boden abgelagert wird, habe ich<br />
dann in meinem Haus.<br />
Wir haben in den Unterlagen nichts darüber gefunden,<br />
welchen prozentualen Anteil die Schadstoffe in Ihrem<br />
Produkt ausmachen, wenn Sie z. B. Altreifen benutzen<br />
oder die Kunststoffabfälle – das dürfte wohl hauptsächlich<br />
der Fluff sein, den Sie einsetzen. Wie viel ist wovon im<br />
Klinker?<br />
Seite 23<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wer kann, wer will von Lafarge etwas dazu sagen? – Herr<br />
Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich bin gerne bereit zu antworten. Ich habe dazu eine<br />
andere interessante Folie. – Herr Block, ich muss ganz<br />
ehrlich sagen: Auch hier würde mich die Quelle dieser<br />
Angaben interessieren.<br />
In der Tat handelt es sich bei der Klinkerherstellung –<br />
wir reden über das Klinkerbrennen – im Wesentlichen um<br />
einen rückstandsfreien Prozess. Darauf ist die Zementindustrie<br />
auch zu Recht stolz. Im Gegensatz zu allen anderen<br />
Verbrennungsprozessen entstehen in der Tat überwiegend<br />
keine zusätzlichen Abfälle. Die eingesetzten<br />
Stoffe werden tatsächlich zu mehr als 99 % genutzt.<br />
Das bedingt natürlich – insofern bitte ich Herrn Haller<br />
um Nachsicht, dass ich noch einmal auf die Fluff-Qualität<br />
zu sprechen kommen muss –, dass im Vorfeld die eingesetzten<br />
Stoffe überprüft werden müssen. Die müssen<br />
aufgrund von Umweltaspekten überprüft werden. Aber es<br />
muss natürlich auch geschaut werden, inwiefern das<br />
letztlich mit der Produktqualität in Einklang zu bringen ist.<br />
Die Spurenelemente, die Sie ansprechen, heißen eben<br />
„Spurenelemente“, weil sie ubiquitär vorhanden sind. Auch<br />
im Kalkstein, auch im Ton, auch im Mergel, auch in einer<br />
natürlichen Kohle sind Spurenelemente enthalten.<br />
Wenn wir über Sekundärbrennstoffeinsatz reden, dürfen<br />
Sie nicht vergessen, dass wir insgesamt über 10 %<br />
Substitution des Mengeninputs reden. 90 % des Eintrages<br />
in einen Klinkerofen sind Kalkstein, Ton, Mergel, also die<br />
natürlichen Rohstoffe, die natürlich einen gewissen Anteil<br />
dieser Spurenelemente mit sich bringen.<br />
Genau das Gleiche ist für die Brennstoffe der Fall. Das<br />
gilt für die primären Brennstoffe genauso wie für die<br />
sekundären oder alternativen Brennstoffe. Ganz wichtig<br />
ist, dass gewisse Schwellenwerte nicht überschritten<br />
werden; da ist sich die deutsche Zementindustrie einig.<br />
Jetzt kann ich wieder nicht allein für Lafarge sprechen,<br />
sondern ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie sich das für<br />
die in ganz Deutschland hergestellten Zemente darstellt.<br />
Die werden regelmäßig untersucht.<br />
(Schaubild: Spurenelementgehalte in deutschen<br />
Normzementen – Anlage 4, S. 120)<br />
Sie sehen hier die verschiedenen Spurenelementgehalte<br />
z. B. von Arsen, Cadmium, Kobalt, Chrom und<br />
Quecksilber – das sinkt sogar –, und Sie sehen die verschiedenen<br />
Jahreszahlen.<br />
1994 hatten wir, glaube ich, eine Substitutionsrate, bezogen<br />
auf den Ersatzbrennstoffeinsatz, von im Schnitt weit<br />
unter 10 %. Im Jahre 2011 lag die Substitutionsrate bei<br />
über 60 %. Sie können sehen, speziell beim Quecksilber<br />
ist der Gehalt sogar gesunken. Es ist natürlich ein bisschen<br />
ein atmendes System. Aber ganz entscheidend ist,<br />
dass sich die Spurenelementgehalte in den deutschen
Zementen innerhalb eines Korridors bewegen, der sich<br />
völlig durch die geogene Hintergrundbelastung abbilden<br />
und beschreiben lässt.<br />
Es gibt darüber hinaus ein Merkblatt über Anforderungen<br />
an zementgebundene Baustoffe im Trinkwasserbau.<br />
Da sind für verschiedene Spurenelemente, beispielweise<br />
für Arsen, entsprechenden Grenzwerte oder Richtwerte<br />
vorgegeben, bis zu denen der Zement bedenkenlos als<br />
Bindemittel im Trinkwasserbau benutzt werden kann. All<br />
diese Werte werden bei Weitem unterschritten.<br />
Sie sehen anhand dieser Darstellung: Das wird durch<br />
unser akkreditiertes Prüflabor fortgeschrieben. In regelmäßigen<br />
Abständen werden alle in Deutschland hergestellten<br />
Zemente untersucht, um zu gewährleisten, dass<br />
auch durch diesen steigenden Sekundärbrennstoffeinsatz<br />
die Produktqualität, insbesondere was die Spurenelementgehalte<br />
angeht, nicht in irgendeiner Form nachhaltig<br />
verändert wird.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Oerter. – Herr Bauer.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Bauer ist mein Name, auch von der BI Müll und Umwelt.<br />
Dahin gehend habe ich eine Frage. Das Forschungszentrum<br />
Karlsruhe kam 2001/2002 zu etwas anderen Einschätzungen.<br />
Die Beimischung von Sekundärbrennstoffen<br />
lag da bei etwa 35 %.<br />
Dort wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die<br />
Verwertung von Zementstaub als Kalkersatz in Forst- und<br />
Landwirtschaft aufgrund des nicht geklärten langfristigen<br />
Verhaltens zu vermeiden ist und dass im Idealfall kein<br />
gebrochener Altbeton im Straßenbau eingesetzt werden<br />
soll.<br />
Jetzt haben wir eine Verdreifachung vom Sekundärbrennstoff<br />
und dadurch natürlich auch eine entsprechende<br />
Erhöhung der Schadstoffe. Wo sind die entsprechenden<br />
wissenschaftlichen Nachweise, dass das, was<br />
2001 vom Forschungszentrum bemängelt wurde, nicht<br />
richtig ist?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Sie meinen mit Sicherheit die Studie vom ITAS aus dem<br />
Jahr 2003, dem Institut für Technikfolgenabschätzung am<br />
Forschungszentrum Karlsruhe. Von Herrn Dr. Achternbosch<br />
und Herrn Bräutigam ist die Studie seinerzeit<br />
erstellt worden. Daran hatten wir im Übrigen damals<br />
mitgearbeitet; deswegen sind mir die Namen noch so<br />
geläufig.<br />
Herr Bauer, wir sollten uns das in der Tat noch einmal<br />
genauer anschauen. Ich habe die wesentlichen Ergebnisse<br />
der Studie etwas anders in Erinnerung. Insbesondere<br />
steht in der Zusammenfassung drin, dass das grundsätzlich<br />
umweltverträglich und schadlos erfolgt.<br />
Seite 24<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Ich stimme Ihnen zu, dass der Hinweis gegeben ist,<br />
dass dann, wenn Altbeton gebrochen wird, zumindest auf<br />
die Lagerbedingungen etwas zu achten ist. Allerdings<br />
habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass es bei der Verwendung<br />
von Betonbruch im Wege- und Straßenbau eine<br />
Einschränkung gab. In den Wege- und Straßenbau gehen<br />
auch aufgrund der Versiegelung ganz andere Dinge hinein<br />
als Betonbruch. Ich stimme Ihnen zu, dass darauf hingewiesen<br />
wird, dass darauf zu achten ist.<br />
Bei der seinerzeitigen Studie ging es im Übrigen im<br />
Fokus nicht um den sekundären Brennstoffeinsatz, sondern<br />
um den viel höheren Einsatz von sekundären Rohstoffen,<br />
von Schlacken, von Flugaschen und von anderen<br />
mineralischen Reststoffen.<br />
Die wesentliche Aussage der Studie war allerdings,<br />
dass das umweltverträglich und schadlos ist. So wurde es<br />
seinerzeit geschrieben, und das ist auch der Stand heute.<br />
– Wir können uns das gerne anschauen. Ich habe es jetzt<br />
nicht mehr präsent, aber auf dem Rechner.<br />
(Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der<br />
Mitverbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
auf die Schwermetallbelastung des<br />
Produkts im Hinblick auf die Zulässigkeit der<br />
Abfallverwertung – S. 121)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Das ist nicht ganz richtig. In der Zusammenfassung heißt<br />
es ganz eindeutig, es ginge hier um die „Untersuchung<br />
des Einflusses der Mitverbrennung von Abfällen in den<br />
Zementwerken“. Das ist die Überschrift. Ob es da um<br />
etwas anderes ging als um Sekundärbrennstoffe, weiß ich<br />
nicht. Ich kann nur das nachlesen, was hier steht.<br />
Alles, was ich gesagt hatte, sind Zitate aus der Zusammenfassung<br />
der Studie. Da stehen die einzelnen<br />
Punkte nicht so definitiv drin. Da steht aber definitiv drin:<br />
Im Idealfall sollte gebrochener Altbeton nicht im Straßenbau<br />
zum Einsatz kommen – und das bei 35 % Sekundärbrennstoffen!<br />
Ich habe das hier schwarz auf weiß<br />
vorliegen. Es ist in meinen Augen anders, als Sie es<br />
darstellen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich hätte noch eine kurze Frage. Herr Dr. Oerter hat die<br />
Studie ITAS 2003 erwähnt. Ist das die gleiche, oder ist das<br />
jetzt eine andere?<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich habe hier das Jahrbuch vom Institut, und da steht<br />
2001/2002. Von 2003 steht da jetzt nichts drin.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist aber auch vom Institut für Technikfolgenabschätzung?
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Genau, ITAS.<br />
(Dr.-Ing. Martin Oerter [AS]: Es gibt einen<br />
Abschlussbericht aus dem Jahre 2003!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das war meine Vermutung. Die Studie ist 2001/2002<br />
erstellt worden, und 2003 wurde sie dann mit Anschlussbericht<br />
veröffentlicht. So etwas ist üblich. Ich gehe aber<br />
davon aus, dass die Grundlage gleich ist. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Bei unseren Folien zur Einwendung steht unten angegeben,<br />
woher sie kommen. Die Folie, die ich eben aufgelegt<br />
habe, stammt von Beckmann und Scholz: „Energetische<br />
Bewertung der Substitution von Brennstoffen durch<br />
Ersatzbrennstoffe bei Hochtemperaturprozessen“. Das<br />
sind alles wissenschaftliche Arbeiten, die nicht von der<br />
Industrie gefördert wurden, das waren alles Doktorarbeiten<br />
– vielleicht abgeschrieben; das weiß ich nicht; aber es<br />
sind Doktorarbeiten. Die, die wir zitiert haben, ist in der<br />
Unterlage drin.<br />
Jetzt, Herr Oerter, zu einem ganz wichtigen Problem:<br />
Ich bin von Haus aus Mathematiker. Mittelwerte sind für<br />
mich das Oberallerletzte. Sie und ich wissen, dass 0 Grad<br />
und 100 Grad gemischt 50 Grad gibt. Und 50 Grad ist<br />
immer gut. Damit kann ich sogar noch in die Badewanne<br />
gehen. Aber Sie alle wissen, bei 99 Grad wird es für das<br />
Wasser schon echt problematisch.<br />
Je nachdem, welches Produkt Sie gerade bei der Verbrennung<br />
einsetzen, wird das unterschiedliche Auswirkungen<br />
haben. Die Mittelwerte bei Zink werden extrem<br />
hoch, wenn Sie Altreifen drin haben. Gucken Sie sich<br />
doch einmal an, was im Altreifen drin ist! Das Produkt wird<br />
darum garantiert nicht die natürlichen Werte an Zink<br />
enthalten.<br />
Oder gucken Sie sich doch einmal Blei in der Umwelt<br />
an! Sie bekommen doch im Kalk nicht diese Bleiwerte!<br />
Erzählen Sie doch nicht so etwas! Als Mittelwert ist das<br />
alles wunderbar.<br />
Ihre Tabelle ist wirklich übel, weil Sie mit Mittelwerten<br />
arbeitet. Wenn Sie noch einen Zentralwert angegeben<br />
hätten, wenn Sie das Quartil angegeben hätten, wenn ich<br />
gewusst hätte, wie ich das einschätzen kann, dann hätte<br />
ich als Mathematiker gesagt: Das ist brauchbar. Aber das<br />
hier ist wirklich die Leute „vera…“. Das können Sie so<br />
nicht bringen.<br />
Sie haben z. B. Zink in Ihrer Tabelle aufgeführt gehabt,<br />
und die Werte stiegen. Das war 2011. Das heißt, je mehr<br />
Ersatzbrennstoffe Sie nutzen, desto mehr wird Ihr Produkt<br />
das beinhalten. Der Mittelwert wird dadurch unter Umständen<br />
minimal höher. Aber der minimal höhere Mittelwert<br />
kann in Ihrem Produkt sehr wohl zu Einschränkungen<br />
führen.<br />
Ich saß idiotischerweise auch 20 Jahre im Bauausschuss,<br />
und genau das haben wir immer besprochen.<br />
Seite 25<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Immer dann, wenn Beton für unsere Wasserbereiche<br />
genutzt wurde, mussten Gutachten vorgelegt werden. Das<br />
wurde auch individuell getestet. Denn man hat gesagt: In<br />
Gebieten, wo unsere Wasserversorgung betroffen ist, oder<br />
bei unseren Brunnen ist eine spezielle Art von Beton<br />
gefordert, gerade wegen der Inhaltsstoffe.<br />
Jetzt, wenn viele Zementwerke auf 100 % Ersatzbrennstoffe<br />
übergehen, wird sich das Produkt dramatisch<br />
verschlechtern, und zwar individuell, nicht global gesehen.<br />
Wenn Sie 40 Zementwerke nehmen, wird ein Mittelwert<br />
das austarieren. Aber je nachdem, was Sie annehmen, je<br />
nachdem, was in dem Fluff drin ist, werden die Inhalte in<br />
Ihrem Zement nicht durch einen Mittelwert deutlich,<br />
sondern da müssen Sie Quartile angeben. Dann könnte<br />
man nachweisen, ob das stimmt, was Sie sagen. Ich sage:<br />
Es stimmt nicht. Ihr Produkt wird schlechter durch den<br />
Einsatz von Ersatzbrennstoffen.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Herr Block, vielleicht dazu: Es ist natürlich wesentlich<br />
leichter, Behauptungen aufzustellen, als sie dann tatsächlich<br />
zu belegen.<br />
Auf der Hand liegt das, wenn ich mir die Altreifen anschaue.<br />
Es werden in den deutschen Zementwerken jedes<br />
Jahr ungefähr 250.000 t an Altreifen eingesetzt. Natürlich<br />
hat der Altreifen einen höheren Zinkeintrag als beispielsweise<br />
eine durchschnittliche Kohle. Aber wichtig ist doch<br />
in der Tat, welche Auswirkungen das auf das Produkt hat.<br />
Schauen Sie sich auf der anderen Seite den Quecksilbergehalt<br />
des Altreifens an: Der ist im Vergleich auch zu<br />
primären Brennstoffen deutlich niedriger. Deswegen<br />
würde kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen: Jetzt<br />
dürfen nur noch Altreifen eingesetzt werden – unabhängig<br />
davon, dass das von der Technik her nicht ginge.<br />
Ich möchte damit sagen: Wir betrachten mittlerweile<br />
mehr oder weniger das halbe Periodensystem. Ich sagte<br />
eingangs bereits: Das ist ein dynamisches System. Es gibt<br />
durchaus Schwankungen, die sich auch in geogenen<br />
Hintergrundbelastungen niederschlagen können.<br />
Das Entscheidende ist, dass die Produktzusammensetzung<br />
als solche sich nicht so verändert, dass in irgendeiner<br />
Form schädliche Auswirkungen für die Nutzer zu<br />
befürchten sind. Das ist sichergestellt; das wird durch<br />
Untersuchungen sichergestellt. Sowohl national als auch<br />
europäisch gibt es ellenlange Forschungsberichte, die<br />
auch zur Verfügung stehen, die genau dieser Frage<br />
nachgehen.<br />
Tatsache ist aber, dass Zement und zementgebundene<br />
Baustoffe nach wie vor im Wesentlichen auch in<br />
hygienisch sensiblen Bereichen, z. B. im Trinkwasserbe-
eich, zum Einsatz kommen. Deren Ungefährlichkeit ist<br />
sichergestellt und gewährleistet.<br />
Stefan Hüsemann (Antragstellerin):<br />
Noch ein kleiner Hinweis, Herr Block: Es kann doch sein,<br />
dass Sie – und vielleicht auch ich – lieber Holzhäuser<br />
bauen und dass der Herr Oerter das Produkt Zement<br />
favorisiert oder nach vorne bringen will. Aber die Behörde<br />
hat hier über eine Anlagengenehmigung zu entscheiden,<br />
und das ist, denke ich, eine äußerste schwere und anspruchsvolle<br />
Aufgabe.<br />
Was die Behörde heute bzw. im laufenden Genehmigungsverfahren<br />
nicht entscheiden kann ist, die Frage nach<br />
der Ökobilanz des Produktes Zement oder einer Produktgenehmigung<br />
oder die Frage, wo der Zement einzusetzen<br />
ist: im Wasserbau oder im Straßenbau oder bei Ihnen zu<br />
Hause.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Da gebe ich Ihnen recht. Aber wir haben in unserer<br />
Einwendung gesagt: In Ihrem Verfahrensprozess könnte<br />
es – ich bin da lediglich Laie – zu einer übermäßigen<br />
Erwärmung des Abgases kommen. Dann könnten eine<br />
Krustenbildung in Ihrem Materialfluss und dadurch eine<br />
Anreicherung von diesen Schadstoffen in Ihrem Produkt<br />
stattfinden. Das sagen diese Wissenschaftlicher. Ich sage<br />
das nicht. Wenn Sie sagen, das sei nicht so, ist das Ihre<br />
Sache. Die sagen aber: Es ist so.<br />
Die sagen weiterhin: Das Entscheidende ist, wie viel<br />
Sie davon einsetzen, wie effektiv Sie das einsetzen. Wenn<br />
Sie auf 100 % Fluff gehen - ich gehe einmal davon aus,<br />
dass es Tage gibt, an denen Sie nur Fluff einsetzen -,<br />
dann werden Sie unter Umständen ein Problem bekommen,<br />
und damit bekommen Sie einen höheren Eintrag von<br />
Schadstoffen.<br />
Gucken Sie sich an, was in den Kunststoffabfällen drin<br />
ist: Chlor. Fragen Sie sich doch einmal, woher das Dioxin<br />
kommt! Wo ist die De-novo-Synthese? Die ist im Abgas;<br />
die kommt daher. Das ist doch in der Immission dann<br />
spürbar und damit auch im Produkt vorhanden. Sie<br />
können mir nicht erklären, dass dem nicht so sei.<br />
Die Wissenschaftler sagen das. Lesen Sie es nach! Es<br />
sind Doktorarbeiten, und es sind wissenschaftliche Abhandlungen,<br />
die hoffentlich nicht von der Industrie gesponsert<br />
sind, sondern die auf guten wissenschaftlichen<br />
Grundlagen beruhen.<br />
Das haben wir in der Einwendung angeführt, Herr Haller,<br />
und deswegen tragen wir es auch vor. Wir haben<br />
gefragt: Wie wird diese Verkrustung in der Anlage in<br />
Wössingen sicher verhindert, wenn Sie 100 % Fluff<br />
einsetzen? Haben die das ausprobiert? Was passiert da in<br />
dem Produkt? Das wollten wir heute auch erörtert wissen.<br />
Deswegen haben wir es eingewendet. Darum gibt es ja<br />
diesen Tagesordnungspunkt.<br />
Seite 26<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich habe das genauso verstanden, Herr Block. Vielleicht<br />
hat jetzt auch Ihre letzte Ausführung noch einmal dafür<br />
gesorgt, dass es Lafarge richtig verstanden hat.<br />
Will noch jemand von Lafarge etwas zu den konkreten<br />
Hinweisen und Fragen sagen? Zum Teil waren das zu den<br />
betriebsinternen Problemen ja Hinweise an Lafarge –<br />
wenn ich das richtig verstanden habe.<br />
(Harry Block [BUND]: Bei Gas hätten Sie es<br />
nicht!)<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Die Anlage ist, wie ich schon erwähnt habe, in den Jahren<br />
2008/2009 modernisiert worden. Bei dem Anlagenkonzept<br />
wurde berücksichtigt, dass die Anlage langfristig mit<br />
Ersatzbrennstoffen, mit unterschiedlichen Brennstoffen zu<br />
fahren ist und dass Emissionen langfristig weiter reduziert<br />
werden können.<br />
Zunächst einmal zum Betrieb einer Anlage: Eine Anlage<br />
wird kontinuierlich überwacht. Wir haben eine 7-Tage-<br />
Produktion und eine 24-Stunden-Überwachung. Wir haben<br />
Leitstandfahrer, die permanent vor Ort sind, die alle<br />
Produktionsparameter – Temperaturen, Emissionsmessungen<br />
– wie auch Qualitätsparameter permanent überwachen.<br />
Kontinuierlich überwacht wird auch über automatische<br />
Probennehmer, wo Materialien gezogen werden.<br />
Außerdem gibt es Anforderungen an die Gleichmäßigkeit<br />
der Eingangsmaterialien. Dies gewährleistet, dass wir<br />
einen kontinuierlichen Permanentbetrieb und einen<br />
gleichmäßigen Austritt haben.<br />
Es gibt – was Sie ansprechen – Anbackungen, sogar<br />
eine gezielte Anbackung im Ofenbereich. Das heißt, damit<br />
der Drehofen autogen geschützt wird, gibt es eine Anbackung.<br />
Dieser Ansatz gewährleistet, dass bei diesen<br />
hohen Temperaturen die Ausmauersteine geschützt<br />
werden. Ansonsten ist ein permanenter Betrieb auch<br />
wichtig, um die Qualität der Materialien herzustellen. Das<br />
ist einfach gegeben.<br />
Ansätze sind durch die Auslegung der Anlage bereits<br />
minimal. Wir haben einen sehr homogenen Ansatz. Wir<br />
haben eine große Ausbrandstrecke in dem Vorwärmerturm,<br />
in dem Calcinator, und wir haben ausreichend<br />
dimensionierte Zyklonstufen, die einen homogenen<br />
gleichmäßigen Betrieb gewährleisten.<br />
Sollte es zu einem Problem mit den Temperaturen<br />
kommen, wird die Anlage automatisch sofort gestoppt. Es<br />
wird dann auch die Brennstoffzufuhr gestoppt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Herr Weber. – Wir haben jetzt zwei Stunden<br />
erörtert. Herr Block, haben Sie zu dem konkreten Thema<br />
noch eine Ergänzungsfrage?<br />
Dann, würde ich vorschlagen, machen wir zehn Minuten<br />
Pause, sorgen für ein bisschen frische Luft und setzen<br />
anschließend mit dem nächsten Ersatzbrennstoff fort. Wir<br />
werden nach der Pause direkt das Tiermehl erörtern, weil
der Kollege von Veterinärseite noch einen anderen Termin<br />
hat. Vielen Dank.<br />
(Unterbrechung von 10:57 Uhr bis 11:13 Uhr)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich bitte Sie alle, wieder Platz zu nehmen.<br />
Wie vor der Pause schon angekündigt, würden wie bei<br />
den Sekundärbrennstoffen weitermachen und als speziellen<br />
Sekundärbrennstoff aufrufen:<br />
Tiermehl<br />
Gibt es von den Einwendern etwas zum Thema Tiermehl<br />
zu sagen?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich gebe nur zum Besten, was mir gerade ein Herr aus<br />
dem Ort sagte, der sich hier sehr gut auskennt: Müllverbrennungsanlage?<br />
– Nein, das sei jetzt auch ein Krematorium.<br />
Da er hat nicht unrecht.<br />
Bei Tiermehl liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier<br />
um eine Entsorgung handelt, die man früher Krematorien,<br />
in dem Fall Tierkörperbeseitigungsanstalten zugeführt hat.<br />
Jetzt hat man ein Zementwerk als Krematorium.<br />
Ich habe zum Tiermehl die Frage: Wie hoch ist der Anteil<br />
an Fetten in diesem Tiermehl?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Fischer von Lafarge.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Der Anteil von Fetten im Tiermehl bewegt sich üblicherweise<br />
zwischen 16 und 18 %.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Zweite Frage: Aus welchen Tierkörperbeseitigungsanlagen<br />
stammt dieses Tiermehl? Tiermehle können Sie seit<br />
2003, glaube ich, oder 2005 nicht mehr in Nahrungsmitteln<br />
versteckt werden. In der Lasagne ist es also nicht mehr.<br />
Jetzt ist es im Zementwerk. Die Frage ist wieder: Verwerten<br />
wir oder beseitigen wir? Umgehen wir das Abfallwirtschaftsgesetz<br />
insoweit, dass wir hier Mülltourismus<br />
machen? Deswegen unsere Frage: Woher stammt das<br />
Tiermehl?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Fischer.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Das Tiermehl, das wir in der Vergangenheit eingesetzt<br />
haben, stammte aus zertifizierten TBAs hier aus der<br />
Region bzw. auch weiter weg, z. B. aus Orsingen, aus<br />
Plattlingen, aus Warthausen oder auch aus der Europäischen<br />
Gemeinschaft,<br />
(Harry Block [BUND]: Ja!)<br />
Seite 27<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
aus dem Hause SARIA beispielsweise. Das sind alles<br />
Tiermehle, die den Nachweis über die entsprechende<br />
Herstellung haben und die, wie gesagt, bei uns eingesetzt<br />
wurden. – Ich betone den Bezug auf die Vergangenheit.<br />
Ich denke, der Kollege wird selber noch etwas dazu<br />
sagen.<br />
Ein kurzer Hinweis noch: Wirklich spruchreif wurde die<br />
thermische Verwertung von Tiermehl im Zusammenhang<br />
mit BSE. Sie wissen sicherlich, dass bis dahin Tiermehl zu<br />
100 % verfüttert wurde.<br />
Heute sind diese Tiermehle in drei Kategorien eingeteilt.<br />
Hier bei der thermischen Verwertung reden wir nur<br />
über die Kategorie 1, die von der Einstufung her als<br />
biologisch gefährlich betrachtet wird, weil es irgendwelche<br />
Tiere waren, die vielleicht krank oder was auch immer<br />
waren.<br />
Dann durchläuft dieses Tier einen ganz speziellen definierten<br />
Prozess. – Das möchte ich jetzt aber nicht vorwegnehmen.<br />
Ich hatte es so verstanden, dass Vertreter<br />
vom Land noch etwas dazu sagen wollen, wie das grundsätzlich<br />
funktioniert.<br />
Das bedeutet aber auch – dies als letzte Bemerkung<br />
meinerseits –, dass die Menge von Tiermehl, die in die<br />
thermische Verwertung geht, in der gesamten Entwicklung<br />
jetzt wieder sehr stark zurückgeht. Wir in Wössingen<br />
setzen seit einiger Zeit überhaupt kein Tiermehl mehr ein.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Uns interessiert schon: Wie viel Tiermehl ist beabsichtigt<br />
einzusetzen? Sie sagen ja richtig: Es handelt sich um<br />
Tiere, die problematisch sein können, und eine "Vorbehandlung",<br />
eine Trocknung unter Umständen, gibt es da<br />
nicht. So einen Transport durch meinen Ort, den halte ich<br />
jetzt nicht – –<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Entschuldigung, ich hatte klar gesagt: Wir setzen keine<br />
Tiere ein.<br />
(Harry Block [BUND]: Nein, nein; das ist<br />
schon klar!)<br />
Wir setzen bzw. setzten Tiermehl ein, das in einem ganz<br />
bestimmten Prozess nach deutschen Gesetzen produziert<br />
wurde.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ja, da gibt es die verschiedenen Gefährdungsklassen des<br />
Tiermehls. Die Frage ist noch einmal unter dem Gesichtspunkt<br />
verwerten oder beseitigen: Welche spezifische Art<br />
des Tiermehls nehmen Sie? Wie hoch ist die Tonnage?<br />
Woher kommt es? Sie hatten angedeutet, es kommt auch<br />
aus dem Ausland. Ich weiß nicht, ob das noch unter das<br />
Abfallwirtschaftsgesetz fällt oder wie Sie das dann hier<br />
irgendwie hineinbringen wollen.<br />
In Deutschland haben wir 750.000 t laut Statistik. Bei<br />
den 40 Zementwerken, wo das sicherlich mit drin ist,<br />
kommen ja Summen zusammen. Deswegen wäre die Zahl
für uns schon wichtig. Wie viel Tonnen wollen Sie einsetzen?<br />
Deswegen war auch die Frage nach den Fetten<br />
gestellt worden. Der Fettgehalt entscheidet doch ganz<br />
stark darüber, was das für Tiermehl ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, die Frage zu den Fetten ist beantwortet. Wenn<br />
ich Herrn Fischer richtig verstanden habe – jetzt nur noch<br />
einmal für mich zum Verständnis –, war die Aussage, dass<br />
der Einsatz von Tiermehl stark rückläufig ist und aktuell<br />
keines eingesetzt wird. Habe ich das richtig verstanden?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Absolut richtig verstanden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wenn Sie damit einverstanden sind, Herr Block, würde ich<br />
den Vorschlag machen, weil dieses Einbringen von<br />
Tiermehl in solche Anlagen ganz generell europäisch und<br />
auch national geregelt ist, dass Herr Dr. Zapf vom Regierungspräsidium<br />
Karlsruhe, Referat 35, ein paar Worte zur<br />
allgemeinen Situation sagt. Das wäre für das Verständnis<br />
der Zusammenhänge sicherlich sehr gut.<br />
(Harry Block [BUND]: Das fände ich gut,<br />
denn die wollen das ja genehmigt haben!)<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Auch ich begrüße Sie hier ganz herzlich. Ich freue mich,<br />
dass ich ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann, was<br />
ja im Interesse dieser Veranstaltung liegt.<br />
Ich möchte erst einmal sagen, dass das, was Sie jetzt<br />
gerade angeführt haben, Herr Block, in der Realität so<br />
nicht stattfindet. Ich sage einmal, was in der Realität<br />
stattfindet.<br />
Richtig ist: Wir haben drei Kategorien. Seit 2001, seit<br />
dieser BSE-Krise, hat die EU das so geregelt. Gott sei<br />
Dank gibt es diese Krise nicht mehr; sie ist durch diese<br />
Maßnahmen bewältigt worden. Das muss man hier einmal<br />
ganz deutlich sagen.<br />
Zur Kategorie 1: Das sind tote Heimtiere, die zu Tiermehl<br />
und Tierfett verarbeitet werden, das sind alle Rinder,<br />
weil diese damals die krankmachenden Prionen entwickelt<br />
haben, und das sind aus der Schlachtung entnommene<br />
zentrale Nervensystemanteile, die eben für diese Prionen<br />
das entsprechende Organ waren.<br />
Die EU hat dann beschlossen: Diese Kategorie 1 muss<br />
zu einem Tiermehl verarbeitet werden, das sicher ist. Man<br />
hat dazu gesagt: Auf 133 °C über 20 Minuten und 3 bar<br />
muss dieses Tiermaterial nach seiner Zerkleinerung erhitzt<br />
werden, damit es keine zumindest theoretische Gefahr<br />
mehr für Mensch und Tier sein kann.<br />
Die BSE-Krise hat die EU dazu gebracht zu sagen: Wir<br />
wollen einen Schritt weiter gehen; wir wollen dieses<br />
Tiermehl, auch wenn eigentlich keine Gefahr mehr besteht,<br />
nicht weiter in der Fütterungskette haben, wo es<br />
vorher drin war, wir wollen es nicht weiter in der Düngemit-<br />
Seite 28<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
telkette haben, sondern wir wollen es nur noch der Verbrennung<br />
oder Mitverbrennung zuführen.<br />
Tiermehl ist ein biologischer Eiweißstoff, der einen<br />
sehr guten Brennwert hat. Er ist, glaube ich, um ungefähr<br />
ein Drittel geringer als bei Braunkohle. Von der Seite kam<br />
das überhaupt auf, dass die Industrie für dieses Tiermehl<br />
Kategorie 1 Interesse gezeigt hat. Ich denke, so ist es<br />
letztendlich auch in der Zementindustrie gewesen.<br />
Wir sprechen hier von einem ungefährlichen Stoff, weil<br />
jegliche mikrobiologischen Gefahren durch diesen Tiermehlverarbeitungsprozess<br />
bereits ausgeschlossen sind.<br />
Es geht jetzt eigentlich nur noch um die weitere Verwendbarkeit:<br />
Die einzige Verwendbarkeit, die möglich ist, ist die<br />
Verbrennung oder Mitverbrennung. Deswegen wird es<br />
auch von der Zementindustrie mitverwendet. Biologische<br />
Gefahren bestehen also keine mehr, weder beim Transport<br />
noch in dem eigentlichen Betrieb, wenn das Tiermehl<br />
ordnungsgemäß gelagert und verbrannt wird. – So weit<br />
zum Herstellungsprozess.<br />
Wir haben kein Krematorium. Ein Krematorium ist etwas<br />
ganz anderes. In einem Krematorium werden tote<br />
Tiere direkt verbrannt. Das ist hier absolut nicht der Fall.<br />
Das Tierfett, das in der Tierkörperbeseitigungsanstalt<br />
zusätzlich abgepresst wird, geht in die Biodieselherstellung.<br />
Das ist also auch ein Brennstoff. Insofern haben wir<br />
zwei Brennstoffe in der Kategorie 1: einmal Tiermehl und<br />
einmal Fett als Biodiesel. Beides hat kein besonderes<br />
Risiko mehr.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Dr. Zapf. Ich glaube, dass das den Sachverhalt<br />
weiter geklärt hat. Aber konkret eine Nachfrage dazu.<br />
Monika Siech (Einwenderin):<br />
Dr. Zapf sagte gerade, dass Gefahren nicht bestehen,<br />
wenn ordnungsgemäß gelagert und verbrannt wird. Ich<br />
hätte gerne gewusst: Wenn nicht ordnungsgemäß gelagert<br />
und verbrannt wird, was ist dann?<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Dann kann es nicht in diesen Betrieb hineinkommen. Das<br />
ist ein zulassungs- oder registrierungspflichtiges Verfahren.<br />
Jeder Betrieb, der Tiermehle bekommt, muss gewisse<br />
Anforderungen, die die EU für diese Mitverbrennung<br />
festgelegt hat, erfüllen. Das wird hier vom Veterinäramt in<br />
Karlsruhe, Landratsamt Karlsruhe, überwacht, und so ist<br />
es hier auch erfolgt. Wir haben hier ein ganz normales<br />
Registrierungsverfahren für die Mitverbrennung von<br />
Tiermehl gehabt, um die Voraussetzungen zu prüfen, dass<br />
diese Anforderungen eingehalten werden.<br />
Aus diesem Grund geht es nicht, was Sie sagen, dass<br />
jemand sich irgendwie Tiermehl liefern lässt und das<br />
mitverbrennt, sondern da ist ein überwachtes Zulassungs-<br />
oder Registrierungsverfahren für die Annahme von Tiermehl<br />
erforderlich.
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Dr. Zapf, wir wissen ja aus den Skandalen der letzten<br />
paar Wochen, was alles zertifiziert ist und was alles<br />
passieren kann. Müll hat ja immer ein Geschmäckle; wir<br />
kennen das seit Langem. In diesem Fall ist es "Müll", der<br />
auch noch Geld bringt.<br />
Wie oft haben Sie hier in Wössingen die Tiermehle<br />
kontrolliert? Wie oft wird das passieren? Können Sie sich<br />
vorstellen, dass die von jeder Anlieferung eine kleine<br />
Probe nehmen, sodass man das nachkontrollieren kann,<br />
wenn jemand irgendwann einmal die Behauptung aufstellt:<br />
„Da war ja etwas anderes drin als das, was die behauptet<br />
haben.“? Wenn das erst verbrannt ist, gibt es überhaupt<br />
nichts mehr nachzukontrollieren. Gibt es so eine Kontrolle?<br />
Gibt es eine Kontrolle bei Ihnen im Werk, ob das wirklich<br />
stimmt, was da behauptet wird, was auf dem Lieferschein<br />
steht? Papier ist geduldig; da steht alles drauf. Die<br />
Frage meiner Vorrednerin war mehr als berechtigt: Was<br />
passiert, wenn das nicht ordnungsgemäß abläuft? Besteht<br />
dann tatsächlich eine Gefahr? Und wie oft kontrollieren<br />
Sie?<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Ich habe gesagt, dass das Tiermehl als solches und auch<br />
das Tierfett einen gewissen Erhitzungsprozess hinter sich<br />
haben, nach dem keine mikrobiologischen Gefahren mehr<br />
bestehen.<br />
Dass die Anforderungen an die Lagerung und Weiterverwendbarkeit<br />
in einem Betrieb erfüllt sein müssen,<br />
davon hat sich das Veterinäramt Karlsruhe überzeugt, und<br />
es überzeugt sich in unregelmäßigen Abständen immer<br />
wieder davon. – Ich bin nicht Überwachungsbehörde. Ich<br />
bin hier lediglich der Informant für dieses Verfahren hier.<br />
Dass da kein reines Tiermehl angeliefert wird, kann<br />
man ganz einfach dadurch ausschließen, dass man bei<br />
der Anlieferung dabei ist und sich das anguckt. Tiermehl<br />
hat ein ganz spezielles Aussehen und einen eigenen<br />
Geruch. Da kann nichts anderes drin sein, weil es nämlich<br />
nur von einer zugelassenen Anlage kommt. Dort wird es<br />
hergestellt, dann wird es im Silo-Transportfahrzeug<br />
abtransportiert und hier angeliefert. Dieses Fahrzeug ist<br />
verplombt. Das heißt, es geht vom Herstellungsbetrieb<br />
direkt verplombt zu diesem Zementwerk. Ich weiß nicht,<br />
wie dann da noch etwas anderes hineinkommen soll.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Bitte.<br />
Gisela Kassner (Einwenderin):<br />
Ich bin Bewohnerin aus Wössingen, und ich habe ebenfalls<br />
eine Frage zu dem Tiermehl. Uns allen ist bekannt,<br />
dass Tiere übermäßig mit Antibiotika und anderem gefüttert<br />
werden. Was passiert mit den Medikamentenrück-<br />
Seite 29<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
ständen in dem Tiermehl? Ich glaube nicht, dass die sich<br />
einfach in Luft auflösen.<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Die Medikamentenrückstände in diesen Tiermaterialien<br />
gehen bei dem Verarbeitungsprozess – 130 °C, 3 bar,<br />
20 Minuten – selbstverständlich verloren. Das heißt, die<br />
werden zersetzt. Anschließend werden sie im Zementwerk<br />
vollständig verbrannt. Bei diesen Eiweißstoffen sind kaum<br />
Aschereste übrig; die sind praktisch zu 100 % verbrennbar.<br />
Am Schluss bleiben einige wenige Spurenelemente<br />
übrig. Soweit ich weiß, spielt Phosphor da eine Rolle. Aber<br />
alles andere verbrennt vollständig während dieses Verbrennungsprozesses.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Dr. Zapf, für mich wäre es schon wichtig zu wissen –<br />
auch an Lafarge gerichtet –: Gibt es von Ihrer Seite eine<br />
Überwachung, wenn Tiermehl eingesetzt wird? Gibt es<br />
diese Sichtkontrolle? Haben Sie ausgebildete Mitarbeiter,<br />
die das kontrollieren? Und wie oft wird das untersucht?<br />
Das ist schon interessant, wie oft so etwas kontrolliert<br />
wird. Es gilt ja immer: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist<br />
besser!". Man kann sich schon fragen, warum solche<br />
Transporte verplombt sind. Was kann ich nicht alles im<br />
Müll verstecken! Wir wissen das.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Bei der Anlieferung gibt es ganz klare Prozeduren: Es ist<br />
ein Mitarbeiter bei der Anlieferung vor Ort. Es gibt eine<br />
Gefährdungsbeurteilung, eine Anweisung letztendlich, wie<br />
die Annahme zu erfolgen hat. Es wird dann, wie gesagt,<br />
optisch kontrolliert. Die Anlieferung erfolgt verplombt. Die<br />
Plombe wird entsprechend gelöst. Sie wird auch aufgehoben<br />
mit den Papieren und allen Begleitscheinen, die für<br />
die Anlieferung von Tiermehl notwendig sind. Das wird<br />
dokumentiert und der Behörde auf Verlangen bei den<br />
Überprüfungen vorgezeigt. Wir können also eine Gefährdung<br />
hundertprozentig ausschließen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Villano. - Stellen Sie sich bitte kurz vor!<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Anette Sorg, Walzbachtal. Eine Frage, Herr Dr. Zapf:<br />
Handelt es sich bei dem Transport um einen Gefahrguttransport?<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Das ist kein Gefahrguttransport. Es ist biologisches<br />
Material, das keinerlei Gefährdungsklasse zu erfüllen hat.<br />
Es ist ein ganz normaler Transport von Tiermehl. Deswegen<br />
sage ich ja: Es ist kein Gefahrengut, womit man hier<br />
zu tun hat.
Wir haben hier auch keinen Abfall, sondern das ist tierisches<br />
Nebenprodukt, und das Tierische-Nebenprodukte-<br />
Recht, das die Verwendungs- und Bearbeitungsanforderungen<br />
in der EU beschreibt, macht Unterschiede zum<br />
Abfall.<br />
Abfall ist etwas ganz anderes. Das sind alles Stoffe,<br />
die praktisch im Referat von Herrn Haller bearbeitet<br />
werden. Die Veterinäre kümmern sich um die toten Tiermaterialien,<br />
die an Schlachthöfen anfallen und die dann in<br />
diesen spezialisierten Betrieben zu Tiermehl und Tierfett<br />
weiterverarbeitet werden.<br />
Wir haben da keine besonderen Gefahren. Deswegen<br />
ist es auch kein Gefahrengut.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Dr. Zapf. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Der Herr Haller hat so gut wie keinen Abfall mehr. Es gibt<br />
nur noch Wertstoffe. In dem Augenblick, wo Sie was auch<br />
immer in die Mülltonne tun, ist es für irgendjemanden ein<br />
Wertstoff. Auch dieses Tiermehl ist natürlich ein Wertstoff.<br />
Abfall gibt es also gar nicht mehr. „Müllverbrennungsanlage“<br />
ist eigentlich ein Euphemismus, weil es den Müll ja<br />
nicht mehr gibt. Es ist ein Wertstoff, der darin verbrannt<br />
wird. Es ist alles immer nur Wertstoff.<br />
Eins verstehe ich nicht: Worin besteht diese Sicherheit<br />
mit dieser Verplombung? Das ist interessant, das wusste<br />
ich nicht. Aber wenn ich etwas verplombe, habe ich doch<br />
ein höheres Sicherheitsinteresse; sonst würde ich das<br />
doch nicht machen. Oder?<br />
Dr. Frank Zapf (RP Karlsruhe):<br />
Das ist einfach eine Anforderung. Wenn Tiermehl aus<br />
anderen Mitgliedstaaten verbracht wird, will man verhindern,<br />
dass diese Transporte, die von dem Ursprungsbetrieb<br />
bis zum Empfängerbetrieb möglicherweise eine<br />
längere Zeit brauchen, von den Transporteuren manipuliert<br />
werden können.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, jetzt muss ich eine Forderung stellen. Da wir<br />
es nicht eingewendet haben, ist sie nicht beklagbar. Aber<br />
ich stelle sie trotzdem.<br />
Es darf kein Tiermehl aus außereuropäischen Ländern<br />
kommen. Das Tiermehl muss eindeutig aus einer deutschen<br />
Beseitigungsanlage stammen. Sonst wären, wenn<br />
der Weg beispielsweise über Rumänien ginge und dort<br />
irgendwo das Ganze in einen Lkw umgepackt würde,<br />
Haus und Hof geöffnet.<br />
Wir fordern also, dass nur regionale Beseitigungsbetriebe<br />
dieses Tiermehl hier zur Entsorgung anliefern<br />
dürfen und dass kein anderes, schon gar nicht ausländisches<br />
Tiermehl hier angebracht wird – egal, was die jetzt<br />
machen, und egal, was Sie jetzt entscheiden. Wir fordern<br />
es jetzt einfach einmal.<br />
Seite 30<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wie gesagt, ich kann das nicht gerichtlich angehen,<br />
weil wir das nicht eingewendet haben. Aber die Diskussion<br />
beweist doch, dass es auch aus dem Ausland kommen<br />
kann. Bei Lafarge, einer französischen Firma, könnte ich<br />
mir vorstellen, dass es da Beziehungen woandershin gibt.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, ich habe eine Nachfrage. Habe ich Sie richtig<br />
verstanden? Haben Sie „außereuropäisch“ gesagt oder<br />
„ausländisch“ generell?<br />
(Harry Block [BUND]: Ausländisch!)<br />
Generell ausländisch. Ich dachte, ich hätte „außereuropäisch“<br />
verstanden.<br />
(Harry Block [BUND]: Nein, nein!)<br />
Also ausländisch, okay.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Von meiner Seite noch, weil Herr Dr. Zapf jetzt da ist und<br />
es uns zur Information dient: Diese ganzen Tierische-<br />
Nebenprodukte-Regelungen sind meines Wissens nach<br />
europaweit geltende Regelungen. Das heißt, dieses<br />
Prozedere, das Herr Dr. Zapf dargestellt hat, ist entsprechend<br />
europaweit geregelt und gleich geregelt. Das nur<br />
als Hinweis dazu.<br />
Wir haben Ihren nachträglichen Antrag zur Kenntnis<br />
genommen – das steht ja auch im Protokoll –, aber nur als<br />
Info. – Frau Vangermain.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ich bin mir nicht ganz sicher: Habe ich es richtig verstanden,<br />
dass Sie eigentlich kein Tiermehl einsetzen wollen?<br />
Zu Beginn wurde das gesagt. Dann habe ich nämlich eine<br />
Frage dazu.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Aktuell setzen wir kein Tiermehl ein – aktuell!<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Das heißt, Sie beabsichtigen aber wieder, welches einzusetzen.<br />
Sonst würde ja ein Genehmigungsantrag über<br />
diesen Punkt hinfällig sein. Sonst hätte das doch keinen<br />
Zweck. Dann sprächen wir hier über weiß der Himmel<br />
was.<br />
(Harry Block [BUND]: Ungelegte Eier!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Fischer.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Ich hatte richtig gesagt, dass wir aktuell keins einsetzen.<br />
Ihre Frage zielt darauf ab: Wie planen wir in Zukunft? Die<br />
Frage ist ja: Warum setzen wir im Moment keins ein? Das<br />
hängt einfach mit den marktüblichen Bedingungen zusammen,<br />
nicht mehr und nicht weniger.<br />
Um Ihre Frage ganz klar zu beantworten: Wir haben<br />
hier nicht beantragt, mehr Tiermehl einzusetzen als heute;
das ist auch nicht unsere Absicht. Es kann aber durchaus<br />
sein, das wir es irgendwann wieder als sinnvoll erachten,<br />
im Gesamtprozess diesen Brennstoff mit einzusetzen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielleicht noch einmal zur Erläuterung: Der Antrag ist so<br />
gestellt, dass in den Szenarien, die betrachtet wurden –<br />
heute Morgen zu Beginn der Veranstaltung hatte Herr<br />
Weber diese kurz vorgestellt –, 10 % Tiermehl in der<br />
Zusammensetzung der Sekundärbrennstoffe beantragt<br />
sind – korrigieren Sie mich ggf. bitte –, und von diesen<br />
10 % müssen wir als Genehmigungsbehörde ausgehen.<br />
Darauf sind auch die Emissionen und Immissionen zurückzuführen.<br />
Das wird heute im Fortgang der Veranstaltung<br />
noch ein Thema sein. Das ist auch Grundlage für den<br />
heutigen Termin.<br />
Herr Block, Sie haben keine Anmerkungen mehr? –<br />
Dann geht mein Dank an Herrn Dr. Zapf für die Information.<br />
Wir fahren dann in der Tagesordnung fort und kommen<br />
zum Thema<br />
Radioaktivität.<br />
Auch das war ein zentraler Punkt der Einwendungen.<br />
Wir kommen bei der gesamten Diskussion immer wieder<br />
auf das Thema Qualitätssicherung zu sprechen. Das<br />
hat sich eben schon beim Tiermehl gezeigt. Ich denke,<br />
das wird auch eines der großen Themen bei der Radioaktivität<br />
sein.<br />
Wer möchte zu diesem Thema etwas sagen? – Herr<br />
Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das ist mit Sicherheit kein Hauptthema. – Es geht hier um<br />
Müll, der aus Industrieanlagen kommt. Zu den Industrieanlagen<br />
zählen z. B. Universitäten, Forschungsinstitute oder<br />
Arztpraxen. Dort wird mit Radioaktivität umgegangen. Wir<br />
reden jetzt nicht von Atomkraftwerken, sondern wir reden<br />
von Tracern in der Medizin und in Wissenschaftsbereichen.<br />
Tracer werden z. B. bei Daimler zur Materialprüfung<br />
eingesetzt. Das sind radioaktive Stoffe. Diese radioaktiven<br />
Stoffe befinden sich im Müll. Die schmeißen die einfach<br />
weg. Natürlich gibt es Vorschriften, wie man damit umzugehen<br />
hat, aber die werden aus Kostengründen in vielen<br />
Bereichen einfach ignoriert.<br />
Deswegen unsere Frage: Die Radioaktivität wird sich<br />
hauptsächlich im Fluff befinden. Was können die Firmen,<br />
die diesen Fluff untersuchen, messen?<br />
Wir haben hier in Karlsruhe ein Institut für Transurane,<br />
und die haben große Probleme z. B. mit plutoniumhaltigem<br />
Müll. Sie werden fragen: Wie kommt Plutonium in<br />
Müll hinein? Es könnte aus einem Versuchsreaktor einer<br />
Universität stammen. Das könnte theoretisch sein. Bei-<br />
Seite 31<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
spielsweise könnte ein Handschuh von da weggeschmissen<br />
worden sein.<br />
Können die auf Alpha-Strahler prüfen? Gamma ja,<br />
aber Alpha? Können Sie das nachweisen? Ich sage Ihnen:<br />
Nein. Das einzige Institut, das das kann, ist das Forschungszentrum<br />
draußen in Karlsruhe. Sie können es<br />
letztendlich nicht nachprüfen. Damit wird es sich – davon<br />
gehen wir aus – auch in diesem Müll befinden.<br />
Aber sprechen wir einmal nicht von Alpha, sondern<br />
von Beta oder Gamma. Die Firma sagt Ihnen: Wir haben<br />
das untersucht. Nun habe ich in Karlsruhe, wo auch<br />
zertifizierter Müll für z. B. Stora Enso angeliefert wird,<br />
noch nie einen Geigerzähler gesehen. Wie kontrollieren<br />
die den Fluff auf Radioaktivität? Das würde mich interessieren.<br />
Und wie – wieder: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist<br />
besser" – kontrollieren Sie selber es, ob da Radioaktivität<br />
drin ist?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ganz kurz: Wir reden hier nicht über den Müll bei Stora<br />
Enso. – Wir geben die Frage konkret an Lafarge weiter.<br />
Herr Fischer kann dazu etwas sagen.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Vielleicht kann ich an der Stelle kurz einmal beschreiben,<br />
wie im Prinzip die Abläufe sind, bis der Fluff bei uns im<br />
Werk angekommen ist und zur thermischen Verwertung<br />
zur Verfügung steht.<br />
Grundsätzlich arbeiten wir immer mit entsprechend<br />
zertifizierten Unternehmen zusammen, die die Aufgabe<br />
haben, den Fluff, den Brennstoff so zu produzieren, dass<br />
er unseren Anforderungen entspricht. Da geht es um zwei<br />
Dinge: zum einen um die umweltrelevanten Anforderungen<br />
und zum anderen um die qualitativen Anforderungen<br />
durch den Produktionsprozess, den wir haben.<br />
Uns interessiert im Moment Punkt eins. Das bedeutet,<br />
solche Anlagen haben von der zuständigen Genehmigungsbehörde<br />
die Auflage bekommen, nur bestimmte<br />
Stoffströme in ihrem Input anzunehmen. Diese Stoffströme<br />
werden nach deutschem Abfallrecht hinsichtlich der<br />
Abfallschlüsselnummern kategorisiert, und die wiederum<br />
beschreiben die Herkunft.<br />
Das heißt, es wird bei der Genehmigung des Produzenten<br />
von Brennstoff schon vorgeschrieben: Diese fünf<br />
oder sieben verschiedenen Abfallschlüsselnummern darfst<br />
du für die Produktion des Brennstoffs nehmen. Das sind<br />
Abfallschlüsselnummern, die ausschließen, dass Radioaktivität<br />
überhaupt ein Thema wird. Es sind keinerlei Abfallschlüsselnummern<br />
dabei, die z. B. aus dem Bereich der<br />
Medizin kommen. Ich kenne keinen Aufbereiter, der<br />
irgendwelche medizinischen Abfälle annehmen darf. Es<br />
wird mit dieser Art der Kategorisierung also ausgeschlossen,<br />
dass die Radioaktivität überhaupt ein Thema wird.<br />
Dann erfolgt die Produktion. Während der Produktion<br />
werden Qualitätsparameter überprüft. Dazu gehört nicht<br />
Radioaktivität – das ist richtig –, und zwar genau aus dem
Grund, den ich gerade genannt habe. Dazu gehören<br />
vielmehr die üblichen Umweltparameter, wie Schwermetalle,<br />
und die üblichen Prozessparameter, also Heizwerte,<br />
Feuchte, Chlor usw. Das sind alles Parameter, die in<br />
diesem Prozess geprüft werden. – Aber ich denke, das<br />
Werk selber wird noch auf die Qualitätskontrollen zu<br />
sprechen kommen. Das ist ja jetzt ein anderes Thema.<br />
Ich will damit ausdrücken: Diese Gesamtabläufe, die<br />
hinter der Produktion von Fluff bis zur Annahme im Zementwerk<br />
stehen, sind eigentlich die Basis dafür, um von<br />
vornherein sagen können: Radioaktivität ist für uns einfach<br />
kein Thema.<br />
(Harry Block [BUND]: Was nicht sein kann<br />
und nicht sein darf! Das ist aber ein Thema!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, Sie wollten noch einmal vertiefen.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Fischer, das ist alles richtig. Wir sind aber wegen der<br />
Probleme hier, die wir alle kennen. Sie haben doch die<br />
Skandale der letzten Wochen gesehen. Es werden doch<br />
immer nur ein paar öffentlich. Beim Müll wird getrickst<br />
ohne Ende. Hier sitzt die BI Müll; die beschäftigt sich seit<br />
30 Jahren mit nichts anderem als Müll. Die kennt jede<br />
Müllverbrennungsanlage. Die hat Thermoselect verhindert,<br />
die hat sich über Müll genau informiert.<br />
Wir haben uns den Müll angesehen. Wir sind in den<br />
Müllsortieranlagen herumgekrochen, haben den Mist<br />
eingeatmet und haben den Leuten zugesehen, was da<br />
passiert. Wir haben die Zertifizierung gesehen. Wir haben<br />
gesehen, was die anliefern. Das ist ein Katastrophe, was<br />
da stattfindet.<br />
Sie sagen: Von Arztpraxen nehmen die nichts. Arztpraxen<br />
lassen sich z. B. von einer Entsorgungsfirma in<br />
Karlsruhe entsorgen. Die Entsorgungsfirma sagt: Das ist<br />
Industriemüll. Der Industriemüll geht irgendwohin. Die<br />
Arztpraxis hat gerade einen Tracer benutzt, eine Jod-<br />
Untersuchung gemacht, und der benutzte Handschuh ist<br />
nun radioaktiv. Der Arzt sagt: Das ist nichts. Der wirft das<br />
weg.<br />
Sie sagen klar, es darf nicht drin sind. Aber das Problem<br />
ist: Es ist drin. Die Frage ist: Wie schließt man das<br />
aus? Ich würde den Leuten nicht einmal kriminelle Energie<br />
unterstellen. – Aber seit Hoeneß glaube ich gar nichts<br />
mehr. – So etwas ist halt möglich.<br />
Deswegen möchte ich, dass Sie es selber überprüfen<br />
– Sie selbst! Glauben Sie nicht das, was Ihnen Ihr Zertifizierer<br />
erzählt! Darum möchte ich wissen, was in Ihre<br />
Anlage hineingeht, und möchte wissen, ob Sie eine<br />
Möglichkeit haben, das zu prüfen. Ich will das jetzt nicht<br />
für einen Stoff, der nur eine ganz geringe Strahlungsintensität<br />
hat. Aber bei z. B. gamma-indiziertem Material<br />
müssen Sie sagen können: Freund, das kann ja nicht sein,<br />
was du mir hier gibst! Deswegen soll eine Untersuchung<br />
stattfinden.<br />
Seite 32<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Block. – Wollten Sie seitens Lafarge noch<br />
etwas dazu sagen? Das Thema Qualitätssicherung ist aus<br />
meiner Sicht ein ganz zentrales bei diesem ganzen<br />
Prozess. Aber wenn Lafarge nichts mehr zu sagen hat, ist<br />
das für mich erledigt.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, ich habe es angedeutet: Die Radioaktivität ist<br />
in dem Fall sicherlich von untergeordneter Bedeutung.<br />
Das sehen auch wir so. Aber sie muss kontrolliert werden.<br />
Sie können sich nicht auf den Abfallschlüssel berufen und<br />
sagen: Das kann darin nicht vorkommen. Das kann nicht<br />
sein. Das geht nicht.<br />
Ihr Zement wird ebenfalls kontrolliert. Sie können nicht<br />
einfach bei der Stadt Karlsruhe behaupten: Das ist der<br />
und der Zement. Die kontrollieren das nach. Die geben<br />
einem Institut den Auftrag und fragen: Stimmt das, was die<br />
da sagen? Die glauben Ihnen das nicht. Dabei sind Sie ein<br />
zertifizierter Betrieb. Sie sind hier sogar heimisch und man<br />
kennt Sie. Auch wenn jemand sagt: „Ich vertraue dem<br />
Herrn Villano aufs Wort“, müssen sie es trotzdem kontrollieren,<br />
und sie kontrollieren es zu Recht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, das Thema ist angekommen; es wird auch<br />
mitgenommen. Ob Lösungen für solche Themen immer<br />
direkt parat sind, ist hier fraglich. Denn die Ideen, um z. B.<br />
Radioaktivität an so einer Anlage zu kontrollieren, sind<br />
zumindest nicht standardmäßig verbreitet. Ich kenne<br />
keinen Abfallverwerter, der dies standardmäßig prüft. Das<br />
hatten Sie, glaube ich, eingangs auch so ausgeführt. Wir<br />
sind an einem Punkt, wo man im Bereich der Entwicklung<br />
ist und worüber man nachdenken muss. Aber ich glaube,<br />
diese Botschaft ist klar angekommen.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ich habe eine Nachfrage zum Verständnis an Sie, Herr<br />
Haller. Sie haben zu Herrn Block gesagt: Wir reden hier<br />
nicht über die Müllverbrennung in der Papierfabrik Stora<br />
Enso. Wie kommen Sie jetzt darauf?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Er hat gesagt, dass er weiß, dass bei Stora Enso keine<br />
Radioaktivität untersucht wird. Jetzt will er wissen, wie das<br />
bei Lafarge stattfindet.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Aber wir gehen doch davon aus, dass hier genauso wie<br />
bei Stora Enso Müll verbrannt wird.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir gehen davon aus, dass wir heute den Antrag von<br />
Lafarge Zement erörtern.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, ich versuche immer Beispiele aus dem wirklichen<br />
Leben zu bringen.
Verhandlungsleiter Haller:<br />
Ja, ist in Ordnung.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Es nützt nichts, wenn ich Ihnen irgendetwas erzähle vom<br />
Otto. Der Witz ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben<br />
– ich bin bei vielen Erörterungsterminen dabei –, dass in<br />
diesem und in jenem Betrieb nicht kontrolliert wird.<br />
Deswegen auch die Frage an Herrn Dr. Zapf: Wie oft<br />
kontrollieren Sie das? Wir stellen halt immer wieder fest:<br />
Es findet keine Kontrolle statt. Das ist unser Problem.<br />
Unser Problem ist, dass vonseiten der Aufsichtsbehörden<br />
keine Kontrollen stattfinden. Die sind überfordert. Ich<br />
mache Ihnen da um Gottes Willen keinen Vorwurf, aber es<br />
ist so.<br />
Dann wird den Bürgerinnen und Bürgern und uns suggeriert,<br />
es würde kontrolliert werden. Das ist zum Teil<br />
sicher richtig, aber zum Teil stimmt es nicht. Deswegen<br />
fordern wir ein, dass das kontrolliert wird. Wirklich wichtig<br />
ist das am Tor vorne am Zementwerk. Da ist es wirklich<br />
wichtig, dass dort eine Kontrolle stattfindet.<br />
Wir kennen Beispiele von anderen, wo es auch nicht<br />
passiert. Das finden wir nicht gut. Bei Stora Enso war es<br />
nicht in der Genehmigung drin. Das ist erst anderthalb<br />
Jahre her oder so. Da war es nicht in der Genehmigung.<br />
Wir versuchen in jedem Erörterungstermin, irgendetwas<br />
durchzusetzen, was Stand der Technik ist, was problemlos<br />
geht, damit es einmal gemacht wird.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist gutes Stichwort: Stand der Technik. Stand der<br />
Technik sieht auch Qualitätssicherung und entsprechende<br />
Kontrollen vor. Herr Dr. Zapf, der inzwischen nicht mehr<br />
da ist, hat ausgeführt, wie die Kontrollen im Bereich des<br />
Tiermehls stattfinden. Genauso hat Lafarge inzwischen<br />
einiges gesagt, wie man dort generell mit dem Thema<br />
Qualitätssicherung umgeht. Aber dazu kommen wir noch.<br />
Ich möchte weiterführen zu dem Thema:<br />
Qualitätssicherung/Fluff<br />
Die Qualitätssicherung gilt allerdings nicht nur beim Fluff,<br />
sondern aus unserer Sicht ganz allgemein. – Wollen Sie<br />
direkt vortragen, Herr Block?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Uns geht es beim Fluff darum, ob hier nicht das Abfallgesetz<br />
und das Kreislaufwirtschaftsgesetz konterkariert<br />
werden.<br />
Irgendjemand von der anderen Seite hat gesagt – ich<br />
weiß nicht, wer es war –: Es sind wirklich nur die letzten<br />
Reste von Abfallsortieranlagen. Es gibt Abfallsortieranlagen,<br />
z. B. die in Karlsruhe, die Müll sortenrein trennen<br />
kann bis zur Briefmarkengröße – Briefmarkengröße! Es<br />
gibt Anlagen, die können das nicht einmal bis zur Größe<br />
DIN A4. Es gibt Anlagen, die können ein Kilo Müll nicht<br />
herausnehmen, und es gibt Anlagen, die können das.<br />
Seite 33<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Deswegen wär es hochinteressant zu erfahren: Woher<br />
kommt der Fluff? Das ist die erste Frage.<br />
Die zweite Frage ist: Wie wird gewährleistet, dass keinerlei<br />
PCB-haltigen Stoffe – darauf muss man bestehen:<br />
keine! – in diesem Fluff drin sind?<br />
Das Dritte betrifft die ortsnahe Verwertung. Wir haben<br />
mitbekommen, dass Ihr Werk in Köln nicht mehr existiert<br />
und deswegen vielleicht dort noch ein paar Abnehmer<br />
sind.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Existieren tut<br />
es noch!)<br />
– Aber nur noch das Mahlwerk. – Wir hätten gerne gewusst:<br />
Woher stammt dieser Müll? Wir wollen keinen<br />
Mülltourismus. – Wenn Sie so etwas wollen, aber nicht<br />
das, was wir wollen, sage ich immer wieder: Gas, Gas,<br />
Gas! – Woher kommt dieser Müll?<br />
Wir wollen nur ortsnahen Müll, d. h. aus dem Land <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>.<br />
Wir haben die Entsorgungspflicht bzw.<br />
die Verwertungspflicht für den Müll hier. Wir wollen keinen<br />
– ich sage es noch einmal – europäischen Müll; den<br />
wollen wir nicht. Man könnte jetzt zwar sagen, das ist eine<br />
sehr deutschtümelnde oder baden-württembergische<br />
Blödheit, aber wir wollen keinen Mülltourismus. Das sind<br />
Transporte, die in Ihrer CO2-Bilanz nicht auftauchen, die<br />
bei den Stickoxiden nicht auftauchen, die in keiner Schadstoffbilanz<br />
auftauchen. Sie sind aber vorhanden. Deswegen<br />
wollen wir so etwas nicht.<br />
Noch einmal die drei Fragen: Erstens. Welche Anlagen<br />
sind es, die das machen? Zweitens. Aus welchen Anlagen<br />
stammt der Fluff? Drittens. Gibt es auch europäischen<br />
Müll, der da hineinkommt?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ich möchte Sie ungern korrigieren, aber das<br />
war jetzt zweimal die gleiche Frage. Wenn ich es richtig<br />
mitbekommen habe, war die erste Frage, woher es<br />
stammt,<br />
(Harry Block [BUND]: Woher? Deutschlandweit?)<br />
und die zweite Frage betraf Ihr Problem mit dem PCB.<br />
Oder ist das kein Problem mehr?<br />
(Harry Block [BUND]: Doch! Sie passen<br />
besser auf als ich, danke!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist gut. Ich darf das Wort an Herrn Fischer geben.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Grundsätzlich kommen etwa 80 % der Inputströme, die<br />
zur Produktion von dem Ersatzbrennstoff hier in Wössingen<br />
verwendet werden, aus der direkten Region. Damit<br />
meine ich <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Die anderen etwa 20 %<br />
sind Materialien, die aus Sortieranlagen hauptsächlich aus<br />
dem ostdeutschen Raum akquiriert sind.
Die Materialien, die wir – damit meine ich auch unser<br />
zweites Zementwerk – in Deutschland benötigen, werden<br />
in einer Aufbereitungsanlage produziert, an der Lafarge<br />
eine entsprechende Mehrheit hat, und zwar unter den<br />
Aspekten, die wir heute schon ausgiebig diskutiert haben.<br />
Von dort aus wird es dann als Brennstoff hierhin nach<br />
Wössingen geliefert. Es wird kein Material aus dem<br />
Ausland – egal, ob EU oder nicht – dazugenommen. Das<br />
macht kaufmännisch auch keinen wirklichen Sinn.<br />
Ich will direkt eine Frage beantworten, die Sie vielleicht<br />
gleich stellen wollen: Warum haben wir eine Produktionsstätte<br />
geschaffen, die diesen Fluff für unsere Zementwerke<br />
direkt selber produziert? Der einzige Grund dafür ist,<br />
dass wir die Qualitätskontrolle nicht unbedingt Dritten<br />
überlassen wollen. Vielmehr wollen wir die Mitverantwortung<br />
tragen und sagen: Wir wollen an dieser Stelle dafür<br />
sorgen, dass unsere umweltrelevanten und prozessrelevanten<br />
Vorgaben, die wir zu diesem Material haben, so<br />
weit und so gut wie möglich umgesetzt werden.<br />
Es gibt noch eine zweite Anlage in dieser Region in<br />
der Nähe von Stuttgart. Die bereitet uns zusätzlich bestimmte<br />
Materialien auf, die wir mengenmäßig nicht<br />
herstellen können. Sie unterliegt genau den gleichen<br />
prozess- und umweltrelevanten qualitativen Vorgaben und<br />
beliefert uns logischerweise ebenfalls mit Materialien, die<br />
hier aus der Region stammen. Damit meine ich <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong>.<br />
Dann hatten Sie noch die Frage zum PCB. PCB gehört<br />
zu den Untersuchungen, die im Rahmen der vorgegebenen<br />
Qualitätsanalytik durchgeführt werden. Es gibt<br />
Grenzwerte dafür, die einzuhalten sind; darüber gibt es<br />
keine Diskussion. Das wird kontrolliert.<br />
Ich möchte dem Herrn Villano noch die Möglichkeit<br />
geben, das Gesamtkonzept der Qualitätsüberwachung im<br />
Werk – mein Part ist mehr bis zum Werk – einmal kurz<br />
darzustellen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano, jetzt oder gleich? – Dann bitte erst Frau Sorg<br />
und Herr Bauer.<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Mich würde nur interessieren, ob es sich bei dem, was Sie<br />
eben erzählt haben, nämlich woher das Material kommt,<br />
um eine Zusatzinformation handelt, die wir hier heute<br />
bekommen, oder ob das Bestandteil des Antrages ist.<br />
Steht in dem Antrag schon drin, woher Sie Ihren Müll oder<br />
Ihre Ersatzbrennstoffe beziehen?<br />
Es gibt ja eine riesengroße Überkapazität bei Müllverbrennungsanlagen.<br />
Wir haben seit 2005 nicht mehr die<br />
Möglichkeit zu deponieren, und seitdem schießen diese<br />
Müllverbrennungsanlagen aus dem Boden. Sie sind im<br />
Prinzip Konkurrenz von Müllverbrennungsanlagen. Wir<br />
haben in Deutschland einen Importüberschuss von vielen<br />
Millionen Tonnen Müll, der bei uns verbrannt wird. Ich<br />
sehe einfach die Gefahr, dass diese Stoffe irgendwann<br />
auch im Zementwerk Wössingen landen.<br />
Seite 34<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Vielleicht einen Satz vorweg: Sie sagen, wir sind Konkurrenz<br />
der Müllverbrennungsanlagen. Das stimmt so nicht.<br />
Denn die Intentionen sind gänzlich andere. Die Müllverbrennungsanlage<br />
hat das Ziel, möglichst viel zu verbrennen.<br />
– Jetzt sehe ich es einmal nur von dem kaufmännischen<br />
Aspekt her.<br />
Das Material, das dort verbrannt wird, ist für uns nicht<br />
einsetzbar; das funktioniert nicht. Vielmehr haben wir hier<br />
Teile der entsprechenden Abfallströme zu einem Brennstoff<br />
aufzubereiten. Ich muss das immer wieder betonen.<br />
Das geht beim Heizwert los. Es bringt uns überhaupt<br />
nichts, irgendwelche Megajoule in den Drehrohrofen zu<br />
werfen. Das geht einfach nicht. Das heißt, es gibt im<br />
Grunde genommen keinen wirklichen Wettbewerb, wenn<br />
es um das Material geht.<br />
Zum besseren Verständnis muss ich natürlich dazusagen:<br />
Es gibt immer einen Wettbewerb, wenn es um<br />
"Markt" geht. Sie haben mit Ihrer Frage schon gezeigt,<br />
dass Sie sehr tief im Metier drinstecken. Sie wissen, dass<br />
Müllverbrennungsanlagen natürlich auch kaufmännisch zu<br />
sehen sind. Es kommt im Umkehrschluss natürlich vor,<br />
dass Müllverbrennungsanlagen auf einmal aus rein<br />
kaufmännischen Interessen den Blick auch auf hochwertige<br />
Materialien richten, um dann ihre Kapazitäten auszunutzen.<br />
So herum geht es, andersherum geht es nicht. –<br />
Wie war noch der erste Teil Ihrer Frage?<br />
(Anette Sorg [EW’in]: Ob das Teil Ihres Antrags<br />
ist, wo drinsteht, woher Sie Ihren Müll<br />
beziehen!)<br />
– Das ist es natürlich nicht. Hier geht es um ein Material,<br />
das am Werkstor auf das Gelände kommt, und wir reden<br />
davon: Was muss dieses Material, dieser Brennstoff für<br />
Eigenschaften aufweisen, welche Grenzwerte muss es<br />
umweltrelevant einhalten usw.?<br />
Natürlich wird im Antrag beschrieben, wie das Material<br />
aussieht. Herr Villano wird gleich noch erläutern, wie dann<br />
dieser Anspruch im Grunde genommen durch ein Qualitätsmanagement<br />
im Werk erfüllt wird.<br />
Wir können natürlich schlecht in dem Antrag jetzt<br />
schon irgendeinen Lieferanten benennen. Was machen<br />
wir, wenn der morgen pleite ist?<br />
(Anette Sorg [EW’in]: Wenn Sie selber Betreiber<br />
der Anlage sind, wäre das sinnvoll!)<br />
– Aber auch das kann sich morgen wieder ändern. Wir<br />
könnten durchaus sagen, dass wir vielleicht eine noch<br />
bessere Lösung finden. Dem wollen wir uns jetzt gar nicht<br />
verschließen. Aber noch einmal: Es ist nicht Bestandteil<br />
des Antrags, wer konkret produziert und liefert.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer.
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich wollte noch einmal kurz nachfragen. Habe ich das<br />
richtig verstanden: 80 % des Ausgangsmaterials vom Fluff<br />
kommen aus <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>? Sie haben nicht<br />
gesagt, wohin das gefahren wird, also wo Ihre Herstellungsanlage<br />
ist. Bezieht sich das nur auf diese Anlage,<br />
oder wird die Gesamtanlage, die dort diesen Fluff herstellt,<br />
zu 80 % aus baden-württembergischem Ausgangsmaterial<br />
beliefert? Verursacht das nicht relativ große Fahrtwege?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Das ist so gemeint, wie gesagt: Etwa 70 bis 80 % der<br />
Ausgangsmaterialien – das schwankt etwas, je nachdem,<br />
wie viel da gerade anliegt – für die Herstellung des gesamten<br />
Brennstoffs kommen von hier.<br />
Das hat auch den Grund, dass es hier in <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong> im Gegensatz zu z. B. den ostdeutschen<br />
Ländern hochwertige Vorbehandlungsanlagen gibt, die in<br />
der Lage sind, die Materialien entsprechend vorzubereiten,<br />
sodass die Produktion selber dann einfacher, günstiger<br />
usw. ist.<br />
Sie haben recht: Das ist natürlich auch mit Transportwegen<br />
verbunden. Das Thema ist für uns noch lange nicht<br />
abgeschlossen. Wir optimieren gerade umweltrelevant, wo<br />
wir können. Deswegen will ich das jetzt auch nicht in Stein<br />
gemeißelt sehen.<br />
Ich habe versucht, die Ist-Situation hinsichtlich Ihrer<br />
Frage, Herr Block, zu beantworten. Daher nenne ich auch<br />
diese Größen. Es war ja von Interesse: Ist das Ausgangsmaterial<br />
wirklich in dem Brennstoff wiederzufinden,<br />
der hier verbrannt wird. Das war ja der Inhalt der Frage.<br />
(Andreas Bauer [EW]: Wo ist die Anlage?)<br />
– Der Brennstoff wird im Moment in Sachsen-Anhalt<br />
hergestellt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich schließe an das an, was gerade meine Vorrednerin<br />
gesagt hat. Wir haben in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> Müllverbrennungskapazitäten<br />
geschaffen. Die haben wir mit Sinn<br />
geschaffen. Eine BI sitzt da, die dafür gesorgt hat, dass<br />
die Grenzwerte dieser Müllverbrennungsanlagen auf dem<br />
modernsten Stand sind.<br />
Die haben versucht, wirklich zu minimieren. Die haben<br />
3 bis 5 Megajoule; das habe ich gerade nachgegoogelt.<br />
Eine normale Hausmüllverbrennungsanlage nimmt unter<br />
15 Megajoule nichts mehr an. Das liegt einfach daran,<br />
dass Bioabfälle heute herausgenommen werden; es gibt<br />
ein Bioabfallgesetz. Demnächst kommt sogar noch das<br />
Papier heraus; die Papiertonne wird Pflicht. Das heißt, das<br />
wird nicht als Brennstoff eingesetzt. – Ich habe das eben<br />
bei der Stadt Karlsruhe nachgegoogelt; das stimmt. Das<br />
steht in den Genehmigungsbescheiden für die Müllerverbrennungsanlage<br />
Mannheim und für alle anderen auch.<br />
Seite 35<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Im Osten haben wir das Problem, dass die keine Müllverbrennungskapazitäten<br />
haben. Die haben ihre Altanlagen<br />
gehabt von "Vaters Ehemaligem Betrieb", VEB, die<br />
nichts getaugt haben. Dann haben sie die Mülldeponien<br />
gehabt. Die hatten Deponieplatz ohne Ende. Die hatten<br />
Braunkohlebergwerke ohne Ende. Also hatten sie Mülldeponien<br />
und haben nicht für Müllverbrennung gesorgt. Die<br />
haben ein echtes Problem. Die haben zwar riesengroße<br />
Kläranlagen gebaut, aber die Müllverbrennung haben sie<br />
vergessen. Wir allerdings haben diese Anlagen. – So viel<br />
dazu.<br />
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, kommt der<br />
Müll von <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> nach Sachsen-Anhalt, wird<br />
dort zu Fluff verarbeitet, und diese Firma liefert es dann<br />
hierher.<br />
Sie haben vorhin gesagt: vier Transporte zusätzlich bei<br />
100 %. Wie viele sind es nur für den Fluff? Das ist ja<br />
volumenmäßig eine Riesenfraktion, aber gewichtsmäßig<br />
ganz wenig.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, die Frage ging konkret an Lafarge.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Wir können es ganz simpel hochrechnen, was wir an<br />
Einsatzmengen beantragt haben. Wenn ich von den<br />
aktuellen Ist-Werten ausgehe, reden wir von ungefähr 15<br />
Lkw pro Tag, die sich insgesamt in das Zementwerk<br />
bewegen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich habe Sie jetzt rein akustisch nicht verstanden. Könnten<br />
Sie es bitte wiederholen?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Um eine Vorstellung zu haben: Wir brauchen ungefähr 15<br />
Lkw pro Tag an Brennstoff. Das heißt aber nicht – ich<br />
hatte es vorhin schon erläutert –, dass das ausschließlich<br />
von dieser einen Produktionsstätte kommt. Das ist völlig<br />
unterschiedlich.<br />
Um eine Vorstellung zu vermitteln: Im Durchschnitt<br />
kommt in etwa die Hälfte – zwischen einem Drittel und der<br />
Hälfte – von dieser Produktionsstätte, von der wir gerade<br />
reden. Der Rest kommt von der Produktionsstätte hier im<br />
Umkreis.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Es gibt dann zusätzlich diese vier Lkw? Sie haben ja<br />
gesagt: Durch die Erhöhung auf 100 % sind es zusätzlich<br />
vier Lkw. Sind von den 15 jetzt vier neu, oder kommen zu<br />
den 15 noch einmal vier dazu?
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Nein, nein. In etwa vier; das müssen wir noch einmal<br />
durchrechnen, mit Heizwerten und Abhängigkeiten usw.,<br />
aber ungefähr, ja.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Auch zu unserem Verständnis: Wir haben jetzt eine<br />
Situation, die braucht x Lkw, um diesen Ersatzbrennstoff<br />
anzuliefern, und durch die Erhöhung kommen vier pro Tag<br />
dazu; so ist es auch formuliert. Wie viele davon auf den<br />
Fluff entfallen, ist eine andere Sache. Aber vier wären auf<br />
die Gesamtzahl hinzuzuaddieren. Jetzt meine Frage:<br />
Haben Sie die 15 jetzt nur auf den Fluff oder auf den<br />
gesamten Ersatzbrennstoff bezogen?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
In etwa müsste es auf den Fluff bezogen sein. Ich habe<br />
jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, die schwanken ja<br />
auch täglich. Aber in der Größenordnung, ja.<br />
(Harry Block [BUND]: Mathematik und Größenordnungen!<br />
Das könnten Potenzen<br />
sein!)<br />
– Sie werden nicht erwarten, dass ich jetzt genau sagen<br />
kann: Das sind exakt 14 oder 15.<br />
(Harry Block [BUND]: Doch!)<br />
Ich sage, um 14, 15 bewegt es sich. Aber das ist an einem<br />
Tag ein bisschen mehr und am anderen Tag ein bisschen<br />
weniger.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Kommen die<br />
dazu, oder sind die in den 15 drin? Und ist<br />
das Fluff, oder ist das anderes?)<br />
– Nein. Das ist die Summe.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Um die geht es. Herr Haller, da geht es auch um Lärmbelästigung.<br />
Wir werden nachher eine Forderung beim Lärm<br />
stellen. Wird die Grenze überschritten, kann man unter<br />
Umständen bei vier Lkw die Zeit beschränken, z. B.<br />
Anlieferung bis 17 Uhr oder so etwas. Das sind ganz klare<br />
Forderungen, die daraus resultieren, dass ich weiß, wie<br />
viel das ist. Die Zahlen sind deshalb schon interessant.<br />
Sie haben jetzt bereits 80 % Fluff. Die CO2-Bilanz wird<br />
dadurch insgesamt auch nicht besser.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die zentrale Frage aus unserer Sicht ist: Wie viele Lkw<br />
sind es derzeit konkret? Für mich hat sich eingeprägt: Es<br />
sind zukünftig vier mehr. Ich denke, die Frage ist zu<br />
beantworten: Wie viele Lkw kommen heute im Schnitt an,<br />
und wie viele würden es zukünftig sein? Ich denke, das ist<br />
eine konkrete Frage, die durch Lafarge relativ schnell zu<br />
beantworten sein sollte.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Noch als Ergänzung zu Herrn Haller: Mich interessiert vor<br />
allen Dingen: Was fällt denn tatsächlich weg? Sie benöti-<br />
Seite 36<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
gen dann weniger Steinkohle bzw. Petrolkoks. Wie geht<br />
das in die Rechnung ein?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Um die konkrete Frage jetzt ganz konkret zu beantworten:<br />
Wie schon richtig gesagt, haben wir in etwa 15 Anlieferungen<br />
pro Tag, und vier kommen dazu.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Für alles.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Also nicht nur<br />
für Fluff, sondern für alles!)<br />
- Ja, für alles.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Frage, wie wir diese vier ermittelt haben, ist vielleicht<br />
noch interessant. Sie haben eingangs in der Präsentation<br />
die vier verschiedenen Szenarien für die Emissionsprognose<br />
gesehen. Wir haben anhand der prozentualen<br />
Verteilung der Sekundärbrennstoffe, die eingesetzt werden,<br />
entsprechend ausgerechnet, wie viele Lkw-<br />
Bewegungen dann hinzukommen: Bei diesen vier Szenarien<br />
kommen bei den unterschiedlichen Sekundärbrennstoffzusammensetzungen,<br />
die wir dann im Brennstoffmix<br />
haben, maximal vier dazu. Das heißt, bei einem dieser<br />
Szenarien sind wir bei vier Lkw, bei allen anderen dreien<br />
sind wir darunter.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke für die Erläuterungen. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wäre es brutal kompliziert, wenn Sie Straßenbahnlinien<br />
missbrauchen würden? Die AVG hat eine Diesellok, und<br />
die könnten z. B. einen Teil des Mülls per Bahn anliefern.<br />
Die Haltestelle ist da vorne.<br />
(Zuruf eines Einwenders: Der Anschluss<br />
war mal da!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wir hatten in der Tat in der Vergangenheit einen Bahnanschluss<br />
im Werk. Das ist die gleiche Linie, die auch von<br />
der S 4 benutzt wird.<br />
Eine Anlieferung per Bahn ist grundsätzlich immer eine<br />
Frage, die man am Ende auch unternehmerisch beantworten<br />
muss. Auf der einen Seite muss der Lieferant einen<br />
Bahnanschluss haben, und bei uns muss dieser Bahnanschluss<br />
ertüchtigt werden.<br />
Auch in anderen Zusammenhängen haben wir bereits<br />
über die Frequenzen diskutiert: Die Möglichkeit, Anlieferungen<br />
an dieser Linie abzuwickeln, besteht in einem ganz<br />
kleinen Zeitfenster in der Nacht. Dann wären wir wieder<br />
beim Thema Lärm. Somit ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt<br />
die Bahnanlieferung kein Diskussionsthema.
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Einspruch, Euer Ehren! Ich war auch einmal Aufsichtsrat<br />
der VBK. Ich war bei dem Bau der Bahnlinie dabei. Ich<br />
kenne die Frequenzen hier, und ich weiß, dass es z. B. in<br />
Karlsruhe Atomtransporte über eine ähnliche Straßenbahn<br />
nach Leopoldshafen gibt, die die gleiche Frequenz hat wie<br />
die hier. Die fahren am Tag; die fahren nicht nachts. Die<br />
fahren während des normalen Betriebs. Und Sie haben<br />
jetzt keine gefährlichen Stoffe, die hier zu transportieren<br />
wären. Das ginge also.<br />
Die erste Frage wäre: Ist das überhaupt möglich? Und<br />
die zweite Frage, die uns jetzt aber weniger interessiert:<br />
Rechnet es sich? Da wollten wir eigentlich eine Bilanz<br />
haben: Was wäre besser? Sie brauchen einen Anlieferer<br />
mit Bahnanschluss. Es gibt aber einige Anlagen, die auch<br />
einen Bahnanschluss haben. Die Frage kann man ja<br />
einmal stellen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Aber es kann sie im Moment niemand beantworten. Man<br />
kann heute allerdings etwas mitnehmen; und das war eine<br />
solche Frage, die mitgenommen wird.<br />
Damit wären wir bei dem nächsten Punkt:<br />
Andere Abfälle als beantragt<br />
Dazu ist eine zentrale Einwendung gewesen, welche<br />
Abfälle neben den dargestellten in die Anlage kommen. Es<br />
gab die Einwendung vom BUND, dass eine entsprechende<br />
Tabelle zu verlangen ist, die schon sehr weitgehend<br />
vorbereitet war. - Herr Block, Sie ergänzen bzw. konkretisieren<br />
Ihre Forderung bitte noch einmal!<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir hatten vorhin z. B. das Thema Dachpappe. Unser<br />
Problem ist weniger die Dachpappe, sondern das, was an<br />
der Dachpappe dran ist. Die Stoffe, die sie beispielsweise<br />
zum Kleben brauchen, also die Verunreinigungen, die<br />
machen Probleme. Die Dachpappe selber macht sicherlich<br />
ebenfalls welche, aber das eigentliche Problem ist der<br />
Verschmutzungsgrad.<br />
Uns würde interessieren, was diese Dachpappe darunter<br />
hat. Das ist das Entscheidende. Die Dachpappe wird<br />
auf dem Dach festgemacht. Da gibt es verschiedene<br />
Methoden. Man kann das mit Feuer machen; das ist<br />
allerdings bei manchen Gebäuden verboten. In Karlsruhe<br />
ist das Theater abgebrannt. Deswegen nimmt man auch<br />
Klebstoffe, und diese Kleber sind an der Dachpappe dran.<br />
Wir hätten gerne gewusst, wie hoch dessen Anteil z. B.<br />
bei der Dachpappe ist.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Wir unterscheiden grundsätzlich zwei wesentliche Träger<br />
bei Dachpappen: Das eine sind bituminöse, das andere<br />
teerhaltige Dachpappen.<br />
Seite 37<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wir wissen, dass die teerhaltigen Dachpappen in erster<br />
Linie als gefährliche Abfälle eingestuft sind. Deswegen<br />
sind diese bei uns nicht vorgesehen. Vielmehr haben wir<br />
eine Abfallschlüsselnummer beantragt, die ganz klar<br />
besagt: Das sind bituminöse Dachpappen, die als nicht<br />
gefährlich eingestuft sind.<br />
Dann werden Sie sofort die Frage stellen: Macht ihr<br />
das selber, sortiert ihr das aus? – Ich sehe Ihnen die<br />
Frage schon an. – Nein, wir werden auch da in Zukunft mit<br />
einem Aufbereiter zusammenarbeiten, der exakt für diese<br />
Tätigkeiten, nämlich das Einsammeln und das Sortieren<br />
von Dachpappen, genehmigt ist. Den gibt es schon; der<br />
produziert diese Materialien schon seit einigen Jahren.<br />
Dieser wird uns die nach den entsprechenden Vorgaben<br />
aus der Genehmigung produzierten Materialien aufbereiten<br />
und zur Verfügung stellen.<br />
Die Bindung wird üblicherweise über Teer bzw. Bitumen<br />
realisiert; das ist kein Kleber im wahrsten Sinne des<br />
Wortes.<br />
(Harry Block [BUND]: Die kleben auch!)<br />
– Klebeeffekt, okay. – Das ist also von vornherein geteilt<br />
und auf nicht gefährlichen Abfall beschränkt.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Mich würde noch interessieren, wie man die Qualität<br />
sicherstellen will. Wir kennen die Lebensmittelskandale,<br />
obwohl es natürlich auch da klare Vorgaben gab. Dem<br />
Hackfleisch sieht man erst einmal nichts an; es ist halt<br />
vermischt.<br />
Auch wenn Sie darauf vertrauen, dass man nur die etwas<br />
weniger schädliche Dachpappe liefert, könnten<br />
womöglich 10 % Beimischung darunter sein, weil sich das<br />
über Sie erheblich günstiger entsorgen lässt.<br />
Ich denke, etwas mehr Kontrolle ist wichtig, anstatt nur<br />
darauf zu vertrauen, dass die sich an die Vorgaben halten<br />
werden. Hier geht es um richtig viel Geld. Sie machen die<br />
Müllentsorgung sehr günstig. Das ist dann eine Win-win-<br />
Situation. Ich denke, im Sinne der Bevölkerung sollte man<br />
auch eine eigene Kontrolle mit ins Auge fassen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, gleich die Ergänzung dazu?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Diese Stoffe sind ja kaum noch erkennbar. Welche Fraktionsgröße,<br />
welche Korngröße hat diese Dachpappe? Wie<br />
muss ich mir das vorstellen?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
50 mm.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das heißt, ich kann den Stoff überhaupt nicht erkennen.<br />
An einer ganzen Dachpappe würde ich sofort erkennen,<br />
ob dort Verunreinigungen dran sind, an diesen kleinen<br />
Teilen aber nicht. Das ist das Gleiche wie beim Fluff.
Der Trick besteht darin, dass man darin eine ganze<br />
Menge verstecken kann. – Bitte missverstehen Sie das<br />
nicht! Ich würde Ihnen das nie unterstellen; das ist klar. –<br />
Wenn eine Firma das schon kleingehackt anliefert, sehen<br />
Sie dem Produkt nicht mehr an, was dahintersteckt. Das<br />
merken Sie erst, wenn Sie es chemisch auseinandernehmen,<br />
was sehr kompliziert ist.<br />
Einer normalen Dachpappe sehen Sie sofort an, ob sie<br />
geklebt ist. Aber das sehen Sie dem kleinen Schnipsel<br />
nicht mehr an. Das sehen Sie dem Fluff nicht mehr an.<br />
Das ist unser Problem auch mit den Altreifenschnipseln:<br />
Je kleiner das bei Ihnen angeliefert wird – was für Sie<br />
natürlich gut ist –, desto schwerer wird für Sie die Kontrolle.<br />
Deswegen ist die Kontrolle dann woanders.<br />
Je komplizierter der Kreislauf dieses Verschiebens des<br />
Mülls ist, desto mehr Möglichkeiten der Manipulation gibt<br />
es. Deswegen müssen wir Ihnen vor Ort die Kontrolle<br />
aufdrücken, und wir fragen: Wie weist ihr nach, dass das,<br />
was dieser Zertifizierer Ihnen gesagt hat, wirklich stimmt?<br />
Der Dachpappe sehen Sie nicht mehr an, was dranklebt.<br />
Das wird sich unter Umständen in den Emissionen<br />
und schließlich bei den Immissionen wiederfinden. Das ist<br />
unser Problem. Denn wir wollen sie minimieren – außer<br />
bei Gas natürlich; ich sage es noch einmal.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer hatte ein ganz konkretes Anliegen, und Sie<br />
haben noch einmal draufgesattelt. – Herr Villano von<br />
Lafarge würde gerne etwas dazu sagen.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ganz nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist<br />
besser": Auch uns ist natürlich bewusst, dass wir auf der<br />
einen Seite ein gewisses Vertrauensverhältnis in unsere<br />
Lieferanten haben müssen. Es gibt gewisse Kriterien, die<br />
einzuhalten sind.<br />
Wie eben schon erwähnt, ist es für uns wichtig, dass<br />
es eine zertifizierte Aufbereitungsanlage ist. Das erzeugt<br />
erst einmal ein gewisses Grundvertrauen. Daneben sind<br />
durch die Vorlage von Genehmigungen usw. auch die<br />
Input-Ströme erfasst, sodass wir zumindest auf formeller<br />
Basis sagen können, was da hineingeht. Das ist erst<br />
einmal die Vertrauensbasis.<br />
Wir kontrollieren aber auch: Von Lafarge-Seite als<br />
Endverbraucher dieser Brennstoffe besuchen wir regelmäßig<br />
die Aufbereitungsanlage, um uns selber vor Ort ein<br />
Bild machen zu können, um genau diese Punkte, die Sie,<br />
Herr Block, angesprochen haben, zu hinterfragen. Wir<br />
schauen uns selber den Stoffstrom an: Wie kommt der<br />
Stoff hinein, wie wird er aufbereitet? Da gibt es auch von<br />
unserer Seite eine wiederholte Kontrolle.<br />
Außerdem sitzen wir mit den Lieferanten regelmäßig<br />
zusammen und diskutieren verschiedene Punkte, auch<br />
was die Qualitätssicherung angeht.<br />
Seite 38<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich würde der Behörde den Vorschlag machen, dass Sie<br />
unangekündigt Proben ziehen und untersuchen lassen, ob<br />
das, was der Zertifizierer bzw. was Wössingen behauptet,<br />
wirklich stimmt. Das kann man irgendwann einmal im Jahr<br />
nachkontrollieren. Da muss irgendwo drinstehen, dass sie<br />
damit rechnen müssen, dass einer kommt und wirklich<br />
nachprüft, ob das das auch stimmt. Gerade bei diesen<br />
Stoffströmen, wo Vertrauen nötig ist, sollte die Behörde<br />
das kontrollieren – wenn es geht, mit einem unabhängigen<br />
Gutachter.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die Behörde hat noch einen ganz anderen Ansatz, den ich<br />
Ihnen in dieser Runde einmal sage: Das Thema Qualitätssicherung<br />
basiert nicht auf Untersuchungen an einer<br />
Stelle, sondern da spielen mehrere Dinge zusammen. Das<br />
fängt beim Erzeuger an und geht beim Anwender weiter.<br />
Deswegen ist eine zentrale Forderung von uns die eines<br />
Qualitätssicherungskonzepts. – Ich denke, dies ist<br />
auch eine Forderung des BUND; darüber haben wir eben<br />
nicht mehr im Detail gesprochen. – Ein Qualitätssicherungskonzept<br />
ist im Antrag noch zu ergänzen und entsprechend<br />
nachzuliefern. Ich denke, da muss Lafarge<br />
noch etwas liefern. – Herr Essig.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
In Ergänzung dazu: Wir haben schon die Möglichkeit, uns<br />
selbst zu informieren. Es ist für uns in <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />
natürlich viel einfacher, auf solche Erzeuger zuzugreifen,<br />
als über unsere Kollegen außerhalb <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>s.<br />
Wenn wir wissen, wo die Anlagen sind, werden wir auch<br />
über diese Schiene versuchen, Informationen darüber zu<br />
bekommen, was das für ein Entsorger ist, ob der ordentlich<br />
arbeitet usw. Das können wir Ihnen schon zusichern,<br />
Herr Block; das machen wir auf jeden Fall.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Nicht dass wir uns da missverstehen: Auch wir machen<br />
regelmäßige wiederkehrende Analysen, Herr Block. Wir<br />
haben natürlich ein gewisses Eigeninteresse zu wissen,<br />
was in die Anlage hineinkommt.<br />
Ich habe eine Präsentation dazu. Ich möchte Ihnen<br />
kurz ein Qualitätssicherungskonzept zeigen, wie wir im<br />
Werk die Analysen durchführen und letztendlich durchführen<br />
werden.<br />
(Schaubild: Qualitätssicherungskonzept für<br />
Ersatzbrennstoffe – Anlage 6, S. 126)<br />
Wir haben für uns im Werk ein Qualitätssicherungskonzept.<br />
Es wird als „beste verfügbare Technik“ letztendlich<br />
auch gefordert, ein Qualitätssicherungskonzept zu
erarbeiten. Das soll gewährleisten, dass man konzeptionell<br />
und praktisch vorgeht, um die Qualität sicherzustellen.<br />
Ich möchte jetzt nicht dieses Pamphlet im Einzelnen<br />
durchgehen. Wir haben uns auch an vorhergehenden<br />
Referenzdokumenten orientiert. Wir haben als Unternehmen<br />
Lafarge-Umweltstandards, die weltweit gültig sind.<br />
Hier gibt es gewisse Anforderungen innerhalb der Lafarge-<br />
Gruppe an den Einsatz von Sekundärstoffen.<br />
Natürlich ist uns auch die Genehmigungssituation<br />
ganz wichtig, was an Nebenbestimmungen gefordert wird.<br />
Das wird dann im Prozess selber umgesetzt.<br />
Wir haben hier eine Input- und eine Output-<br />
Betrachtung. Die Input-Betrachtung umfasst u. a. die<br />
Lieferantenkontrolle. Das besagt, dass wir wiederkehrende<br />
Audits bei den Lieferanten machen, also wiederkehrend<br />
vorbeikommen und sie besuchen, um die Aufbereitung<br />
selber zu erfahren und zu hinterfragen.<br />
Es sollen zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe sein,<br />
die uns beliefern. Dazu gehört auch die Vorlage der<br />
entsprechenden gültigen Genehmigung der Aufbereitungsanlage,<br />
sodass wir wissen, welche Eingangsstoffe<br />
bei denen zugelassen sind. Dadurch können wir von<br />
vornherein bestimmte risikobehaftete Materialien anhand<br />
der AVV-Nummer ausschließen.<br />
Wir haben hier die Probenahme geregelt, wir haben<br />
die entsprechende Probevorbereitung geregelt, und wir<br />
haben auch die entsprechenden Analysen, die durchzuführen<br />
sind, geregelt. Das betrifft die Eigenanalyse und die<br />
Fremdanalyse.<br />
Bei der Eigenanalyse haben wir ein zertifiziertes Qualitätsmanagementkonzept<br />
nach ISO 9001. Im Übrigen<br />
orientieren sich die Umweltstandards der Lafarge-Gruppe<br />
an DIN ISO 14001. Wir führen wiederkehrende Fremdanalysen<br />
durch, und wir haben auch Eigenanalysen, um<br />
bestimmte Prozessparameter wiederkehrend zu kontrollieren.<br />
Auch der Lieferant führt entsprechende Analysen<br />
durch, die dann bei dem eben angesprochenen Meeting<br />
diskutiert werden. Daran können wir dann ersehen, ob es<br />
da Entwicklungen nach oben oder nach unten gibt bzw. ob<br />
die Qualität gleich bleibt.<br />
Wir haben genehmigte Input-Werte insbesondere auch<br />
für Fluff – das orientiert sich an dem nordrheinwestfälischen<br />
Leitfaden –, und diese werden wiederkehrend<br />
analysiert und kontrolliert.<br />
Wir haben bestimmte Maßnahmen aufgeschrieben,<br />
wie wir bei einer Input-Erhöhung bzw. hier im speziellen<br />
Fall bei einer Quecksilbererhöhung vorgehen.<br />
Wir haben die Qualitätskontrolle, und es gibt ein klares<br />
Managementsystem, was die Kontrolle, Steuerung,<br />
Dokumentation und Kommunikation der jeweiligen Punkte<br />
angeht.<br />
Dann gibt es die Output-Betrachtung als Rückkopplung.<br />
Wenn ich etwas in den Ofen hineinbringe, kommt es<br />
Seite 39<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
natürlich im Produkt bzw. in der Emission wieder zum<br />
Vorschein. Die entsprechenden Veränderungen kann man<br />
durch die Emissionsmessungen erkennen, und zwar<br />
sowohl kontinuierliche Messungen als auch wiederkehrende<br />
Messungen, die wir hier durchführen.<br />
Ich möchte hier auch darauf hinweisen, dass wir teilweise<br />
schärfere Grenzwerte haben, als die 17. BImSchV<br />
sie vorschreibt. Zum Beispiel liegen beim Quecksilber, bei<br />
Dioxinen und Furanen die Grenzwerte unterhalb dessen,<br />
was die 17. BImSchV vorschreibt.<br />
Dann ist hier auch die entsprechende Qualitätssicherung<br />
nach DIN EN 14181 erwähnt. Das heißt, die Qualitätssicherung<br />
der Emissionsmessgeräte wird bei uns<br />
gewährleistet, sodass auch eine hohe Verfügbarkeit der<br />
Messgeräte vorliegt.<br />
Bei der Emissionssteuerung gibt es Betriebsanweisungen,<br />
sogenannte SOPs, im Englischen „Standard<br />
Operational Procedure“. Das heißt, der Leitstandfahrer<br />
bekommt eine klare Anweisung, wie er sich zu verhalten<br />
hat, wenn sich bestimmte Dinge im Prozess verändern,<br />
auch für die Parameter der Emissionsbetrachtung.<br />
Dann haben wir entsprechende Zertifizierungen, wie<br />
die ISO 9001, die DIN EN ISO 50001, und wir haben die<br />
Lafarge-Standards. Diese Standards sind verbindlich. Das<br />
heißt, es kommen externe Auditoren ins Werk und prüfen<br />
uns auf diese Standards. Dann haben wir noch den<br />
Arbeits- und Gesundheitsschutz insbesondere mit Blick<br />
auf die Sekundärstoffe.<br />
Außerdem haben wir noch die entsprechenden wiederkehrenden<br />
Audits durch externe Gutachterorganisationen<br />
aufgeführt.<br />
Das ist ein Qualitätssicherungskonzept, das wir hier für<br />
die Sekundärstoffe, für die Ersatzbrennstoffe, verwenden.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass wir da in einer guten Position<br />
sind, insbesondere wenn wir die tatsächlichen Input-<br />
Ströme betrachten, gerade beim Quecksilber.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Villano, Sie sehen mich überrascht. Ich kenne das<br />
nicht. Ich habe das nie gesehen. Sie können natürlich<br />
nachliefern – das ist in Erörterungsterminen immer erlaubt<br />
–, aber das ist ein Missbrauch von uns. Ich fühle<br />
mich hier missbraucht.<br />
(Tino Villano [AS]: Warum?)<br />
Sie stellen hier ein Konzept vor, auch mit Zahlen, die<br />
zum Teil sehr detailliert sind, die ich in den Unterlagen<br />
nicht gefunden habe und die ich auch angemahnt habe.<br />
Jetzt warten Sie plötzlich mit Zertifizierungen auf, die ich<br />
alle nicht kenne. Ich kenne Ihre Zahlen nicht. Sie haben<br />
sogar Emissionsprognosen daraus abgeleitet, die anscheinend<br />
neu sind. Ich frage mich, auf welchen Grundlagen<br />
wir jetzt diskutieren, insbesondere wenn wir gleich
über die Emissionen sprechen. Sie könnten dann theoretisch<br />
sagen: Das stimmt alles gar nicht, was Sie sagen.<br />
Ich kenne das nicht. Das war nicht bei den Unterlagen,<br />
und man hat es uns auch nicht zugeschickt. Ich fühle mich<br />
jetzt ein bisschen komisch.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Als Ergänzung von unserer Seite: Das Thema Qualitätssicherung<br />
war nicht Teil des Antrags. Ich habe vorhin<br />
bereits gesagt: Das ist eine Sache, die noch nachzubessern<br />
ist.<br />
Herr Villano hat jetzt – so verstehe ich das bisher – die<br />
interne Vorgehensweise von Lafarge – –<br />
(Harry Block [BUND]: Aber die müssen wir<br />
doch erörtern!<br />
– Wir müssen im Moment erörtern, dass das fehlt und<br />
dass da dringend nachzubessern ist. Was Herr Villano<br />
jetzt dargestellt hat, können wir nicht erörtern; auch wir<br />
kennen es nicht.<br />
(Harry Block [BUND]: Aha, gut!)<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Ich habe gesehen, wesentliche Teile, die da drinstehen,<br />
kommen aus Genehmigungen vom RP. Da steht klipp und<br />
klar drin: Nebenbestimmung soundso, dies und jenes.<br />
Genau das hat er jetzt umgesetzt, wie ich gesehen habe.<br />
Das sind auch die Grundlagen für z. B. die Emissions- und<br />
die Immissionsprognose. Das muss jetzt natürlich noch<br />
nachgeliefert werden. Aber noch einmal, wie gesagt: Was<br />
ich gesehen habe, kam mir sehr bekannt vor.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Wir können<br />
es halt nicht erkennen! Es ist nicht lesbar!)<br />
Harry Block (BUND):<br />
Aber, Herr Haller, Sie verstehen schon, dass wir ein<br />
bisschen überrascht sind. Ich hätte schon gerne nachgeguckt,<br />
was er da jetzt macht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir gehen davon aus, dass die Folien zum Protokoll<br />
dazukommen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der<br />
Antrag diese Dinge nicht enthalten hat. Das ist eine<br />
Sache, die auch von unserer Seite als Forderung im<br />
Raum steht und die nachzubessern ist. – Jetzt Frau Sorg.<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Herr Haller, Sie fordern völlig zu Recht die Nachlieferung<br />
dieses Qualitätssicherungskonzepts. Das sehe ich genauso.<br />
Was mir persönlich noch fehlt, ist ein Brandschutzkonzept.<br />
Wir hatten ja schon einmal einen Brand im Zementwerk<br />
mit Reifenschnipseln – oder was auch immer das<br />
war. Sind denn für bestimmte Vorfälle irgendwelche<br />
Szenarien mit der örtlichen Feuerwehr durchgespielt?<br />
Was passiert, wenn das Löschwasser ins Grundwasser<br />
gelangt? Das sind alles Themen, die für uns ebenfalls<br />
Seite 40<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
relevant sind. Ich fände ein Brandschutzkonzept zusätzlich<br />
zum Qualitätssicherungskonzept sehr hilfreich.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke. – Herr Villano direkt dazu.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Dazu kann ich etwas sagen: Die Lagerstätten für die<br />
Ersatzbrennstoffe sind natürlich schon im Vorfeld mit<br />
einem Brandschutzkonzept versehen worden. Ein Brandschutzkonzept<br />
ist überhaupt ein Bestandteil der Genehmigung<br />
für die Lagerung. Das heißt, das ist im Vorfeld alles<br />
schon geklärt. Wir haben hier keine Erhöhung der Lagerkapazität<br />
und somit auch keine Veränderung bezüglich<br />
des Brandschutzkonzepts.<br />
Wir haben natürlich einen Feuerwehreinsatzplan. Wir<br />
sind immer im engen Kontakt mit der Freiwilligen Feuerwehr<br />
Walzbachtal, zumal auch Mitarbeiter von uns Mitglieder<br />
der Feuerwehr sind. Wir haben regelmäßige<br />
Übungen, wir besprechen uns, wir haben Werksführungen<br />
mit den Feuerwehrmitgliedern. Das heißt, wir sind, was<br />
das Thema Brandschutz angeht, schon gut aufgestellt.<br />
Dass es vereinzelt zu Glimmbränden kommen kann,<br />
weil irgendwo ein Motor heiß gelaufen ist, lässt sich nicht<br />
hundertprozentig vermeiden. Aber das Risiko lässt sich<br />
durch die konzeptionelle Vorgehensweise minimieren.<br />
Zu dem Thema Löschwasserrückhaltung: Wir haben<br />
ein Kanalnetzsystem. Dort ist schon seit langer Zeit ein<br />
Schieber installiert. Wenn es zu einem Anfall von Löschwasser<br />
kommt, was in die Kanalisation fließt, wird der<br />
Kanal abgeschiebert und das Wasser ordnungsgemäß<br />
entsorgt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke. – Herr Wiedenmann.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Ich habe eine Nachfrage: Habe ich das vorhin richtig<br />
verstanden, dass dem TÜV Süd, der die Emissionsprognose<br />
gemacht hat, diese Unterlagen, die Sie als Qualitätssicherungskonzept<br />
vorgestellt haben, zur Verfügung<br />
standen?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ich wüsste jetzt nicht, wieso für die Prognose dieses<br />
Konzept relevant sein soll. Das müssen Sie mir bitte<br />
erläutern.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Wofür soll es denn sonst relevant sein?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Es gibt genehmigte Input-Werte. Die liegen denen natürlich<br />
vor. Das ist die Grundlage einer Emissionsprognose.
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Wofür ist dann dieses Konzept, wenn Sie alle Daten<br />
haben, die Sie für diese Emissionsprognose brauchen?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Nach unserem Verständnis ging es bei der Diskussion in<br />
der letzten halben Stunde oder Stunde darum, dass es<br />
sowohl beim Erzeuger dieser Brennstoffe als auch beim<br />
Anwender, also beim Verwender Lafarge, Mechanismen<br />
geben muss, um sicherzustellen, dass die vereinbarten<br />
und festgelegten Anforderungswerte an den Brennstoff<br />
schadstoffmäßig eingehalten werden. Darauf zielt das<br />
Qualitätssicherungskonzept ab.<br />
Die Emmissionsprognose setzt auf anderen Werten<br />
auf, unabhängig davon, wie es der Qualitätssicherung<br />
gelingt, diese Werte dann auch einzuhalten.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Die Prognosen werden doch aufgrund von Zahlen gemacht.<br />
Soweit ich überhaupt etwas erkennen konnte,<br />
kamen bei diesem Qualitätssicherungskonzept Zahlen für<br />
bestimmte Stoffe vor. Diese Zahlen müssen ja irgendjemandem<br />
vorgelegen haben, der die Prognose macht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Diese Zahlen – ich habe es auf die Schnelle genauso<br />
wenig lesen können wie Sie – sind die gleichen Zahlen,<br />
die jetzt auch der TÜV verwendet hat. Die stehen in<br />
diesem Qualitätssicherungskonzept quasi informativ drin;<br />
so habe ich es jetzt verstanden. Das sind Werte, die mit<br />
der Qualitätssicherung eigentlich nichts zu tun haben.<br />
(Dr. Rolf Wiedenmann [EW]: Trotzdem hat<br />
offensichtlich der TÜV – –)<br />
– Natürlich, wenn die Qualitätssicherung nicht funktioniert,<br />
werden die Werte nicht eingehalten. Aber der TÜV hat bei<br />
seiner Emissionsprognose Zahlen verwendet, die Herr<br />
Villano jetzt wohl in dieses Papier hineingeschrieben hat.<br />
– Aber sagen Sie es am besten selber, Herr Villano, es ist<br />
ja Ihr Papier.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Herr Wiedenmann, in dem Konzept steht drin, was wir<br />
maximal dürfen und wie wir konzeptionell vorgehen, um<br />
das, was wir dürfen, auch wirklich einhalten zu können.<br />
Die Zahlen, die Sie für den Fluff gesehen haben, die<br />
Maximalwerte, die Praxiswerte, die liegen dem TÜV<br />
natürlich vor. Das ist letztendlich das, was an maximalem<br />
Input erlaubt ist.<br />
Wir gehen mit diesem Konzept letztendlich so vor: Wie<br />
stellen wir sicher, dass das, was erlaubt ist, auch wirklich<br />
eingehalten werden kann? Mehr ist es nicht.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Dazu noch als Ergänzung: Ich bin eigentlich eingeladen<br />
worden, um mich mehr auf technische Dinge zu fokussieren.<br />
Herr Block, Sie machen das durchaus nicht ungeschickt.<br />
Deswegen gestatten Sie noch eine Bemerkung.<br />
Seite 41<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Die Zahlen sind mir sehr wohl bekannt. Die sind aus<br />
einem Leitfaden übernommen worden, der im Jahr 2005,<br />
ursprünglich von Bärbel Höhn initiiert, mit dem Ziel erarbeitet<br />
worden ist, entsprechende Input-Werte für solche<br />
Ersatzbrennstoffe auszuarbeiten, die – wenn sie diese<br />
Kriterien einhalten – umweltverträglich und schadlos<br />
eingesetzt werden können.<br />
Das war ein sehr großes Projekt unter Beteiligung<br />
auch des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen. Frau<br />
Höhn, wie gesagt, war seinerzeit Umweltministerin. Man<br />
hat sich bei der Festlegung dieser Inputwerte nicht an den<br />
Möglichkeiten des Prozesses orientiert, sondern tatsächlich<br />
auch an Vergleichsanalysen, die aus dem Bereich der<br />
Abfallaufbereitung zur Verfügung gestellt worden sind. So<br />
sind diese Werte abgeleitet worden, und die waren letztlich<br />
– so habe ich es verstanden –auch Bestandteil der<br />
Emissionsprognose.<br />
Das, was Herr Villano vorgestellt hat – ich denke, es<br />
dürfte kein Problem sein, das auch zur Verfügung zu<br />
stellen –, betrifft sozusagen die internen Abläufe, wie sie<br />
in der Qualitätssicherung von Lafarge organisiert werden.<br />
Das ändert aber nichts an den Werten.<br />
Die Werte sind, wie gesagt, anerkannter Stand, auf<br />
deren Grundlage auch in vielen anderen Bundesländern<br />
solche Ersatzbrennstoffe beschrieben werden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Futterer.<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Ich habe eine Frage zur Qualitätssicherung, wie die<br />
insgesamt erfolgt. Wie kann ich mir das vorstellen? Da<br />
kommt ein Transporter an, da ist eine Tonne Fluff drin,<br />
und Sie machen jetzt die Eingangskontrolle: Nehmen Sie<br />
dann ein bisschen heraus und kontrollieren das dann<br />
entsprechend?<br />
Wie wir schon festgestellt haben, ist doch der gesamte<br />
Müll eine sehr heterogene Masse. Wie wird sichergestellt,<br />
dass da ein Durchschnitt gebildet wird und nicht quasi die<br />
Minimalwerte geprüft werden, wobei die Maximalwerte, die<br />
in dem Qualitätssicherungskonzept sehr unterschiedlich<br />
waren, dann einfach außen vor bleiben?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Man kann sich das so vorstellen: Der Erzeuger macht für<br />
sich wiederkehrende Analysen, die auch uns zur Verfügung<br />
gestellt werden. Dann kommt der Lkw zu uns ins<br />
Werk. Von Lafarge-Seite ist jemand dabei, der kontrolliert,<br />
dass ordnungsgemäß abgeladen wird, und er macht<br />
schon einmal eine optische Beurteilung. Dann werden von<br />
jedem Lkw zwei Rückstellproben gezogen, um entsprechende<br />
Analysen durchzuführen.<br />
(Harry Block [BUND]: Davon habe ich doch<br />
vorhin geschwätzt!)
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Halt, Herr Block! Frau Waibel hatte sich dazu gemeldet.<br />
Bettina Waibel (Einwenderin):<br />
Es ergänzt sich. In der Folie war kurz der Satz zu sehen:<br />
Wenn Ausreißer festgestellt werden, wird das dem Hersteller<br />
kommuniziert. Bezog sich das auf die Stichprobenprüfung<br />
bei der Anlieferung, oder bezog sich das auf die<br />
Messungen, was nachher aus dem Schornstein herauskommt?<br />
Was passiert, wenn z. B. bei der Anlieferung die Werte<br />
überschritten werden? Wird das dann zurückgeschickt?<br />
Oder was passiert dann? Wird das trotzdem verbrannt?<br />
Vermischt man es und nimmt den Mittelwert? Wie ist das<br />
zu verstehen?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielleicht Herr Block ergänzend dazu? – Nicht, okay.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist schon Bestandteil der<br />
bestehenden Genehmigung. Das ist nichts Neues, und<br />
teilweise steht es auch in dem Antrag drin, Herr Block.<br />
Wie wird vorgegangen: Je Lkw werden zwei Rückstellproben<br />
gezogen. Es werden für Prozesse Eigenanalysen<br />
durchgeführt, und es werden Fremdanalysen durchgeführt.<br />
Alle 1500 t werden Mischproben auf die komplette<br />
Palette der Schwermetalle hin analysiert.<br />
Bei den Ausreißern, die dann entstehen, muss man<br />
natürlich gucken: Habe ich jetzt aufgrund der Heterogenität<br />
einen Ausreißer drin, den ich bewerten muss, oder<br />
habe ich einen systematischen Fehler drin?<br />
Da sind wir im engen Austausch mit den Aufbereitungsanlagen,<br />
die sowohl jeden Ausreißer informativ<br />
mitkriegen als auch die Rückverfolgung bei strukturellen<br />
Fehlern vornehmen, wobei das bis zum Ausschluss einer<br />
Erzeugerquelle führen kann.<br />
Wichtig ist die Output-Betrachtung. Wir haben in solchen<br />
Fällen auch entsprechende Emissionskontrollen und<br />
entsprechende Maßnahmen. Wenn es wirklich zu einer<br />
tendenziellen Erhöhung der Emissionen kommt, leiten wir<br />
entsprechende Maßnahmen ein, die sicherstellen, dass<br />
die Emissionswerte eingehalten werden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das Wort „Ausreißer“ stört mich. Wir wollen keine Ausreißer.<br />
(Tino Villano [AS]: Wir auch nicht!)<br />
– Ja gut. Das müssen wir verhindern. Es kann nicht sein,<br />
dass das erst nachträglich auffällt, wenn es verbrannt ist.<br />
Manchmal ist das ganz gut, wenn man z. B. durch Kameraüberwachung<br />
hinterher den Täter findet. Aber es ist<br />
blöd, wenn das vorher durch den Kamin gegangen ist.<br />
Seite 42<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wenn dann zu viel Quecksilber drin war, war das<br />
schlecht. Dann kann man hinterher sagen: „Du böser<br />
Bube du!“, und dann bekommt er vielleicht eine Geldstrafe<br />
von 10.000 € oder so. Das ist ja lächerlich. Wir wollen,<br />
dass das nicht passiert. – Erster Punkt.<br />
Zweiter Punkt. Hat man die Qualitätssicherung für das<br />
Produkt auf die vom TÜV benutzten Zahlen erst hingedreht,<br />
oder war das vorher schon festgelegt – also dass<br />
das nachher hinten in der Spalte Emission stimmt? Hat<br />
man das vorher schon gewusst oder erst, nachdem das<br />
berechnet wurde? Was war zuerst: das Ei oder das Huhn?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano, was war zuerst?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Zahlenwerte Input sind letztendlich eine Vorgabe im<br />
Leitfaden aus Nordrhein-Westfalen. Das sind Erfahrungswerte<br />
im Input. Die sind festgelegt worden. Da ist nicht<br />
zurückgerechnet worden, was wir haben dürfen, sondern<br />
die Werte sind festgesetzt worden. Unter den Voraussetzungen<br />
ist die Emissionsprognose gerechnet worden, um<br />
zu gucken, ob ich die Emissionswerte einhalte.<br />
Das ist der maximale Input – so, wie das der NRW-<br />
Leitfaden vorgibt unter der Voraussetzung, dass keine<br />
Emissionsüberschreitungen stattfinden. Das sollte auch<br />
mit diesen Grenzwerten nicht der Fall sein. Die Zahlen<br />
sind nicht zurückgerechnet worden. Das ist kein Ergebnis<br />
eines Gutachters oder eines anderen, sondern das kommt<br />
letztendlich aus dem Leitfaden vom Umweltministerium.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ich verstehe das wirklich nicht. Wir haben vorhin über<br />
Kontrollen gesprochen. Sie zeigen uns jetzt etwas, was<br />
wir nicht kennen, was wir auch nicht lesen können, weil<br />
das bei dem Licht, bei der Textmasse und bei den Zahlen<br />
unmöglich ist. Vorher war das Konzept offensichtlich nicht<br />
vorhanden. Sie, Lafarge, hatten in Sötenich eine langwierige<br />
Erörterung. Sie müssen doch wissen, dass man so<br />
etwas vorher herausgibt. Ich verstehe Sie nicht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ergänzend.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir erfinden das Rad wirklich nicht neu. Wir haben natürlich<br />
bei unseren Leuten nachgefragt, und selbstverständlich<br />
haben die uns gesagt, was gefordert ist. Deswegen<br />
haben wir überhaupt nicht verstanden, dass das nicht<br />
dabei war.<br />
Meine Frage ist daher schon sehr ernst gemeint: Hat<br />
man da rückwärts gerechnet, sodass dann nachher die<br />
Produkte zu den Emissionen passen? – Gut, ich nehme<br />
zur Kenntnis: Es war nicht so.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir gehen davon aus, dass das nicht zurückgerechnet<br />
wurde. Es ist so, dass Anforderungen zur Qualitätssiche-
ung – Herr Essig hat es vorhin ausgeführt – in anderen<br />
Entscheidungen schon aufgenommen waren. Aber das<br />
Konzept, diese gesamtheitliche Betrachtung, hat in dem<br />
Antrag gefehlt, insbesondere bezogen auf den neuen<br />
Ersatzbrennstoff Dachpappe. Da gilt es einfach nachzulegen.<br />
Das kennen auch wir noch nicht.<br />
Noch etwas zu dem, was Sie vorhin gesagt haben: Die<br />
Qualitätssicherung ist genau der richtige Weg, um diese<br />
Ausreißer, die Sie – wie eben angesprochen – nicht haben<br />
wollen und die, denke ich, niemand haben will, zu minimieren<br />
bzw. auszuschließen. Das ist Ziel und Zweck einer<br />
Qualitätssicherung.<br />
Da hatte Lafarge jetzt Dinge dokumentiert, die aber<br />
weder Sie noch wir in den Antragsunterlagen finden. Gut –<br />
oder nicht gut!<br />
Herr Villano, zum Schluss zur Qualitätssicherung noch<br />
ein Wort.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Herr Block, das, was jetzt als Konzept vorgestellt wurde,<br />
steht größtenteils auch in dem Antrag drin. Die Zahlen, die<br />
dort als Maximalwerte drin sind, finden sich auch in der<br />
Emissionsprognose wieder. Die Zahlen sind vorhanden,<br />
auch im Antrag.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Die konnten<br />
wir ja nicht nachprüfen!)<br />
Dann noch ergänzend bezüglich der Ausreißer: Bitte<br />
vergessen Sie nicht, dass wir auch über das Rohmehl<br />
einen Eintrag haben. Auch hierüber haben wir eine entsprechende<br />
Zufuhr. Die Grenzwertentwicklung ist also<br />
nicht ausschließlich auf die Brennstoffe zurückzuführen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Bei uns bin nicht ich der Rechner, sondern<br />
Dr. Wiedenmann. Wir rechnen die Werte immer ganz<br />
genau nach. Wenn jetzt einem Produkt soundso viel<br />
Cadmium oder soundso viel Zink zugewiesen wird, rechnen<br />
wir das mal 80.000 t – oder mal irgendetwas – mal<br />
Normkubikmeter mal Betriebsstunden, und dann bekommen<br />
wir heraus, ob das stimmt, was der TÜV rechnet.<br />
Der TÜV rechnet ja auch, und die rechnen manchmal<br />
ganz komisches Zeug. Kennen Sie die Formeln? Haben<br />
Sie die einmal gesehen? Da fallen Ihnen die Ohren ab.<br />
Solche Integrale haben Sie im Abitur nicht gehabt, die die<br />
da ausrechnen, um dann nachher irgendeinen Grenzwert<br />
herauszukriegen, den keine Sau hier in diesem Raum<br />
versteht – außer jemand, der Analysis III besucht hat. Nur<br />
der versteht, wie so etwas zustande kommt.<br />
Das Ganze rechnet Dr. Wiedenmann deshalb nach.<br />
Da wir aber die Grundlagen nicht hatten, sind wir davon<br />
ausgegangen, dass diese Prognose vom TÜV ist. Das war<br />
für uns sozusagen sakrosankt.<br />
Seite 43<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wenn Sie nachher bei den Irrelevanzkriterien sagen:<br />
„Wenn wir beim Stoff XY diesen oder jenen Wert einsetzen,<br />
kommt das oder das heraus“, dann gehen wir einfach<br />
nach Hause. Wenn durch Ihre Neuauflage jetzt ein anderer<br />
Wert herauskommt – Sie sagen ja, Sie hätten den Wert<br />
verändert –, dann gehen wir nach Hause. Das sage ich<br />
Ihnen jetzt schon.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Werte wurden keine verändert.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, eine kurze Antwort darauf: Die Grundlagendaten<br />
kennen Sie alle. Die stehen in der Emissionsprognose<br />
des TÜV. Er prüft anhand dieser maximal möglichen<br />
Input-Werte in den einzelnen Stoffströmen über Transferfaktoren,<br />
ob die Emissionsgrenzwerte, die zum Teil durch<br />
uns und durch die 17. BImSchV vorgegeben sind, überhaupt<br />
einhaltbar sind.<br />
Dann macht er seine Immissionsprognose mit den gesetzlichen<br />
oder den in unseren Genehmigungen vorhandenen<br />
Emissionen. Verstehen Sie?<br />
Die Werte hatten Sie alle; da steht nichts Neues drin –<br />
soweit ich jetzt erkannt habe, was er hier präsentiert hat.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Das wissen<br />
wir ja nicht! Wir haben es ja nicht gesehen!)<br />
Die Grundlagen hatten Sie in der Emissionsprognose.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die Qualitätssicherung – um das deutlich zu machen –<br />
dient ganz zentral dazu, sicherzustellen, dass diese<br />
Abfälle, die eingesetzt werden, diese Qualität einhalten.<br />
Das Konzept, das uns allen so nicht vorliegt, ändert an<br />
den Werten nichts.<br />
[Anm. des RP: Das Konzept wurde von Herrn<br />
Villano im Erörterungstermin vorgestellt.)<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das Problem für uns ist jetzt, Forderungen bezüglich der<br />
Qualitätssicherung zu stellen. Ich habe zwar gesehen,<br />
dass eine der Forderungen erfüllt ist, dass Ihnen nämlich<br />
die Betriebe nachgemeldet werden müssen, wenn sie sich<br />
verändern. Das hätten wir natürlich gefordert, aber das<br />
brauchen wir jetzt nicht mehr.<br />
Ich weiß jetzt aber nicht, was ich nicht fordern soll.<br />
Denn ich weiß nicht, was da schon erfüllt ist. Ich habe im<br />
Überblick gesehen, dass ein paar Forderungen von uns<br />
jetzt erfüllt sind. Sie bekommen die Betriebe mitgeteilt,<br />
wenn sich da etwas ändert, die Lager hat er erwähnt,<br />
Brandschutz ist auch – –<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Wir wissen<br />
es ja nicht!)<br />
Wir wissen es nicht ganz genau, ob das so ist.<br />
Wir nehmen jetzt einfach zur Kenntnis, dass Sie das<br />
prüfen und dass Sie unsere Forderungen in die Qualitäts-
sicherung hineinbasteln, sodass die dann zu 100 % erfüllt<br />
werden.<br />
Etwas nachzureichen ist ja gut, aber nicht dann, wenn<br />
es um Einwendungen geht. Die Einwendung können Sie<br />
mir dann zurückweisen, wenn Sie mir das zeigen. Ansonsten<br />
gehen wir zum Anwalt und lassen es uns so geben.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, Sie bekommen mit dem Protokoll, das hier<br />
erstellt wird, auch dieses Qualitätssicherungskonzept; das<br />
hängt bei. Wir wären natürlich dankbar, wenn Sie dann<br />
das eine oder andere dazu noch sagen würden. Dazu sind<br />
Sie gerne eingeladen.<br />
(Harry Block [BUND]: Wann?)<br />
– Sie bekommen dieses Qualitätssicherungskonzept mit<br />
dem Protokoll.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich hätte aber gerne, dass auch die Menschen hier in<br />
Walzbachtal das mitbekommen. Wir machen vieles oft<br />
bilateral; das wissen die dahinten nicht so genau. Der LNV<br />
als Träger öffentlicher Belange macht das mit Ihnen, weil<br />
das tatsächlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist.<br />
Aber ich will schon, dass die Menschen wissen, was<br />
da passiert, und dass sie informiert werden. Aber das<br />
werden sie jetzt nicht. Der Erörterungstermin ist eigentlich<br />
dafür da, dass alle hier auf dem gleichen Stand sind wie<br />
Sie, und das ist dann nicht gegeben. Deswegen finde ich<br />
das jetzt nicht gut.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, alle Einwender bekommen dieses Protokoll<br />
und damit das Qualitätssicherungskonzept.<br />
(Harry Block [BUND]: Gut, okay!)<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ich verstehe es trotzdem immer noch nicht. Wir haben<br />
vorhin über Kontrollen gesprochen. Da kam nichts. Wir<br />
haben gefragt, wie das funktioniert. Es kam nichts.<br />
Auf einmal taucht ein Papier auf, wo die Antworten,<br />
wie es scheint, gegeben werden. – Ich konnte es nicht<br />
lesen. Sie sehen selber, wenn Sie da oben hingucken,<br />
dass fast nichts lesbar ist.<br />
Ich verstehe Sie nicht. Bitte – das wollte ich Ihnen vorhin<br />
schon sagen – gehen Sie etwas näher ans Mikrofon.<br />
Sie sind sehr schwer zu verstehen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano, wollen Sie dazu kurz noch etwas sagen?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Nur noch einen Satz bezüglich der Zahlen von NRW: Herr<br />
Block, im Antrag auf Seite 32 finden Sie die Zahlen.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Welche Seite<br />
32?)<br />
Seite 44<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Harry Block (BUND):<br />
Nur als Mahnung an die Behörde: Ich finde hier in meinen<br />
Unterlagen mindestens zehnmal die Seite 32. Er sagt jetzt<br />
„Antrag“. – Von Ihnen?<br />
(Tino Villano [AS] nickt.)<br />
Das ist immer ein Problem: Auf welche Seite welchen<br />
Gutachters bezieht man sich? Vielleicht kann man sich<br />
einmal darauf einigen, dass man alles durchnummeriert<br />
und die Namen dazuschreibt, dass man weiß, worüber<br />
man redet. Also Seite 32.<br />
(Tino Villano [AS]: Tabelle 3.1.2 im Ordner 1<br />
des Antrages!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Also, man findet es.<br />
Reinhold Adis (Einwender):<br />
Guten Tag, mein Name ist Reinhold Adis. Ich bin ebenfalls<br />
Einwender. Ich habe nicht so großes technisches Verständnis,<br />
glaube aber verstanden zu haben, dass produktionstechnisch<br />
Emissionen auch aus dem Werkstoff<br />
kommen und dass man durch die Verwendung von Fluff<br />
eine zusätzliche produktionstechnische Erhöhung der<br />
Emissionen aus dem Werkstoff bekommt.<br />
Meine Frage: Ist eine Verwendung von Fluff dann<br />
überhaupt sinnvoll, wenn man durch die Erhöhung der<br />
Emissionen möglicherweise über die Grenzwerte kommt?<br />
– Danke.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Prinzipiell: Die Grenzwerte gelten als Grenzwerte. Es<br />
werden Grenzwerte nicht überschritten.<br />
(Reinhold Adis [EW]: Und die Ausreißer?)<br />
– Nein, auch nicht durch Ausreißer. Das managen wir.<br />
Deswegen wird eine Qualitätssicherungskontrolle gemacht.<br />
Das Eingangsmaterial wird kontrolliert, wird gemanagt,<br />
und die Grenzwerte sind einzuhalten.<br />
Ich hatte anfangs erläutert: Mit dem Antrag werden die<br />
Grenzwerte im Bereich NOx, SO2 wie auch Staub sogar<br />
geringer werden als die aktuell gültigen. Und die sind<br />
einzuhalten.<br />
Reinhold Adis (Einwender):<br />
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei so einer<br />
Müllmenge, bei so einem Gebilde an Sekundärbrennstoffen,<br />
die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt<br />
sind, schwierig ist, Ausreißer zu analysieren. Da alles zu<br />
finden, scheint mir sehr schwierig zu sein.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich hätte gerne sichergestellt – ich weiß nicht, ob das im<br />
Qualitätsmanagement drin ist –, dass beim Fluff keine<br />
Vermischung stattfindet, dass gewisse Fraktionen im
Bunker – ich weiß nicht, wie Sie es dort lagern – nicht<br />
einfach vermischt werden. Es könnte sich ein Ausreißer in<br />
B befinden, und in A ist gar nichts. Wie wird sichergestellt,<br />
dass solche Fraktionen sozusagen sortenrein erkennbar<br />
sind, wenn das z. B. von verschiedenen Betrieben<br />
kommt?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Eine Nachfrage: Bezieht sich die Frage nur auf den Fluff?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Fluff, Autoreifen und Dachpappe sind als Schnipsel<br />
verschieden. Man kann Emissionen auch durch Vermischung<br />
minimieren. Aber Vermischung ist verboten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Fischer.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Für die von Ihnen genannten Stoffe wie Dachpappe, Fluff<br />
usw. gibt es natürlich getrennte Vorratslager. Die Dachpappe<br />
wird nicht mit dem Fluff zusammengemischt.<br />
Auch zwei verschiedene Qualitäten von Fluff werden<br />
getrennt voneinander gelagert. Das heißt, für diese beiden<br />
Qualitäten gibt es dementsprechend getrennte Bunker, die<br />
dafür errichtet worden sind.<br />
In jeweils einen Bunker kommt im Grunde genommen<br />
nur gleiches Material. Zum Beispiel kommt das Material<br />
von dem einen Produzenten in das Bunkersystem 1, das<br />
von einem anderen kommt in das Bunkersystem 2, und<br />
die Dachpappe kommt in das Bunkersystem 3. So ist das<br />
geplant, und so findet es eigentlich auch heute schon<br />
statt. Das meiste, was wir hier diskutieren, ist praktisch<br />
nicht neu.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Fischer. – Da war noch eine Wortmeldung.<br />
Bitte.<br />
Dr. Burkhard Wehrmeyer (Einwender):<br />
Wehrmeyer ist mein Name. Auch ich bin hier aus Walzbachtal<br />
und bin einer der Einwender.<br />
Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage zu diesem<br />
Qualitätsmanagement bzw. zu dem Aspekt dieser Proben.<br />
Herr Villano, Sie haben vorhin ausgeführt, der Stoff wird<br />
angeliefert, und Sie nehmen „Rückstellproben“. Sie haben<br />
dieses Wort verwendet.<br />
Ich habe ein Verständnisproblem mit diesem Wort.<br />
„Rückstellprobe“ – ich formuliere es etwas provokativ –<br />
kann heißen: Ich bringe sie in einen Raum und gucke<br />
irgendwann einmal nach, aber mittlerweile ist der Stoff<br />
schon verbrannt worden. – Vergessen Sie es! Schlucken<br />
Sie es herunter!<br />
Ich frage einmal anders: Nehmen Sie die Probe, gucken<br />
Sie sie sich an, und wenn die in Ordnung war, wird<br />
dann der Stoff verbrannt?<br />
Seite 45<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano direkt.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Rückstellproben werden so genommen, wie es jetzt<br />
der Genehmigung entspricht: Eine Rückstellprobe wird ein<br />
halbes Jahr vorgehalten, um Nachkontrollen möglich zu<br />
machen. Es wird aus diesen Rückstellproben nach 1500 t<br />
eine Mischprobe zusammengeführt, und diese Mischprobe<br />
wird entsprechend analysiert.<br />
Harry Block (BUND):<br />
„Mischprobe“ heißt zum Beispiel: Wir nehmen Urin von<br />
uns allen und stellen dann fest: Einer von uns hat Diabetes.<br />
Das kann nicht sein, wenn das so wäre. Wie muss ich<br />
mir das vorstellen? Was ist eine Mischprobe?<br />
Dr. Burkhard Wehrmeyer (Einwender):<br />
Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht wirklich<br />
verstanden. Wird die Probe vor dem Verbrennungsprozess<br />
analysiert, oder machen Sie das parallel zum Ablauf?<br />
Dann kann das schon verbrannt sein. Wenn Sie bei den<br />
Messungen im Abgas eine Erhöhung festgestellt haben,<br />
schauen Sie sich dann gezielt die Proben an? Oder sind<br />
das nur Stichproben? Vielleicht stellen Sie den Ablauf<br />
noch etwas klarer dar. Ich habe es noch nicht wirklich<br />
verstanden.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wie gesagt, es werden von jedem Lkw zwei Rückstellproben<br />
genommen, und alle Rückstellproben von 1500 t, die<br />
angeliefert wurden, werden dann zu einer Mischprobe<br />
vereint, aufbereitet und analysiert. Sollten da entsprechende<br />
Ausreißer vorliegen, hat man die Möglichkeit,<br />
zurückzuverfolgen, woran es lag. Das läuft parallel.<br />
Dr. Burkhard Wehrmeyer (Einwender):<br />
Das läuft parallel. Das heißt, es kann sein, dass das<br />
Ganze verbrannt worden ist. Sie haben also keine Möglichkeit,<br />
in den Prozess so einzugreifen, dass Sie sagen:<br />
Wir stellen fest, der Zulieferer hat Mist gebaut, das verbrennen<br />
wir erst gar nicht. Das ist dann schon draußen.<br />
Habe ich das richtig verstanden? – Das ist für mich ein<br />
Qualitätsmanagement, das ich nicht verstehe.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Es wird auch durch die kontinuierliche Messung überwacht.<br />
Wenn wir sehen, dass das trendmäßig nach oben<br />
geht, können wir darauf mit verschiedenen Möglichkeiten<br />
reagieren: Das kann dazu führen, dass man Ausschleusungen<br />
macht, dass man die Ersatzbrennstoffrate reduziert<br />
oder dass man als wirklich letzte Konsequenz eine<br />
Herdofenkokseindüsung macht, also Aktivkohleeindüsung.<br />
Dr. Burkhard Wehrmeyer (Einwender):<br />
Ist es technisch nicht machbar, oder könnte vonseiten der<br />
Genehmigungsbehörde nicht einmal darüber nachgedacht<br />
werden, dass das Qualitätsmanagement dahin gehend<br />
verändert wird, dass bereits beim Eingang die Stoffe
kontrolliert werden und dass sie, wenn die Kontrollen in<br />
Ordnung waren, freigegeben und erst dann verbrannt<br />
werden?<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, es ist schon hilfreich für das Verständnis,<br />
klarzumachen, wie derzeit die Analytik stattfindet und wie<br />
diese Untersuchungen durchgeführt werden.<br />
Die Grundlage ist eine Entscheidung aus dem Jahre<br />
2006 für ein mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführtes<br />
Genehmigungsverfahren. Da hat man genau dieses<br />
Thema schon einmal diskutiert, und man kam dann zu<br />
einer entsprechenden Regelung, sodass das, was Lafarge<br />
derzeit durchführt, genehmigungskonform ist. – So weit<br />
ein Statement von unserer Seite dazu. Aber wir sehen es<br />
durchaus so, dass da von Lafarge noch entsprechende<br />
Unterlagen beigebracht werden müssen. – Jetzt bitte Frau<br />
Waibel.<br />
Bettina Waibel (Einwenderin):<br />
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Villano. Sie sagten<br />
eben, dass von jedem Lkw, wenn ich das richtig verstanden<br />
habe, zwei Proben genommen werden. Wie ist es<br />
denn mit der Homogenität der Ladung von so einem Lkw<br />
insgesamt? Kann man wirklich davon ausgehen, dass<br />
alles Relevante erfasst ist, oder kann es auch sein, dass<br />
die Homogenität eher nicht gegeben ist und dann an<br />
gewissen Stellen Sachen sind, die man nicht haben<br />
möchte?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Kann Lafarge etwas dazu sagen?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Zur Homogenität: Bei der Probenahme werden beim<br />
Abladen an verschiedenen Stellen entsprechende Proben<br />
gezogen und gesammelt. Das sind in der Regel 10-Liter-<br />
Säcke, in denen das Material dann als eine Rückstellprobe<br />
gesammelt wird. Von jedem Lkw werden also an<br />
mehreren Stellen Proben zu einer Rückstellprobe gezogen.<br />
Ich möchte noch bezüglich der Überwachung eins<br />
noch ergänzen: Es werden auch Ausgangsanalysen von<br />
den Lieferanten gemacht. Wir haben nicht nur unsere<br />
Analyse, sondern auch die Analyse von den Lieferanten.<br />
Wenn die Lieferantenanalyse schon hohe Werte ergibt,<br />
wird das gar nicht erst geliefert.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano, ich glaube, die Frage ist etwas anders<br />
gestellt gewesen, als sie jetzt beantwortet wurde. Oder<br />
ging die Antwort in die richtige Richtung, Frau Waibel?<br />
Bettina Waibel (Einwenderin):<br />
Ich finde es ist noch nicht umfassend beantwortet. Ein Lkw<br />
transportiert ein relativ großes Volumen. Sie sprachen<br />
Seite 46<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
gerade von Säcken. Nehmen Sie dann z. B. zwei Säcke<br />
heraus, oder wie muss man sich das vorstellen? Werden<br />
mehrere Säcke geöffnet, und Sie entnehmen dann das<br />
Volumen von soundso viel Säcken? Es könnten ja in<br />
einem oder zwei Säcken von der ganzen Lkw-Ladung<br />
z. B. hochgiftige Bestandteile drin sein. Wie kann ich die<br />
erwischen, wenn ich praktisch nur zwei Proben nehme?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich weiß nicht, wer von den beiden Herren antwortet: Herr<br />
Dr. Oerter oder Herr Fischer?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Die Homogenität, die Sie ansprechen, ist seit Beginn des<br />
Einsatzes von Ersatzbrennstoffen eine echte Herausforderung.<br />
Es ist so, dass es niemals so homogen sein kann<br />
wie beispielsweise Braunkohlepulver oder ähnliches<br />
Material. Dieser Herausforderung stellt sich die Industrie –<br />
wir sind ja nicht die Einzigen, die Ersatzbrennstoffe<br />
einsetzen – seit vielen, vielen Jahren stellt. Die verschiedensten<br />
Verbände beschäftigen sich mittlerweile<br />
ausschließlich mit dem Thema: Wie kann ich eine repräsentative<br />
Analyse machen aus einem Material, was eben<br />
nicht zu 100 % homogen ist? Das ist eine echte Herausforderung.<br />
Es gibt die verschiedensten Verfahren, und es gibt<br />
verschiedenste Ergebnisse bei diesen Untersuchungen,<br />
bei diesen Forschungen. Lafarge beispielsweise ist<br />
Mitglied im BGS. BGS ist der wohl anerkannteste Verband,<br />
der sich ausschließlich mit dem Thema der Qualitätssicherung,<br />
Qualitätsuntersuchung usw. von Ersatzbrennstoffen<br />
beschäftigt.<br />
Jetzt zurück zu Ihrer Frage: Wie kann ich gute Analysen<br />
erstellen, obwohl ich weiß, dass bei dieser Gesamtmenge<br />
doch eine gewisse Inhomogenität da ist? Die<br />
Erkenntnisse sind: Das geht im Grunde genommen nur<br />
über zwei Wege: zum einen über die Menge – es darf<br />
nicht nur eine kleine Handvoll sein; das kann nie repräsentativ<br />
werden – und zum anderen über die Verfahrensweisen,<br />
die in den Laboren stattfinden.<br />
Ich brauche eine entsprechend große Menge, die definiert<br />
ist, und diese Menge muss zerkleinert sein. Alle, die<br />
sich mit Analytik beschäftigen, wissen: Ich ermittele<br />
irgendeinen Wert nicht von 10 kg, sondern ich messe im<br />
Labor nur eine ganz kleine Menge.<br />
Das bedeutet: Um aus diesem inhomogenen Material,<br />
das ich da in einem 10-Liter-Eimer habe, etwas Homogenes<br />
zu machen und etwas Repräsentatives wenigstens<br />
aus dieser Probe herauszuziehen, wird diese Probe ganz<br />
fein gemahlen. Feines Material kann ich homogenisieren.<br />
Dann wird dieses Material – so ist die Praxis – auf die<br />
entsprechenden Dinge hin untersucht, um die es geht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Schmid-Adelmann hatte sich zu Wort gemeldet, dann<br />
Herr Wiedenmann und Herr Block noch einmal. Frau<br />
Schmid-Adelmann.
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Eine Rückfrage an Herrn Villano zu der Angabe, dass<br />
nach 1500 t die Analyse untersucht wird: Welchen Zeitrahmen<br />
muss man sich da vorstellen? Wie viele Lkw-<br />
Ladungen sind da insgesamt angeliefert worden sind? Wie<br />
häufig erfolgt die Analyse dann überhaupt?<br />
Ingo Leth (Antragstellerin):<br />
Ingo Leth, Produktionsleitung. – Das dauert ungefähr eine<br />
Woche.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Wiedenmann.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Ich habe eine Nachfrage an Herrn Villano. Sind bei diesen<br />
Nachkontrollen der Mischproben schon auffällige Ergebnisse<br />
vorgekommen, die Sie zum Eingreifen bewegt<br />
haben? Muss so etwas dokumentiert werden, und haben<br />
Sie so etwas bereits dokumentiert?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wir hatten schon den Fall, dass wir einen Lieferanten<br />
ausgeschlossen haben, weil er unzuverlässige Qualität<br />
geliefert hat. Das hat dazu geführt, dass wir den Lieferanten<br />
wechseln mussten.<br />
(Harry Block [BUND]: Der war aber zertifiziert?<br />
– Heiterkeit bei den Einwenderinnen<br />
und Einwendern)<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Die ganze Prozedur dauerte dann aber sicherlich mehrere<br />
Wochen. Das heißt, Sie haben während der Zeit Stoffe<br />
verbrannt, von denen Sie hinterher festgestellt haben,<br />
dass sie eigentlich nicht hätten verbrannt werden dürfen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich hatte eben schon gesagt, ich spreche hier nicht oder<br />
nicht nur für die Firma Lafarge. Aber wenn Sie gestatten,<br />
mache ich ein paar Bemerkungen dazu, wie so etwas<br />
generell geregelt wird. Ich habe den Eindruck, dass der<br />
Ansatz, den Herr Villano in dem Qualitätssicherungskonzept<br />
präsentiert hat, damit auch völlig in Linie ist.<br />
Es ist völlig d'accord: Das ist eine echte Herausforderung.<br />
Wir reden bei diesem Fluff über ein heterogenes<br />
Material. Davon sind annähernd 2 Millionen t im vergangenen<br />
Jahr in den deutschen Zementwerken eingesetzt<br />
worden.<br />
Wir substituieren damit natürlich Regelbrennstoffe. Die<br />
Spurenelementgehalte – das ist das, was Sie umtreibt,<br />
Herr Block – sind im Klinkerbrennprozess völlig irrelevant.<br />
Alles, was an Organik hineinkommt, wird tatsächlich<br />
vollständig verbrannt.<br />
Seite 47<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
(Harry Block [BUND]: Meinen Sie das Tiermehl?)<br />
– Zum Beispiel. – Sie greifen sich immer sehr geschickt –<br />
ich habe das eben schon festgestellt – einzelne Punkte<br />
heraus. Beim Thema CO2 hatten Sie das Gas angesprochen.<br />
Wenn Sie Tiermehl einsetzen, wird es noch viel<br />
besser. – Aber lassen Sie mich auf die Qualitätssicherung<br />
zurückkommen.<br />
(Harry Block [BUND]: Ich habe vorhin gesagt:<br />
Gas! Nehmen Sie Gas! Dann haben<br />
Sie das Problem nicht! Ich sage immer:<br />
Gas! Dann brauchen Sie das alles nicht zu<br />
diskutieren!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Meine Herren, lassen Sie uns bei den Fragen bleiben und<br />
diese beantworten. – Herr Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Zurück zur Qualitätssicherung: Das ist in der Tat nicht<br />
einfach, aber es wird gemacht, und es wird kontrolliert.<br />
Das ist ein mehrstufiger Prozess. Dieser fängt damit an –<br />
das ist auch hier mit Sicherheit der Fall –, dass nur bestimmte<br />
Abfallschlüssel zum Einsatz zugelassen sind.<br />
Jetzt können Sie mir natürlich sagen, Herr Block: Das<br />
reicht nicht aus. Klar reicht das nicht aus. Aber ich habe<br />
zumindest schon bestimmte Einschränkungen, bezogen<br />
auf die Herkunft und bezogen auf die Zusammensetzung<br />
des Materials. Dafür sind die Genehmigungsbescheide<br />
auch da.<br />
Der nächste Punkt ist, dass schon während des Aufbereitungsprozesses<br />
entsprechende Analysen durchgeführt<br />
werden. Ich denke, das wird Herr Fischer bestätigen. Es<br />
würde mich wundern, wenn es in seiner Aufbereitungsanlage<br />
anders wäre. Das geht gar nicht anders. Das hat<br />
zunächst nichts mit dem Prozess zu tun – das hatten wir<br />
eben gesagt –, sondern das hängt mit den Umweltanforderungen<br />
zusammen.<br />
Dann ist quasi die letzte Überprüfung in dieser Stufe –<br />
Sie hatten es selber gesagt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist<br />
besser – in der Tat die zusätzliche Probenahme an den<br />
Standorten, die durch regelmäßige Analysen untermauert<br />
wird, um letztlich auf diese Art und Weise die Einsetzbarkeit<br />
des Material sicherzustellen.<br />
Der Fluff – das möchte ich noch einmal betonen – ist<br />
das mit Abstand am besten überwachte Eingangsmaterial<br />
im ganzen Klinkerherstellungsprozess, obwohl das vielleicht<br />
nur 5 oder 6 % des Mengeninputs sind.<br />
Ich hatte es eingangs gesagt: Der komplette Spurenelementeintrag<br />
– er bestimmt letztlich sowohl die Produktzusammensetzung<br />
als auch die Emissionssituation – wird<br />
maßgeblich durch die natürlich Rohmaterialien bestimmt.<br />
Außerdem substituieren wir mit dem Fluff eine Kohle.<br />
Auch darin sind Spurenelemente enthalten. Das habe ich<br />
eingangs versucht, deutlich zu machen. Es ist ja nicht so,
dass wir von Null auf ein Level X kommen. Vielmehr<br />
bewegen wir uns insgesamt innerhalb eines Korridors, der<br />
gewährleisten muss, dass ich mich mit Blick sowohl auf<br />
die Emissionsseite als auch auf die Produktqualität innerhalb<br />
des zulässigen Bereiches bewege.<br />
Wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Fluff geht das<br />
tatsächlich nur über diesen mehrstufigen Prozess: Limitierung<br />
der Einsatzmaterialien über die Herkunft, über den<br />
Abfallschlüssel, dann Untersuchung der „Produkte“ – es<br />
sind stellenweise wirklich qualitativ hochwertig aufbereiteten<br />
Materialien – während dieses Aufbereitungsprozesses<br />
und abschließend noch einmal eine Kontrolle an dem<br />
Verwertungsstandort. Ich denke, das ist im Wesentlichen<br />
auch in Ihrem Qualitätssicherungskonzept, Herr Villano,<br />
so beschrieben.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Sorg noch einmal.<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Die Nachfrage von Frau Schmid-Adelmann vom Landratsamt<br />
hat bei mir ein bisschen die Alarmglocken schrillen<br />
lassen. Das heißt, es gibt keine Auflagen, wie das überprüft<br />
wird. Es ist eine freiwillige Leistung des Zementwerks,<br />
wann, wie oft, in welcher Dimension, in welchem<br />
Zyklus, in welchem Rhythmus diese Untersuchung stattfindet.<br />
Das heißt für mich: Es gibt behördlicherseits<br />
diesbezüglich keinerlei Auflagen. Das ist für mich erschreckend,<br />
sorry.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt müssen wir kurz etwas sagen: In der Genehmigung<br />
aus dem Jahre 2006, die ich vorhin angesprochen habe,<br />
sind Auflagen zur Untersuchung festgelegt. Der Eindruck,<br />
der sich bei Ihnen eingeschlichen hat, dass keine entsprechenden<br />
Auflagen vorhanden sind, stimmt so nicht.<br />
Es gibt Auflagen, und im Rahmen der Qualitätssicherung,<br />
die auch noch andere produktbezogene Zielrichtungen<br />
hat, kann natürlich ein Betreiber intern über solche<br />
Auflagen hinausgehen.<br />
Aber in diesem Antrag fehlt, weil ein neuer Ersatzbrennstoff<br />
dazukam, das Konzept; das liegt nicht vor. Das<br />
wird noch zu erarbeiten sein. – Vielleicht dies zur Klärung,<br />
Frau Sorg. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich habe noch ein Problem. Sie haben angedeutet, dass<br />
Sie, wenn dies oder das passiert, den Brennstoff durch<br />
einen anderen "ersetzen" können, um Grenzwerte einzuhalten.<br />
Wie oft passiert es, dass Sie das merken? Wie oft<br />
merken Sie bei z. B. Altreifen, dass da irgendetwas nicht<br />
in Ordnung ist?<br />
Ich möchte ausschließen, dass durch Produkttricksereien<br />
eine Verdünnung oder eine Minimierung passiert.<br />
Sie haben gesagt, das geht nicht im Bunker. Wir nehmen<br />
einmal an, das ist richtig. Aber ich möchte nicht, dass das<br />
Produkt sozusagen ausgetauscht wird, sondern ich<br />
Seite 48<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
möchte, dass, egal welches Produkt Sie zu 100 % einsetzen,<br />
die Grenzwerte oder die Zielwerte immer eingehalten<br />
werden.<br />
Noch eins, Herr Oerter: Wir haben nur einen Trick, und<br />
der ist Gas. Wir reden hier über eine Müllverbrennung.<br />
Das heißt, wir reden über Müll und über die Grenzwerte<br />
modernster Müllverbrennungsanlagen und nicht über Ihre<br />
Grenzwerte, die Sie da angeben. Die sind so ausgestattet,<br />
dass solche problematischen Stoffe, wie sie im Fluff drin<br />
sind – in anderen Produkten natürlich auch, aber hier im<br />
Fluff existenziell –, nicht vorkommen.<br />
Sie sind hier ein Zementwerk. Deswegen sind Ihre<br />
Grenzwerte weit weg von denen der Müllverbrennung.<br />
Selbst wenn Sie noch so viel machen, bleiben Sie weit,<br />
weit weg von dem, was heute jede moderne Müllverbrennungsanlage<br />
leistet.<br />
Deswegen unser Trick: Gas. Wenn Sie das nähmen,<br />
können wir das alles hier vergessen. Wenn Ihr Produkt<br />
wirklich nachhaltig an diesem Standort weiterhin erzeugt<br />
werden soll, ist das die einzige Alternative. Das, was Sie<br />
hier andeuten, ist ein Herumdoktern an den Symptomen.<br />
Noch eins zu der Mischprobe: Ich verstehe die Mischprobe<br />
nicht. Wie wollen Sie denn mit einem wirklich<br />
massiven Ausreißer umgehen? Eine Woche, 1500 t,<br />
haben Sie gesagt, also umgerechnet etwa 150 Fahrzeuge:<br />
Wenn jetzt drei Fahrzeuge Ausreißer haben, kriegen Sie<br />
die doch gar nicht heraus.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, das war jetzt, glaube ich, zu schnell gerechnet.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wie können Sie die zuordnen? Wie können Sie sagen,<br />
wenn Sie eine Mischprobe gemacht haben, wer das war?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die konkrete Frage an Lafarge lässt sich aus meiner Sicht<br />
so auf den Punkt bringen – ich hoffe, dass Sie das sagen<br />
wollten –: Wie aussagekräftig ist diese Mischprobe?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wenn wir feststellen, dass es einen Ausreißer gibt, haben<br />
wir, wie gesagt, noch die zweite Rückstellprobe. Wir<br />
gehen dann systematisch vor und vereinen kleinere<br />
Mengen zu Mischproben. Dann sehen wir, in welche<br />
Richtung der Ausreißer geht, sodass wir hinterher wirklich<br />
sagen können: Genau der Lkw hatte uns den Ausreißer<br />
hineingebracht.<br />
(Zuruf einer Einwenderin: Und dann ist es<br />
schon verbrannt! – Bettina Waibel [EW’in]:<br />
Ist es dann verbrannt? Definitiv: ja oder<br />
nein?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ja. Aber das heißt nicht, dass ein Grenzwert überschritten<br />
ist.
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, das war noch ein wichtiger Aspekt: dass die<br />
Qualitätssicherung und das Überschreiten eines Grenzwertes<br />
nicht zwingend zusammenhängen. Aber das eine<br />
bedingt durchaus das andere: Man betreibt Qualitätssicherung,<br />
ohne die Emissionen zu vernachlässigen, die man<br />
misst.<br />
Gibt es vonseiten der Einwender noch eine Frage? –<br />
Herr Bauer.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Keine Frage, sondern nur noch eine Anmerkung: Ich<br />
glaube, Herr Weber hat es gesagt, dass man eigentlich<br />
dankbar für den Antrag sein sollte, weil doch die Grenzwerte<br />
zumindest in zwei, drei Punkten reduziert würden.<br />
Das liegt ja nicht daran, dass Sie einen neuen Antrag<br />
stellen, sondern dass Sie bisher 60 % Sekundärbrennstoffe<br />
hatten und erheblich schlechtere Grenzwerte hatten.<br />
Jetzt kommen Sie aufgrund des Neuantrags in eine<br />
andere Kategorisierung. Das sagt vom Grenzwert her erst<br />
einmal nichts aus.<br />
Uns geht es wirklich darum, dass nicht ein tatsächlicher<br />
Mehr-Output kommt. Sprich: Wenn der Grenzwert<br />
vorher bei einer Skala von eins bis zehn bei zehn war und<br />
Sie tatsächlich drei in Anspruch genommen haben, wenn<br />
aber die neuen Grenzwerte künftig bei sieben sind und Sie<br />
statt drei fünf machen, dann haben wir hier eine Verschlechterung<br />
der Situation. Die wollen wir auf jeden Fall<br />
unterbinden. – Das nur als Anmerkung, weil Sie sagten,<br />
Sie hätten bessere Grenzwerte. Ein Grenzwert allein sagt<br />
nichts über die tatsächliche Situation aus.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Bauer. Aus meiner Sicht müssen wir das an<br />
dieser Stelle nicht weiter diskutieren; denn wir kommen<br />
nach der Mittagspause genau zu dem Thema der Emissionen.<br />
Dieses Thema möchte ich quasi als Eingangsthema<br />
für die Zeit nach der Mittagspause nehmen.<br />
Wir haben heute Morgen für die Mittagspause eine<br />
Dauer von einer Stunde verabredet; daran würden wir uns<br />
auch orientieren. Wir machen also um 14:20 Uhr weiter.<br />
Danke und guten Appetit.<br />
(Mittagspause von 13:18 bis 14:20 Uhr)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frisch gestärkt machen wir weiter. Herr Lang geht noch<br />
einmal mit den Anwesenheitslisten herum, falls sich<br />
jemand von den Einwendern noch nicht eingetragen hat.<br />
Bitte nutzen Sie die Gunst der Stunde, und holen Sie es<br />
nach!<br />
Wir kommen in der Tagesordnung jetzt zum Punkt<br />
Seite 49<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
IV. 3. Emission / Immission Luft<br />
Dort haben wir vor der Pause aufgehört. – Ist das lesbar?<br />
(Monika Siech [EW’in]: Schlecht! Können<br />
Sie es kurz vorlesen?)<br />
– Ich kann es gerne vorlesen, kein Problem: Der erste<br />
Punkt unter diesem TOP 3, Emission/Immission Luft, heißt<br />
„Emissions(-grenzwerte) an Staub, Feinstaub, Stickoxide<br />
(NOx), Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO),<br />
Schwermetalle, Dioxine und Furane. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, ich hätte eine Bitte: Können wir nicht die<br />
„Vorbelastung“ nach vorne ziehen, weil das sonst nicht<br />
logisch ist. Man muss zuerst wissen, was vorneweg ist,<br />
wenn dann nachher etwas dazukommt. Denn sonst ergibt<br />
das keine Logik. Dann muss man das Pferd von hinten<br />
aufzäumen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Wir können mit<br />
der Vorbelastung anfangen.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das wäre mir persönlich recht – wenn es Ihnen da drüben<br />
auch recht ist. Aber das betrifft Sie ja eigentlich weniger.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Dann fangen wir mit vierten Punkt an:<br />
Vorbelastung, auch andere Industriebetriebe<br />
Herr Block, würden Sie noch einmal die Einwendung<br />
konkretisieren und erläutern?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, dass<br />
wir in einer belasteten Region leben. – Jetzt funktioniert<br />
die Technik nicht mehr. Ich wollte Ihnen eine Tabelle über<br />
die Vorbelastung hier in dieser Region auflegen, die sich<br />
in der Einwendung befindet. Sie finden diese Tabelle auf<br />
Seite 6.<br />
Sie werden feststellen, dass in Karlsruhe mit Blick auf<br />
Stickoxide, Staub und insbesondere Feinstaub der Verkehr<br />
selbstverständlich eine Rolle spielt. Aber die Werte<br />
liegen immer in etwa bei der Hälfte von dem, was die<br />
Industrie verursacht.<br />
Herr Oerter, Kleinfeuerungsanlagen, z. B. Kamine etc.,<br />
können Sie den Hasen geben. In Karlsruhe kommen von<br />
den rund 7000 t NOx 2300 t vom Verkehr und 4200 t aus<br />
der Industrie. Da ist noch nicht das neue Kohlekraftwerk<br />
dabei, welches erst nächstes Jahr in Betrieb gehen wird.<br />
Die Hauptanteile des Staubs liefert die Industrie. Das<br />
ist ganz klar. Beim Feinstaub – jetzt reden wir von PM10 –<br />
ist es sowohl die Industrie als auch – – Jetzt können Sie<br />
es da sehen.
(Schaubild: Vorbelastung heute/neu – Anlage<br />
2-10, S. 108)<br />
Die Werte sind von der Stadt Karlsruhe. Die Vorlagen<br />
waren alle im Genehmigungsbescheid von RDK 8 zu<br />
finden.<br />
Der Feinstaub wird sich nächstes Jahr um 414 t erhöhen.<br />
Nicht dabei sind die Raffinerien. Die haben<br />
1700 Megawatt und geben auch Feinstäube ab. Feinstäube<br />
heißt: alle Stäube, Frau Schmid-Adelmann, die 2,5 µm<br />
groß sind. Das heißt, sie sind lungengängig. Das liegt<br />
dankenswerterweise an unserer fantastischen Filterleistung<br />
und an der tollen Verbrennung. Alle Stäube – beim<br />
Kohlekraftwerk sind es 95 % - sind heute nicht PM10,<br />
sondern PM2,5.<br />
All das diffundiert in diesen Raum hinein. Der Autoverkehr<br />
trägt immer nur das dazu bei, was, wenn man das mit<br />
Wasser vergleicht, aus 99 Grad die 100 Grad macht. Das<br />
Glas ist voll, und es läuft über.<br />
Bei uns kommen im nächsten Jahr - das sehen Sie<br />
hier bei Block 8 – die 414 t noch hinzu. Es wird nichts<br />
reduziert. RDK 7 wird weiterhin laufen gelassen – das<br />
werden wir am Donnerstag bei der Hauptversammlung der<br />
Energie <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> wieder hören –, und es wird<br />
nicht nachgerüstet. Das heißt, wir sind an dem Punkt,<br />
dass wir alles überschreiten.<br />
Wir haben NOx-Probleme – das brauche ich euch nicht<br />
zu erzählen. Pfinztal ist eine Luftreinhaltungszone. Sie<br />
brauchen also eine Plakette. Jetzt wissen Sie, warum. Es<br />
liegt nicht in erster Linie am Autoverkehr. Am Ende ist er<br />
es natürlich. Aber insgesamt liegt es an der Vorbelastung<br />
des Raumes.<br />
(Schaubild: Luftbild Karlsruhe - Walsbachtal<br />
– Anlage 2-4, S. 105)<br />
Am Anfang zeigte ich Ihnen dieses Luftbild: Vom<br />
Rhein über Pfinztal bis Walzbachtal gehen die Emissionen,<br />
die dann bei uns hier als Immissionen zu finden sind.<br />
(Schaubild: Emissonen beta- und gammastrahlender<br />
Aerosole – Anlage 2-11, S. 109)<br />
In Karlsruhe kommt noch etwas Spezifisches, etwas<br />
Außergewöhnliches hinzu. Hier sehen Sie Werte vom<br />
Forschungszentrum Karlsruhe, heute KIT Nord. Gucken<br />
Sie sich die logarithmische Kurve der Emissionen einmal<br />
an! Sie sehen hier die radioaktiven Substanzen, die in<br />
diesen Raum diffundieren. Das sind die Zahlen aus dem<br />
neuen LfU-Bericht 2012. Gucken Sie sich an, was das<br />
Kernkraftwerk emittiert! Das sind nur Beta- und Gammastrahler.<br />
Da fehlt ein wichtiger Strahler: Plutonium, Alphastrahler.<br />
Das gibt nur Karlsruhe ab und nur das Institut für<br />
Transurane. – Ich sage das nur deswegen, damit Sie<br />
wissen, was dieser Raum an Vorbelastung hat.<br />
Vorhin hat jemand beim Essen gesagt: Das Grundgesetz<br />
verpflichtet uns, gleichwertige Bedingungen für alle<br />
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen.<br />
Mit dem Zementwerk schaffen wir das auch hier. Das<br />
Seite 50<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
heißt: Wir machen es gleich schlecht. Gleich schlecht<br />
heißt: Es ist etwas da, und dann kommt noch etwas dazu.<br />
Emissionen(-grenzwerte) an Staub, Feinstaub,<br />
Stickoxide (NOX), Schwefeldioxid<br />
(SO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwermetalle,<br />
Dioxine und Furane<br />
(Schaubild: Emissionsfrachten – Anlage 2-12,<br />
S. 109)<br />
Hier sehen Sie Ihre Emissionen. – Mit der Einheit Milligramm<br />
pro Kubikmeter kann kein Mensch etwas anfangen.<br />
Kein Mensch kann sich vorstellen, was Mikrogramm<br />
in einem Kubikmeter sind. Sie alle kennen diese berühmten<br />
Nanogramm bei Dioxinen: Ein Nanogramm bezogen<br />
auf den Bodensee entspricht einem Tropfen. Das ist ein<br />
Witz!<br />
Hier sehen Sie einmal Ihre Werte in Tonnen an Gesamtstaub<br />
– dabei wäre die Frage an Sie: Ist das PM10<br />
oder PM2,5? -, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Quecksilber,<br />
52 kg. Das sind die von Ihnen zur Genehmigung<br />
anstehenden Frachten, die Emissionen. Das würden Sie<br />
bei voller Ausnutzung der Werte, die Sie genehmigt haben<br />
wollen, in diesen Raum abgeben.<br />
(Schaubild: Immissionszusatzbelastung –<br />
Anlage 2-13, S. 110)<br />
Jetzt geht es um die Immission. Was heißt das jetzt für<br />
die Immission? Für die Immission heißt das laut Gesetzgeber,<br />
17. BImSchV: Eine Anlage ist dann genehmigungsfähig,<br />
wenn sie eine Zusatzbelastung von 3 % jährlich<br />
nicht überschreitet. Das ist die Irrelevanzgrenze. Dann<br />
haben wir das bei Ihnen durchgerechnet.<br />
(Schaubild: Foto Zementwerk – Anlage 2-14,<br />
S. 110)<br />
Hier sehen Sie ein Foto von Dürrenbüchig herüber zu<br />
Ihrem Kamin. Das ist in etwa in gleicher Höhe.<br />
(Schaubild: Foto Gasleitung – Anlage 2-15,<br />
S. 111)<br />
Das ist die Gasleitung, die an Ihrem Werk vorbeiführt.<br />
(Schaubild: Problem bei Gas und Müll –<br />
Stickstoffdioxid [NOX] – Anlage 2-16, S.<br />
111)<br />
Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was NOX anrichtet. Wir<br />
kommen vielleicht nachher noch einmal darauf zurück.<br />
Aber jeder weiß, was Sommersmog bedeutet und was es<br />
in Karlsruhe, in einer der wärmsten Regionen Deutschlands,<br />
heißt, wenn bei uns der Ozonwert überschritten<br />
wird.<br />
Jetzt komme ich wieder mit meinem Totschlagargument,<br />
Herr Oerter: Bei Gas hätten Sie auch kein NOX.<br />
Denn NOX können Sie bei Gas auf ein Viertel reduzieren<br />
oder sogar, wie wir es jetzt schon wollen, auf Null. Man<br />
kann feuern ohne eine Abgabe von NOX. Wir sagen: In<br />
Karlsruhe ist der Wert – Grenzwert wie Zielwert – über-
schritten. Deswegen dürfen Sie kein zusätzliches Stickstoffdioxid<br />
abgeben. Darum sagen wir: Nehmen Sie Gas!<br />
Überschreitung von Irrelevanzwerten<br />
(Schaubild: Immissionsjahreszusatzbelastung –<br />
Anlage 2-17 a, S. 112)<br />
Jetzt gehen wir einmal Ihre Stoffe durch, Immissionen:<br />
Was ist erfüllt? – Das sind die, die den Irrelevanzwert<br />
erfüllen. In der hinteren Spalte haben wir die Frachten<br />
ausgerechnet, was Sie pro Kubikmeter in die Luft blasen.<br />
Das sind Ihre Werte, das ist vom TÜV. – Meine Frage: Ist<br />
Lafarge Mitglied beim TÜV Südwest? – Bei vielen Stoffen<br />
ist der Irrelevanzwert von 3 % erreicht.<br />
(Schaubild: Immissionsjahreszusatzbelastung,<br />
u. a. Cadmium, Quecksilber – Anlage 2-<br />
17 b, S. 112)<br />
Aber jetzt kommen wir zu anderen Stoffen, z. B. Cadmium:<br />
nicht erfüllt. Quecksilber: nicht erfüllt. Die Irrelevanzwerte<br />
von 3 % sind hier überschritten. – Sie können<br />
uns nachher einmal erzählen, wie Sie es hinkriegen, dass<br />
Sie das erfüllen. –<br />
(Schaubild: Immissionsjahreszusatzbelastung,<br />
u. a. Antimon, Arsen – Anlage 2-17 c, S. 113)<br />
Antimon: nicht erfüllt. Arsen: nicht erfüllt.<br />
(Schaubild: Immissionsjahreszusatz-belastung,<br />
u. a. Dioxine, Furane – Anlage 2-17 d, S. 113)<br />
Jetzt kommt, finde ich, der dickste Hammer. Dioxine<br />
und Furane: nicht erfüllt, und zwar mit 8 %. Wenn Sie also<br />
im Augenblick die Genehmigung bekommen, so wie Sie<br />
sie wünschen, überschreiten Sie die Werte für Dioxine und<br />
Furane um 8 %.<br />
Normalerweise kommt von Ihrer Seite immer der Satz:<br />
Irrelevanz erfüllt. Ich sage Ihnen nun von unserer Seite:<br />
Irrelevanz nicht erfüllt. Für Sie ist es genehmigungsfähig,<br />
aber für uns heißt es: nicht genehmigungsfähig.<br />
Diese Müllverbrennungsanlage hat Werte, die teilweise<br />
um den Faktor 1000 – Faktor 1000! – höher sind als<br />
jede moderne Müllverbrennungsanlage. Ich zeige Ihnen<br />
nachher die Werte, was heute eine Müllverbrennungsanlage<br />
leisten kann, und zwar eine normale und nicht eine<br />
superkandidelte. Sie werden dann sehen, was das verglichen<br />
mit Ihren Werten bedeutet.<br />
Für Ihre Müllverbrennungsanlage heißt das – ich sage<br />
es noch einmal –: Dioxin: überschritten, Arsen: überschritten,<br />
Antimon: überschritten, Quecksilber: überschritten<br />
und Cadmium: überschritten.<br />
Es sind hier ja Ärztinnen und Ärzte anwesend. Frau<br />
Schmid-Adelmann vom Landratsamt sitzt mit drin beim<br />
RDK 8. Hier gibt es einen Arzt, der sich mit Quecksilber<br />
gut auskennt; der wird dazu vielleicht etwas sagen. Zu<br />
Dioxin will ich auch nichts sagen.<br />
Seite 51<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
(Schaubild: Feinstaub, Feinststaub – Anlage<br />
2-18, S. 114)<br />
Aber zu Feinstaub will ich etwas sagen: Denn das<br />
größte Problem ist dieser Feinstaub. Das ist dieser PM10<br />
bzw. PM2,5. Alle diese Stoffe, die ich vorher genannt habe<br />
- Dioxin lasse ich weg –, sind solche Stoffe. Diese Feinstäube<br />
sind alle lungengängig.<br />
Frau Schmid-Adelmann, Sie hatten damals bei RDK<br />
ganz am Schluss den Satz gesagt – und das bestätigt<br />
Ihnen auch jeder Arzt -: Grenzwerte, wie wir sie hier<br />
diskutieren, sind eigentlich hinfällig. Bei den Grenzwerten<br />
geht man von einem 30-jährigen gesunden Mann aus,<br />
aber nicht von einem Kleinkind, einer schwangeren Frau<br />
oder einem alten Menschen, bei dem diese Prozesse<br />
ganz anders reinhauen als für den 30-jährigen gesunden<br />
Mann.<br />
Über Ihre Grenzwerte, die Sie jetzt angebracht haben<br />
- nehmen wir z. B. NOX mit 320 mg –, haben die bei uns in<br />
der Zentrale in Stuttgart gelacht. Die haben gesagt: Das<br />
kann nicht wahr sein! Ein Kohlekraftwerk bekommt höchstens<br />
200 mg genehmigt, eine Müllverbrennungsanlage<br />
100 mg, und Sie wollen 320 mg! Als Zielwert gibt Ihr<br />
eigener Gutachter 200 mg an. – Wann denn: in 1000<br />
Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren? Nein!<br />
Da geht es um diese Stoffe. Da diese Stoffe die 3-%-<br />
Werte nicht einhalten, ist diese Anlage unserer Meinung<br />
nach nicht genehmigungsfähig. Das ist der eigentliche<br />
Punkt.<br />
Das mit den 3 % habe ich Ihnen erklärt: Das ist nicht<br />
Ihre Schuld; dafür können Sie nichts. Das ist der Raum, in<br />
dem Sie leben. Wenn Sie nachhaltiger weiterproduzieren<br />
wollen, müssen Sie die Irrelevanzgrenze einhalten. Die<br />
halten Sie aber nicht ein, und damit ist die Anlage, so wie<br />
Sie sie jetzt zu 100 % wollen, nicht genehmigungsfähig.<br />
Damit breche ich ab, möchte aber bitten, dass Sie zu<br />
den genannten Stoffen noch etwas sagen. – Wir können<br />
auch noch alle anderen durchgehen. Denn es dürfte Ihnen<br />
wohl klar sein, dass in einer Region, in der die größte<br />
Raffinerie Deutschlands mit 15 Millionen m 3 Öl, also<br />
15 Milliarden Liter, liegt, eine riesige Menge an Benzol in<br />
der Luft ist. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Alle<br />
diese Sixpacks in der Chemie – ob das ein Benzol oder<br />
ein Dioxin ist – sind hoch karzinogen. Vielleicht sagen<br />
Ihnen die hier anwesenden Ärzte zu diesen Stoffen<br />
einmal, was Antimon, was Arsen, was Dioxine, Vanadium<br />
und Nickel im Körper bewirken.<br />
Dann muss man auch die Frage stellen – deswegen<br />
haben wir sie vorhin auch gestellt, Herr Haller –: Woher<br />
kommt das Zeug? Woher kommen plötzliche die Dioxine<br />
und Furane? Jeder weiß, dass normalerweise bei Ihrem<br />
Verbrennungsprozess bei Temperaturen über 900 °C<br />
Dioxine lückenlos vernichtet werden. Normalerweise sind<br />
sie nicht mehr existent. Sie sind aber da. Warum?<br />
Wir wissen es natürlich, klar: De-Novo-Synthese. Es<br />
liegt an den Stoffen, die im Müll drin sind. Im Müll ist alles
drin, und deswegen bilden sie sich in den Abgasen hinten<br />
am Kamin wieder neu.<br />
Erzählen Sie uns, wie Sie die Irrelevanzgrenze einhalten<br />
wollen! - Erster Punkt. Zweiter Punkt: Was richtet das<br />
im menschlichen Körper an? Ich will niemandem vorschreiben,<br />
an welchem Stoff er mir das erklärt. Aber ich<br />
möchte wissen, was da passiert.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block hat zwei Fragen formuliert. Will Lafarge direkt<br />
antworten? Wer? – Wenn nicht, würde ich etwas dazu<br />
sagen.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Irrelevanzwerte. Ich erläutere, wie die Vorgehensweise<br />
bei der Berechnung der Immissionsprognose ist. Die<br />
Wirkung muss ich Ihnen nicht erklären. Ich erkläre Ihnen<br />
jetzt, wie wir auf die Werte gekommen sind.<br />
Letztendlich betrachtet der Gutachter die Emissionsseite<br />
und schaut natürlich auf die Immissionsseite. Jetzt<br />
gibt es für die Emissionsseite Grenzwerte, und es gibt für<br />
die Immissionsseite Grenzwerte und Zielwerte. Es wird<br />
unter einer Worst-Case-Annahme davon ausgegangen,<br />
dass die Grenzwerte emissionsseitig ausgeschöpft werden.<br />
Wie verhält sich das in der Verteilung? Wir haben hier<br />
den Betrachtungsraum absichtlich noch erweitert. Das<br />
heißt, wir sind nicht auf den vorgegebenen Mindestumfang<br />
von der TA Luft eingegangen, sondern darüber hinaus und<br />
haben betrachtet, was immissionsseitig ankommt.<br />
Auch da haben wir letztendlich eine Worst-Case-<br />
Betrachtung gemacht, nämlich die Annahme, dass auch<br />
dort immissionsseitig der Grenzwert ausgeschöpft ist. Wir<br />
haben dann geguckt, was da noch hinzukommt. Das ist<br />
erst einmal die theoretische Grundlage für die Betrachtung<br />
der Immissionsprognose und die Betrachtung der Irrelevanzwerte.<br />
Das, was dann hinzukommt, darf einen bestimmten<br />
prozentualen Anteil – nämlich den der Irrelevanz<br />
– nicht überschreiten. Das ist insofern korrekt.<br />
Jetzt haben wir hier aber zwei Worst-Case-<br />
Betrachtungen: emissionsseitig die Ausschöpfung der<br />
Grenzwerte, und immissionsseitig sind ebenfalls die<br />
Grenzwerte ausgeschöpft.<br />
Dann kommt die Vorbelastung mit ins Spiel. Da stehen<br />
wir deutlich besser da.<br />
(Harry Block [BUND]: Ich weiß nicht, was er<br />
damit meint! – Andreas Bauer [EW]: Überschreiten<br />
Sie nun die Grenzwerte oder<br />
nicht?)<br />
– Nein, wir überschreiten die Grenzwerte nicht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer, nehmen Sie bitte das Mikro! Das ist ein<br />
Termin, der für alle interessant ist, und auch das, was Sie<br />
Seite 52<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
sagen, ist interessant. Dann sollte es auch jeder wahrnehmen<br />
und mitbekommen.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Ich möchte ganz kurz darauf antworten. Es gibt hier ein<br />
bisschen Verwirrung, wann der Irrelevanzwert für ein<br />
Verfahren allein wichtig ist und wann die Gesamtbelastung<br />
für ein Verfahren allein wichtig ist.<br />
Mit den Emittenten aus dem Raum Karlsruhe und wegen<br />
der relativ schlechten Durchlüftung im Rheintal ist es<br />
dort für jeden Antragsteller natürlich extrem wichtig, dass<br />
er die Irrelevanzgrenzen nicht überschreitet. Denn die<br />
Gesamtbelastung ist dort schon sehr hoch. Das ist ganz<br />
klar.<br />
Allerdings sind wir hier nicht in Karlsruhe, und auch<br />
diese Anlage steht nicht in Karlsruhe. Deswegen ist vom<br />
TÜV – jetzt muss ich gucken, wer genau das war; ich bin<br />
die Umweltgutachterin, und Herr Sigl ist leider nicht da –<br />
eine Vorbelastungsmessung gemacht worden. Das ist<br />
sehr wichtig. Sie läuft jetzt schon neun Monate und nicht<br />
nur die sechs Monate, die sie bis zur Antragsabgabe<br />
gelaufen ist.<br />
Die Vorbelastungsmessung gibt hier nicht nur die tatsächliche<br />
Vorbelastung vor Ort am Punkt der stärksten<br />
Immissionsbelastung an, sondern gleichzeitig die derzeitige<br />
Belastung bei Normalbetrieb des Werkes. Das Werk ist<br />
bei dieser Vorbelastungsmessung nicht herausgenommen<br />
worden.<br />
Das heißt: Wenn die Firma Lafarge mit ihrem Werk die<br />
Irrelevanzgrenzen zwar überschreitet, die Gesamtbelastung<br />
aber zeigt, dass sie die Grenzwerte – oder Orientierungswerte,<br />
wie immer man sie auch nennt – nicht überschreitet,<br />
ist es durchaus genehmigungsfähig. Es ist nicht<br />
wahr, dass das Überschreiten der Irrelevanz bedeutet,<br />
dass es nicht genehmigungsfähig sei. Das ist eine Verwechslung.<br />
So haben Sie es dargestellt. Das kann so<br />
nicht stehenbleiben.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ganz kurz von unserer Seite: Frau Dr. Hübner hat insoweit<br />
recht, dass das Irrelevanzkriterium nicht unterschritten<br />
werden muss. – Das vielleicht als Erläuterung für die<br />
Zuhörer. – Das ist eine Forderung der TA Luft, die nur<br />
darauf abzielt, dass ich auf Immissionswerte unter anderem<br />
dann verzichten kann, wenn ich die Irrelevanzschwelle<br />
unterschreite. Das hat nichts mit der Genehmigungsfähigkeit<br />
eines Antrags oder einer Anlage grundsätzlich zu<br />
tun, sondern es dient nur der Systematik der Prüfung zur<br />
Festlegung von Immissionswerten. – Herr Bauer, Sie<br />
wollen eine Frage stellen.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Es hat sich dahin gehend schon etwas geklärt. Frau<br />
Dr. Hübner hat ja gesagt, dass die Irrelevanzwerte überschritten<br />
werden. Herr Villano hat gesagt, dass sie nicht<br />
überschritten werden.<br />
(Tino Villano [AS]: Nein, die Grenzwerte!)
– Ich habe doch gefragt, ob die Irrelevanzwerte überschritten<br />
werden. Dann hatten Sie gesagt – –<br />
(Tino Villano [AS]: Dann habe ich Sie nicht<br />
richtig verstanden! Die Grenzwerte werden<br />
nicht überschritten!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Dann stellen wir das noch einmal klar: Die Irrelevanzschwellen<br />
– diese 3 % - werden bei einzelnen Stoffen<br />
überschritten, aber das ist nicht das Kriterium, dass die<br />
Anlage bzw. der Antrag deshalb nicht genehmigungsfähig<br />
ist. Denn die Prüfung der Irrelevanzwerte ist nur ein<br />
Prüfschritt im Rahmen der Abprüfung von Punkten mit<br />
Blick auf die Festlegung von Immissionswerten. Ist das<br />
überall so angekommen? – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, ich sagte: Aus unserer Sicht ist die Anlage<br />
nicht genehmigungsfähig. Würden Sie die Anlage in<br />
<strong>Baden</strong>-<strong>Baden</strong> bauen, wäre sie bei Überschreitung von<br />
3 % dort nicht genehmigungsfähig. Sie ist allerdings in<br />
diesem hochbelasteten Raum genehmigungsfähig. Das ist<br />
mein Vorwurf.<br />
Wir haben hier bereits Immissionen, und diese Immissionen<br />
werden um 3 % überschritten. Sie überschreiten<br />
hier den Critical Load. Auch darüber habe ich bis jetzt<br />
nirgendwo etwas gelesen. Da heißt es – AG.L.N, Ulrich<br />
Tränkle, Seite 150 -: Das Zementwerk hat keine Neubelastung,<br />
obwohl bei bestehender Überschreitung der<br />
Critical Loads in Dürrenbüchig und – – Wie heißt der<br />
andere Ort?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Lesen Sie kurz weiter! Das geht noch weiter. Wir haben<br />
verschiedene Vorgaben.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das ist mir völlig wurscht. Mir ist nur eins klar: Die Critical<br />
Loads nehmen wir als Ökos ganz ernst. – Wir kommen<br />
nachher auch noch auf ein paar Tierchen zu sprechen. –<br />
Die nehmen wir sehr ernst, wenn sie überschritten sind<br />
und noch einmal 3 % Immissionen hinzukommen. Ich<br />
habe die Kilos genannt. Sie wissen auch, wo sie heruntergehen:<br />
Sie gehen in Dürrenbüchig bei 108 m – oder wie<br />
hoch der Kamin ist – herunter. Der Boden ist hier schon<br />
versifft. Das heißt, Sie müssen nachkalken oder sonst<br />
etwas machen. Warum gibt es denn diese Critical Loads?<br />
– Es gibt nun einmal diese Werte.<br />
Herr Haller, das Totschlagargument der anderen Seite<br />
war immer umgekehrt: Wir halten das Irrelvanzkriterium<br />
ein, die Anlage ist genehmigungsfähig. So war immer das<br />
Totschlagargument gegen uns. – Herr Essig, bei jedem<br />
Verfahren, wo auch Sie dabei waren, war das ein Totschlagargument<br />
– nicht von Ihnen natürlich, Entschuldigung,<br />
aber immer von der anderen Seite: Das Irrelevanzkriterium<br />
ist eingehalten, und damit ist die Anlage okay.<br />
Jetzt mache ich es einmal genau umgekehrt und sage: Sie<br />
Seite 53<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
halten es nicht ein, und das ist jetzt mein Totschlagargument.<br />
Sagen Sie mir, Frau Schmid-Adelmann, wie Sie diese<br />
8 % bei Dioxin für völlig ungefährlich erklären! Das kann<br />
meiner Meinung nach eine Ärztin nicht. Denn das ist ein<br />
sehr gefährlicher Stoff, der da abgegeben wird.<br />
Ich sage es noch einmal: Wir haben Ihnen die Verfahrensalternative<br />
von Anfang an gesagt: Die ist Gas. Da<br />
geben Sie keinen dieser Stoffe ab – nicht einen! Sie<br />
könnten Ihren Betrieb – Zementherstellung – vor Ort<br />
problemlos weiterführen. Wir würden dann kein Wort<br />
sagen und auch über Lärm nur noch ganz ruhig sprechen.<br />
Aber das hier lassen wir nicht zu.<br />
Ich sage nicht, dass das gesetzlich nicht richtig ist.<br />
Aber wollen wir doch einmal sehen, was die Medizin zu<br />
den Werten sagt, ob die 3 % so irrelevant sind, dass man<br />
sagen kann: Darüber sehen wir einfach hinweg.<br />
Von Seiten der Gesundheit würde ich gerne noch ein<br />
Wort z. B. zu den Feinstäuben hören, damit man nicht<br />
glaubt, dass das kein Problem sei. Zu den Critical Loads<br />
können Sie ebenfalls gerne noch etwas sagen.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Dazu würde ich gerne später etwas sagen, wenn es in der<br />
Tagesordnung dran ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir hatten auf Ihren Wunsch hin mit der Vorbelastung<br />
begonnen. Von daher sollten wir das auch abarbeiten.<br />
Wir haben die Sache mit der Irrelevanz klargestellt. –<br />
Frau Schmid-Adelmann, ich frage Sie jetzt direkt, ob Sie<br />
zu diesen gesundheitlichen Dingen noch etwas sagen<br />
möchten?<br />
(Harry Block [BUND]: Über die Vorbelastung<br />
brauchen wir uns mit Ihnen nicht zu unterhalten!)<br />
– Auf Ihren Wunsch haben wir das Thema vorgezogen.<br />
Wenn das Thema Irrelevanz damit für Sie erledigt ist, ist<br />
es das für uns auch.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Nein, die Irrelevanz ist nicht erledigt. Aber die Vorbelastung<br />
ist erledigt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir sind noch bei den Emissionen und Immissionen. Jetzt<br />
war noch die konkrete Frage an Frau Schmid-Adelmann<br />
zu der gesundheitlichen Wirkung.<br />
(Harry Block [BUND]: Feinststäube!)<br />
Sind Sie so gut?<br />
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Herr Block bzw. die Einwender haben mich schon mehrfach<br />
zitiert, was die Feinstäube angeht. Die Wissenschaft<br />
sagt: Es gibt keine unbedenklichen Konzentrationen bei
Feinstäuben. Das ist ein Argument, das gerne bei entsprechenden<br />
Veranstaltungen verwendet wird. Aber es ist<br />
Fakt: Auch bei sehr niedrigen Konzentrationen an PM2,5-<br />
und PM10-Partikeln ist eine Wirksamkeit bei großen<br />
Populationen nachgewiesen.<br />
Die Wirksamkeit geht in Richtung Atemwegserkrankungen<br />
und kardiovaskuläre Erkrankungen. Man geht<br />
auch davon aus, dass es einen linearen Zusammenhang<br />
zwischen der Konzentration an Feinstäuben und der<br />
Häufigkeit an diesen genannten Erkrankungen gibt.<br />
Wie sich das jetzt im Verfahren letztendlich auswirkt,<br />
kann Ihnen niemand mit konkreten Zahlen benennen. Der<br />
Zusatzbeitrag, zu dem wir jetzt wahrscheinlich bald<br />
kommen werden, ist absolut gesehen sehr klein, so dass<br />
wir das in Zahlen auch nicht ausdrücken können.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Frau Schmid-Adelmann. – Was mich interessieren<br />
würde: Wir haben eben über die Immissionssituation<br />
des Raumes Karlsruhe gesprochen. Wir haben<br />
auch über die Vorbelastung hier im Raum Walzbachtal-<br />
Wössingen gesprochen. Hat man in diesem Zusammenhang<br />
– auch vielleicht von Ihrer Seite – einmal die Luftverfrachtungen<br />
von A nach B – ich denke an Ihr Schaubild<br />
von vorhin -, sich überlegt oder von Gutachtern untersuchen<br />
lassen? Die Immissionen müssen ja auf einen<br />
bestimmten Raum wirken. – Ist meine Frage so weit klar?<br />
Die ging durchaus auch an Herrn Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wenn Sie mich fragen: Ich kenne die Hauptwindrichtung,<br />
und Sie kennen sie auch. Sie ist Ihnen in so vielen Terminen<br />
bekanntgemacht worden. Die Hauptwindrichtung ist<br />
Südwest. Das heißt, die Kamine diffundieren in diesen<br />
Raum hinein.<br />
Sie können zweimal fragen, warum Pfinztal eine Luftreinhaltezone<br />
ist. Dann frage ich zweimal, ob Sie alle von<br />
den umgekehrten Winden im Kraichgau wissen: Winde<br />
nachts nach Karlsruhe hinein und tagsüber heraus.<br />
Wir kennen diese ökologische Situation ganz gut und<br />
wissen ganz genau die Niederschlagspunkte. Vom RDK 8<br />
bei 230 m Höhe liegen sie etwa in der Entfernung zwischen<br />
10 km und 25 km. Der Hauptniederschlagspunkt<br />
liegt im Bereich Bretten. Es ist die Gerechtigkeit im Sinne<br />
gleicher Lebensumstände für alle Deutschen, dass Sie es<br />
hier in Wössingen ebenfalls abkriegen. Dazu kann wahrscheinlich<br />
auch der Gutachter kaum etwas sagen.<br />
Das heißt: Die Immissionen hier sind zum Teil natürlich<br />
fremdgemacht. Das ist ganz klar. Deswegen überschreiten<br />
sie auch die 3 %. Was Sie „ein bisschen“ nennen,<br />
ist ein bisschen viel. Das sind Tonnen, die da an<br />
Feinstäuben herausgeblasen werden. Das sind nicht ein<br />
paar Gramm. Weil das schon so viel ist, ist auch dieses<br />
bisschen einfach zu viel.<br />
Seite 54<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist schon eine ganz ernste Frage, die ich gerne<br />
beantwortet hätte. Frau Dr. Hübner hat sich gemeldet,<br />
aber auch Herr Essig hat noch einen Punkt.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, ich bin jetzt über Ihre Aussage etwas verwundert.<br />
Denn wir wissen aus den Genehmigungsverfahren<br />
- nicht nur Steinkohleblock 8, sondern auch Grosskraftwerk<br />
Mannheim -, dass wir im Rheintal eine talseits<br />
gerichtete Strömung haben. Da geht keine Strömung<br />
hierher nach Wössingen bzw. Walzbachtal. Das geht<br />
straight an den Hügeln entlang: Vogesen, Pfälzer Wald<br />
und Kraichgau. Das ist die gerichtete Strömung. Das<br />
kennen wir doch aus vielen Immissionsprognosen, mit<br />
denen wir schon gemeinsam zu tun hatten, Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Essig, es ist richtig – Gott sei Dank –, dass wir hier<br />
nicht alles abkriegen. Denn dann könnten Sie hier gar<br />
nicht mehr leben. Das wissen Sie so gut wie ich. Dass der<br />
Dreck von Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe<br />
regelmäßig am Rhein entlang hin und her diffundiert, ist<br />
sicher richtig.<br />
Ich bin in der glücklichen Situation, in Karlsruhe so zu<br />
wohnen, dass ich morgens jeden Tag auf diese Kamine<br />
gucken kann. Ich sehe die Wolkenbewegungen. Diese<br />
Wolkenbewegungen sind leider manchmal auch hierhin<br />
gerichtet. Das kommt dann hier an. Das hängt davon ab,<br />
wie die Wolkenverhältnisse sind. Die sind bei uns verschieden.<br />
Es entscheidet also nicht nur die Windrichtung,<br />
sondern auch die Wolkenrichtung, wo die Kamine hineindiffundieren.<br />
Das hängt auch davon ab, ob es kalt ist oder<br />
warm. Kalte Luft transportiert relativ schlecht und warme<br />
relativ gut.<br />
Das Problem ist: Sie bekommen in diesen Raum einiges<br />
hinein. Wäre es anders, ginge also alles in Richtung<br />
Südwest, könnten Sie hier und könnten wir in Karlsruhe<br />
bei den vorhandenen Emissionen nicht mehr leben. Das<br />
ist ganz klar. Wir haben permanent diese Rheinverquerung,<br />
diese Verwirbelungen am Rhein entlang, sodass wir<br />
all die Schadstoffe mehr oder weniger zwischen Mannheim<br />
und Karlsruhe austauschen. Es gibt es ein paar<br />
Bereiche, wo das wirklich schrecklich ist; das ist wahr.<br />
Aber trotzdem: Der Kraichgauwind geht sowohl in die<br />
eine Richtung als auch in die andere Richtung, und zwar<br />
genau über Pfinztal, Wössingen und Bretten herüber.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Dr. Hübner.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Ich wollte noch einmal kurz auf die Irrelevanz und auf die<br />
Vorbelastungsmessungen zurückkommen. Wir reden hier<br />
von Vorbelastungen, und Sie beziehen sich immer auf<br />
Karlsruhe und diesen Raum mit RDK, Stora Enso, MiRO<br />
und alle Ihre Verfahren, die Sie sehr gut kennen.
Aber wichtig sind vor allen Dingen die Tabellen 6.1<br />
und 6.2 vom Immissionsgutachten, in denen die maximale<br />
Immissionsgesamtbelastung für Dürrenbüchig an dem<br />
Hauptaufpunkt der Immissionen des Werkes gemessen<br />
worden sind. Dem ist dann der Immissionsjahreswert oder<br />
der Beurteilungsmaßstab – je nachdem, worum es sich<br />
handelt – gegenübergestellt worden. Wichtig ist, dass die<br />
Werte der maximalen Immissionsgesamtbelastung den<br />
Immissionsjahreswert nicht überschreiten. Das ist das,<br />
was man beurteilen muss.<br />
Darauf wollte ich hinweisen, dass Sie einmal dort hineinschauen;<br />
auch Sie haben ja die Unterlagen. Ich finde<br />
nämlich, dass wir jetzt zu viel auf Karlsruhe zu sprechen<br />
kommen. Denn die Immissionen, die in Walzbachtal oder<br />
Dürrenbüchig – was natürlich zu Bretten gehört - herunterkommen,<br />
sind gemessen und nicht irgendwie abgeschätzt<br />
worden. Von diesen Werten aus muss man das<br />
Ganze beurteilen.<br />
Wir beurteilen als Fachleute nicht einfach aus dem<br />
hohlen Bauch heraus, sondern wir haben unsere Vorgaben.<br />
Auch der Immissionsgutachter, der dieses Gutachten<br />
gemacht hat, der heute leider wegen Krankheit nicht da<br />
sein kann, hat seine genauen Vorgaben. – Darauf wollte<br />
ich noch einmal zurückkommen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, wollten Sie direkt dazu noch etwas sagen?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Sie wissen im Augenblick nicht konkret, wie sich diese<br />
zusätzliche Belastung hier auswirkt. Sowohl emissionsmäßig<br />
weiß man es nicht genau, weil wir nicht wissen,<br />
was im Müll drin ist, als auch immissionsmäßig. Es ist also<br />
alles berechnet. Das ist nach den Grundlagen der<br />
17. BImSchV berechnet worden, deren Werte in diesem<br />
Fall für uns viel zu hoch sind, weil es Anlagen gibt, die sie<br />
nicht nur problemlos, sondern um ein Vielfaches unterschreiten.<br />
Hier geht es um sehr hohe Werte. Das heißt, die Werte,<br />
die Sie wollen, sind so hoch, dass wir auf diesem<br />
Irrelevanzkriterium herumhacken. Wir werden darauf<br />
herumhacken, weil Sie – wenn Sie wollten – entweder<br />
Gas oder bessere Filter nehmen könnten. Wir kommen ja<br />
nachher auch noch auf die Filteranlagen zu sprechen.<br />
Wenn Sie andere Filter nehmen, können Sie dieses<br />
Irrelevanzkriterium einhalten.<br />
Ich bin dankbar, dass Frau Schmid-Adelmann da ist.<br />
Das Medizinische dazu kann man nachlesen; das steht<br />
überall drin. Es gibt für diese Stoffe eigentlich keinen<br />
Grenzwert. Eigentlich machen wir hier etwas, mit dem wir<br />
unsere Kinder bewusst vergiften. Ich bringe sie damit nicht<br />
um, aber ich vergifte sie. Denn es gibt für diese Stoffe<br />
keine Grenzwerte.<br />
Ich hatte vorhin die Frage gestellt: Wie hoch ist bei<br />
dieser Anlage der Anteil der Feinstäube PM2,5 in Prozent?<br />
Auch das ist eine interessante Frage. Über PM10 sagten<br />
Seite 55<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Sie etwas aus; aber das ist eigentlich wurscht. Denn PM2,5<br />
ist bei diesen Stoffen wesentlich gefährlicher.<br />
Der Rückgriff auf Karlsruhe zeigt nur, dass wir in einer<br />
Welt leben. Da kommt jetzt etwas hinzu, und das wollen<br />
wir nicht. Vielmehr muss diese Anlage nachweisen – jetzt<br />
zitiere ich das Bundesumweltamt -, dass sie minimiert,<br />
und nicht, dass sie einen Grenzwert einhält.<br />
Ich sage es noch einmal: Sie betreiben nach meiner<br />
Ansicht eine Müllverbrennungsanlage. Sie sagen: Nein,<br />
wir machen eine Verwertung. Aber das ist eine andere<br />
Seite. Für mich sind Sie eine Müllverbrennungsanlage.<br />
Dann müssen Sie nachweisen, dass Sie massiv weniger<br />
abgeben. Dann könnten Sie das von mir aus – das heißt,<br />
vonseiten der Behörde aus – machen.<br />
Die Irrelevanzgrenzen sind natürlich berechnet. Aber<br />
sie sind nun einmal gesetzgeberisch so festgelegt. Ich<br />
denke, sie sind zu hoch festgelegt. Die 17. BImSchV hat<br />
zu hohe Werte festgelegt und die neue 39. BImSchV<br />
bedeutet noch einmal eine Vermiesung. Das ist für uns<br />
nicht das Kriterium. Für uns ist das Kriterium: Die Werte<br />
sind für diesen Raum bei diesen Stoffen nicht irrelevant.<br />
Deswegen ist unsere Forderung an Sie: Nehmen Sie Gas!<br />
Zur Minimierung bei den Stickoxiden stellt sich nachher<br />
bei der Filtertechnik die Frage: Ist da das Optimum<br />
erreicht? Ist der Filter, den Sie bei den Feinstäuben<br />
einsetzen, das Optimum der Technik? Ist es wirklich das,<br />
was heute an Filtertechnik möglich ist? Können Sie, wenn<br />
Sie einen Filter der modernsten Bauart nehmen – ein<br />
Beispiel ist die Müllverbrennung Hagen, ich zeige Ihnen<br />
nachher die Werte –, die Werte mit einer anderen Filtertechnologie<br />
einhalten? Das wären die Fragen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt bringen wir in der Tagesordnung in der Tat einige<br />
Dinge durcheinander. Wir sollten jetzt wieder zu dem<br />
zurückkommen, wo wir eigentlich stehen. Das, was Sie<br />
fordern, ist die eine Sache, die im Raum steht. Aber wir<br />
müssen gucken: Können wir konkrete Dinge klären,<br />
erläutern oder erörtern? Aus meiner Sicht war von Ihnen<br />
bei dem letzten Block dazu nichts gekommen.<br />
(Harry Block [BUND]: PM2,5 – wie viel?)<br />
– Genau. Dann bringen wir die Frage noch einmal auf den<br />
Punkt. Kann jemand von Lafarge dazu eine Aussage<br />
machen: Wie hoch ist der Anteil an PM2,5? – Herr<br />
Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Zwei Sachen: Ich bin natürlich nicht sprechfähig, was die<br />
Gewebefilter von Lafarge angeht, aber hier ist ein Gewebefilter<br />
installiert. Das ist absolut der neueste Stand der<br />
Technik für die Zementindustrie.<br />
Herr Block, Sie haben es angesprochen: Dadurch,<br />
dass die Abscheidegrade bei den modernen Filteranlagen<br />
extrem hoch sind, ist das, was noch durchkommt, natürlich<br />
überwiegend die Feinstaubfraktion. Dazu nur ein Daumenwert:<br />
Es sind ungefähr 60 bis 70 % PM2,5 und größer
90 % PM10. Das ist letztlich dem hohen Abscheidegrad<br />
geschuldet. Bei einem modernen Gewebefilter ist das so.<br />
Man reduziert die Staubfracht auf unter 10 mg/m 3 . Das,<br />
was noch durchkommt, ist in der Tat der Feinstaub.<br />
Wenn Sie gestatten, Herr Haller, noch eine kurze Bemerkung:<br />
Ich habe die Immissionsprognose nicht gemacht,<br />
möchte aber sagen, weil Sie, Herr Block, auf die<br />
Zusatzbelastung so deutlich hingewiesen haben: Ich hatte<br />
mich gestern kurz mit Herrn Sigl vom TÜV austauschen<br />
können. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er in<br />
der Tat das Werk virtuell als neue Anlage auf die Vorbelastung,<br />
in der das Werk messtechnisch allerdings schon<br />
berücksichtigt war, noch einmal draufgerechnet. Ich<br />
glaube, das wird auch in dem Gutachten deutlich. Das<br />
heißt, das ist eine Worst-Worst-Case-Betrachtung. – Das<br />
nur zum Thema der Zusatzbelastung. Das Zementwerk ist<br />
also im Grunde genommen bei den Vorbelastungsmessungen<br />
– das wird Herr Bachmann mit Sicherheit noch<br />
vorstellen – schon mitberücksichtigt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
(Schaubild: Vergleich: Feinststäube KA –<br />
Anlage 2-19, S. 114)<br />
Das sind die Feinststäube in Karlsruhe – aktuell, LfU. Das<br />
sind alles berechnete Werte: 170 t Verkehr, 206 t Industrie.<br />
Durch RDK 8 kommen in diesem Raum 400 t hinzu,<br />
und von Ihnen kommen 60 t hinzu. Die 400 t kann er gar<br />
nicht berechnen; sie kommen aber. – Es ist absolut<br />
Vorschrift, dass er das so rechnet. Das geht gar nicht<br />
anders, er muss es so rechnen. Er darf das gar nicht<br />
anders. Es wäre ja getrickst, wenn er es so macht. Also<br />
hat er es richtig gemacht.<br />
Die 400 t kann er also nicht berechnen, weil das Kohlekraftwerk<br />
noch gar nicht da ist. Das wird aber kommen,<br />
vermutlich im Juli nächsten Jahres. Dann wird dieser<br />
Raum durch das Kohlekraftwerk noch mehr vorbelastet<br />
sein. Von Mannheim kommt genau das Gleiche wieder in<br />
der Querverbindung in diesen Raum hinein. Das ist leider<br />
die Situation in einem Land, wo wir halt wirtschaften; das<br />
ist klar. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jeden<br />
Wert verringern.<br />
(Schaubild: Staubdeposition in mg/[m².d] –<br />
Anlage 2-20, S. 115)<br />
Hier habe ich Ihnen einmal die Spannweite der Jahresmittelwerte<br />
der Staubniederschläge hingeschrieben.<br />
Die rote Linie zeigt Karlsruhe. Alle sinken, nur einer steigt:<br />
Karlsruhe. Das ist der neueste Bericht, Stand: 2012. Der<br />
neueste Bericht zeigt: Der Wert geht nach oben, und er<br />
wird noch höher gehen.<br />
Dann frage ich das RP: Wie wollen Sie sowohl den regionalen<br />
Behörden oder Parlamenten als auch dem<br />
Europäischen Parlament klarmachen, dass jetzt wieder<br />
Seite 56<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
eine Anlage genehmigt wird, deren Irrelevanzwerte<br />
überschritten sind?<br />
Der Europäische Gerichtshof kennt Irrelevanz und<br />
Grenzwerte nicht. Er kennt nur Gefährdungen. So ist der<br />
EuGH. Man glaubt das nicht, aber auch das ist Europa.<br />
Gucken Sie sich das hier an: Das können wir nicht zulassen.<br />
Der Wert für Feinstaub steigt nur in Karlsruhe. Bei<br />
allen anderen sinkt er. Das müssen Sie sich einfach<br />
klarmachen. Sie können sagen: Das ist irrelevant. Wir<br />
sagen aber: Nein, das ist nicht irrelevant. Sie müssen<br />
minimieren.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank für die Folie, auch wenn ich sie nicht ganz so<br />
verstehe, wie Sie uns das gerade dargestellt haben. Denn<br />
zumindest in 2012 steigen die Werte in mehreren Regionen,<br />
z. B. auch im Schwarzwald und in Oberschwaben.<br />
Aber ich sage einfach, wie ich das sehe.<br />
(Harry Block [BUND]: Karlsruhe hat die<br />
Spitze!)<br />
– Das wollte ich damit jetzt nicht in Zweifel ziehen. Einfach<br />
zur Versachlichung: Da gehen noch ein paar mehr Werte<br />
nach oben. Aber Karlsruhe ist da sicherlich mit oben. Das<br />
wollte ich auch nicht in Frage stellen.<br />
Mir scheint noch die Frage von vorhin zur Windrichtung<br />
und zur Luftströmung, wozu auch Herr Essig eine<br />
etwas andere Auffassung vertreten hat, in dieser Diskussion<br />
relevant und interessant zu sein. Kann die LUBW<br />
etwas zur Windrichtung sagen, um das zu versachlichen?<br />
Christiane Lutz-Holzhauer (LUBW):<br />
Es ist auf jeden Fall richtig, dass Sie im Rheingraben<br />
durch die Kanalisierung von den Vogesen und dem<br />
Schwarzwald diese südwest-nordost-gerichtete Strömung<br />
haben.<br />
(Schaubild: PM10-Zusatzbelastung in der bodennahen<br />
Schicht – Anlage 2-21, S. 115)<br />
– Genau, das zeigen Sie sehr schön. – In diesem Raum<br />
ist es jetzt ein bisschen anders. In Wössingen tritt eine<br />
etwas andere Windrichtung auf. Da hat man etwas mehr<br />
die überregionale Ostwest-Ausrichtung und nicht so stark<br />
die Südwest-Nordost-Winde.<br />
Aber es wird durch die Abluftfahne vom RDK auf jeden<br />
Fall eine Beeinflussung dieses Raumes stattfinden; das ist<br />
keine Frage. Die Hauptmaxima werden woanders sein,<br />
aber es gibt natürlich in gewissen Anteilen hier eine<br />
Beeinflussung. Das kann man nicht ganz abstreiten. Ob<br />
die jetzt von der Immissionsseite messtechnisch erfassbar<br />
ist, muss man einfach dahingestellt sein lassen. Ich<br />
meine, dafür gibt es Rechnungen. Das betrifft ja die<br />
Zukunft.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Frau Lutz-Holzhauer. – Nur zur Klarstellung:<br />
Der Raum Walzbachtal wird von den Emissionen in
Karlsruhe beeinflusst. Das war jetzt im Kern Ihre Aussage.<br />
Man kann nicht quantifizieren, wie viel.<br />
Christiane Lutz-Holzhauer (LUBW):<br />
Nein. Auch in den Ursachenanalysen und in den Luftreinhalteplänen<br />
gibt es einen großräumigen Hintergrund, der<br />
natürlich von allen Quellen bedient wird. Dazu zählt<br />
natürlich auch der Großraum Karlsruhe.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ja, natürlich. Mir war es nur wichtig, hier noch einmal<br />
klarzustellen, was die sachliche Grundlage und der Kern<br />
Ihrer Aussage war. Sprich: Karlsruhe emittiert ins Walzbachtal.<br />
Harry Block (BUND):<br />
(Schaubild: PM10-Zusatzbelastung in der<br />
bodennahen Schicht – Anlage 2-21, S. 115)<br />
Das Irrelevanzkriterium für RDK beträgt hier 3 %. Sie<br />
sehen hier: 400 t Stäube reißen in Karlsruhe nicht das 3-<br />
%-Kriterium – 400 t Feinstäube! Und in Wöschbach reißen<br />
20 t die 3-%-Hürde. Da sehen Sie einmal die unterschiedliche<br />
Vorbelastung. Sie reißen bei fünf Stoffen aus diesem<br />
Katalog PM10, PM2,5 die Irrelevanzgrenze.<br />
Die haben damit bewiesen, dass sie genehmigungsfähig<br />
sind. Ich sage Ihnen: Sie sind es nicht, weil eine<br />
Behörde in diesem Bereich keine Zulassung geben darf,<br />
dass durch irgendeine Maßnahme die Immissionen vor<br />
Ort zunehmen. Ob das jetzt 3,5 % oder 7 % sind, ist völlig<br />
egal. Da darf es keine Zunahme geben. Das ist unsere<br />
Forderung, die wir mit diesem Punkt verbunden haben.<br />
Und sonst gar nichts. Hier sehen Sie es noch einmal:<br />
400 t reißen das 3-%-Kriterium nicht, und dort reißen es<br />
20 t, so viele sind es da.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, nur eine kurze Anmerkung dazu: In Karlsruhe<br />
haben sehr wohl Schwermetalle die Irrelevanz gerissen.<br />
Deswegen hat die LUBW in unserem Auftrag dort Vorbelastungsmessungen<br />
gemacht. Hier ist das genauso.<br />
Das heißt, wenn ich irgendwo eine Irrelevanzgrenze<br />
reiße, muss ich, um eine Genehmigung zu bekommen,<br />
eine Vorbelastungsmessung machen. Das ist hier erfolgt.<br />
Das ist der Unterschied.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Noch einmal ganz direkt dazu: Natürlich kann man in einer<br />
Diskussion nicht alles vorlesen, was man in Hunderten<br />
von Seiten geschrieben hat. Aber es kam so an, als würde<br />
die Irrelevanz für PM10 nicht erfüllt sein. Die ist aber erfüllt.<br />
Und genauso gilt das für PM2,5.<br />
Das betrifft ganz alleine Arsen, Nickel, Vanadium, Dioxine<br />
und Furane. Das betrifft aber nicht den Schwebstoff<br />
als solchen, nicht PM10 als solches und auch nicht PM2,5.<br />
Das ist ganz wichtig. Das ist ähnlich offensichtlich, wie es<br />
beim RDK war. – Ich sage das nur, damit Sie noch einmal<br />
darüber nachdenken.<br />
Seite 57<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Harry Block (BUND):<br />
Entschuldigung, wo befindet sich denn das Vanadium? –<br />
In flüssiger Form oder was? Das ist ein Staub! Es sind<br />
- ich kenne jetzt die Staubverordnung nicht; Sie sind die<br />
Fachfrau; Sie werden das wissen – 810 Stoffe, die in<br />
Deutschland als Staub bezeichnet werden. Darunter sind<br />
alle diese Stoffe. Das ist ein Euphemismus. Dahinter<br />
verbergen sich Cadmium usw. Das sind da alles Stäube.<br />
Was soll das denn sonst sein? Das ist natürlich Staub.<br />
Oder schütten Sie das mit der Schaufel heraus, wie<br />
Kupfer oder so? – Ich weiß es nicht. Es kann ja sein, dass<br />
Sie eine neue Methode gefunden haben.<br />
Ich verstehe nicht, wie Sie da argumentieren. Es ist<br />
Staub, und es sind die 3 %. Es tut mir leid, es ist so. –<br />
Oder irre ich mich jetzt so arg, Rolf?<br />
Gut. Danke.<br />
(Dr. Rolf Wiedenmann [EW]: Nein, nein!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ihre Auffassung, Herr Block, ist, glaube ich, angekommen.<br />
– Herr Dr. Wiedenmann, hatten Sie noch eine Frage, weil<br />
Sie sich kurz zu Wort gemeldet hatten?<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Ich will jetzt einfach weg von diesem Irrelevanzwert, weil<br />
das meiner Ansicht nach eine Fehldebatte ist. Wir wissen<br />
seit Jahrzehnten, dass dieser Irrelevanzwert niemals<br />
medizinisch oder gesundheitlich begründet war, sondern<br />
immer nur damit, was man der Technik und der Industrie<br />
zumuten kann, damit sie überhaupt noch ihre Anlagen<br />
betreiben kann. Insofern ist es einfach falsch, sich darauf<br />
so festzunageln und zu sagen: Darunter ist es okay, und<br />
darüber ist es nicht okay.<br />
Ich möchte auf die Region und auf Ihre Frage, Herr<br />
Haller, noch einmal zurückkommen. Sie haben vorhin die<br />
Ausbreitung hier im Bereich Wössingen, Walzbachtal bis<br />
nach Bretten betrachten wollen. Da muss man nur diese<br />
Gutachten sehr sorgfältig lesen. Da sind wunderschöne<br />
Bilder drin, wo der Gutachter die Immissionen – egal für<br />
welchen Schadstoff – farblich gekennzeichnet hat. Wir<br />
haben hier eine ganze Latte von Schadstoffen. Egal,<br />
welcher Schadstoff es ist, ob vom Grenzwert her irrelevant<br />
oder nicht irrelevant: Das Zentrum der Immissionen ist<br />
mitten in Dürrenbüchig; das gilt für alle diese Stoffe.<br />
Ich würde gerne die Leute von der Firma fragen: Wer<br />
von Ihnen wohnt in Dürrenbüchig? Wahrscheinlich wären<br />
Sie alle längst weggezogen, wenn Sie da einmal gewohnt<br />
hätten, weil Sie vielleicht wissen, was Ihre Firma anrichtet.<br />
Wenn ich jetzt hier in Dürrenbüchig wohnte, würde ich<br />
schleunigst versuchen, mein Haus zu verkaufen - wenn es<br />
überhaupt noch verkäuflich ist –, und da wegziehen. Da<br />
kann man doch nicht guten Gewissens wohnen! Da kann<br />
man doch keine Kinder großziehen! Es ist wirklich egal,<br />
welchen Wert Sie nehmen: Im Zentrum von diesem<br />
kleinen Ort kommt das alles herunter. Wollen Sie das der<br />
Region zumuten, in der Sie Ihre Firma betreiben?
Sie können natürlich mit Recht fragen: Was sollen wir<br />
denn machen? Sollen wir den Schornstein noch höher<br />
machen, oder sollen wir die Firma um 3 km nach Norden<br />
versetzen? Dann geht es an Bretten vorbei und an Dürrenbüchig<br />
vorbei.<br />
Sie haben vom Land, vom Bund und von Europa den<br />
Auftrag, die Immissionen zu vermindern. Und was machen<br />
Sie? – Sie packen durch Ihren Antrag zusätzlich etwas<br />
drauf.<br />
Deswegen die Frage: Was haben Sie denn überhaupt<br />
für eine Möglichkeit, diesem Ansinnen der Regierungen,<br />
nämlich eine Immissionsminderung oder Emissionsminderung<br />
zu erreichen, gerecht zu werden? – Es geht nur,<br />
indem Sie den Brennstoff ändern. Sie müssen weg von<br />
Ihren Müllverbrennungsanlagen, Sie müssen etwas<br />
anderes machen. Sonst ist meiner Ansicht nach diese<br />
Firma einfach nicht verträglich für die Region.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Lafarge will wohl nichts zu diesem Punkt sagen. Ihre<br />
Botschaft ist sicherlich angekommen.<br />
Wir sind gehalten – das wissen Sie auch -, den Antrag<br />
aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland mit den entsprechenden<br />
Regelungen und Grenzwerten, die wir in der<br />
17. BImSchV und der TA Luft haben, zu entscheiden. Wir<br />
werden das mitnehmen und auch diese Forderung von<br />
Ihnen im Rahmen der Prüfung einbeziehen.<br />
Jetzt gibt es zwei weitere Wortmeldungen. Ladies first,<br />
Herr Block. – Frau Siech.<br />
Monika Siech (Einwenderin):<br />
Ich möchte dazu noch etwas wissen. Einhaltung der<br />
Grenzwerte bedeutet doch, dass innerhalb der Grenzwerte<br />
die Giftstoffe in den Boden gehen. Ist das so weit<br />
richtig?<br />
(Zuruf eines Einwenders: Ja!)<br />
– Okay. Ich stelle mir jetzt als Nichtfachmann vor: Dieses<br />
Jahr kommt Quecksilber herunter. Quecksilber hat keine<br />
Halbwertszeit, das bleibt innerhalb des Grenzwertes im<br />
Boden. Nächstes Jahr kommt wieder Quecksilber dazu.<br />
Das reichert sich doch an. Haben wir nicht irgendwann<br />
einmal Sondermüll in unseren Böden? Das ist meine<br />
Frage.<br />
(Paolo Caciolli-Kassner [EW]: Wie lange<br />
wollen Sie noch produzieren: 20, 30, 40<br />
Jahre?)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Entschuldigung, würden Sie sich einfach kurz mit Namen<br />
vorstellen?<br />
(Monika Siech [EW’in]: Ich hätte gerne meine<br />
Frage beantwortet!)<br />
Seite 58<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
– Das hätte ja eine Ergänzung dazu sein können. – Will<br />
jemand vom Bodenschutz etwas zu dem Thema Immissionswert<br />
und Emissionswert sagen? – Frau Dr. Hübner?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Die Immissionsprognose bewertet auch die Auswirkungen<br />
auf die Bodenbeschaffenheit. Das müsste Ihnen eigentlich<br />
wieder Herr Sigl erklären. Er hat prognostiziert, wie viel<br />
sich von Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber,<br />
Nickel, Blei, Thallium, Zink und Benzo(a)pyren innerhalb<br />
von 100 Jahren im Boden anreichern würde.<br />
Dann gibt es sogenannte Orientierungswerte aus der<br />
Bundes-Bodenschutzverordnung und hilfsweise auch aus<br />
der UVP-Verwaltungsvorschrift. Er hat diese maximalen<br />
prognostizierten Bodenzusatzbelastungen diesen Orientierungswerten<br />
gegenübergestellt und den Anteil in Prozent<br />
ausgerechnet, den das Werk in 100 Jahren daran hätte.<br />
Er kommt im Ergebnis immer auf Werte unter jeweils 1 %.<br />
Das liegt an den Orientierungswerten der UVPVwV.<br />
Dann gibt es noch zusätzliche zulässige jährliche<br />
Frachten in Gramm pro Hektar und Jahr aus der Bundes-<br />
Bodenschutzverordnung. Auch diese hat er berechnet und<br />
den Anteil an diesen zulässigen Frachten ermittelt. Diese<br />
Werte liegen bei maximal 12 bis 13 % vom zulässigen<br />
Wert. Das heißt, es wird etwa ein Zehntel bis ein Sechstel<br />
vom zulässigen Wert erreicht.<br />
Dann hat er noch die Vorbelastungsmessung genommen,<br />
woraus sich ergibt, wie viele Emittenten da sind.<br />
Das ist letztendlich eine Antwort auf Ihre Frage, was<br />
tatsächlich gemacht worden ist. Die Kumulation, die<br />
Anreicherung, ist also berechnet worden.<br />
Jürgen Herr (RP Karlsruhe):<br />
Ich möchte dazu kurz etwas ergänzen: Die Schadstoffverfrachtung<br />
auf die Böden aus BImSch-Anlagen ist im<br />
Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt und im Fachlichen<br />
dann in der TA Luft verfeinert – da sind einige<br />
Schwermetalle genannt – und darüber hinaus auch in der<br />
UVPVwV.<br />
Jetzt habe ich noch in Erinnerung, dass bei der Diskussion<br />
über RDK Block 8 vor sechs Jahren Sie, Herr<br />
Block, oder Kollegen damals etwas erbost waren über die<br />
ständige Argumentation mit der Irrelevanzklausel. Deswegen<br />
habe ich hier beim Skopingtermin angeregt, dass man<br />
noch einmal nachschaut, was vergleichbar die einschlägige<br />
Vorschrift im Bodenrecht regelt.<br />
Da gibt es die Bundes-Bodenschutzverordnung und<br />
dazu eine Anlage, in der geregelt ist, wie hoch die zulässigen<br />
maximalen Frachten sein dürfen. Hier ist jetzt nachgewiesen<br />
worden, dass wir deutlich unter dem Maximalwert<br />
liegen. Bei Zink sind es 0,06 %, am höchsten ist es<br />
allerdings bei Quecksilber mit 13 %.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Hller:<br />
Danke, Herr Herr. – Jetzt kommt Herr Futterer.
Quecksilber im Schwebstaub<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Das Quecksilber geht ja nicht alleine auf den Boden,<br />
sondern wir befinden uns hier in einem Raum, wo Landwirtschaft<br />
betrieben wird. Da frage ich mich natürlich: Wie<br />
wahrscheinlich es ist, dass das Quecksilber am Schluss<br />
auch in den Äpfeln steckt, die ich hier kaufe und zu mir<br />
nehme?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Da haben Sie völlig recht. Aus diesem Grund sind diese<br />
jährlichen Frachten und diese Orientierungswerte von der<br />
UVPVwV überhaupt festgelegt worden. Es geht nicht<br />
darum, den Boden reinzuhalten. Ich meine, die Blut-und-<br />
Boden-Mentalität haben wir schon lange nicht mehr.<br />
Tatsächlich betrachtet werden müssen die Wirkpfade,<br />
die dahinterstecken. Die sind da subsummiert; die sind<br />
dort enthalten. Sonst wären diese Werte nicht so, wie sie<br />
sind. Denn Sie müssen sehen: Es kommt etwas nicht nur<br />
aus irgendeinem Schornstein, aus irgendeinem Auspuff<br />
oder irgendeinem Holzofen, sondern natürlich auch aus<br />
der Landwirtschaft da hinein. Die Frachten durch die<br />
Dünger zum Beispiel sind dort nicht unerheblich.<br />
Man muss im Blick haben, dass solche Stoffe in der<br />
Nahrungskette wie auch in der Mehrfachnahrungskette<br />
- also nicht nur, wenn es um Getreide und Brot geht,<br />
sondern auch um Viehfutter für das Tier, das entweder<br />
gemolken oder gegessen wird – enthalten sind. Auch das<br />
muss betrachtet werden. Sonst macht das Ganze keinen<br />
Sinn.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die Frage ist damit beantwortet. Oder gibt es noch eine<br />
kurze Nachfrage? – Sie können nachfragen; dazu sind wir<br />
hier.<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Nur noch eine Nachfrage dazu: Sie sagen, das sei enthalten.<br />
Wenn aber die Werte jetzt durch diese zusätzliche<br />
Befeuerung insgesamt steigen – wie ich höre –, haben wir<br />
da natürlich ein Problem. Denn jetzt kommt zusätzlich zu<br />
den ganzen Schadstoffen, die schon im Boden drin sind,<br />
noch etwas dazu.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich noch an die Emissionsprognose<br />
erinnern können. Da gibt es die beiden Tabellen<br />
5.7 und 5.8.<br />
Ich nehme jetzt einmal das Beispiel Quecksilber, das<br />
ja den höchsten prozentualen Anteil hat. Das hat Herr<br />
Herr auch schon gesagt. Da ist die zusätzliche jährliche<br />
Fracht mit 1,5 g pro Hektar und Jahr festgelegt, um auch<br />
die Wirkpfade mit hineinzunehmen. Die zusätzliche<br />
jährliche Fracht vom Werk liegt etwa bei 0,19 g pro Hektar<br />
und Jahr. Das sind knapp 13 %. Also knapp 13 % beträgt<br />
Seite 59<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
der Anteil des Werkes an dieser maximalen zusätzlichen<br />
Fracht. Das ist berechnet, und das ist der stärkste Wert.<br />
Es wird also nichts überschritten, und es wird auch<br />
nichts deutlich angehäuft. Damit hat man vom Fachlichen<br />
her und von der Genehmigungsseite her, wo man das<br />
Ganze bewerten muss, diese Möglichkeiten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch eine Nachfrage?<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Für mich stellt sich nicht die Frage, ob das genehmigungsfähig<br />
ist, sondern was das mit meiner Gesundheit macht.<br />
Vielleicht könnte man dazu vom Landratsamt noch eine<br />
Information bekommen. 0,19 g/ha hört sich erst einmal<br />
nicht nach viel an, aber insgesamt sind das natürlich<br />
Kilogramm, was da herausgeht und dann entsprechend<br />
über das Land verteilt wird.<br />
Wenn ich nur ein bisschen davon esse, ist es nicht<br />
schlimm. Aber für mich stellt sich schon die Frage, wann<br />
die Gesundheitsgefährdung anfängt. Die kann vielleicht<br />
schon bei 0,01 g/ha anfangen. Ich bin da kein Fachmann.<br />
Deshalb frage ich einmal nach.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Schmid-Adelmann.<br />
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Ich habe mir die Konzentration angeschaut, die in der Luft<br />
zu erwarten ist. Was die Niederschläge auf Obst oder den<br />
Äckern angeht, muss ich zugeben: Da habe ich mich nicht<br />
kundig gemacht, weil ich davon ausging, dass das eine<br />
Sache des Bodenschutzes ist.<br />
Die Vormessung in Dürrenbüchig im Hinblick auf das,<br />
was letztendlich eingeatmet werden kann, weil es noch in<br />
der Luft vorhanden ist, ergab eine Konzentration von<br />
5,5 ng/m³ Luft. Nach entsprechender Genehmigung würde<br />
dieser Beitrag um maximal 0,14 ng/m³ höher werden.<br />
Wenn man das Ganze abschätzt – das habe ich gemacht<br />
– mit Blick auf die Werte der Weltgesundheitsorganisation,<br />
kommt man mit der Umrechnung auf Atemvolumen<br />
pro Tag zu einem ganz geringen Anteil der erlaubten<br />
Konzentration, die man durch die Luft oder durch andere<br />
Expositionspfade aufnehmen darf.<br />
Hier kommt man auf insgesamt nur 0,2 % dessen, was<br />
der Mensch regelmäßig das ganze Leben über aufnehmen<br />
könnte. Es ist also ein sehr kleiner Anteil bezogen auf<br />
das, was letztendlich in der Luft ankommt. Der Mensch<br />
könnte mehr Quecksilber – in Anführungszeichen –<br />
aushalten, ohne dass er krank würde.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Frau Schmid-Adelmann. Sie haben noch<br />
eine Wortmeldung, Frau Kassner?
Gisela Kassner (Einwenderin):<br />
Ich möchte gerne weg von den Prozentzahlen der jährlichen<br />
Fracht. Ich möchte stattdessen Zahlen haben,<br />
welche Emissionen von welchem Material in Kilogramm<br />
jährlich aus diesem Schornstein kommen, also absolute<br />
Zahlen, nicht verteilt auf soundso viel Terrain in Prozent.<br />
Wie viele Kilogramm kommen da wirklich heraus?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke. Konkretisieren Sie es bitte noch: pro Tag oder pro<br />
Jahr? Wie wollen Sie es haben?<br />
(Gisela Kassner [EW’in]: Pro Jahr!)<br />
Die Zahlen sind doch vorhanden.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich spreche jetzt hier noch einmal über ein Gutachten, das<br />
ich selber nicht geschrieben habe. Aber die Zahlen – Herr<br />
Block, teilweise haben Sie das auch mit Maximalzahlen<br />
ausgerechnet – lassen sich relativ schnell aus der Emissionsprognose,<br />
die der TÜV gerechnet hat, ermitteln. Der<br />
hat mit den maximalen Inputwerten der Materialien auch<br />
eine Prognose für die Emissionen vorgenommen. Daraus<br />
lassen sich die Zahlen relativ schnell ausrechnen. Das ist<br />
nicht das Problem. Ich glaube, die Zahlen stehen so nicht<br />
drin; sie sind angegeben in Gramm pro Stunde. Es ist<br />
dann ein schlichter Dreisatz in Abhängigkeit von der<br />
Betriebszeit bzw. den Betriebsstunden, daraus eine<br />
maximale Mengenemission zu ermitteln.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Man könnte die Zahlen, die Herr Block schon ausgerechnet<br />
hat, übernehmen, oder man könnte sie einfach einmal<br />
überprüfen. Die Zahlen als solche stehen im Zusammenhang<br />
mit der Emission in den Gutachten. Jetzt ist die<br />
Frage, ob und wie schnell man das umrechnen könnte.<br />
Wenn das nicht so einfach geht, würde ich zur Orientierung<br />
die Zahlen, die wahrscheinlich Herr Dr. Wiedenmann<br />
ausgerechnet hat, nehmen. Denn wir haben im Moment<br />
keinen Zweifel, dass man das richtig gerechnet hat.<br />
(Schaubild: Emissionsfrachten – Anlage 2-12,<br />
S. 109 – Harry Block [BUND]: Das ist die<br />
Fracht!)<br />
Dann wären das die orientierenden Zahlen, Frau Kassner.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich habe nur eine Bitte: Wir haben nicht nachvollzogen, ob<br />
das richtig berechnet ist. Der Fairness halber muss man<br />
natürlich sagen, das ist mit 8760 Jahresstunden gerechnet<br />
worden , also 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag. Das<br />
stellt natürlich eine absolute Maximalabschätzung dar.<br />
Das Werk wird nicht 365 Tage im Jahr über 24 Stunden<br />
betrieben.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einmal: Es ging um konkrete Zahlen, damit sich Frau<br />
Kassner besser vorstellen kann, was passiert. Dann wäre<br />
das zumindest eine Größenordnung unter kontinuierlichen<br />
Seite 60<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Betriebsbedingungen. Man muss hinzufügen: Das Werk<br />
steht ab und zu still, sodass das wirklich eine Volllastbetrachtung<br />
ist. – Ist die Frage damit beantwortet, Frau<br />
Kassner?<br />
(Gisela Kassner [EW’in]: Ja!)<br />
Danke. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, die Frage, die sie gestellt hat, ist genau die<br />
entscheidende. Warum geht man immer mit Milligramm,<br />
mit Mikrogramm oder mit Nanogramm an die ganze<br />
Geschichte heran? – Weil das so klein ist. Aber diese<br />
52 kg Quecksilber kommen.<br />
Sie haben das Thema Boden als Punkt 8 oder so ähnlich<br />
vorgesehen.<br />
(Zuruf eines Einwenders: Ganz hinten!)<br />
- Ja, ganz hinten. Aber wir sind jetzt ja schon beim Boden;<br />
deshalb mache ich beim Boden weiter.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Eigentlich sind wir nicht beim Boden. Wir waren bei den<br />
Emissionen.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Aber es wurde jetzt die ganze Zeit über den Boden geredet,<br />
wie viel Quecksilber im Boden ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir haben unter anderem die Frage behandelt, wie viel<br />
Fracht aus der Anlage kommt. Das war die konkrete<br />
Frage, und die wurde anhand Ihrer Werte als Orientierung<br />
konkret beantwortet. Vorher waren wir bei der menschlichen<br />
Gesundheit. Bevor wir zum Thema Boden kommen,<br />
würde ich fragen, ob wir denn mit dem Punkt Emissionen<br />
schon am Ende sind.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Zu den Emissionen will ich Ihnen noch etwas sagen.<br />
(Schaubild: Emissionsfrachten – Anlage 2-12,<br />
S. 109)<br />
Hier sehen Sie in der zweiten Spalte die Werte, die Sie<br />
beantragt haben. Jetzt zeige ich Ihnen einmal, was man<br />
erreichen könnte, wenn man wollte.<br />
(Schaubild: Emissionswerte Gesamtkohlenstoff,<br />
Chlorwasserstoff, Stickoxide – Anlage 2-22 a,<br />
S. 116)<br />
Sie sehen links den vorgegebenen Grenzwert. Bei<br />
Stickoxid beispielsweise ist der Grenzwert 200 mg/Nm³,<br />
und Sie wollen 320 mg/Nm³. Das ist Ihr Zielwert. Meine<br />
Frage: Wann wollen Sie das Ziel erreichen?<br />
Links ist das, was Sie wollen. Rechts sehen Sie den<br />
Durchschnittswert einer normalen Müllverbrennungsanlage.<br />
Das sind die Werte der Müllverbrennungsanlage<br />
Hagen - Hausmüllverbrennung und Industriemüllverbren-
nung - aus dem Jahre 2010. Sie sehen, das ist beim<br />
Gesamtkohlenstoff ein Viertel, bei Chlorwasserstoff ein<br />
Fünftel, bei Stickoxiden weniger als die Hälfte,<br />
(Schaubild: Emissionswerte Schwefeldioxid,<br />
Staub, Kohlenmonoxid – Anlage 2-22 b, S. 116)<br />
beim Schwefel ein Viertel. Beim Staub – gucken Sie es<br />
sich einmal an! – wollen Sie 10 mg/Nm³ als Zielwert<br />
erreichen, Sie haben jetzt 20 mg/Nm³, und machbar sind<br />
0,24 mg/Nm³.<br />
(Schaubild: Emissionswerte Quecksilber und<br />
seine Verbindungen, Ammoniak, anorganische<br />
gasförmige Fluorverbindungen – Anlage<br />
2-22 c, S. 117)<br />
Gucken Sie sich einmal an, wie viele Nullen beim Quecksilber<br />
hinter dem Komma möglich sind! Das ist im Hausmüll.<br />
Da sehen Sie einmal, was in Ihrem Fluff drin ist, was<br />
in Ihren Autoreifen drin ist. Bei Ammoniak – gucken Sie es<br />
sich an! - und anorganischen Fluorverbindungen sind<br />
weniger als ein Fünftel machbar.<br />
Alle diese Werte können Sie problemlos erreichen.<br />
Das sind Durchschnittswerte. Da sind Störfälle mit drin. Da<br />
gibt es garantiert fünf, sechs ziemlich hohe Überschreitungen.<br />
Das ist ein nachgewiesener Durchschnittswert.<br />
Die haben kontinuierliche Messungen in Hagen. Jeder<br />
Wert, außer Dioxin, wird kontinuierlich gemessen.<br />
(Schaubild: Emissionswerte Cadmium,<br />
Thallium, Antimon etc., Dioxine und Furane<br />
– Anlage 2-22 d, S. 117)<br />
Gucken Sie sich Cadmium und die anderen an: Die<br />
Grenzwerte sind immer um den Faktor 10 bis Faktor 100<br />
unterschritten. Dioxine: 0,0003 ng/Nm³! Wir reden hier von<br />
Nanogramm, von winzigen Mengen.<br />
Das geht, und das wären unsere Forderungen, wenn<br />
Sie eine Müllverbrennungsanlage hätten. Sie wollen ein<br />
Zementwerk betreiben. Deswegen sagen wir Ihnen: Dann<br />
betreiben Sie es mit diesen Werten. Dann brauchen Sie<br />
die Filteranlagen, die das erreichen, und dann brauchen<br />
Sie die Verbrennungstechnik, die dies erreicht.<br />
Die Eingangsstoffe sind gleich. Da tut sich hier beim<br />
Autoreifen nicht viel gegenüber einer Hausmüllverbrennung.<br />
Die Werte sind sicherlich etwas höher, aber mehr<br />
tut sich nicht.<br />
Wenn Sie das erreichen wollen und sogar noch Besseres,<br />
dann nehmen Sie Gas! Dann erreichen Sie die Werte,<br />
die wir von Ihnen haben wollen. Als Bürger würde ich<br />
sagen: Das geht, das ist technisch möglich. Es erfordert<br />
natürlich Geld, wenn sie das machen. Aber Sie verlangen<br />
ja auch Geld für Ihr Produkt.<br />
Ich sage Ihnen noch eins: Ihr Produkt wird ja ein Teil<br />
der Senke sein. Sie haben eine Filtertechnik, wo die Filter<br />
abgeklopft werden und das Ganze in den Verbrennungsprozess<br />
zurückgeführt wird.<br />
Seite 61<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wenn Sie diese Emissionwerte nicht einhalten, würde<br />
ich sagen: Ihr Produkt ist schlechter, weil Sie diese Stoffe<br />
auch in Ihrem Produkt haben. Dann können Sie sich auf<br />
einen Shitstorm auf Ihrer Homepage einstellen, wenn Sie<br />
da von Nachhaltigkeit oder was weiß ich reden. Das ist<br />
nicht nachhaltig.<br />
Nachhaltig wäre, Sie würden Gas nehmen, oder Sie<br />
würden diese erreichten Werte einhalten. Auch dann<br />
könnten wir darüber reden. Aber davon sind Sie Millionen<br />
Lichtjahre entfernt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ich nehme das jetzt einfach als Ihre Auffassung<br />
- vielleicht noch ergänzt durch Herrn<br />
Dr. Wiedenmann. Aber wir haben dort hinten schon seit<br />
Längerem eine Wortmeldung. Bitte gehen Sie ans Mikrofon,<br />
und stellen Sie sich kurz vor!<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Ich bin ein bisschen später gekommen. Hans-Jürgen<br />
Klawe ist mein Name. Auch ich bin Einwender; meinen<br />
Namen werden Sie auf der Liste finden.<br />
Wir haben jetzt gehört – eine ganz wichtige Frage und<br />
eine ganz wichtige Antwort -, was an Quecksilber im Falle<br />
einer Genehmigung dieser 100 % Ersatzbrennstoffverwendung<br />
ausgestoßen wird. Wir haben jetzt von Herrn<br />
Block auch gehört, was technisch an Emissionsbegrenzung<br />
möglich ist. Aber ganz wichtig für mich – darauf zielt<br />
auch meine Einwendung ab – ist der Vergleich vorher/nachher.<br />
Wir haben jetzt gehört: 52,1 kg Quecksilber<br />
werden dann pro Jahr ausgestoßen werden. Was wird<br />
denn im heutigen Zustand ausgestoßen? Wie viel mehr<br />
wird es denn zukünftig?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Klawe. – Da gebe ich an Lafarge weiter.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Eine kurze Erläuterung dazu: Die 52 kg Quecksilber, die<br />
Sie jetzt hier in der Präsentation gezeigt haben, sind wie<br />
folgt berechnet: Sie haben eine maximale Ausnutzung der<br />
Anlage: 365 Tage im Jahr, 100 % Sekundärbrennstoffrate<br />
jeden Tag und maximale Ausschöpfung der Produktionskapazität.<br />
Außerdem wird der Grenzwert mit 28 µg/m³<br />
ausgeschöpft. Und der Grenzwert, den wir haben, ist auch<br />
noch schärfer als die Anforderungen der 17. BImSchV.<br />
Jetzt sagen Sie mir bitte einmal ein Werk, das so fährt!<br />
Realistisch sind wir deshalb deutlich unter dem, was Sie<br />
ausgerechnet haben.<br />
(Andreas Bauer [EW]: Und die Antwort?)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke auch, die Frage war relativ eindeutig und klar.<br />
Kann man dazu etwas sagen, Herr Dr. Oerter?<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Das ist natürlich wie immer ein bisschen in die Zukunft<br />
gerichtet. In der Tat ist das, was ausgerechnet worden ist
- die 52 kg -, der Grenzwert multipliziert mit dem Abgasvolumenstrom<br />
für das ganze Jahr als Betriebszeit.<br />
Schauen Sie sich den Jahresemissionswert an: Der<br />
lag letztes Jahr, glaube ich, im Jahresdurchschnitt bei<br />
0,02 mg/Nm³.<br />
(Hans-Jürgen Klawe [EW]: Das kommt heute<br />
heraus, ja!)<br />
Die Emissionsprognose des TÜV liegt in der gleichen<br />
Größenordnung. Gehen Sie also davon aus, dass sich<br />
keine Veränderung durch die Substitution von Petrolkoks<br />
durch den Fluff ergeben wird!<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Sie haben doch mehr Quecksilber im Brennstoff drin. Da<br />
werden Sie mir doch nicht erzählen können, wenn Sie<br />
keine oder nur sporadisch Filtermaßnahmen ergreifen,<br />
dass weniger oben herausgeht. Quecksilber geht bei den<br />
Temperaturen, die im Drehrohrofen herrschen, zu 100 %<br />
oben heraus.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Zunächst einmal ist das richtig. Es ist dann zu 100 % in<br />
der Gasphase. Es hängt auch davon ab, in welcher<br />
Bindungsform das Quecksilber vorliegt, ob wir über<br />
elementares oder oxidisches Quecksilber sprechen.<br />
In der Tat ist die wesentliche Staubminderungsmaßnahme<br />
eine regelmäßige Staubausschleusung aus dem<br />
Prozess. Und in der Tat hat man aufgrund des ambitionierten<br />
Grenzwertes – man ist ja unterhalb des Emissionsgrenzwertes<br />
der 17. BImSchV – die Herdofenkokseindüsung<br />
sozusagen als Sicherungsmaßnahme noch<br />
zusätzlich vorgesehen – auch das habe ich gelernt –, die<br />
allerdings nicht kontinuierlich betrieben wird.<br />
Eine Bemerkung noch: Es ist wirklich eine Besonderheit<br />
der Zementwerke gegenüber vielen MVAs, dass<br />
Quecksilber kontinuierlich gemessen wird. Sie können das<br />
Werk natürlich an den Emissionen, die in der Vergangenheit<br />
kontinuierlich gemessen wurden, sehr wohl selber<br />
bewerten. Diese Zahlen werden auch in Zukunft weiter<br />
veröffentlicht werden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vorhin war dort hinten eine Wortmeldung. Hat sich die<br />
erledigt?<br />
(Zuruf einer Einwenderin: Ich wollte vorhin<br />
etwas zur Gesundheit sagen, aber jetzt<br />
nicht!)<br />
Danke. – Jetzt Frau Sorg, dann Herr Block.<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Dieselbe Frage wurde in der Gemeinderatssitzung schon<br />
einmal gestellt: Wer oder was hindert Sie daran, kontinuierlich<br />
Aktivkohle einzudüsen, um diesen Quecksilberausstoß<br />
zu minimieren?<br />
Seite 62<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ich hatte eben schon kurz das Qualitätssicherungskonzept<br />
erläutert. Letztendlich sind wir bestrebt, Quecksilber erst<br />
gar nicht in den Prozess hineinzubringen. Dafür gibt es<br />
Inputgrenzwerte, und dafür machen wir auch unsere<br />
Langzeitanalysen, wo wir Trends beobachten. Wir liegen<br />
da deutlich unter den genehmigten Inputgrenzwerten. Das<br />
heißt, wir haben prozesstechnische Aktivitäten. Weil wir<br />
kontinuierliche Quecksilbermessungen machen, können<br />
wir rechtzeitig im Prozess gegensteuern.<br />
Die Herdofenkokseindüsung, die Eindüsung von Aktivkohle,<br />
ist als „Polizeimaßnahme“ zu verstehen, falls es<br />
kurzzeitig zu einer Spitze kommt. Diese sollte dann<br />
abgefangen werden. Das heißt, das Bestreben von der<br />
Prozessseite her, von den Inputmaterialen her ist schon<br />
selber ein relativ niedriger Emissionswert von Quecksilber.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Genau.<br />
(Harry Block [BUND]: Aber Herr Villano,<br />
jetzt gerade - -)<br />
- Entschuldigung! Gedulden Sie sich bitte noch einen<br />
Moment, Herr Block! Sie kommen gleich auch noch dran.<br />
Gerhard Rother (Einwender):<br />
Mein Name ist Gerhard Rother, ich bin ebenfalls Einwender.<br />
Ich bin zwar Laie, aber mir ist jetzt vom ganzen Prozedere<br />
her, was sehr interessant ist, aufgefallen, dass hier<br />
von unserer Seite genaue Zahlen genannt werden - man<br />
kann das da oben an der Wand sehen –, aber von Ihrer<br />
Seite jetzt keine Zahlen genannt werden, sondern eigentlich<br />
alles sehr blumig umschrieben wird. Auch von den<br />
Fachleuten wird nie klar gesagt, was Tatsache ist. Es wird<br />
immer auf irgendetwas hingewiesen, was eventuell sein<br />
könnte, aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist mein<br />
Eindruck.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Dr. Hübner.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Ich wollte nur ganz kurz sagen: Auf diese Gesamtwerte,<br />
die jetzt erfragt worden sind, geht man deshalb nicht ein,<br />
weil der Gesamtwert immer sehr plastisch ist. Man rechnet<br />
z. B. im Landverbrauch gerne mit Fußballfeldern – oder<br />
was auch immer. Das ist sehr plastisch, und darunter kann<br />
sich jeder etwas vorstellen.<br />
Aber die Beurteilungswerte aus den Bundes-Bodenschutzverordnungen<br />
für die Wirkpfade, aus den medizinischen<br />
Verordnungen, die LAI-Orientierungswerte und<br />
andere sind nun einmal entweder Konzentrationen oder<br />
Wertedepositionen, weil mit Hilfe dieser Werte auch<br />
tatsächlich Wirkungen festgestellt worden sind.
Es kommt natürlich für Sie darauf an, dass Sie sich<br />
vorstellen können, wie viel da herauskommt. Aber um<br />
Wirkungen in der Umgebung oder beim Menschen oder<br />
z. B. bei Ratten feststellen zu können, brauche ich Konzentrationen.<br />
Deswegen hat man diese kleinen Werte. Das hatten<br />
Sie ein bisschen kritisiert, Herr Block. Das ist auch richtig,<br />
unter Femtogramm und Nanogramm kann man sich<br />
schwer etwas vorstellen. Das ist ganz klar. Das ist so klein<br />
und wirkt aus Ihrer Sicht vielleicht verharmlosend. Aber<br />
diese Konzentrationen sind wichtig für die Beurteilung von<br />
Beeinträchtigungen, der gesundheitliche Beeinträchtigung,<br />
der Beeinträchtigung von Pflanzen usw.<br />
Deswegen sind diese Gesamtkilogramm nicht dargestellt.<br />
Denn es gibt für ein Gesamtkilogramm einfach<br />
keinen Beurteilungswert. Das ist kein böser Wille.<br />
Insofern sind alle Daten, die Sie gerade angefragt hatten,<br />
letztendlich vorhanden. Aber man muss sie für Sie<br />
umrechnen, damit Sie sich etwas darunter vorstellen<br />
können. So ist das nicht anschaulich; da haben Sie völlig<br />
recht. Aber der Beurteilungswert ist nicht 50 kg, sondern<br />
das ist das, was draußen in der Umgebung passieren<br />
könnte, was Sie aufnehmen, was im Boden deponiert wird<br />
usw.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt ganz kurz eine Nachfrage dazu?<br />
Gerhard Rother (Einwender):<br />
Ja. – Bei diesem Antrag geht es doch darum, dass von 60<br />
auf 100 % gegangen wird. Das, was ich Ihren Äußerungen<br />
entnehme, bedeutet im Prinzip so gut wie keine Mehrbelastung.<br />
Es tut mir leid, aber das können wir als normale<br />
Bürger Ihnen einfach nicht abnehmen. Das kommt einfach<br />
nicht rüber.<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Das kommt wahrscheinlich daher, dass Sie glauben, dass<br />
die gesamten Schadstoffe aus den Feuerungen, also aus<br />
den Brennstoffen kommen. Aber wir haben z. B. Gestein,<br />
das in einem gewissen Maße Arsen und auch andere<br />
Spurenstoffe enthält. Deshalb müssen wir beim Zementwerk<br />
ein bisschen anders denken als bei einer Müllverbrennung.<br />
(Gerhard Rother [EW]: Das ist für uns egal!<br />
Die Schadstoffe sind da!)<br />
– Aber Sie ändern sich nicht so stark, wenn man von 60<br />
auf 100 % geht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Halt, Herr Bauer! Die Reihenfolge war, glaube ich: Block,<br />
Bauer, Klawe. Dann noch einmal Ihre Wortmeldungen.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Frau Dr. Hübner, Sie haben klar gesagt – das ist schon<br />
richtig -: Der Mensch muss sich darunter etwas vorstellen<br />
können. Wenn eine Klärschlammverbrennungsanlage in<br />
Seite 63<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Karlsruhe mit 200.000 t 6 kg Quecksilber abgibt, dann<br />
sagen die Leute dort vor Ort, wo die Anlage steht: Das ist<br />
wahnsinnig viel. Jeder weiß: Bei 1 g Quecksilber hier drin<br />
müssen Sie die Berufsfeuerwehr holen, weil Sie hier ein<br />
Problem haben. Es wurde ja schon angedeutet: Bei<br />
Temperaturen von 30, 35 °C ist das Quecksilber direkt<br />
flüchtig. Das heißt, wir müssten diesen Raum räumen.<br />
Ich bin auch einmal Physiklehrer gewesen, und ich<br />
weiß, was früher passierte, wenn eines der alten Quecksilberthermometer<br />
heruntergefallen ist: Da ist die Berufsfeuerwehr<br />
gekommen, und der Raum war gesperrt. Das<br />
kann manch einer noch nachempfinden. Deshalb hat man<br />
die Quecksilberthermometer verboten.<br />
Quecksilber ist ein Stoff, von dem jeder eine Vorstellung<br />
hat. Wenn eine Anlage – wir wollen jetzt nicht über<br />
ein Gramm oder ein Kilogramm streiten – zusätzlich 3 %<br />
mehr Immissionen verursacht, dann kann sich jeder<br />
vorstellen: Das ist mehr als das Gramm, wofür früher mein<br />
Klassenzimmer geräumt wurde. Diese 3 % sind mehr -<br />
hundertprozentig.<br />
Jetzt ist die Frage: Wo kommt das an? Frau<br />
Dr. Hübner, Sie und ich wissen ja, wie so etwas gerechnet<br />
wird; Sie haben es oft gemacht und ich auch. Sie wissen<br />
genau, dass es Hotspots gibt. Da, wo eine Wolke oder wo<br />
der Wind irgendetwas hintreibt, kann das viel sein, es<br />
kann aber auch ganz wenig sein, und zwar auf mehreren<br />
Ebenen. Das ist beim Boden so, und das ist in der Luft so.<br />
Man weiß das von der Radioaktivität, weil die direkt<br />
messbar ist.<br />
Wir machen daraus einen Grenzwert. Den kann man<br />
verharmlosen oder - wie wir es jetzt machen – drastisch<br />
zeigen. Das Problem ist: Der Schadstoff ist da. Aber ich<br />
sage Ihnen: Er muss nicht da sein.<br />
Da ich atme, gebe ich Kohlendioxid ab. Ich kann den<br />
Prozess unterbrechen, aber dann verrecke ich. Das will<br />
ich nicht, also atme ich. Ich weiß, ich schädige die Umwelt,<br />
kann es allerdings nicht verhindern.<br />
Ein Zementwerk kann es aber verhindern. Es braucht<br />
kein Nanogramm mehr abzugeben, es braucht kein<br />
Milligramm mehr abzugeben, es kann umstellen und dann<br />
nachhaltig sein.<br />
Die Frage war doch: Wie lange sollen die Böden noch<br />
versifft werden, 30 Jahre, 40 Jahre? Sie haben jetzt 60<br />
oder 70 Jahre – ich weiß es nicht - an diesem Standort<br />
hinter sich. Wollen Sie noch 40 Jahre weitermachen – was<br />
ich Ihnen wünsche, auch für die Arbeitsplätze? - Dann<br />
nehmen Sie Gas, und die Sache ist erledigt.<br />
Dann braucht sich Herr Essig keine Gedanken zu machen,<br />
wie er das mit der 17. BImSchV in Einklang bekommt.<br />
Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, ob<br />
wir einen Anwalt beauftragen. Dann reden wir über alle<br />
anderen Sachen – Lärm usw. – völlig neutral und harmlos;<br />
daraus würden wir nichts machen. Dann wäre die Sache<br />
erledigt.
So aber muss ich wie er sagen: Es kommt etwas hinzu,<br />
und das will ich nicht. Ich wollte als Anwohner dort<br />
nicht wohnen. Ich hätte ein schlechtes Gefühl, meine<br />
gelben Rüben da aus dem Boden herauszuholen. – Wir<br />
kommen nachher noch zu den Critical Loads.<br />
Ich weiß nicht, wie die Einbaufähigkeiten sind. Ich<br />
weiß wohl, wie sich das Plutonium im Spargel verhält. Das<br />
habe ich gesehen. Ich war erschrocken, dass Schwermetalle<br />
in eine Frucht hineinkommen können. Da habe ich<br />
mich gefragt: Wie macht die Frucht das? Sie schafft es!<br />
Das ist genau unser Problem, vor dem wir hier stehen.<br />
Zugegebenermaßen nehmen wir hier schon einen<br />
Hammer. Ich habe Ihnen eben auf den Folien die Hämmer<br />
gezeigt. Das gebe ich zu. Die Werte werden Sie nie<br />
erreichen können; das ist auch mir klar. Denn da ist Ihr<br />
Prozess durch das Produkt Zement schon außen vor.<br />
Auch mit Gas wird es nicht anders sein; denn die Stoffe<br />
sind da drin. Da haben Sie schon recht. Aber Sie könnten<br />
es vermindern. Und darauf hinzuwirken ist unsere Aufgabe<br />
hier.<br />
Ich sage noch einmal: Wir wollen für NOx den Grenzwert<br />
von Gas: 50 mg/Nm³.<br />
Es gibt auch mit Blick auf die Tiere Empfehlungen. Da<br />
steht: Minderung des NOx-Wertes, Minderung des SO2-<br />
Wertes und Minimierung des Feinstaubs. Das steht bei<br />
allen Tierarten drin. Ich bin auch Vertreter des NABU, und<br />
uns sind die Tiere wichtig. Sie gefährden hier den Hirschkäfer<br />
und nicht nur den Menschen, sondern die gesamte<br />
Umgebung.<br />
Ich kann Ihnen nachher auch die anderen Arten von<br />
der Roten Liste vorlesen, damit Sie sehen, wie voll dieser<br />
Raum an Tieren ist, die alle auf der Roten Liste stehen.<br />
Die sind uns genauso wichtig wie der Mensch und genauso<br />
wichtig wie die Natur.<br />
All das können Sie vermeiden – das sage ich jetzt zum<br />
dritten Mal -, indem Sie einen anderen Ersatzbrennstoff<br />
nehmen, nämlich Gas.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, die Botschaft haben wir gehört.<br />
(Harry Block [BUND]: Dann hören Sie es<br />
auch zum fünften Mal!)<br />
- Ja, gerne. Der Hirschkäfer kommt, denke ich, bei dem<br />
Thema UVU – oder, Frau Dr. Hübner?<br />
(Dr. Friederike Hübner [AS]: Artenschutz!)<br />
- Beim Artenschutz. Der kommt auf jeden Fall unter<br />
TOP 5.<br />
Ich würde an der Stelle direkt weitermachen mit Herrn<br />
Bauer und dann mit Herrn Klawe.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich wollte noch einmal nachfragen, ob ich Frau Dr. Hübner<br />
richtig verstanden habe. Sie geben also zu, dass es durch<br />
die Erhöhung auf 100 % mehr Schadstoffe gibt. Habe ich<br />
Seite 64<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
das richtig verstanden, dass Sie sagten, es ist nicht enorm<br />
viel, aber es ist mehr?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Nein, es tut mir leid. Als ich den Satz gesagt habe, habe<br />
ich gedacht: Der kommt jetzt wie ein Bumerang zurück.<br />
Das ist so klassisch, wenn man so etwas sagt.<br />
Was wir an Werten haben, finden Sie in der Immissionsprognose.<br />
Da ist die Vorbelastung drin, da ist die<br />
Jahreszusatzbelastung drin. In der gemessenen Vorbelastung<br />
ist der Normalbetrieb des Zementwerkes bereits drin.<br />
Dann wird aus Vorsorgegründen die gesamte berechnete<br />
Immissionsjahreszusatzbelastung für den Worst Case<br />
noch einmal draufgesattelt.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Es gibt also keine Zunahme an Emissionen, egal von<br />
welchem Stoff, wenn Sie auf 100 % gehen?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Die vorherige Berechnung zu beurteilen ist nicht mein Part<br />
gewesen. Das ist etwas aus der Immissionsprognose und<br />
für den Immissionsgutachter.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Sie stehen hier doch als Firma Lafarge und sagen: Es gibt<br />
keine Zunahme. Sie können doch hier als Bürger jetzt<br />
nicht sagen, Sie wüssten nicht, wie es vorher war!<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Entschuldigung, ich bin nicht Firma Lafarge.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Aber irgendjemand muss doch sagen können, ob es mehr<br />
wird oder nicht. Bei keinem Schadstoff wird es mehr – das<br />
ist das, was ich tendenziell heraushöre. Stehen Sie dazu?<br />
Oder gibt es Schadstoffe, deren Anteil durch die Umstellung<br />
zunimmt, ja oder nein? - Das wäre das Erste. Ich<br />
habe noch zwei kleine Punkte danach.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt machen wir das erst zu Ende. – Herr Hüsemann.<br />
Stefan Hüsemann (Antragstellerin):<br />
Danke schön. – Ich wollte hier noch ein paar Anmerkungen<br />
loslassen, weil ich feststelle, dass man sich als<br />
Gutachter hier zumindest missverstanden fühlen muss.<br />
Zum Thema Zusatzbelastung, was Frau Dr. Hübner<br />
angesprochen hat: Sie müssen sich einmal klarmachen,<br />
was unter „Zusatzbelastung“ zu verstehen ist. Die Zusatzbelastung<br />
nach der TA Luft ist die Belastung durch den<br />
Betrieb Lafarge und nicht durch die Erhöhung von 60 %<br />
auf 80, 90 oder 100 % Recyclingstoffe. Das ist quasi der<br />
simulierte Fall, als würden Sie das gesamte Werk auf eine<br />
grüne Wiese stellen. Dann hätten Sie eine tatsächliche<br />
Zusatzbelastung von regelmäßig unter 3 % - also irrelevant<br />
– und nur zu kleinen Teilen über 3 %.
Die Firma Lafarge beantragt die Erhöhung der Sekundärbrennstoffrate<br />
von 60 auf 100 %. Damit einher geht<br />
zwangsweise eine Reduzierung von Emissionsgrenzwerten,<br />
weil sie den Anhang der 17. BImSchV dann nicht<br />
mehr nutzen kann. Das heißt, die Firma Lafarge erhöht<br />
weder die Kapazitäten der Anlage noch irgendwelche<br />
Grenzwerte. Insofern kommt für den Immissionsgutachter<br />
am Ende auch keine Erhöhung von Schadstoffen heraus.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen. Ich stelle eine<br />
ganz einfache Frage, und Sie antworten hier fünf Minuten.<br />
Ich muss gestehen, dass ich als Laie davon nicht viel<br />
verstehe. Ich frage doch ganz konkret: Kommt aus dem<br />
Schornstein mehr Schadstoff heraus, wenn ich auf 100 %<br />
erhöhe? Kann man das nicht mit Ja oder Nein beantworten?<br />
Stefan Hüsemann (Antragstellerin):<br />
Herr Bauer, der Immissionsgutachter muss mit den<br />
Grenzwerten rechnen, weil er die Situation berücksichtigen<br />
muss, dass die Firma Lafarge ihre Grenzwerte voll<br />
ausschöpft. Für diese volle Ausschöpfung der Grenzwerte<br />
muss beurteilt werden, ob die Immissionswerte eingehalten<br />
werden.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Ja oder nein?<br />
Bitte!)<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich beantworte das jetzt für mich. Es ist ganz klar: Es<br />
kommen mehr Schadstoffe heraus. Sonst würden Sie sich<br />
da nicht so im Kreis drehen.<br />
Gehen wir weiter: Es gab diesen Probebetrieb, wenn<br />
ich das richtig verstanden habe. Sie geben an, dass Sie<br />
eine kontinuierliche Quecksilbermessung durchführen.<br />
Wäre es möglich, die Zahlen vom letzten Jahr zu betrachten,<br />
wie die sich verändert haben, ob sich eine Veränderung<br />
der tatsächlichen Werte ergeben hat? Dann können<br />
wir vielleicht selbst entscheiden, wie wir das einschätzen.<br />
Liegen die Zahlen vor? Wenn sie nicht vorliegen, würde<br />
ich die Genehmigungsbehörde bitten, sie weiterzugeben.<br />
Sie werden die Zahlen doch wahrscheinlich haben. Gab<br />
es in diesem halben Jahr eine Steigerung an Quecksilberausstoß<br />
- und wenn es nur 1 g war -, ja oder nein?<br />
Dann hätte ich noch eine Frage zu der ursprünglichen<br />
Präsentation. Da wurde auf der Seite 7 angegeben, dass<br />
es seit 2001 nur einmal eine Überschreitung des Quecksilbertagesmittelwertes<br />
gab. Da muss ich mich schon<br />
wundern. Wir sind jetzt in 2013; 2011 ist nicht so weit weg.<br />
Wie war es denn in den letzten zehn Jahren? Wie häufig<br />
gab es da Quecksilbergrenzwertüberschreitungen? - Das<br />
als zweiter Punkt.<br />
Wie gesagt, zum einen: Liegen die Werte vor? Kann<br />
man sehen, wie die sich verändert haben, was die kontinuierliche<br />
Messung des Quecksilbers angeht? Und zum<br />
anderen: Wie schaut es mit den Überschreitungen in den<br />
letzten zehn Jahren aus?<br />
Seite 65<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano, sagen Sie etwas dazu? – Gut.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Quecksilberemission für das Jahr 2011 lag bei<br />
0,021 mg/Nm³. Das ist auch in der Gemeinderatssitzung<br />
so präsentiert worden. Das hat sich im Vergleich zu 2012<br />
nicht geändert. Wir haben von 2011 bis heute für Quecksilber<br />
eine einzige Tagesmittelwertüberschreitung.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Und die zehn Jahre zuvor? Können wir die Daten sehen?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Von den letzten zehn Jahren habe ich nichts hier.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Können wir die konkreten Zahlen sehen, wie sie sich in<br />
diesem letzten Jahr entwickelt haben?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Im letzten Jahr?<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ja, Sie hatten doch jetzt einen Probebetrieb. Da haben<br />
Sie eine kontinuierliche Messung durchgeführt. Diese<br />
Zahlen würde ich gerne im Vergleich zu dem halben Jahr<br />
zuvor sehen, wo Sie noch mit 60 % gefeuert haben.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Den Vergleich kann ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Das ist ganz schlecht, weil es hier genau darum geht. Das<br />
ist doch das Thema dieser Sitzung - zumindest für mich.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer, das sind ja kontinuierliche Messungen. Wenn<br />
der Herr Villano die Daten dabei hat, ist es sicherlich<br />
möglich, das zu beantworten. Aber es war nicht explizit<br />
Thema: Legen Sie für die letzten zehn Jahre Emissionsmessdaten<br />
auf den Tisch! Das war hier kein zentrales<br />
Thema und steht in den Antragsunterlagen auch nicht<br />
drin.<br />
Diese Frage müssen wir weitergeben. Ist sie jetzt und<br />
hier zu beantworten? Haben Sie die Daten dabei?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Nein, ich kann die Daten jetzt nicht so aufbereiten, dass<br />
ich sie als kontinuierliche Messungen im Vergleich zeigen<br />
kann. Ich kann Ihnen allerdings den Emissionsbericht von<br />
2011 zeigen und sagen, wie es 2012 war.<br />
(Schaubild: Emissionsmessbericht für das<br />
Jahr 2011 – Anlage 7, S. 136)<br />
Wie gesagt, wir haben hier insgesamt sieben Tagesmittelwertüberschreitungen:<br />
sechsmal NOx, einmal<br />
Quecksilber. Beide waren technisch bedingt bzw. im<br />
Anfahrprozess. Es gab entsprechende Halbstundenwert-
überschreitungen. Das hat sich in 2012 insofern gebessert,<br />
als wir da deutlich weniger Überschreitungen haben.<br />
(Hans-Jürgen Klawe [EW]: Das eine ist Tagesmittelwert<br />
und das andere Jahresmittelwert?)<br />
- Halbstundenmittelwerte.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Klawe, nehmen Sie das Mikrofon, dann hören alle,<br />
was Sie sagen!<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Sie sehen hier die tatsächlichen Emissionssituationen für<br />
das Jahr 2011. Wir haben hier den Grenzwert für SO2 und<br />
den tatsächlichen Jahresdurchschnittswert mit 12,1<br />
mg/m³, die Jahresmittelwerte für NOx, Ammoniak, Staub<br />
und Quecksilber, die Tagesmittelwerte und Halbstundenmittelwerte.<br />
Sie sehen auch, dass wir da deutlich unter<br />
den Grenzwerten liegen.<br />
Sie sehen bei den wiederkehrenden diskontinuierlichen<br />
Messungen durch einen externen Gutachter die<br />
entsprechenden Parameter für HCl, HF, Cadmium, Thallium,<br />
die Summe der Schwermetalle, Dioxine und Furane.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Es wird jetzt einmal konkret. – Aber ich verstehe es<br />
einfach nicht. Sie messen Quecksilber kontinuierlich. Das<br />
wird wahrscheinlich den Grund haben, weil es ein bedenklicher<br />
Stoff in Ihrem Produktionsprozess ist. Sie beantragen<br />
eine Umstellung von 60 auf 100 %, was die Emission<br />
von Quecksilber maßgeblich beeinflusst. Können Sie hier<br />
nicht sagen, wie sich die Emission in diesem halben Jahr<br />
Probezeit im Verhältnis zu dem halben Jahr zuvor verändert<br />
hat?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Herr Bauer, wir haben keine Überschreitungen gehabt.<br />
(Andreas Bauer [EW]: Darum geht es nicht!)<br />
Wir messen eine Konzentration, und die hat sich nicht<br />
verändert.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Die Emissionsabgabe hat sich im letzten Jahr nicht<br />
verändert?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wir können in der nächsten Pause noch einmal darüber<br />
reden. Ich suche es heraus; das dauert allerdings ein paar<br />
Minuten.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Es hat also keine Steigerung gegeben?<br />
Seite 66<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Nein.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Über den Emissionsweg ist alles gleich geblieben?<br />
(Tino Villano [AS] nickt.)<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Dieses Kopfnicken von Herrn Villano war wohl ein Ja.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ja.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Und das können wir sehen?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Das kann ich Ihnen zeigen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt Herr Klawe.<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Meine Frage von eben hat sich ein bisschen relativiert. Sie<br />
haben vorhin auf die Frage von der Frau Kassner hin<br />
diese drei Werte gezeigt: 0,028 mg/m³ Quecksilber prognostiziert,<br />
143 g pro Tag und 52,1 kg pro Jahr. Sie haben<br />
auf meine Frage dann geantwortet: Der bisherige Ausstoß<br />
lag bei 0,20 mg/m³. – Habe ich eben etwas anderes<br />
gesagt? Dann Entschuldigung!<br />
Wenn ich die 0,02 mg/m³ zugrunde lege – jetzt habe<br />
ich mal den Taschenrechner bemüht, ich hätte es auch im<br />
Kopf machen können, aber dazu war ich zu faul –, das<br />
jetzt Prognostizierte dagegenstelle und die 0,02 mg/m³ auf<br />
100 % setze, dann habe ich hinterher 140 %. Das ist also<br />
eine Steigerung um 40 %.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielleicht geht es noch ein paar mehr Leuten so wie mir:<br />
Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie gerade mit Ihrem<br />
Taschenrechner ausgerechnet haben.<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Einmal wird zum heutigen Zeitpunkt bei 60 % Ersatzbrennstoff<br />
eine Quecksilberemission von 0,02 mg/m³<br />
angesetzt. Für die Zukunft wird eine Quecksilberkonzentration<br />
von 0,028 mg/m³ prognostiziert. Das ist eine Steigerung<br />
um 40 %.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Jetzt wird es, denke ich, klarer. Können Sie etwas dazu<br />
sagen, Herr Dr. Oerter?<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Noch einmal: Die 0,028 sind der vorgesehene Emissionsgrenzwert,<br />
der unterhalb des Grenzwertes aus der<br />
17. BImSchV liegt. Diese 52 kg – ich komme auf ein<br />
bisschen weniger, aber das ist auch völlig wurscht -, diese
Jahresfracht ist tatsächlich mit dem Emissionsgrenzwert<br />
bestimmt worden.<br />
Die tatsächliche Emission, die sich als Jahresmittelwert<br />
aus den kontinuierlichen Quecksilbermessungen<br />
ergeben hat, entspricht eben nicht dem Grenzwert – was<br />
auch gut so ist -, sondern liegt darunter. 0,02 mg/m³ war<br />
die tatsächlich gemessene Jahresemission im Jahr 2011.<br />
Wenn ich Herrn Villano richtig verstanden habe, war das<br />
auch für das gesamte Jahr 2012 der Fall. – Herr Bauer,<br />
Herr Villano hat es mir zugesagt: Er zeigt Ihnen gleich<br />
noch den entsprechenden Messwert.<br />
Diese Maximalfracht ist nicht mit der gemessenen Jahresemission,<br />
sondern mit dem Emissionsgrenzwert, der<br />
einzuhalten ist, mit dem Tagesmittelwert von 0,028 mg/m³,<br />
abgeschätzt worden. Die 0,02 mg/m³ sind der tatsächlich<br />
gemessene Jahresemissionswert für das Quecksilber.<br />
Das heißt, ich liege um 8 µg/m³ unterhalb des Grenzwertes,<br />
was üblicherweise auch der Fall ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich denke, jetzt ist es klarer geworden, wie die Betrachtung<br />
zustande kam. Es gibt einfach einen Unterschied<br />
zwischen dem realen Wert und dem Emissionsgrenzwert.<br />
Da gab es unterschiedliche Rechengänge.<br />
Eine weitere Einwenderin hatte sich vorhin zu Wort<br />
gemeldet.<br />
Jutta Aberle (Einwenderin):<br />
Solche Werte, von denen wir sprechen, sind doch immer<br />
auf einen erwachsenen Menschen bezogen, der vielleicht<br />
1,80 m groß ist und 70 kg wiegt. Meine Frage wäre: Wie<br />
wirkt sich das auf Kinder aus? Wenn ich meinen Kindern<br />
z. B. Hustensaft gebe, muss ich immer ganz genau darauf<br />
achten, wie alt die sind und wie schwer die sind, weil die<br />
einfach nicht so viel vertragen. Wenn ich jetzt von den<br />
Werten zum Quecksilber höre, stelle ich mir die Frage:<br />
Wie viel verträgt so ein kleines Kind?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke für die Frage. – Frau Schmid-Adelmann, könnten<br />
Sie etwas dazu sagen? Ich denke, es ist mehr eine<br />
informative Frage.<br />
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Bei der Berechnung, die ich vorhin dargestellt habe, war<br />
der Wert auf einen erwachsenen Menschen bezogen. Es<br />
ist Tatsache, dass der Erwachsene um die 20 m³ Luft pro<br />
Tag einatmet. Für das Kind ist der Wert natürlich durch die<br />
niedrigere Aufnahme von Luft in der Lunge entsprechend<br />
niedriger. Verhältnismäßig geringer ist auch die Menge an<br />
Quecksilber, die das Kind aufnehmen kann. Insofern gilt<br />
dieser unbedenkliche PTWI-Wert, auf den ich mich bezogen<br />
habe, für Erwachsene und für Kinder gleich.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank. – Jetzt Herr Block.<br />
Seite 67<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Rauchgasreinigung (SNCR, Nasswäscher,<br />
Versuch zur Minimierung von<br />
Quecksilber)<br />
Harry Block (BUND):<br />
Quecksilber: Sie hatten die Werte für 2011 aufgelegt, und<br />
der Durchschnittswert war 0,021; den habe ich mir gemerkt.<br />
Damit haben Sie den von Ihnen beantragten Wert<br />
als Schnitt gerissen. Das war seine Frage. Seine Frage<br />
war, wie der Wert 2012 ist. Da haben Sie ja schon HOK<br />
eingesetzt. Das heißt, die Frage wäre: Wenn HOK, also<br />
Aktivkohle, nicht eingesetzt worden wäre, wie wäre dann<br />
der Wert gewesen? Anders gefragt: Warum nehmen Sie<br />
nicht immer HOK? Bei Quecksilber, bei so einem Stoff<br />
muss man doch um jeden Preis minimieren. Frage:<br />
Warum nehmen Sie nicht immer Aktivkohle? Dann liegen<br />
Sie mit dem Wert immer darunter.<br />
Sie haben in 2011, wenn ich es richtig gelesen habe,<br />
den Wert, den Sie jetzt beantragen, im Schnitt nie erreicht<br />
- nie! Sie haben einen Schnitt von 0,021.<br />
(Kopfschütteln aufseiten der Antragstellerin)<br />
– Doch, der war zwischen 0,021 und 0,028. Zahlen kann<br />
ich mir gut merken. Der Witz ist: 2011 haben Sie es nicht<br />
erreicht, und für 2012 werden Sie es uns nachher zeigen.<br />
Ich sage der Genehmigungsbehörde: Das kann man<br />
immer erreichen. Wir betrachten das jetzt unter dem<br />
Gesichtspunkt, was wir erreichen könnten, wenn immer<br />
Aktivkohle eingesetzt würde – immer! Oder geht das<br />
technisch nicht? Oder ist der Preis entscheidend?<br />
Dann kommt als nächste Frage – wir sprechen nachher<br />
noch über die Filter -: Schaffen wir das bei den anderen<br />
Sachen auch?<br />
Ich habe Ihnen vorhin gesagt, eine Müllverbrennungsanlage<br />
bzw. die Stadt Karlsruhe hat bei der Klärschlammverbrennung<br />
0,00068 mg/Nm³ Quecksilber im Schnitt. Das<br />
liegt um zwei Potenzen unter den 0,02, die Sie im Augenblick<br />
noch nicht erreicht haben. Sie haben noch nicht<br />
bewiesen – weil 2012 fehlt -, dass Sie die 0,02 überhaupt<br />
schaffen.<br />
Wissen Sie es als Behörde, dass das so ist? Wir können<br />
die Walzbachtaler ja nicht als Versuchskaninchen<br />
missbrauchen. Das heißt, Sie müssten die Werte kontinuierlich<br />
bekommen. Sie können doch nicht eine Genehmigung<br />
erteilen, wenn Sie nicht genau wissen, was die da<br />
treiben, oder?<br />
Das ist keine Genehmigung; das ist ja genehmigungsfrei.<br />
Und genehmigungsfrei heißt, dass Sie hoffentlich<br />
jeden Wert dokumentiert haben. Das hoffe ich doch im<br />
Interesse der Menschen da hinten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die Werte haben Sie vorhin gehört. Zu Ihrer Anmerkung<br />
am Schluss gleich die Antwort: Die Werte werden uns<br />
monatlich in Berichten übermittelt. Wir haben aus diesen<br />
Berichten keine Auffälligkeiten erkennen können oder
dass eine Erhöhung gegenüber der vorigen Emissionssituation<br />
aufgetreten ist. Wir haben jetzt die Werte ebenfalls<br />
nicht dabei.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Haller, haben Sie diesen Versuch beobachtet?<br />
Haben die dort wirklich die Brennstoffe eingesetzt, die jetzt<br />
gewünscht sind? Ist das so gewesen? Waren Sie da vor<br />
Ort? Haben Sie das jeden Tag nachkontrolliert? Wie oft<br />
wurde Aktivkohle eingesetzt? War das die ganze Zeit, war<br />
das an einem Tag? Das müssen wir doch jetzt wissen. Es<br />
wäre schön, wenn wir das einmal sehen könnten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vorhin hat Lafarge diese Frage meines Erachtens schon<br />
beantwortet. Aber Lafarge kann es gerne noch einmal tun.<br />
Sie haben vorhin die Frage gestellt, warum diese Aktivkohlezudosierung<br />
oder diese Herdofenkokszudosierung<br />
nicht kontinuierlich stattgefunden hat. – Wer will von<br />
Lafarge dazu etwas sagen: Herr Villano, Herr Dr. Oerter?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Noch einmal zum allgemeinen Verständnis: Der Tagesmittelwert,<br />
der Grenzwert, beträgt 0,028 mg/m³. Der Jahresmittelwert,<br />
also der tatsächliche Emissionswert, liegt bei<br />
0,021 mg/m³, also darunter. Das haben wir durchgehend<br />
gemessen; wir messen kontinuierlich.<br />
Dass wir keine Herdofenaktivkohle kontinuierlich eindüsen,<br />
liegt daran, dass wir versuchen, von vornherein<br />
den Input zu kontrollieren und zu minimieren. Das heißt,<br />
wir wollen nicht, dass so viel Quecksilber ins System<br />
hineinkommt; wir müssen das auch irgendwie handeln.<br />
Es gibt letztendlich technische Maßnahmen, die auch<br />
Stand der Technik sind: Ausschleusung usw., Reduzierung<br />
der Sekundärbrennstoffrate bei langanhaltendem<br />
Trend nach oben und die Eindüsung als wirklich allerletzte<br />
Maßnahme, um Spitzen, ich sage einmal: abzuschießen.<br />
Sie haben gesehen – ich habe es Ihnen gezeigt -,<br />
dass es eine einzige Tagesmittelwertüberschreitung seit<br />
2011 gegeben hat. Ansonsten fahren wir den Ofen sehr<br />
stabil mit der Sekundärbrennstoffrate und stabil unter dem<br />
Grenzwert.<br />
(Harry Block [BUND] meldet sich zu Wort.)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, lassen Sie noch die Frau Sorg und den Herrn<br />
Futterer zu Wort kommen. Wenn es eine konkrete Nachfrage<br />
ist, gern. Aber vielleicht drückt bei den anderen<br />
beiden das gleiche Problem.<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Herr Villano, auch wenn Sie es noch hundertmal wiederholen:<br />
Das befriedigt mich überhaupt nicht, wenn Sie<br />
sagen, Sie möchten von vornherein lieber vermeiden. Wir<br />
alle möchten hier Müll vermeiden und können es nicht zu<br />
100 %.<br />
Seite 68<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Herr Dr. Oerter, Sie haben gesagt: Quecksilber geht<br />
zu 100 % gasförmig heraus.<br />
(Widerspruch von Dr.-Ing. Martin Oerter<br />
[AS])<br />
– Nein, stimmt nicht? Egal. - Auf jeden Fall geht es in die<br />
Luft. Es gibt eine Steigerung bei den Mengen. Warum<br />
nehmen Sie nicht kontinuierlich Aktivkohle? Sie könnten<br />
die Menge des ausgestoßenen Quecksilbers reduzieren,<br />
wenn Sie wollten. Sie wollen aber nicht. Ist das eine<br />
finanzielle Frage? Kann man sich das nicht leisten? Ist Ihr<br />
Werk von der Anlage her nicht darauf vorbereitet? Kann<br />
man das nicht kontinuierlich machen? Ich verstehe es<br />
nicht. Sie könnten Schadstoffe minimieren und tun es<br />
nicht, sondern sagen, Sie möchten irgendwelche Spitzen<br />
verhindern.<br />
Zweite Frage. Am 3. Juli 2009 – das Datum dürfte<br />
Ihnen ein Begriff sein – gab es einen Störfall. Gibt es<br />
Daten, wie hoch der Tagesmittelwert des Quecksilbers an<br />
diesem Tag war, wie viel da in die Luft ging? Das würde<br />
mich interessieren.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ganz kurz von meiner Seite: Der Begriff „Störfall“ ist etwas<br />
irreführend. Wir haben Gott sei Dank keine „Störfälle“ bei<br />
solchen Anlagen. Es geht um „Betriebsstörungen“, die<br />
dann eben zu erhöhten Werten führen können oder<br />
gegebenenfalls zu ungeplanten Folgen.<br />
(Zurufe von Anette Sorg [EW’in] und Harry<br />
Block [BUND])<br />
– Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Sie werden<br />
richtige Störfälle kennen. Wir sind wirklich froh, wenn wir<br />
keine haben.<br />
Dazu direkt eine Frage? - Gehen Sie bitte ans Mikrofon!<br />
Roland Lang (RP Karlsruhe):<br />
Das ist aber keine Einwenderin. - Sind Sie Einwenderin?<br />
(Zuhörerin: Das sage ich, wenn ich fertig<br />
bin!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Nein, nein! Halt!<br />
(Zuhörerin: Was bedeutet es, wenn Reinigungstrupps<br />
durch den Ort fahren und Zettel<br />
in den Briefkästen landen? Sind das keine<br />
Störfälle?)<br />
– Ich erkläre es Ihnen nachher.<br />
(Harry Block [BUND]: Ich übernehme die<br />
Fragen! – Weitere Zurufe von den Einwenderinnen<br />
und Einwendern)<br />
Wir waren eigentlich bei der Frage von Frau Sorg.
Harry Block (BUND):<br />
Wenn eine Firma etwas in die Briefkästen von Wössingen<br />
hineinwirft, wo draufsteht, dass sich irgendetwas in dem<br />
Betrieb ereignet hat, bezeichnen Sie das dann nicht als<br />
Störfall?<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Reinigungstrupps!)<br />
– Und wenn Reinigungstrupps durch die Straßen fahren,<br />
ist das dann ein ganz normaler Vorgang, eine Betriebsstörung<br />
– so, als ob bei mir das Blinklicht nicht geht?<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, das ist kein normaler Vorgang, das ist eine<br />
Betriebsstörung. Aber „Störfall“ ist gesetzlich belegt. Heute<br />
geht einiges ein bisschen durcheinander, wenn ich an<br />
„Irrelevanz“ und die Folgerungen denke. Das geht ein<br />
bisschen quer durch die TA Luft. Juristisch werden wir es<br />
dann in der Entscheidung entsprechend darstellen.<br />
Aber eines muss klar sein: Einen Störfall gibt es im<br />
Störfallbetrieb. Das ist ein Betrieb, der unter die Störfallverordnung<br />
fällt. Das ist dann wirklich eine ernsthafte<br />
Geschichte. Da geht es dann nicht um Staub oder Ähnliches,<br />
da geht es um ganz andere Stoffe.<br />
Der Begriff ist belegt, und wir werden die Begriffe – ob<br />
es Ihnen gefällt oder nicht – so verwenden, wie sie im<br />
Gesetz stehen. Ich will nicht herunterspielen, dass da eine<br />
Störung stattgefunden hat. Aber den Begriff „Störfall“<br />
werden wir in dem Zusammenhang nicht verwenden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Es geht wirklich nicht darum, dass man das nicht ernst<br />
nähme. Aber es gibt schlicht und einfach Begriffe, die<br />
gesetzt und belegt sind. Wir sind froh, dass wir bei Lafarge<br />
allein von den Begrifflichkeiten her keine „Störfälle“ haben<br />
können. Das sind Kleinigkeiten, aber man muss auch<br />
solche formalen Dinge angesprochen haben. - Jetzt zu der<br />
Frage von Frau Sorg.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Ich kann Ihnen jetzt keinen Messwert oder Quecksilberwert<br />
angeben. Aber ich will das noch einmal erläutern:<br />
Das, was dort am Klinkerkühler ausgetreten ist, war<br />
Staub. Die Entstaubung ist ein System, wo Frischluft<br />
eingedüst wird. Das heißt, das war reine Frischluft über<br />
diesem Kamin - mit staubbelastetem Rohmaterial, ja. Aber<br />
da sind keine Gase aus dem Ofen oder keine im Verbrennungsprozess<br />
entstandenen Gase mit abgeschieden<br />
worden, sondern das war Frischluft.<br />
Den Tageswert von Quecksilber an diesem Tag kann<br />
auch ich Ihnen jetzt nicht sagen; den müsste ich heraussuchen.<br />
Aber die Anlage wurde unvermittelt gestoppt,<br />
sodass der gesamte Produktionsprozess gestoppt war.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Futterer.<br />
Seite 69<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Noch einmal, um Frau Sorg zu unterstützen. – Ich weiß<br />
auch nicht, ob wir in der Tagesordnung noch zu den<br />
Filteranlagen kommen oder ob das jetzt schon mit dabei<br />
ist.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Im Moment sind wir noch bei der Emissionssituation,<br />
wobei ich hoffe, dass wir die bald verlassen können.<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Okay. Die Filteranlagen sind schon ein zentraler Punkt,<br />
worüber wir hier gerne noch diskutieren und unsere<br />
Bedenken vortragen würden. Dann stelle ich es zurück,<br />
bis wir dahinkommen.<br />
(Anette Sorg [EW’in]: Meine Frage ist nicht<br />
beantwortet!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Da hat die Frau Sorg recht. – Herr Villano, haben Sie sie<br />
verstanden? - Es hilft manchmal nachzuhaken, wenn man<br />
eine Frage nicht verstanden hat. Dann wird es vielleicht<br />
einfacher mit dem Antworten.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Dann wiederholen Sie das bitte noch einmal. Ich denke,<br />
es ging darum, was an dem Tag aus dem Kamin herauskam.<br />
(Anette Sorg [EW’in]: Nein, warum Sie nicht<br />
kontinuierlich Aktivkohle nehmen, um die<br />
Schadstoffe, um Quecksilber zu reduzieren!)<br />
Da kam jetzt die andere Frage dazwischen. – Frau Sorg,<br />
ich kann mich da nur wiederholen. Wir versuchen letztendlich,<br />
das Quecksilber im System zu reduzieren. Es gibt<br />
verschiedene Maßnahmen, um Quecksilberemissionen zu<br />
reduzieren, sprich: Temperatursenkung, um die Kondensation<br />
zu erhöhen, Ausschleusung, Senkung der Sekundärbrennstoffrate.<br />
Wenn das nicht ausreicht, werden die<br />
Spitzen abgefangen. Das heißt, das ist die allerletzte<br />
Maßnahme. Das ist letztendlich Stand der Technik.<br />
Andere Maßnahmen sind hier in der Zementindustrie nicht<br />
eingesetzt.<br />
(Bettina Waibel [EW’in]: Sie weichen aus!)<br />
Anette Sorg (Einwenderin):<br />
Ich habe vorhin, glaube ich, vernommen, dass zwei Drittel<br />
des Quecksilberausstoßes im Rohmaterial drinstecken. An<br />
diesem Quecksilberwert aus dem Rohmaterial können Sie<br />
im Vorfeld nichts ändern. Der Rest kommt aus den Sekundärbrennstoffen.<br />
Da können Sie etwas ändern, je<br />
nachdem, woher Sie das beziehen oder wie genau Sie<br />
das kontrollieren. Aber warum können Sie diese zwei<br />
Drittel im Rohprodukt nicht mit Ihrer Aktivkohle behandeln?
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen durcheinander, Frau<br />
Sorg. Das mit den zwei Dritteln habe ich heute früh<br />
möglicherweise nicht präzise genug ausgedrückt. Das<br />
bezog sich auf die CO2-Emissionen. Zwei Drittel des CO2<br />
kommen aus dem Prozess, ungefähr ein Drittel kommt<br />
aus der fossilen Verbrennung. Das kann reduziert werden,<br />
wenn ich entsprechende Alternativbrennstoffe einsetze.<br />
Gleichwohl ist es so – das ist allerdings von Anlage zu<br />
Anlage unterschiedlich; da müsste man eine sehr aufwendige<br />
Quecksilberbilanz machen, wenn Sie die genaue<br />
Zahl hören wollen -, dass allein durch den unterschiedlichen<br />
Massenhebel – das sind sozusagen zehn Teile<br />
Rohmaterial auf einen Teil Kohle – ein ungleich höherer<br />
Massenstrom des Rohmaterials in das System eingeht,<br />
als es der Brennstoff tut. Deswegen ist die Spurenelement-eintragssituation<br />
im Wesentlichen durch die Rohmaterialien<br />
bestimmt.<br />
Natürlich muss ich gerade bei den Brennstoffen auch<br />
auf die Komponente Quecksilber schauen, wie Herr<br />
Villano das gesagt hat. Wir reden hier - um das klar zu<br />
sagen - letztlich über den Stand der Technik. Die Grenzwerte,<br />
wie sie im Immissionsschutzrecht festgelegt sind<br />
- wobei hier schon ein dynamisierter Grenzwert genommen<br />
worden ist -, tragen letztlich dafür Sorge, dass der<br />
Betrieb der Anlage umweltverträglich und schadlos erfolgt.<br />
Es gibt einen Stand der Technik, wie er auch im BVT-<br />
Papier festgeschrieben ist. Das sind genau die Maßnahmen,<br />
die Herr Villano dargelegt hat, und die entsprechen<br />
derzeit dem aktuellen State-of-the-Art.<br />
Wir hatten heute früh schon angesprochen, dass bei<br />
der Komponente Quecksilber aufgrund ihrer Emissionsrelevanz<br />
sehr wohl eine sorgfältige Inputüberwachung<br />
erforderlich ist, um hohe Belastungen zu vermeiden. Das<br />
ist genau die Technik bzw. das Verfahren, das Lafarge<br />
anwendet. Der Emissionsgrenzwert, der von der Genehmigungsbehörde<br />
vorgeschlagen worden ist, enthält schon<br />
eine gewisse Dynamisierung. Man geht nämlich von den<br />
0,03 herunter auf 0,028 mg/Nm³. Das ist derzeit das, was<br />
das Werk leisten muss. Und das wird unter Anwendung<br />
des Standes der Technik getan.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer und dann Herr Klawe.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich habe noch eine Rückfrage an Herrn Villano. Habe ich<br />
es jetzt richtig verstanden, dass Sie die Quecksilbergeschichte<br />
also doch über den Brennstoff beeinflussen? Sie<br />
hatten doch gesagt, dass Sie irgendwie durch Beeinflussung<br />
der Brennstoffe versuchen, die Quecksilberanteile im<br />
Zaum zu halten.<br />
Seite 70<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Es hat niemand bestritten, dass Quecksilber auch über<br />
den Brennstoff mit hineinkommt. Das heißt, wir haben hier<br />
eine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Quecksilberemissionen.<br />
Wenn wir also solche Trends feststellen, kann<br />
man entsprechend gegensteuern. Dazu gibt es Betriebsanweisungen,<br />
wie zu verfahren ist. Das ist eine Maßnahme,<br />
die dann geschaltet wird, wenn andere technische<br />
Maßnahmen nicht greifen. Die allerletzte Maßnahme ist<br />
eben die Eindüsung von Aktivkohle.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Dann hätte ich noch eine konkrete Rückfrage. Sie sagen,<br />
Sie können den Quecksilberausstoß beeinflussen. Aber es<br />
spielt dann letzten Endes doch wieder keine Rolle, ob Sie<br />
von 60 auf 100 % Sekundärbrennstoffe gehen. Es muss<br />
doch irgendwo in den Stoffen, die Sie verbrennen, das<br />
Quecksilber enthalten sein. Dementsprechend muss der<br />
Anteil auch unterschiedlich sein; denn sonst könnten Sie<br />
ihn nicht beeinflussen, je nachdem, was Sie verbrennen.<br />
Darum würde mich interessieren, welche Quecksilberinhalte<br />
die einzelnen Brennstoffe haben. Ich mag nicht<br />
so ganz glauben, dass gerade auch in dem Fluff so wenig<br />
drin sein soll, dass Sie bei Erhöhung der Sekundärbrennstoffrate<br />
den Grenzwert trotzdem noch halten.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Vielleicht kann ich das gerade beantworten. Es sind<br />
mehrere Prozesse, die da ablaufen, wie ich es heute früh<br />
schon einmal gesagt hatte: Bei der Produktion des Brennstoffes<br />
zeigen sich viele Herausforderungen. Zum Beispiel<br />
ist beim Thema Quecksilber herauszufinden, wo eigentlich<br />
das Quecksilber im Stoff ist und wie ich es minimieren<br />
kann.<br />
Die Untersuchungen, die wir und auch andere Verbände<br />
gemacht haben, haben zu verschiedenen Ergebnissen<br />
geführt. Eine Erfahrung ist, dass in den Feinanteilen,<br />
die sich in diesem Ersatzbrennstoff befinden, der<br />
größere Teil an Quecksilbergehalten zu finden ist. Daraus<br />
ergibt sich ganz logisch die Maßnahme, den Grad der<br />
Feinanteile durch die Produktion des Brennstoffs so weit<br />
wie möglich zu reduzieren. Genau das ist eine der Zielstellungen,<br />
die wir als Lafarge unseren Produzenten mitgeben,<br />
indem wir sagen: Das sind gemeinsame Erkenntnisse;<br />
wir wollen, dass das so läuft. Und so funktioniert das<br />
im Prinzip auch.<br />
Sie haben richtig erkannt: In dem Moment, wo ich die<br />
Menge erhöhe, aber auf einem bestimmten Level bleiben<br />
will, ist sofort die Herausforderung da, die entsprechenden<br />
Einträge noch weiter zu minimieren, als es bisher erfolgt<br />
ist.<br />
Ich sage es einmal aus der Erfahrung heraus: Wir reden<br />
hier von zeitlich abgestimmten Prozessen. Wenn ich<br />
mir vor Augen führe, wie vor 15 Jahren mit Ersatzbrennstoffen<br />
umgegangen wurde, muss ich ganz klar sagen: Da<br />
sind wir heute Kilometer weiter.
Herr Block, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie sich<br />
schon viele von diesen Aufbereitungsanlagen angesehen<br />
haben. Ich denke, Sie können das bestätigen, wenn ich<br />
sage: Da gibt es eine riesige Entwicklung. So wird es auch<br />
in der Zukunft sein. Dass wir da noch lange nicht am Ende<br />
sind, darüber müssen wir nicht diskutieren; das ist völlig<br />
klar.<br />
(Harry Block [BUND]: Deswegen sitzen wir<br />
hier!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Konkret dazu?<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Ja. – Herr Fischer, geht es ein bisschen konkreter?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Was meinen Sie jetzt?<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Könnten Sie das vielleicht an einem bildhaften Beispiel<br />
klarmachen? Es ist für mich vollkommen abstrakt, was Sie<br />
gesagt haben.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Ich meine z. B. die gesamten technischen Entwicklungen,<br />
die in diesem Bereich hinter uns liegen. Wir reden hier die<br />
ganze Zeit über Quecksilber. Das ist ein Thema. Ein ganz<br />
entscheidendes anderes Thema war all die Jahre Chlor.<br />
Schauen wir uns doch einmal an, was für Methodiken und<br />
Technologien in der Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen<br />
eingesetzt werden. Ich meine beispielsweise Technologien,<br />
um diesen Chloranteil während des Produktionsprozesses<br />
herauszunehmen. Das sind Beispiele, die mir<br />
vorschweben, wenn ich von technischer Entwicklung rede.<br />
Dann kommt noch die Herausforderung hinzu - die ist<br />
jetzt aber nicht für uns so relevant, sondern viel relevanter<br />
für den Produzenten, also unseren Partner in dem Fall -,<br />
wie die Inputströme sortiert werden. Da ist aber nicht das<br />
Zementwerk aktiv, sondern der Hersteller. Aber natürlich<br />
kommen die Vorgaben vom Zementwerk.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer hat noch eine Nachfrage. Herr Klawe, etwas<br />
Geduld noch!<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Noch eine Verständnisfrage: Haben also diese 40 %<br />
Brennstoff, die Sie jetzt durch weiteren Sekundärbrennstoff<br />
ersetzen, vom Grundsatz her den gleichen Quecksilbergehalt<br />
wie Fluff beispielsweise? Wenn Sie sagen, dass<br />
Sie keine Änderung in der Gesamtbilanz haben, muss Ihr<br />
bisheriger Brennstoff genauso viel Quecksilber enthalten<br />
wie der neue - es sei denn, Sie würden jetzt diese Sekundärbrennstoffe<br />
unter völlig neuen Vorgaben herstellen<br />
lassen.<br />
Seite 71<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Diese völlig neuen Vorgaben bei der Entwicklung hatten<br />
wir im Prinzip schon in der gesamten Vergangenheit. Ich<br />
muss es noch einmal deutlich sagen: Auch wir entwickeln<br />
uns auf diesem Gebiet, und zwar nicht nur als Zementwerk,<br />
sondern auch in der Partnerschaft mit den entsprechenden<br />
Lieferanten.<br />
Natürlich kommen die Vorgaben in erster Linie aus der<br />
Genehmigungssituation. Solche Vorgaben, die daraus<br />
resultieren, werden auch weitergegeben. Heute früh ist<br />
schon erwähnt worden, dass wir als Werk auch zu den<br />
Lieferanten gehen, uns deren Technologie anschauen und<br />
uns vor Ort überzeugen: Können die das überhaupt? Sind<br />
die überhaupt geeignet – und zwar völlig unabhängig von<br />
Zertifizierungen -, uns den Stoff entsprechend den Vorgaben<br />
zu liefern?<br />
Ich wiederhole mich gerne: Wir haben da seit 2004,<br />
wenn ich mich recht entsinne, eine tolle Entwicklung hinter<br />
uns. Aber wir werden da nie an ein Ende kommen; das<br />
wiederhole ich ebenfalls gerne. Wir haben da gemeinsame<br />
Interessen – auch wenn das nirgendwo richtig deutlich<br />
wird –, auch auf diesem Gebiet weiter voranzukommen.<br />
Das können Sie mir gerne glauben.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND] meldet sich zu<br />
Wort.)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wenn es direkt dazu ist. Ansonsten ist eigentlich der Herr<br />
Klawe dran.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Was hat sich denn bei Ihren Lieferanten während dieser<br />
Versuchszeit geändert? Wenn Sie sagen, es hat sich<br />
nichts bei dem geändert, was oben herauskommt, muss<br />
sich doch bei den Lieferanten etwas geändert haben.<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Vielleicht habe ich es immer noch nicht klar und deutlich<br />
gemacht. Wir haben ein Lieferanten-Verwerter-Verhältnis.<br />
Als das begann – das war 2004 oder 2006, irgendwann in<br />
diesem Zeitraum -, wurden durch den Verwerter, also<br />
durch das Zementwerk, klare Vorgaben gemacht, wie wir<br />
uns das vorstellen. Von da an wurde im Prinzip täglich<br />
daran gearbeitet, die Bedingungen zu verbessern. – Jetzt<br />
rede ich nicht nur von Quecksilber, sondern von allen<br />
wichtigen Parametern. Wichtige Parameter sind im Grunde<br />
genommen sowohl Genehmigungsparameter als auch<br />
Prozessparameter.<br />
Mit verbesserten Bedingungen meine ich z. B. die<br />
Konstanz. Wir haben heute früh auch von Homogenisierung<br />
gesprochen: Wie homogen ist das, wie verlässlich<br />
sind die Werte? Und so weiter. Das ist dieser Prozess,<br />
von dem ich rede. – Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie<br />
dazu jetzt noch hören wollen.<br />
(Harry Block [BUND]: Ich werde sauer!)
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Der Herr Klawe wartet schon die ganze Zeit.<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Ich möchte auf die vorletzte Antwort von Herrn Villano<br />
zurückkommen. Sie haben da einen sehr interessanten<br />
Begriff verwendet, der auch sehr wichtig ist. Das war der<br />
„Stand der Technik“.<br />
Ich vergegenwärtige mir jetzt einmal Ihre Emissionswerte,<br />
die Sie beantragen, und stelle sie denen gegenüber,<br />
die Herr Block gezeigt hat, was in einer Müllverbrennungsanlage<br />
erreichbar ist.<br />
Sie werden demnächst eine Müllverbrennungsanlage<br />
mit 100 % Ersatzbrennstoff betreiben, die nach der<br />
17. Bundesimmissionsschutzverordnung, also nach der<br />
Verordnung für Müllverbrennungsanlagen, genehmigt<br />
wird. Es ist folglich eine Müllverbrennungsanlage.<br />
Stand der Technik, denke ich, ist das, was erreichbar<br />
ist, was der Herr Block gezeigt hat. Davon sind Sie im<br />
Moment noch ein erhebliches Stück entfernt. Wenn Sie<br />
sagen, Ihre Anlage wird nach dem Stand der Technik<br />
betrieben, dann doch bitte mit den Emissionswerten, die<br />
Herr Block eben gezeigt hat!<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Nur dazu: Es ist jetzt ein bisschen unglücklich, hier jede<br />
einzelne Zahl zu vergleichen. Bei der Vielzahl an Spurenelementen,<br />
auch bei den Dioxinen und Furanen gibt es,<br />
glaube ich, wenig bis keine Unterschiede zum Durchschnitt<br />
der Müllverbrennungsanlagen. Ich kann jetzt nicht<br />
für die Anlage in Hagen sprechen. Aber ansonsten ist das<br />
in der Tat völlig korrekt.<br />
Im Übrigen waren und sind die Vorgaben der<br />
17. BImSchV auch schon für eine 60-%-Substitutionsrate<br />
einschlägig. In 14 Tagen wird die revidierte Fassung<br />
veröffentlicht werden, die zu einer weiteren Angleichung<br />
auch der Emissionsgrenzwerte führen wird.<br />
Tatsache ist aber auch, dass wir teilweise über verschiedene<br />
Prozesse reden. Rechtlich gesehen werden<br />
sicherlich Abfälle in einem Produktionsprozess eingesetzt.<br />
Aber wir reden beim Klinkerbrennen nach wie vor über<br />
den Stoffumwandlungsprozess. Bei Schwermetallen und<br />
Dioxinen haben wir die gleichen Emissionsgrenzwerte.<br />
Beim NOx beispielsweise ist sehr wohl der Stand der<br />
Abgasreinigungstechnik zu berücksichtigen; das brauche<br />
ich Ihnen nicht zu erklären. Für eine Müllverbrennungsanlage<br />
liegt das Ausgangslevel bei, ich glaube, 500 mg/m³<br />
und bei einem Zementwerk ohne sekundäre Minderungsmaßnahmen<br />
bei über 1000 mg/m³.<br />
Wir reden letztlich über ein Produkt – ich glaube, das<br />
ist deutlich geworden -, das produziert werden muss. Es<br />
Seite 72<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
stellt sich jetzt nur die Frage, ob es nicht tatsächlich<br />
sinnvoll ist, diesen Produktionsprozess durch entsprechend<br />
aufbereitete und geeignete Ersatzbrennstoffe zu<br />
betreiben.<br />
Es ist für mich trotz der 100 % Ersatzbrennstoffe keine<br />
Abfallverbrennungsanlage. Den Hirnschmalz, Herr Block<br />
- wenn ich das so sagen darf -, muss ich zu Teilen vorher<br />
hineinstecken, um die Einsatzstoffe aufzubereiten, um die<br />
Abfälle zu analysieren – rechtlich sind es immer noch<br />
Abfälle - und um letztlich zu ermöglichen, den Produktionsprozess<br />
zu betreiben.<br />
Es ist jetzt nicht zielführend, die Emissionswerte einer<br />
Müllverbrennungsanlage mit den Emissionsgrenzwerten<br />
für ein Zementwerk zu vergleichen. In den letzten Jahren<br />
sind hier erhebliche Investitionen getätigt worden. Schauen<br />
Sie sich die tatsächlichen Staubemissionen an - Herr<br />
Villano hat mir gerade den Jahresmittelwert gezeigt -: Das<br />
sind unter 2 mg/m³. Das ist sensationell gut für ein Zementwerk.<br />
Natürlich, Herr Block, ist das dann überwiegend Feinstaub;<br />
das liegt in der Natur der Sache. Je besser die<br />
Abscheidetechnik ist, umso höher ist der Feinstaubanteil.<br />
Es wird niemand auf die Idee kommen, wieder 100 mg/m³<br />
zuzulassen, um den Feinstaubanteil abzusenken.<br />
Genau die gleiche Schwierigkeit - Herr Bauer, wenn<br />
ich darauf zurückkommen darf – haben wir im Moment mit<br />
der Beschreibung der Ersatzbrennstoffe. Herr Villano hat<br />
mir zugesagt, Ihnen die Werte noch zu zeigen. Die Prognose<br />
ist mit den Werten errechnet worden - wir hatten das<br />
heute früh diskutiert -, wie sie aus dem Leitfaden NRW<br />
kommen. Noch einmal - ich berufe mich jetzt schon<br />
mehrfach auf Bärbel Höhn -: Das sind Mittel- und Maximalwerte,<br />
die für Stoffe festgelegt worden sind, wo es<br />
hieß: Wenn diese Werte eingehalten werden, kann dieser<br />
Stoff unweltverträglich und schadlos im Zementherstellungsprozess<br />
eingesetzt werden.<br />
Die tatsächlichen Quecksilbergehalte in diesen Stoffen<br />
liegen deutlich darunter. Das hat mir Herr Villano gezeigt,<br />
und das kann ich Ihnen auch gerne anhand von anderen<br />
Messungen zeigen. Es liegt in der Natur der Sache, dass<br />
ich solche Grenzwerte letztlich niemals ausnutzen kann.<br />
Wir reden beim Betrieb eines Zementwerks auch nicht<br />
über den Betrieb einer Spielzeugeisenbahn. Ich kann nicht<br />
sagen: Super, da fahre ich auf 0,7 % an den Grenzwert<br />
heran. Ich brauche immer die Luft zum Atmen. Das gilt für<br />
die Inputparameter genauso wie für die Emissionsgrenzwerte.<br />
Die tatsächlichen Emissionen – das ist bei dem, was<br />
Herr Villano gesagt hat, letztlich deutlich geworden –<br />
liegen naturgemäß unter den Grenzwerten. Damit ist ein<br />
umweltverträglicher und schadloser Betrieb der Anlage<br />
gewährleistet.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Klawe, eine kurze Nachfrage.
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Sie reden von Grenzwerten, vorhin wurde vom Stand der<br />
Technik geredet. Der Stand der Technik ist ein anderer.<br />
Es ist möglich, das herauszufiltern. Ich gebe Ihnen recht:<br />
Beim NOx ist das bei 1400 °C im Drehrohrofen naturgemäß<br />
schwierig, aber bei Quecksilber und anderen<br />
Schwermetallen geht es. Genau das ist es, was wir hier zu<br />
bedenken geben, anregen und im Prinzip fordern.<br />
(Vereinzelt Beifall bei den Einwenderinnen<br />
und Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, Sie haben noch etwas. Und dann Herr Wiedenmann.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Schilling, ich kann gut verstehen, dass die Begrifflichkeiten<br />
hier für einen Juristen fürchterlich sind. Aber ein<br />
„Störfall“ ist für einen normalen Menschen, wenn etwas<br />
nicht geht.<br />
Ich sage Ihnen einmal etwas zu diesen Überschreitungen<br />
an einem Tag. Stellen Sie sich vor, ich habe Betriebsstörungen<br />
an meinem Auto. Meine Bremse ist kaputt, und<br />
ich überfahre ein Kind. Das ist dann eine Betriebsstörung<br />
meines Autos, und ich habe ein Kind verletzt oder es im<br />
schlimmsten Fall getötet.<br />
Eine der Bürgerinnen dieser Ortschaft hat es sehr<br />
deutlich gesagt: Was ist mit ihrem kleinen Kind? Was ist,<br />
wenn das Kind an dem Tag, wo diese Grenzüberschreitung<br />
passiert, irgendwo spielt und das Quecksilber abbekommt?<br />
Es wird geschädigt. Dann gilt das hier als irgendein<br />
kleiner Störfall. Es ist halt eine Überschreitung an<br />
einem Tag festgestellt worden. Da sehen Sie einmal, was<br />
juristische Begriffe so an sich haben.<br />
Der Störfall von 2009 bestand aus 50 kg Kalk. Da wird<br />
dann von Gutachtern gesagt: Mein lieber Gott, wir kalken<br />
doch den Wald ohne Ende. Ob in dem Kalkstein vielleicht<br />
noch anderes Zeug drin war – das hätte ich gerne gewusst.<br />
Was ist denn da noch drin in dem Kalk? Ist das der<br />
gleiche Kalk, den wir zur Kalkung benutzen?<br />
Jetzt kommen wir zu den Ursachen: Warum kalken wir<br />
unsere Wälder? Weil wir NOx haben von solchen Anlagen,<br />
die – das hat er gesagt – 320 mg/Nm³ ausstoßen. Ich<br />
sage: 100 mg/Nm³ ginge mit Gas. Da brauchen wir keine<br />
320 mg/Nm³. Wir können das also reduzieren und brauchen<br />
dann die Wälder nicht zu kalken.<br />
Ich weiß, was in diesem Kalk drin ist. Wir haben untersuchen<br />
lassen, was die in unsere Wälder schmeißen. Das<br />
ist das Zigfache von dem, was bei diesem Störfall bei<br />
Ihnen oben herausgekommen ist. Aber bei Ihnen war mit<br />
Sicherheit auch spezifisches Zeug drin. Da war nicht nur<br />
Kalk drin; da gehe ich jede Wette ein. - Erster Punkt.<br />
Zweiter Punkt, Quecksilber. Wenn es möglich ist, eine<br />
Abscheidung durch eine HOK-Maßnahme vorzunehmen,<br />
die relativ einfach zu sein scheint, und Sie durch die<br />
Mitverbrennung von Aktivkohle eine Art Verdünnung<br />
Seite 73<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
haben - oder was weiß ich -, dann verstehe ich nicht,<br />
warum Sie nicht sagen: Das machen wir immer. Fertig!<br />
Die Sache ist erledigt.<br />
Dann zu den 0,02. Sie wollen 0,028; das ist beantragt.<br />
Ich sage Ihnen: Das darf eine Behörde nicht genehmigen.<br />
Sie können nicht diese 3 % Irrelevanz vernachlässigen.<br />
- Wir kommen nachher zu den Critical Loads. - Sie können<br />
nicht 13 % zusätzlich an Quecksilber in den Boden einbringen;<br />
das geht nicht. Das geht genauso wenig wie bei<br />
Arsen.<br />
Ich hätte eigentlich von Frau Schmid-Adelmann erwartet,<br />
dass sie sagt, was das Vanadium macht. Was ist denn<br />
das? Was macht Arsen? Arsen kennt jeder: Das ist ein<br />
Mordgift. Da ist klar, was das macht. Die toxischen Wirkungen<br />
von Arsengehalten sind bei uns ein Grundproblem,<br />
weil wir Arsen im Boden haben; das ist dort natürlich<br />
vorhanden. Das ist auch im Grundwasser vorhanden.<br />
Wenn aber 10 % dazukommen, ist das für uns letztlich<br />
nicht akzeptabel.<br />
Vanadium und Cadmium sind Stoffe, bei denen Anosmie<br />
als Langzeitwirkung möglich ist. Und wir reden hier<br />
von Langzeitwirkungen. Die Leute wohnen nicht nur zwei<br />
Tage hier wie wir jetzt, die morgen wieder weg sind. Die<br />
Leute wohnen hier immer, und die essen das immer,<br />
jeden Tag.<br />
Wenn dann 10 %, die ich nicht brauche, zusätzlich in<br />
diesen Raum hineinkommen, dann - sage ich - müssen<br />
Sie alles tun. Ich bleibe jetzt beim Beispiel Quecksilber,<br />
weil es da am einfachsten zu sein scheint. Nehmen Sie<br />
immer HOK, und Sie können 0,02 oder was auch immer<br />
erreichen!<br />
Deshalb wollen wir die Werte von 2012 nicht nur in der<br />
Pause genannt haben, sondern wir wollen sehen, was Sie<br />
mit diesem HOK erreichen, was da geht. Können Sie 0,02<br />
problemlos erreichen? Dann machen Sie es immer! Das<br />
ist eine Minimalforderung, die Sie erfüllen können.<br />
Vanadium ist ein Nervengift. Das ist ein schweres Gift,<br />
das Leberschäden ohne Ende verursacht. Nehmen Sie<br />
einmal Zinnober. Da ist Quecksilber drin; das weiß allerdings<br />
keiner. Wenn Sie so einen Stein sehen, denken Sie:<br />
ganz harmlos. Das ist hochtoxisch! Wenn Sie so etwas<br />
kaufen, kriegen Sie 30 Schilder mit: Um Gottes Willen!<br />
Legen Sie es nirgendwo hin, wo die Sonne draufscheint,<br />
weil das gefährlich sein kann! Bei Vanadium ist es genau<br />
dasselbe. Das ist eines der giftigsten Paralysegase, die es<br />
überhaupt gibt.<br />
Das überschreiten Sie irrelevant – zugegeben: irrelevant.<br />
Aber das sind 3 % zusätzlich. Da müssen Sie alles<br />
tun, was er gesagt hat. Da müssten Sie einfach sagen:<br />
Okay, mit HOK geht es, wir machen das. Man vereinbart<br />
dann den Entsorgungsweg. Wenigstens beim Quecksilber<br />
sollten wir, wenn wir hier herausgehen, das Gefühl haben:<br />
Der Stoff ist minimiert.<br />
Zu einer Frage, die nicht beantwortet ist: Auch ich<br />
glaube, dass Sie da oben am Kamin mehr abgeben. Das
kann doch nicht anders sein. Sie müssen mehr abgeben;<br />
das ist doch ganz klar. Es kann gar nicht sein, dass sich<br />
bei 40 % Zunahme – egal, was in Petrolkoks drin ist –<br />
nichts ändert. Ich habe Ihnen eben die Zahlen zum<br />
Quecksilber bei Kohle aufgelegt. Sie haben vorhin gesehen,<br />
dass im Petrolkoks nicht so viel drin ist wie in diesem<br />
Müll. Im Müll ist mehr drin.<br />
Ich möchte noch etwas zur MVA sagen, zur Müllverbrennungsanlage,<br />
weil geäußert wurde, wir reden hier von<br />
verschiedenen Sachen. Herr Schilling, für einen Laien wie<br />
uns ist es extrem schwierig, zwischen TA Luft,<br />
17. BImSchV, 39. und 16. BImSchV immer hin und her zu<br />
lavieren. Ich habe sie hier ausgedruckt. Hier sehen Sie die<br />
Verordnungen, über die wir reden. Lesen Sie die einmal!<br />
Da steht alles drin, was beachtet werden muss usw. Wie<br />
soll ein Laie da durchblicken?<br />
Hier geht es - da hat er vollkommen recht - um eine<br />
Anlage nach der 17. BImSchV, um eine Müllverbrennungsanlage.<br />
Sonst wären Sie nicht bei der 17. BImSchV,<br />
sondern bei der TA Luft. Deswegen verlangen wir – ich<br />
sage es noch einmal - die Werte wie für Hagen. Es muss<br />
nicht auf die Nachkommastelle genauso sein. Ich will<br />
nicht, dass Sie 0,000 machen. Aber machen Sie es um<br />
eine Potenz darunter! Dann sind wir schon zufrieden.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Zufriedener!)<br />
- Zufriedener; sagen wir es so. - Wenn Sie das aber nicht<br />
anstreben, wenn Sie uns erklären, Sie halten bei Quecksilber<br />
ja schon 0,02 ein, werden die Leute hier und auch<br />
wir Ihnen das immer vorhalten. Wir kennen auch die<br />
Klagewege. Und wenn wir wegen einer Lappalie klagen!<br />
Mit Lappalien gehen wir gegen den Unsinn vor, wenn Sie<br />
von Ihrer Seite sagen: Das mit dem Quecksilber ist so<br />
okay.<br />
Sie müssen das jetzt um Gottes Willen nicht beantworten.<br />
Da brauchen Sie die Betriebsleitung, die irgendwo in<br />
Paris sitzt und die Ihnen wahrscheinlich viel erzählen wird.<br />
Aber sagen Sie denen: Hier gibt es vor Ort Widerstand,<br />
wir wollen hier das HOK einfahren, das kostet soundso<br />
viel, und wir prüfen bei unseren Vorlieferanten - wie es<br />
Herr Fischer angesprochen hat -, dass die Quecksilberwerte<br />
im Vorprodukt niedrig sind.<br />
Allerdings fangen wir, Herr Fischer, immer ganz woanders<br />
an: Wir fangen beim Produkt an, nicht bei der Verwertung<br />
des Produktes. Schon das Produkt darf kein<br />
Quecksilber mehr enthalten. Wir versuchen, die Produktkette<br />
so zu verändern, dass das eben nicht mehr drin ist.<br />
Das ist das Ziel von Umweltschutzverbänden. Nicht die<br />
Nachsorge, sondern die Vorsorge ist das eigentlich<br />
Wesentliche – das Wort zum Sonntag.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Was war mit<br />
der Eisenbahn?)<br />
- Das mit der Eisenbahn habe auch ich nicht verstanden.<br />
Ich bin Eisenbahnspieler. Aber Ihre Anmerkung zur<br />
Spielzeugeisenbahn haben wir nicht verstanden.<br />
Seite 74<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Aber wir haben Sie verstanden, und Herr Schilling wird<br />
jetzt etwas dazu sagen.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Nicht ganz habe ich den Herrn Block verstanden. Was ein<br />
Kind zu überfahren mit der Anlage zu tun hat, verstehe ich<br />
nicht.<br />
(Harry Block [BUND]: Es ging um Störfall,<br />
Betriebsstörung!)<br />
Das war ein bisschen daneben, Herr Block, ganz einfach.<br />
Eines noch, weil Sie sagten: „Wir als Laien“. Ich habe<br />
Sie so eingeschätzt, da Sie bei solchen Veranstaltungen<br />
öfter auftreten, dass Sie nicht ganz Laie sind.<br />
Dazu möchte ich deutlich sagen, dass ich da differenziere.<br />
Wenn hier heute jemand aus Walzbachtal zum<br />
ersten Mal von einer solchen Sache betroffen ist und<br />
etwas falsch einschätzt, dann ist das okay. Wenn jemand<br />
wie Sie – Ihre wievielte Erörterungsverhandlung ist es,<br />
wenn es um Verbrennung geht? – heute noch Dinge<br />
durcheinander-schmeißt, verstehe ich das nicht ganz. Das<br />
muss ich offen sagen.<br />
Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir die Gesetze<br />
– das ist unsere Pflicht – und die Definitionen im<br />
Gesetz so anwenden werden, wie es dort drinsteht. Heute<br />
Morgen haben Sie ein Urteil zu einer Sondermüllverbrennungsanlage<br />
zitiert. Davon sehe ich hier beispielsweise<br />
auch nichts. Wir sollten schon hart an der Sache bleiben.<br />
(Harry Block [BUND]: Autoreifen?)<br />
Dann kommen die Argumente auch besser an, Herr Block.<br />
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Damit wären wir bei Herrn Wiedenmann, der noch eine<br />
konkrete Frage hat.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Ich muss jetzt noch einmal auf das Thema Quecksilber<br />
zurückkommen. Die Anwohner hier hatten vorhin Herrn<br />
Villano gefragt, was er denn macht, wenn er feststellt,<br />
dass sie Überschreitungen beim Quecksilber haben. Der<br />
Herr Villano hat geantwortet: Wir variieren unseren Brennstoff.<br />
Das war die Antwort.<br />
Er hat dann aber sofort an seinen Kollegen, den Herrn<br />
Fischer, das Wort weitergegeben. Anschließend hat der<br />
Herr Oerter ausschweifend eine reine Verschleierungstaktik<br />
betrieben, indem er beschwichtigen wollte mit der<br />
Aussage: Wir wollen ja alle besser werden, und in den<br />
nächsten Jahren und Jahrzehnten wird das alles noch<br />
besser, und irgendwann ist das vielleicht kein Problem<br />
mehr.<br />
Aber die Leute wollen wissen, was passiert, wenn Sie<br />
eine Überschreitung haben. Wenn der Herr Villano sagt,<br />
wir machen das mit variablem Brennstoff, kann das schon<br />
deswegen nicht gehen, weil er bei 100 % Fluff nur noch
einen Brennstoff hat. Da kann er nichts variieren. Die<br />
einzige Chance ist, dass dann Aktivkohle verwendet wird.<br />
Er hat sich aber geweigert, auf das Thema richtig einzugehen,<br />
vor allem auf die Personen hier, die gefragt haben:<br />
Warum machen Sie das denn nicht immer? Ist es Ihnen zu<br />
teuer? Oder ist es prozesstechnisch zu aufwendig? Oder<br />
ist die Entsorgung des Quecksilbers in der Aktivkohle<br />
nachher zu problematisch? Diese Antworten sind Sie den<br />
Anwohnern hier schuldig geblieben. Ich denke aber, dass<br />
sie das wissen wollen.<br />
Dann will ich noch etwas zu Frau Dr. Hübner sagen,<br />
die vorhin erklärt hat, die Zahlen sagten eigentlich überhaupt<br />
nichts aus, wenn man von irgendwelchen Frachten<br />
redet.<br />
(Widerspruch von Dr. Friederike Hübner<br />
[AS])<br />
– Das haben Sie gesagt. Sie haben nur noch mit Grenzwerten<br />
und prozentualen Anteilen argumentiert. Die<br />
Zahlen selbst würden nichts aussagen.<br />
Ich habe jetzt als Nachtrag einmal die Jahresfrachten<br />
von vier Stoffen schnell ausgerechnet, die jemand wissen<br />
wollte. Daran wird man sehr gut erkennen, dass man sich<br />
sehr wohl eine Vorstellung von der Bedeutung machen<br />
kann. Ich habe es einmal für die Summe der Schwermetalle<br />
ausgerechnet. Darin ist das, was Herr Block angesprochen<br />
hat, Vanadium usw. Es ist fast eine Tonne im<br />
Jahr. Das sind insgesamt 930 kg an Schwermetallen.<br />
Bei Cadmium und Thallium sind es 56 kg im Jahr. Vom<br />
Fluorwasserstoff – jetzt kommen wir zu den gasförmigen<br />
Stoffen - haben Sie ungefähr 2 t im Jahr, und vom Chlorwasserstoff<br />
– also Salzsäuregas bzw. Gas, das mit<br />
Wasser Salzsäure bildet – sind es 18,6 t im Jahr. Darunter<br />
kann sich jeder etwas vorstellen, vor allen Dingen von der<br />
einen Tonne Schwermetalle, die aus dem Schornstein<br />
herauskommt.<br />
Wenn man dann weiß – das hatten wir vorhin ja beschrieben<br />
–, dass durch den hauptsächlich aus Westsüdwest<br />
wehenden Wind der Hauptanteil von diesen Stoffen<br />
Richtung Dürrenbüchig getrieben wird, kann man sehr<br />
wohl eine Vision haben, was mit dieser einen Tonne<br />
Schwermetalle passiert, die da verteilt wird.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich sehe jetzt ein kleines Problem darin, dass zumindest<br />
ich den Herrn Villano anders verstanden habe – vielleicht<br />
müssen wir das im Protokoll nachgucken –, als Sie es<br />
dargestellt haben, was seine Äußerung zum Reagieren<br />
auf die Quecksilberüberschreitung mit dem Brennstoff<br />
angeht. Ich glaube, das war ein kleines Missverständnis.<br />
Das sollten wir noch einmal klarstellen und vielleicht auch<br />
noch etwas zum Thema Herdofenkoks sagen.<br />
Ich tue mich jetzt schwer damit, die Zahl von einer<br />
Tonne, die Sie ausgerechnet und in den Raum gestellt<br />
Seite 75<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
haben, anhand der Werte, die vorhin Herr Block aufgelegt<br />
hatte, nachzuvollziehen. Da waren Zahlen im Nullkommabereich<br />
an Gramm pro Jahr dabei. Von diesem Bereich<br />
wieder auf eine Tonne zu kommen, macht es nicht einfacher.<br />
(Harry Block [BUND]: Immissionen! Nicht<br />
verwechseln!)<br />
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Denn das Thema Immission<br />
und Emission geht schon die ganze Zeit durcheinander.<br />
Da müssen wir einfach noch einmal nachgucken,<br />
woher die Zahl kommt und was sie wert ist. Das wollte ich<br />
nur zur Klärung sagen.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Das kann ich schnell aufklären. Das sind die Angaben aus<br />
den Unterlagen. In den Unterlagen ist für die Summe der<br />
Schwermetalle 0,5 mg/m³ Rauchgas oder Abgas angegeben.<br />
Dann kennen wir die Zahlen des Rauchgases oder<br />
des Abgases pro Stunde. Wir kennen die Zahl der Stunden<br />
pro Tag, und wir kennen die Zahl der Tage im Jahr.<br />
Herr Oerter hat mich am Anfang einmal kritisiert und<br />
gesagt, wir hätten mit 365 Tagen und 24 Stunden gerechnet.<br />
Genau das steht in Ihren Antragsunterlagen drin, dass<br />
nämlich die Anlage 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro<br />
Tag betrieben wird. Dann kann man nicht anders, als von<br />
diesen Zahlen auszugehen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
In Ordnung. So ist das also gerechnet: 0,5 mg/m³ mal 365<br />
Tage mal 24 Stunden. Mir ging es einfach um die Grundlage<br />
der Daten.<br />
Herr Villano, sagen Sie noch etwas zu den anderen<br />
zwei Punkten, damit das klar wird? – Wenn es nicht klar<br />
wird, bitte gleich nachfragen! Denn ich glaube, das ist im<br />
Moment das größte Problem.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Dazu sage ich noch etwas. Die Frage war ja: Was tun wir,<br />
um eine drohende Grenzwertüberschreitung zu verhindern?<br />
(Dr. Rolf Wiedenmann [EW]: Nein, eine vorhandene!)<br />
Wir sehen im Vorfeld durch die kontinuierliche Emissionsmessung,<br />
wohin es geht. Das heißt, wir sehen Trends.<br />
Wenn wir feststellen, dass der Trend nach oben geht,<br />
müssen wir reagieren, um eine Grenzwertüberschreitung<br />
zu vermeiden. Ich habe Ihnen die entsprechenden Maßnahmen<br />
genannt. In den BVT-Merkblättern wird vorgegeben,<br />
was man machen kann, was die Anlage technisch<br />
hergibt. Eine Konsequenz ist die Reduzierung – nicht die<br />
Variation – einer Ersatzbrennstoffrate.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Wenn Sie den Brennstoff reduzieren, reduzieren Sie die<br />
Rauchgasmenge, und dadurch ändert sich dann nicht Ihre<br />
prozentuale Schadstoffverteilung. Die Jahresfracht würde
sich ändern. Wenn Sie die Anlage ein halbes Jahr stillstehen<br />
lassen, haben Sie natürlich die halbe Jahresfracht.<br />
Aber wenn Sie die voll mit Ihren 91 Megawatt – oder so –<br />
betreiben und die Brennstoffeinsatzmenge reduzieren,<br />
dann geht es mit der Leistung herunter, dann gehen Sie<br />
mit den Rauchgasmengen herunter. Aber dadurch verändert<br />
sich dann nicht der Schadstoffanteil pro Kubikmeter.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Ersatzbrennstoffrate kann reduziert werden, und die<br />
Primärbrennstoffrate würde dann ansteigen. Das heißt,<br />
insgesamt bleiben wir trotzdem bei der Feuerungswärmeleistung.<br />
Dr. Rolf Wiedenmann (Einwender):<br />
Aber Sie haben doch 100 % Ersatzbrennstoff schon<br />
eingesetzt. Wenn Sie reduzieren, müssen Sie herunterfahren.<br />
Oder wollen Sie dann plötzlich Gas nehmen? Haben<br />
Sie das in Reserve, dass Sie sagen, jetzt mache ich einen<br />
Gasbrenner an?<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Ja, wir haben natürlich mehrere Brennstoffe. Wir haben<br />
- wie gerade gesagt wurde – Bunker mit Altreifen usw. Die<br />
Gesamtfeuerungswärmeleistung muss gleichbleiben. Wie<br />
Sie in dem Gutachten sehen, geben wir Bereiche an, bei<br />
Dachpappe z. B. 0 bis 10 %. Das sind Parameter, mit<br />
denen man arbeiten kann.<br />
Generell noch ein wichtiger Punkt zur MVA-Anlage,<br />
wozu Sie, Herr Block, Zahlen und Grenzwerte genannt<br />
haben: Diese Zahlen, die Sie zeigten – z. B. die 52 kg<br />
Quecksilber -, sind Maximalwerte unter theoretischen<br />
Bedingungen, die wir nicht erreichen, wie gerade auch von<br />
Herrn Dr. Oerter erwähnt.<br />
Auch beim Staub werden wir mit 10 mg/Nm³ einen<br />
neuen Grenzwert bekommen. Das heißt aber nicht, dass<br />
unser jetziger reeler Wert, der unter 2 mg/Nm³ liegt, nach<br />
oben geht, sondern der wird unten bleiben. Somit geht die<br />
Immissionsprognose von einer Theorie aus, und es<br />
werden die maximalen Werte angesetzt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Bei meinen Folien war links immer der Grenzwert der<br />
TA Luft - da steht auch der Wert, den Sie mit NOx nicht<br />
einhalten können -, und rechts war deren Mittelwert. So<br />
weit dazu.<br />
Herr Schilling, ich habe Ihnen das Urteil genannt, weil<br />
sich der VGH Mannheim auf das Urteil zu dieser Sondermüllverbrennungsanlage<br />
bezogen hat. Ich bin kein Jurist,<br />
aber auch wir haben einen Rechtsanwalt, und der hat mir<br />
das geschrieben. Der hat gesagt: Beziehe dich darauf,<br />
weil sich unserer Verwaltungsgerichtshof Mannheim auf<br />
dieses höchstrichterliche Gutachten einer Sondermüllverbrennungsanlage<br />
bezogen hat, als er festgestellt hat, dass<br />
bei einer Müllverbrennungsanlage bzw. bei einem Sekun-<br />
Seite 76<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
därbrennstoffeinsatz entscheidend gefragt werden muss:<br />
Ist Verwertung oder Entsorgung der Hauptzweck dieser<br />
Anlage? Um das ging es am Anfang.<br />
Wir müssen für das Protokoll klarstellen, Herr Schilling:<br />
In einer Müllverbrennungsanlage darf man niemals Autoreifen<br />
anliefern - niemals! Das ist Sondermüll, und der<br />
Sondermüll in Karlsruhe ging nach Marokko. Seit es dort<br />
einige politische Unruhen gibt, geht der gesamte Käsekram<br />
nicht mehr nach Marokko, sondern er muss woanders<br />
entsorgt werden. Jetzt kommt man auf die fantastische<br />
Idee, ihn kleinzuschnitzeln und zu den Zementwerken<br />
zu bringen. Sie können das woanders nicht anliefern.<br />
Bringen Sie einmal Dachpappe in eine Müllverbrennungsanlage!<br />
Die freuen sich! Das ist bei denen zwar drin,<br />
aber wenn einer mit einer großen Charge käme, müsste er<br />
das sonderanmelden.<br />
Bei uns wüsste ich von keiner Müllverbrennungsanlage,<br />
die von der Energie <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> oder einer<br />
Kommune betrieben wird, dass dort Autoreifen angenommen<br />
werden. Deswegen ist die Entsorgung von Autoreifen<br />
hochproblematisch gewesen. Wie gesagt, der Entsorgungsweg<br />
war Marokko, zugegebenermaßen auch für<br />
Kraftwerke dort. – Das nur zur Klarstellung.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, ganz kurz - ich möchte es nicht vertiefen -:<br />
Autoreifen gehen nicht in eine Müllverbrennungsanlage<br />
wegen der Abfallhierarchie im § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz.<br />
Die müssen vorrangig verwertet werden und dürfen<br />
nur, wenn sie nicht verwertet werden können, in die<br />
Abfallbeseitung.<br />
(Harry Block [BUND]: Aber nicht in die Müllverbrennung!)<br />
Aber ich möchte das nicht vertiefen. Wir werden es<br />
genauso auswerten wie all das, was hier heute vorgebracht<br />
wurde.<br />
Es ging in der Tat um die Einschätzung: Ist es Verwertung<br />
oder Beseitigung eines Abfalls, wenn ich den in die<br />
Sondermüllverbrennungsanlage zu einem bestimmten<br />
Zweck einbringe? Auch das werden wir uns ganz genau<br />
anschauen, keine Sorge.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Da möchte ich auch auf das Protokoll verweisen. Wir<br />
sollten das Thema, das wir heute Morgen eigentlich<br />
erledigt hatten, nun erledigt lassen. Wir fangen jetzt nicht<br />
mehr die Diskussion um die Verwertung neu an.<br />
(Harry Block [BUND]: Aber eine Klarstellung<br />
müssen Sie schon erlauben!)<br />
– Dann sind wir jetzt aber mit der Klarstellung von beiden<br />
Seiten am Ende.<br />
Ich würde das Thema nun gerne zu Ende bringen. Es<br />
ist aber immer noch die Frage offen - so leid es mir tut;<br />
das wäre aus meiner Sicht aber wirklich dann das Ende -,
warum der HOK nicht ständig zudosiert werden soll. Das<br />
ist die entscheidende Frage der letzten Dreiviertelstunde.<br />
Ich muss jetzt einmal hartnäckig bleiben und sagen<br />
- Entschuldigung -: Die Antwort sollte nun von Lafarge<br />
gegeben werden. Noch einmal: Wir brauchen heute keine<br />
Entscheidung, aber es ist die Zeit für Antworten. - Möchte<br />
Lafarge darauf antworten?<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Noch einmal: Unser Ziel ist, Grenzwerte einzuhalten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Entschuldigung, Herr Weber, lassen Sie mich die Frage<br />
noch einmal formulieren: Wollen Sie zukünftig kontinuierlich<br />
HOK zudosieren? Jetzt reicht mir für das Protokoll ein<br />
Wort.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Nein.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke.<br />
(Harry Block [BUND]: Das Warum wäre<br />
auch interessant!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einen Satz dazu, Herr Weber? – Einen Satz, sodass<br />
es jeder versteht!<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Ziel ist es, gesetzlich vorgegebene Grenzwerte einzuhalten.<br />
(Harry Block [BUND]: Bei Einbruch der<br />
Dunkelheit ist mit Nacht zu rechnen!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einmal: Die Diskussion zu den Grenzwerten ist jetzt<br />
wirklich zu Ende geführt. Wollen Sie noch etwas ergänzen,<br />
Herr Weber? – Okay.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Ist das wirtschaftlich<br />
oder technisch zu begründen?)<br />
– Vielleicht müssen wir es dahin gehend noch einmal<br />
anschauen. – Aber der Herr Bauer meldet sich schon die<br />
ganze Zeit sehr hartnäckig. Dann soll er auch das Wort<br />
bekommen.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich möchte nur kurz an Ihre Homepageauftritte erinnern.<br />
Da steht doch so schön: Sie wollen die Umwelt so wenig<br />
wie möglich belasten. Ich meine, wenn Sie jetzt diese<br />
Filterung im Dauereinsatz hätten, gäbe es doch definitiv<br />
weniger Emissionen. Sie vermitteln also nach außen das<br />
Bild: Ja, wir machen hier auf Umwelt, aber nicht mehr, als<br />
die Grenzwerte erfordern. Das ist das Problem.<br />
Wir wollen nicht, dass die Grenzwerte nur eingehalten<br />
werden, sondern wir wollen so wenig, wie technisch<br />
Seite 77<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
möglich ist, ohne dass es einem das Genick bricht. Wenn<br />
Sie jetzt sagen, es bricht Ihnen das Genick, weil das weiß<br />
Gott wie teuer ist, dann wäre das zumindest eine Aussage,<br />
und man wüsste, woran man ist. Aber so weiß man<br />
nicht, ob Ihnen nicht vielleicht die Gewinnmaximierung das<br />
Wichtigste ist.<br />
Dann heißt es dort weiter zum gesellschaftlichen Engagement,<br />
die ökologischen Belange der Region würden<br />
Sie berücksichtigen. Wir haben hier eine hochgradig<br />
belastete Region. Wie gehen Sie darauf ein?<br />
Dann sprechen Sie weiterhin von der Verringerung der<br />
Emissionen. Sie tun doch nicht das Mögliche, um die<br />
Emissionen zu verringern! Sie zeigen nur schöne Baggerseen<br />
auf.<br />
Sie haben heute Morgen auch erwähnt, dass Sie mit<br />
dem WWF zusammenarbeiten. Ich meine, dass ist ein<br />
Greenwashing-Naturschutzverband, der genügend Probleme<br />
hat, weil er nur Umweltsponsoring macht. Sprich:<br />
Eine Firma, die ökologisch nicht ganz so toll dasteht, zahlt<br />
ein bisschen, und dann darf sie da den Panda abbilden.<br />
Insgesamt treten Sie hier also sehr stark auf und erklären,<br />
Sie würden alles machen. Aber das, was Sie könnten,<br />
tun Sie nicht wirklich.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Auch dazu noch einmal: Die 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung<br />
nennt da einen Grenzwert von<br />
30 µg/Nm³. Wir haben bereits einen Grenzwert, der mit<br />
28 µg/Nm³ darunterliegt. Wir fahren, wie gerade erwähnt,<br />
die Anlage mit Aktivkohleeindüsung automatisiert bei<br />
einem Wert von 25 µg/Nm³. Das heißt, es gibt einen<br />
zusätzlichen Puffer darunter, sodass wir den Grenzwert<br />
auch einhalten.<br />
Wie bereits von Herrn Villano erwähnt, setzen wir auch<br />
viele andere Maßnahmen ein, sodass wir unseren Jahresmittelwert<br />
sogar weit darunter einhalten.<br />
Eine Aktivkohleeindüsung permanent zu fahren bedeutet<br />
auch, permanent Stäube, die dort durch das Material<br />
anfallen, auszuschleusen. Das Ganze müsste auch<br />
anlagentechnisch dann komplett neu überprüft werden.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Frau Kassner.<br />
Gisela Kassner (Einwenderin):<br />
Es gab eine Gemeinderatssitzung, in der das Thema<br />
ebenfalls schon erörtert wurde. Da wurden die Vertreter<br />
von Lafarge auch nach der Eindüsung von Aktivkohle<br />
gefragt, warum sie die nicht kontinuierlich verwenden<br />
wollen. Ich möchte die Herren nur an die Antwort erinnern<br />
- ich weiß nicht, ob es Herr Weber oder Herr Villano war -:<br />
Dann hätten wir das Problem mit den Filtern.
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Daran kann ich mich jetzt nicht so entsinnen, auch nicht<br />
vom Wording her.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Weber, das ist für uns relativ schwierig zuzuordnen.<br />
Ich gucke jetzt auf die Tagesordnung und meine, wir<br />
haben schon sehr lange über Emissionen diskutiert. Aus<br />
meiner Sicht sind noch folgende Punkte offen: die Filtertechnik,<br />
der Immissionsstundenwert für SO2, die Kaminhöhe<br />
und die Bodenwerte bzw. Critical Loads.<br />
Wenn die Einwender das jetzt ebenso sehen, würde<br />
ich vorschlagen, zehn Minuten Pause zu machen, uns<br />
dann diesen vier Punkten zu dem Thema Emission/Immission<br />
Luft in frischer Stärke neu zuzuwenden und<br />
die anderen als diskutiert zu betrachten. Einverstanden?<br />
- Ich nehme das jetzt einmal als Ja. Zehn Minuten Pause!<br />
(Unterbrechung von 17:08 bis 17:20 Uhr)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Meine Damen und Herren, ich bitte, wieder Platz zu<br />
nehmen. Wir fahren in den Verhandlungen fort.<br />
Ich greife jetzt den Vorschlag und die Bitte von Herrn<br />
Block auf, dass die anwesenden Bürger – nicht die Einwender<br />
– die Gelegenheit bekommen, die eine oder<br />
andere Frage zu stellen, wenn sie möchten. Das ist nur<br />
ein Service von uns. Die Beiträge müssen nicht zwingend<br />
im Detail von uns erörtert werden. Aber wir würden sie –<br />
das ist auch mit Lafarge so kommuniziert – hier in den<br />
Raum stellen, und Lafarge würde das durchaus dann als<br />
Botschaft mitnehmen.<br />
Deswegen gucke ich jetzt einmal in die hinteren Reihen<br />
zu den Bürgerinnen und Bürgern hier aus Wössingen,<br />
Walzbachtal oder auch aus Dürrenbüchig. Gibt es irgendwelche<br />
Fragen und Anregungen? – Gerne.<br />
Karin Herlan:<br />
Mein Name ist Karin Herlan, ich komme aus Wössingen,<br />
bin gebürtige Wössingerin und mit diesem Zementwerk<br />
aufgewachsen.<br />
Ich war vorhin erschrocken, als Sie, Frau Schmid-<br />
Adelmann, auf die Frage von Frau Aberle geantwortet<br />
haben, dass Quecksilber in der Form, wie es jetzt vorkommt,<br />
für Kinder nicht beängstigend wäre und für Erwachsene<br />
auch nicht.<br />
Quecksilber baut sich im Körper ja nicht ab. Wir leben<br />
hier in Wössingen jahrelang, möchten hier vielleicht auch<br />
sterben. Was sind das denn für Zukunftsaussichten, wenn<br />
Sie so eine Aussage machen?<br />
Ich möchte einfach wissen, ob es Langzeitstudien gibt,<br />
wie die Auswirkungen von Quecksilber im Körper sind, wo<br />
es ja nicht abgebaut wird. Ich denke, die ganze Fragerei<br />
und die ganze Diskutiererei heute sind umsonst. Denn<br />
dann wird ganz klar, dass Lafarge etwas unternehmen<br />
muss und diese Aktivkohlefilter einbauen muss.<br />
Seite 78<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Noch ein Zweites: Sie wollen jetzt Dachpappe als Zusatzstoff<br />
nehmen. Dazu möchte ich nur wissen: Wird das<br />
ebenso wie Fluff in einem Ihrer Werke aufbereitet, oder<br />
bekommen Sie das von außen?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank. – Ich habe es vorhin schon gesagt, wir<br />
können nicht alles im Detail beantworten. Aber ich möchte<br />
Lafarge fragen, ob Sie als Service eine kurze Antwort<br />
darauf geben wollen. Das Gleiche würde ich in Richtung<br />
Landratsamt fragen. Das muss nicht beantwortet werden.<br />
Aber wenn das möglich ist, wäre es nett.<br />
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Es gibt sehr viele Untersuchungen zum Quecksilber. Die<br />
Datenlage zum Quecksilber ist ausgezeichnet, und man<br />
weiß auch, innerhalb welcher Zeit Quecksilberbelastungen<br />
im Körper wieder ausgeschieden werden, sowohl über<br />
Stuhlgang als auch über Urin.<br />
Es stimmt nicht, dass sich Quecksilber im Körper anreichert<br />
und den Körper nicht wieder verlässt. Das gilt<br />
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.<br />
Der Punkt, den die Wissenschaftler im Zusammenhang<br />
mit Quecksilber als besonders relevant erkannt<br />
haben, ist weniger die Aufnahme durch die Inhalation als<br />
vielmehr die Aufnahme mit der Nahrung. Darüber muss<br />
man sich heutzutage wirklich Gedanken machen, insbesondere<br />
was den Fischverzehr angeht. Es gibt entsprechende<br />
Studien, dass man über Seefisch verhältnismäßig<br />
viel Quecksilber aufnehmen kann, das dann allerdings<br />
wieder ausgeschieden wird.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank. – Herr Villano? Herr Weber?<br />
Enrico Fischer (Antragstellerin):<br />
Zum zweiten Teil der Frage werde ich ganz kurz antworten.<br />
Die Frage war, woher die Dachpappe in Zukunft<br />
kommt. Aktuell ist geplant, dieses aufbereitete Material<br />
von einem Aufbereiter in der Nähe von Stuttgart entgegenzunehmen.<br />
Ich hatte es heute früh, glaube ich, schon<br />
einmal erwähnt. – Reicht das?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen und Anregungen?<br />
- Bitte.<br />
Sandra Doll:<br />
Ich bin Sandra Doll und wohne ebenfalls in Walzbachtal-<br />
Wössingen.<br />
Es geht hier wirklich nur um Geld – nicht um den Menschen<br />
und nicht um die Gesundheit. Sonst müssten wir<br />
hier gar nicht stehen. Mensch und Gesundheit sind für<br />
mich das Allerwichtigste. Wenn das für alle so wäre,<br />
müssten wir hier nicht über Altreifen, über Tiermehl, über<br />
Dachpappe oder über Ausreißer sprechen. Wir müssten<br />
auch nicht entscheiden, ob wir entsorgende Verwertung<br />
oder verwertende Entsorgung betreiben. Das ist der
Hauptpunkt, wie ich finde: Menschen sind am Allerwichtigsten.<br />
Was würde passieren, wenn Sie diese Aktivkohlefilter<br />
die ganze Zeit benutzen würden? Wären dann diese Filter<br />
Sondermüll? Müssten Sie die entsorgen? Wäre das sehr<br />
teuer?<br />
Sie sollten noch einmal darüber nachdenken, ob Ihnen<br />
nicht der Schutz der Gesundheit der Menschen ein bisschen<br />
mehr Geldausgabe wert wäre.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Vielen Dank, Frau Doll. Ich gehe jetzt davon aus, dass<br />
Lafarge dazu nichts weiter sagt, sondern Ihre Anmerkungen<br />
mitnimmt und überdenkt. Gibt es sonstige Fragen<br />
oder Anregungen? – Wenn nicht, würden wir in der<br />
Erörterung fortverfahren.<br />
Zur Erinnerung: Wir hatten vor der Pause festgestellt,<br />
das noch vier Themen offen sind – ich hoffe, dass da noch<br />
Konsens besteht –: Filtertechnik, Immissionsstundenwert<br />
von SO2, Kaminhöhe und Bodenwerte im Umkreis/Critical<br />
Loads.<br />
(Andreas Bauer [EW] meldet sich zu Wort.)<br />
– Herr Bauer, habe ich etwas vergessen?<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Jein – oder ja. Ich durfte jetzt in der Pause die Tagesmessungen<br />
kurz anschauen. Leider lagen sie aber für 2011<br />
nicht vor.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Also von Quecksilber – um das zu konkretisieren.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ja, Quecksilbermessungen, genau. – Ich weiß jetzt nicht,<br />
warum man sie nicht zeigen konnte oder durfte.<br />
Ich verstehe das alles nicht so ganz. Herr Villano hat<br />
mir erklärt, dass die ganze Zeit sowieso nur mit 80 %<br />
gefahren wird. Sprich: Wie sich das bei 100 % auswirkt,<br />
muss die Zukunft erst zeigen bzw. das ist entsprechend<br />
berechnet worden.<br />
Aber eindeutig zu sehen ist natürlich, dass die Quecksilberdosis<br />
erheblich schwankt. In meinen Augen pendelte<br />
sie sich nach dem Wiederanfahren 2012 eher weiter oben<br />
ein als möglicherweise im Jahr davor. Es wurde gesagt,<br />
dass das immer so sei, wenn die Anlage heruntergefahren<br />
wird. Aber einen Beleg für 2011 gab es eben nicht. Ich<br />
denke, es wäre interessant gewesen, die Folie allen zu<br />
zeigen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich kann Ihnen hier zusichern, dass wir uns die Daten<br />
noch einmal angucken. Warum sie heute nicht da waren,<br />
können wir nicht sagen.<br />
Seite 79<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
(Andreas Bauer [EW]: Sie sind ja da!)<br />
– Genau, sie sind da.<br />
(Andreas Bauer [EW]: Sie sind auf dem<br />
Rechner! Ich habe sie gesehen! – Gudrun<br />
Vangermain [BUND]: Sie wurden uns für<br />
nach dem Kaffee versprochen! Ich würde<br />
sie gerne sehen!)<br />
– Herr Villano hat gesagt: Er prüft, was in der Pause<br />
möglich ist. Ich habe das so verstanden, dass die Daten<br />
da sind, aber nicht darstellbar sind. 2012 ist da, 2011 ist<br />
nicht da, heißt es.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Aber vorhin<br />
stand doch „2011“ darauf! – Tino Villano<br />
[AS]: Das war der Emissionsbericht!)<br />
– Nein. Das vorhin war ein Emissionsmessbericht. Das ist<br />
quasi eine Jahresauswertung; da gibt es einen Jahresmittelwert.<br />
Das, was wir eigentlich wollten, sind die kontinuierlichen<br />
Messdaten, die Sie dann quasi in Form einer<br />
Ganglinie gesehen hätten.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Die hat er mir ja gezeigt. Ich weiß nicht, warum er die jetzt<br />
nicht an die Wand werfen kann. Er hat sie ja auf dem<br />
Rechner.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ja, wenn das hilfreich ist. Das geht doch – oder, Herr<br />
Villano?<br />
(Tino Villano [AS]: Es war die Anforderung<br />
2011/2012; wir haben nur 2012!)<br />
– Wenn nur 2012 da ist, kann man doch die Gelegenheit<br />
nutzen, 2012 an die Wand zu werfen, denke ich. Dann<br />
wird zumindest deutlich, dass die Daten vorhanden sind.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
(Schaubild: Tagesmittelwertverteilung: Hg-<br />
Emissionen Ofen – Anlage 8, S. 137)<br />
Sie sehen hier die Quecksilberemissionen aus dem<br />
Jahr 2012. Sie sehen auch die Stellen, wo der Messwert<br />
auf der x-Achse auf Null heruntergeht. Das sind die<br />
Zeiträume, in denen der Ofen zu Revisionszwecken,<br />
aufgrund eines ungeplanten Ofenstillstands oder zu<br />
Reparaturzwecken mindestens einen ganzen Tag lang<br />
stand.<br />
Sie sehen hier auch: Vor dem großen Winterstillstand<br />
im Februar ist der Wert der Quecksilberemission etwas<br />
niedriger als danach. Das ist dadurch bedingt, dass wir vor<br />
der Großrevision naturgemäß immer wieder Anlagenausfälle<br />
haben, was dazu führt, dass wir den Ofenbetrieb<br />
stundenweise für Reparaturarbeiten stoppen müssen.<br />
Dann haben wir natürlich eine geringere Tagesemission,<br />
weil der Ofen nicht den ganzen Tag über betrieben wurde.<br />
Nach dem Ofenstillstand wird entsprechend wieder<br />
angefahren. Sie sehen auch, dass wir ab Juni 2012 einen
Zielwert von 25 µg/Nm³ stabil einhalten und oftmals auch<br />
unterschreiten. Das ist diese Zielvorgabe bezüglich der<br />
HOK-Eindüsung. Das heißt, wir haben da einen entsprechenden<br />
Abstand zum Grenzwert.<br />
Der Grenzwert ist hier als rote Linie dargestellt. Die<br />
rote Linie sind die 28 µg/Nm³ oder 0,028 mg/Nm³. Der<br />
Grenzwert nach der 17. BImSchV sind die 0,03 mg/Nm³.<br />
Das heißt, wir haben hier einen niedrigeren Grenzwert als<br />
die 17. BImSchV. Aufgrund von Dynamisierungen, auch<br />
weil wir in der Vergangenheit keine Vorbelastungsmessungen<br />
gemacht haben, ist dieser Wert aus der Historie<br />
entstanden. Durch die Qualitätssicherungsmaßnahmen,<br />
die wir hier anwenden, halten wir den Grenzwert entsprechend<br />
sicher ein.<br />
– Nein.<br />
(Harry Block [BUND]: Und das sind 100 %?)<br />
(Harry Block [BUND]: Das sind 80 %?)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, es gibt wohl einen Antrag auf 100 %, aber es<br />
gibt noch keinen Betrieb mit 100 %.<br />
(Gudrun Vangermain [BUND]: Bei wie viel<br />
Prozent ist das?)<br />
Harry Block (BUND):<br />
Bekommen Sie in Deutschland irgendetwas genehmigt,<br />
wenn Sie nicht nachweisen können, dass die Anlage das,<br />
was Sie behaupten, auch kann? Derjenige, der etwas<br />
beantragt, muss doch zeigen können, dass das geht. Der<br />
muss doch zeigen können, dass das irgendwo möglich ist.<br />
Sie können doch nicht eine Genehmigung geben und<br />
einfach sagen: Mit 80 % habt ihr es probiert; da hat es<br />
geklappt.<br />
Ich denke, dass das HOK dabei war. Das sind ja Tagesmittelwerte;<br />
das ist schon ein Durchschnittswert. Das<br />
heißt, da werden auch ein paar Ereignisse dabei sein, die<br />
näher an 0,03 oder an 0,028 mg/Nm³ sind. Das sind<br />
Mittelwerte, das besagt wieder nichts.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das sind Tagesmittelwerte.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ja gut, das ist schon ziemlich gerundet. Frage: Bei 100 %<br />
wären Sie da schon nah dran, oder? – Ich sage jetzt der<br />
Behörde: Da ist man ziemlich nah dran.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einmal: Ich habe Ihnen nur sagen wollen, dass der<br />
Antrag auf 100 % lautet und dass diese realen Daten aus<br />
dem Jahr 2012 nicht auf der Grundlage von 100 % Ersatzbrennstoff<br />
sein können. Denn das ist noch nicht<br />
genehmigt. Sonst würden wir heute hier nicht sitzen.<br />
(Harry Block [BUND]: 80 % sind auch nicht<br />
genehmigt!)<br />
Seite 80<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Der Nachweis, dass dieser Versuch mit den 100 % funktioniert,<br />
ist im Rahmen des Antrags nach Aussage und<br />
Meinung von Lafarge geführt. Deswegen sitzen wir heute<br />
hier, um die Aspekte, die möglicherweise noch fehlen, zu<br />
beleuchten.<br />
Gibt es noch Fragen zu dieser Tagesmittelwertverteilung?<br />
– Ja, gerne.<br />
Gudrun Vangermain (BUND):<br />
Wir bekommen jetzt diese 60 % nicht zu sehen, weil Sie<br />
sie nicht dabei haben, sagen Sie. Dieses Bild zeigt die<br />
80 %, richtig?<br />
(Tino Villano [AS] nickt.)<br />
Zum Quecksilber habe ich noch eine Frage an Frau<br />
Schmid-Adelmann. Sie sagten eben, dass sich Quecksilber<br />
im Körper nicht anreichert. Problematisch sei nicht der<br />
Luftweg, sondern die Nahrungskette – siehe Fisch. Fisch<br />
ist doch auch ein Körper, oder?<br />
(Harry Block [BUND]: Sie beziehen sich<br />
doch auf Japan, auf diese Beriberi-<br />
Krankheit von den Japanern, oder?)<br />
Friederike Schmid-Adelmann (LRA Karlsruhe):<br />
Ich beziehe mich auf Untersuchungen, die auch die<br />
deutschen Verhältnisse wiedergeben. Wenn viel Fisch<br />
gegessen wird, kann man den PTWI-Wert durchaus auch<br />
in Deutschland überschreiten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Bauer noch einmal zum Thema Quecksilber.<br />
Andreas Bauer (Einwender):<br />
Ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich sehe dort, dass die<br />
Werte im Mai für ein, zwei Wochen ziemlich nah am<br />
Grenzwert lagen, und das sind Mittelwerte. Wie oft sind<br />
Sie dann tatsächlich darüber? Mittelwert kann ja heißen,<br />
dass Sie vielleicht fünf Stunden deutlich darüber sind,<br />
zehn Stunden halt darunter. Dann sind Sie im Mittel knapp<br />
unter dem Grenzwert. Wie lange sind Sie denn darüber?<br />
Sagen wir es einmal so herum.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Villano.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ich hatte eben den Emissionsbericht 2011 gezeigt und<br />
darauf hingewiesen, dass wir insgesamt 17 Halbstundenwertüberschreitungen<br />
für Quecksilber im Jahr 2011<br />
hatten. Das heißt, wir haben hier entsprechende Überschreitungen<br />
des Halbstundenwertes gehabt.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Nur ganz kurz noch einmal als Information: Der Grenzwert<br />
für das Tagesmittel sind die 28 µg/Nm³, also die 0,028<br />
mg/Nm³. Der Wert wurde mit einer Ausnahme nicht<br />
überschritten. Man muss immer sehen, von welchem<br />
Grenzwert man spricht. Also, die 0,028 passen zu den
Tagesmittelwerten. Die 0,028 stehen als Tagesmittelwert<br />
so in unserer Genehmigung.<br />
Deswegen ist die Fragestellung, wie viele Stunden<br />
dieser Tagesmittelwert überschritten war, eine falsche.<br />
Der Halbstundenmittelwert ist eine andere Größe und hat<br />
einen anderen Anforderungswert.<br />
Mir geht es jetzt nur um die Information. Es ist immer<br />
genau zu beachten, von welchem Grenzwert, von welcher<br />
Einheit, von welcher Größe man spricht. Das nur als<br />
Information von unserer Seite. – Okay, Herr Bauer? – Gut.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Zusatzfrage: Wie lange wurde HOK zugegeben? An wie<br />
vielen Tagen, Stunden – was weiß ich?<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Die Eindüsung erfolgt automatisch; wir haben hier einen<br />
Automatismus hinterlegt. Das heißt, es dreht niemand<br />
einen Hahn auf, wenn er meint, das tun zu müssen,<br />
sondern das Ganze ist auf die Zielgröße 25 µg/Nm³<br />
automatisiert. Wenn diese 25 µg/Nm³ erreicht werden,<br />
wird für wenige Minuten, maximal ein, zwei Stunden<br />
Herdofenkoks entsprechend eingedüst, um den Grenzwert<br />
wieder zu erreichen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Villano. – Herr Klawe.<br />
Hans-Jürgen Klawe (Einwender):<br />
Ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema, das uns toll<br />
interessieren muss. Ich denke, diese Kurve zeigt doch,<br />
dass man sich sehr nah an den Grenzwert heranbewegt.<br />
Das bedeutet – ich spekuliere einmal -, dass man, wenn<br />
100 % Ersatzbrennstoff eingesetzt wird, im gleichen<br />
Bereich bleibt, weil dann bei einer höheren Emission<br />
etwas mehr Aktivkohle eingedüst wird. Da wird einfach der<br />
Aktivkohleverbrauch steigen. Aber das ist jetzt nicht das<br />
Thema, das wir hier im Fokus haben.<br />
Wir haben gesagt, dass uns dieses Fahren dicht am<br />
Grenzwert eigentlich zu wenig ist. Ich möchte, dass das<br />
Quecksilber kontinuierlich herausgefiltert wird und dass<br />
wir einen sehr viel niedrigeren Emissionswert haben.<br />
(Vereinzelt Beifall bei den Einwenderinnen<br />
und Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Klawe, dass Sie das noch einmal verdeutlicht<br />
haben.<br />
Ich möchte jetzt meinen Versuch von vorhin wiederholen<br />
und sagen: Wir haben vier Punkte aus dem Block<br />
Emission/Immission Luft übrig: Filtertechnik, Immissionsstundenwert<br />
von SO2, Kaminhöhe und die Bodenwerte,<br />
Critical Loads. Ich würde gerne versuchen, wenn Sie<br />
damit einverstanden sind, das in dieser Reihenfolge mit<br />
Ihnen zusammen abzuarbeiten.<br />
Ich will anfangen mit dem Thema<br />
Seite 81<br />
Filtertechnik/Betriebsstörungen,<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
das vorhin schon einmal angesprochen worden war.<br />
Damit meine ich jetzt nicht noch einmal die Diskussion<br />
über HOK, sondern die Diskussion über die anderen<br />
vorhandenen Filter, die eingesetzt werden. Gibt es da<br />
noch Fragen oder Themen, die zu erörtern sind?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Stickoxide. Bei Stickoxiden wollen Sie einen Grenzwert<br />
von 320 mg. Für ein Zementwerk ist das verständlich,<br />
aber für eine Müllverbrennungsanlage ist das unverständlich,<br />
und im Hinblick auf meine Forderung von Gas ist das<br />
total unverständlich.<br />
Ich möchte gerne wissen: Wann erreichen Sie den<br />
Zielwert von 200 mg, der von Ihren eigenen Gutachtern<br />
gefordert wird? Nehmen wir einmal an, Sie genehmigen<br />
320 mg – was ich nicht hoffe, Herr Haller – und schreiben<br />
den Zielwert mit hinein: Wann erreichen Sie diesen<br />
Zielwert? Was machen Sie dann? Sie brauchen dann eine<br />
neue SNCR-Anlage oder etwas anderes.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Weber.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Die 320 mg NOx als Grenzwert und 200 mg als Zielwert<br />
sind damit zu begründen, dass die Anlage konzeptionell<br />
dafür vorgesehen ist, 200 mg bei 100 % Sekundärbrennstoffraten<br />
zu fahren.<br />
Wie wir das erreichen, wissen wir aber noch nicht. Wir<br />
haben noch keine Erfahrungen damit, da wir nur eine<br />
Testgenehmigung von bis zu 80 % Sekundärbrennstoffe<br />
haben. Da wir allerdings zeigen konnten, dass wir mit<br />
dieser höheren Sekundärbrennstoffrate einen niedrigeren<br />
Grenzwert als 350 mg erreichen können, haben wir einen<br />
Grenzwert von 320 mg beantragt mit dem Ziel, möglichst<br />
schnell zu erfahren und zu lernen, auch die 200 mg zu<br />
erreichen.<br />
Es wird, ich glaube, zum 1. Januar 2019 die novellierte<br />
17. Bundesimmissionsschutzverordnung greifen. Spätestens<br />
bis dahin muss der 200-mg-Grenzwert eingehalten<br />
werden. Unser Ziel ist es, möglichst schnell zu lernen, mit<br />
der SNCR-Anlage die 200 mg zu fahren. Diese muss<br />
dafür nicht neu gebaut werden, wie Sie sagen, aber sie<br />
muss optimiert werden. Wenn es wirklich erforderlich ist,<br />
müssen wir gegebenenfalls auf eine Technologie umrüsten,<br />
die 200 mg permanent gewährleistet, damit die<br />
novellierte 17. Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten<br />
werden kann.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Weber. – Herr Block, eine Nachfrage?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich würde es als nachhaltig bezeichnen, wenn Sie das bei<br />
dieser Umstellung sofort tun. Entweder kann die SNCR-<br />
Anlage das – der Hersteller muss Ihnen ja nachweisen,
dass die Anlage das kann für das, was Sie hier verbrennen<br />
–, oder Sie probieren noch fünf Jahre herum, bis der<br />
Grenzwert kommt. Ich denke: Entweder kann sie es, oder<br />
sie kann es nicht. Kann die Anlage es nicht, dann bauen<br />
Sie eine neue! Denn 320 mg, das ist ein Unding!<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Dr. Oerter.<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Herr Block, in der Tat ist das derzeit eine Herausforderung<br />
für die gesamte deutsche Zementindustrie. Ab dem<br />
1. Januar 2019 soll ein Emissionsgrenzwert flür NOx von<br />
200 mg/m 3 tatsächlich verbindlich gelten, und zwar gleichzeitig<br />
mit einer Vorgabe – das ist wirklich ein Novum, das<br />
es bisher auch im europäischen Umweltrecht nicht gibt –<br />
für eine Limitierung der Ammoniakemissionen.<br />
Das ist in der Tat im Moment eine Frage des Standes<br />
der Technik, mit der die gesamte deutsche Zementindustrie<br />
beschäftigt ist. Deswegen gibt es auch in Absprache<br />
mit den Umweltbehörden diese verlängerte Übergangsfrist<br />
für die 17. BImSchV. Da muss die ganze Industrie ihre<br />
Hausaufgaben machen. Das betrifft auch den Standort<br />
Wössingen.<br />
Es geht nicht darum, ob die SNCR-Anlage 200 mg/m³<br />
packt - um das einmal sehr linear zu sagen -, sondern es<br />
geht darum, das Ganze gleichzeitig mit einer Minimierung<br />
des Ammoniakschlupfes betreiben zu können. Das ist der<br />
Hintergrund.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Störfall, Herr Schilling! Beim SNCR geht es um Ammoniak.<br />
Wie viel Ammoniak lagern Sie? Wie lagern Sie es bei<br />
dem SNCR-Filter? Wahrscheinlich nehmen Sie nicht<br />
reines Ammoniak, sondern Sie nehmen eine Verdünnung.<br />
Aber Sie haben gerade in den Vereinigen Staaten gesehen,<br />
was mit Ammoniak passieren kann: Da sprengt es<br />
einen ganz Ort weg. Wie viel haben Sie für diese SNCR-<br />
Anlage? Wie hoch ist die Ammoniakkonzentration in der<br />
SNCR-Anlage? Wir haben letzte Woche zufällig eine<br />
Anlage besichtigt. Wir kennen die Daten und wissen, was<br />
ab einer gewissen Größenordnung passiert.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Noch einmal zur Konkretisierung: Geht es Ihnen um eine<br />
mögliche Ammoniaklagerung?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Beides: Einerseits geht es mir darum, wie viel Sie einsetzen,<br />
um die SNCR-Anlage für 200 mg zu optimieren.<br />
Denn dann brauchen Sie mehr. Da frage ich nach der<br />
Lagerung. Vorhin wurde das schon mit Blick auf die<br />
Feuerwehr gefragt.<br />
Seite 82<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Andereseits frage ich im Hinblick auf einen Störfall,<br />
Herr Schilling. Wenn Ammoniak explodiert, ist das ein<br />
Störfall. Das ist dann keine Betriebsstörung.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wir bekommen das relativ schnell ausgeräumt, wenn<br />
nämlich Lafarge etwas dazu sagt, was sie wirklich tun.<br />
(Harry Block [BUND]: Wie viel Prozent Ammoniak<br />
sind es?)<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Bei unserer SNCR-Anlage handelt es sich um zwei<br />
Tankanlagen, die jeweils etwa 100 m 3 Fassungsvermögen<br />
für Harnstofflösung haben. Das ist eine 20-prozentige<br />
Harnstofflösung. Dass dabei irgendetwas Explosives<br />
entsteht, schließen wir aus. Es handelt sich hier um eine<br />
VAwS-Anlage, die letztendlich entsprechend konzipiert<br />
wurde.<br />
Die Harnstofflösung wird zur Reduzierung von NOX in<br />
der Anlage in ein bestimmtes Temperaturfenster eingedüst.<br />
Dieses Temperaturfenster bei der Eindüsung gilt es<br />
entsprechend zu optimieren, und zwar so, dass gleichzeitig<br />
der Ammoniakschlupf optimiert wird, der entsteht, wenn<br />
ich zu viel Harnstofflösung eindüse. Das ist die Herausforderung.<br />
Einfach nur einzudüsen, um auf 200 mg zu<br />
kommen, ist das eine. Aber gleichzeitig muss man den<br />
Ammoniakschlupf optimieren, dass dieser Grenzwert nicht<br />
überschritten wird.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Villano. – Herr Block, wäre damit für Sie das<br />
Thema SNCR, NOX- und Ammoniakemissionen erledigt?<br />
Für uns ist das ein ganz relevantes Thema.<br />
Ich muss dem Herrn Dr. Oerter leider noch sagen<br />
- Lafarge weiß es schon -: Wir sind hier nicht nur in<br />
Deutschland, sondern wir sind auch in <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong>, und hier im Land gibt es ambitionierte Ziele,<br />
was die NOX-Emissionen angeht. Das Jahr 2019 ist da<br />
sehr weit weg.<br />
(Harry Block [BUND]: Sagte der Herr Minister!)<br />
- Sehen Sie, wie gut wir das machen! – Ich denke, wir<br />
haben das Thema NOX damit ebenfalls erledigt.<br />
Vorhin kam das Thema mit den Wäschen und der Filtertechnik.<br />
Da wollte ich noch einmal speziell nachfragen:<br />
Herr Futterer, ist das erledigt? – Nein? Dann kommen wir<br />
jetzt noch einmal zu diesem Thema.<br />
Michael Futterer (Einwender):<br />
Das betrifft eigentlich das Gleiche, was Herr Klawe vorher<br />
schon gesagt hat. Wir haben uns innerhalb des grünen<br />
Ortsverbandes über dieses Thema unterhalten. Deswegen<br />
kamen dazu einige Einwendungen, die in ähnliche Richtungen<br />
gegangen sind.<br />
Es wurde gefordert, dass man hier einen Permanentfilter<br />
einbaut. Es wurde in der Gemeinderatssitzung auch
gesagt – das hat die Kollegin vorhin schon angesprochen<br />
-: Wenn man Permanentfilter einbaut, wird das<br />
Quecksilber dort entsprechend gebunden. Das Quecksilber<br />
müsste dann mit dem Filter irgendwie entsorgt werden.<br />
Wir hatten im Nachgang besprochen: Das hilft uns<br />
nicht weiter. Das wäre genauso, als ob man bei der<br />
Atomendlagerung sagen würde: Wir verteilen alles über<br />
das ganze Land, dann haben wir kein Problem mehr,<br />
anstatt es irgendwo endzulagern. – Ist das verständlich?<br />
Wir möchten damit sagen: Wir wollen im Prinzip nicht,<br />
dass dieses Quecksilber aus diesem Zementwerk herausgeht,<br />
sondern wirklich in einem Filter gebunden wird und<br />
dann irgendwo hingeht. Das ist nach meinem Wissensstand<br />
technisch auch möglich. Deshalb ist das eine<br />
zentrale Forderung von uns.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Futterer. Wir haben das vorhin schon mehrfach<br />
diskutiert, und ich würde es einfach dabei bewenden<br />
lassen wollen. Denn andere Punkte sind noch offen, die<br />
wir noch gar nicht angesprochen haben, also Immissionsstundenwert<br />
von SO2, Kaminhöhe und Bodenwerte.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Noch zur Filtertechnik: Auch die Feinstaubabscheidung<br />
scheint mir noch nicht ganz optimal zu sein. Ich denke, Sie<br />
haben einen Gewebefilter. Es ist sicherlich ein Gewebefilter<br />
mit dieser Ausschlagtechnik, dass Sie das abschütteln<br />
und ihn mehrfach wiederverwenden können. Wie oft<br />
machen Sie das im Ofen selbst? Hat diese Filterreinigung<br />
Auswirkungen auf das Produkt?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Weber.<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Der Schlauchfilter wird über Differenzdruck betrieben.<br />
Dabei wird der Druck am Eingang und Ausgang des<br />
Filters gemessen. Der Differenzdruck löst automatisch die<br />
Reinigungszyklen aus, sprich: Es ist eine Druckluftauslösung.<br />
Nach Empfehlungen des Herstellers muss sich zunächst<br />
ein Filterkuchen – so nennt sich das – auf diesen<br />
Filtersäcken bilden. Das heißt, ein gewisser Mindestdifferenzdruck<br />
ist zu fahren. Es sollte aber nicht die maximale<br />
Druckdifferenz erreicht werden, um die Langlebigkeit der<br />
Schläuche und die Abscheidewirkung zu gewährleisten.<br />
Ich kenne die genauen Daten nicht auswendig; ich<br />
müsste sie nachschauen. Aber ich glaube, die Anlage wird<br />
mit 6 bis 8 Millibar betrieben. Das wird automatisch<br />
kontrolliert. Das Produkt geht direkt wieder in den Prozess<br />
hinein und wird somit vollständig im Klinkerprodukt, dem<br />
Zement, eingebunden.<br />
Seite 83<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Harry Block (BUND):<br />
Genau das meine ich. Wie viel von den Schadstoffen<br />
befindet sich dann im Klinker? Das war die Frage, die wir<br />
heute Morgen schon einmal gehabt haben. Ich hatte Ihnen<br />
bereits gesagt: Das Produkt wird schlechter. – Wie viel<br />
schlechter, ist egal. Aber das ist auf jeden Fall so.<br />
Auf wie viel Prozent schätzen Sie den Anteil der Stäube,<br />
die nicht über die Filteranlage herauskommen, sondern<br />
durch die Gewebefilter wieder ins Produkt eingebracht<br />
werden? Wie hoch schätzen Sie diesen Anteil im<br />
Vergleich zu der Emission über den Kamin?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Kann Lafarge das abschätzen?<br />
Lutz Weber (Antragstellerin):<br />
Wir reden hier über einen kleinen Teil zwischen 1 und<br />
2 %.<br />
(Harry Block [BUND]: Gut!)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Damit wäre auch das Thema Filtertechnik behandelt. –<br />
Wir kommen dann zu dem Punkt<br />
Immissionsstundenwert von SO2.<br />
Wenn es allerdings keinen Bedarf an einer Erörterung<br />
dieses Punktes gibt, können wir ihn auch ohne Erörterung<br />
so stehen lassen. Die Einwendung kam vom BUND.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Schwefeldioxid ist natürlich ein Problem; das weiß jeder.<br />
Ich weiß allerdings nicht, wie man in diesem speziellen<br />
Fall darangeht; da muss ich eigentlich passen.<br />
Da muss ich hoffen, dass Sie uns erklären, wie die<br />
Problematik von SO2 – Schwefel ist eine Problematik,<br />
allerdings keine Kernproblematik – in dem Zementwerk zu<br />
minimieren ist. Das wird wohl nur über die Eingangsstoffe<br />
gehen. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, wo überall<br />
Schwefel drin ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie<br />
haben vorhin die Tabelle gesehen: Schwefel ist überall<br />
drin, z. B. auch in Altreifen. Aber ich weiß nicht, wie sich<br />
das im Prozess oder in den Produkten auswirkt.<br />
Sie wollen da den Grenzwert von 150 mg, in der<br />
17. BImSchV sind es 50 mg. Ich denke, es ist klar: Sie<br />
dürfen nicht mehr als 50 haben. Ich will jetzt nicht wieder<br />
auf die 13 gehen, die möglich sind, sondern von mir aus<br />
können es 50 sein. Ich weiß, bei SO2 ist das problematisch.<br />
Aber die 50 müssen Sie erreichen. Wie, weiß ich<br />
nicht; das kann ich Ihnen nicht sagen. Die 17. BImSchV<br />
sagt 50. Deswegen sagen auch wir: 50.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, wir erörtern diesen Punkt hier nicht weiter. Wir<br />
werden das mitnehmen und im Rahmen der Abwägung<br />
und Bewertung weiter verfolgen. Ich denke, das reicht an<br />
dieser Stelle.
Wir kommen zum Thema<br />
Kaminhöhe,<br />
wozu Sie und der BUND ebenfalls ausführlich Stellung<br />
genommen haben. Wollen Sie dazu noch etwas sagen?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ich habe die Zahlen jetzt nicht. Wie hoch ist der Kamin?<br />
108 m?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ja, 108 m.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Die TA Luft nennt für Zementwerke einen Grenzwert von,<br />
ich glaube, 950.000 t. Da hatten wir ausgerechnet: Das<br />
entspricht etwa einer Höhe von 96 m. 96 zu 108 m ergibt<br />
einen Unterschied von 12 m. Das heißt, es erfolgt in 12 m<br />
eine Verdünnung der Emission. Wir konnten weder in den<br />
Unterlagen vom TÜV noch in der Bewertung von der<br />
DEKRA irgendetwas dazu finden, dass auf der Grundlage<br />
dieses Wertes gerechnet wird.<br />
Gerechnet werden muss mit der von der TA Luft vorgeschriebene<br />
Kaminhöhe – nicht mit der wirklichen Höhe;<br />
die ist uninteressant. Denn eine Verdünnung durch Luft ist<br />
nicht erlaubt.<br />
Also sagen wir: Sie berechnen die Belastung, die Immission<br />
in Dürrenbüchig etc. auf den Wert 96 m neu. Das<br />
ist der Wert, den die TA Luft vorschreibt. Danach müssen<br />
alle Berechnungen gemacht werden. Die fand ich nicht. –<br />
Die haben Sie jetzt aber dabei, ja?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Ich gebe das Wort an Lafarge. Die Frage ist nur: an wen?<br />
– An Herrn Dr. Oerter?<br />
Dr.-Ing. Martin Oerter (Antragstellerin):<br />
Ich versuche es einmal als derjenige, der am wenigsten<br />
mitgerechnet hat. Ich habe die Anlage nur in Augenschein<br />
genommen.<br />
Punkt 1: Die Regelung, dass ich nicht mit der Ist-Höhe<br />
rechnen darf, sondern gemäß TA Luft nur mit der entsprechenden<br />
Mindesthöhe, kenne ich so nicht – um das ganz<br />
klar zu sagen.<br />
(Harry Block [BUND]: Sie haben unsere<br />
Einwendung gelesen?)<br />
– Ihre Einwendung habe ich gelesen, natürlich.<br />
(Weiterer Zuruf von Harry Block [BUND])<br />
Ich habe eben gesagt – da bitte ich um Nachsicht –:<br />
Sowohl die Ausbreitungsrechnung als auch die entsprechende<br />
Prognose ist von jemand anderem gemacht<br />
worden, der heute aus Krankheitsgründen nicht hier ist. –<br />
Also Punkt 1: Ich selber kenne diese Regelung nicht. Ich<br />
habe Ihre Einwendung sehr wohl gelesen, was aber nicht<br />
heißt, dass ich diese Regelung kenne.<br />
Seite 84<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Punkt 2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe<br />
- korrigieren Sie mich bitte, Herr Weber –, befindet sich<br />
der Kamin innerhalb des Wärmetauschers. Es gibt sehr<br />
wohl die Regelung, dass sich die Kaminhöhe grundsätzlich<br />
oberhalb des Firstes des höchsten Gebäudes befinden<br />
muss. Wenn ich den Kamin kürzer machen würde als<br />
den Wärmetauscherturm, würde ich innerhalb des Gebäudes<br />
emittieren, was möglicherweise zu anderen Schwierigkeiten<br />
führen würde.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Irrelevant, Euer Ehren! Denn es geht nicht darum, was<br />
wirklich ist – wie bei den Werten, die wir die ganze Zeit<br />
besprechen –, sondern darum, was der Gesetzgeber sagt,<br />
Herr Schilling. Das Recht sagt: Sie haben Ihre Immissionswerte<br />
so zu berechnen, als wenn es so wäre. Denn<br />
eine Verdünnung durch Luft ist nicht erlaubt. Deswegen<br />
müssen Sie alle Kaminhöhen auf die Höhe der TA Luft<br />
rechnen. Alle Immissionswerte sind auf der von der TA<br />
Luft vorgeschriebenen Höhe zu berechnen. Ich glaube,<br />
das haben wir schon fünfmal gesagt und beklagt und<br />
jedes Mal Recht gekriegt. Dann kriegen wir auch jetzt<br />
Recht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist kein neuer Punkt,<br />
(Harry Block [BUND]: Nein, der ist alt!)<br />
aber wir werden ihn kritisch prüfen. Wir sind auch schon<br />
dabei, ihn zu prüfen. Herr Essig wird ein paar Hinweise<br />
von unserer Seite dazu geben. Dann sind wir bei diesem<br />
Punkt, glaube ich, einen Schritt weiter. – Herr Essig.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Herr Block, ich gebe Ihnen da recht. Wir haben diese<br />
Diskussion schon ein paar Mal im Erörterungstermin<br />
geführt. Sie haben vollkommen recht, was den Neubau<br />
einer Anlage anbelangt, wo noch kein Kamin steht. Genau<br />
das ist der springende Punkt. – Verstehen Sie das nicht<br />
falsch, Herr Block: Wir nehmen Ihre Hinweise tatsächlich<br />
sehr ernst und nehmen sie auch mit.<br />
Nur noch ein kleiner Hinweis von mir: Es gibt – da<br />
muss auch ich einmal ein Gerichtsurteil zitieren – ein Urteil<br />
vom VGH <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> vom 17.05.1997. Das<br />
Aktenzeichen war 10 D 607/96. Da wird dieser Ansatz der<br />
tatsächlichen Schornsteinhöhe vom Gericht völlig übernommen.<br />
Der Hintergrund ist, dass die tatsächlichen Immissionen<br />
ermittelt werden sollen, die nachher wirklich z. B. in<br />
Dürrenbüchig niedergehen - und nicht 500 m vorher auf<br />
dem freien Feld, was natürlich ein völlig falsches Bild<br />
ergeben würde. Wir müssen vielmehr von den tatsächlichen<br />
Immissionen ausgehen. Das ist der springende<br />
Punkt.<br />
Dazu hat der VGH ein Urteil gefällt und gesagt: Falls<br />
ein Kamin vorhanden ist, ist tatsächlich mit der vorhandenen<br />
Höhe zu rechnen. Punkt. – Aber trotzdem nehmen wir<br />
das noch einmal mit.
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Genau. Danke, Herr Essig. – Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Wir haben es Ihnen gesagt: Unser Anwalt ist da anderer<br />
Ansicht. Wir haben es auch beklagt. Das von Ihnen<br />
genannte Urteil kenne ich nicht, aber ich kenne andere<br />
Urteile. Jedes Mal wurde dann vom Gericht festgestellt,<br />
dass die von uns vertretenen Werte vorliegen müssen.<br />
Die TA Luft ist sicherlich kein Gesetz, aber sie ist eine<br />
rechtliche Anweisung für Sie. Sie haben dafür zu sorgen,<br />
dass uns als Träger öffentlicher Belange diese Werte<br />
vorliegen. Wir müssen beurteilen können: Was wäre<br />
wenn, und was ist? Der Unterschied von 12 m dürfte für<br />
einige Bereiche in Dürrenbüchig erheblich sein.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, ich kann es nur wiederholen: Wir nehmen es<br />
mit. Wir werden auch diesen Punkt prüfen. Sie sehen, wir<br />
sind schon dabei. Wir sind für jedes weitere Zitieren eines<br />
Gerichtsurteils dankbar. Wir kümmern uns auch um<br />
diesen Punkt.<br />
Damit wären wir mit der Kaminhöhe am Ende, zumindest<br />
was die Diskussion angeht.<br />
Wir kommen dann noch einmal zu dem Punkt<br />
Bodenwerte im Umkreis (Critical Loads),<br />
den wir heute schon gestreift haben. Auch da sehe ich<br />
wahrscheinlich den Herrn Block gefordert.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Der Critical Load für NOX – das ist klar – ist in ganz<br />
<strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> in vielen Bereichen überschritten.<br />
Hier, in Dürrenbüchig und in den Wäldern wurde festgestellt:<br />
Der Critical Load an NOX ist erreicht. Ich – rein als<br />
Ökologe – würde deshalb sagen: Nein, eine weitere<br />
Zunahme darf nicht mehr erfolgen – egal, um wie viel; das<br />
ist völlig wurscht. Der Critical Load ist erreicht.<br />
Das ist sicherlich kein Wert, der gesetzlich einklagbar<br />
ist, aber er ist bedenklich für alle Pflanzen, auch für einen<br />
Teil der Tiere. Dieser Critical Load wird sicherlich nur bei<br />
NOX überschritten.<br />
Vorhin hatten wir über zusätzlich 13 % Quecksilber im<br />
Vorjahr gesprochen. Ich weiß, dass unsere Böden hier<br />
relativ viel Nickel und Chrom enthalten. Das heißt, diese<br />
Werte würde ich nicht nehmen. Aber auch andere Stoffe<br />
- Vanadium, Cadmium, Kupfer etc. – werden von dieser<br />
Anlage in den Boden eingebracht.<br />
Dieser Boden wird hauptsächlich landwirtschaftlich<br />
genutzt. Wir haben hier Naherholungs- und Waldbereiche.<br />
Wir denken, dass dies ein weiterer Punkt ist zu sagen: Ihr<br />
hättet die Probleme nicht, wenn ihr Gas nehmen würdet.<br />
So habt ihr das Problem, dass ihr bei NOX diese Werte<br />
überschreitet. Deswegen kann es nicht wahr sein, dass<br />
erst im Jahre 2019 200 mg erreicht werden. Meiner<br />
Seite 85<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Ansicht nach muss dieser 200er-Wert sofort hineingeschrieben<br />
werden mit dem Zielwert 150 mg in 2019. Das<br />
wäre auch für die Böden etwas besser.<br />
Ich will jetzt nicht en detail auf diese Bodenwerte eingehen,<br />
weil die Flächenprüfung beim Boden extrem<br />
schwierig ist. Darin ist alles Mögliche; das sind alles<br />
Momentaufnahmen. Was wirklich in dem Boden ist, wird<br />
letztendlich nicht deutlich. Wir wissen das von Radioaktivität,<br />
wo es insgesamt einfacher festzustellen ist.<br />
Aber Schwermetalle zu finden ist oft wie die Suche<br />
nach der Nadel im Heuhaufen. Schwermetalle, die wie<br />
z. B. Vanadium im Boden nur in geringer Größenordnung<br />
vorkommen – die finden Sie hier mit Sicherheit; das sagt<br />
auch der Gutachter –, haben aber Auswirkungen über die<br />
Nahrungskette. Ich bin kein Biologe, und ich weiß es nicht<br />
genau. Ich weiß, was ein Teil der Früchte, Getreide etc.<br />
aufnehmen kann. Ich weiß, dass manche Pflanzen sehr<br />
empfindlich sind, z. B. Tabak, der hier aber nicht angebaut<br />
wird. Tabak ist die Pflanze, die am meisten Schwermetalle<br />
aufnimmt. Die Raucher sind also doppelt geschädigt. Ich<br />
weiß auch, dass Gemüse sehr stark Schwermetalle<br />
einlagert. Es gibt aber auch Pflanzen, die ganz wenig<br />
einlagern.<br />
Für mich ist im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit<br />
Folgendes noch wichtig: Bei Dürrenbüchig, wo<br />
meiner Ansicht nach der Hauptniederschlagspunkt dieses<br />
Kamins ist, ist eine Wasserquelle, ist ein Brunnen. – Das<br />
müssen die Bürger hier besser wissen; wir sind da bloß<br />
vorbeigegangen. – 100 m neben den Gasanschlüssen ist<br />
die Wasserstelle von Dürrenbüchig, wo sie ihr Wasser<br />
herholen. Ich hätte gerne genau gewusst, wie dort die<br />
Werte sind. Denn das ist Trinkwasser ist ein Nahrungsmittel.<br />
Darin möchte ich nichts haben.<br />
Der Boden ist vorbelastet; das habe ich eben gesagt:<br />
Es sind Nickel und Chrom da, aber kein Vanadium und<br />
anderes Zeug. – Soweit ich weiß, gibt es hier keine<br />
Arsenböden. Frau Dr. Hübner, gibt es hier Arsen in den<br />
Böden? Ich weiß es nicht.<br />
Ich wüsste gerne, wie die Werte oben am Trinkwasserreservoir<br />
sind, das genau auf der Höhe des Kamins liegt.<br />
Die Werte hätten wir gerne.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Können Lafarge oder die angesprochene Gutachterin<br />
etwas dazu sagen?<br />
(Harry Block [BUND]: Mich wundert, dass<br />
die Gemeinde da nichts tut!)<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Für welchen Stoff möchten Sie es wissen?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Für die Schwermetalle und NOX, also Stickoxide: Wie<br />
hoch ist der Critical Load da beim Trinkwasser? Das muss<br />
man wissen; denn das Wasser wird ja verkauft. Die Leute<br />
trinken das doch hier.
Jürgen Herr (RP Karlsruhe):<br />
Herr Haller, das Wasser wird nach der Trinkwasserverordnung<br />
von der Gesundheitsverwaltung überwacht. Der<br />
Frage können wir hinterher noch nachgehen.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke für den Hinweis. Das heißt aber schon, dass es<br />
dort eine genutzte Trinkwasserfassung gibt?<br />
Jürgen Herr (RP Karlsruhe):<br />
Da schließt sich ein Wasserschutzgebiet an. Das ist in der<br />
UVU von Frau Dr. Hübner dargestellt worden. Das ist eine<br />
genutzte Trinkwasserfassung, denke ich.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Herr. Der Herr Herr ist vom Regierungspräsidium<br />
und vertritt dort den Bereich Boden, Grundwasserschutz<br />
und Wasserversorgung. Von daher werden wir uns<br />
auf jeden Fall um die Daten noch kümmern.<br />
Habe ich es richtig verstanden, Frau Dr. Hübner: Sie<br />
haben jetzt keine Werte dazu?<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
Dazu, welche Werte im Grundwasser vorliegen? Das weiß<br />
ich nicht.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Nein. Herr Block wollte Bodenwerte in dem Bereich<br />
wissen. Die konkrete Frage war, ob Sie im Rahmen Ihrer<br />
Untersuchungen – –<br />
Dr. Friederike Hübner (Antragstellerin):<br />
– Bodenuntersuchungen auf Schwermetalle gemacht<br />
haben? Nein. Wozu auch?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke. – Wir hätten damit den Punkt Emission/Immission<br />
Luft erledigt und kommen zu einem weiteren großen<br />
Tagesordnungspunkt:<br />
IV. 4. Emission / Immission Lärm<br />
Lärmbelastung in Walzbachtal/Bretten<br />
Da geht es um die Lärmbelastung. Auch die haben wir<br />
heute schon mehrmals im Zusammenhang mit den vier<br />
Lkws gestreift. Aber wir wollten Ihnen die Möglichkeit<br />
geben, hier noch einmal Ihre Einwendungen zu konkretisieren<br />
und nachzuhaken, wenn Bedarf besteht. – Herr<br />
Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Heute Morgen wurde von Werten für „Dorfgebiete“ gesprochen.<br />
Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur<br />
Mischgebiete, Industriegebiete und Wohngebiete. Da<br />
stand aber etwas von „Dorfgebieten“. Der Grenzwert ist 40<br />
dB(A), der andere ist 45 dB(A). Sie überschreiten den<br />
Seite 86<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Wert für Wohngebiete um 3,5 dB(A). Herr Haller, stimmt<br />
es, dass angrenzend ein Wohngebiet ist?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Der Anforderungswert für 40 dB(A) gilt für ein Wohngebiet.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ist das ein Wohngebiet?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Wo Lafarge drin liegt?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ist das Gebiet ein Wohngebiet?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das ist nicht eindeutig.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Das ist doch die Frage! Das ist wie vorhin: Bei Einbruch<br />
der Dunkelheit ist mit Nacht zu rechnen. Ich muss doch<br />
wissen, was das für ein Gebiet ist. 10 dB(A) mehr entspricht<br />
einer Verdopplung des Verkehrs. 3,5 bis 4 dB(A)<br />
bedeutete also fast die Hälfte mehr an Verkehr. Das ist<br />
enorm viel; das ist nicht wenig. Das ist eine logarithmische<br />
Kurve. Die Zunahme ist relativ groß.<br />
Wenn das ein Wohngebiet ist, hält diese Anlage die<br />
Werte nicht ein, und dann – jetzt kommen wir wieder zu<br />
meinem Punkt – ist sie nicht genehmigungsfähig. Denn<br />
wenn Sie die Lärmgrenzwerte überschreiten – das hat<br />
jetzt nichts mit der aktuellen Erhöhung auf 100 % zu tun,<br />
sondern kann auch durch eine Vermehrung des Lkw-<br />
Verkehrs entstehen –, dann müssen Sie Maßnahmen<br />
ergreifen, dass die Werte eingehalten werden. Oder Sie<br />
führen Lärmminderungsmaßnahmen durch und bezahlen<br />
entsprechende Fenster bei den Menschen in der Umgebung.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Essig sagt von unserer Seite etwas dazu.<br />
Dieter Essig (RP Karlsruhe):<br />
Es gibt hier im Walzbachtal verschiedene Messpunkte für<br />
Lärmimmissionen. Wir reden jetzt von einem einzigen, bei<br />
dem es ein Problem gibt, aber nicht am Tag, sondern in<br />
der Nacht. Bei allen anderen gibt es überhaupt keine<br />
Probleme.<br />
Das ist ein allgemeines Wohngebiet. Dummerweise<br />
existiert dieses allgemeine Wohngebiet direkt neben<br />
einem Industriegebiet. Das ist eine ganz kritische Sache;<br />
denn Sie wissen, Herr Block: Normalerweise muss es eine<br />
Gebietsabstufung geben. Es hätte hier zumindest ein<br />
Mischgebiet dazwischenliegen müssen.<br />
Diese krasse Gegenüberstellung zwischen Industriegebiet<br />
und allgemeinem Wohngebiet ist natürlich für eine<br />
Firma wie Lafarge mit einer Vielzahl von mechanischen<br />
Anlagen, die Lärm verursachen, eine ganz große Herausforderung.<br />
Da arbeiten wir im Moment sowieso dran.
Also noch einmal: Der Wert zumindest für ein Mischgebiet<br />
wird hier nicht überschritten, sondern er wird in dem<br />
Fall sogar eingehalten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Essig, es geht jetzt darum, dass es eben keins ist.<br />
Mir hat vorhin jemand erzählt, wie die Leute gelitten<br />
haben, als es die Umgehungsstraße noch nicht gab und<br />
die Filter bei Lafarge noch laut waren. Die Leute waren<br />
schon vor dem Betrieb da. Dieser Mensch, der vorhin mit<br />
mir gesprochen hat, ist älter als dieser Betrieb gewesen.<br />
Er hat es über viele Jahrzehnte erduldet. Die Menschen,<br />
die heute dort leben, brauchen das meiner Ansicht nach<br />
nicht zu erdulden.<br />
Deswegen ist es wichtig, dass wir Lärmüberschreitungen<br />
in der Nacht nicht zulassen oder dass Ausgleichsmaßnahmen<br />
in Form von Fenstern etc. von der Firma<br />
bezahlt werden. Aber es kann nicht sein, dass Bürgerinnen<br />
und Bürger für das Handeln einer Firma Lärm ertragen<br />
müssen. Sie müssen schon genug ertragen, denke<br />
ich, weil auch durch den normalen Lärm am Tag der<br />
Grenzwert ziemlich erreicht ist. Bei den Zementmengen<br />
und den Lkws, die dort vorbeifahren, denke ich, dass die<br />
Menschen schon viel ertragen. Deswegen muss man<br />
dafür sorgen, dass zumindest ihre Nachtruhe gewährleistet<br />
ist. Darum sind solche Minimierungsmaßnahmen nötig.<br />
Egal, wie der Wert getrickst ist – – Einen Teil des<br />
Kalks bekommen Sie doch aus Köln. Ist das richtig, dass<br />
Sie das Material aus Köln bekommen?<br />
(Lutz Weber [AS]: Nein!)<br />
– Nicht? Sie bekommen kein Material aus Köln?<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, noch einmal: Es gibt ein Lärmminderungskonzept<br />
mit vielen Maßnahmen, die identifiziert, entsprechend<br />
gemessen und bewertet worden sind. Dazu sollte meines<br />
Erachtens Lafarge noch etwas sagen. Das wird schon seit<br />
geraumer Zeit auch mit uns fortgeschrieben; Herr Weber<br />
hat es heute Morgen kurz erwähnt. Ich denke, jetzt wäre<br />
der richtige Zeitpunkt, diese Informationen hier mitzuteilen,<br />
Herr Weber, Villano oder ein Gutachter.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Ich suche gerade einmal die Folie von heute Vormittag<br />
heraus, wo wir über das Thema Lärm gesprochen haben.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Die von heute Morgen haben wir gesehen. Ich denke, Sie<br />
haben ein Lärmminderungskonzept erstellt. Vielleicht<br />
können Sie dazu ein bisschen sagen.<br />
(Tino Villano [AS]: Ja, gut!)<br />
Seite 87<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Das Regierungspräsidium weiß solche Dinge, aber die<br />
Einwender und Bürger wissen das nicht. Ich meine, das<br />
wäre jetzt eine hilfreiche Information.<br />
Tino Villano (Antragstellerin):<br />
Wir sind bei Ihnen, dass es eine Herausforderung gibt<br />
aufgrund der geringen Distanz zwischen dem Werk und<br />
dem Wohngebiet. Wir sind auch bei Ihnen, dass es eine<br />
Herausforderung ist, den Immissionsrichtwert von Lärm zu<br />
Nachtzeiten an der Friedenstraße zu reduzieren. Da sind<br />
wir nicht weit auseinander. Die Frage ist nicht ob, sondern<br />
wie wir dahinkommen.<br />
Wir haben diesbezüglich Messungen durchgeführt,<br />
haben das Problem erkannt und entsprechende Maßnahmen<br />
eingeleitet. Eine Maßnahme hat Herr Weber heute<br />
Vormittag schon genannt: Wir haben als Erstmaßnahme<br />
eine sogenannte Hotspot-Analyse durchgeführt, um die<br />
größten Emittenten schnell ausfindig zu machen - auch<br />
Gebäudeschäden, z. B. eine Türzarge mit Riss –, um<br />
dadurch austretenden Lärm schnell zu reduzieren. Wir<br />
haben festgestellt, dass wir mit den Erstmaßnahmen nicht<br />
zu dem gewünschten Ziel gekommen sind.<br />
Die Zweitmaßnahme, die wir durchgeführt haben, war<br />
dann eine Auflistung aller lärmemittierenden Anlagen. Da<br />
kommt bei einem Zementwerk so einiges zusammen. Wir<br />
haben diese entsprechend der Lärmemission priorisiert<br />
und das dann abgearbeitet. Wir haben dafür 300.000 €<br />
investiert und haben – nageln Sie mich bitte nicht auf die<br />
genaue Anzahl fest – um die 24 Einzelmaßnahmen<br />
durchgeführt. Letztendlich haben wir die Spitzen erfasst,<br />
und diese Spitzen konnten wir auch reduzieren.<br />
Aber das reicht anscheinend nicht aus. Wir haben<br />
nach den umgesetzten Maßnahmen wieder eine Messung<br />
durchgeführt und festgestellt, dass wir zwar eine Verbesserung<br />
erreichen konnten, dass wir aber noch nicht da<br />
sind, wo wir hin wollen.<br />
Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass wir nicht<br />
mehr exponierte Spitzen haben, die wir angreifen können,<br />
sondern dass wir eine Vielzahl von Lärmquellen haben,<br />
die gleich laut sind. Sie werden mir zustimmen, Herr<br />
Block: Bei einer Vielzahl von Anlagen, die gleich laut sind,<br />
muss man viele Maßnahmen machen, und das bedarf<br />
einer entsprechenden Zeit.<br />
Lafarge hat als Unternehmen in seinen Standards und<br />
in seinem Programm mit drin, dass wir hier weitere Lärmminimierungsmaßnahmen<br />
einleiten. Wir sind jetzt an<br />
einem Punkt, wo wir sagen: Wir halten zwar den Immissionsrichtwert<br />
zu Nachtzeiten für das allgemeine Wohngebiet<br />
– das ist das Viertel – nicht ein, aber wir sind schon so<br />
weit mit dem Lärm heruntergekommen, dass wir den<br />
Immissionsrichtwert für Dorfgebiete und Mischgebiete<br />
einhalten.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block.
Harry Block (BUND):<br />
Das ist dankenswerterweise so. Herr Villano, wenn Sie die<br />
Genehmigung für 100 % haben wollen, müssen Sie an<br />
dem Tag, an dem Sie diese 100 % haben wollen, diese<br />
Werte einhalten. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie sie<br />
nicht einhalten, andere Maßnahmen versuchen.<br />
Ich weiß nicht, wie viele Menschen betroffen sind.<br />
Aber man kann in den Wohnungen messen, wer davon<br />
betroffen ist – 10 oder 20 Häuser –, und dann werden dort<br />
z. B. Lärmschutzfenster eingebaut. Sie müssen Maßnahmen<br />
ergreifen. Diese Anlage ist nach TA Lärm so nicht<br />
genehmigungsfähig. Denn Sie überschreiten eindeutig<br />
einen Grenzwert.<br />
Es ist ein Wohngebiet. Jetzt können Sie sich streiten:<br />
Entweder ändert die Gemeinde die Einschätzung in ein<br />
Mischgebiet, dann ist die Sache erledigt – was ich nicht<br />
hoffe –, oder Sie bieten den Bürgern vor Ort etwas an,<br />
z. B. Lärmschutzmaßnahmen in Form eines Walls. Ich<br />
habe es mir angeguckt: Dort ist eigentlich ein natürlicher<br />
Schutz. Vielleicht verstärkt man den. Ich weiß nicht, ob<br />
das etwas hilft. Aber solche Maßnahmen sollten Sie sich<br />
überlegen, bevor Sie eine Genehmigung wollen.<br />
Ich denke, wenn solche Maßnahmen nicht erfolgen, ist<br />
das nicht genehmigungsfähig. Sie können das mit den<br />
Bürgern nicht machen. Der betroffene Bürger wird sonst<br />
klagen; er hat ein Recht dazu. Der Grenzwert darf nicht<br />
überschritten werden. Wenn er überschritten wird, muss<br />
die Quelle beseitigt werden – und das sind Sie! Es wäre<br />
übel für Sie, wenn das Werk stillgelegt würde. Sie können<br />
sicher sein, dass wir den Menschen dabei helfen, wenn<br />
das nicht passiert. Ich bitte Sie: Machen Sie es einfach!<br />
Wie Sie es machen, ist uns wurscht, aber machen Sie es!<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Dann gibt es auch noch die Behörde, die darauf aufpasst.<br />
Herr Schilling ist schon unruhig.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Sie haben es die ganze Zeit in Kauf genommen. Dieser<br />
Wert wird jetzt schon überschritten. Ich wundere mich,<br />
warum die Kommune nicht geklagt hat.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Ganz einfach, Herr Block, ich sage es Ihnen: weil es in der<br />
TA Lärm z. B. eine Ziffer 6.7 gibt, die folgende Regelung<br />
enthält: Wenn ein Industriegebiet auf ein Wohngebiet trifft,<br />
wird ein Mittelwert gebildet; dann gilt der niedrigere Wert<br />
nicht. Weiterhin schreibt die TA Lärm an anderer Stelle<br />
genau vor, wie bestehende Anlagen zu behandeln sind,<br />
wenn die Überschreitung bis zu 3 dB(A) beträgt etc. All<br />
das wurde berücksichtigt. Einfach so schwarz-weiß zu<br />
malen, wie Sie es gerade tun, geht also nicht. So ist die<br />
Sicht der TA Lärm. Es ist wunderschön, wenn Sie sich das<br />
so ausmalen.<br />
Tatsache ist, dass man aufgrund der untergesetzlichen<br />
Regelung TA Lärm auf vertraglicher Basis mit der Firma<br />
Lafarge zu einem Lärmminderungskonzept gekommen ist,<br />
Seite 88<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
und zwar mit genau dem Ziel, diesen ganz niedrigen<br />
Grenzwert zu erreichen.<br />
Allerdings sind noch einige Vorschriften zu beachten,<br />
die in der TA Lärm stehen. Da steht nicht nur drin:<br />
40 dB(A) in Wohngebieten, sondern da steht noch ein<br />
bisschen mehr drin: z. B. zur Gemengelage oder auch zur<br />
Überschreitung von bis zu 3 dB(A). Auch dazu gibt es eine<br />
besondere Vorschrift in der TA Lärm. Das müssen wir<br />
alles berücksichtigen. – Und den Betrieb schließen: Ich<br />
weiß nicht, ob wir das dann können.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Herr Block, Sie haben aber völlig recht: Die gesetzlichen<br />
Werte müssen eingehalten werden. Lafarge weiß, dass<br />
sie sich darauf einstellen müssen. Deswegen haben sie<br />
einen entsprechenden Antrag gestellt.<br />
(Zuruf von Harry Block [BUND])<br />
– Noch einmal: Lafarge muss die Anforderungen in dem<br />
Moment einhalten, wo sie die Anlage so in Betrieb nehmen,<br />
wie sie sie beantragt haben.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Herr Schilling, die haben die Reduktion um 0,3 dB(A)<br />
natürlich absichtlich gemacht; so blöd sind die nicht. Sie<br />
wussten, dass sie unter die 43,5 dB(A) kommen müssen.<br />
Aber selbst bei der Argumentation mit Mischgebiet und<br />
Wohngebiet sind sie jetzt immer noch um 3,2 dB(A)<br />
darüber. Auch ich habe das Ding gelesen. Wenn ich das<br />
jetzt nicht total missverstehe, wäre diese Anlage ein<br />
Problem, denke ich.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Es ist schön, wenn Sie es gelesen haben. Dann hätten Sie<br />
es vorhin auch gleich erwähnen können. Dann hätte ich<br />
mir den Einwand sparen können.<br />
Aber eines noch: Warum Mischwert von 45 und 40?<br />
Wir sind hier im Industrie- und Gewerbegebiet bei 70.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Mischgebiet! Es ist kein Industriegebiet.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Lafarge liegt doch nicht im Mischgebiet! Ein „Mischwert“<br />
ist zu bilden von den Gebietswerten.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Sie betrachten also gleich ein Industriegebiet?<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Wo liegt denn Lafarge? Im Wohngebiet oder im Industriegebiet?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Noch sind sie in einem Wohngebiet.
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Lafarge in einem Wohngebiet? Die Firma liegt in einem<br />
Wohngebiet?<br />
Harry Block (BUND):<br />
Ja, ja.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Das muss man klarstellen: Lafarge liegt nicht in einem<br />
Wohngebiet, sondern in einem ausgewiesenen Sondergebiet.<br />
– Herr Dehm, Sie können es besser sagen.<br />
Klaus Dehm (Gemeinde Walzbachtal):<br />
Das Zementwerk liegt weder in einem Mischgebiet noch in<br />
einem Wohngebiet, sondern hat einen eigenen Bebauungsplan.<br />
Es grenzt allerdings an ein Wohngebiet. Aber<br />
das Areal des Zementwerkes hat einen eigenen Bebauungsplan.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Darauf zielten die Hinweise vom Herrn Schilling ab, die<br />
wirklich informativ für Sie gedacht waren, nämlich dass es<br />
in der TA Lärm, Ziffer 6.7, Regelungen gibt, die in solchen<br />
Fällen, angepasst an die örtliche Situation, eine besondere<br />
Beurteilung dieser Situation bei der Festlegung der<br />
Grenzwerte vorsehen. Genau das haben wir im Rahmen<br />
dieses Verfahrens vorzunehmen.<br />
Noch einmal ganz klar: Es gibt dieses Lärmminderungskonzept.<br />
Das wird nicht in der Schublade verschwinden.<br />
Gleichzeitig werden wir im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens<br />
die Vorgaben der TA Lärm auf die<br />
Anwendung des Sonderfalls Lafarge in Wössingen prüfen.<br />
Im Ergebnis wird auf rechtlicher Grundlage möglicherweise<br />
ein Wert herauskommen, den es dann einzuhalten<br />
gilt - genauso, wie Sie es vorhin gefordert haben.<br />
Wolfgang Schilling (RP Karlsruhe):<br />
Ich möchte noch einen Satz ergänzen: Das Lärmminderungskonzept<br />
arbeitet genau auf diese 40 dB(A) hin. Dazu<br />
ist die Firma auch bereit. Wir müssen nur sehen, was<br />
rechtlich durchsetzbar ist und was die TA Lärm tatsächlich<br />
enthält. Es reicht nicht, dass ich irgendein Bruchstück<br />
herausnehme, sondern ich muss das gesamte Werk<br />
sehen und es dann auch richtig beurteilen. – Und Lafarge<br />
liegt nicht im Wohngebiet.<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Es war wichtig, dass man das an dieser Stelle noch<br />
einmal klarstellt. – Danke, Herr Dehm.<br />
Haben Sie zum Thema Lärm – ich schaue jetzt in die<br />
Runde – noch Fragen, Einwendungen, Wortmeldungen? –<br />
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt Ihr Einverständnis<br />
voraussetzen, dass wir den Punkt 5 noch behandeln.<br />
Seite 89<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
IV. 5. Sonstiges<br />
UVU/Ausgleichsmaßnahmen<br />
Da waren zum Thema Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
bzw. zu den Ergebnissen dieser Untersuchung vom<br />
BUND Einwendungen vorgetragen worden. Ich würde<br />
deshalb Ihnen, Herr Block, zu diesem Punkt das Wort<br />
geben.<br />
Harry Block (BUND):<br />
Es geht hier vor allen Dingen um den Schutz und den<br />
Gefährdungsstatus von betroffenen Arten. Es geht hier<br />
hauptsächlich um Fledermäuse, von denen sehr viele auf<br />
der roten Liste stehen und die sich hier in unserer Region<br />
befinden. Das ist erstaunlich. Es geht um Vögel<br />
- Feldlerche, Feldsperling usw. –, die alle auf der FFH-<br />
Liste stehen, entweder auf der Vorwarnliste oder sogar<br />
ganz oben.<br />
Das Interessante bei der ganzen Sache des Naturschutzes<br />
ist sicherlich nicht die Gefährdung oder das<br />
Tötungsverbot oder dass die Tiere besonders betroffen<br />
sind. Interessant ist vielmehr, dass aus diesem Formblatt<br />
jedes Mal die gleiche Schlussfolgerung abgeleitet wird.<br />
Sie lautet immer: Es besteht zwar keine direkte Gefahr,<br />
und es werden von dem Gutachter keine direkten Maßnahmen<br />
gefordert, aber er sagt immer: Es müssen Minimierungen<br />
stattfinden. Er nennt immer die drei Stoffe NOX,<br />
SO2 und Staub und sagt jedes Mal: die NOX-Werte senken<br />
und die SO2-Zielwerte anders setzen – wobei ich seine<br />
200 mg/m³ für falsch halte; ich habe es vorhin versucht zu<br />
erklären.<br />
Ich denke, dass dieser Naturraum, den es hier Gott sei<br />
Dank noch gibt, ein schützenswertes Gut darstellt und<br />
deswegen diese Werte schnell erreicht werden müssen.<br />
Wenn Sie uns folgen würden – ich sage es noch einmal –<br />
mit dem Einsatz von Gas, hätten Sie die Probleme nicht,<br />
sondern Sie hätten nachhaltig auch etwas für diese<br />
Tierarten getan.<br />
Mich hat es selber verwundert, wie viele geschützte<br />
Tierarten es gibt – auch sehr viele amphibisch lebende<br />
Tiere. Es ist ganz erstaunlich, wie viel es hier in dieser<br />
Region an Lebendigkeit gibt. Das liegt sicherlich auch an<br />
dem Steinbruch drüben, der einen einmaligen Lebensraum<br />
darstellt. Wir haben auch die Greifvögel gesehen,<br />
die hier geflogen sind. Es ist schon erstaunlich, wie toll es<br />
hier eigentlich ist. Das sollte man auch erhalten, denke<br />
ich.<br />
Den WWF – Herr Bauer hat es schon angedeutet –<br />
würde ich da für Maßnahmen nicht heranziehen. Mit dem<br />
König von Spanien auf Elefantenjagd ist das nicht so gut.<br />
Es ist besser, Sie nehmen die NABU-Leute, die die Vögel<br />
schützen und Führungen für die Bevölkerung durchführen.<br />
Die beste Ausgleichsmaßnahme wäre, Sie erklären<br />
hier und heute: Wir nehmen das Quecksilber heraus; wir
werden versuchen, so weit und so schnell wie möglich den<br />
SNCR-Filter einzusetzen; wir geben uns zwei Jahre. Das<br />
machen Sie dann als Verpflichtung. – Ich mag diese<br />
freiwilligen Selbstverpflichtungen eigentlich nicht.<br />
Wenn das so erklärt wird, werden Sie ja als Ausgleichsmaßnahmen<br />
irgendetwas tun, vielleicht einen<br />
Lafarge-Gedächtnispark oder Ähnliches einrichten. Beim<br />
Fußball sind Sie ja aktiv; das habe ich gesehen. Da<br />
sponsern Sie; das ist gut. Der Rasen ist auch saugrün;<br />
das gefällt mir ebenfalls gut. Das alles ist gut, und das<br />
sollten Sie auch weitermachen und fördern.<br />
Aber das Beste Ausgleichsmaßnahme, die Sie machen<br />
können, ist, dass Sie diese Minimierungen optimal<br />
annehmen, diese so schnell wie möglich durchführen und<br />
über das hinausgehen, was der Gesetzgeber vorgibt.<br />
Es wird geschätzt, dass 8 Millionen t Müll über die<br />
Zementwerke entsorgt werden können. Das ist eine<br />
Menge Holz, die Sie hier an Emissionen in Europa mit<br />
verschulden. Die Zementindustrie ist mit 7 % der höchste<br />
Kohlendioxidproduzent der Welt. 7 % aller Kohlendioxidemissionen<br />
stammen aus Zementwerken.<br />
(Zuruf von Dr. Rolf Wiedenmann [EW])<br />
– Genau, 6 %. Wir haben uns auf den Mittelwert von 6 %<br />
geeinigt, denn es war zwischen 5 % und 7 % angegeben.<br />
Das ist eine Menge Holz, was Sie da auch an Verantwortung<br />
mittragen.<br />
Wenn Sie es dann noch schaffen, dass das Produkt<br />
besser wird - das wollen wir ebenfalls –, ist das für uns als<br />
Ausgleichsmaßnahme mehr wert, als wenn wir von Ihnen<br />
fordern, dass Sie sieben Bäume an der Kreuzung Y und<br />
acht Froschzäune für den BUND bezahlen, damit er die<br />
Lurche schützt. Wenn Sie das machen, ist das natürlich<br />
gut. Und wenn Sie darüber sprechen, ist das ebenfalls gut.<br />
„Tue Gutes und rede darüber“ ist immer gut bei einer<br />
Firma.<br />
Wir werden uns die Genehmigung genau angucken,<br />
auch mit Blick auf <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong>. Wir werden das<br />
auch im politischen Rahmen betrachten. Bitte denken Sie<br />
daran: Es gibt auch Änderungen an der Spitze von Politik.<br />
Ich denke, dass das Problem der Sekundärbrennstoffe im<br />
Augenblick von gewissen Leuten anderes gehandhabt<br />
wird, als es vorher einmal der Fall war. Wir sehen das<br />
sehr kritisch; das haben wir deutlich gemacht. Ich denke,<br />
Sie sollten auch das mitnehmen.<br />
Wir werden diese Genehmigung, die in <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong> die erste für den Einsatz von 100 % Ersatzbrennstoffen<br />
sein wird, dem Minister vorlegen, und wir<br />
werden mit ihm darüber sprechen; darauf können Sie Gift<br />
nehmen. Wir treffen uns regelmäßig mit ihm – der LNV<br />
alle acht Wochen. Wir werden ihm das vortragen.<br />
Wir werden auch den Herrn Ministerpräsidenten fragen,<br />
ob er die von der EU geforderte Luftreinhaltung in der<br />
Region Karlsruhe ernst nimmt. Das werden wir ihn fragen.<br />
Seite 90<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Die Bürgerinnen und Bürger werden Sie fragen: Was<br />
haben Sie getan, um Quecksilber oder die Besorgnisse<br />
der Bürger hier ernst zu nehmen? Wenn Sie das einigermaßen<br />
über die Bühne kriegen, wäre das gut. – Das war<br />
es.<br />
(Beifall bei den Einwenderinnen und<br />
Einwendern)<br />
Verhandlungsleiter Bernd Haller:<br />
Danke, Herr Block. Ich nehme an, Sie erwarten jetzt keine<br />
Antwort von Lafarge.<br />
(Harry Block [BUND]: Nein, um Gottes willen!)<br />
Der letzte Punkt, der unter „Sonstiges“ steht, ist ein<br />
Hinweis an uns und das Regierungspräsidium.<br />
EU-Anforderungen<br />
Dabei geht es um die neue Richtlinie 2010/75/EU, um die<br />
Richtlinie über Industrieemissionen. Sie haben uns darauf<br />
hingewiesen, dass sie gilt und die bestverfügbaren Techniken<br />
fordert. Wir danken für den Hinweis. Das ist uns<br />
bewusst.<br />
Wir alle wissen, dass zum 26. März die BVT-<br />
Schlussfolgerungen Zement veröffentlicht wurden. Sie<br />
werden jetzt in der 17. BImSchV umgesetzt. Diese bestverfügbaren<br />
Techniken, die in Deutschland „Stand der<br />
Technik“ lauten, werden wir natürlich im Rahmen des<br />
Genehmigungsverfahrens ebenfalls beachten.<br />
Wenn von Ihrer Seite nichts mehr zu dem Thema anzusprechen<br />
wäre, würde ich damit zum Schluss der<br />
Veranstaltung kommen und den Erörterungstermin schließen.<br />
Ich schaue noch einmal in die Runde: Gibt es noch<br />
irgendwelche Wortmeldungen?<br />
V. Schlusswort<br />
Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen, für die intensive<br />
Diskussion und den Austausch. Ich danke insbesondere<br />
den Fachbehörden für Ihre Geduld und Ihre Zeit. Das<br />
gilt natürlich auch für Sie als Einwenderinnen und Einwender<br />
und für die Bürger aus Walzbachtal.<br />
Ich denke, wir haben einen Teil der Ziele weitgehend<br />
erreicht, nämlich dass wir die Informationslage für beide<br />
Seiten verbessert haben und dass wir – damit meine ich<br />
uns als Genehmigungsbehörde – eine vertiefte Einsicht in<br />
Ihre Forderungen bekommen haben, die wir dann als<br />
Grundlage für unsere Entscheidung mitnehmen.<br />
Also von unserer Seite: Vielen Dank, einen guten<br />
Nachhauseweg und noch einen schönen Abend!<br />
(Allgemeiner Beifall)<br />
(Ende des Erörterungstermins: 18:36 Uhr)
Aberle, Jutta (EW‘in) 67<br />
Adis, Reinhold (EW) 44<br />
Bauer, Andreas (EW) 24, 25, 35, 37, 49, 52, 64, 65, 66,<br />
70, 71, 77, 79, 80<br />
Block, Harry (BUND) 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,<br />
23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,<br />
40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63,<br />
67, 68, 69, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89<br />
Dehm, Klaus (Gemeinde Walzbachtal) 89<br />
Doll, Sandra 78<br />
Essig, Dieter (RP Karlsruhe) 30, 36, 38, 40, 43, 44, 54,<br />
57, 84, 86<br />
Fischer, Enrico (AS) 14, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,<br />
45, 46, 70, 71, 78<br />
Futterer, Michael (EW) 41, 59, 69, 82<br />
Herlan, Karin 78<br />
Herr, Jürgen (RP Karlsruhe) 58, 86<br />
Hübner, Dr. Friederike (AS) 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 63,<br />
64, 85, 86<br />
Hüsemann, Stefan (AS) 19, 26, 64, 65<br />
Kassner, Gisela (EW‘in) 29, 60, 77<br />
Klawe, Hans-Jürgen (EW) 61, 62, 66, 72, 73, 81<br />
Lang, Roland (RP Karlsruhe) 68<br />
AS Antragstellerin (Lafarge Zement Wössingen<br />
GmbH inkl. Gutachter und Berater)<br />
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland<br />
EW Einwender<br />
EW’in Einwenderin<br />
Seite 91<br />
Rednerliste<br />
Abkürzungen<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013<br />
Leth, Ingo (AS) 47<br />
Lutz-Holzhauer, Christiane (LUBW) 56, 57<br />
Oerter, Dr.-Ing. Martin (AS) 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25,<br />
41, 47, 55, 60, 62, 67, 70, 72, 82, 84<br />
Rother, Gerhard (EW) 62, 63<br />
Schilling, Wolfgang (RP Karlsruhe) 8, 14, 69, 74, 76, 88,<br />
89<br />
Schmid-Adelmann, Friederike (LRA Karlsruhe) 47, 53, 59,<br />
67, 78, 80<br />
Siech, Monika (EW‘in) 28, 58<br />
Sorg, Anette (EW‘in) 29, 34, 40, 48, 62, 68, 69<br />
Vangermain, Gudrun (BUND) 13, 22, 30, 32, 42, 44, 71,<br />
80<br />
Villano, Tino (AS) 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,<br />
46, 47, 48, 52, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 79,<br />
80, 81, 82, 87<br />
Waibel, Bettina (EW‘in) 42, 46<br />
Weber, Lutz (AS) 9, 13, 18, 20, 26, 44, 69, 76, 77, 78, 81,<br />
83<br />
Wehrmeyer, Dr. Burkhard (EW) 45<br />
Wiedenmann, Dr. Rolf (EW) 15, 20, 21, 40, 41, 47, 57, 74,<br />
75, 76<br />
Zapf, Dr. Frank (RP Karlsruhe) 28, 29, 30<br />
LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und<br />
Naturschutz <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong><br />
RP Regierungspräsidium<br />
LRA Landratsamt<br />
Protokollverantwortliche<br />
Verhandlungsleiter: _______________________________<br />
Bernd Haller, Regierungspräsidium Karlsruhe<br />
Protokollführer: ____________________ _________________<br />
Norbert Remke, Königswinter Ursula Dütsch, Saerbeck
Seite 93<br />
Anlagen<br />
zum Antrag der Firma<br />
Lafarge Zement Wössingen GmbH,<br />
für die Erhöhung der Sekundärbrennstoffrate<br />
am Drehrohrofen des Zementwerks<br />
von derzeit genehmigten 60 % auf zukünftig 100 %<br />
23. April 2013<br />
in der Sport- und Mehrzweckhalle Walzbachtal-Wössingen<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 94<br />
Anlage 1: Vorstellung des Projektes Lutz Weber<br />
Anlage 1-1: Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate auf 100 % Seite 9<br />
Anlage 1-2: Inhalt Lutz Weber, Seite 9<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 95<br />
Anlage 1-3: Lafarge Zement Wössingen Lutz Weber, Seite 9<br />
Anlage 1-4: Die Rahmenbedingungen Lutz Weber, Seite 9<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 96<br />
Anlage 1-5: Warum Sekundärbrennstoffe? Lutz Weber, Seite 10<br />
Anlage 1-6: Antragsumfang Lutz Weber, Seite 10<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 97<br />
Anlage 1-7: Emissionsbericht 2012 Lutz Weber, Seite 10<br />
Anlage 1-8: Warum Dachpappe? Lutz Weber, Seite 11<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 98<br />
Anlage 1-9: Warum HOK-Anlage? Lutz Weber, Seite 11<br />
Anlage 1-10: Warum Neubewertung Lärm? Lutz Weber, Seite 11<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 99<br />
Anlage 1-11: Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung Lutz Weber, Seite 11<br />
Anlage 1-12: Umweltverträglichkeitsuntersuchung Lutz Weber, Seite 11<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 100<br />
Anlage 1-13: Emissionsprognose Lutz Weber, Seite 12 und Seite 13<br />
Anlage 1-14: Immissionsvorbelastung Lutz Weber, Seite 12<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 101<br />
Anlage 1-15: Immissionsprognose Lutz Weber, Seite 12<br />
Anlage 1-16: Lärmgutachten Lutz Weber, Seite 12<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 102<br />
Anlage 1-17: Betrachtung: diffuse Staubemissionen Lutz Weber, Seite 12<br />
Anlage 1-18: Umweltverträglichkeitsuntersuchung Lutz Weber, Seite 12<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 103<br />
Anlage 1-19: Information im Verfahren Lutz Weber, Seite 12<br />
Anlage 1-20: Zusammenfassung Lutz Weber, Seite 13<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 104<br />
Anlage 2: Einwendungen vom BUND Harry Block<br />
Anlage 2-1: Antrag der Firma Lafarge Zement Wössingen Seite 13<br />
Anlage 2-2: Beschluss der EU-Kommission Harry Block, Seite 16<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 105<br />
Anlage 2-3: Vorbelastungen im Raum KA Harry Block, Seite 16<br />
Anlage 2-4: Luftbild Karlsruhe - Walzbachtal Harry Block, Seite 16 und Seite 50<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 106<br />
Anlage 2-5: Quelle Bundesumweltamt Harry Block, Seite 16<br />
Anlage 2-6: Kohlendioxidvergleich Harry Block, Seite 17<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 107<br />
Anlage 2-7: CO2-Emissionen verschiedener Brennstoffe Harry Block, Seite 17<br />
Anlage 2-8: Gaskraftwerk-Emission Harry Block, Seite 17<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 108<br />
Anlage 2-9: Was ist im Müll enthalten? Harry Block, Seite 23<br />
Anlage 2-10: Vorbelastung heute/neu Harry Block, Seite 50<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 109<br />
Anlage 2-11: Emissionen beta- und gammastrahlender Aerosole Harry Block, Seite 50<br />
Anlage 2-12: Emissionsfrachten Harry Block, Seite 50 und Seite 60<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 110<br />
Anlage 2-13: Immissionszusatzbelastung Harry Block, Seite 50<br />
Anlage 2-14: Foto Zementwerk Harry Block, Seite 50<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 111<br />
Anlage 2-15: Foto Gasleitung Harry Block, Seite 50<br />
Anlage 2-16: Problem bei Gas und Müll – Stickstoffdioxid (NOX) Harry Block, Seite 50<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 112<br />
Anlage 2-17 a: Immissionsjahreszusatzbelastung Harry Block, Seite 51<br />
Anlage 2-17 b: Immissionsjahreszusatzbelastung Harry Block, Seite 51<br />
u. a. Cadmium, Quecksilber<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 113<br />
Anlage 2-17 c: Immissionsjahreszusatzbelastung Harry Block, Seite 51<br />
u. a. Antimon, Arsen<br />
Anlage 2-17 d: Immissionsjahreszusatzbelastung Harry Block, Seite 51<br />
u. a. Dioxine, Furane<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 114<br />
Anlage 2-18: Feinstaub - Feinststaub Harry Block, Seite 51<br />
Anlage 2-19: Vergleich: Feinststäube KA Harry Block, Seite 56<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 115<br />
Anlage 2-20: Staubdeposition in mg/(m² x d) Harry Block, Seite 56<br />
Anlage 2-21: PM10-Zusatzbelastung Harry Block, Seite 56 und Seite 57<br />
in der bodennahen Schicht<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 116<br />
Anlage 2-22 a: Emissionswerte 2010 - Gesamtkohlenstoff, Harry Block, Seite 60<br />
Chlorwasserstoff, Stickoxide<br />
Anlage 2-22 b: Emissionswerte 2010 - Schwefeldioxid, Staub, Harry Block, Seite 61<br />
Kohlenmonoxid<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 117<br />
Anlage 2-22 c: Emissionswerte 2010 - Quecksilber etc. Harry Block, Seite 61<br />
Anlage 2-22 d: Emissionswerte 2010 - Cadmium, Thallium, Harry Block, Seite 61<br />
Antimon etc, Dioxine und Furane<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 118<br />
Anlage 3: CO2-Minderung durch den Einsatz Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 17<br />
alternativer Einsatzstoffe<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 119<br />
Zu Anlage 3: CO2-Minderung durch den Einsatz Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 17<br />
alternativer Einsatzstoffe<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 120<br />
Anlage 4: Spurenelementgehalte in deutschen Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 23<br />
Normzementen<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 121<br />
Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mit- Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 24<br />
verbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 122<br />
Zu Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mit- Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 24<br />
verbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 123<br />
Zu Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mit- Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 24<br />
verbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 124<br />
Zu Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mit- Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 24<br />
verbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 125<br />
Zu Anlage 5: Untersuchung des Einflusses der Mit- Dr.-Ing. Martin Oerter, Seite 24<br />
verbrennung von Abfällen in Zementwerken<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 126<br />
Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 127<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 128<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 129<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 130<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 131<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 132<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 133<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 134<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 135<br />
Zu Anlage 6: Qualitätssicherungskonzept für Ersatzbrennstoffe Tino Villano, Seite 38<br />
__________________________________________________________________<br />
Erstellt durch Lutz Weber, Tino Villano, Ingo Leth,<br />
Dilek Teoman, Martin Hauswirth,<br />
Gerlinde Hauswirth, Markus Rauser,<br />
Rüdiger Fleck, Enrico Fische<br />
Erstellt am 16.04.2013 Vers. 1<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 136<br />
Anlage 7: Emissionsbericht für das Jahr 2011 Tino Villano, Seite 65<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013
Seite 137<br />
Anlage 8: Tagesmittelwertverteilung: Hg-Emissionen Ofen Tino Villano, Seite 79<br />
Konzentration [mg/Nm³]<br />
0,040<br />
0,035<br />
0,030<br />
0,025<br />
0,020<br />
0,015<br />
0,010<br />
0,005<br />
Tagesmittelwertverteilung: Hg Emissionen Ofen<br />
0,000<br />
01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01.<br />
Erörterungstermin Lafarge Zement Wössingen GmbH, 23.04.2013





![presse neu [Schreibgeschützt]](https://img.yumpu.com/25873015/1/184x260/presse-neu-schreibgeschutzt.jpg?quality=85)