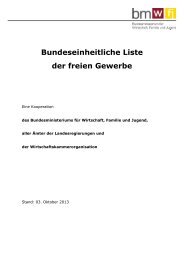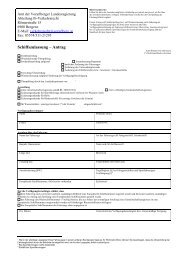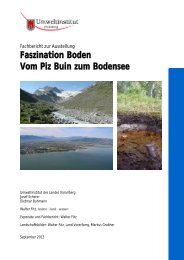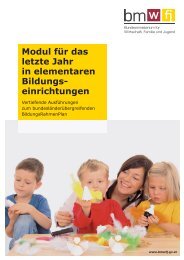Annemarie Bösch-Niederer, „Der kunstreiche Herr ... - Vorarlberg
Annemarie Bösch-Niederer, „Der kunstreiche Herr ... - Vorarlberg
Annemarie Bösch-Niederer, „Der kunstreiche Herr ... - Vorarlberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschichtsverein<br />
Region Bludenz<br />
Bludenzer Geschichtsblätter<br />
104 (2013)
Impressum<br />
Herausgeber der Bludenzer Geschichtsblätter:<br />
Geschichtsverein Region Bludenz, Postfach 103, 6700 Bludenz<br />
Schriftleiter:<br />
Univ.-Doz. Dr. Manfred Tschaikner,<br />
<strong>Vorarlberg</strong>er Landesarchiv, Kirchstraße 28, 6900 Bregenz<br />
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die Verfasser verantwortlich.<br />
Adresse der Verfasser:<br />
Dr. <strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong>, <strong>Vorarlberg</strong>er Landesarchiv, Kirchstr. 28, 6900 Bregenz<br />
Dr. Helmut Tiefenthaler, Kummenweg 8, 6900 Bregenz<br />
© 2013 Bludenz<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Satz, Umbruch und Bildbearbeitung: Grafik-Design Frei, Götzis<br />
Papier: Claro Bulk<br />
Druck: Buchdruckerei Lustenau, Lustenau<br />
Bindung: Buchbinderei Albrecht, Baindt<br />
Printed in Austria<br />
ISBN 978-3-901833-32-8
Inhalt<br />
Helmut Tiefenthaler<br />
Entwicklungen des Bergwanderns am Beispiel Brandnertal 4<br />
<strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong><br />
<strong>„Der</strong> <strong>kunstreiche</strong> <strong>Herr</strong> Blasius Nezer“ 28<br />
Eugen Probst<br />
Gefälschte Ansicht der Burg Sonnenberg 47<br />
Manfred Tschaikner<br />
Das Urbar der <strong>Herr</strong>schaften Bludenz und Sonnenberg 49<br />
von 1620 – ein Überblick<br />
Manfred Tschaikner<br />
Ein Brief aus Sabatisch (1642) – 75<br />
Walgauer Täufer in Mähren und Oberungarn<br />
Manfred Tschaikner<br />
Der Galgen am Satteinser Berg 81<br />
Manfred Tschaikner<br />
Siedelten sich im Spätmittelalter Juden in Bludenz an? 82<br />
Manfred Tschaikner<br />
Die einzige bekannte Urkunde der <strong>Herr</strong>en von Nenzing (1328) 85
<strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong><br />
<strong>„Der</strong> <strong>kunstreiche</strong> <strong>Herr</strong> Blasius Nezer“<br />
Aktuelle Forschungsergebnisse zur Musikerfamilie Ne(t)zer in Bludenz<br />
Das öffentliche Musikleben in den Städten und Gemeinden abseits der größeren<br />
<strong>Herr</strong>schaftszentren wurde bis zum Erwachen einer interessierten Bürgerschaft und<br />
der Gründung von Musikgesellschaften und -vereinen im ausgehenden 18. Jahrhundert<br />
ausschließlich von Lehrern und Organisten gestaltet. 1 In ihren Reihen entdeckt<br />
man mitunter kompositorisch begabte Pädagogen, die es unter anderen sozialen<br />
und künstlerischen Voraussetzungen durchaus zu höheren Ehren geschafft hätten.<br />
Ihre Werke, anerkannt und oftmals gepriesen von den Zeitgenossen, schlummern –<br />
sofern sie der Vernichtung oder dem Verlust entkommen sind – heute in Archiven.<br />
In Bludenz war man besonders bemüht, auf die Musikalität des Pädagogen zu achten,<br />
war er doch dazu verpflichtet, ausgewählte Schüler im Choral- und Figuralgesang zu<br />
unterrichten. 2 Schulstiftungen weisen bereits im 17. Jahrhundert darauf hin. 3 Zentrales<br />
Anliegen war die sorgfältige Pflege des Gesanges zur festlichen Ausgestaltung<br />
der Liturgie. Bevorzugt wurden Schulmeister wurden, die ihre eigene Familie zum<br />
Kirchendienst einsetzen konnten, wie jene des Christoph Machleid aus Konstanz in<br />
den 1750er und 1770er Jahren. Machleids Ehefrau wie auch die beiden Söhne Johann<br />
Baptist und Cajetan besaßen musikalische Fähigkeiten, worauf in den schriftlichen<br />
Quellen mehrmals hingewiesen wird. 4<br />
Von 1768 (1766?) bis 1835 wirkten in Bludenz – über sechs Jahrzehnte, mit fünfjähriger<br />
Unterbrechung durch Machleid – Mitglieder der aus Tirol stammenden Familie<br />
Nezer (Netzer).<br />
Blasius Nezer 5 (1728 - 1785)<br />
Als 1765 in Bludenz der Schulmeisterposten vakant wurde, dürfte sich bald der aus<br />
Pfunds im oberen Inntal gebürtige Johann Blasius Nezer für das Amt beworben<br />
haben. 6 Er brachte beste Voraussetzungen mit, war im Orgelspiel wie auch im Komponieren<br />
versiert. Die musikalischen Schöpfungen des Zeitgenossen von Josef und<br />
1 Zur Förderung und Unterhaltung des musikalischen Lebens, zur Organisation des Musikunterrichts, zur<br />
finanziellen Sicherung des Noten- und Instrumentenankaufs wurden Gesellschaften gegründet: u.a. 1797 in<br />
Dornbirn die „Gesellschaft der Kirchenmusick“, um 1808 eine „hiesige Musikgesellschaft“ in Schruns, der<br />
„Musikverein“ in Feldkirch 1842, eine „Gesellschaft der Musikfreunde“ in Dornbirn 1883/84.<br />
2 <strong>Vorarlberg</strong>er Landesarchiv (folgend kurz: VLA), Stadtarchiv Bludenz (folgend kurz: StABlu), Fasc. 130/6 (1745/46):<br />
Instruction Eines jeweiligen Organistn vnd Schulmeister allhier Zu Bludenz; dem jetzmaligen H: Organist und<br />
Schuelmeister Johann Christoph Schmid [...]<br />
3 Zum Neßlerschen Stipendium siehe: Manfred Tschaikner, Bludenz im Barockzeitalter. In: Geschichte der Stadt<br />
Bludenz. Von der Urzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Sigmaringen 1996 (Bodenseebibliothek 39), S. 235f.<br />
Vgl. auch: P. Isidor Flür O.Cap., Kirchengeschichtliche Fragmente aus dem Walgau, H. 2, Bregenz 1926, S. 100f<br />
4 VLA, StABlu, Handschrift 22, Ratsprotokoll (fortan kurz: Rp.) 1774 bis 1779, S. 11<br />
5 Schreibweise „Netzer“ taucht erst in der nächsten Generation auf.<br />
6 Leider fehlen die Ratsprotokolle aus diesen Jahren, der genaue Dienstantritt kann daher nicht belegt werden.<br />
28
Michael Haydn wurden zu seinen Lebzeiten nicht nur geschätzt, sie wurden auch<br />
außerhalb seines Wirkungskreises handschriftlich kopiert und aufgeführt.<br />
Blasius Nezer führte ein kurzes, aber sehr bewegtes Leben: Er überlebte vier Ehefrauen,<br />
die ihm neun Kinder zur Welt brachten, und er war bereit, für einen attraktiven<br />
Dienst mit seiner gesamten Familie mehrmals den Wohnort zu wechseln. In der<br />
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts war dies nur unter denkbar beschwerlichsten Umständen<br />
zu bewältigen.<br />
Pfarrkirche Ampass/Tirol<br />
(Foto: <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong>)<br />
Geboren wurde Johann Blasius Nezer am 3. Februar 1728 als Sohn des Jakob Nezer<br />
und der Johanna Lentsch in Pfunds / Tirol. 7 Sein Ausbildungsweg ist unbekannt, seine<br />
Fähigkeiten lassen eine Klosterschule vermuten, naheliegend wäre Stams. Hier blühte<br />
in der Barockzeit nicht nur die geistliche die Musikkultur, auch weltliche Musik und<br />
Theater waren Teil der klösterlichen Repräsentation. 8 Davon zeugen die zahlreichen<br />
7 Für die Angaben danke ich <strong>Herr</strong>n Peter Schweinbacher, Genealogiebeauftragter der Pfarre Pfunds.<br />
8 Zur Musikgeschichte von Stams siehe: Kurt Drexel, Klöster und Stifte als Musikzentren. In: Musikgeschichte<br />
Tirols II (Schlern-Schriften 322), Innsbruck 2004, S. 140 bis 146
Handschriften und Drucke im Musikarchiv des Klosters, darunter auch Kompositionen<br />
von Blasius Nezer. 9 Das Zisterzienserkloster hatte Besitzungen in Pfunds, Stiftungen<br />
ermöglichten begabten Kindern den Schulbesuch. Noch ist aber nicht erwiesen,<br />
dass Blasius zu den Stipendiaten gehörte.<br />
Die ersten Berufsjahre führen ihn in die Nähe von Innsbruck. Fünfzehn Jahre, von 1751<br />
bis 1766 ist er in Ampass tätig. Hier schließt der Lehrer und Organist am 4. Februar<br />
1751 seine erste Ehe mit Anna Kindl. 10 Wenige Monate nach der Geburt des ersten<br />
Kindes Christian (1751) stirbt am 19. April 1752 die Gattin Anna. 11 Blasius vermählt sich<br />
bald darauf, am 25. September 1752, mit Maria Catharina Mingl. 12 In den folgenden<br />
Jahren werden in Ampass Maria Brigitta (1753), Maria Anna (1755) 13 , Johann Georg<br />
(1758) und Johann Baptist (1762) getauft. 14 Der älteste Sohn Christian aus erster Ehe,<br />
wie auch die Töchter Maria Brigitta und Maria Anna aus der zweiten Ehe überleben<br />
das Kindesalter nicht. 15<br />
Dass Blasius Nezer bereits in diesen Ampasser Jahren die Kunst des Komponierens<br />
beherrschte, bezeugen Handschriften und Drucke, die im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum<br />
aufbewahrt werden. Eine Niederschrift eines religiösen Volksschauspiels<br />
(„Maria Hilf-Spiel“) vermerkt: Die music hat componirt der Kunstreiche <strong>Herr</strong> Blasius<br />
Nezer, organist zu ampass. 16 Die Musik selbst ist leider verschollen. 17<br />
Um 1765/66 beschließt der 37jährige Blasius Nezer, Tirol zu verlassen und die seit 1765<br />
vakante Stelle als Lehrer und Organist in Bludenz anzunehmen. 18 Die Beweggründe<br />
für den Familienvater über den Arlberg zu ziehen, liegen im Dunkeln, vielleicht waren<br />
es die Lage der Stadt, die Nähe zu Feldkirch, einem musikalisch-kulturellen und pädagogischen<br />
Zentrum der Region, oder auch die Nähe zum Dominikanerinnenkloster St.<br />
Peter mit seiner nicht unbeachtlichen Musiktradition. 19 Sechs Jahre, von 1768 bis 1774,<br />
kann Netzers erster Aufenthalt in Bludenz eindeutig nachgewiesen werden. Vermutlich<br />
war er bereits zwei Jahre zuvor mit seiner Familie hierhergekommen, denn am<br />
9 Eine Inventarisierung erfolgt von Hildegard <strong>Herr</strong>mann-Schneider, siehe dazu: „Répertoire International des<br />
Sources Musicales“ (www.rism.info/en/home.html)<br />
10 Tiroler Landesarchiv (folgend kurz: TLA), Mikrofilm (folgend kurz: MF) 643/1 Pfarrarchiv (folgend kurz: PfA)<br />
Ampass, Traubuch B 1 1750 bis 1784, Eintragung 4. Februar 1751.<br />
11 TLA, MF 641/8 PfA Ampass Taufbuch III 1750 bis 1783, Eintragung 25. Dezember 1751 und MF 643/8 PfA Ampass,<br />
Tauf-, Trau- und Totenbuch 1724 bis 1769, Eintragung 19.April 1752.<br />
12 TLA, MF 643/1 PfA Ampass, Traubuch B1 1750 bis 1784, Eintragung 25. September 1752. In den Sterbbüchern von<br />
Bludenz wird sie „Meingeinin“ genannt<br />
13 TLA, MF 643/8 PfA Ampass, Tauf-, Trau- und Totenbuch 1724 bis 1769, Eintragung 21. Dezember 1753 sowie 13. Mai<br />
1755.<br />
14 TLA, MF 641/8 PfA Ampass, Taufbuch III 1750 bis 1783. Eintragungen 18. April 1758 und 14. Februar 1762.<br />
15 TLA, MF 643/8 PfA Ampass, Tauf-, Trau- und Totenbuch 1724 bis 1769, Eintragung 14. April 1762 und MF 643/9 PfA<br />
Ampass, Totenregister.<br />
16 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Bibliothek, Maria Hilf-Spiel FB 317/4<br />
17 Vgl. dazu: Thomas Naupp, Zeugnisse des Musiklebens aus dem Benediktinerstift St. Georgenberg – Fiecht vom<br />
17. bis zum 19. Jahrhundert. In: Musikgeschichte Tirol, hg. Kurt Drexel und Monika Fink, Bd.2, (Schlern-Schriften<br />
322), Innsbruck 2004, S. 244.<br />
18 Die Schulmeisterstelle in Bludenz betreffend siehe: VLA, Landgericht (fortan kurz: LG) Bludenz -Sonnenberg Sch<br />
160/20 (1765)<br />
19 Netzers Wirkungsstätten waren immer in der Nähe von Klöstern: Ampass - Stift Wilten, Tschengls - Kloster St.<br />
Johann im Münstertal. In St. Peter bei Bludenz ist mehrstimmiger Gesang bereits im 17. Jahrhundert belegt,<br />
überliefertes Notenmaterial zeugt von beachtlichen Aufführungen im 18. Jahrhundert. Zur Musikgeschichte<br />
siehe: Anton ROHRER, Pflege der Kirchenmusik in St. Peter. In: Das Dominikanerinnenkloster St. Peter in Bludenz.<br />
Ein Beitrag zur Geschichte des ältesten Frauenklosters <strong>Vorarlberg</strong>s. Bludenz [2007], S. 103 bis 118.<br />
30
22. Mai 1766 stirbt in Bludenz nach vierzehnjähriger Ehe Catharina Meingeinin Coniux<br />
D. Organicij Blasij Nezer Tyrolensis, die zweite Gattin. 20 Ein halbes Jahr später, am 26.<br />
Jänner 1767, geht D[ominus] Blasius Nezer – seine Profession wird diesmal nicht angeführt<br />
- eine dritte Ehe mit Barbara Garnutsch (1728-1771) aus Rungelin ein. 21<br />
Heirat mit Barbara Garnutsch, Eintrag Traubuch, 1627-1889 (Abschrift Film 394/3) fol. 50/I<br />
Zwei weitere Söhne erblicken in Bludenz das Licht der Welt: am 13. Oktober 1768 Christian<br />
Andreas, am 6. Februar 1770 Johann Blasius. 22 Wieder treffen den Tiroler Organisten<br />
schwere Schicksalsschläge: am 9. Februar 1771 verunglückt nicht nur eines seiner<br />
Kinder, vermutlich Christian Andreas, am 22. März dieses Jahres stirbt auch die dritte<br />
Gattin Barbara. 23 Diesmal zögert er mit einer erneuten Heirat, spielt aber mit dem<br />
Gedanken, sich ganz in Bludenz niederzulassen und das Bürgerrecht zu erwerben.<br />
1774 wird zu einem Jahr großer Entscheidungen. Am 13. Mai werden seine drei Söhne<br />
Johann Georg, Johann Blasius und Johann Baptist gefirmt. 24 Um die Familie kostengünstiger<br />
zu versorgen – über drei Jahre hinweg war er gezwungen gewesen, Dienstboten<br />
zu beschäftigen – trifft er zum Wohl [seiner] Kinder und [seiner] Würtschaft<br />
mit der Bludenzer Bürgerstochter Elisabeth Burger Sponsalien, d. h. ein Eheverlöbnis.<br />
25 Nezers Hoffnung, mit dieser Heirat auch seine soziale Stellung zu verbessern<br />
und in die Bludenzer Bürgerschaft aufgenommen zu werden, erfüllt sich aber nicht.<br />
20 VLA, PfA Bludenz, Sterb-Trauungs-Firmbuch Bludenz 1668 bis 1805, S. 195<br />
21 VLA, PfA Bludenz, Traubuch 1627 bis 1889, Eintragung 26. Jänner 1767<br />
22 VLA, PfA Bludenz, Tauf- und Trauungsbuch 1668 bis 1787, S. 376 und 381<br />
23 VLA, PfA Bludenz, Sterb-Trauungs-Firmbuch 1668 bis 1805, S. 205 – der Name des Kindes ist hier nicht<br />
angegeben<br />
24 VLA, PfA Bludenz, Sterb-Trauungs-Firmbuch 1668 bis 1805, S. 7<br />
25 VLA, StABlu, Fasc. 116/23, Ansuchen um Bürgeraufnahme vom 10. September 1774
Am 10. September 1774 erscheint er persönlich mit einem schriftlichen Ansuchen<br />
um die Bürgerschaft vor dem Rat und drängt auf eine Entscheidung, weil seine Zeit<br />
anrückt, so könne er nicht länger warten. Die Zeit für die Neubestellung im Schul- und<br />
Organistendienst war gekommen, das neue Schuljahr sollte bald beginnen. Der Rat<br />
beschließt, Netzer auch weiterhin auf sein Wohlverhalten den Dienst zu überlassen<br />
und zwei Söhnen – vermutlich den jüngeren Johann Baptist und Johann Blasius – im<br />
Falle seines Ablebens das Bleiberecht in Aussicht zu stellen. Das Bürgerrecht wird ihm<br />
aber verweigert: dass er fur iezt weder für Gebühr noch sonst aufgenommen werde. –<br />
Wohl aber, wenn er (Gott verhüte es lang) vor denen Kindern dahin sterbn sollte, wurde<br />
man seine 2 Söhne nicht sobald verstoßen. 26<br />
Heirat mit Elisabeth Burger, Eintrag Traubuch, 1627-1889 (Abschrift Film 394/3) fol. 57/I<br />
Der Organist heiratet am 19. September 1774 die wesentlich jüngere Elisabeth Burger<br />
(1747 – 1778) 27 und erscheint am 22. Oktober nochmals vor dem Rat um seine<br />
Beschwerde über die Abfuhr vorzubringen und seine Resignation mitzuteilen. 28<br />
In weiterer Folge bemüht sich Blasius Nezer um eine neue Stellung, die er schlussendlich<br />
er in Südtirol findet und verlässt somit Bludenz. Als der Organist persönlich<br />
im Marienwallfahrtsort vorstellig wird, eilt ihm bereits ein guter Leumund voraus,<br />
man beschreibt ihn als Mann von guter auffiehrung und in seiner Musicalischen<br />
26 VLA, StABlu, Handschrift 22, Rp. 1774 bis 1779, S. 4, der älteste Sohn Johann Georg war zu diesem Zeitpunkt<br />
bereits 14jährig und dürfte sich in Ausbildung an einem anderen Ort aufgehalten haben.<br />
27 VLA, PfA Bludenz, Traubuch 1627 bis 1889, Eintrag 19. September 1774.<br />
28 VLA, StABlu Handschrift 22, Rp. 1774 bis 1779, S. 410<br />
32
Ansuchen um Bürgeraufnahme<br />
vom 10. September<br />
1774. VLA, StABlu Fasc.<br />
116/23<br />
Wissenschaft ebenso beriemt als mit Instruierung dero Jugend sich […] Meritn erworben.<br />
29 Die folgenden Jahre verbringt Nezer in Tschengls, das wie Bludenz noch zur<br />
Diözese Chur gehörte. Man könnte vermuten, dass er während seines Aufenthaltes<br />
im Vintschgau Kontakte zu den Benediktinerinnen St. Johann in Müstair pflegte,<br />
denn Abschriften seiner Kompositionen werden noch heute im Musikarchiv des Klosters<br />
aufbewahrt: zwei Lauretanische Litaneien, zwei Lateinische Messen und zwei<br />
geistliche Gesänge. 30<br />
29 PfA Tschengls, Lade PAT_DIV-VI Schulsachen, undatiertes fragmentarisches Schreiben bezüglich des<br />
Schuldienstes.<br />
30 Verzeichnisse des Notenmaterials im „Répertoire International des Sources Musicales (kurz RISM)“. 1757 hatte<br />
im Kloster eine aus Pfunds gebürtige Schwester Maria Gabriela Cäcilia Tschott Profess gefeiert. Siehe dazu: P.<br />
Albuin O.M.Cap., Geschichte des Bündnerischen Münstertales, Sterzing 1931, S. 431
Lytaniae Lauretanae, Archiv Kloster St. Johann Müstair, Ms A 159<br />
In Tschengls erlebt die Familie weiteren Zuwachs: Sohn Christian Carl (1775) und<br />
Tochter Maria Elisabetha (1776) werden geboren 31 . Doch bald schlägt das Schicksal<br />
wieder zu. Die Matrikenbücher verzeichnen am 10. April 1778 das Ableben der aus<br />
Bludenz gebürtigen Gattin Elisabeth Burger. Die Witwe Anna Maria Wiser wird ein<br />
halbes Jahr später Nezers fünfte Gattin. Die Eheschließung erfolgt in Tschengls am<br />
26. November 1778. 32<br />
In Bludenz ging die Besetzung des Schulmeister- und Organistendienstes indes nicht<br />
reibungslos vonstatten. Als Nachfolger Nezers war sein Vorgänger Johann Christoph<br />
Machleid angenommen worden. Wiederholte Kontroversen bewogen den Magistrat<br />
jedoch, sich nach vier Jahren um einen neuen Organisten umzusehen. 33 Die Stadt<br />
beschließt am 14. Mai 1778 mit Blasius Nezer aus Tschengels in Tirol in Kontakt zu treten<br />
und lässt schriftlich anfragen, ob er denn bereit wäre, den organist dienst allein,<br />
welcher um 146 fl verringert wordn annehmen, und etwa binnen einem Viertl Jahr sich<br />
31 PfA Tschengls, Taufbuch I 1661 bis 1784, Eintragung 13. Mai 1775 und 6. Oktober 1776<br />
32 PfA Tschengls, Traubuch I, 1661 bis 1794, Eintragung 26. November 1778.<br />
33 Vgl. Wolfgang Scheffknecht, Bludenz im Jahrhundert der Aufklärung (1730 bis 1814). In: Geschichte der Stadt<br />
Bludenz , hg. Manfred Tschaikner (Bodensee-Bibliothek 39), Bludenz 1996. S. 374f<br />
34
stelln wurde. 34 Man hatte sich an den bereits bewährten Organisten erinnert. Die Verhandlungen<br />
zögern sich aber hinaus. Ausschlaggebend dazu dürften finanzielle Fragen<br />
gewesen sein, inzwischen war im Zuge der Umsetzung der neuen Schulgesetzte<br />
das Schulamt vom Organistenamt getrennt worden, das Einkommen des Organisten<br />
somit deutlich geschmälert. Nezer war bis 1774 auch Lehrer gewesen, hatte aber<br />
ohne Zusatzausbildung und Prüfung nun keine Befugnis mehr, diesen Beruf auszuüben.<br />
Machleid, der sich für die Weiterbildung und den Besuch der Normalschule in<br />
Feldkirch bereit erklärt hatte, bleibt noch ein weiteres Jahr im Amt, kündigt aber an,<br />
am St. Gallustag (16. Oktober) 1779 einen neuen Dienst in Chur antreten zu wollen.<br />
Am 9. Oktober ordnet nun der Rat an, Blasius Nezer nochmals zu schreiben und ihm<br />
34 VLA, StABlu, Handschrift 22, Rp. 1774 bis 1779, S. 230<br />
Pfarrkirche Tschengls/<br />
Südtirol (Foto: <strong>Bösch</strong>-<br />
<strong>Niederer</strong>)
mitzuteilen, dass der dienst vacant und künftig gegen 180 od[er] 200 fl. Dem Organisten<br />
gegeben werdn. 35<br />
Der 51jährige entscheidet sich, nach Bludenz zurück zu kehren. Dieses Angebot übertrifft<br />
das Tschengler Einkommen. 36 Eine fixe Summe von 200 Gulden erhält er allerdings<br />
nicht, dafür werden ihm Naturalleistungen zugesagt. Am 13. November 1779<br />
wird er als Organist angestellt, gegen jährl[ichen] Gehalt per 176 fl [Gulden] 59 1 /2 x<br />
[Kreuzer] nebst einem Acker von ehemalign Schuelgueter, Nothduerft Holz und Quatier<br />
Befreyung. 37 Lehrer wird zugleich Jakob Fickelscherrer mit einem Gehalt von 200<br />
Gulden.<br />
1780 kommt es zu einer neuen Festlegung des Gehaltes. Demzufolge erhält der<br />
Organist neben Quartier- und Holzfreiheit – für den Scheiterlohn muss er selbst aufkommen<br />
– für den Dienst an der Pfarrkirche St. Laurentius als Solarium 72 Gulden 1<br />
1 /2 Kreuzer. Mit den Beträgen u.a. für gestiftete Jahrtage (34 Gulden 28 Kreuzer), den<br />
Choral zur Advent und Fastenzeit (20 Gulden), für Rorate-Ämter (3 Gulden), Dienst an<br />
der Filialkirche St. Leonhard (24 Gulden), aus dem Betteltuch-Amt (13 Gulden), Spitalamt<br />
(12 Gulden 12 Kreuzer) und Spendamt (6 Gulden 17 1 /2 Kreuzer), kommt er auf eine<br />
feste Summe von 190 Gulden 14 1 /2 Kreuzer. Dazu gibt es pro Hochzeit 30 Kreuzer und<br />
ebenso Beträge für Beerdigungen und Gottesdienste der Bruderschaften. 38 Als 1783<br />
die Bruderschaften per kaiserlichem abgeschafft wurden, musste auch der Organist<br />
Eintrag des Ablebens von Blasius Nezer in das Tauf- Trau- und Sterbbuch 1668 bis 1805, S. 233<br />
35 Ebenda S. 357<br />
36 Vgl. Pfarrarchiv Tschengls, Lade PAT-DIV-VI Schulsachen, Rechnungen<br />
37 VLA, StABlu, Handschrift 23, Rp. 1779 bis 1783, S. 4.<br />
38 VLA StABlu, Fasc. 198/42, Aufstellung der Einkünfte des Organisten laut Magistratsresolution vom 27.4.1780<br />
36
Titelblatt zu „IV Hymni de<br />
Venerabili“, Musikbibliothek<br />
Kloster Stams<br />
finanzielle Einbußen hinnehmen. 39 Damit dürften sich die Lebensumstände der<br />
Familie maßgeblich verschlechtert haben.<br />
Sechs Jahre nach seiner Rückkehr nach Bludenz, am 29. September 1785, stirbt der<br />
erst 57Jährige. 40 Die Todesursache ist nicht bekannt. In den Quellen finden sich bereits<br />
einige Jahre zuvor Hinweise auf Alkoholmissbrauch, Polizeiprotokolle sprechen dem<br />
Organisten Blasi Nezer Verwarnungen wegen Vollsaufens aus. 41 Der Pfarrherr tituliert<br />
ihn dennoch ehrend in den Sterbmatriken als honestus ac Artis peritus Dominus. 42<br />
Blasius Nezer war ein unter Zeitgenossen anerkannter Komponist. Ihm zugeschriebene<br />
Musikalien wurden und werden z.Teil noch heute in den Klöstern Müstair in<br />
39 Vgl. P. Isidor Flür, S. 8; Fußnote 3; VLA, StABl, Fasc. 198/42, spätere Anmerkung zur Rosenkranz-Bruderschaft: Ist<br />
aufgehoben.<br />
40 VLA, PfA Bludenz, Tauf- Trau- und Sterbbuch 1668 bis 1805, S. 233<br />
41 VLA, StABlu, Handschrift 23, Rp. 1778 bis 1783, S. 72<br />
42 VLA, PfA Bludenz, Tauf- Trau- und Sterbbuch 1668 bis 1805, S. 233
der Schweiz, St. Georgenberg/Fiecht 43 , Stams und Wilten in Tirol, in den Pfarrarchiven<br />
Sterzing und Schwaz 44 und im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum aufbewahrt.<br />
Auch in <strong>Vorarlberg</strong> waren Musikalien verbreitet, die heute jedoch verschollen sind.<br />
Im Mai 1790, fünf Jahre nach dem Tod des Musikers hatte der Feldkircher Chorregent<br />
Johann Georg Schaller um 1 Gulden 20 Kreuzer ein Offertorium von Nezer erworben,<br />
das heute leider nicht mehr vorhanden ist. 45 Im Pfarrarchiv Bludenz finden sich aus<br />
dem Besitz der Familie handschriftliche Choralbücher.<br />
Blasius Nezer schreibt für eine sparsame Besetzung, solistische und auch zwei bis<br />
vierstimmige Kompositionen. An instrumentaler Begleitung genügen Orgel und<br />
Streicher, für besondere Anlässe nimmt er Hörner, aber auch Trompeten hinzu. Das<br />
Repertoire entspricht den kirchlichen Hochfesten: Lateinische Hymnen, Litaneien,<br />
Messen, aber auch deutsche Gesänge. 46<br />
Johann Georg Nezer /Netzer (1758-1829)<br />
Johann Georg, der älteste von den drei überlebenden Söhnen des Blasius, geboren<br />
am 18. April 1758 in Ampass, tritt die Nachfolge seines Vaters in Bludenz an und<br />
wird hier über 42 Jahre hinweg, von 1785 bis 1827, als Organist an der Pfarrkirche St.<br />
Laurentius und der Filialkirche St. Leonhard wirken. Er selbst zeichnet vorerst noch<br />
mit „Nezer“, in späteren Jahren jedoch mit „Netzer“. Sein Ausbildungsweg ist nicht<br />
bekannt. Bei der Übernahme des Organistenamtes ist er bereits 27 Jahre alt, man<br />
kann annehmen, dass er zuvor an einem anderen Ort tätig gewesen war. Drei Jahre<br />
nach Amtsantritt ehelicht er am 21. April 1788 die 32jährige Franziska Theodora Mangart,<br />
die Verbindung bleibt aber kinderlos. 47<br />
Ein zusätzliches Einkommen erwirbt sich Netzer zwischen 1796 bis 1800 durch die<br />
Verpflegung von Soldaten, er erhält Einkünfte aus den Realitäten seiner Schwiegermutter<br />
in Bürs und ist als Kanzlist tätig. 48<br />
Unter Johann Georg Netzer dürfte die instrumental begleitete Kirchenmusik geblüht<br />
haben, mehrmals verzeichnen Rechnungen Ausgaben für Saiten. 49 Auch er wird als<br />
Komponist erwähnt. Im Dezember 1806 verfasst Joseph Hilar Dialer, königl. bayr. provisorischer<br />
Administrator, ein Empfehlungsschreiben, worin er den Organisten nicht<br />
nur als pünktlich, genau und ruhig, sondern auch durch seine in musikalischen Sache,<br />
43 Der Musikalienbestand des Klosters St. Georgenberg/Fiecht wurde bei einem Brand vernichtet, über den ehemaligen<br />
Bestand informiert jedoch ein Musikalienverzeichnis. Vgl. Thomas Naupp, Fußnote 17, S. 229f<br />
44 Die Musikalien des Schwazer Pfarrarchivs gehören heute zum Bestand des Tiroler Landesmuseum<br />
Ferdinandeum. Nach Schwaz dürften sie zwischen 1779 und 1794 gekommen sein.<br />
45 StA Feldkirch, F II/92, Akt 14, Musikalienverzeichnis vom 26.3.1790; im Musikalienverzeichnis von Columban<br />
Alder 1803 scheint die Komposition nicht mehr auf. Vgl. Ebda., F I Sch 29 F 30<br />
46 Vorläufige Werksverzeichnisse von Blasius und Franz Salers Netzer sind publiziert in: <strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<br />
<strong>Niederer</strong>, Vergessene Talente: Die Musikerfamilie Nezer (Netzer) in Bludenz. In: Montfort . Zeitschrift für<br />
Geschichte <strong>Vorarlberg</strong>s 2012/2, S. 81 f<br />
47 VLA, PfA Bludenz, Tauf- Trau- und Sterbbuch 1668 bis 1805, o.S.<br />
48 VLA, StABlu, Fasc. 198/42, Rechnungen und Einkommensaufstellung; Fasc. 185/41 Rechnungstellung für<br />
Schreiberdienste 3. Juli 1807<br />
49 Vgl. Anton ROHRER, Die Bludenzer Kirchenmusik. In: Bludenzer Geschichteblätter 1988/2, S.27<br />
38
und Kompositionen bewiesene Geschicklichkeit und guter Kenntnisse [...] beschreibt.“ 50<br />
Johann Georg Netzers Werke sind leider verschollen. Als der als friedfertig, eifrig und<br />
geschickt in seinen Diensten charakterisierte 72jährige Organist am 13. April in 1829 in<br />
Bludenz Haus Nr. 88 an Brustwassersucht stirbt, 51 hinterlässt er u.a. einige Musikalien,<br />
die Basil Beiser, städtischer Kommunalverwalter, 52 um zwei Gulden erwirbt, darüber<br />
hinaus auch ein völlig unbrauchbares Klavier, das Mathis Müller für das Kloster St.<br />
Peter um 40 Kreuzer ersteigert. Ein großes Choralbuch, ebenfalls aus Johann Georgs<br />
Besitz, stand nach seinem Ableben in Gebrauch von Stadtpfarrer Michael Duelli.<br />
Die Verlassenschaftsabhandlung gibt nicht nur Auskunft über den dürftigen Besitz<br />
des Verstorbenen Organisten Johann Georg Netzer, sie informiert auch über die<br />
Familienverhältnisse. Als hinterbliebene Verwandte werden darin Bruder Christian<br />
(1775 bis 1830), Organist und Lehrer in Zams – Vater des weithin bekannten Komponisten<br />
und Kapellmeisters Johann Josef Netzer (1808-1864) – sowie die Kinder des bei<br />
Luzern verstorbenen Bruders Johann erwähnt. 53<br />
Die Witwe Franziska überlebt den Gatten nur um wenige Jahre, sie stirbt am 6. Juli<br />
1835, ohne Vermögen zu hinterlassen, im Armenhaus. Die Nachfolge im Organistenamt<br />
bleibt indessen weiter in der Familie.<br />
Karl Christian Netzer (1775-1830)<br />
Christian ist der einzige Sohn des Blasius Netzer und der Bludenzerin Elisabeth Burger.<br />
Er wird früh zum Waisen, seine Mutter war bald nach seiner Geburt in Tschengls/<br />
Südtirol verstorben, beim Tode seines Vaters Blasius 1786 ist er gerade elf Jahre alt.<br />
1794 bestätigt Johann Georg Nezer einen Betrag von 19 Gulden 56 Kreuzer, den der<br />
Administrator 1791 in seinem Namen auf feldkirch von wegen meinem Bruder Christian<br />
bezahlte. 54 In Feldkirch erhielt Christian eine gehobene Ausbildung. 1789/90<br />
sowie 1790/91 wird er in den Matriken des Gymnasiums geführt. 55 Feldkirch hatte<br />
gewiss kirchenmusikalisch eine Vorbildfunktion im Lande, hier hatte der ehemalige<br />
Bludenzer Organist und Lehrer Christoph Schmid (1709-1788) in seiner 40jährigen<br />
Tätigkeit als Chorregent ein beachtliches Repertoire erarbeiten können. 56 Auch sein<br />
Nachfolger Johann Georg Schaller (1742-1801) war sehr um die Kirchenmusik und den<br />
50 VLA, StABlu, Fasc. 198/42. Schreiben vom 5. Dezember 1806.<br />
51 VLA, PfA Bludenz, Sterbbuch 1785 bis 1839, S. 136<br />
52 Basil Beiser (1795 bis 1875), aus Lech/Omisberg gebürtig, war 1817 als Schreiber nach Bludenz gekommen und<br />
hier später als städtischer Kommunal- und Stiftungsverwalter und als Wirt im Bad Fohrenburg tätig. Beiser war<br />
eine bemerkenswerte Persönlichkeit der kulturellen und politischen Elite der Region. Sein Interesse galt nicht<br />
nur der Erhaltung von Baudenkmälern, auch der Philosophie und der Musik. Er ist Großvater des Volkstanzforschers<br />
August Schmitt. Vgl. dazu: <strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong>, „En offi, en ahi“. Zum Volkstanz. Forschung und<br />
erste Versuche einer Wiederbelebung in <strong>Vorarlberg</strong>. Montfort Jg. 61 (2009), H.4, S. 277 bis 290<br />
53 VLA, Landgericht (fortan kurz: LG) Bludenz, Verlassenschaften, Johann Georg Netzer Sch 214, 551; Einschaltung<br />
im Boten für Tirol und <strong>Vorarlberg</strong> Nr. 96, 10.11.1829; vgl. auch: Anton Rohrer 1988/2, S. 25 bis 34.<br />
54 VLA, StABlu, Fasc. 185/41 Schreiben vom 29. April 1794<br />
55 Andrea Sommerauer, Matricula Gymnasii Feldkirchensis. In: Alemannia Studens 5. Mitteilungen des Vereins für<br />
<strong>Vorarlberg</strong>er Bildungs- und Studenten-Geschichte, Regensburg 1995, S. 61f<br />
56 Vgl. <strong>Annemarie</strong> <strong>Bösch</strong>-<strong>Niederer</strong> (Hg.), Die Musikdrucke des historischen Archivs des Domchores zu St. Nikolaus<br />
in Feldkirch (Quellen und Studien zur Musikgeschichte <strong>Vorarlberg</strong>s 1), Regensburg 2005.
Musikunterricht bemüht. Es ist nicht auszuschließen, dass der Organist von St. Nikolaus<br />
Johann Udalrich Friz zu Christians Lehrern gehörte.<br />
Seine ersten Erfahrungen als Organist dürfte er in Bludenz gesammelt haben, wo<br />
auch sein Bruder als Organist wirkte. 1794 sucht er in einem Schreiben an seinen<br />
„Waisen-Vatter“ Joseph Duelli, Bürgermeister von Bludenz, um die Auszahlung des<br />
ausständigen Orgelzinses von 67 Gulden an.<br />
Schreiben Christian Netzers an<br />
den k.k. Administrator Joseph<br />
Duelli 25. November 1794, VLA,<br />
StABlu Fasc. 185/41<br />
1793/94 kommt Christian als Schullehrer und Organist nach Wenns ins Tiroler Pitztal, 57<br />
später nach Zams. Mit seiner Gattin Viktoria Geiger erfreute er sich einer großen Kinderschar.<br />
Seine Nachkommen sind höchst musikalisch und erhalten von ihrem Vater<br />
den ersten Musikunterricht.<br />
Sohn Johann Josef (1808-1864) wird es bis zum angesehenen Kapellmeister bringen<br />
(an Theatern in Leipzig, Wien, Mainz und Graz) und ist unter seinen Zeitgenossen als<br />
Komponist (Oper „Mara“, vier Sinfonien u.a.) weithin anerkannt. Bereits im zehnten<br />
57 VLA, StABlu Fasc. 185/41, Amtliche Bekundung der Anstellung des Christian Nezer in Wenns 14.September 1794.<br />
40
Lebensjahr spielte und phantasirte [er] mit seltener Geläufigkeit auf dem Claviere. 58 Er<br />
wurde Schüler Johann Gänsbachers und Simon Sechters und lebte u.a. mehrere Jahre<br />
in Wien, wo er Kontakte zum Schubertkreis gepflegt haben soll. 59 Seine Werke kamen<br />
u.a. auch in Feldkirch zur Aufführung. 1842 wurde unter Leitung des Musikdirektors<br />
Georg Frick (1805-1891), einem gebürtigen Tiroler, bei einer Musikalischen Produktion<br />
in Feldkirch Josef Netzers Duett „Lore Ley“ dem Publikum vorgestellt, 1849 ein Duett<br />
aus der Oper „Mara“.<br />
Aufführung eines<br />
Duetts aus der<br />
Oper „Mara“ von<br />
Johann Josef<br />
Netzer bei einer<br />
musikalischen<br />
Akademie 1849 in<br />
Feldkirch. Stadtarchiv<br />
Feldkirch<br />
Akt 2315<br />
58 Wiener Zeitung 4. Juni 1864, Nachruf<br />
59 Manfred Schneider, Booklett zur CD “Josef Netzer“, Innsbruck 2005 und 2006; Vgl. auch de.wikipedia.org/wiki/<br />
Josef_Netzer
Franz Netzer (1810-1842)<br />
Nachfolger von Johann Georg Netzer wird im Jahre 1829 Franz Netzer. Mit ihm<br />
beginnt die Geschichte der Blasmusik in Bludenz. Die Anregung zu deren Gründung<br />
hatte bereits im Jahre 1827 Basil Beiser gegeben, der in einem Schreiben an den<br />
Magistrat klagt, dass keine ordentlich gut besetzte Musik vorzufinden sei und somit<br />
für die Errichtung einer Kirchen- und Feldmusik eintritt. 60 Nicht zu unrecht, denn in<br />
anderen Gemeinden war man hier bereits einen Schritt voraus. 61<br />
Komponist und Kapellmeister<br />
Johann Josef Netzer<br />
(1808 -1864). Lithografie von<br />
Gabriel Decker 1843,<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<br />
Josef_Netzer<br />
1829 vorerst provisorisch als Organist und Musiklehrer angestellt, wird Franz Netzer<br />
erst zwei Jahre später im Amt bestätigt. 62 Als sich der Magistrat 1831 endlich dazu<br />
entschließen kann, den Organistenposten definitiv zu besetzen, ist man sich bei der<br />
60 VLA, StABlu, Fasc. 418/57: Bittliches Vorwort zu Errichtung einer Kirchen und Feldmusik für die Stadtpfarrs-<br />
Gemeinde Bludenz zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Bürgerschaft 1827.<br />
61 Laut Erich Schneider (hg.), Blasmusik in <strong>Vorarlberg</strong>. Lustenau 1986, S. 99f soll in Hörbranz bereits 1797 eine<br />
Musikkapelle existiert haben. In Lustenau war es 1821 zu einem ersten Auftritt einer Blasmusik bei der<br />
Fronleichnamsprozession gekommen.<br />
62 Andreas Ulmer und Manfred Getzner, Die Geschichte der Dompfarre St. Nikolaus in Feldkirch, Feldkirch 2000,<br />
Bd.2, S. 518. Franz wird hier als ein Sohn des Johan Georg Netzer genannt.<br />
42
Personalentscheidung nicht einig, denn Netzers Person war bislang nicht unangefochten.<br />
Die bei seinen Verwandten gepriesene ruhige Wesensart scheint dem<br />
jungen Mann nicht mitgegeben worden zu sein. Zwar hebt man seine vorbildliche<br />
Betreuung der Kirche und der neu errichteten Feldmusik hervor, bemängelt aber seinen<br />
unkonventionellen Umgang mit seiner Tätigkeit. So sprechen sich bei einer Beratung<br />
des Magistrats am 13. Juni 1831 nur drei von fünf Personen für seine Bestellung<br />
aus. Bürgermeister Jakob Beron, sein Quartiergeber, bescheinigt dem Kandidaten<br />
zwar Leichtsinn, gibt jedoch zu Protokoll, dass er ihn als keineswegs unmoralischen<br />
jungen Mann kenne, von dem sich bey seiner Jugend und seinem unverkennbar guten<br />
Herzen die gründliche Ablegung der ihm anklebenden jugendlichen Fehler mit allen<br />
Grund erwarten lasse. 63 Ähnlich argumentieren die Magistratsräte Johann Andreas<br />
Brunold und Anton Jussel, letzterer sieht sich besonders dem Wunsche der jungen<br />
Bürgerschaft verpflichtet. Franz Neyer Mutter dagegen beruft sich auf eigene Erfahrungen<br />
mit Netzer als Hausinstruktor, bei dem er keinen entsprechenden Fleiß erkennen<br />
könne und befürwortet, wie auch Jakob Lorünser einen anderen Kandidaten.<br />
Einen Gegner fand Netzer auch in dem sonst musikalisch höchst interessierten Kommunalverwalter<br />
Basil Beiser, welcher der Behörde eine Beschwerde wegen Beschimpfung<br />
übermittelt. 64 Stadtpfarrer Michael Duelli wirft Netzer am 15. Juli 1831 in einem<br />
Beschwerdeschreiben an den Magistrat vor, die Jugend zum Trunke und Nachtschwärmung<br />
zu verleiten, zu polizeiwidrigen gefährlichen nächtlichen Stunden den Musickunterricht<br />
zu erteilen, seine Choralobligenheiten nachlässig zu erfüllen und sich bei<br />
öffentlichen Anlässen unanständig zu benehmen. Er ersucht, dass diesem daher u.a.<br />
aufgetragen werde, die schulpflichtigen Knaben nicht mehr zum Tanz aufspielen zu<br />
lassen und auch die anderen beanstandeten Kritikpunkte zu unterlassen. 65 Breite<br />
Unterstützung erhält Netzer dagegen von der Bludenzer Bürgerschaft, die eine Unterschriftenliste<br />
mit über 100 Personen vorlegt und darauf verweist, dass dieser während<br />
seiner Probezeit in der Musik einen ganz unerwarteten und dankschuldigen Fortschritt<br />
machte. 66 Allen Unkenrufen zum Trotz wird Franz Netzers Bestellung beschlossen, ein<br />
Dienstvertrag verpflichtet ihn, neben seinen Kirchenaufgaben täglich Musikunterricht<br />
zu erteilen. 67 Ruhe kehrt dennoch nicht ein. Dass er nicht nur Beschimpfungen austeilte,<br />
sondern auch körperliche Angriffe einstecken musste, zeugt eine Eingabe an das<br />
Landgericht. Netzer wurde in einen Raufhandel verwickelt und dabei Opfer von Misshandlungen<br />
durch den Lehrer Gapp und Valentin Bischof, die auf Netzers Anzeige vom<br />
Gericht verurteilt werden. 68<br />
Franz Netzer wohnt im Hause des Bürgermeisters (Nr. 63), seine Tätigkeit ist bis Mitte<br />
April 1835 in den Rechnungsbüchern der Stadt nachweisbar. 69 Im Juni 1835 wird ihm<br />
ein verabschiedetes Anstellungsgesuch vom Landgericht Landeck zugestellt, was<br />
63 VLA, StABlu, Fasc. 198/42<br />
64 VLA, LG Bludenz-Sonnenberg, Einlaufprotokoll 2001 vom 5. Juli 1831.<br />
65 VLA, StABlu, Fasc. 198/42<br />
66 Ebda. Abschrift des Verzeichnisses<br />
67 VLA, StABlu, Handschrift 25, RP 1810 bis 1840, S. 262f<br />
68 VLA, LG Bludenz-Sonnenberg, Einlaufprotokoll 1832, Anzeige des Organisten dahier über erhaltene Misshandlung;<br />
Nr. 4345. 4352 vom 24. Dezember 1832.<br />
69 VLA, StABlu, Handschrift 86 bis 88, Hauptbücher 1831 bis 1836
darauf hindeutet, dass Franz Netzer Bludenz verlassen wollte. 70 Seine letzte Spur in<br />
Bludenz findet man bei Collaudierung der neuen Orgel am 27. Jänner 1836. Noch in<br />
diesem Jahr wird der Organistenposten neu ausgeschrieben. Netzer gehört nicht<br />
mehr zu den Bewerbern, die Zusage erhält Johann Pernstein aus Linz/Urfahr. 71<br />
Herkunft, wie auch der weitere Lebensweg des Bludenzer Organisten und Musiklehrers<br />
Franz Netzer waren lange ungeklärt und werfen noch viele Fragen auf. Er selbst<br />
schreibt in seiner Bewerbung für das Organistenamt lediglich, dass er 21jährig sei,<br />
verschiedene Instrumente beherrsche und auch seine Kompositionen Empfehlungen<br />
wären. Als Geburtsjahr kann demnach das Jahr 1810 angenommen werden.<br />
Eine Andeutung, dass er ein Enkel von Blasius sei, findet man in Quellen des Stadtarchivs<br />
Bludenz. Als 1831 die Stelle in Bludenz neu ausgeschrieben und Franz als<br />
Musiklehrer und Organist angestellt wird, kommt in der Diskussion zur Sprache, dass<br />
bereits sein Großvater, sein Veter [Vater?] und Oheim Bürger und Organisten zu Bludenz<br />
gewesen wären. 72 Da von Johann Georg keine Kinder bekannt sind, ist dieser als<br />
der genannte Oheim anzunehmen. Als Vater kommt daher nur einer der anderen beiden<br />
Söhne des Blasius in Frage, die höchstwahrscheinlich während ihrer Jugendjahre<br />
im Organistenamt Aushilfe geleistet haben: ein in der Schweiz lebender Johann (Blasius<br />
oder Baptist?), oder der in Zams als Schullehrer wirkende Christian (1775-1830). 73<br />
Johanns Biografie ist unbekannt, Christians dagegen ausreichend dokumentiert. Ihm<br />
und seiner Gattin Viktoria Geiger wird am 17. Jänner 1810 in Zams ein weiterer Sohn<br />
namens Franz Anton getauft. 74 Im Sterbbuch von Zams findet sich ein Hinweis auf dessen<br />
Ableben. Es wird darin vermerkt, dass am 22. September 1842 im Spitale Tourtallen<br />
[= Pourtalés] in der Stadt Neuchatel der 32jährige Franz Anton Netzer verstorben sei. 75<br />
Die Spuren in die französische Schweiz lassen sich anhand von Quellen nachweisen.<br />
In den Staatsratprotokollen von Neuchâtel/Schweiz aus dem Jahre 1842 wird Franz<br />
Sales Netzer – erstmals taucht hier ein neuer Zweitname auf - erwähnt, er ist maître<br />
de musique dans le Val-de-Travers, Musiklehrer dieser Region. 76 Am 16. Mai 1842 wurde<br />
dieser mit einer Lungenerkrankung (Pleuropneumonie chronique) in das Hopital Pourtalés<br />
eingeliefert, wenige Monate später stirbt er hier. Die Dokumente des Spitals geben<br />
allerdings als Todesdatum den 12. Oktober an. 77 Das frühe Ableben des Tiroler Musikers<br />
scheint familiär bedingt gewesen zu sein, die Lebenserwartung der Familienmitglieder<br />
war nicht besonders hoch, Großvater Basil und Vater Christian waren noch vor dem<br />
60. Lebensjahr verstorben. Auch ein Bruder Karl Christian wurde früh Opfer einer Lun-<br />
70 VLA, LG Bludenz-Sonnenberg, Einlaufprotokoll 1835, Nr.1872 vom 6. Juni 1835.<br />
71 Siehe Gerhard Vonach, Die Organisten der alten Stadtpfarrkirche zum Heiligen Laurentius in Bludenz. Diplomarbeit<br />
Innsbruck 1981, S. 78<br />
72 VLA, StABlu, Fasc. 198/42 Abschrift des Sitzungsberichtes vom 13.6.1831, siehe dazu auch StABl, Handschrift 25,<br />
RP 1810 bis 1840, S. 263 (Eintragung 28.4.1831).<br />
73 Gerhard Vonach (s. Fußnote 71) gibt in seiner Hausarbeit als Vater Johann Georg an, was bislang nicht<br />
nachgewiesen werden konnte. S. 69f.<br />
74 TLA, MF 885/4 PfA Zams, Taufbuch C 1773 bis 1863<br />
75 TLA, MF 887/5 PfA Zams, Totenbuch III, S. 187, Eintrag nach Anzeige des Landgerichts Landeck.<br />
76 VLA, Musiksammlung, BS M Netzer, Schreiben des Office des Archives de l‘Etat, Château - CH-2001 Neuchâtel<br />
vom 6. Oktober 2011 bezüglich Netzers Ableben<br />
77 VLA, Musiksammlung, BS M Netzer, Schreiben von Girardbille Olivier 6.11.2011: Kopien aus „Supplement des<br />
observations au régistre des Malades admis á L`Hopital-Pourtales […] Nr.3, Eintrag 16. Mai 1842 Nr. 168“ und<br />
„Copie de Lettres Nr.7 de l`Hopital de Pourtalés » 1839 bis 1844, S. 399<br />
44
generkrankung. 78 Näheres wissen wir über die Aufgaben von Franz Sales Netzer im<br />
damals preussischen Fürstentum – heute Schweizer Kanton Neuchâtel (Neuenburg)<br />
– noch nicht. 79 Spärlich sind seine hinterlassenen Habseligkeiten: eine Brieftasche mit<br />
25.50 F[ran]cs, Kleider, Hut, Stiefel, Spazierstock.<br />
Die Zweifel an der Identität dieses in Zams geborenen Enkels von Blasius namens<br />
Franz Anton/Franz Sales dürften somit aus dem Weg geräumt sein.<br />
Widmung der Messe in Es-Dur<br />
an den Feldkircher Musikdirektor<br />
Georg Frick (1805 bis 1891), Handschrift<br />
Stadtbibliothek Feldkirch,<br />
Musiksammlung, Bestand Domarchiv,<br />
PS II 204<br />
Der Verbleib des gesamten musikalischen Nachlasses von Franz Sales Netzer ist noch<br />
ungeklärt. In den Quellen von Neuchâtel werden keine Musikalien erwähnt. Einige<br />
seiner Kompositionen finden sich in der Stadtbibliothek Feldkirch im Bestand Domarchiv.<br />
Bemerkenswert daran ist, dass Widmungen von einer freundschaftlichen<br />
78 Rudolf Pascher, Josef Netzer (1808-1864) – Biografie, Analyse und Werksverzeichnis, Dipl.-Arb. Innsbruck 2004.<br />
79 In Neuchâtel wirkten zwischen 1835 und 1842 zwei namhafte deutsche Musiker, Ludwig Kurz und Andreas<br />
Spaeth (1790-1876), die dem städtischen Musikleben enormen Aufschwung verliehen. Vgl. dazu Edgar Refardt,<br />
Historisch-biografisches Musiker-Lexikon der Schweiz. Leipzig-Zürich 1928.
Beziehung zu dem aus Vils/Tirol stammenden Musikdirektor Georg Frick (1805- 1898)<br />
zeugen, der seit 1830 hier in Feldkirch wirkte. Frick hatte, wie der um drei Jahre jüngere<br />
Johann Josef Netzer und vermutlich auch dessen Bruder Franz, seine musikalische<br />
Ausbildung in Innsbruck erhalten.<br />
Autografe Handschrift von Franz Sales Netzer, Offertorium „Desiderium anima eius“, StBF-Musiksammlung,<br />
Bestand Domarchiv, PS II 202<br />
Nachwort<br />
Lange bevorzugte die Musikgeschichtsforschung den Umgang mit herausragenden<br />
Persönlichkeiten. Wenig dagegen war und ist von talentierten, in ihrer Zeit angesehenen<br />
Kleinmeistern zu erfahren. Ihre Bedeutung und ihr Einfluss auf die musikalische<br />
Entwicklung treten heute erfreulicherweise zunehmend in das Blickfeld der neuen<br />
Forschergeneration.<br />
Wie spannend sich gerade auf dieser Ebene Recherchen gestalten können, zeigt das<br />
Beispiel der Familie des Blasius Nezer (1728-1785), die über mehrere Generationen hinweg<br />
weit über ihr Umfeld hinaus musikalisch wirkte und deren Kompositionen sich<br />
heute noch in Archiven erhalten haben.<br />
46